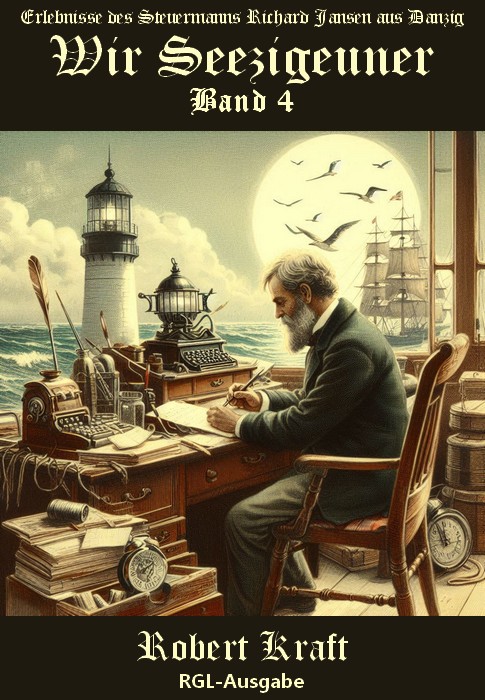
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
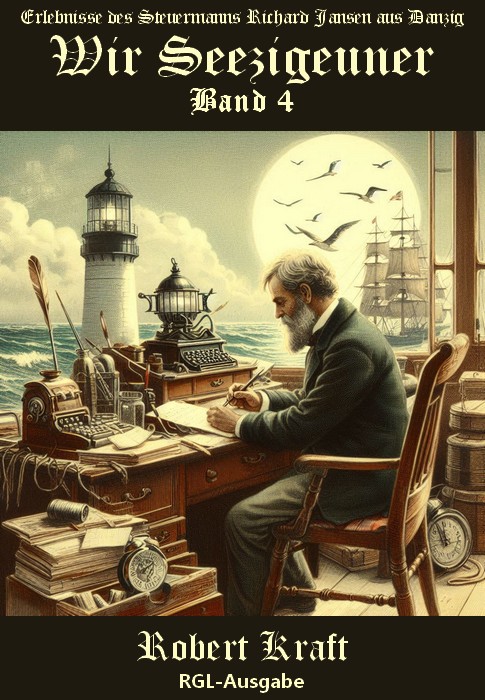
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
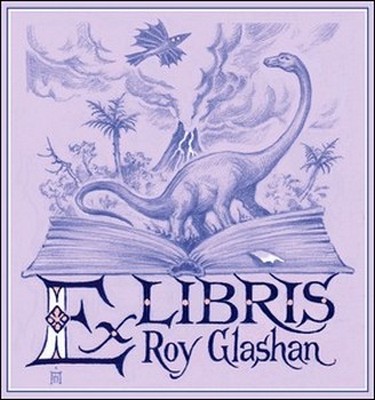
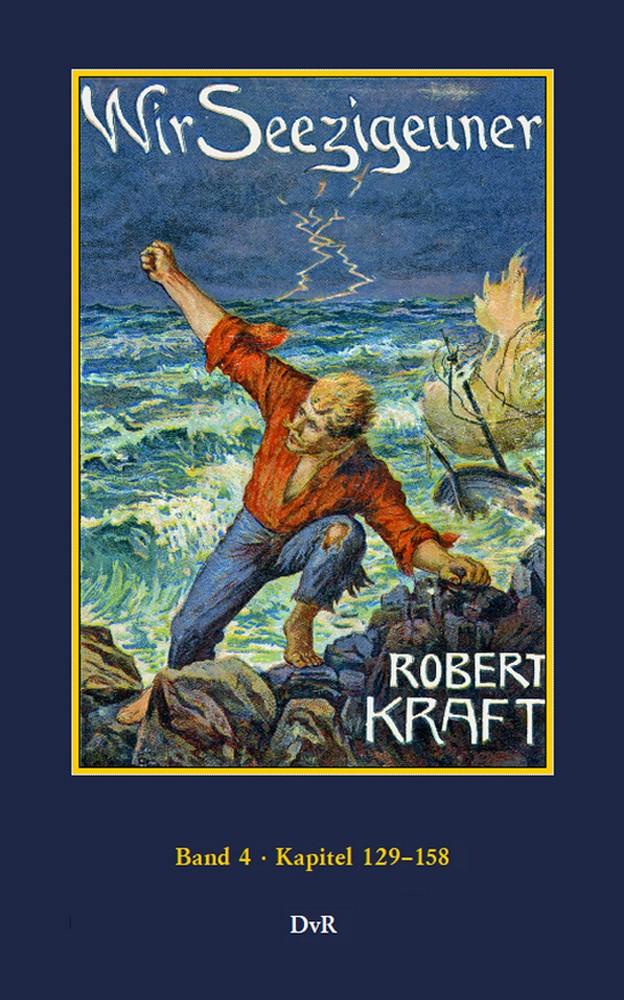
"Wir Seezigeuner," Band 4, Verlag Dieter von Reeken, 2023
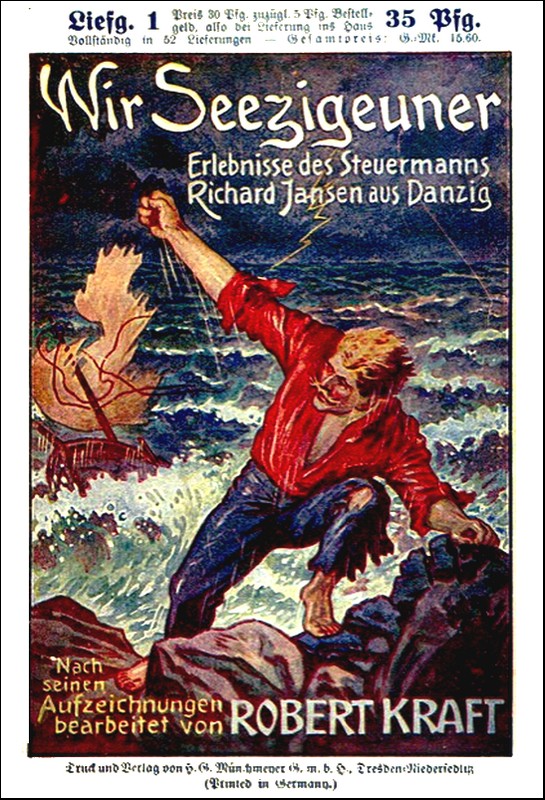
"Wir Seezigeuner," Lieferung 1.
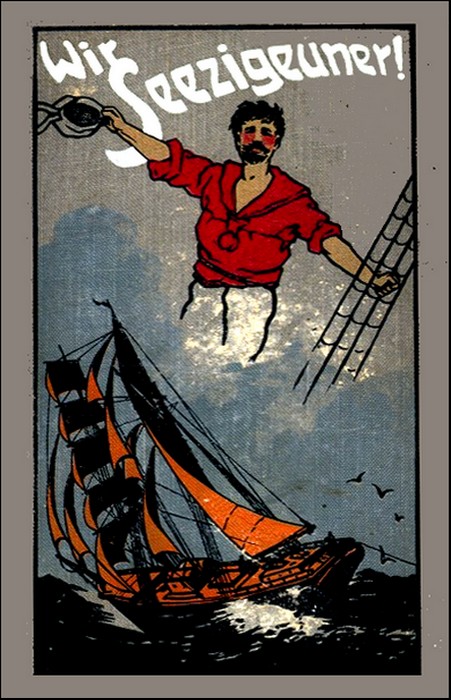
"Wir Seezigeuner," Cover der Ausgabe von 1920
Wir durchkreuzten den Indischen Ozean, steuerten durch die Sundastraße, von Java und Sumatra gebildet, ohne ein Abenteuer zu bestehen, ohne von einem englischen oder einem sonstigen Kriegsschiffe angehalten zu werden, wohl aber wiederholt mit einem solchen Grüße wechselnd und auf Verlangen irgendeinen fingierten Namen nennend. Ehe man dort in der internationalen Schiffsliste nachgeschlagen und eventuell Verdacht geschöpft hatte, waren wir schon längst außerhalb Schussweite.
An einem Nachmittage lag vor uns im Sonnenscheine Pontianak, eine Stadt von damals 18 000 Einwohnern, also ein ganz beträchtlicher Hafen, nicht nur so ein Nest, ist es doch auch die Residenz des Gouverneurs von WestBorneo.
Auch befestigt ist diese Hafenstadt, wir konnten die mit Kanonen gespickten Batterien schon von Weitem erkennen, was freilich kein besonders günstiges Zeichen ist. Heutzutage darf ein Fort gar nicht mehr als solches zu erkennen sein, in Kiel und Wilhelmshaven sieht man nichts von den massenhaften Riesengeschützen, man kann dicht neben ihnen stehen.
Lotsen boten uns ihre Dienste an, und wie immer, wenn er gebraucht wurde, stand plötzlich mein Kommodore neben mir.
»Ist nicht nötig, ich kenne die Einfahrt, kenne den ganzen Stromlauf.«
Tischkoff übernahm das Kommando, wir steuerten mit vollem Dampf in die Bucht, in den Hafen ein, wir umfuhren verankerte Schiffe, kamen in ein anderes, sehr breites Wasserbecken, welches von kleineren und größeren Fahrzeugen belebt war, wo aber wirkliche Seeschiffe fehlten — die Mündung des Pontianak, schon der Strom selbst.
Die Stadt im Allgemeinen kümmerte mich nicht, ich beobachtete nur unsere Umgebung, was für ein Aufsehen da auf den Schiffen wie an Land entstand, weil ein so großes Schiff schlank durch den Hafen fuhr.
Denn ein Schiff kann doch nicht so mir nichts dir nichts in einen Hafen steuern, etwa anlegen, wo es will, da sind Formalitäten zu beobachten, der Hafenmeister ist hier der Allgewaltige. Ein kleiner Dampfer mit der holländischen Regierungsflagge hielt seitwärts auf uns zu, kam dicht heran.
»Was für ein gottverfluchtes Luderschiff ist denn das?!«, schrie uns ein uniformierter Kerl zu.
Ich stand gerade am Heck, beugte mich über die Bordwand und deutete auf den Schiffsnamen, der unten angemalt war: ›Anna Maria, Boston‹.
Das war nur auf schwarze Leinwand gemalt, die aber so geschickt ausgehängt war, dass man die Nase dicht daran halten musste, ehe man die Maske bemerken konnte.
»Wohin wollt ihr denn?«
»Weit, weit«, winkte ich mit der Hand in unbestimmte Ferne.
»Bei Gottes Tod, dreht bei!!«
»Is nich, is nich«, winkte ich wiederum ab.
»Beigedreht, oder ich schieße!!«, brüllte der unten.
Da wir nur mit halber Kraft dampften, konnte sich das kleine Boot neben oder vielmehr hinter uns halten.
»Schießen Sie man los!«, war meine freundliche Aufmunterung. Da fiel wirklich ein Kanonenschuss — freilich nicht von dem da unten abgegeben. Ich wusste, woher er kam, lenkte meine Augen nach der Seewarte.
Dort wurden Flaggen gehisst, unsertwegen, und es mochten uns schon mehrere Signale zugegangen sein, die wir nur nicht beachtet hatten.
»›Anna Maria‹! Zum letzten Male: Beigedreht, oder ihr werdet beschossen!«
Tischkoff blickte gar nicht hin, und ich war ebenfalls sorglos. Eine Kanonenkugel, die uns nicht direkt traf, konnte anderen Schaden genug anrichten, das Wasser war ja überall belebt, der Strand auf beiden Seiten mit Hütten und Faktoreien besetzt, so weit das Auge die Flussufer überblicken konnte.
Da doch noch ein Kanonenschuss, aber wiederum ein blinder.
»Seeräuber, Seestrolche!!«, brüllte unten der Mann auf dem uns hartnäckig folgenden Dampfboot.
»Nun macht, dass ihr wegkommt, sonst fangen wir auch an zu böllern!«
»Und das nicht nur blind«, setzte Tischkoff hinzu, ebenfalls am Heck erscheinend. »Die Leinwand weg!«
Er hatte einige Matrosen mitgebracht, welche schnell das Segeltuch mit dem falschen Namen entfernten.
Ich hatte hinten noch immer den einst ehrlichen Namen meines Schiffes stehen — ›Sturmbraut‹ — nur den Heimathafen hatte ich wegmachen lassen, früher London, dann New York — wir hatten ja keine Heimat mehr — aber auf die ›Sturmbraut‹ hatte ich gehalten, mit einem gewissen Gefühle des Stolzes — immer wieder blendend weiß angepinselt, und die Matrosen hatten sich um diese Ehre gestritten. Nur für andere waren wir ehrlos.
Und nun die Wirkung dieses weißleuchtenden Namens! Ich glaube, das kleine Dampfboot hatte Augen und erschrak selber. Ohne dass ich ein Kommando gehört hätte, stoppte es plötzlich, blieb schnell zurück.
»So, nun wissen sie, mit wem sie es zu tun haben!«, sagte Tischkoff, als er sich wieder auf die Kommandobrücke begab.
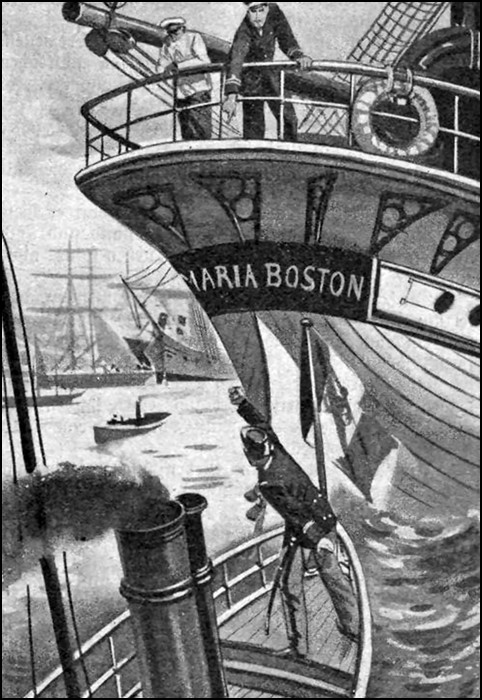
Ich konnte diese seine Handlungsweise nicht recht begreifen, aber... riesig freuen tat sie mich doch. Wäre nicht Tischkoff an Bord gewesen, zu dem ich doch in einer gewissen Abhängigkeit stand — wenn auch nur wie etwa der Sohn zum Vater — ich hätte ebenso gehandelt, vorausgesetzt, dass ich auf diesen Einfall gekommen wäre.
Denn ob nun ›Anna Maria‹ oder ›Sturmbraut‹, das war doch schließlich ganz egal. Wir hatten etwas getan, was, so einfach es im Grunde genommen auch ist, in der Weltgeschichte zu Friedenszeiten vielleicht noch gar nicht vorgekommen ist. Segeln durch einen großen, befestigten Hafen direkt in die Mündung des Flusses hinein, dem dieser Hafen seine Existenz verdankt, immer weiter ins Land hinein.
Was die jetzt wohl denken mussten! Ganz abgesehen davon, dass es die berüchtigte ›Sturmbraut‹ war.
Ich glaubte damals, dieses tolle Stückchen müsste im ganzen Seefahrtswesen eine Revolution hervorrufen. Die Bedingungen zur Hafeneinfahrt sind denn auch deshalb durch internationale Gesetze damals geändert, verschärft worden.
Nun, man konnte uns nichts anhaben. Links und rechts Häuser und Hütten, der Strom selbst hier sehr belebt, das war unser Schutz, und bald genug waren wir außer Schussweite.
Dass man uns jetzt aber nicht wieder herauslassen würde, das war selbstverständlich. Deshalb wurden wir auch gar nicht verfolgt, kein Dampfboot blieb uns auf der Spur, wenigstens war nichts davon zu erblicken. Die hielten uns eben in diesem Flusse für gefangen; dass derselbe noch einen anderen Ausgang nach dem Meere hatte, das wussten die ja nicht. Doch, da sprengten am Ufer einige Reiter, hüben wie drüben, die uns bald überholt hatten.
»Hat nichts zu sagen«, meinte Tischkoff. »Die Flussufer sind nirgends mehr armiert.«
Die Meldereiter kamen auch nicht sehr weit. Wie abgeschnitten hörten auf beiden Ufern plötzlich alle Ansiedlungen auf; ein Sumpf gebot Halt.
Wie wir beobachten konnten, wollten die abgesessenen Reiter wohl ein Boot benutzen, um uns noch zuvorzukommen, wollten die Meldung von dem Vorfall noch nach Ansiedlungen jenseits des Sumpfes tragen — ganz zwecklos, sie handelten eben nach Befehlen, die ihnen von sinnlos gewordenen Beamten gegeben worden waren.
Wir hoben alle ihre Bemühungen auf, indem wir schon vorüberrauschten, noch ehe sie ein Fahrzeug bekommen hatten.
Eine halbe Meile hinter der Stadt begann schon der Urwald. In gewaltiger Breite trug der Pontianak seine schwarzen Fluten zwischen mächtigen Bäumen hin, welche selbst noch im Wasser standen, sodass hier von einem Ufer eigentlich gar keine Rede war. Deshalb gab es hier auch noch kein Wild, auch Affen konnte man noch nicht verlangen, dagegen zeigten sich schon sehr viele Papageien, und wir wurden von einem Geschwätz in holländischer Sprache überrascht — durchgebrannte; oder nur ein besonders begabter Papagei mochte dem heimatlichen Bauer entflohen sein, er hatte seine Wörtlein die wilden Kameraden gelehrt.
Karlemann bekam gleich wieder eine Idee.
»Babegein, hm. Damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Ich werde ein paar von den Ludersch fangen, die müssen aber bei mir noch was ganz anderes lernen, die müssen große Reden halten können — ich glaube, das bringt einen guten Feng Geld ein.«
Vorläufig aber war keine Zeit, um ›Babegein‹ zu fangen.
Nicht lange, so wich der Urwald wieder einer malaiischen Ansiedlung mit holländischer Faktorei. Das bedingte der feste Boden. Denn wo solcher an den Flussufern zu finden war, war dieser hier in der dichten Nähe der Hauptstadt natürlich benutzt worden, die Bäume hatten fallen müssen.
So wechselte immer wieder Urwald mit Ansiedlungen, nur dass diese immer spärlicher kamen, oder mehrere lagen nach einer größeren Strecke dicht zusammen.
Die Nacht brach an. Am Bug ward eine große Blendlaterne mit Reflexspiegel befestigt, das war alles, was Tischkoff brauchte, um sich zurechtzufinden.
Es war eine herrliche Tropennacht. Das Wasser rauschte leise an den Bäumen, überall leuchteten Glühkäfer, manche so groß wie ein Taubenei, und nun überhaupt — dieses große Schiff, mit allem Komfort versehen, mitten im jungfräulichen Urwald — so etwas hatte ich mir auch in meinen romantischsten Jugendphantasien nicht träumen lassen Am angenehmsten wurde die Nacht dadurch, dass die schrecklichen Moskitos fehlten.
Dann konnten wir auch den Himmel nicht mehr sehen, nicht deshalb, weil die Bäume wegen Verschmälerung des Flussbettes näher zusammengerückt waren, sondern schon begannen Schlingpflanzen eine dichte Decke zu spinnen.
Doch uns konnte sie nicht hindern, wir hatten bereits vor Anbruch der Dunkelheit die Masten, die keine Takelage mehr hatten, verkürzt und dann völlig umgelegt.
Wir gingen Wache wie auf See. Als ich nach einem kurzen Schlafe wieder an Deck kam, begann schon der Morgen zu grauen. Eigentlich mochte es schon tageshell sein, aber hier im Urwald unter den Schlingpflanzen herrschte eine ewige Dämmerung.
Im Laufe dieses Tages passierten wir noch zwei Ansiedlungen, und diese Ortschaften machten, dass uns ab und zu ein Fahrzeug oder eine ganze Flottille entgegenkam. Die Eingeborenen staunten nicht schlecht unser großes Schiff an, das taten aber nicht weniger auch die spärlichen Europäer, die manchmal in den primitiven Booten saßen.
Wir machten in der Stunde sechs Seemeilen, und wenn man auf einer großen Karte die zahlreichen Krümmungen dieses Stromes genau ausmaß, so mussten wir etwa zwei und einen halben Tag gebrauchen, die Nacht also mitgerechnet, um die ganze Strecke von Pontianak bis nach jener Stelle zurückzulegen, was auch Tischkoff ebenso wie dann die Tatsache bestätigten.
Von Tischkoff sei hierbei bemerkt, dass er diese ganze Zeit unentwegt am Steuerrad stand und auch noch zwei weitere Tage und Nächte stehen sollte, ohne ein Auge zugetan zu haben.
Die schlauesten von den Matrosen meinten, das sei nur so zu erklären, weil er sich vorher wieder einmal ein paar Tage ausgeschlafen habe, und ich widersprach ihnen nicht.
Am Morgen des vierten Tages — d. h. unserer Fahrt, wir waren erst zwei und einen halben Tag unterwegs — zeigte der Fluss vor uns eine ganz andere Beschaffenheit.
An Mündungen von Nebenflüssen waren wir schon wiederholt vorbeigekommen. Irrefahren konnte man da nicht, denn einmal stießen diese Seitenarme fast rechtwinklig ein, dann war ihr Wasserlauf immer bedeutend schmäler als der Hauptstrom.
Hier aber zeigte sich eine ganze Masse von abzweigenden Kanälen, oder man hätte auch sagen können, dass sich der Strom plötzlich ungeheuer verbreiterte und überall mit Inselchen durchsetzt war, und zwar nicht nur mit im Wasser stehenden Baumgruppen, sondern es war wirklich festes Land, wie überhaupt die Sumpfregion schon längst aufgehört hatte, ohne dass deshalb die Ansiedlungen häufiger geworden wären. Überall hätte man durch Fällen des Waldes anbauwürdiges Land gehabt, doch hier sah man eben, wie wenig noch auf Borneo kultiviert ist, selbst noch in der Nähe der größten Stadt.
Wo der Hauptstrom floss, konnte man allerdings noch unterscheiden. Die zahllosen Kanäle zweigten sich alle linkerhand ab, aber die meisten noch immer breit genug, um die ›Sturmbraut‹ einzulassen, und Tischkoff steuerte denn auch in einen solchen hinein.
»Würden Sie diesen Weg noch einmal allein finden?«, wandte sich Tischkoff an mich.
Ich bejahte.
»Nein, das würden Sie nicht können.«
»Weshalb nicht? Diesen Kanal würde ich schon wiedererkennen.«
»Aber dann werden wir uns gleich in einem Labyrinth befinden.«
»Ich meine auch nur den Weg, den wir bisher zurückgelegt haben.«
»Auch auf diesem würden Sie Ihr Schiff nicht zurückbugsieren können. Sie glauben gar nicht, wie viele Sand- und Schlammbänke ich schon umsteuert habe.«
Das hatte ich ebenfalls nicht gemeint, nur den allgemeinen Weg, etwa in einem Boot. Wie schwierig das Fahrwasser war, das hatten wir ja erkannt, als Tischkoff das Schiff auch auf dem breitesten Wasser fortwährend hin und her gesteuert hatte, manchmal ganz dicht bis ans Ufer heran.
Woher kannte mein Kommodore diesen tagelangen Stromweg so außerordentlich genau? Ich erfuhr es nicht.
Dass er all diese Hindernisse bei einer einzigen Reise niemandem beibringen konnte, war begreiflich, und so hatte er auch niemals den Lehrmeister gespielt.
Wenn aber nun meinem Kommodore ein Unfall zustieß, was dann?
Da konnte ich nur auf die Richtigkeit seiner Worte bauen, die er einst zu mir gesprochen: ihm könne der Tod nichts anhaben. Inwiefern nicht, darüber zerbrach ich mir in meiner Weise nicht den Kopf.
Noch etwas tiefer drangen wir ein, jetzt sahen wir, dass das wirklich ein unentwirrbares Wasserlabyrinth sei; da ließ Tischkoff stoppen.
Während die ›Sturmbraut‹ langsam nach einem Inselchen trieb, bis sie in den Ästen eines Baumes hängen blieb, musste ich alle Mann an Deck zusammenrufen.
Hierbei will ich einmal bemerken, dass sich auch die fünf Sportsmen an Bord befanden. Die hatte Tischkoff ebenfalls mit nach der Fucusinsel genommen, wir machten doch jetzt gemeinschaftliche Sache, sie hatten mich auch begleitet.
Ich hatte das so selbstverständlich gefunden, dass ich bisher noch gar nichts davon erwähnt, wie ich ja überhaupt die ganze Reise übergangen habe. Jedenfalls hatte ich so immer angenehme Gesellschaft gehabt.
Da ich nun einmal dabei bin, Versäumtes nachzuholen, sei hier auch einmal bemerkt, dass schon meine ganze Kajüte und noch andere Kabinen voll Ölbilder hingen, die verschiedensten Sujets behandelnd, Seestücke, Szenen vom Leben an Land und an Bord unseres Schiffes, gemalt von Mijnheer van Zyl, der noch genau derselbe Dreckbarthel war, aber fleißig malte, immer die Pfeife zwischen den Zähnen, dem es am liebsten war, wenn er nicht angesprochen wurde, dann auch nur mit einem Knurren antwortend.
Auch er hatte mich selbstverständlich begleitet, malte jetzt an einer Dschungellandschaft, und Monsieur Chevalier, der am meisten davon verstand, behauptete, dass jedes dieser Gemälde auf jeder Ausstellung den Ehrenplatz verdiene.
So waren wir alle versammelt. Tischkoff sprach davon, dass wir jetzt in ein Gebiet kämen, in dem Dajaks hausten, welche mit vergifteten Pfeilen schössen, auch uns sicherlich beschießen würden.
Deshalb solle sich womöglich niemand an Deck sehen lassen. Sehen lassen! Es sollten sich wohl immer welche oben befinden, die besten Schützen, aber möglichst unsichtbar. Das sei meine, des Kapitäns Sache.
Das eigentlich sofort tödliche Pfeilgift könne unschädlich gemacht werden. Tischkoff verteilte Papierchen, die ein Pulver enthielten. Bei der leisesten Verwundung sollte dieses Pülverchen verschluckt, dann die Wunde sofort ausgebrannt werden. Das könne eventuell jeder selbst machen, etwa mit der brennenden Zigarre, sonst gleich hinunter zu Goliath, der sich immer zu diesem Liebesdienst bereithalten würde.
Meine Leute hörten nichts Neues. Ich hatte davon schon zu den Offizieren gesprochen, diese hatten es weitergegeben.
Ja, ich hatte die Jungen sogar in Verdacht, dass sie sich über diese Wundenausbrennerei freuten, sie hofften, ich würde Zigarren verteilen, sie könnten immer rauchen, was sonst während der Wache nicht etwa erlaubt ist — ich hatte schon so etwas gehört, und ich wollte ihre seligen Hoffnungen auch nicht zuschanden machen.
Und wem vielleicht doch das Herz etwas schneller schlug, weswegen er ja noch lange keine Memme zu sein brauchte — na, der durfte von dieser allgemeinen Stimmung doch keine Ausnahme machen.
Während wir hier noch still lagen, wurde um die Kommandobrücke und besonders um die Stelle, wo sich Steuerrad und Bussole befanden, eine Bretterwand gezogen, hoch genug, dass die Dahinterstehenden auch nicht vom höchsten Baume aus erblickt werden konnten. Für die anderen genügten vorn und hinten die Kistenaufbaue, durch welche wir das Aussehen der ›Sturmbraut‹ verändert hatten. Hier drin sollte sich die Wache immer aufhalten. Arbeit an Deck würde es ja gar nicht geben. Nur wurden überall noch Schießscharten angebracht, und ich gab entsprechende Instruktionen, wann loszuknallen war, falls sich ein verdächtiger Mensch zeigte.
Dann ging es weiter, die ›Sturmbraut‹ mit viertel, meine Jungen mit vollem Dampf. Ich hatte einige tausend Stück Zigarren an Bord.
Nichts zeigte sich. Wenn es einmal in den Büschen knackte, so war es ein fliehendes Wild gewesen.
Tischkoff sagte, dass wir den ersten See noch am Abend erreichen würden. Über seine früheren Erlebnisse sprach er nicht, auch nicht, was er sonst eigentlich beabsichtigte.
Immer mehr merkte ich die Schwierigkeiten des Weges. Oftmals lag vor uns ein ganz breiter Wasserstreifen, Tischkoff aber steuerte in den allerschmälsten hinein, immer wieder in einen anderen, wir beschrieben förmliche Halbkreise. Gerade in dem breitesten Kanal war auch ein ganz flaches Boot auf dem Grunde sitzen geblieben, sehr viele Kanäle sollten blind enden.
Dabei steuerte Tischkoff nach keiner Karte, sondern frei aus dem Kopfe. Wenn er sich das erstemal nach einem Plane gerichtet, konnte es denn solch ein phänomenales Erinnerungsvermögen geben?
Zu Mittag wurde nach der Ablösung des Mannes am Ruder gepfiffen.
Der Matrose Konrad, der daran war, kam unter der Back hervor, eilte schnellen Laufes über Deck, auf die Treppe zu.
Noch ehe er diese erreicht hatte, sah ich etwas durch die Luft gesaust kommen, in demselben Augenblick brach der Matrose zusammen, nach dem Halse greifend, aus dem der Schaft eines Pfeiles hervorsah.
Ich brauchte nicht die Kommandobrücke zu verlassen, von hinten und vorn kamen Matrosen hervorgestürzt, um ihren Kameraden zu bergen.
Da zischte und pfiff es in der Luft — die wackeren Retter wurden mit einem ganzen Hagel von Pfeilen überschüttet.
Den Erfolg sah ich nicht, schlimm konnte es nicht sein, sie alle gewannen wieder die sichere Deckung, Konrad mitnehmend, und schon knatterte es auch aus den Schießscharten; die Zurückbleibenden waren nicht minder brav gewesen, sie hatten die Umgegend nicht aus den Augen gelassen, und jetzt sah ich selber an den Ufern, hüben wie drüben auf Ästen menschliche Gestalten hocken.
Auch mein Gewehr sprach, ich schoss einige dunkle Gestalten wie Früchte herab. Zwei oder drei stürzten ins Wasser, doch Tischkoff ließ nicht stoppen, und den einen Schwimmer sah ich im Rachen eines Krokodils verschwinden.
»Folgen uns die denn wie die Affen auf den Bäumen nach?«
»Nein, das können sie nicht, das war nur ein Vorposten, und wir haben es unglücklich getroffen, dass gerade bei einem solchen der Wechsel stattfinden musste.«
Meine größte Sorge war jetzt natürlich, was die Pfeile angerichtet hatten.
Da sprang abermals ein Matrose über Deck und die Treppe zur Kommandobrücke herauf.
Es war gut abgelaufen. Konrad hatte als erster die schlimmste Wunde erhalten, der Pfeil war ihm in den Hals gedrungen, aber ohne Speise- oder Luftröhre und Schlagader zu verletzen. Goliath hatte die Wunde ausgebrannt und verbunden, jetzt saß Konrad schon beim Essen.
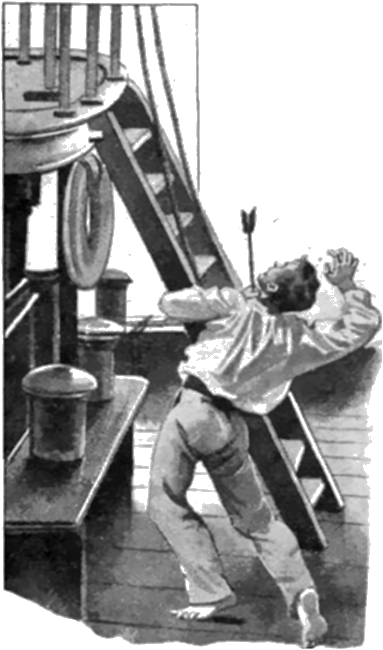
Die übrigen Verletzungen waren noch geringfügiger gewesen. Die Pfeile wurden mit so wenig Kraft abgeschossen, dass sie kaum einen festen Kleiderstoff durchdrangen.
Das ist es ja eben: das wilde Volk, welches seine Waffen vergiftet, den Dolch, den Pfeil, weiß diese Waffe auch nie recht zuhandhaben. Das ist der Fluch der Feigheit. Vergiften sie die Pfeile, weil sie eben nicht schießen können, ihr Bogen keine Kraft hat, oder haben sie infolge dieses hinterlistigen Vergiftens, da ja die kleinste Wunde genügt, um ein Tier, einen Menschen zu töten, das Anfertigen von kraftvollen Waffen und das sichere Schießen verlernt?
Eines wird wohl vom anderen abhängen. Jedenfalls wird ein echter Jäger oder Krieger, wie der nordamerikanische Indianer, solch eine hinterlistige Waffe stets verachten. Dafür aber durchbohrt er mit seinem Pfeil auch einen Schild von Büffelhaut, welcher, richtig gehalten, selbst einer Büchsenkugel spottet.
Auch dieser Matrose hatte einen Pfeilschuss in den Arm erhalten. Er zeigte mir die Wunde, welche nur deshalb böse aussah, weil sie ausgebrannt war, wahrscheinlich viel intensiver, als nötig gewesen.
»Nun, wie tat das?«
»Was denn?«
»Das Ausbrennen.«
»Wenn's weiter nix ist«, war die mit verstecktem Stolz gegebene Antwort. »Bei uns zu Hause werden die Schweine doch auch gebrannt.«
»Aber die werden wohl tüchtig dabei jauchzen.«
»Wir nicht.«
»Wie fühlst du dich denn sonst?«
»Wie soll ich mich denn fühlen?«
Er konnte eben sofort seinen Dienst antreten. Tischkoffs geheimnisvolles Pulver hatte seine Pflicht getan, bei diesem wie bei allen anderen.
Wir wurden nicht mehr beschossen, nicht anderswie belästigt. Es war gegen Abend, als der Wald plötzlich aufhörte — vor uns lag der unübersehbare Spiegel eines Sees, in diesem hin und wieder ein bewaldetes Inselchen, auch sonst alles umsäumt von gigantischen Bäumen — eine herrliche Landschaft, die bald vom vollem Lichte des Mondes übergossen ward.
Wir fuhren noch tiefer ein, bis auf Tischkoffs Befehl die Anker ausgeworfen wurden, außer Büchsenschussweite von jeder Insel.
Dann zog sich Tischkoff in seine Kabine zurück, er wollte schlafen, und bis auf die Wache pflegten alle der Ruhe, die wir reichlich verdient hatten. Denn in Erwartung dessen, was uns bevorstand, hatte während der ganzen Fahrt niemand einen ordentlichen Schlaf in der Koje gehalten.
Am anderen Morgen zeigte uns die Sonne dasselbe liebliche Bild des inselreichen Sees im Urwalde. Sonst war nichts zu sehen, was unsere Aufmerksamkeit gefesselt hätte.
Da, als Tischkoff eben das Kommando zum Ankerhieven gab, kam hinter einer Insel ein Boot hervor, direkt auf uns zuhaltend.
Es wurde von sechs dunkelhäutigen, fast nackten Gestalten gerudert, die siebente war in ein weißes Gewand gehüllt — es war ein alter, weißbärtiger Mann, schon von weitem in seinen Gesichtszügen den Kaukasier, den Europäer, den Germanen verratend.
Ohne jede Vorsichtsmaßregel war das Boot herangekommen, legte neben uns bei. Wir hatten die Kommandobrücke verlassen, Tischkoff bat mich, ihn den Sprecher machen zu lassen, er würde sich zunächst des Englischen bedienen, sonst des Holländischen, das ja auch ich verstände.
»Was wollt ihr?«, rief er hinab.
»Das habe ich Sie zu fragen, was Sie hier wollen«, entgegnete der Alte in tadellosem Englisch.
Oho! Aber diese Antwort war eigentlich nicht in anmaßendem, eher in würdevollem Tone gegeben worden.
»Wünschen Sie an Deck zu kommen?«, fragte jetzt Tischoff sehr höflich.
»Ich bitte darum«, erklang es ebenso zurück.
Das Fallreep ward hinabgelassen. Der Alte stieg mit ziemlicher Rüstigkeit herauf.
Zunächst ruhten seine Augen lange auf Tischkoff.
»Der Mann, der schon einmal in unser Reich dringen wollte — ich dachte es mir fast«, sagte der Alte dann.
»Ich kenne Sie nicht, habe Sie damals nicht gesehen«, erwiderte Tischkoff.
»Aber ich Sie.«
»Damals wurde ich durch einen anderen, durch einen Malaien gewarnt, weiter vorzudringen, und das recht spät, denn da hatte man mir schon die Hälfte meiner Leute weggeschossen.«
»Jetzt bin ich es, der Sie warnt.«
»Wer sind Sie, oder wie darf ich Sie nennen?«
»Ich bin... man nennt mich den Alten vom See.«
»Ein schlechter Titel zur Anrede. Wovor warnen Sie mich?«
»Weiter in unser Reich zu dringen.«
»Sie merken wohl, dass ich diesmal schon ganz bedeutend weiter vorgedrungen bin, als damals in dem offenen Boote.«
»Aber noch kein Mensch hat dieses unser Reich lebendig wieder verlassen.«
»Ich bezweifle überhaupt, dass ein Fremder schon so weit vorgedrungen ist.«
»Kehren Sie um!«
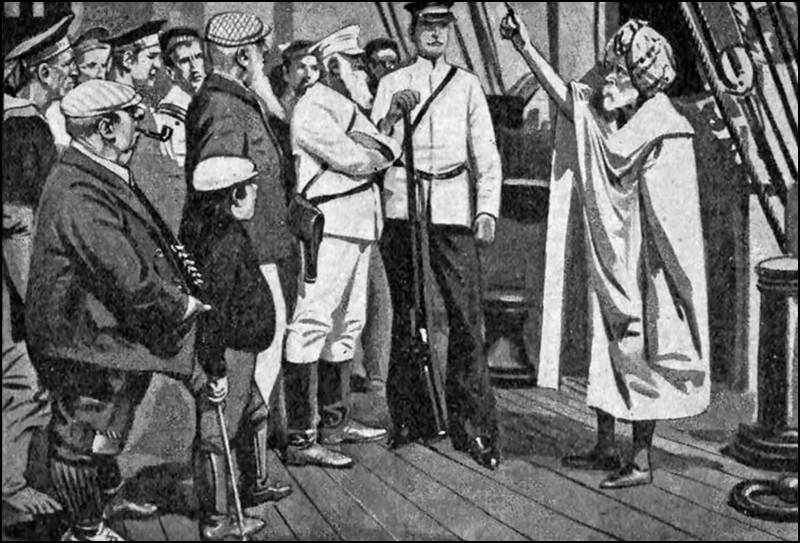
»Nein, sondern ich bitte, so wie damals, die Bauten der alten Malusos besuchen und studieren zu dürfen.«
»Kehren Sie um!!«, erklang es nochmals in eindringlichstem Tone.
»Ich kehre nicht um!«
»Das ist Ihr und aller Ihrer Leute Tod.«
»Das bezweifle ich.«
»Haben Sie nicht schon Tote genug in Ihrem Schiff?«
»Woher wissen Sie das?«
»Weil Sie unbedingt von unseren Wächtern beschossen worden sind.«
»Wir können uns doch verborgen gehalten haben.«
»Es sind genug Leute von Ihnen getroffen worden.«
»Woher ist das Ihnen schon bekannt?«
»Ich weiß es.«
»Nun gut. Ja, viele sind von vergifteten Pfeilen verwundet worden, aber ich habe dennoch keine Tote an Bord.«
»So haben Sie diese eben schon ins Wasser versenkt.«
»Mitnichten. Ich habe Sejara.«
So ungefähr klang das Wort, welches Tischkoff aussprach, und welches auf den Alten einen solch kolossalen Eindruck machte. Mit verfärbtem Gesicht prallte er zurück.
»Sie haben... ?«
»Sejara. Ja, diese vergifteten Pfeile können uns jetzt nichts mehr anhaben, ich habe das Gegenmittel dazu.«
»Woher... ?«, stieß der Alte noch immer schreckerfüllt hervor.
»Das ist diesmal mein Geheimnis.«
Der Alte hatte sich schnell wieder gefasst, warnend hob er den Finger.
»Und wenn dem auch so ist — kehren Sie um, kehren Sie um!! — Dies ist das Reich des Todes, aus dem kein Sterblicher den Rückweg findet — wir haben noch ganz andere Mittel, als vergiftete Pfeile, wir werden Sie und Ihr ganzes Schiff vernichten!«
»Ich bin neugierig, diese Mittel kennen zu lernen.«
»Ein Wort meines Gebieters genügt.«
»Wer ist dieser Gebieter?«
»Sie werden ihn zu Ihrem Schrecken kennen lernen.«
»So mag er zunächst jenes Wort aussprechen. Ich aber glaube nicht an Zauberworte, und gegen irdische Waffen und Mittel, mit denen man uns schaden könnte, bin ich gewappnet.«
»Unglücklicher, kehren Sie um!!!«
»Nein! Ich werde meinen Willen mit Gewalt durchsetzen — ich werde diese alten Bauten besichtigen, und niemand soll mich daran hindern.«
Der Alte blickte den Sprecher an, hob leicht die Schultern und wandte sich zum Gehen.
»Halt!«
Tischkoff vertrat ihm den Weg.
»Was wollen Sie noch?«
»Ich habe Lust, Sie als Geisel festzuhalten. Sie sind durch nichts als Abgesandter oder Parlamentär geschützt und geben sich mir direkt als Feind zu erkennen.«
»So tun Sie es. Mein Gebieter hat mir befohlen, mich zu Ihnen zu begeben, um Sie zu warnen, und ich habe gehorcht. Tun Sie es, legen Sie mich in Ketten, töten Sie mich, martern Sie mich!«
»Nein! Ich werde Sie freiwillig als unverletzlichen Parlamentär behandeln. Aber verschonen Sie mich fernerhin mit Ihren Drohungen, sie haben bei mir keinen Zweck.«
»Und doch spreche ich die Wahrheit: Sie und Ihre Leute gehen in den Tod.«
»Das wird sich finden. Jetzt aber werde auch ich einmal drohen. Wer ist Ihr Gebieter?«
»Der Herr der heiligen Seen.«
»So sagen Sie ihm, dass ich, wenn er mir nicht die Erlaubnis dazu gibt, dennoch die alten Bauten der Malusos besichtigen werde, und für jeden Mann, der hier durch seine Schuld den Tod findet, werde ich blutige Sühne fordern, und wird er mir zu lästig, so werde ich seine Residenz in Trümmer schießen. Verstanden?«
»Seine Residenz?«, fragte der Alte mit offenbarem Stutzen.
»Ja, die heilige Stadt der Malusos, welche auf der Elefanteninsel liegt.«
Wieder erschrak der Alte furchtbar.
»Woher wissen Sie...«
»Ich weiß noch viel mehr. Sagen Sie aber auch Ihrem Gebieter, dass er, wenn er mich in Ruhe lässt, in mir keinen Verräter zu fürchten hat. Sechs Jahre lang habe ich dieses euer Geheimnis still in meiner Brust verwahrt, ich werde es fernerhin hüten, nur meinen eigenen Wissensdurst will ich löschen.«
»Und Ihre Leute?«, wurde der Alte jetzt doch kleinlauter und nachgiebiger.
»Sind ebenfalls verschwiegen wie das Grab.«
»Ich werde es meinem Gebieter berichten.«
Diesmal wurde der Alte nicht mehr zurückgehalten, er bestieg sein Boot, dieses verschwand wieder hinter der Insel.
Noch immer wusste ich nicht, um was es sich eigentlich handelte — nun ja, eben um die Baulichkeiten eines ausgestorbenen Volkes, das seine eigene Religion gehabt hatte, die jetzt noch an versteckten Orten heimlich gepflegt wurde — aber für Tischkoff selbst musste dies alles schon eine Vorgeschichte haben, die ich jedoch nie erfahren sollte.
Übrigens war das auch gar nicht nötig, es war schon genug, was ich selbst hier noch erlebte.
Wir dampften weiter, richteten auch wieder die Masten auf, nutzten die aufkommende Brise mit Segeln aus, und es war nicht anders, als wenn wir uns auf dem Meere befänden, etwa im Ägäischen Archipel, wo in gewissen Gebieten die Inselchen nicht minder zahlreich sind.
Nur diesen hatten wir auszuweichen, sonst war der See für unser Schiff überall tief genug. Das Wasser war klar wie Kristall, jeden der zahlreichen Fische konnte man noch auf dem weißsandigen Grunde erkennen, die Tiefe betrug mindestens zehn Meter.
»Das ist unser erstes Ziel«, sagte Tischkoff, auf eine vor uns liegende, größere Insel deutend.
»Wie weit können wir heran?«
»Das weiß ich nicht, das müssen wir erst untersuchen.«
So ganz allwissend war mein Kommodore also doch nicht, und auch seine Kenntnisse über diese Gegend hatten ihre Grenzen.
Die Maschine begann wieder zu arbeiten, wir näherten uns vorsichtig der bewaldeten Insel. Ein Loten war nicht nötig, man konnte auch hier bis dicht an die Insel den Grund erkennen, und wir durften so weit herankommen, bis wir das Schiff mit Seilen an Bäumen befestigten. Dann genügte ein kurzes Laufbrett, um an Land zu gelangen.
»Es ist keine weitere Vorsicht beim Betreten der Insel nötig«, sagte Tischkoff vorher, wieder zeigend, dass er doch schon etwas in die hiesigen Verhältnisse eingeweiht war. »Sie ist unbewohnt, ganz verwildert, und sie verteidigen zu lassen, hat man gar keine Zeit gehabt, wir sind zu plötzlich gekommen. Aber wir wollen doch zeigen, dass wir auch Kanonen führen. Lassen Sie doch einmal beide Breitseiten abfeuern.«
Ich gab dazu die Kommandos; sechzehn Kanonen waren es, die mit Kartuschen geladen und gleichzeitig durch die offenen Stückpforten abgefeuert wurden.
Es gab einen mächtigen Spektakel, das Echo grollte lange nach, selbst das ferne Gebirge gab es noch wieder.
Kreischend flohen Papageien und andere Vögel davon, die vielen Affen dagegen, die wir in den Zweigen bemerkt und die uns ohne Scheu schnatternd begrüßt hatten, waren dessen nicht fähig, wie gelähmt blieben sie hocken, viele purzelten auch von den Bäumen herab und blieben eine Zeitlang wie die geprellten Frösche liegen, bis die allgemeine Flucht begann.
Dann fanden wir aber doch einige, welche der furchtbare Schreck wirklich getötet hatte.
»Und den hier hausenden Eingeborenen wird es nicht anders gehen«, sagte Tischkoff, »wir haben nichts von ihnen zu fürchten.«
Aber so ganz sorglos war er doch nicht. Wozu forderte er sonst zur Begleitung die ganze Freiwache, und wenn er die Leute zu einer Arbeit gebrauchte, wozu mussten sich diese dann außer mit Messern und Äxten auch mit Gewehren und Revolvern bewaffnen?
Nun, wir waren eben immerhin in Feindesland.
Also es waren dreiundzwanzig Mann, die Hälfte aller meiner Leute, soweit Arbeitshände in Betracht kommen, welche sich der Expedition in der vorgeschriebenen Ausrüstung anschlossen, wozu dann noch außer meiner Person der zweite Steuermann und Maschinist, Lord Seymour, Fairfax, Brown und Chevalier kamen. Nur Mr. Rug blieb zurück, der hatte schon wieder einmal einen Rausch auszuschlafen.
Die mitgenommenen Äxte und Messer waren sehr nötig. Wir mussten uns jeden Schritt durch Buschwerk und Schlingpflanzen hauen, und das schneidende Messer reichte wahrhaftig manchmal nicht aus, es gehörten wuchtige Axthiebe dazu.
Nein, so ganz allwissend war Tischkoff doch nicht. Er kannte nicht die Lage der gesuchten Bauwerke, er wusste nur bestimmt, dass sich solche auf dieser Insel befanden, vermutete sie in der Mitte liegend, aber sonst konnte er nicht einmal die Richtung angeben, und wie sich später zeigte, hatten wir manchen Weg unnötig gehauen, obgleich wir dicht an einem Bauwerk vorbeigekommen waren.
Man muss sich nur die Üppigkeit solch einer tropischen Vegetation vorstellen können, um das begreiflich zu finden — und was mich anbetrifft, so freute es mich förmlich, es diente zu meiner Erleichterung, dass sich mein Kommodore einmal als ›auch nur ein Mensch‹ erwies.
Da fanden Axt und Messer in den Schlingpflanzen einen Widerstand, den sie nicht besiegen konnten, und nach Beseitigung einer dicken, grünen Schicht zeigte sich ein Stück Mauerwerk. Nur auf diese Weise hatten wir zufällig eine Wand gefunden.
Jetzt begann die eigentliche Arbeit, das Bloßlegen der Mauer. Von dem ganzen Gebäude, dem sie angehörte, konnten wir uns absolut noch keine Vorstellung machen; alles Schlingpflanzen und Buschwerk und Bäume, von denen wohl noch so mancher gefällt werden musste, wollte man das ganze Gebäude wirklich freilegen.
Eine Stunde hatten wir vielen Menschen zu tun, ehe wir nur einige Quadratmeter der verfilzten Schicht aus Schlingpflanzen entfernt hatten, dann aber zeigten sich mächtige Quadersteine — die man vorläufig freilich auch noch für Steinplatten halten konnte — und diese waren frei von Moos und Gras und allen anderen Schmarotzerpflanzen, die Schlingpflanzen hatten nichts anderes neben sich aufkommen lassen.
Die Steine waren über und über mit keilschriftartigen Hieroglyphen bedeckt, eingemeißelt, und ich entsann mich, ganz ähnliche Buchstaben gesehen zu haben, als ich einmal einen Blick in Tischkoffs dicke Schweinslederfolianten geworfen hatte.
Außerdem aber zeigten sich die verschiedensten Figuren, Menschen wie Tiere, in jenem steifen Stile eingemeißelt, den man auch bei den alten Ägyptern findet, und doch wieder anders, was ich hier nicht näher beschreiben kann. Erwähnt mag nur noch werden, dass hier z. B. bei den Männern der charakteristische Flechtbart fehlte. Was hatten denn aber die alten Bewohner der Sundainseln mit den Ägyptern zu tun?
Doch auch hier stellten die einzelnen Szenen meistenteils dar, wie Männer und Frauen den verschiedenen Beschäftigungen nachgingen, zu Hause, auf dem Felde, bei der Jagd.
Unter den Tieren spielte die wichtigste Rolle der Elefant, er war überall dabei, mir schien aber, dass er nicht als Arbeitstier gebraucht wurde, er sah immer nur zu, z. B. wie Ochsen den Pflug zogen, überall wurde er nur gefüttert, und bei einigen Szenen war ganz deutlich ersichtlich, dass er auch angebetet wurde.
»Haben die Malusos den Elefanten göttlich verehrt?«, fragte ich Tischkoff, der schon in ein Buch abzuzeichnen begann.
»Ja, aber nur die Malusos.«
»Die Malusos waren über die sämtlichen Sundainseln verbreitet?«
»Nein, sie herrschten nur auf Borneo und Celebes.«
»Nicht wahr, auf Celebes gibt es doch ebenfalls keine Elefanten?«
»Nein, nur auf Java und Sumatra.«
»Wie kommt das nur eigentlich? Diese Inseln ähneln sich doch sonst in Klima und Vegetation und in allem ganz und gar.«
»Wissen Sie, dass es in Irland keine Frösche gibt?«
»Das weiß ich.«
»Wie erklären Sie sich das?«
Ich wusste keine Antwort.
In England und Schottland kommen Frösche massenhaft vor, in Irland existiert kein einziger. Und Vegetation und Klima dieser ›grünen Insel‹, sollte man meinen, müssten dem Frosche doch gerade sehr günstig sein. Man hat Frösche eingeführt, nicht nur Gelehrte zur Konstatierung dieser Tatsache, Kröten besonders wegen ihres Nutzens im Garten, sie bleiben auch am Leben, im Glase, im Garten, auf Wiesen, sie werden dick und fett, erreichen ein hohes Alter, aber... sie schreiten in Irland nicht zur Fortpflanzung. Wer löst dieses Rätsel? Bisher hat es noch kein Mensch gekonnt.
»Ob früher hier Elefanten gewesen sind, weil sie bei den Malusos eine so große Rolle gespielt haben?«
»Schwerlich, und eben aus dieser Verehrung kann man dies schließen. Möglich, dass ab und zu ein Elefant über die Meerenge von Insel zu Insel geschwommen ist, der dann wie eine Gottheit empfangen wurde. Auch in dem eigentlichen Indien gibt es ja heilige Elefanten, es brauchen gar keine weißen zu sein.«
Eine andere Bilderreihe wurde bloßgelegt, welche offenbar Gerichtsverhandlungen vorführte und dann, wie der Verurteilte bestraft wurde: mit dem Schwerte geköpft, aufgehangen, verbrannt — aber auch andere Strafen, wie Bastonade und dergleichen; die Malusos schienen da recht niedliche Strafen gehabt zu haben, der eine hing an einem Baume, es war ganz deutlich zu erkennen, dass ihm der Strick unter den Armen durchgezogen war, aber man hatte seine Füße mit mächtigen Steinen beschwert — und dann andere Situationen, die ich mir nicht erklären konnte, danach auch kein Verlangen trug.
So z. B. lag da einer auf einer Art von Bett, die Beine festgebunden, und zu seinen Füßen stand ein Ochse, der sehr angelegentlich die Fußsohlen dieses Mannes betrachtete, während wie gewöhnlich ein Elefant zuguckte. Da sich dieses Bild mitten unter lauter Szenen befand, welche ausschließlich Strafen darstellten, so musste wohl auch das eine sein, aber was für eine, das wussten die Götter — vielleicht auch mein Kommodore.
Ein anderes Bild fesselte meine Aufmerksamkeit.
Da sah man ganz deutlich, wie auf einem Altar ein Mensch geschlachtet, geopfert wurde, und zwar wiederum zu Ehren eines mit einem Heiligenschein umgebenen Elefanten, und nicht nur das, sondern auf einem zweiten Bilde war ersichtlich, wie ein Mensch regelrecht zerwirkt und die einzelnen Stücke von anderen verspeist wurden. Ein durch Tracht und Haarfrisur ausgezeichneter Kerl, ein Häuptling oder gar ein König, wenn nicht ein Hoherpriester, hatte ein Herz in der Hand, so wie auch wir und besonders Liebende es immer darstellen, und biss eben mit Wohlbehagen hinein. Es fehlte nur noch der Pfefferkuchenspruch darauf.
»Waren denn die Malusos Menschenfresser?«, wandte ich mich an Tischkoff.
»Nein.«
»Aber hier wird doch ein Mensch geopfert und aufgefressen.«
»Das stimmt schon, aber eigentliche Menschenfresser waren sie doch nicht. Das Verzehren des menschlichen Opfers war eine vorschriftsmäßige Handlung der Frömmigkeit, geradeso wie bei den Azteken. Bei diesen wurden die gefangenen Feinde zu Ehren des Sonnengottes geopfert, dann mussten die Teilnehmer von dem Fleische essen, aus Gehorsam gegen die Religion. Denn die alten Mexikaner waren sonst doch alles andere als Menschenfresser.«
Na, ich danke für solch eine Frömmigkeit!
»Und das tun die hier hausenden Malusos noch jetzt?«
»Weiß nicht«, brummte Tischkoff, ganz in seine Zeichnungen vertieft.
Mich konnten diese Ausgrabungen aus grünem Flechtwerk nicht mehr reizen. Allein bahnte ich mir mit Messer und Axt den Weg, der Mauer entlang folgend, die man jetzt dort vermuten konnte, wo die zusammengefilzten Schlingpflanzen selbst einer Mauer glichen, kam in eine Gegend, wo ich nur noch das Messer zu benutzen brauchte, immer lichter wurde der Urwald, bis ich in eine Waldgegend gelangte, die eher einem Parke glich.
Es standen hier auch ganz andere Bäume, welche dem Boden wohl etwas mitteilten, was die Schlingpflanzen nicht aufkommen ließ, und auch das Unterholz war nur sehr spärlich, zwischen den Bäumen hindurch sah ich den See schimmern.
Wenn mein Kommodore allwissend gewesen, so wäre er von hier gekommen, hier hätte er viel leichteres Spiel gehabt, obschon er sich noch immer ein tüchtiges Stück hätte durcharbeiten müssen, denn ich hatte mich doch ziemlich weit von jener Ruine entfernt.
Nun, ich gab mich dem Genusse hin, hier in einem tropischen Urwalde wie in einem Parke spazieren gehen zu können, warf mich in das weiche, ausnahmsweise niedrige Gras, welches überall den Boden bedeckte, spazierte dann weiter nach dem Strande.
Da sah ich einen Busch, mit großen, roten Früchten behangen — Tomaten, auch Liebes- oder Paradiesapfel genannt; denn das soll die Frucht gewesen sein, welche Eva dem Adam reichte. Die Orientalen, welche unsere Religion geschaffen haben, kennen unseren Apfel gar nicht.
Ich esse Tomaten leidenschaftlich gern, als Salat mit Essig und Öl, wie auch gleich so. Man muss nur erst hinter den Geschmack kommen.
Nachdem ich eine Menge Früchte gepflückt hatte, warf ich mich ins Gras, begann sie zu verspeisen.
Sie schmeckten viel süßer als die, welche ich in Italien und in anderen südlichen Ländern gegessen hatte. Doch in der heißen Zone hatte ich sie wohl noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Dann erzeugte eben hier die Sonnenwärme diese größere Süßigkeit.
Hätte ich früher die Tomaten mit etwas aufmerksameren Augen gegessen, so würde ich gewusst haben, dass die Früchte ganz andere Kerne haben — aber ich stecke alles unter der Nase und nicht darüber hinein — und wäre ich ein Botaniker gewesen, so hätte ich vielleicht gewusst, dass die Blätter des Tomatenstrauches übel riechen, während von diesem Busche ein süßer Duft ausging, so süß, wie das Fleisch der Früchte schmeckte.
Mit einem Male wurde ich recht müde. Ich hatte doch in der vergangenen Nacht ein paar gute Stunden geschlafen?
Und immer müder wurde ich, die Augen fielen mir zu.
Da stieg in mir schon eine kleine Ahnung auf. Sollten diese Paradiesäpfel unter dieser Zone vielleicht...
Und da war ich schon eingeschlafen.
Süße Träume umgaukelten mich, süß wie das Fleisch dieser Früchte, und wenn es keine echten Paradiesäpfel gewesen wären, so führten sie mich im Traume doch in den siebenten Himmel.
Aber dabei sollte es nicht bleiben. Plötzlich hat so eine glutäugige Huri, mit der ich gerade poussiere, eine Lanze in der Hand und kiekst mich damit in den Bauch.
Au, das tat weh! Und obgleich das Mädel nicht weiterstach, blieb der Schmerz doch, zerwühlte mir die ganzen Eingeweide.
Das tat so weh, dass ich darüber erwachte.
Und im Wachen ward es nicht besser, ich hatte nicht nur geträumt, hatte wirklich fürchterliche Leibschmerzen, vulgo Bauchkneipen.
»Diese verdammten Liebesäpfel...«
Ich erstarrte, glaubte, die Äpfel hätten auch meine Augen behext.
Ich lag nicht mehr im weichen Grase gebettet, sondern sehr hart — hatte über mir nicht mehr grüne Zweige, sondern eine gewölbte Decke, aus großen Quadersteinen bestehend — und noch enger lag ich in einem Sarge, in einem Kasten, in dem ich meine Gliedmaßen nur wenig bewegen konnte. Doch mein Kopf war frei, ruhte wohl auf einem Kissen, ich sah mit dem Kopfe aus diesem Kasten heraus, mein Hals wurde eng von Holzplanken umgeben. Wie so ein modernes Schwitzbad für den Hausbedarf, wo man nur mit dem Kopfe herausguckt, nur dass ich darin nicht saß, sondern ausgestreckt lag.
Hallo!! Ich hatte im Augenblick kein Bauchkneipen mehr. Ich wendete den Kopf, sah Quaderwände und daran verschiedene seltsame Geräte stehen, Pritschen und Böcke mit eisernen Ringen und dergleichen — und ich hatte all dieses Gerümpel schon einmal gesehen — — in Stein gehauen, die bildliche Wiedergabe der Strafverfahren und Marterwerkzeuge der Malusos!
Mein Schreck lässt sich denken. Denn ich kann ebenso erschrecken wie ein anderer Mensch.
»Trink, Faringi!«, erklang da eine Stimme.
Ich drehte meinen eingezwängten Kopf nach der anderen Richtung und starrte einen schwarzen Kerl an, der eben aus einer Flasche etwas in einen hölzernen Löffel goss.
»Wo bin ich?«
»Nix Anglisi — trink!«
Er wollte mir den Löffel in den Mund schieben, aber ich biss die Zähne zusammen.
»Haben Sie noch Schmerzen?«, fragte da eine andere Stimme. Es war der Alte vom See, wie er sich genannt, der neben dem Schwarzen aufgetaucht war.
»Wo bin ich?«
»In den Händen der Malusos.«
Das hatte ich mir schon selber gesagt.
»Wie komme ich hierher?«
»Sie haben von den Früchten des Schlafbaumes gegessen.«
»Das erklärt mir noch immer nicht, wie ich hierher gekommen bin.«
Ich blieb ganz sachgemäß — nur immer hübsch eins nach dem anderen — als wenn ich nicht in einem kopffreien Sarge, sondern wohlgeborgen im Bette eines Krankenhauses läge, wo ich zu befehlen hätte, und der alte Knasterbart blieb ebenso sachgemäß — vorläufig.
»Sie sind eingeschlafen und von meinen Leuten gefunden worden.«
»Ihre Leute sind auf der Insel gewesen?«
»Ja.«
»Sie sind in einem Boote hingerudert?«
»Ja.«
»Und haben mich als Gefangenen mitgenommen?«
»So ist es.«
»Wie lange habe ich denn geschlafen?«
»Einen Tag und eine ganze Nacht.«
Sapperlot! Das hätte ich im Traume wirklich nicht gedacht.
»Fühlen Sie noch Schmerzen, wie man sie nach dem Genusse dieser Früchte bekommt?«
Nein, die Magenschmerzen waren tatsächlich mit einem Male verschwunden, jetzt nicht nur augenblicklich vergessen.
»Wir haben Ihnen auch immer während des Schlafes von einem heilsamen Mittel eingeflößt.«
»Das ist nett von Ihnen. Aber warum hat man mich hier in diesen Kasten eingesperrt?«
»Damit Sie wehrlos sind.«
»Ja, das ist allerdings bequemer, als wenn man einen Menschen erst binden muss. Was hat man mit mir vor?«
»Sie werden dem heiligen Elefanten geopfert.«
Hallo! Und das so ganz gelassen, sogar freundlich herausgebracht!
Diesem eigentlich gutmütigen Gesicht des würdevollen Alten war überhaupt nicht recht zu trauen, das hatte ich schon heraus. Er hatte doch etwas Falsches in den Augen.
»Ich — werde — geopfert?!«
»Gewiss. Wir haben Ihren Gebieter genug gewarnt, in unser Reich einzudringen.«
Ich hielt es für geratener, mich nicht für den Kapitän jenes Schiffes zu erkennen zu geben.
»So machen Sie doch meinen Gebieter dafür verantwortlich.«
»Das wird er auch, der befindet sich ebenfalls schon in unseren Händen.«
»Was?!«, stieß ich hervor.
»Die ganze Besatzung des Schiffes.«
Ich erstarrte abermals.
»Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr!«, schrie ich dann wild auf.
»Es ist so. Übrigens ist mir ganz gleichgültig, ob Sie das glauben oder nicht. Ehe Sie aber geopfert werden, sollen Sie mir einige Fragen beantworten.«
Ich hatte mich wieder beruhigt. Mochte es kommen, wie es wollte.
»Nun?«
»Was wissen Sie über den Mann mit dem faltigen Gesicht zu sagen?«
»Über Mr. Tischkoff?«
»Ich weiß nicht, wie er heißt. Sie sind der Kapitän jenes Schiffes, aber er ist Ihr Gebieter.«
Der Alte kannte also doch schon meinen Rang. Das war begreiflich. Ich hatte bei seinem Besuche eine Jacke mit Abzeichen getragen.
»Ich weiß gar nichts von ihm«, lautete meine Antwort.
»Hören Sie, wenn Sie nicht sprechen wollen, so werden Sie dazu gezwungen!«
»Wie wollen Sie denn das anfangen?«, stellte ich mich unschuldig.
»Sie werden gefoltert.«
Ich stieß ein verächtliches Lachen aus, was aber noch einen anderen Grund hatte, als nur, um meinen Trotz zu zeigen.
»Ja, Sie werden noch viel mehr lachen.«
»Allerdings, nämlich über Sie — jetzt haben Sie ja bewiesen, was für ein Renommist und Lügner Sie sind.«
»Inwiefern?«, klang es so gemütlich wie immer zurück.
»Sie haben vorhin doch gesagt, auch Mr. Tischkoff befände sich in Ihren Händen.«
»Nun, und?«
»So fragen Sie diesen doch selbst, was Sie über ihn wissen wollen.«
»Das haben wir bereits getan.«
»Und er will nicht sprechen?«
»Nein, er wollte nicht sprechen.«
»So foltern Sie diesen Mann doch.«
»Das haben wir bereits getan; er ist den Folterqualen erlegen.«
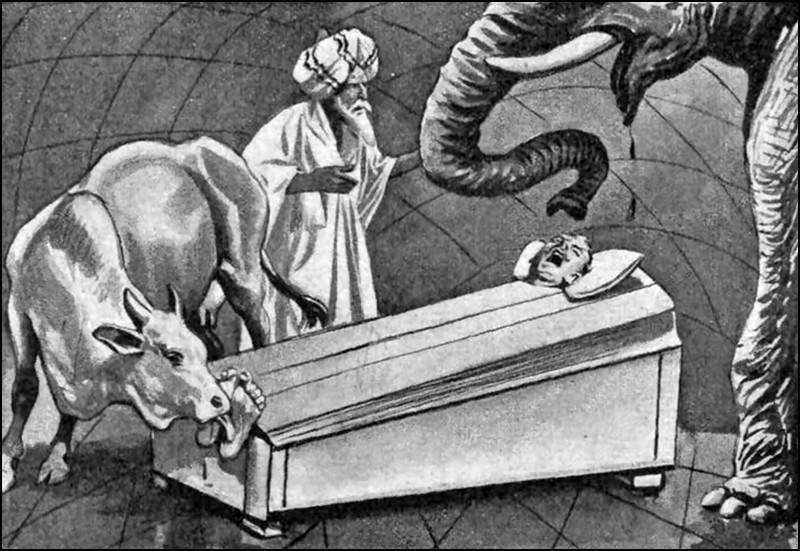
Ich erschrak doch mächtig. Gerade diese fast freundliche Ruhe des Alten war es, die so überzeugend wirkte. An die Unsterblichkeit meines Kommodores glaubte ich doch nicht so recht, dachte jetzt überhaupt gar nicht an seine damalige Behauptung, die er ja vielleicht auch ganz anders gemeint haben mochte — betreffs Unsterblichkeit der Seele und dergleichen.
»Er ist tot?!«
»Ja, unter Folterqualen verendet.«
»Und er hat nicht das gesagt, was Sie von ihm wissen wollten?«
»Nein, er hat kein Wort gesprochen; mit festgeschlossenem Munde ließ er sich alle Glieder verrenken.«
Ich starrte den Sprecher, der ein so gutmütiges Gesicht hatte, an, und dann fuhr ich mit wildem Triumphe empor, soweit meine enge Halskrause das erlaubte.
»Nun, so probiert dasselbe bei mir — und ihr werdet dasselbe erleben — werdet sehen, wie ein Mann aller Qualen spotten wird!«
»Sie wissen, wer dieser Mann, den Sie Tischkoff nennen, ist?«, fragte dann der Alte in aller Gemütsruhe.
»Ja, ich weiß es.«
Ich wusste es ja durchaus nicht, aber ich befand mich wirklich in einer Stimmung, um jenen immer mehr zum gewaltsamen Vorgehen zu reizen.
»Sie wissen, woher er die Kenntnisse von unserem Reiche hat?«
»Ja.«
»Wie er zu der Zeichnung der Flussläufe gekommen ist?«
»Ich weiß es.«
»Wie er in Besitz des Gegengiftes zu dem Pfeilgift gelangt ist?«
»Ich weiß es.«
»Nun?«
»Ich weiß es, alles, alles, aber ich verrate nichts.«
»Dann werden Sie gefoltert.«
»Immer zu!«
»Aber auf eine ganz andere Weise, als wir bei jenem angewandt haben.«
»Machen Sie das, wie Sie wollen.«
»Sie sollen dabei nicht sterben.«
»Mir sehr angenehm!«
»Denn dem heiligen Elefanten müssen lebendige Menschen geopfert werden, noch zuckend müssen wir sein Fleisch essen.«
»Also auch Sie essen Menschenfleisch? Guten Appetit — und gute Zähne wünsche ich, mein Fleisch wird verdammt zäh sein!«
»Deshalb dürfen Sie nicht unter der Folter sterben«, fuhr der Alte unbeirrt fort.
»Das haben Sie schon einmal gesagt.«
»Nicht einmal Schmerzen sollen Sie dabei empfinden.«
»Das ist mir noch angenehmer, zu hören. Nur ist mir unbegreiflich, wie man jemandem auf der Folter etwas auspressen will, ohne dass er dabei Schmerzen empfindet.«
»Das begreifen Sie nicht?!«
Das war in einem Tone gesagt, dass ich mein abgewandtes Gesicht wieder einmal dem geschwätzigen Alten zukehrte.
Und da sah ich, wie sich das sonst so würdevolle, fast gutmütige Gesicht total verändert hatte, es war förmlich entstellt durch einen furchtbaren Hohn, und jetzt las ich es auch in den Augen, dass dieses Mannes eigentlicher Charakter die blutdürstigste Grausamkeit war.
»Sie begreifen nicht, wie das möglich ist?«, sagte er in einem ebenso furchtbar höhnischen Tone, wie er nur zu diesem Gesicht passte. »Und ich sage Ihnen: lachen sollen Sie dabei, lachen, lachen, lachen...«
Ich glaube, er sagte es noch einige Male, seine Stimme entfernte sich dabei, er kam mir, der ich den Kopf nicht heben konnte, durch Zurückgehen aus den Augen.
Ich hatte nicht lange Zeit, über den Fall nachzugrübeln. Über mir erscholl ein schauerliches Trompetengeschmetter, vor meinen Augen tauchte es wie ein grauer, dicker Ast auf, bis ich auch den Kopf des Elefanten sah. Er trat hinter mich, nur sein Rüssel blieb über meinem Kopfe schweben.
Auch Menschen waren hereingekommen, ab und zu ging einer an mir vorüber, dunkelbraune Gestalten, fast nackt, aber mit bunten Federn und Blumen geschmückt — und dann wurde eine Kuh vorübergeführt, ich sah zufällig noch das Euter, ehe sie aus meinem engbegrenzten Gesichtskreise wieder verschwand — ich glaubte, sie musste zu meinen Füßen Stellung genommen haben — ja, jetzt hörte ich sie dort vorn brüllen.
Da fiel mir jenes Bild ein, wie der Mann auf der Bank gelegen, wie eine Kuh seine Füße beschnobert hatte.
Was in aller Welt sollte das bedeuten? Auf welche Weise sollte ich gemartert werden? Und was hatte der Alte immer von ›Lachen‹ geschwatzt?
Doch jetzt dachte ich nur daran, dass ich überhaupt gefoltert werden, sollte, und ›Foltern‹ und ›Schmerzen‹ sind wohl untrennbare Begriffe.
Ich war gewillt, die Folter zu bestehen, unter Schmerzen zu sterben.
Noch einmal: des war ich gewillt, hatte es ja selbst provoziert. Ob ich die Folterqualen aushielt, stumm, höchstens noch meine Peiniger verspottend, das war eine andere Sache.
Das kann kein Mensch im Voraus sagen, und tut er es, so ist er an sich schon ein Renommist, dem nicht viel zuzutrauen ist. Renommisten sind stets Feiglinge. Er kann den festen Willen haben, alle Folterqualen standhaft zu ertragen — das genügt schon, schon dann ist er ein Held — aber ob er sie wirklich erträgt, ob er nicht zu wimmern beginnt und um Erbarmen fleht — das weiß nur der, der die Zukunft in alle Ewigkeit kennt.
Eine Stimme sprach in salbungsvoller Weise, ein allgemeines Gemurmel, ein monotoner Gesang — es war für diese Menschen eine feierliche Handlung, sie beteten. Dann erschien wieder der Alte neben mir.
»Willst du mir jetzt alles mitteilen, was du über diesen Tischkoff weißt?«
»Nein!«
»Du weißt, woher er die Pläne von unserem Gebiete hat?«
»Ja, das weiß ich«, forderte ich nun immer mehr heraus.
»Und du willst nicht sprechen?«
»Nein!«
»Wir werden dich sprechend machen.«
Ein fremdes Wort, und ich fühlte, wie hinten der Kasten geöffnet wurde, indem es kühl von unten herauf kam.
Sofort wurden meine Füße gepackt und meine Beine noch unterhalb der Knie eingeschraubt, worauf man mir die hohen Schnürstiefel und dann auch die Strümpfe auszog.
»Willst du sprechen?«
»Ich verrate nichts!«
Man kann mir nicht verdenken, dass mir ganz unheimlich zumute wurde, um so mehr, als ich gar nicht sehen konnte, welche Vorbereitungen man traf, was für Folterqualen mich erwarteten. Ich dachte an Splitter, die man mir unter die Zehennägel bohren wolle, an glühende Kohlen und dergleichen. Aber meinem Entschlusse, allen Qualen zu trotzen, blieb ich treu. War fast selber gespannt, was ich in dieser Hinsicht leisten könne.
Wieder ein fremdes Wort, und da fühlte ich, wie man in meine Fußsohlen mit einem scharfen Messer lange Einschnitte machte, in jede deren zwei, von den Zehen an bis zur Hacke.
Die Einschnitte konnten gar nicht tief sein, wahrscheinlich wurde nur die Haut geritzt. Es schmerzte durchaus nicht, so wenig wie das Impfen am Oberarm — im Gegenteil, ich hatte eine fast angenehme Empfindung dabei. Wohl schnitt es, schmerzte es ein klein wenig, aber zugleich war es wie ein Kitzeln, dass ich gleich hätte laut auflachen mögen.
Ich habe einmal ein merkwürdiges Buch gelesen, sehr sinnlich geschrieben, üppig, aber in gewissem Sinne hochinteressant. Da wurde erzählt, wie sich zu allen Zeiten hysterisch veranlagte Menschen, aber nicht nur solche, sondern auch andere, besonders Weiber, Lustempfindungen der verschiedensten Art erzeugten.
Besonders im byzantinischen Kaiserreiche sollen sich Frauen Blutegel an die Fußsohlen gesetzt haben, Mücken, Flöhe und dergleichen, das soll ihnen höchst angenehm gewesen sein, zuerst, dass sie sich nicht kratzen durften, und dann, dass sie sich nach Herzenslust kratzen konnten — und nicht nur das, sondern weil die Empfindung des Kitzels mit der Zeit immer schwächer wurden, indem sich die Nerven daran gewöhnten, abgestumpft wurden, mussten sie die Ursache immer verstärken, bis sie ihre Fußsohlen von Sklaven zerfleischen ließen, und da war nicht nur der Prozess der Heilung, der ja immer mit einem Kitzeln verbunden ist, angenehm, sondern auch das schmerzhafte Zerfleischen selbst.
Weiter kam ich in meinen Erinnerungen nicht, denn plötzlich fühlte ich an meinen Fußsohlen einen brennenden Schmerz, dass ich, wenn ich nicht an meinen Vorsatz gedacht, laut aufgeschrien hätte.
Die Schnittwunden an meinen Fußsohlen wurden mit etwas eingerieben, erst mit etwas Feuchtem, dann wie mit einem scharfem, das heißt körnigen Pulver mit scharfen Ecken, was ich fast für Salz halten mochte.
Doch gleich ließ der furchtbare Schmerz wieder nach. Wohl tat es noch weh, aber dazu kam ein anderes Gefühl, ein kitzelndes — kurz, eine Verbindung von Gefühlen, die fast angenehm zu nennen war.
Da brüllte die Kuh, und im nächsten Augenblick fühlte ich, wie es über meine eng zusammenliegenden Fußsohlen in kurzen Zwischenräumen wie ein scharfes Reibeisen ging, immer von unten nach oben.
Was soll ich sagen? Ich brüllte laut auf vor schreiendem Lachen!
Jetzt wusste ich, was jenes Bild vorgestellt, was man mit mir selbst vorhatte.
Zu Tode kitzeln! Ich hatte schon oft genug davon gehört, gelesen — auch in jenem Buche war davon die Rede gewesen — ich hatte nie daran geglaubt, es für ein Märchen gehalten.
Ganz abgesehen von mir! Ich bin überhaupt nicht kitzlig. Mich kann man am Halse oder unter den Armen oder sonst wo kitzeln soviel man will — ich werde höchstens unangenehm. Und wenn ich also da auch nicht mitsprechen kann, so hielt ich es doch auch bei einer sehr reizbaren Person für ausgeschlossen, dass sie durch dieses nicht zu ertragende Kitzeln sich zu Tode lachen kann.
Aber zwischen Kitzeln und Kitzeln ist doch ein Unterschied. Ich will hier nicht von Nervenreiz und dergleichen sprechen, sondern bleibe einfach bei dem allgemein bekannten Worte ›Kitzel‹. Mit einer Federspule darf man mich in den Nasenwinkeln auch nicht kitzeln, dann fange ich ebenfalls an zu lachen und zu jucken. Und wie empfindlich meine Fußsohlen gegen Kitzeln waren, das empfand ich jetzt.
Kurz, ich brüllte geradezu hinaus vor Lachen. Ich wusste, wie man das bewerkstelligte — man hatte meine Sohlen mit Salzwasser eingerieben, das leckte die Kuh mit ihrer reibeisenähnlichen Zunge gierig ab, das Salzwasser wurde immer erneuert, und die feinen Einschnitte in der Haut, noch etwas ins Fleisch, trugen nur dazu bei, die kitzelnde Empfindung zu verstärken.
Und als mir zum Bewusstsein kam, auf welche Weise man mich zum Sprechen bringen wollte, da kam mir auch mein Vorsatz wieder in Erinnerung — ich verstummte, blieb ruhig liegen.
Es gelang mir auch vorläufig, eine kurze Zeit. Aber was ich während dieser wenigen Minuten, vielleicht nur Sekunden, ausgestanden habe, das kann ich gar nicht schildern, da fehlt überhaupt jedes Wort.
Meine Hände waren frei, die sah man ja auch nicht, die durfte ich bewegen — und mit diesen meinen Händen habe ich mir in der Kiste die Sachen vom Leibe gerissen, habe mir die Nägel ins Fleisch gebohrt, immer tiefer, habe mir Fleischfetzen aus den Schenkeln gerissen.
Und dann begann ich zu keuchen — und dann brach der Angstschweiß aus allen Poren hervor — und dann der Todesschweiß — und dann war es vorbei mit meiner Widerstandskraft, denn ich war ein von einem irdischen Weibe geborener Mensch — und da brach ich in ein gellendes Lachen aus und wand mich in meinem Kasten in krampfhaften Zuckungen, soweit die Halskrause und die festgeschnallten Füße es erlaubten.
Ich glaube, dass ich alle Schmerzen und Qualen standhaft ertragen kann — ich will nicht renommieren, aber ich glaube es. Es sind so viele Märtyrer auf dem Scheiterhaufen, am Kreuze gestorben, sie sind fürchterlich gefoltert worden und haben bis zum letzten Atemzuge ein lächelndes Antlitz gezeigt — Blassgesichter haben am Marterpfahl ebenso mit spöttischer Verachtung alle Qualen ertragen wie jeder nordamerikanische Indianer — ich habe genug Gliedmaßen amputieren sehen, ohne Narkose, habe selbst Beine und Arme abgesägt, und ich habe oft genug den Fall erlebt, dass der Betreffende mit keiner Wimper zuckte, der eine Matrose kaute dabei seinen Tabak klein, ein anderer rauchte seine Pfeife dazu — ja, ich glaube, ich weiß es, das könnte auch ich! Ich wäre zu stolz dazu, Zeichen des Schmerzes zu geben, da würde ich mich selbst verachten.
Aber hier die an meinen Fußsohlen leckende Rinderzunge — das hielt ich nicht aus, das ging über meine Kräfte.
»Hahahaha — ich will gestehen — hahaha — hört auf — hört auf — hahahahaha — ich sterbe vor Lachen!!«
Und das Lecken der scharfen Rinderzunge hörte auch auf, sofort war jede kitzelnde Empfindung verschwunden.
Aber keuchend und röchelnd lag ich da, wohl schon Schaum vor dem Munde — es war dennoch nicht anders, als ob ich die furchtbarsten Schmerzempfindungen durchgemacht hätte.
»Willst du gestehen?«
»Ich habe nichts zu gestehen.«
»Was, schon wieder?!«
»Nein, ich weiß ja selbst nicht, wer dieser Tischkoff — —«
Da fing das Reibeisen von Zunge schon wieder zu lecken an.
Einen Augenblick wollte ich fest bleiben, konnte es auch — dann aber war ich von Neuem überwältigt.
»Ich kann ja gar nichts aussagen«, wimmerte ich unter brüllendem Lachen. »Erbarmen, Erbarmen — hahaha — — das hatte ich ja nur so gesagt — hahahaha...«
»Bei meinem Heiland, was geht hier vor?!«, wurde da mein sonores Brüllen noch von einer durchdringenden Stimme übertönt, die nur einem Weibe angehören konnte, und da das Lecken sofort aufhörte, war es auch sofort mit dem Kitzel vorbei, die Nachwehen bestanden nur noch in vollkommener Erschöpfung.
Und während zu meiner Linken, mir sichtbar, der Alte stand, sah ich zu meiner Rechten plötzlich ein Mädchen stehen mit blondem Haar und weißer Haut, die schlanke Gestalt nach malaiischer Weise in einen enganliegenden Sarong aus kostbarster, buntschillernder Seide gewickelt, vielen Schmuck von Gold, Perlen und Edelsteinen tragend.
Dieses Mädchen, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, eben erst zur Jungfrau erblüht, kam mir wie ein Engel, wie eine Fee aus dem Märchenlande vor — und der Alte, trotz seines weißen Gewandes, wie ein der Hölle entstiegener Teufel.
Denn solch eine Grimasse schnitt er beim Anblick des Mädchens, das ihm ebenfalls ganz überraschend gekommen sein musste.
»Was willst du hier, Jokonda?«, stieß er hervor.
Sie sprachen Englisch zusammen, und dabei blieb es. Offenbar sollten die umstehenden Eingeborenen ihre Unterhaltung nicht verstehen. Ich gebrauche das im Englischen fast ganz unbekannte ›du‹, um wiederzugeben, wie die beiden auf vertrauterem Fuße stehen mussten.
»Was hier vorgeht, frage ich!«
»Du siehst es ja.«
»Du hast den Gefangenen gefoltert, obgleich ich es dir streng verboten habe.«
»Das ist keine Folter, ich mache nur Kaiadoba mit ihm.«
»Hast du mir nicht selbst gesagt, dass Kaiadoba die fürchterlichste Qual sei, an der jeder Mensch unter Lachen stürbe?«
»Ich hätte ihn nicht sterben lassen.«
»Aber die furchtbare Qual muss er doch ausstehen. Und weshalb machst du Kaiadoba mit ihm?«
»Er soll mir gestehen, wer jener Mann mit dem faltigen Gesicht ist, der unsere Gewässer und fast alle unsere Geheimnisse kennt...«
»Das weiß dieser Mann, der Kapitän jenes Schiffes, gar nicht.«
»Woher willst du denn das wissen?«
»Weil jener Mann, der sich Mister Tischkoff nennt, sich mir bereits offenbart hat.«
Das Stutzen des Alten war groß.
»Was?! Er hat — sich dir — offenbart?!«
»Ja.«
»Wie ist denn das möglich? Hast du denn schon mit ihm gesprochen?«
»Er befindet sich als Gast auf der Insel. Während du dich mit dem Gefangenen beschäftigtest, d. h., während du meiner Ansicht nach dem an der giftigen Frucht Erkrankten deine Pflege widmetest, habe ich mich an Bord jenes Schiffes begeben und mit dem fremden Manne Rücksprache genommen.«
»Den Tod über dich!!«, schrie der Alte in plötzlich hervorbrechender Wut auf.
»Solche Worte verbitte ich mir!«, fuhr da aber auch das Mädchen empor, und trotz seiner zierlichen Gestalt und seiner lieblichen Gesichtszüge stand es im Augenblick doch wie eine zürnende Rachegöttin da, ohne dadurch etwas von seiner Hoheit einzubüßen.
Ich sah es schon kommen — hier sollte so etwas ausbrechen, was man im gewöhnlichen Leben einen Familienstreit nennt — und so war es denn auch.
Der Alte brach in ein höhnisches Lachen aus.
»Du — du? Gar nichts hast du dir zu verbitten!«
»Was?! Was wagst du mir zu sagen?«, fuhr das Mädchen noch mehr empor, mit einem Male ganz bleich werdend.
»Dass du dir gar nichts zu verbitten hast!«
»Oho! Oho! Wer hat hier zu befehlen, wir, mein Bruder und ich, oder Sie, Mijnheer Gustav van Roch?«
Ein Wort gab schnell das andere, jetzt schien aber die Unterhaltung trotz aller Bissigkeit doch zeremonieller zu werden, oder eben deshalb, sodass ich wieder das ›Sie‹ wähle.
»Hahaha!«, lachte der Alte. »Glaubt ihr Kinder denn wirklich, dass ihr hier überhaupt etwas zu befehlen habt?«
»Allerdings haben wir schon längst bemerkt, dass Sie uns zu Puppen machen wollten, denen man nur scheinbar gehorcht, während Sie hier als Tyrann regieren wollen!«
»Nun, wenn ihr das schon längst gemerkt habt, dann ist es ja gut, dann erspart ihr mir ja die nähere Erklärung!«, lachte der Alte weiter, welcher Hohn das brave Mädchen aber nicht viel zu inkommodieren schien.
»Ja, es wäre gut für Sie, wenn nicht auch wir schon Gegenmaßregeln getroffen hätten.«
»Maßregeln? Was für Maßregeln?«, stutzte der Alte doch etwas.
»Sie werden es erfahren. Und nun befehle ich Ihnen: Dieser Gefangene wird sofort befreit, er ist unser Gast!«
»Und ich sage dir: er bleibt auf der Folterbank! Willst du es denn endlich hören? Er soll der erste dieser vermaledeiten Faringis sein, der dem heiligen Elefanten geopfert wird, dessen noch rauchendes Herz unsere Leute essen werden, auf dass sie nicht mehr nur dem Namen nach Malusos sind, sondern würdige Nachfolger ihrer großen Ahnen. — Auf, ihr Priester der Malusos, fahrt fort mit Kaiadoba an diesem verfluchten Fremden, der heilige Elefant wartet und segnet eure Arbeit!«
Der Alte hatte wohl vergessen, dass er Englisch sprach, was die dunkelhäutigen Kerls nicht verstanden — jedenfalls sah ich keine Gestalt sich rühren.
Oder war es die Erscheinung dieses Mädchens, dass sie dem Alten den Gehorsam verweigerten?
Sie war dichter an mich herangetreten, und erst jetzt sah ich, dass sie in der rechten Hand eine Art Hundepeitsche trug, und mit der linken Hand machte sie sich an meiner hölzerner Halskrause zu schaffen.
»Dieser Mann ist frei, sage ich!«
»Wehe, wenn du ihn zu befreien wagst!«, erklang es aus dem Munde des Alten noch drohender, als aus dem ihren, und auch er streckte die Hand aus, um sie zu hindern.
»Weg die Hand!«
»Zurück!«
»Gottes Tod über...«
»Da!!«
Es klatschte, knallte schon mehr — und die steife Lederpeitsche hatte über das weißbärtige Gesicht des Alten einen blutenden Streifen gezogen.
Der Getroffene war zurückgetaumelt, die Hände vor dem blutenden Gesicht — dann aber fuhr er wie ein Rasender empor.
»Das mir — das mir — nun ist es gut — ram ram mahadeo, ram mahadeo, mahadeeeooooo!!!«
Die ersten Worte waren keuchend, die letzten gellend von seinen Lippen gekommen.
Und ich kannte diese Worte ›ram ram mahadeo‹, hatte wenigstens von ihrer Bedeutung gelesen, schon von Augenzeugen erzählen hören.
Die Inder haben sich schon seit uralten Zeiten der Elefanten nicht nur zur Arbeit, sondern auch im Kriege bedient, und dabei wiederum nicht nur als Reittier, sondern die kolossalen Dickhäuter mussten selbst mit ›Soldatens spielen‹, mussten direkt als furchtbare Gegner vorgehen.
Jedes Tier unterliegt manchmal Wutanfällen, wenn man da nicht gleich von Wahnsinn sprechen kann, und das um so mehr, je höher entwickelt seine Geistesfähigkeiten sind. Und das klügste Tier ist unbestreitbar der Elefant.
Die Veden, das sind die heiligen Bücher der Brahmanen, wie die der Buddhisten, z. B. Buddhas Lebensbeschreibung, der Inder Evangelium, sind voll von wahnsinnigen Elefanten. Alles wirft der rasende Riese nieder, zerstampft es unter seinen Füßen, da hilft keine Waffe, Regimenter zerstieben vor dem Ungeheuer — da tritt ihm Bodhisattva Buddha entgegen, mit liebevollem Blick streckt der Göttersohn die Hand gegen ihn aus — und kraftlos bricht das Ungeheuer plötzlich zusammen, beruhigt erhebt es sich wieder, schmiegt sich gehorsam an den Gottgesandten — der Geist des Wahnsinns ist von ihm gewichen.
Und diesen Wahnsinn können die Inder bei jedem gutabgerichteten Elefanten künstlich hervorrufen. Noch heute. Der Führer singt mit kreischender Stimme: ram ram mahadeeeoo!! — und da gerät der Elefant plötzlich außer sich, wirft den Rüssel zurück, ein furchtbares Gebrüll, und nun drauflos, alles Lebendige unter die Füße gestampft! Wie das den Tieren beigebracht wird, weiß ich nicht.
Schließlich ist das gar nicht so schwer zu begreifen. Der Elefant wird eben erst in sicherem Verschlage öfters zur Wut gereizt, durch Schläge und Stiche, immer unter jenem Kampfrufe.
»Ram ram mahadeeeooo!!!«, hatte auch der Alte gekreischt. Und da aus dem Rüssel, der ständig über meinem Kopfe geschwebt hatte, ein schmetterndes Gebrüll, aber ein ganz anderes als vorhin, das war gegen dieses nur das Lärmen eines Kindertrompetchens gewesen. Einfach haarsträubend, im übrigen ganz unbeschreibbar, mit keinem anderen Tone zu ergleichen.
»Ram ram mahadeeeooo!!!«, brüllte der Alte nochmals.
Was sollte der Elefant? Nun, jedenfalls tat er nicht das, was der Alte von ihm verlangte, vielmehr ganz offenbar gerade das Gegenteil.
Plötzlich schoss der graue Rüssel wie eine vorwärtsschnellende Schlange über mich hinweg, und im nächsten Augenblick zappelte der Alte über meinem Kopfe, umschlungen von eben diesem Rüssel.

Ich hörte noch viele Schreie des Entsetzens, sah die mir zunächst stehenden Kulis auf und davon stürzen — mehr Zeit zum Beobachten hatte ich nicht, und es war auch keine günstige Gelegenheit, um Studien zu treiben.
Sofort hatten weiche Händchen an meinem Halse herumgekrabbelt, ich sah das Mädchen nach dem Fußende des Kastens springen, der Sargdeckel wurde empor gekippt, ich war frei.
»Wir müssen fliehen, wir müssen fliehen — schnell, schnell — wir sind noch nicht in Sicherheit!«
Das ließ ich mir nicht zum zweiten Male sagen, und wenn meine Glieder auch durch das lange, eingeschränkte Liegen sehr gelähmt waren, vielleicht mehr noch durch den Genuss jener höllischen Frucht, so war ich wieder lebendig gewordener Toter doch schnell genug aus meinem Sarge heraus, und ich hatte noch so viel Geistesgegenwart, sofort nach meinen Strümpfen und Stiefeln zu greifen, die ich am Boden liegen sah. Denn ich bin nicht gern barfüßig in Gesellschaft, zumal in Damengesellschaft.
Die Fußfutterale auch noch anzuziehen, dazu hatte ich freilich keine Zeit mehr, das Mädel, mein Engel, hatte mich schon bei der Hand genommen und zog mich mit sich fort.
Es ging im Laufschritt durch ein Tor in der Wand. Vor mir waren keine Menschen mehr, und als ich noch einmal zurückblickte, sah ich den riesenhaften Elefanten dastehen und mit dem zappelnden und brüllenden Alten noch immer Fangball spielen, oder ihn doch im Rüssel so hin und her schwenken.
Und weiter Hand in Hand im Laufschritt durch einen endlosen Gang!
»Können Sie laufen?«, fragte mich unterwegs einmal mein Engel mit fliegendem Atem.
»Das merken Sie doch.«
»Hat man Ihnen nicht die Fußsohlen aufgeschnitten?«
Ich fühlte wirklich absolut nichts davon. Ja, doch — aber nichts weiter als etwas Jucken. Es waren eben ganz schwache Hautritze gewesen.
»Wir sind noch nicht gerettet«, stieß meine Führerin wieder mit fliegendem Atem hervor. »O, das wird noch ein Blutbad geben — ein furchtbares Blutbad — wenn wir nur erst auf dem Schiffe sind!«
»Auf meinem?«
»Ja, ja, auf der ›Sturmbraut‹.«
»Wo liegt die?«
»Hier an der Mauer. Ha, wenn das van Roch gewusst hätte, dass das Schiff bis dicht an die Insel herankam! Aber er war eben so ganz in seine scheußliche Beschäftigung vertieft, und so war dies schließlich auch ein Glück.«
Wir hatten das Ende des Klosterganges — denn an einen solchen musste ich immer denken — erreicht, und da sah ich an einer Art von Kaimauer meine ›Sturmbraut‹ liegen, sah meine Jungen an Deck stehen — in diesem Augenblicke aber, als mich die brennende Sonne umflutete, fühlte ich mit einem Male eine furchtbare Schwäche über mich kommen — und plötzlich war mir, als ob die ›Sturmbraut‹ mit der ganzen Takelage in die Luft schösse, während ich in die Tiefe versank — das Bewusstsein hatte mich zum zweiten Male verlassen.
Wie befinden Sie sich, Herr Kapitän?« Ich sah mich in meiner Koje liegen, und neben mir saß Tischkoff, schon wieder mit einem Löffel.
»Danke, ganz gut.«
»Fühlen Sie kein Gliederreißen?«
Ich betastete meinen Körper.
»Nein, bei mir reißt gar nichts.«
»Sie haben doch wenigstens ein Dutzend Früchte von dem Schlafbaume gegessen, wie wir dann an den Kernen erkannten.«
»Wahrscheinlicher sogar drei Dutzend.«
»Mensch, haben Sie eine Natur! Drei Früchte genügen schon, um einen normalen Menschen zu töten. Und Sie schlafen gesund und erwachen ohne Krämpfe.«
»Mir ist von den Malusos, wie sich die Kerls nennen, schon vorher etwas eingeflößt worden.«
»Ich weiß es. Aber trotzdem. Ich glaube, Sie können ein Beefsteak mit Arseniksauce vertragen. Doch lassen wir das. Sind Sie zum Sprechen und zum Zuhören fähig?«
»Ich denke, das könnten Sie doch merken. Wer ist nun eigentlich dieses engelgleiche Mädchen, das mich gerettet hat?«
»Sie ahnen es nicht?«
»Nein.«
»Das ist die Tochter von James Brooke.«
Nein, das hatte ich allerdings nicht geahnt. Das heißt nämlich, in meinem Sarge hatte ich mich überhaupt nicht mit Ahnungen abgegeben, und jener ›Familienstreit‹ hatte sich gar schnell abgespielt.
»Was Sie nicht sagen! Sollte James Brooke nicht eine Tochter des Sultans von Brunei geheiratet haben?«
»So ist es, das ist ihre Mutter.«
»Und war das nicht eine Malaiin?«
»Ganz recht.«
»Dieses Mädel hat aber verdammt wenig Ähnlichkeit mit einer Malaiin, sieht vielmehr ganz wie eine reinrassige Engländerin aus.«
»Weil sie eben ganz nach dem Vater geraten ist. Solche Naturspiele kommen vor. Der Sohn, Rudyard Brooke, hat wieder Aussehen und Wesen der Mutter. Sonst aber dennoch ein germanisches Herz.«
»Ja, wie kommen die Kinder von James Brooke eigentlich hierher?«
»Wollen Sie nicht lieber zuerst erfahren, wie Sie selbst hierher kommen?«
»Ja, erzählen Sie von Anfang an.«
»Sie haben uns mit Ihrer Entfernung große Sorge gemacht.
Erst als Sie auch nicht zum Mittagessen an Bord kamen, suchte man Sie. Ihre Fährte war ja leicht genug zu finden, nur Sie selbst nicht, aber ich erkannte doch sofort, dass Sie von den Früchten des Schlafbaumes gegessen hatten, und ferner, dass Sie in die Hände von Eingeborenen gefallen waren. Das verrieten Ihre Spuren und die eines Bootes, das halb auf den Strand gezogen worden war.
Nun, es war zum Teil auch meine Schuld, ich hätte die ganze Insel besser bewachen lassen sollen. Eingeborene hatten trotz unserer Schießdemonstration gewagt, die Insel von einer anderen Seite zu betreten, hatten Sie im todähnlichen Schlafe gefunden, Sie mitgenommen.
Als wir das konstatiert hatten, war es schon nachmittags gegen vier Uhr. Sofort Dampf aufgemacht und hin nach jener Insel, welche die Malusos ihre Residenz nennen. Doch über die Malusos selbst später.
Ich ließ mich an Land rudern, auf jede Gefahr hin. Mijnheer van Roch, der sich selbst den Alten vom See nennt, das Haupt dieser Bande, kam mir denn auch entgegen.
Ja, ganz richtig, der Kapitän des Schiffes wäre in seiner Gewalt, und er würde Sie uns nicht eher ausliefern, als bis ich bei meinem Gott und bei sonst etwas heiligst geschworen hätte, sofort den Rückweg anzutreten, wegen der Verschwiegenheit müssten wir statt Ihrer drei Matrosen als Geiseln stellen, wie wir drei vornehme Malaien bekommen sollten, die später wieder ausgetauscht würden.
Ich drohte damit, die ganze Residenz in Trümmer zu schießen. Er lachte mich einfach aus. Dann könnten wir zusehen, wie Sie dem heiligen Elefanten geopfert würden.
Sie verstehen. Dieser geriebene Holländer, von dem ich Ihnen noch später erzählen werde, wusste eben ganz genau, dass Sie hier doch eigentlich die Hauptperson sind, mindestens, dass wir Sie niemals aufopfern würden, und somit hatte er uns ganz in der Hand.
Nun war guter Rat teuer. Ich erbat mir Bedenkzeit bis zum anderen Morgen, was mir auch gewährt ward, wodurch jedoch der gute Rat nicht billiger wurde.
Ich saß die ganze Nacht in meiner Kabine und zermarterte mir den Kopf, wie herauskommen aus dieser Kalamität. Da ward ein Boot gemeldet. Wären es Feinde gewesen, sie hätten uns überrumpeln können. So finster war die Nacht, und so geräuschlos war es herangekommen.
Ein Weib, eine Malaiin wünsche mich zu sprechen, meldete mir der ob seiner Nachlässigkeit ganz verwirrte Mahlsdorf.
Sie kam in die Kajüte. Und als sie sich aus Tüchern und Schleiern gewickelt hatte, sah ich vor mir eine junge Engländerin stehen, fast ein Kind noch.
›Wissen Sie, wer ich bin?‹ — Nein. — ›Jokanda, die Tochter von James Brooke, die mit ihrem Bruder, der jetzt krank darniederliegt, hier bei der geheimen Sekte der Malusos ein Asyl gefunden hat, und ich komme, um mich mit Ihnen zu verbünden.‹
Sie erzählte mir die ganze Nacht. Was ich von ihr erfuhr, ist folgendes:
Vor vier Jahren also starb James Brooke, bisher von den Engländern in Ruhe gelassen. Jetzt aber kamen diese, forderten die Provinz Sarawak als erbloses Besitztum eines englischen Untertanen als ihr Eigentum. Wie sie die beiden vorhandenen Kinder nicht als erbberechtigt anerkannten, weil der Vater eine Malaiin nach mohammedanischem Ritus geehelicht, das habe ich Ihnen ja schon erzählt.
Der Sultan von Brunei musste klein beigeben, er nahm seine beiden Enkel an seinen Hof. Aber diese, die zwölfjährige Jokanda und der um ein Jahr ältere Rudyard, waren hier vor Nachstellungen von englischer Seite nicht sicher. In der Ansicht, dass sie doch einmal als berechtigte Erben auftreten, überhaupt Schwierigkeiten machen könnten, trachtete man den beiden Kindern nach dem Leben, mindestens nach der Freiheit, suchte sie mehrmals zu entführen. Wenn die Attentäter auch immer Inder oder Chinesen waren, so gingen die Anschläge doch ganz offenbar von England aus, wenn ich auch nicht gerade von der englischen Regierung sprechen will.
Nun muss ich eine andere Hauptperson auftreten lassen, den Radscha von Surinam, mit seinem eigentlichen Namen Mijnheer Gustav van Roch.
Der ist früher einmal holländischer Offizier gewesen, hat es bis zum General gebracht, wurde auf den holländischen Sundainseln Gouverneur von verschiedenen Distrikten, wurde wegen mehrerer Delikte, die seinem maßlosen Hochmute entsprangen, immer versetzt, bis sein Maß voll war. Er wurde aller Ehren und Ämter entkleidet, mit Schimpf und Schande davongejagt.
Mijnheer van Roch schnaubte und schwor Rache gegen sein eigenes Vaterland, verschwand und... tauchte als erster Minister des Sultans von Brunei unter dem Namen eines Radschas von Surinam wieder auf.
Und nun ist dieser alte Holländer länger denn zehn Jahre bemüht gewesen, seinen Landsleuten in den indischen Kolonien das Leben so sauer wie möglich zu machen. Das heißt, er operierte immer gegen die Regierung, die ihn davongejagt.
Von großer politischer Bedeutung sind diese seine vom Hass diktierten Bemühungen allerdings nie geworden. Der Aufstand der Atschinesen auf Sumatra wäre auch ohne ihn nie zur Ruhe gekommen, auch ohne seine ministeriellen Ratschläge hätte sich das Property Borneo unter dem Sultan von Brunei noch immer unabhängig halten können.
Aber dieses Abtrünnigen Hass oder Ehrgeiz ging noch weiter: Ganz Borneo, alle Sundainseln müssen den Holländern wieder aus den Zähnen gerückt werden, sie sollen denen gehören, die sie von jeher besessen, den Malaien!
Dass nun mit den schwächlichen Malaien allein kein ordentlicher Aufstand anzuzetteln war, das musste dieser geriebene Politiker und Kriegsmann von selbst wissen. So wandte er sich an England, versprach der Regierung ganz Borneo und so weiter in die Hände zu spielen, und wenn die englische Regierung auch nicht offiziell auf so etwas einging, so fanden sich doch Hintermänner genug, die gleich unter dem Schutze der englischen Flagge zur Annexion der Provinz Sarawak bereit waren.
So war es also dieser Mijnheer van Roch, welcher das Erbe von James Brookes Kindern, als deren würdevoller, ihre Rechte wahrender Vormund er sich aufspielte, den Engländern in die Hände lieferte, und er selbst sorgte dafür, dass es dabei unter den dortigen Eingeborenen nicht zum Aufstande kam, dass sich diese die fremde Annexion ruhig gefallen ließen.
Aber bald erkannte dieser edle Holländer, dass er bei seinem doppelten Spiele sich selbst betrogen hatte. Die englischen Unternehmer, schon im Besitze der rentablen Antimonbergwerke, trauten dem Frieden doch nicht recht, sie wollten auch noch James Brookes Kinder als Sicherheit haben.
Kurz und gut, Mijnheer van Roch hielt es für besser, diese Kinder, als deren Vormund er sich schon immer aufgespielt hatte, in Sicherheit zu bringen. Doch wohin?
Wohl kein zweiter Mensch ist in die Verhältnisse der Eingeborenen des Sundaarchipels so tief eingeweiht wie dieser alte Holländer. So war er auch ziemlich genau orientiert über die Sekte der Malusos, so geheim sich diese auch halten.
Über die Malusos habe ich Ihnen ja schon früher erzählt. Das waren eben die Ureinwohner dieser Inseln, hatten ihre besondere Religion, eine sehr blutige, selbst mit Menschenopfern und Menschenfresserei verbunden. Also diese Religion existiert noch, wird aber ganz, ganz geheim betrieben, ihrer Anhänger sind nur noch wenige, sie machen auch keine Propaganda.
Mijnheer van Roch kannte den geheimen Sitz dieser Sekte, eben hier auf den Inseln dieser Seen, die von einem undurchdringlichen Wasserlabyrinth umgeben sind, kannte den Weg hierher. Woher er diese Kenntnis hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er sie einem Mitgliede der Sekte durch Martern erpresst, obgleich das gar nicht so leicht sein soll. Ich selbst bin auch nur durch einen Zufall in alles dies eingeweiht worden, habe Pläne und anderes durch einen Zufall erhalten.
Also der alte Holländer zog sich mit den unerwachsenen Kindern hierher zurück, wusste die Malusos zu beeinflussen, dass sie ihn gastfreundlich aufnahmen. Das war vor vier Jahren. Roch fand damals ein aus Malaien und Dajaks gemischtes Völkchen von etwa zweitausend Seelen vor, das auf den Inseln zerstreut lebte, sich von etwas Ackerbau, Jagd und Fischfang ernährte und den heiligen Elefanten anbetete.
Aber dieser heilige Elefant, der die ganze Welt erschaffen hat, das Symbol der Göttlichkeit, existierte damals nur in den Köpfen dieser schrecklich unwissenden Eingeborenen, und dann noch in zahllosen Bildnissen und Monumenten. Auf ihre Religion will ich sonst nicht weiter eingehen. Kurz, Eingeborene hatten hier einmal die großartigen Überreste der Kultur einer verschwundenen Nation entdeckt, Bauten, Monumente, und dergleichen, eine Ahnung von der alten Religion war noch vorhanden, so machten sie jetzt das alles nach. Aber bis zu Menschenopfern oder Menschenfresserei verstiegen sie sich durchaus nicht. Wenn ein Dajak ab und zu den Kopf eines Fremden mitbrachte, so war das etwas ganz anderes, diesem Sport huldigen auch alle anderen Dajaks, die gar nichts von den Malusos wissen.
Und nun stieg in dem Kopfe des alten Mannes, der von seinen eigenen Landsleuten davongejagt, von den Engländern geprellt worden war, die grandiose Idee auf, die aber schon mehr an Wahnsinn grenzte. Mijnheer van Roch ist so alt, dass er schon bald wieder kindisch wird — aber es gibt eine ganz besondere Art dieser Altersschwäche — der an Wahnsinn grenzende Hochmut, meinetwegen auch Cäsarenwahnsinn genannt.
Tod allen Fremden! Tod der ganzen Menschheit! Und als erstes Handwerkszeug sollten ihm hier diese Malusos dienen, mit denen er zunächst die Insel Borneo von der Fremdherrschaft befreit.
Trotz seines Wahnsinns ging der alte Holländer ganz systematisch vor. Er ist früher weit in der Welt herumgekommen, versteht manche Künste, die ihm auch die hiesigen Gaukler nicht nachmachen können. Dazu mögen noch Hilfsmittel der modernen Chemie und Physik kommen.
Dies alles brachte er nun nach und nach den beiden Kindern bei, wusste diese mit einem größeren Nimbus zu umgeben, stellte sie als mit übernatürlichen Kräften begabte Propheten, als Halbgötter hin, dazu bestimmt, einst wieder ein malaiisches Reich zu gründen, wie die Malusos es früher gehabt.
Dann war ihm die Hauptsache, auch die alte Religion der Malusos in ihrer Ursprünglichkeit wiederherzustellen. Welcher Mittel er sich dazu bediente, dafür nur ein einziges Beispiel.
Eines Tages wurde der heilige Elefant angebetet, der auf der Hauptinsel in natürlicher Größe aus Stein gemeißelt daliegt. Van Roch sorgte für bengalische Beleuchtung, für Feuerwerk und dergleichen, was diese von aller Welt abgeschiedenen Malaien alles nicht kennen, Jokonda muss in Verzückung verfallen, sie spricht eine Beschwörung, als Zeichen ihrer Göttlichkeit soll sich der steinerne Elefant erheben — — und richtig, er steht auf, fängt an zu brüllen, er lebt.
Na, Sie werden darüber nicht staunen. Höchstens über die Raffiniertheit dieses alten Mannes, wie er es verstanden hat, einen lebenden Elefanten heimlich hier einzuschmuggeln und ihn so zu einer steinernen Rolle abzurichten.
Aber Sie können sich wohl auch die Wirkung dieser Gaukelei auf die Gemüter dieser naiven Naturkinder vorstellen. Diese Naivität machte ihm nur den Strich durch die Rechnung, dass diese Naturkinder nicht zum Gebrauch von Menschenopfern zu bewegen waren, noch weniger zum Genuss von Menschenfleisch, nicht einmal der blutdürstigste, kopfabschneidende Dajak. Aber van Roch hatte weiter gewühlt und gepredigt, schließlich hatte er das geblendete Völkchen doch so weit, wie er wollte. Als erstes sollte ein Malaie, der eine Strafe verdient, dem heiligen Elefanten auf dem Altar geopfert werden, sein Fleisch würde man verspeisen, die schon bestimmten Priester sein noch rauchendes Herz — — da waren es James Brookes Kinder, welche ihm den zweiten Strich durch die Rechnung machten. Jokonda und Rudyard hatten unterdessen die Kinderschuhe abgelegt, hatten sich entwickelt, konnten selbstständig denken, ihr besseres Ich war erwacht.
Nein, zu solchen Kinkerlitzchen wollten sie sich nicht mehr hergeben. Wohl wollten sie ihr Erbe von den Engländern zurückhaben, es mit Waffengewalt zurückerobern, aber nicht als betrügende Gaukler, und nun gar solche blutige, schauderhafte Zeremonien — nein, niemals!
Kurz und gut, die feierliche Hinschlachtung, die ganze heilige Handlung wurde unterbrochen. Das ist erst vor zwei Wochen passiert. Und seitdem ist das Heerlager der Malusos in zwei Parteien gespalten. Wenn auch noch nicht in scharfer Grenze, sodass man noch nicht sagen kann, wie viele Anhänger jede Partei hat. Vorläufig hat es nur gegärt, es werden Reden gehalten, noch immer hat van Roch versucht, die Kinder wieder für sich zu gewinnen. Vorhin aber ist der Streit zum offenen Ausbruche gekommen. Rudyard liegt gegenwärtig am Wundfieber danieder. Ein Krokodil hat ihn in den Schenkel gebissen. Nicht schlimm, er wird bald wiederhergestellt sein. So übernahm Jokonda die Überwachung der Verhältnisse. Sie erfuhr von Ihrer Gefangennahme, gebot Ihre Pflege. Dann erfolgten Beratungen, wie man uns Fremde empfangen sollte. Es ging sehr hitzig zu. Als man sich nicht einigen konnte, stattete mir Jokonda einen heimlichen Besuch ab. Sie erzählte mir all dies, was Sie jetzt von mir gehört haben.«
Tischkoff hatte seine lange Erzählung geschlossen.
»Da fehlt aber noch viel«, sagte ich, als mein Kommodore nicht wieder beginnen wollte. »Wie war denn nun das mit meiner Befreiung aus dem Sarge?«
»Aus dem Sarge?«
»Aus dem Kasten, in dem ich eingeklemmt lag, damit mir die Kuh gemütlich die Füße ablecken konnte. Ist das Ihnen nicht bekannt?«
»Natürlich, Jokonda hat mir doch alles erzählt. Auf ihren Vorschlag dampften wir bei Morgengrauen gleich dicht an die Insel heran, um mit einem Schlage der ganzen Sache ein Ende zu machen, wir waren eben sofort die Sieger.
Die Aufregung unter der Inselbevölkerung war beim Anblick unseres Schiffes, das dicht an einer Mauer beilegte, natürlich kolossal. Jokonda eilte sofort davon, um Sie aus Ihrem Gefängnis zu befreien. Ihre Autorität, die sie vorläufig noch besaß, hielt sie zu ihrem Schutze für genügend. Aber sie witterte gleich Unheil, weil van Roch nicht zu sehen war und keine Vorbereitungen zu unserer Abwehr traf.
»Richtig, sie fand ihn mit seinen Priestern in einem Heiligtume, zu dem nur die Eingeweihten den Zugang kennen, er war dabei, Sie zu martern, und das war insofern gut, als man eben dadurch keine Möglichkeit gehabt hatte, ihn von der Ankunft unseres Schiffes zu benachrichtigen. Wie das tapfere Mädchen Sie befreit hat, wissen Sie ja selbst am besten.«
»Und was geschah dann weiter?«
»Zunächst holte Jokonda noch ihren kranken Bruder, ließ ihn an Bord bringen. Es war die höchste Zeit, denn da kam schon der racheschnaubende Holländer angestürmt, blies in ein Büffelhorn, und das Blutbad begann.«
»Was für ein Blutbad?«
»Nun, die Geschwister haben genug Getreue, die wollten sich ihnen anschließen, zu uns an Bord kommen, aber nur wenigen gelang das. Sie waren zum Teil noch zu weit ab. Die Malusos, d. h. die Anhänger des alten Holländers, haben mit Lanze, Schwert und Kris schrecklich unter ihnen aufgeräumt.«
»Konnten Sie denn da mit meinen Jungen nicht eingreifen?«, fuhr ich empor.
»Leider gar nicht. Dass ich alles getan hätte, wenn es eine Möglichkeit gegeben, können Sie sich wohl denken. Aber Sie müssen die baulichen Verhältnisse dieser Inseln erst kennen lernen, um diese Unmöglichkeit begreiflich zu finden.«
»Konnten Sie denn nicht mit Kanonen dazwischenschießen?«
»Um Jokondas Getreue zu töten? Nein, es ging nicht. Übrigens währte der Kampf nur kurze Zeit. Was noch lebte, wurde gefangengenommen, Jokonda schätzt sie auf wenigstens fünfzig Mann, welche jetzt in einem burgähnlichen Hause interniert sind. Vierzehn Mann konnten sich zu uns an Bord retten, zweiunddreißig Mann gelang es, in Booten noch unsere Insel zu erreichen. Nun haben die aber leider ihre Frauen und Kinder zurücklassen müssen.«
»Was für eine Insel ist das?«
»An der jetzt die ›Sturmbraut‹ verankert liegt, eine kleinere, auch mit Heiligtümern besetzt, in Büchsenschussweite von jener großen entfernt, auf der sich die Residenz befindet.«
»Was soll nun geschehen?«
»Jetzt gilt es, die Gefangenen aus den Händen der Malusos zu befreien.«
»Auf welche Weise?«
»Das ist erst noch zu beraten.«
Ich wusste nicht gleich, was ich sonst noch zu fragen hätte. Ja, doch, eins fiel mir ein.
»Warum liege ich hier eigentlich in der Koje?«
»Weil Sie krank sind.«
»Keine Spur davon«, sagte ich, sprang heraus, schlüpfte in Kleider und Stiefel und begab mich mit Tischkoff an Deck.
Die ›Sturmbraut‹ lag in der Ausbuchtung einer kleineren Insel, zwischen deren Bäumen ich altertümliche Bauten sah, welche hier aber von allem Schlingpflanzenwuchs und anderem Unkraut freigehalten worden waren.
Es gab im Umkreise noch andere Inselchen, auf denen solche Baulichkeiten zu erkennen waren, doch vor allen Dingen fesselte die Aufmerksamkeit eine sehr große Insel, auf der fast gar nichts von Vegetation zu bemerken war. Sie war vollständig mit Gebäuden bedeckt, und zwar mit altertümlichen, sich immer der Pyramidenform nähernd, jedoch viel stumpfer als die ägyptischen Pyramiden.
Lebhaft wurde ich etwas an das alte Babylon erinnert, so wenigstens hatte ich mir immer in meiner Phantasie solch eine Stadt aus uralten Zeiten vorgestellt, und da war ja zum Beispiel auch der Nimrodsturm, wenn auch in etwas kleinerem Maßstabe, immerhin alle anderen Gebäude weit überragend.
Doch die Blicke wurden zunächst von meiner Umgebung gefesselt.
Am Strande und zum Teil auch an Deck trieben sich braune, mehr ganz- als halbnackte Gestalten herum, welche, lebhaft gestikulierend, zusammen schwatzten, ihre Speere und Dolche drohend nach jener Inselstadt schwenkten, während unter anderen eitel Jammern und Wehklagen herrschten.
»Das sind die, welche sich gerettet haben«, erklärte Tischkoff, »aber viele sind in Sorge um ihre zurückgebliebenen Weiber und Kinder. Nun wollen Sie wohl zuerst Mister Rudyard Brooke kennen lernen?«
Er lag in einem Klappstuhl, in Decken gebettet, ein gereifter Jüngling, schon mit einem Flaum, ein edles Gesicht, die malaiische Abstammung verratend, während die blauen Augen von germanischer Treue und Tatkraft erzählten.
Lächelnd streckte er mir die Hand entgegen, und ich ergriff sie mit jener Ehrfurcht, die ich stets auch vor den Nachkommen großer Männer habe, und bei mir braucht ein großer Mann kein historisch bekannter Welteroberer zu sein. In meinen Augen war James Brooke, der durch seine Tatkraft und seinen Unternehmungsgeist sich sein eigenes kleines Königreich geschaffen hatte, ebenfalls ein großer Mann gewesen. Denn was für ein Stümper war ich planloser Abenteurer doch gegen diesen!
»Mister Tischkoff hat mir erzählt, dass Sie, Herr Kapitän Jansen, der eigentliche Kommandant dieses Schiffes sind, er nur Ihr beratender Freund ist, eigentlich nur Ihr Gast.«
Ich weiß nicht, was ich darauf Abwehrendes geantwortet habe.
»Doch, so ist es. Und Mister Tischkoff wiederum hat Ihnen schon alles über uns erzählt.«
»Ich glaube, alles zu wissen.«
»Aber über eins hat er Sie doch falsch unterrichtet.«
»Und das wäre?«
»Wir, Jokonda und ich, sollten entschlossen sein, das uns von den Engländern abgenommene Erbe unseres Vaters wiederzugewinnen.«
»So wurde mir erzählt.«
»Das ist nicht richtig. In dieser Ansicht wurden wir nur durch Mijnheer van Roch erzogen, diese Rachegedanken wurden uns eingeimpft; aber dann haben wir erkannt, dass diese englischen Unternehmer die Provinz Sarawat ganz rechtmäßig in Besitz genommen haben, es ist uns eine Abfindungssumme von zweimalhunderttausend Pfund gezahlt worden, und ob das nun zu wenig gewesen oder nicht — der, welcher für uns handeln durfte, hat den Kontrakt unterzeichnet — wir sind auf rechtmäßigem Wege abgefunden worden.«
»Wer hat denn dieses Geld bekommen?«, mischte sich da Karlemann ein, der sich ebenfalls eingefunden hatte.
»Das ist im Besitze des Sultans von Brunei, und wie ich unseren Großvater kenne, steht es jederzeit zu unserer Verfügung. Nein, etwas anderes ist es, was ich begehre.«
»Und was ist das?«, fragte ich wieder.
»Die Freiheit!«, war die lakonische Antwort.
»Enthält man die Ihnen denn vor?«
»Man tat es; jetzt kann man es nicht mehr.«
Träumerisch waren die blauen Augen in die Ferne gerichtet, und nach einer Weile erklang es ebenso träumerisch:
»Ich möchte so gern Baumeister werden.«
Für manchen mochte das kindlich, sogar lächerlich geklungen haben, nicht für mich, ich verstand diesen Jüngling.
Ihm genügte nicht, ein kleiner oder sogar großer König zu werden, er wollte hinaus ins Leben, um zu arbeiten, zu schaffen, und was er werden wollte, dazu hatte ihm der lange Anblick hier dieser alten Baudenkmäler die Anregung gegeben.
»Aber«, fuhr er energisch wieder fort, »ehe ich von hier gehe, müssen die Engländer mir doch noch etwas ausliefern, was sie meiner Schwester und mir von unserem tatsächlichen Erbe vorenthalten.«
»Was ist das?«
»Ich werde Ihnen später davon erzählen. Vor allen Dingen können wir diese Gegend doch nicht eher verlassen, als bis wir die Eingeborenen, die treu zu uns gehalten, befreit haben.«
»Wie ist das zu machen?«
»Ja, wie ist das zu machen?«, wiederholte er so träumerisch wie zuvor, während ich von ihm, der doch die Verhältnisse am besten kennen musste, einen Kriegsplan erwartet hatte.
Ich blickte nach jener Insel, wo sich zwischen den Gebäuden noch kleine Menschlein erkennen ließen, und musterte die Umgebung.
»Wir bombardieren einfach die Stadt.«
»Das darf nicht geschehen. Die unersetzlichen Bauten mit Inschriften müssen der Nachwelt erhalten bleiben«, mischte sich da zum ersten Male Tischkoff als Gelehrter ein.
»Und außerdem«, fügte Rudyard hinzu, »würden wir ja das Leben unserer Getreuen gefährden.«
»Wissen Sie nicht, wo diese gefangengehalten werden?«
»Nein, das weiß ich nicht, das kann überall sein, und eben wegen einer Beschießung werden sie von dem schlauen Roch überallhin verteilt worden sein, was er uns auch noch beizeiten mitteilen würde.«
»Ist die Insel reichlich mit Proviant versehen?«
»Sogar mit sehr wenig, die ganze Bevölkerung ist fast nur auf den Ertrag der Jagd angewiesen, und das Wild muss an den Küsten erbeutet werden.«
»So hungern wir die Insel einfach aus, und dass keine Kommunikation stattfindet, dafür können wir schon mit unseren vielen Booten sorgen.«
»Dann aber würden auch unsere Getreuen mit verhungern, und ich zweifle nicht daran, dass dieser Holländer, dessen Charakter ich erst in der letzten Zeit kennen lernen sollte, sie sogar als Schlachtvieh benutzen würde.«
»Na, da greifen wir eben die Insel im offenen Sturme an«, sagte ich ungeduldig, »trotz aller vergifteten Pfeile.«
»Auch dann würde man erst die Gefangenen töten. Nein, alles dies geht nicht.«
»Sie haben einen anderen Plan? So nennen Sie ihn doch!«
Der junge Mann blickte sich um. Es waren einige der Malaien in der Nähe, er streckte mit einer eigentümlichen Bewegung beide Arme seitwärts aus, und wer diese Geste gesehen hatte, machte den anderen darauf aufmerksam, bis sie alle verschwunden waren.
Meine Leute waren viel zu gut erzogen, als dass sie in Hörweite gewesen waren, wenn ich mich mit einem Fremden unterhielt, falls sie nicht wegen einer Arbeit dort sein mussten.
»Es ist etwa zwei Jahre her«, begann jetzt Rudyard ohne Umschweife zu erzählen. »Wir waren noch Kinder, Jokonda und ich, und so spielten wir eines Tages an der Nordküste jener großen Insel, dort, wo die alten Gebäude alle in Trümmern liegen, suchten nach kleinen steinernen Götzenbildern, die man hier manchmal findet. Plötzlich stieß Jokonda einen Schrei aus und verschwand vor meinen Blicken. Eine Lehmdecke, die wir für Stein gehalten, war unter ihren Füßen eingebrochen. Sie war nicht tief gestürzt, und sie beeilte sich auch nicht, wieder herauszukommen, sondern sie meldete mir, das sich dass Loch seitwärts fortsetze.
Auch ich stieg hinab, wir verfolgten den Tunnel bis an sein Ende. Dieses bestand in einer Steinplatte. Nach einigem Rütteln bemerkten wir, dass diese beweglich war, wir konnten sie beiseite schieben, und wir stiegen hinauf in einen finsteren Raum.
Aber wo wir uns nun eigentlich befanden, das sollte uns lange ein Rätsel bleiben; bis wir kleine Löcher entdeckten, durch die wir spähen konnten, und da kam uns zur Erkenntnis, dass wir uns im Innern des großen heiligen Elefanten befanden.
Die Malusos haben nicht nur lebendige, sondern auch steinerne Elefanten angebetet. Ein solcher steht im Elefantenturm, den ihr dort seht, von riesenhafter Größe, dreimal so groß wie ein natürlicher, aus schwarzem Stein gemeißelt, und Mijnheer van Roch hatte uns schon früher erzählt, dass in diesem Elefanten die zum Opfer bestimmten Menschen lebendig verbrannt wurden, wozu auch noch die Roste vorhanden sind, hatte uns die Klappvorrichtung gezeigt, durch welche der steinerne Elefant, bevor er glühend gemacht, mit Menschen beschickt wurde.
Diese Klappe konnten wir nicht von innen öffnen, wir mussten zurück. Es gab für uns auch noch etwas anderes zu entdecken. Von dem Haupttunnel zweigte noch ein zweiter ab. Als wir diesen verfolgten, kamen wir wieder an eine Steinwand, die mit Löcherchen durchsetzt war, und durch diese erblickten wir den eigentlichen Opferraum, die große Halle, in der der riesige Elefant aufgestellt ist. Diese Steinplatte vermochten wir nicht zur Seite zu bringen, aber für einige kräftige Männer muss es ein leichtes sein.
Wir hüteten diese Entdeckung als unser Geheimnis. Einmal macht es doch jedem Kinde Freude, irgendein Geheimnis, ein geheimes Versteck zu besitzen, und dann bekam dieser Tunnel für uns noch eine besondere Bedeutung.
Wiederholt benutzten wir ihn, aber immer sorgsam jede Spur bei der Ein- und Ausfahrt verwischend, eine Zeit wählend, da wir nicht vermisst wurden, und da haben wir in dieser heiligen Opferhalle oftmals Mijnheer van Roch beobachtet und belauscht, wie er sich mit seinem Freunde, dem Radscha Siuntala, der ihm hierher gefolgt ist, unterhielt, wie er ihm alle seine Pläne offenbarte, wobei auch dieser heilige Elefant mit Menschenopfern wieder zu Ehren kommen sollte.
Auf diese Weise sind wir in alle intriganten Pläne, die Roch mit den Malusos und hauptsächlich mit uns vorhatte, eingeweiht worden, und wenn wir noch oftmals in das Innere des steinernen Elefanten krochen, so geschah es auch deshalb, um uns zu überzeugen, ob nicht auch ohne unser Wissen der teuflische Holländer schon Menschen verbrannt habe. Doch wir haben niemals Knochen oder sonstige Überreste gefunden.
Und hier für uns nun ist die Hauptsache, dass wir ungesehen bis in das Innere der Stadt gelangen können, und da wird der Schreck ein so großer sein, dass niemand mehr an eine Gegenwehr denkt. Am besten freilich wäre, wenn wir zuvor auch noch erfahren könnten, wo die Gefangenen untergebracht sind, dass die zuerst befreit werden.«
Der junge Malaie mit dem germanischen Blute schwieg.
»Sonst weiß kein anderer Mensch von diesem Tunnel?«, fragte ich.
»Kein einziger.«
»Sind die Tore, welche die Heiligtümer abschließen, sehr stark, oder wie kann man sie überhaupt öffnen?«
»Es sind offene Tore ohne Türen.«
So vergewisserte ich mich noch über verschiedenes, und dann wurden sofort die Vorbereitungen zu unserer nächtlichen Expedition getroffen. — — —
Die Nacht war angebrochen, und der Mond ging erst früh um drei auf.
Es war eine wolkenbedeckte, daher stockfinstere Nacht. An der Küste der großen Insel flackerten überall Feuerchen auf, ein Zeichen, wie man dort auf der Hut war.
Es war gegen neun Uhr, als ich die vier größten unserer Boote ins Wasser ließ, auf der Seite, welche der Insel abgewandt war, denn auch wir mussten ja helle Lichter führen, um einen Angriff der Malusos rechtzeitig bemerken zu können. Wie die Schleichexpedition auszuführen sei, war schon reiflich besprochen worden. Rudyard konnte wegen seiner Wunde nicht mitkommen, Jokonda musste unsere Führerin sein, und dieses Mädchen hatte ja schon Mut und Umsicht genug bewiesen.
In die vier Boote gingen zwanzig meiner Jungen und ebensoviel Malaien oder Dajaks mit, die ausgesuchtesten Männer, während die anderen, Weiße wie Braune, zum Schutze des Schiffes zurückblieben, unter Tischkoffs Kommando, der wieder einmal für solch ein Abenteuer gar kein Interesse zeigte.
Die Boote stießen ab. Die Feuer auf der Insel gaben uns die Richtung an, mussten aber in weitem Bogen umfahren werden, da wir uns südlich von der Insel befanden, jene Stelle aber auf der Bordseite lag.
Nun kam es darauf an, ob auch dort die Küste bewacht würde. Ja, leider brannten auch dort drei Feuerchen, jedes etwa hundert Schritte von dem anderen entfernt, und Jokonda teilte mir mit, dass sich zwischen den beiden letzten, dem einen sogar ganz nahe, der Eingang zu dem Tunnel befände.
Noch einige Schläge mit den mit Tüchern umwickelten Rudern, und wir konnten an den Feuern auch menschliche Gestalten erkennen. Dass man die Boote von dort aus gewahren könne, daran war nicht zu denken, wir konnten sogar ziemlich dicht an die Küste heranfahren, aber immerhin waren jene beiden Wachtfeuer jetzt die größten Hindernisse für uns.
»Diese Wächter müssen sterben, es geht nicht anders«, sagte Jokonda, und dann wandte sie sich in malaiischer Sprache an einige ihrer braunen Gefährten.
Als hätten sie schon solch einen Befehl erwartet, zogen fünf von ihnen ihren Kris aus dem Gürtel, nahmen ihn zwischen die Zähne, glitten wie die Aale über Bord und waren in der Nacht verschwunden.
Ich war nicht wenig über diese Kürze verblüfft.
»Die werden diese Wächter tatsächlich in aller Stille abfertigen?«
»Der Tod wird über sie kommen wie der Engel in der Nacht. Es sind fünf Dajaks, die besten Kopfjäger, die treu zu mir gehalten haben, sie beschleichen jeden anderen ihresgleichen, und die wissen das Herz mit sicherem Stoß zu treffen.«
»Aber, Miss, wenn Sie so ausgezeichnete Krieger zur Verfügung haben, da brauchten Sie uns plumpe Seebären doch eigentlich gar nicht, um die Gefangenen zu befreien, überhaupt um dieser ganzen Sippschaft den Garaus zu machen, da können wir Ihnen und Ihren Leuten doch nur hinderlich sein.«
»Nicht doch. Nur weil diese Eingeborenen die ihnen in jeder Hinsicht überlegenen Europäer hinter sich oder vielmehr mit sich wissen, finden sie den Mut zu solch einem Unternehmen. Und den Tunnel dürfen sie überhaupt nicht betreten, mindestens nicht das Ziel erreichen, von wo sie erkennen, wo sie sich befinden, im Innern des Allerheiligsten; denn der religiöse Aberglaube ist ihnen doch schon zu sehr in Fleisch und Blut übergegangen, als dass sie da ein Eingreifen wagten, und eben deswegen sollen sie dann unter einigen wenigen Matrosen in den Booten zurückbleiben, während Sie und Ihre wackeren Leute mir nachfolgen, denn die müssen dann doch die Hauptsache ausführen.«
Dass die Malaien und Dajaks sämtlich als Bewachung des Bootes zurückbleiben sollten, das hatten wir tatsächlich schon ausgemacht, darauf hatten Jokonda wie Rudyard bestanden, ohne damals einen Grund dafür angegeben zu haben.
Ich blickte nach den Feuern. Die Wächter tauchten in dem roten Scheine auf und verschwanden wieder, sonst war nichts zu bemerken. Jokonda ließ die Boote noch etwas näher heranrudern, dann mussten sie stoppen.
So verging wohl eine Viertelstunde, ich ward immer unruhiger.
»Ob es ihnen auch glückt, die Wächter zu überrumpeln?«
»Ganz sicher. Ich kenne diese Leute, die ich dazu auserwählt habe.«
»Können sie nicht Krokodilen zum Opfer gefallen sein?«
»Krokodile vermeiden das kristallklare Wasser, wo sie keine Fische erbeuten können, sie würden verhungern. In diesem See gibt es keine... da, da, am rechten Feuer ist es geschehen!«
Ich hatte gerade nach diesem hingeblickt, und es war mir gewesen, als ob einer der Wächter mit Absicht seinen Arm dreimal vor dem Feuer hin und her bewegt hätte.
»Und jetzt ist auch an dem linken Feuer das Zeichen gegeben worden. Nun vorwärts, der Weg ist frei!«
Die Matrosen legten sich in die Riemen, kraftvoll, aber doch so vorsichtig wie möglich.
»Wenn diese Wächter nun abgelöst werden?«, fragte ich noch einmal zweifelnd.
»Meine Dajaks sind jetzt doch als Wächter am Feuer.«
»Ja eben, wenn nun die abgelöst werden sollen, und man findet andere daran, die man doch leicht als Ihre Getreuen erkennen wird?«
»Ah so, ich weiß, was Sie meinen, habe auch schon etwas von Militär gehört. Nein, solch eine militärische Ablösung gibt es hier nicht, und würden diese Dajaks dennoch besucht, so würden sie sich zu helfen wissen.«
Die Kiele der Boote knirschten auf Sand, wir hatten das Ufer erreicht, brauchten nur wenige Schritte noch durchs Wasser zu waten.
Als Landungsstelle hatten wir gerade die Mitte zwischen beiden Feuern gewählt, welche ja nun auch von unseren Leuten unterhalten werden mussten, doch reichte ihr Schein nicht bis zu uns, um auch nur die Konturen der Boote sichtbar zu machen, und das dritte, äußerste Feuer auf dieser Seite kam für uns überhaupt nicht in Betracht.
Wir waren an Land, außer Jokonda und mir noch achtzehn Mann, die zurückgebliebenen Malaien brachten die vier Boote unter Anleitung von zwei meiner Matrosen wieder mehr in den See hinein. Aber auch sie würden sich noch an einem Kampfe zu beteiligen haben, wenn es dazu kommen musste.
Es ging einige Schritte in die Stockfinsternis hinein, über Gras und Steine, einer an der Hand des anderen, Jokonda den Kopf dieser Schlange bildend. Dann blieb sie stehen.
»Hier ist die Öffnung«, flüsterte sie, »helfen Sie mir den Stein weg zu wälzen.«
Dazu genügte wohl die Kraft zweier Kinder, es mussten aber eben zwei Paar Hände sein, welche zugriffen.
Als ich in dem Erdloch stand, konnte ich noch mit dem Kopfe heraussehen, fühlte nur mit den Füßen unten die seitliche Öffnung, in der Jokonda bereits verschwunden war. Diese kleine Person brauchte sich vielleicht nur zu bücken, ich aber musste auf Händen und Knien kriechen.
Doch bald erhöhte sich der etwas abwärts führende Schacht wieder, auch ich konnte mich ziemlich aufrichten, und nachdem ich mich vergewissert, dass alle hinter mir waren, was militärisch durch Abzählen konstatiert wurde, setzten wir den Marsch fort, in dem unterirdischen Tunnel, der so schmal war, dass kaum zwei Personen nebeneinander gehen konnten.
Der Elefantenturm lag in der Mitte der ziemlich kreisrunden Insel, und da deren Durchmesser etwa zwei Kilometer betrug, hatten wir einen zu durchwandern, sodass wir bei dem langsamen Vorwärtskommen auf eine Viertelstunde zu rechnen hatten.
Während dieses Schleichweges musste ich mich nur immer wundern, wie die beiden halbwüchsigen Kinder damals den Mut gehabt hatten, gleich beim ersten Male diesen unterirdischen Tunnel bis an sein Ende zu verfolgen, ohne ein Licht bei sich zu haben, mit den Händen und Füßen tastend... doch alle diese Erwägungen vergingen mir, als ich vor mir in der Stockfinsternis plötzlich einen Lichtschein auftauchen sah.
Ich stieß gegen meine Führerin, sie war stehen geblieben und nicht minder überrascht als ich.
»Was ist denn das?«, flüsterte sie. »Die Opferhalle ist erleuchtet?«
Jetzt war mir auch die Eigenart dieses rötlichen Lichtscheins aufgefallen. Man konnte die Lichtquelle eher als eine viereckige, rotglühende Platte bezeichnen. Es war einfach die siebartig durchlöcherte Steinplatte, von welcher Rudyard mir erzählt hatte.
Und da auch ein Stimmengemurmel — und jetzt ein eintöniger Gesang.
»O weh, die Malusos sind hier zu einer feierlichen Handlung versammelt!«
»Desto besser, so haben wir sie gleich alle zusammen«, sagte ich und drängte meine Führerin vorwärts.
Wir hatten die Platte erreicht, konnten noch nebeneinander stehen und durch die ziemlich großen Löcher alles überblicken.
Ich sah eine weite Halle, mit Menschen gefüllt, festlich in bunte Seide gekleidet und mit Blumen geschmückt, den in der Mitte aufrecht stehenden, riesigen Elefanten umringend.
Wie mir Rudyard gesagt, war er mindestens dreimal so groß wie ein natürlicher, ausgewachsener Elefant, ich hätte ihn eher für aus Bronze gefertigt gehalten als aus Stein gemeißelt, denn es war doch ein großes Kunststück, den Rüssel, so dick er auch sein mochte, so wagerecht in die Luft ragen zu lassen.
Der geheime Eingang aus diesem Tunnel in sein Inneres sollte durch das rechte Hinterbein gehen, und dieses war ja nun allerdings dick genug, um selbst einen korpulenten Menschen durchzulassen.
Dann gab es noch einen anderen Eingang ins Innere, durch den weitgeöffneten Rachen, in dem auch die gewaltigen Stoßzähne nicht fehlten. Eine Art aus Holz gezimmerte Bockleiter führte hinauf.
Doch die Hauptsache, worüber wir alles andere vergaßen, war, dass diese schwarze Riesenfigur schon von züngelnden Flammen umspielt wurde, welche aus einem unter dem Leibe aufgestapelten Holzstoße emporschlugen.
»Um Gott, da sind schon Menschen drin, die lebendig geröstet werden sollen!!«, stöhnte neben mir Jokonda.
Ja, daran zweifelte auch ich nicht. Die ›religiöse‹ Zeremonie war schon weit vorgeschritten, die ›Gemeinde‹ betete und sang, dass der heilige Elefant, dieser moderne Moloch, das Opfer gnädig annehme, und ich sah an der Wand noch eine Menge von braunen Männern, Weibern und Kindern stehen, mit gebundenen Händen, von Kriegern bewacht, mit entsetzten Augen nach dem menschenfressenden Ungeheuer stierend — kurz, ich zweifelte nicht im Geringsten, dass sich im Innern des Molochs schon Menschen befanden.
»Hinaus, hinaus, vielleicht können wir sie noch retten!!«, schrie Jokonda, alle Vorsicht vergessend, und stemmte sich gegen die durchlöcherte Steinplatte, die kaum drei Zentimeter dick sein konnte.
Beobachtete ich jetzt auch nicht mit kaltem Blute, sodass ich alles genau beschreiben konnte, wie es hier aussah, so war doch mein Kopf mit einem Male ganz kalt geworden.
»Halten Sie ein, Miss!«, sagte ich, die Aufgeregte zurückziehend. »Wenn wir jetzt hier hervorbrechen, so wird die ganze Bande davonfliehen, Tore gibt es ja genug, und wir wären in derselben Lage, als wenn wir irgendwo an der Insel gelandet wären.«
»Aber die unglücklichen Gefangenen, die Gefangenen, die schon verbrennen!!«, jammerte Jokonda.
»So lassen Sie uns doch erst diese befreien, durch die Hintertür, die durch das Elefantenbein führt.«
Schon das plötzliche Nachlassen des Widerstandes verriet, dass sie gleich die Richtigkeit meines Vorschlages erkannt hatte.
»Wahrhaftig! Gut, gut, kommen Sie!«
Ich hielt sie noch einmal zurück, erteilte erst dem hinter mir befindlichen Mahlsdorf einige Instruktionen. Er sollte hier meinen Beobachtungsposten einnehmen, auf mein Zurückkommen warten — was sonst zu tun war, wenn sich irgend etwas in der Situation änderte, das freilich musste seiner eigenen Initiative überlassen bleiben, und Mahlsdorf war ja auch der Mann, der selbstständig handeln konnte.
Dann folgte ich meiner Führerin, ließ mich von ihrer Hand leiten, und wir hatten kaum die Reihe der uns folgenden passiert, als wir in einen Seitentunnel einschwenkten, es ging etwas tiefer hinab, dann wieder hinauf, und Jokonda blieb stehen.
»Hier müssen wir hinaufklettern.«
Ich bemerkte, dass sie einen senkrechten Schacht hinaufstieg.
Als ich einmal tastete, fühlte ich noch ihre Füße und außerdem in der sonst glatten Felswand eingeschnittene Kerbe.
Ich wartete einige Minuten, dann hielt ich für besser, ebenfalls empor zu klettern.
»Denken Sie sich, es ist gar niemand drin, der Steinboden fühlt sich auch noch gar nicht heiß an«, klang es mir da entgegen.
Nun, desto besser! Da wurde der Backofen eben, weil Stein doch ein gar schlechter Wärmeleiter ist, schon vorher ein bisschen angeheizt, damit man dann nicht so lange auf das knusprig gebratene Fleisch zu warten brauchte.
Jetzt wollte ich mir aber auch einmal das Innere dieses modernen Molochs ansehen.
»Kann ich hinaufkommen?«
»Kommen Sie nur, es ist ganz hell hier.«
Hierbei bemerke ich, dass wir wohl mehrere Laternen mit uns führten, auch ich meine eigene, sie aber vorsichtshalber noch nicht benutzt hatten.
Mich in einen Schornsteinfeger verwandelnd, war ich schnell oben, und ich sah zwei Lichtstrahlen wie weiße Streifen durch die Finsternis gehen. Sie gingen von den Augen des Elefanten aus, und wenn man sich erst daran gewöhnt, genügten sie vollständig, um seine Umgebung zu erkennen.
Von ›Umgebung‹ war freilich nicht viel die Rede. Der steinerne Dickhäuter hatte kein Herz, keine Lunge, keinen Magen, keine Eingeweide — es war einfach ein Hohlraum, und auch von Überbleibseln von Menschen, die hier früher lebendig oder tot verbrannt worden, war keine Spur zu bemerken, selbst die Asche musste ausgekehrt worden sein.
Zunächst konstatierte ich, dass der Boden zwar schon etwas warm war, aber von Hitze gar keine Rede. Dann wandte ich meine Aufmerksamkeit dem Elefanten zu, konnte mit Leichtigkeit an der Innenseite des Halses in den ungeheueren Kopf klettern, wobei ich bemerkte, dass der Rachen mit einer Platte verschlossen war, die hier nicht aus Stein bestand, sondern wohl aus Eisen, oder vielmehr, was ich aber erst später bei genauerer Untersuchung konstatierte, aus Bronze.
Der Elefant hat überhaupt kleine Augen, das war auch hier beibehalten, das Loch hatte nur einige Zoll im Durchmesser, was aber vollkommen genügte, um den ganzen vor mir liegenden Raum zu überblicken.
Es hatte sich unterdessen nicht viel geändert. In der Mitte standen ungefähr zwei Dutzend Weiber, mit Blumen geschmückt, um sie herum schritten in monotonem Gesange eine Reihe Männer, das andere Publikum brüllte immer den Refrain mit, welcher ›dschai dschai dschai‹ lautete, und in der Mitte dieser Weiber wieder stand auf einer altarähnlichen Erhöhung mein alter Freund Mijnheer van Roch, phantastisch herausgeputzt, und machte dazu mit den Händen segnende Bewegungen.
»Das sind gewiss die ersten Opfer, welche in dem glühenden Ofen verbrannt werden sollen«, meinte Jokonda, die sich neben mich gestellt hatte und durch das andere Auge spähte.
Sie selbst wusste ja gar nicht, was diese Zeremonien zu bedeuten hatten.
»Ja, das ist gewissermaßen die Vorbereitung zur Einsegnung der Konfirmanden«, entgegnete ich.
Weiter unterhielten wir uns während dieses Beobachtens über das, was nun zu tun sei.
Wir mussten eben zurück und gleichzeitig durch jenen Tunnel hervorbrechen. Was ich zuerst als ein großes Hindernis angesehen hatte, nämlich, dass hier in dieser Halle sehr viele Malusos versammelt waren, um das Gebäude herum wahrscheinlich das ganze Inselvolk, soweit es nicht Wache ging, zeigte sich bei näherer Betrachtung als ein großer Vorteil.
Für uns handelte es sich ja nur darum, die Gefangenen zu befreien, die unsertwegen dem Tode geweiht waren, und diese waren hier ja alle hübsch beisammen, die würden beim Anblick ihrer jungen Gebieterin sicher nicht fliehen, aber dass die anderen in heilloser Flucht davonstürzen würden, daran war doch gar kein Zweifel, wir konnten ja auch mit einigen blauen Bohnen nachhelfen, und dann wollten wir uns unter Jokondas Führung, da wir wohl kaum sämtlich den Tunnel zum Rückweg benutzen konnten, schnell nach dem Ufer durchgeschlagen haben, und dann konnte die ›Sturmbraut‹ sofort mit der Kanonade beginnen, und dass Tischkoff genau den richtigen Zeitpunkt traf, das war für mich doch ganz selbstverständlich.
So hatte ich mit Jokonda besprochen, während wir immer beobachteten, ohne dass sich dort unten etwas änderte.
»Nun wollen wir aber keine Zeit mehr verlieren«, sagte sie jetzt. »Wir müssen in der Halle sein, noch ehe der Ofen mit diesen Weibern gefüllt wird. Kommen Sie schnell!«
Auch ich rutschte wieder an dem Halse hinab. Zunächst befühlte ich einmal mit der Hand den Boden. Immer noch erst lauwarm, so wie die ganze Temperatur hier drin, noch ganz gut auszuhalten. Der Stein, wer weiß wie dick, musste sich doch recht schwer anheizen lassen. War er freilich erst einmal heiß, dann konnten die Brote schnell hintereinander gebacken werden.
Übrigens, nebenbei bemerkt, wenn ich nun einmal so ein Maluso wäre, oder überhaupt Freude an solcher Menschenrösterei hätte, ich würde meinen Moloch doch ganz anders konstruieren. Vor allen Dingen dürfte er nicht von Stein sein, sondern von Metall, das sich schnell erhitzt und schnell wieder abkühlt, und dann müsste man die schmorenden Opfer doch auch beobachten können, um sich an ihren Qualen...
Mein etwas merkwürdiger Gedankengang wurde durch einen leisen Schrei Jokondas unterbrochen.
»Um Gott, wir sind gefangen!«
»Was, gefangen?!«
»Der Ausgang ist verschlossen!«
Schnell war ich an Ort und Stelle und fühlte dort, wo des Elefanten hohles rechtes Hinterbein beginnen sollte, festen Boden.
Ich brannte meine Laterne an und sah denn auch richtig in die Öffnung eine bronzene Platte eingepasst, mit einer nur ganz geringen Fuge, ohne jede Handhabe.
»Haben Sie denn beim Heraufkommen die Klappe hinter sich zugemacht?«, fragte Jokonda.
»Ich habe überhaupt nichts von einer Klappe bemerkt. War denn eine vorhanden?«
Diese meine Frage war keine so dumme, zwecklose, wie ich sie durchaus nicht leiden kann. Es konnte ja jemand hinter uns gewesen sein, der den Deckel eingepasst hatte.
»Jawohl, eine solche ist vorhanden, die muss man eben aufstoßen.«
»Auf welche Weise?«
»An einem Handgriff.«
»Sie geht in Scharnieren, in Angeln?«
»Ja.«
»Wie oft haben Sie diesen hohlen Elefanten besucht?«
»Wenigstens ein Dutzend Mal.«
»Und diese Klappe ist niemals von allein zugefallen?«
»Niemals.«
»Dann könnte ich wirklich der schuldige Teil sein«, gestand ich jetzt.
Ich entsann mich nämlich, dass ich beim Verlassen des Loches mit dem Fuße an irgend etwas hängen geblieben war, es mit mir ziehend — aber an solch eine Klappfalle hatte ich doch nicht gedacht.
Doch darüber brauchten wir nicht zu disputieren, jetzt handelte es sich für uns darum, die Klappe wieder aufzubekommen.
Ich will nicht schildern, was für Anstrengungen ich machte, wie ich mit dem Messer arbeitete, um das vermaledeite Ding wieder in die Höhe zu bringen. Wie lange ich mich so abmühte, weiß ich nicht, mir fehlte jede Zeitbestimmung.
Und dabei brach bei mir der Schweiß aus allen Poren hervor, und es war nicht allein der sogenannte Angstschweiß.
»Jetzt wird der Boden heiß, fühlen Sie nur«, sagte Jokonda mit etwas heiserer Stimme.
Ja, ich merkte es schon, ich brauchte nicht erst zu fühlen.
Wir blickten uns im Scheine meiner Laterne an — ich sah ein ruhiges Mädchenantlitz, in dem noch nichts von Verzweiflung oder Todesangst zu erkennen war.
»Das ist eine nette Geschichte«, meinte ich.
»Wir müssen den Deckel aufbekommen, oder wir sind verloren!«
»Ich habe mein möglichstes getan.«
»Wir müssen, wir müssen!«
Aber sie selbst stürzte sich nicht auf die vermaledeite Platte, um mit den Fingernägeln daran zu kratzen, was vielleicht manch anderes Mädchen und Weib getan hätte, sondern sie überließ die sachgemäße Behandlung der widerspenstigen Platte mir.
Es war vergeblich. Und wir dampften. Schon ging die Hitze des Fußbodens durch die Schuhsohlen, auf den Knien liegen konnte ich nicht mehr.
»Dann muss der Ausweg durch den Rachen uns Rettung bringen.«
Hier an dieser hinteren Stelle war der Boden noch kühl zu nennen gewesen. Bei dem Wege nach dem Halse begann es brenzlig zu riechen — unsere Ledersohlen fingen schon an zu sengen. Der Hals dagegen war wieder kühler, noch mehr der Kopf. Das heißt, das galt nur von den Steinwänden, sonst hüllte uns hier oben erst recht ein heißer Brodem ein, die Luft war kaum noch atembar.
Dort unten ward noch immer getanzt und gesungen. Wir aber wollten die Augen des Elefanten nicht mehr zum Beobachten benutzen, sondern wir pressten unseren Mund an die Öffnung, damit wir wenigstens noch atmen konnten.
Was nützte es? Immer glühender ward die Atmosphäre, die unsere Körper umhüllte, ein russisches Heißluftbad war nichts mehr dagegen.
Nein, in einem Backofen zu verbrennen, der noch dazu die Gestalt eines Elefanten hatte, dieses Los hätte ich von meinem Schicksale denn doch nicht erwartet.
Dann untersuchte ich den Verschluss des Rachens, fand keinen Handgriff, und all mein Drücken und Stemmen war vergebens.
Wir mussten uns bemerkbar machen, um nur dieser Todesart zu entgehen, und so schrien wir aus Leibeskräften durch die Löcher. In diesem Augenblicke aber verwandelte sich der eintönige Gesang dort unten in ein Heulen, welches unser Rufen übertönte, und in diesem Heulen wollte keine einzige Pause eintreten.
Noch ein Mittel wusste ich, um den Malusos vielleicht begreiflich zu machen, dass sich in dem Backofen schon Menschen befanden. Ich zog den einen der beiden Revolver, die ich am Gürtel hängen hatte, setzte die Mündung gegen das Loch. Durchstecken konnte ich den Lauf nicht.
»Halt, halt, nicht schießen, wir werden dennoch gerettet!!«, schrie da Jokonda.
Ich zog den Revolver wieder zurück, brachte dafür das Auge an die Öffnung.
Die Ringelreihegesellschaft dort unten hatte sich aufgelöst, die Weiber waren gepackt worden, wurden nach dem Elefanten zu geschleppt, alles unter einem ohrenbetäubenden Lärm, und schon stieg als erster der Hohepriester, Mijnheer van Roch, die Stufen der Bockleiter empor.
Und was wollte er anderes als die Klappe des Rachens öffnen? Ich war bereit, ihn zu empfangen, in mir jauchzte alles. Wenn der Kerl nur nicht gar so langsam die Stufen emporgestiegen wäre, jeder Schritt wurde mir zur Ewigkeit, fühlte ich an meinem Leibe doch schon das ewige Höllenfeuer brennen, glaubte wirklich, dass auf der Haut schon Blasen entständen. Jetzt endlich hatte der alte Holländer mit dem mächtigen Turban die oberste Stufe erreicht, an der metallenen Platte knackerte es, sie öffnete sich...
Ich wollte ihn packen, aber es gelang mir nicht. Dass sich ihm aus dem glühenden Schlunde zwei Arme entgegenstreckten, die zu einem menschlichen Oberkörper gehörten, das ging dem alten Holländer doch über die Hutschnur, oder vielmehr über die Turbanschnur — er prallte zurück und purzelte hinab.
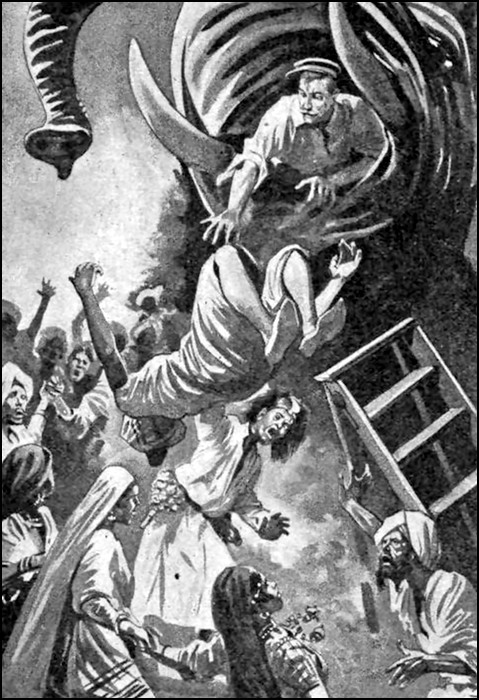
Und dann stand ich draußen an seiner Stelle, tief diese atembare Luft einsaugend. Und was für den Priester galt, das galt auch für die ganze Gemeinde.
Ein Moment Todesstille, erzeugt durch lähmendes Entsetzen, und dann ein einziger gellender Schrei.
»Albeteel, albeteel! — Der Teufel, der Teufel!«
Und alles stürzte in sinnloser Flucht den Ausgängen zu, an denen kein Mangel war, während gleichzeitig aus einer Seitenwand meine Jungen hervorbrachen, Mahlsdorf an der Spitze. Er hatte immer beobachtet, und als ich plötzlich aus dem Rachen des Elefanten dem Hohenpriester entgegengesprungen war, da hatte er gewusst, was es hier geschlagen, und er hatte mit einem Tritt seines Seestiefels die dünne Steinplatte in Trümmern gelegt.
Doch nicht alle waren geflohen. Die gefangenen Männer und Frauen waren vor Angst schon halbtot gewesen, und dann hatte ihnen die Erscheinung der mir sofort nachfolgenden Jokonda gesagt, dass es ein guter Teufel war, welcher dem feurigen Elefanten entstieg, der ihnen die Rettung bringen würde.
Was sich in den folgenden Stunden ereignete, kann ich nicht im Einzelnen schildern.
Eigentlich ereignete sich überhaupt gar nichts. Die Abteilungen, welche unter Fackelbeleuchtung die Straßen der alten Stadt durchstrichen, die Revolver in der Hand, erblickten keinen einzigen Menschen mehr, und die Mannschaft der Boote, welche sich uns bald zugesellte, auch von der ›Sturmbraut‹ aus, konnte uns Aufklärung geben.
Als die Malusos gesehen, dass sich die weißen Fremden schon innerhalb der Stadt befanden, hatten sie eben schleunigst die Insel verlassen, die wenigsten in ihren primitiven Booten, die meisten hatten sich einfach ins Wasser gestürzt, um die nächsten Inseln oder die Küste des umgebenden Festlandes schwimmend zu erreichen, auch die Weiber, die Kinder mitnehmend.
Wir fanden in derselben Nacht nur noch ein einziges, etwa einjähriges Kind, welches durch sein Schreien meine Jungen angelockt hatte.
Als sich am anderen Tage durchaus keiner der Malusos sehen lassen wollte, setzten wir das arme Wurm, ein kleines Mädchen, in ein Boot, ruderten dieses weit in den See hinaus und ließen es dort zurück, dafür sorgend, dass das Kind darin sichtbar war, und es dauerte auch gar nicht lange, so näherte sich hastig ein von zwei Eingeborenen gerudertes Boot, nahm jenes ins Schlepptau; die beiden verschwanden hinter einer Insel.
So war von dem ganzen ›Volke‹, welches hier auf dieser Insel aus mehr als tausend Köpfen bestanden haben sollte, nur der alte Holländer zurückgeblieben. Aber Mijnheer van Roch war tot. Er hatte sich beim Sturze von der hohen Treppe außer einem Beine auch das Genick gebrochen.
Wir verweilten zwei Wochen hier, nur Tischkoffs wegen, welcher die alten Bauten untersuchte, ihre Skulpturen und Inschriften abzeichnete, auf dieser Insel sowohl wie auf anderen.
Wir anderen hatten bald kein Interesse mehr für die alten Gebäude, in und an denen wir auch wirklich gar nichts Bemerkenswertes fanden, keine Särge mit Mumien und dergleichen. Manchmal ein kleines, steinernes Götzenbild, das wir uns als Andenken mitnehmen konnten, das war alles.
Dann lagen wir dem Fischfang und an der Küste der Jagd ob. Wohl floh manchmal vor uns ein aufgescheuchter Eingeborener davon, aber während dieser ganzen zwei Wochen wurden wir durch keinen einzigen Pfeil belästigt.
Nach diesen zwei Wochen traten wir auf der ›Sturmbraut‹ die Rückfahrt an, aber nach einer anderen Küste, unter Tischkoffs Führung einen anderen Weg wählend — jenen, der durch den Stromlauf des Palo gebildet wurde.
Die von uns befreiten Malaien und Dajaks wie auch jene, welche schon vorher geflohen waren, die also zu den Geschwistern gehalten hatten, wollten uns nicht begleiten.
Ich weiß nicht, was für lange Debatten da stattfanden, jedenfalls blieben sie zurück. Sie wollten sich wohl, Boote benutzend, eine neue Heimat suchen, wo sie vor der Rache ihrer ehemaligen Religionsgenossen sicher waren.
Viele Jahre später, als ich schon nicht mehr der Welt angehörte, erfuhr ich zufällig einmal, dass diese Ruinen der ehemaligen Ureinwohner Borneos das Ziel einer holländischen Forschungsexpedition geworden waren, aber von deren Erfolg hörte ich nichts, also auch nicht von dem ferneren Schicksale der Malusos, mit denen ich noch selbst Bekanntschaft gemacht hatte.
Hiermit wollen wir wieder einmal unseres Helden persönliche Erzählung verlassen und das Folgende aus anderen Berichten zusammenstellen.
Wir versetzen uns nach Bantang, der Hauptstadt der unter englischem Schutze stehenden Provinz Sarawak, am Ausfluss des Palo gelegen. Mr. Ephraim Jonas, der Direktor der AngloIndischen Antimonbergwerkgesellschaft, saß in seinem Privatkontor und zog in dem großen Hauptbuch die Jahresbilanz, und als er die Feder weglegte, konnte sich der alte Herr mit der Habichtsnase mit Recht schmunzelnd die hageren Hände reiben, denn der Reingewinn der Gesellschaft betrug in diesem Jahre mehr als 70 000 Pfund Sterling, und da der Herr Direktor außer seinem Gehalt von 8000 Pfund Sterling auch den vierten Teil der Aktien besaß, so fiel ihm natürlich auch der vierte Teil dieses Reingewinnes zu.
Nachdem Mr. Ephraim Jonas seiner Freude durch schmunzelndes Händereiben genügenden Ausdruck gegeben hatte, blickte er eine Zeit lang sinnend durch das Fenster, vor dem sein Schreibtisch stand.
Er konnte von hier aus ein gut Teil des Stromes überblicken, belebt von größeren und kleineren Fahrzeugen, Kähnen, welche stromabwärts das Antimonerz aus den höherliegenden Bergwerken nach den Schmelzhütten brachten, deren rauchende Schornsteine man noch sehen konnte, während eine Reihe leerer Kähne durch einen Dampfer wieder stromauf geschleppt wurden, und so zeigte sich überall ein geschäftiges Leben im Hauptlager dieser englischen Bergwerksgesellschaft, welche, durch großes Kapital und alle Hilfsmittel der modernsten Ingenieurwissenschaft unterstützt, die Ausbeute der Antimongruben noch auf einen ganz anderen Stand hatten bringen können, als dem einzelnen Privatmanne, James Brooke, mit seinen geringen Mitteln und Kenntnissen in diesem Geschäft früher möglich gewesen war.
Doch dieses geschäftige Bild konnte den Direktor nicht fesseln, das hatte er ja täglich vor seinen Augen, und nach dem englischen Kanonenboot, welches seit einigen Tagen im Hafen lag, um den Eingeborenen wieder einmal die englische Kriegsflagge und einige zehnzöllige Kanonenmündungen zu zeigen, blickte er gleich gar nicht.
Seine Augen waren nur sinnend geradeaus gerichtet, aber ideale Gedanken konnten ihn wohl schwerlich beschäftigen, denn der Blick dieser grauen Augen harmonierte ganz mit der geierähnlichen Nase wie überhaupt mit dem ganzen Raubvogelgesichte.
Die Folge dieses angestrengten Nachsinnens war, dass sich der Direktor erhob, und nachdem er das Hauptbuch im Panzerschrank verschlossen, ging er durch eine Seitentür in das benachbarte Zimmer.
Auch dieses enthielt viele Panzerschränke, wir wollen aber gleich verraten, dass ihr Inhalt nichts mit dem geschäftlichen Betriebe der Gesellschaft zu tun hatte.
Nachdem Jonas die schwere Tür hinter sich geschlossen und abgeriegelt hatte, öffnete er durch umständlichen Mechanismus einen der Panzerschränke, zog eine breite Schublade heraus, in der in verschiedenen Fächern eine Anzahl Dolche lagen, und auch manche Dame wäre beim Anblick dieser Waffen außer sich vor Entzücken geraten, oder ihre Augen hätten ebenso habgierig gefunkelt, wie jetzt die des Mr. Ephraim Jonas.
Denn es waren keine gewöhnlichen Dolche, mit denen man sich verteidigt oder vorsätzlich einen Menschen vom Leben zum Tode befördert — zum größten Teil waren Scheide und Griff mit Diamanten und anderen Edelsteinen besetzt, danach war auch das Metall, aus dem die ganze Waffe bestand, und war es doch einmal nur einfache Bronze oder etwas ähnliches, so zeigte es dafür eine wunderbare Arbeit, eine kunstvolle Ziselierung — Kunstwerke der indischen Handarbeit, wie wir sie in Europa mit all unseren Hilfsmitteln niemals nachahmen können.
Mr. Ephraim Jonas war nämlich ein Sammler von indischen Raritäten, speziell von Dolchen. Es gibt ja noch andere indische Raritäten und Kostbarkeiten, die von europäischen Handwerkern gar nicht nachzuahmen sind, abgesehen von ihrem historischen Werte, als da sind: Urnen, Vasen, seidene Tücher, viele Quadratmeter groß, die sich dennoch durch einen Fingerring ziehen lassen, und dergleichen mehr — Mr. Jonas aber hatte es einzig und allein auf indische Dolche abgesehen, die man auch wirklich noch als Dolche bezeichnen konnte. Eine Waffe, die von der Spitze der Scheide bis zum äußersten Ende des Griffes länger als neun ein viertel Zoll war, wurde von ihm schon zu den Halbschwertern gerechnet und konnte daher sein Verlangen nicht mehr reizen, und wenn der um einen viertel Zoll längere Dolch auch ein Wunderwerk der indischen Goldschmiede- und Juwelierkunst gewesen und von dem König Ikshvaku, Buddhas Vater, nachgewiesenermaßen selbst im Gürtel getragen worden wäre.
In dieser Hinsicht war Mr. Ephraim Jonas ein echter Engländer, dessen Gründlichkeit keine Grenzen kennt. Der Deutsche ist in der ganzen Welt wegen seiner Gründlichkeit bekannt, aber mit dem Engländer kann er sich da doch bei Weitem nicht messen.
Für die englische Gründlichkeit gibt der Professor Maximus Powl, der berühmte englische Zoologe, ein hübsches Beispiel, der in den achtziger Jahren nach Hinterindien ging, um dort die Sippschaft der Wanzen zu studieren, Bettwanzen, Tierwanzen, Baumwanzen und was für Wanzen es sonst noch gibt. Zwei Jahre hat er dazu gebraucht, dann kehrte er mit seinen an Insektennadeln gespießten Wanzen nach England zurück, um in seinem Heim seine Jagdbeute zu ordnen, zu untersuchen, zu klassifizieren und dann darüber ein tatsächlich epochemachendes, dickes Wanzenbuch zu schreiben, und nachdem dies geschehen war, ging er wieder für einige Jahre nach Hinterindien, um diesmal dieselbe Untersuchung auf... die dort vorkommenden Flöhe zu erstrecken, Menschenflöhe, Hundeflöhe, andere Tierflöhe, Vogelflöhe.
Nun fragt man einen Menschen: konnte dieser englische Gelehrte das Sammeln der Wanzen nicht gleich mit der Jagd auf Flöhe verbinden?
Nein, das konnte er eben nicht, da hätte er zerstreut werden können, nur immer hübsch eins nach dem anderen, nur immer so gründlich wie möglich.
Doch wir wollen das lieber nicht Gründlichkeit, sondern Pedanterie nennen, und die Ehre der größten Gründlichkeit bleibt auf allen Gebieten dennoch der deutschen Nation gelassen.
Mr. Ephraim Jonas also hatte seinen ganzen Sammeleifer auf indische Dolche konzentriert, die nicht länger sein durften als neun ein viertel Zoll; wurde ihm einer angeboten, der dieses Maß nur um eine Viertellinie überschritt, so wies er ihn zurück, wollte ihn nicht geschenkt haben, und wenn er auch ein großes Vermögen repräsentiert hätte — d. h. nicht für seine Sammlung, sonst hätte dieser Mann mit der Geiernase ihn schon angenommen, um ihn zu verkaufen, um die für seine Sammlung zu große Waffe bei Gelegenheit gegen eine kleinere einzutauschen, und deshalb natürlich nahm Jonas auch alles, was er sonst bekommen konnte, und dann natürlich am liebsten geschenkt.
Es ist gar nicht leicht, derartige orientalische Sachen zu bekommen. Ob nun Dolche oder Vasen oder Teppiche oder Schmuckgegenstände — da handelt es sich doch gewöhnlich, besonders wenn sie kostbar sind, um Heiligtümer oder doch um heilig gehaltene Familienerbstücke.
Im britischen Museum kann man zahllose solche indischen Kostbarkeiten anstaunen, da erkennt man, was für ein ungeheuerer Reichtum in diesem Indien doch gesteckt haben muss, wie er noch heute drin steckt; das berühmteste Schaustück ist der ›Tiger von Lahore‹, in Lebensgröße ganz aus bunten Edelsteinen zusammengesetzt, einfach unschätzbar, ebenso wie der Thronsessel des Maharadschas von Nagpur, diese Pracht spottet aller Beschreibung; und was sich dann sonst noch an indischen Wertobjekten in englischem Privatbesitz befindet, das entzieht sich ja der Kenntnis. Denn ein echter Sammler zeigt doch seine Schätze niemandem, spricht gar nicht davon; sie betrachten zu können, das Bewusstsein, sie ganz allein zu besitzen, sich ganz allein an ihrem Anblick weiden zu können, das ist ja eben das undefinierbare Glücksempfinden des echten Sammlers, worin er ganz dem Geizhals gleicht, der er auch gewöhnlich ist.
Diese Schätze sind zusammengeräubert worden, als England von Indien Besitz nahm, zunächst durch die ostindische Kompanie, ein Privatunternehmen, nur von der Regierung sanktioniert, und wenn auch dann noch später Gewalt immer vor Recht ging, alles Kostbare den schwachen Eingeborenen einfach weggenommen wurde, so geht das heute doch nicht mehr so ohne Weiteres.
Indische Tempelheiligtümer sind heutzutage überhaupt nicht mehr zu haben. Und reizt einen der Besitz einer kostbaren Waffe, einer seltenen Vase, eines Teppichs oder einer sonstigen Rarität, so muss man den betreffenden Gegenstand dem Eigentümer eben abkaufen.
Nun sind aber solche Sachen, doch meist Familienerbstücke, im Allgemeinen meist nicht käuflich zu haben. Und wird eine indische Familie durch Not dazu getrieben, solch ein altes Erbstück zu verkaufen, dann wendet sich die Familie doch lieber an einen reichen Inder, der vielleicht noch einen ganz anderen Preis zahlen kann, als dem reichsten Europäer möglich wäre, und wobei der in Not Geratene vielleicht noch die Möglichkeit hat, das alte Heiligtum später wieder einmal zurückzukaufen, was es bei einem Sammler nicht gibt.
Infolge dieser Schwierigkeiten ist in Indien wie im ganzen Orient ein förmliches Gewerbe entstanden, nämlich von professionellen Dieben, die es einzig und allein auf solche alte Raritäten abgesehen haben. Es ist natürlich das charakterloseste Gesindel, religions- und vaterlandslos, Verräter an den eigenen Stammesgenossen; sie visitieren auch die ärmlichsten Hütten, ob sie nicht ein altes Familienstück enthalten, in den Palästen der Reichen schmuggeln sie sich als Diener ein, um dann bei Gelegenheit mit einem sorgsam gehüteten Familienstück zu verschwinden, welches sie an Sammler oder deren Agenten verkaufen, weit unter dem eigentlichen Werte, wenn auch nicht gerade zu Schleuderpreisen, da diese Leute doch schon immer etwas von Antiquitäten verstehen.
Also fast nur noch auf diese Weise kann heute der Sammler in den Besitz solcher indischer Raritäten und Kleinodien kommen. Aber auch das hat noch einen bösen Haken.
Nach englischem Recht und Gesetz hat der Käufer eines gestohlenen Gegenstandes, wenn er nicht etwa gar als Hehler entlarvt wird, diesen dem rechtmäßigen Eigentümer, der sich als solcher legitimieren kann, zu demselben Preise zurückzugeben, den er der letzten Hand, aus der er den gestohlenen Gegenstand empfangen, gezahlt hat.
Es ist ja nun allerdings gerade hierbei sehr schwer, den Dieb zu ermitteln, solch ein gestohlenes Kleinod geht doch gleich hinaus aus Indien, hinwiederum wissen auch die Inder, wo sie das vermisste Eigentum zu suchen haben, es kommen so ziemlich immer dieselben Sammler in Betracht, und da es sich nun solch ein reicher Radscha ein gutes Stück Geld kosten lässt, vielleicht die Hälfte seines Vermögens opfert, bloß um den gegenwärtigen Eigentümer von etwa nur einer Tonurne ausfindig zu machen, und da arme Kulis dabei durch Sammlungen unterstützt werden, so hat schon mancher Sammler ein Objekt wieder herausrücken müssen, an dessen Anblick er sich bereits seit Jahren in stillen Stunden geweidet hat. —
Mr. Ephraim Jonas war früher Bergwerksbeamter in England gewesen. Er hatte einen hochbezahlten Posten verlassen und war nach Indien gegangen, nur um der Quelle nahe zu sein, aus der er seine Dolchsammlung vermehren konnte.
Denn diese Sammelwut grenzte bei ihm schon mehr an Wahnsinn. Nur um diese Sucht befriedigen zu können, hatte er nicht geheiratet, deshalb war er zum schmutzigen Geizhals geworden, der sich keinen Diener hielt, sich das Essen vom Munde absparte, der tatsächlich mit der Seife knauserte, denn der Penny, den er für ein Stück Seife ausgab, mochte ihm ja gerade an der Summe fehlen, mit der er einen wertvollen Dolch kaufen konnte.
Andererseits hatte diese Sammelleidenschaft ihn dazu angetrieben, alle seine Fähigkeiten bis zum höchsten Grade zu entwickeln, um dadurch wieder so viel Geld wie möglich zu verdienen, nur dadurch hatte er sich von einem kleinen Bergbeamten bis zum Direktor einer großen Aktiengesellschaft emporgeschwungen, der jetzt über ein Einkommen von fast einer halben Million verfügte.
Diese seine Liebhaberei für kleine Dolche war in der ganzen Welt bekannt, d. h., bei allen denen, die sich eben für so etwas interessieren, also zunächst bei Sammlern. Wer keine indischen Dolche sammelte oder einen überflüssigen hatte, der schickte ihn nach Bantang an Mr. Ephraim Jonas, der zahlte den höchsten Preis dafür, da kannte er keinen Geiz mehr, sondern wurde zum sinnlosen Verschwender.
Aber auch andere kamen zu ihm, Eingeborene, welche von der Not getrieben wurden, eine durch Edelsteine oder historisches Alter wertvolle Familienwaffe zu veräußern, denn der Bergwerksdirektor zahlte vielleicht doch mehr dafür als ein einheimischer Fürst, und dann noch mehr solche Eingeborene, welche eine derartige Reliquie gestohlen hatten.
Wie viele solcher gestohlenen Dolche Mr. Jonas in seiner Sammlung besaß, war natürlich nicht bekannt. Er zeigte sie ja niemandem.
Aber zweimal war er in den Verdacht gekommen, einen solchen gekauft zu haben. Die erste Behauptung hatte ein malaiischer Fürst erhoben, die zweite ein armer Kuli, dem ein uraltes Messer verschwunden war, und als Mr. Jonas ableugnete, waren beide zum Richter gegangen.
Auch in Bantang war eine englische Gerichtsbarkeit, ganz unabhängig von der Aktiengesellschaft, wenn diese auch sonst hier allmächtig war. Die beiden waren also zu diesem Richter gegangen, bezeichneten den Bergwerksdirektor als denjenigen, der die ihnen gestohlenen Waffen dem Diebe abgekauft hätte. Wer der Dieb sei, das konnten sie freilich nicht angeben, ihre Behauptungen stützten sich schließlich nur auf Vermutungen.
Gleiches Recht für alle! Das heißt, so sagt man, nur der Schein muss immer gewahrt werden. Die Klagen der beiden Eingeborenen wurden angenommen, von dem armen Kuli so gut, wie von dem mächtigen Reichen, der Herr Bergwerksdirektor wurde gerichtlicherseits ins Verhör genommen.
Bei einem anderen wäre einfach eine Haussuchung abgehalten worden, wie es die beiden Eingeborenen auch verlangten. Aber das ging doch bei dem Herrn Bergwerksdirektor nicht, dem England gar so viel verdankte, weil er auf dem Festlande von Borneo die erste englische Flagge aufgepflanzt hatte.
Mr. Ephraim Jonas beschwor, die beiden ganz deutlich beschriebenen Waffen niemals gesehen, also sie auch nicht in seinem Besitze zu haben, und damit war die Sache erledigt. Und als die beiden abgewiesenen Kläger ihn des Meineides bezichtigten, wurden sie hart bestraft.
Dann schwor Mr. Jonas auch noch einmal in einem ganz ähnlichen Falle, nur dass es sich da nicht gerade um einen Dolch handelte.
Er kaufte ja bei Gelegenheit auch noch andere Sachen, die ihm angeboten wurden, indische Teppiche, Urnen, auch große Dolche, Schwerter und dergleichen, für deren Wert er ein ebenso großes Verständnis hatte, nur dass er sie nicht sammelte, sondern diese billig erworbenen Gegenstände dann weiter an Liebhaber verkaufte oder sie gegen Dolche vertauschte.
Noch nachträglich zu erwähnen ist, dass Jonas schon unter James Brooke der erste Beamte, der Direktor dieser Antimonbergwerke gewesen war. Brooke, der ja nur ein tatkräftiger Abenteurer war, sonst keine Kenntnisse im Bergbau besaß, hatte ihn aus Ostindien geholt, wo Jonas damals in einem Kupferbergwerk angestellt gewesen war, hatte dem tüchtigen Ingenieur und Geschäftsmann ein Gehalt gegeben, das von dem jetzigen nur wenig übertroffen wurde; oder hatte ihn an dem ganzen Unternehmen partizipieren lassen, und mit Recht hatte Brooke sein ganzes Vertrauen in diesen Mann gesetzt, denn dessen eigentliches Verdienst war es gewesen, dass das ganze Unternehmen, soweit es die geschäftliche Seite betraf, zu solch hoher Blüte gekommen war.
Vor fünf Jahren war die Gattin James Brookes gestorben. Er hatte also eine Tochter des Sultans von Brunei geheiratet. Als ihre Hinterlassenschaft geordnet wurde, meist aus Schmucksachen bestehend, die sie als Mitgift mitbekommen hatte, alte Familienstücke, wurde ein Diamanthalsband von unschätzbarem Werte vermisst.
Die Aufregung war groß. Niemand konnte sagen, wann Suleika es zum letzten Male getragen hatte, oder alle Behauptungen widersprachen sich.
Der Verdacht musste sich auf die Dienerschaft lenken, ganz besonders auf die Amme der Sultanin, eine alte Malaiin, welche die sämtlichen Schmucksachen unter sich gehabt hatte.
Sie leugnete — selbstverständlich. In Brookes Abwesenheit ließ Jonas, der der Wiederherbeischaffung des Halsbandes all seine freie Zeit widmete, die alte Frau peitschen, foltern, um von ihr ein Geständnis zu erzwingen; denn er war gar zu fest von ihrer Schuld überzeugt.
Unter den Qualen der Folter gestand die alte Sotinja denn auch ein, das Halsband gestohlen zu haben. Sie hätte es im Parke vergraben, an einer Stelle, die sie genau bezeichnen konnte.
Dieses Geständnis aber rettete nicht ihr Leben, noch in derselben Stunde erlag die alte Frau den Wirkungen der Tortur.
Es wurde an jener Stelle nachgegraben, man fand tatsächlich das Kästchen aus kostbarem Holze, aber das noch wertvollere Halsband war nicht darin.
Nun ging wieder die Untersuchung los, bis James Brooke selbst das Zeitliche segnete.
Er hätte sich, wie man zu sagen pflegt, wohl im Grabe umgedreht, hätte er gewusst, wie Jonas, auf dessen Treue er bei Lebzeiten geschworen, jetzt sein Möglichstes tat, um den Kindern seines Herrn das Erbe zu entreißen. Er war es, der mit Mijnheer van Roch verhandelte, wonach das ganze Bergwerksunternehmen eine englische Aktiengesellschaft wurde, nachdem man die Kinder mit einer lächerlich kleinen Summe abgefunden hatte.
Bald darauf erhob der Sultan von Brunei die gerichtliche Klage gegen ihn, dass er selbst, Ephraim Jonas, damals das Halsband seiner Tochter entwendet habe. Ein Malaie, der damals in des Direktors Diensten gestanden, habe auf dem Sterbebette gebeichtet, er sei heimlicher Zeuge gewesen, wie Jonas die schon auf der Folterbank liegende Sotinja überredet habe, sie solle doch, um ihr Leben zu retten, irgendeine Angabe machen, wo sie das gestohlene Halsband vergraben habe, nur um erst einmal Zeit zu gewinnen.
Die Malaiin sei in ihrer Todesangst wohl darauf eingegangen, und da man nun an jener Stelle, die ihr Jonas erst vorgeschrieben, auch wirklich wenigstens das Kästchen fand, so müsse doch also auch Jonas selbst der Entnehmer des Halsbandes sein. Der Malaie habe teils aus Furcht vor dem allmächtigen Manne, teils aus einem alten Hasse gegen das ganze Sultansgeschlecht von Brunei bisher keine Anzeige gemacht, erst in der Todesstunde sei ihm die Reue über seine Verschwiegenheit gekommen.
Jonas wies diese Anklage entrüstet zurück. Nein, gerade umgekehrt, dieser Malaie hatte immer einen Hass gegen ihn gehabt, noch auf seinem Sterbebette hatte er ihm, wie man sagt, eins auswischen wollen.
Und der tadellose Ehrenmann beschwor, von der Entwendung des Halsbandes nichts zu wissen, dass ihm Sotinja jenes Geständnis damals freiwillig gemacht habe, und damit war die ganze Angelegenheit erledigt.
So sehen wir jetzt den Herrn Direktor vor einem geöffneten Panzerschranke stehen und eine Serie seiner Sammlung mit entzückten Augen betrachten, und nicht nur das, sondern er nahm einen Dolch nach dem anderen, streichelte ihn zärtlich und drückte ihn inbrünstig gegen seine Lippen.
Wer nicht selbst leidenschaftlicher Sammler ist, versteht ja so etwas gar nicht. Mit dem Kusse der Geliebten lässt sich das nicht vergleichen. Mr. Ephraim Jonas war ein äußerst fleißiger Mann, er arbeitete bis zur Erschöpfung, und die zeitweilige Besichtigung seiner Sammlung bedeutete für ihn dieselbe geistige Erfrischung, wie wenn etwa ein genialer, selbstdenkender Gelehrter, der aber aus materieller Not am Schreibtisch mechanische Frondienste leisten muss, ab und zu nach einem philosophischen Werke greift, das seine Lieblingslektüre bildet.
Plötzlich stutzte der Direktor, lauschte.
Drüben in sein Privatkontor war jemand eingetreten, ganz auffällig geräuschvoll.
Und sein Stutzen verwandelte sich in Schreck, als jetzt heftig gegen die Tür gepocht wurde.
Eine ganz blasse Nase bekommend, warf Jonas den Panzerschrank zu und öffnete die Zimmertür.
Es war sein Sekretär, der so ungestüm Einlass begehrte.
»Mister Hudley, was fällt Ihnen denn... ja, Mensch, was ist Ihnen denn?«
Der Sekretär war wirklich ganz verstört.
»Herr Direktor, ein Schiff kommt den Strom herab, ein großes Schiff!«
Zunächst starrte Jonas den Sprecher verständnislos an.
»Sie meinen wohl, es kommt mit der Flut herab, in den Strom herein.«
»Nein, es dampft den Strom herab, kommt aus dem Innern des Landes — ein großes Schiff mit voller Takelage.«
Noch immer starrte Jonas den Sprecher fassungslos an.
»Das ist gar nicht denkbar...«
Er eilte an dem Sekretär vorbei, sprang ans Fenster.
Ja, da kam wirklich den Strom herab ein großer Dreimaster mit voller Takelage, auch mit einer Maschine ausgerüstet, denn aus dem Schlote wirbelten Rauchwolken empor.
»Die ›Anna Maria‹«, hauchte der Direktor mit farblosen Lippen, »nein, die ›Sturmbraut‹, die vor vier Wochen in den Pontianak eingelaufen ist!!«
Denn jener ungeheuerliche Vorfall mit dem Schiffe, das sich dann als die berüchtigte ›Sturmbraut‹ zu erkennen gab, war auch schon hier bekannt geworden; Schiffe hatten die Nachricht davon hergebracht, es stand ja schon in allen Zeitungen, und der Direktor brauchte gar keine so große Kombinationsgabe zu besitzen, brauchte die ›Sturmbraut‹ noch gar nicht gesehen zu haben, um sofort zu wissen, dass dieses Schiff kein anderes sein könne, als jene ›Sturmbraut‹, die damals von Westen her in das Innere Borneos eingedrungen war.
»Ja, wie kann sie aber da hier auf dem Palo wieder herauskommen?!!«
»Herr Direktor, das ist der Seeräuberkapitän Richard Jansen!«, stöhnte der Sekretär, dem das Herz wohl überhaupt sehr leicht herunterrutschte.
Diese Bemerkung brachte den Direktor zunächst auf andere Gedanken, die nichts mit dem Ergründen von geografischen Rätseln zu tun hatten.
Sein Gesicht nahm einen lauernden Ausdruck an, die lange Habichtsnase ward noch länger, als er sich wieder die knöchernen Hände rieb.
»Kapitän Richard Jansen, hm«, brummte er, dabei starr nach dem stattlichen Schiffe blickend. »Viermalhunderttausend Pfund stehen auf seine lebendige Ergreifung — fünfzigtausend Pfund erhält der, der ihn nur tötet — hm — fünfzigtausend Pfund Sterling — dann könnte ich mir gleich den Dolch des Maharadscha...«
Seine ihm wohl sehr angenehmen Betrachtungen wurden durch polternde Schritte unterbrochen, die ihn emporschrecken ließen.
»Was ist das?!«
Er sollte es gleich erfahren. Ein Herr stürzte herein, ein Büroschreiber.
»Herr Direktor, retten Sie sich, der Seeräuberkapitän Richard Jansen...«
Der Mann ward von einer vorläufig noch unsichtbaren Faust zurückgerissen, der Direktor blickte nach der zweiten Tür, die nach seinem Allerheiligsten führte, duckte sich zum Sprunge, kam aber nicht dazu, ihn auszuführen. Schon traten vier Männer ein, vierschrötige Matrosen, was man ihnen gleich an den Teerjacken ansah, geführt von einem fünften, und wir wollen gleich verraten, dass es Mahlsdorf war.
»Mister Ephraim Jonas, der Direktor vom Janzen? Jawohl, das sind Sie, Ihre Geierphysiognomie ist mir zur Genüge beschrieben worden, und die können Sie nicht verleugnen. Mann, bleiben Sie stehen, denken Sie nicht etwa an Flucht!«
Nein, der Direktor konnte gar nicht daran denken, weil es hier nur zwei Türen gab und jenes andere Zimmer gar keinen weiteren Ausgang besaß.
Aber man ist nicht umsonst Bergwerksdirektor in einem noch ziemlich wilden Lande. Mr. Ephraim Jonas ließ sich nicht so leicht ins Bockshorn jagen.
Sofort hatte er sich wieder gefasst. Seinen Revolver zog er noch nicht, hätte ihn aber in einem Moment schussbereit in der Hand haben können.
»Was wollen Sie? Wer sind Sie, dass Sie hier so einzudringen wagen?«
»Ich bin der erste Steuermann der ›Sturmbraut‹...«
»Was? Der ›Sturmbraut‹?«
»Jawohl, die Sie doch recht gut kennen — und der Kapitän der ›Sturmbraut‹, den Sie doch ebenso gut kennen, Richard Jansen ist sein Name, ladet Sie höflichst zu sich an Bord ein.«
Es war allein die Überlegenheit, die in diesen Worten lag, welche dem Direktor sagte, dass hier aller Widerstand vergeblich sei.
Etwas freilich musste er sich doch noch sträuben, das verlangte die ganze Situation.
»Sie sind wohl verrückt!«
»Was?! Hören Sie, vorläufig bin ich noch höflich! Also bitte, folgen Sie mir!«
»Was will der Kapitän von mir?«
»Das werden Sie von ihm selbst erfahren. Na, wollen Sie nun kommen?«
»Ich stehe unter dem Schutze eines englischen Kanonen...«
»Diesem englischen Kanonenboot haben wir bereits zusignalisiert, dass es sich nicht muckst, und es liegt wie ein Mäuschen vor der Katze da. Sie wissen doch, wer wir sind? Nun lade ich Sie aber nicht mehr ein — Jochen, Konrad, henkelt den Herrn Direktor unter die Arme, der alte Herr scheint etwas schwach auf den Beinen zu sein.«
Zwei Matrosen traten vor. Als sie die Hände ausstreckten, um ihn zu fassen, hätte der Direktor noch immer Zeit gehabt, seinen Revolver zu ziehen; aber er tat es nicht, er wollte sich lieber auf seine geistigen Kräfte verlassen, die ihn noch immer auch in den gefährlichsten Situationen, die in diesen Gegenden ja oft genug vorkamen, herausgeholfen hatten.
So ließ er sich unter die Arme nehmen, und die Matrosenfäuste ergriffen auch noch zärtlich seine Hände.
Zunächst ging Mahlsdorf nach der anderen Tür, öffnete sie, blickte in das Zimmer, welches die vielen Panzerschränke enthielt, nickte zufrieden.
»Alles so, wie es mir beschrieben wurde. Karl, du stellst dich hier auf, zieh dein Käsemesser, und du, Moritz, hältst hier Wache! Niemand hat mehr diese Zimmer zu betreten. Verstanden?«, wandte er sich an den Sekretär. »Sagen Sie es Ihren Kollegen. Wer hier eintritt, wird niedergehauen, und wenn ich diese beiden Matrosen dann verletzt vorfinde, oder etwa eingeschlafen, dann wird ganz Bantang zusammenkartätscht. Verstanden? Na, was werden Sie denn auf einmal so käseweiß?«
Diese letzten Worte hatte er an den Direktor gerichtet. Ja, als dieser gesehen, wie Mahlsdorf nach jener Tür gegangen war, in sein Heiligtum geblickt hatte, da war er wirklich todblass geworden, ein Zittern ging durch seine Glieder, er hatte einen krampfhaften Versuch gemacht, seine Arme freizubekommen, jetzt hätte er wohl Gebrauch von seinem Revolver gemacht — freilich hatten die herkulischen Matrosen von diesem Versuche einer Befreiung fast gar nichts verspürt.
»Das ist Hausfriedensbruch!«, stöhnte er.
»Hausfriedensbruch? O nein, das ist noch etwas ganz anderes. Mit solchen Kleinigkeiten wie Hausfriedensbruch geben wir uns gar nicht erst ab.«
»Ihr wollt mir meine kostbare Sammlung rauben!«, ächzte Mr. Jonas.
»Rauben nicht, vielleicht nur einmal besichtigen. Doch nun genug der Worte! Kehrt! Ohne Tritt — marsch!«
Der Direktor ward hinausgeführt, durch den Saal, in welchem viele Schreiber standen und saßen, sich in noch gar nichts finden könnend, jedenfalls aber auch nicht an einen Befreiungsversuch denkend; es ging die Treppe hinab, durch den Hof, über die Straße an den Strand, wo ein Boot von der ›Sturmbraut‹ wartete.
Diese lag mitten im Strome verankert, sämtliche Kanonen waren ausgefahren worden, überall schauten aus den Stückpforten drohend die respektablen Mündungen hervor, auch nach dem einen Kilometer weiter stromab im Hafen liegenden Kanonenboot, auf welchem dieselbe Ruhe herrschte wie in der ganzen Stadt. Denn Kapitän Jansen hatte unterdessen schon Befehle gegeben, sie öffentlich bekannt gemacht. Jeder Widerstand, jede drohende Bewegung oder auch nur Miene dazu ward sofort mit Kanonenschüssen vergolten.
Während der Bootsfahrt noch visitierte Mahlsdorf des noch immer Festgehaltenen Taschen, brachte einen Revolver zum Vorschein.
»Haben Sie sonst noch Waffen bei sich?«
»Nein!«
»Wirklich nicht?«
»Auf mein Ehrenwort, nein!«
»Hm, wollen lieber selber noch einmal nachschaun.«
Mahlsdorfs Hand strich an des Direktors Körper herum, und der Steuermann musste in so etwas schon eine große Übung haben, seine Hand musste für so etwas sehr empfindsam geworden sein, denn als er dem Gefangenen unter die Weste und noch unters Hemd griff, brachte er einen kleinen Dolch zum Vorschein, der an einer Lederschnur auf der Brust gehangen hatte, so flach, dass er einer anderen tastenden Hand wahrscheinlich entgangen wäre.
Zunächst zog Mahlsdorf den Dolch aus der Scheide, betrachtete den Stahl, der nur Papierstärke besaß.
»Ein merkwürdiges Ding! Aber doch immerhin ein Dolch. Und Sie sagten doch vorhin, Sie hätten keine Waffe mehr bei sich. Ist das etwa keine Waffe?«
»Nein.«
»Was denn sonst?«
»Nur eine Spielerei.«
»Eine Spielerei, so. Sollte diese Spielerei nicht vergiftet sein?«
»Vergiftet?«
»Stellen Sie sich nicht so dumm, als ob Sie mich nicht verständen. Ist die Klinge nicht vergiftet?«
»Gott bewahre!«
»Wirklich nicht?«
»Sonst würde ich die Klinge doch nicht so leichtsinnig auf der nackten Brust tragen.«
»Na, deswegen, in der Metallscheide. Auf Ihr Ehrenwort, dieser Dolch ist nicht vergiftet?«
»Auf mein Ehrenwort!«
»Na, da geben Sie mal Ihre Hand her, da will ich mal ein bisschen hineinritzen.«
Mahlsdorf griff nach einer der festgehaltenen Hände, da aber machte Jonas vor Schreck eine solche krampfhafte Bewegung, dass er sich bald befreit hätte.
»Was haben Sie denn? Nur ein ganz klein wenig in die Haut stechen.«
»Ich — ich — ich kann kein Blut sehen«, stöhnte der sich wild Sträubende.
»Ach was, geben Sie her...«
»Nein — nein — der Dolch — der Dolch — könnte doch vielleicht vergiftet sein!«
Mahlsdorf sah den Erbleichten einige Sekunden fest an, dann machte er keinen Versuch weiter, sagte nur noch etwas.
»Also das nennen Sie keine Waffe! Und innerhalb einer Minute geben Sie zum zweiten Male ein falsches Ehrenwort. Ich bedaure, dass ich keine Kette bei mir habe. Ein ehrlicher Seemannshanf ist für Sie zu schade, wir könnten das Ende nicht wieder gebrauchen, und wir haben keinen Überfluss an Stricken. Jochen, Konrad, lasst den Menschen los, ihr besudelt eure Hände!«
Die ›Sturmbraut‹ war erreicht, der Direktor wurde genötigt, das Fallreep zu erklettern. Mahlsdorf half durch einen Kniestoß nach, und Mister Ephraim Jonas stand vor der riesenhaften Gestalt des Kapitäns, an dem er schon auf irgendeine Weise wenigstens 50 000 Pfund zu verdienen gehofft hatte.
»Mister Ephraim Jonas?«, fragte Jansen, nachdem er den vor ihm Stehenden einige Zeit schweigend gemustert hatte.
»Was wollen Sie eigentlich von mir?«, stieß jener mühsam hervor.
»Folgen Sie mir!«
Ehe sich Jansen wenden konnte, trat Mahlsdorf an ihn heran.
»Ich möchte Ihnen doch erst melden, was ich mit diesem Gentleman erlebt habe, wie der mit seinem Ehrenwort umzugehen gewohnt ist.«
»Nun?«
Mahlsdorf erzählte mit kurzen Worten; ruhig hörte Jansen zu, nur immer den Mann betrachtend.
»Es wundert mich nicht; gut — folgen Sie mir in die Kajüte!«
Er schritt voraus, aber doch nicht so ganz sorglos, die Anordnungen waren schon getroffen worden, zwei andere Matrosen schlossen sich an, deren ungeballte Hände auch schon genügten.
Auf der Schwelle des Kajüteneinganges stockte der Fuß des Direktors, er prallte zurück. Der Anblick von James Brookes Kindern war es, der ihm solchen Schreck eingeflößt hatte.
»Rudyard — Jokonda — ist es möglich!«, stöhnte er.
»Was erschrecken Sie denn so vor uns, Mister Jonas?«, fragte Rudyard, der seinen Fuß wieder gebrauchen konnte. »Sie haben doch keinen Grund dazu!«
»Setzen Sie sich, Mr. Jonas«, machte Jansen dieser Szene ein Ende.
Der Direktor merkte schnell genug, dass er sich anders benehmen müsse, er bekam seine Fassung wieder.
»Ich habe Sie ja für tot gehalten«, sagte er, als er sich setzte, und anderes mehr, um seinen Schreck zu rechtfertigen, und dann sprach er auch etwas von Freude ob dieses Wiedersehens der Kinder seines hochverehrten früheren Herrn.
»Kommen wir zur Sache!«, musste Jansen ihn abermals unterbrechen. »Mr. Jonas, Sie werden von diesen Geschwistern Rudyard und Jokonda Brooke beschuldigt, ein Diamantenhalsband ihrer Mutter, der Tochter des Sultans von Brunei, gestohlen zu haben.«
Jetzt zeigte der Direktor durchaus keinen Schreck, höchstens Staunen über diese Anschuldigung.
»Ist denn nicht vor Gericht bewiesen worden, dass ich schon einmal so unschuldig verdächtigt worden bin?«, war sein erstes Wort.
Doch wir wollen nicht ausführlich dabei verweilen, wie er sich zu rechtfertigen suchte. Kapitän Jansen machte auch sehr kurzen Prozess.
»Rudyard und Jokonda Brooke waren dabei, als jener Malaie, Soliman war sein Name, auf dem Sterbebett das Geständnis ablegte, und beide sind der festen Überzeugung, dass der Sterbende die Wahrheit gesagt hat. Ist dem nicht so?«
»Ja, Herr Kapitän«, antwortete das Geschwisterpaar einstimmig.
»Sie sind also im Besitze dieses Schmuckes.«
»Es ist nicht wahr!«
»Dann haben Sie ihn schon verkauft.«
»Herr Kapitän, wollen Sie sich die Sache doch überlegen. Ich habe dieses Halsband oft genug gesehen, es war ein prachtvolles, ganz auffallendes Geschmeide, solch einen Schmuck dürfte man ja gar nicht zu verkaufen wagen...«
»Nun gut, dann ist er eben noch in Ihrem Besitze.«
Jetzt begnügte sich der Direktor damit, einfach wie bedauernd die Schultern zu heben.
»Wollen Sie diesen entwendeten Schmuck freiwillig wieder ausliefern?«
»Was heißt freiwillig? Ich habe ihn nicht!«
»So werden wir Sie dazu zwingen!«, ließ sich Jansen nicht beirren.
»Sie wollen mich doch nicht etwa foltern?«, fragte Jonas mit großen Augen. »Lassen Sie mein ganzes Haus durchsuchen, ich will Ihnen die Schlüssel zu den Geldschränken geben, welche meine Sammlungen enthalten...«
»O nein. Sie haben schon so oft vor einer Haussuchung gestanden, dass Sie für ein absolut sicheres Versteck wohl gesorgt haben werden. Aber tatsächlich, ich werde das Geständnis mit Gewalt erpressen.«
»Sie wären wirklich fähig, mich der Tortur auszusetzen?«
»Bei Ihnen, ja. Es ist für Sie übrigens sehr charakteristisch, dass Sie dabei immer gleich von Folter und Tortur sprechen. Unsereins denkt da nur an Prügel, wir Seeleute an die neunschwänzige Katze. Kennen Sie dieses Instrument?«
Jansen hatte unter sich gegriffen und ließ etwas durch die Luft pfeifen, die sogenannte neunschwänzige Katze, welche noch heute auf englischen Kriegsschiffen, auf deutschen wenigstens noch bei Schiffsjungen, als entehrende Strafe angewendet wird.
Aber es ist ein vielverbreiteter Irrtum, oft auf Bildern ersichtlich, dass man sich diese neunschwänzige Katze als eine Art Geißel vorstellt, aus neun einzelnen Riemen oder Stricken bestehend, unten womöglich noch mit Widerhaken versehen. Es ist ganz einfach ein Tauende, und nur weil dieses Strafinstrument früher in der hochnotpeinlichen Zeit unter gewissen feierlichen Zeremonien angefertigt wurde, aus neun einzelnen sogenannten Karthelen zusammengedreht oder geflochten, deren jede ein Vergehen ausdrücken sollte, dessentwegen es die Prügelstrafe gab, daher der Name.
Auf den Direktor hatte das pfeifende Heulen einen sehr geringen Eindruck gemacht.
»Schlagen Sie mich, wie Sie wollen«, sagte er ganz ruhig, »schlagen Sie mich tot — ich kann nichts anderes aussagen als die Wahrheit, und die ist: ich weiß nicht, wo das Halsband der Sultanin geblieben ist.«
»O, mein geehrter Herr Direktor«, entgegnete Jansen spöttisch, aber es lag auch etwas Fürchterliches darin, »dass Sie zu denjenigen Menschen gehören, welche sich lieber zu Tode prügeln lassen, ehe sie nur ein Goldstück herausgeben, weil dieses Goldstück ihnen eben lieber ist als ihr Leben, das sehe ich Ihnen gleich an. Sie haben nicht umsonst so ein Raubvogelgesicht und so eine charakteristische Nase.«
»Was haben Sie mit mir vor?«
»Das werden Sie gleich sehen. Ich kenne ein Mittel, es ist sogar an mir selbst probiert worden, es sollte mich eigentlich wundern, wenn es nicht auch Ihnen bekannt ist...«
In diesem Augenblicke trat der Matrose Pieplack ein, die Hacken zusammenschlagend.
»Der Ochse ist da, Herr Kapitän«, meldete er.
Trotz des Ernstes der Situation konnte der so humoristisch veranlagte Jansen ein Lächeln doch nicht unterdrücken.
»Ist er schon an Bord?«
»Er hat sogar schon das ganze Deck vollschweineriert. Aber — aber — aber...«
»Na, aber was?«
»Der Ochse hat Euter, eigentlich ist er eine Kuh, einen richtigen Ochsen konnte ich nicht gleich auftreiben.«
»Schon gut, schon gut, es braucht ja auch nicht gerade ein Ochse zu sein, bei mir war es ja überhaupt ebenfalls eine Kuh, die macht die Sache vielleicht sogar noch besser. Nun kommen Sie, Herr Direktor.«
Aber dieser hatte gar keine Lust, aufzustehen; die hinter ihm stehenden Matrosen mussten ihn wieder unter die Arme nehmen.
»Was haben Sie mit mir vor?«, fragte er mit schreckensbleicher Miene.
»Wissen Sie, was Kaiadoba ist?«
»Kaiadoba?«
»Sie wissen es nicht?«
»Nein. Was ist das?«
»Desto besser, wenn Sie es noch nicht wissen. Sie werden es gleich kennen lernen. Führt ihn hinaus!«
Richard Jansen hatte diesen Mann wohl ganz richtig beurteilt, wenn er meinte, er würde jede Tortur ertragen, ehe er ein Geständnis ablegte, durch welches er einen schmerzlichen Verlust erlitt.
Dass es genug solche Menschen gibt, daran ist doch gar kein Zweifel. Der Grund zu dieser Widerstandsfähigkeit lässt sich sogar logisch erklären. Während der körperlichen Schmerzen denken sie daran, was für einen seelischen Schmerz sie hinterher durch die Preisgabe eines Geheimnisses oder eines Besitzes haben werden, und schon in der Einbildung ist der seelische Schmerz über den zukünftigen Verlust stärker als der körperliche Schmerz. Das gilt sogar für den Märtyrer, der für die edelste, idealste Sache alle Martern standhaft, lächelnd erträgt. Der wäre etwa durch Ableugnen seines Glaubens dann der unglücklichste Mensch. Aber das Ungewisse, das Geheimnisvolle war es, weil ihm das Wort Kaiadoba ganz fremd war, weshalb der Direktor mit einem Male zusammenbrach, dass er hinausgeschleppt werden musste. Denn ein starker Held war der ja nun gerade nicht, seine Charakterstärke entsprang nur einem schmutzigen Geize.
An Deck waren mit Segeln vier Wände gezogen worden, ein oben offenes Zelt, in dieses ward Jonas gebracht.
Matrosen hielten an einem Strick eine gutmütig aussehende Kuh, dann war noch eine Art Pritsche aufgeschlagen.
Der Leser weiß, was Jansen beabsichtigte — Kaiadoba — und Meister Pieplack sollte dabei den Henker spielen.
»Gestehen Sie, das Halsband der Sultanin gestohlen zu haben?«, wandte sich Jansen zuvor nochmals an den Direktor.
Dieser stierte verständnislos, aber auch angsterfüllt die so überaus gutmütig aussehende Kuh an.
»Ich habe das Halsband nicht.«
»Ich frage nicht, ob Sie es noch besitzen, sondern ob Sie es damals überhaupt entwendet haben.«
»Nein, ich weiß gar nichts davon.«
»So legen Sie sich auf die Pritsche!«
Der Delinquent musste auf sie niedergedrückt werden, kundige Matrosenhände banden ihn fest, besonders auch die Füße, welche noch über die Pritsche ragten.
»Pieplack, zieh ihm Stiefel und Strümpfe aus!«
Meister Pieplack tat es, zog wenigstens erst die Stiefel ab, dann zögerte er.
»Die Strümpfe auch?«, fragte er.
»Gewiss, gewiss!«
»Der hat aber schon lauter Löcher in den Strümpfen, unter den Sohlen überhaupt gar nichts mehr.«
»Zieh ihm die Strümpfe aus!«
Pieplack kam der Aufforderung nach.
»Der könnte sich aber die Füße auch einmal waschen.«
»Das wird ihm gleich die Kuh besorgen. Nun pinsele ihm die Sohlen ein.«
Sie wurden mit einer starken Salzlösung bestrichen. Von einem Aufritzen der Haut sah Jansen vorläufig noch ab, das konnte noch immer geschehen, falls es nicht so ging.
Die vorgeführte Kuh beschnüffelte die angefeuchteten Sohlen und begann sofort gierig zu lecken.
Im gleichen Moment fing Jonas sich zu krümmen und zu lachen an.
»Na, was soll denn das — hahaha — das halte ich ja gar nicht aus — hahahahaha — so hört doch nur auf — hahahahaha...«
»Gestehen Sie, das Halsband damals gestohlen zu haben?«
»Hahahaha — nein, nein — hahahaha — das halte ich nicht mehr aus — hahahaha!«
Die Salzlösung auf den Sohlen ward ständig erneuert, und der Festgebundene krümmte sich unter krampfhaftem Lachen wie ein Wurm, krallte die Finger in seine Schenkel, der Schweiß brach aus allen Poren hervor.
»Hahahaha — hört auf, hört auf — ich sterbe vor Lachen — hahahaha...«
Auf Jansens Wink ward die Kuh etwas zurückgezogen. Keuchend lag der Direktor auf der Pritsche, das Gesicht noch ganz verzerrt.
»Gestehen Sie, das Halsband damals gestohlen zu haben?«
»Nein, ich weiß nichts davon.«
Ein Wink, und die Kuh begann wieder zu lecken.
»Hahahaha — ja, ja, ich will alles gestehen«, fing der Delinquent jetzt unter schrecklichem Lachen zu brüllen an. »Hahahaha — hört doch nur auf — ich sterbe — hahahaha — ja, ja, ich habe das Halsband gestohlen — hahahahaha...«
Die Kuh war wieder zurückgezogen worden. Und Jansens männliches Antlitz hatte einen fast entsetzten Ausdruck angenommen. Er war nämlich entsetzt über die Wirkung, welche dieses seltsame Zwangsmittel ausübte.
Er hatte es ja erwartet — und doch fürchtete er sich fast vor dieser schnellen Wirkung. Doch diese seine Schwäche war schnell wieder vorüber.
Mit furchtbar arbeitender Brust lag der Direktor da, Schaum vor dem Munde.
»Also Sie gestehen, das Halsband gestohlen zu haben?«
»Nein, nein!«, erklang es röchelnd.
»Führt wieder die Kuh heran!«
Diesmal genügte schon die Drohung, mit der kitzelnden Tortur fortzufahren, da war der Widerstand gebrochen.
»Ja, ich habe damals das Halsband gestohlen!«
»Was haben Sie damit gemacht?«
»Ich habe es verkauft.«
»An wen?«
»An — an — an einen mir unbekannten Mann.«
»So so, an den großen Unbekannten. Herr Direktor, widersprechen Sie sich doch nicht. Sie haben ja vorhin selbst gesagt, dass man solch ein auffälliges Halsband nicht verkaufen kann...«
»Ich habe die Steine ausgebrochen und alles einzeln verkauft.«
»An wen?«
»An verschiedene englische und amerikanische und holländische Juweliere, so immer bei Gelegenheit, durch dritte Hand.«
»Sie widersprechen sich ja immer mehr. Vorhin wollten Sie das ganze Halsband an einen Ihnen unbekannten Mann verkauft haben. Das ist ein deutlicher Beweis, dass sich dieses Halsband noch in Ihrem Besitze befindet.«
»Es ist nicht wahr.«
»Führt die Kuh wieder heran!«
Wir wollen die weitere Handlung nicht in ihren Details verfolgen. Sie hatte immer wieder ihre Pausen des Leugnens.
Aber der leckenden Rinderzunge konnte der Delinquent doch nicht standhalten. Schließlich hatte er alles gestanden, auch wo man das Halsband finden würde.
Er hatte eine genaue Beschreibung gegeben; Mahlsdorf ward wieder abgeschickt, er begab sich in das Kontor zurück, in jenes Zimmer mit den Panzerschränken, hatte an der Wandtapete bald die bezeichnete Stelle gefunden, als er darauf drückte, öffnete sich ein geheimes Wandfach.
Dieses enthielt nicht nur das gesuchte Halsband, sondern auch noch mehrere Dolche und andere Sachen, von denen man jetzt doch annehmen konnte, dass sie nicht rechtmäßig in den Besitz des Direktors gekommen waren.
»Ich mische mich prinzipiell nie in Dinge, die mich nichts angehen«, sagte Jansen, nachdem ihm alles dies gemeldet worden war. »Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter. Das soll auch in diesem Falle gelten. Die Geschwister Brooke haben sich an mich gewendet, ihnen bei der Wiederbeschaffung des verschwundenen Erbstückes ihrer Mutter behilflich zu sein, und so würde ich auch jedem anderen helfen, soweit ich kann. Aber sonst will ich kein Detektiv werden, ich fühle mich nicht dazu geeignet, allem Unrecht nachzuspüren, und ich glaube überhaupt, bei Ihnen würde man da niemals fertig; denn ich halte Sie zu allem fähig, schon Ihrer Physiognomie nach. — Nun aber etwas anderes. Ich bin ein Feind aller Folter, mochte sie auch nicht bei Ihnen anwenden. Denn dieses Kitzeln der Fußsohle ist doch etwas ganz anderes, nur ein ganz vortreffliches Mittel, um jemandem die Zunge zu lösen. Sie jedoch haben einen Menschen zu Tode foltern lassen, von dessen Unschuld Sie von vorn herein überzeugt gewesen sind — dass Sie ein meineidiger Schuft sind und so weiter und so weiter, davon will ich gar nicht sprechen, dafür werden Sie sich einmal vor einem höheren Richter zu verantworten haben — aber eine Tracht Prügel mit der neunschwänzigen Katze sollen Sie doch noch bekommen, das kann ich mir doch nicht versagen.«
Und bald darauf hallte das ganze Schiff wider von dem Wehegeheul des Herrn Direktors, der unter der Peitsche wohl kaum gestanden hätte, aber durch Schreien sich Luft machen musste.
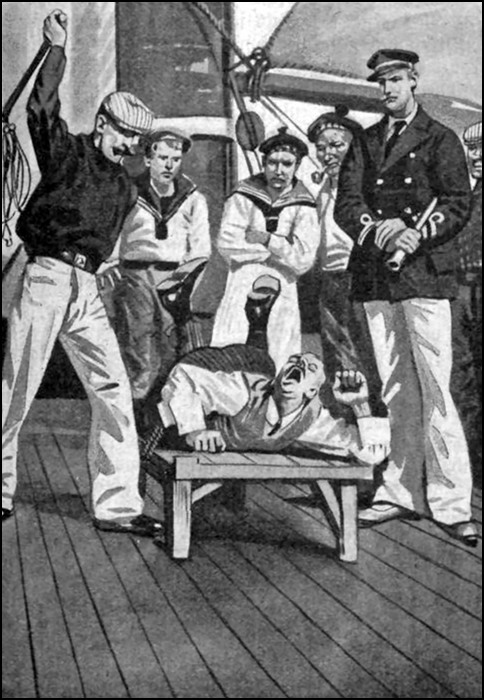
Mag das genügen. Sonst wollen wir solche Prügelszenen nicht näher beschreiben.
Auch im Übrigen sei diese Episode aus unseres Helden Leben ganz kurz erledigt, bis wir seine persönliche Erzählung wieder aufnehmen.
Der Herr Direktor ward wieder an Land gebracht und, da er nicht mehr stehen konnte, einfach in den Sand gelegt, und zwar auf die Bauchseite, auf der anderen würde er einige Zeit ohne Schmerzen nicht mehr liegen oder sitzen können; der gekaufte Ochse, der aber in Wirklichkeit eine Kuh war, ward als Schlachtvieh zurückbehalten, und die ›Sturmbraut‹ lichtete die Anker und dampfte stromabwärts, an dem englischen Kanonenboote vorüber, welches höflich den Abschiedsgruß erwiderte, ohne daran zu denken, dem gefürchteten Seeräuberschiffe, wie es jetzt ganz einfach bezeichnet wurde, eine Kugel nachzuschicken.
Die Geschwister Brooke wünschten, nach Brunei zu ihrem Großvater gebracht zu werden. Weshalb, was sie sonst beabsichtigten, was später aus ihnen wurde, das ist wohl alles in Jansens Tagebüchern angegeben worden, doch auf solche Einzelheiten bei Personen, die nur eine Nebenrolle spielen, wollen wir uns nicht einlassen.
Genug, die ›Sturmbraut‹ ging nach Brunei, der Residenz des Sultans von Property Borneo, und dieser Handelshafen, in dem viele Holländer, Engländer und Amerikaner ansässig sind, ist wichtig genug, dass ihn allmonatlich ein Postdampfer anläuft.
Wie schon früher erwähnt, liegt diesem Hafen gegenüber die Insel Labuan, welche von den Engländern annektiert worden ist, als Kohlenstation stark befestigt, von einem ständig dort liegenden Kriegsschiffe bewacht, sehr oft von anderen besucht.
Die ›Sturmbraut‹ hatte nichts zu fürchten. Brunei, dessen Unabhängigkeit bekannt ist, darf von keinem Kriegsschiffe angelaufen werden, und sollte die Verfolgung eines notorischen Piraten dieses Verbot aufheben, so wollte das doch Zeit und Weile haben.
Die Entfernung zwischen Labuan und Brunei beträgt immerhin achtzehn geografische Meilen, auch ist der Hafen von Brunei so beschaffen, dass eine Blockade unmöglich wäre, und überhaupt: im Schiffslexikon der ›Sturmbraut‹ war das Wort ›Fürchten‹ ausgestrichen.
In einen Hafen, der für ihn eine direkte Mausefalle bedeutete, hätte sich Jansen natürlich ohne dringenden Zwang niemals begeben, aber bei einem so beschaffenen Hafen, wie Brunei ist, trug er nicht das mindeste Bedenken. Das war ja nichts anderes, als wenn er an einem englischen Kriegsschiffe in Rufweite vorbeifuhr.
Außerdem gebrauchte er noch immer die Vorsicht, Aussehen und Namen des Schiffes zu ändern — wenn auch nur aus der Vorsicht, nicht unternehmungslustige Menschen in Uniform oder Zivil zu kühnen Versuchen zu verleiten, wobei sie sich blutige Nasenstüber holen würden.
Jansen ward von dem alten Sultan von Brunei wie ein königlicher Gast empfangen, er hatte nur einen Tag bleiben wollen, aber das ihm zu Ehren gegebene Fest, an dem sich die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ wachenweise beteiligte, währte drei Tage, dann nahm er Abschied von den Geschwistern Brooke.
Und nun lassen wir ihn wieder persönlich erzählen.
Das erste war, als ich während dieser Festlichkeiten einmal aufatmen konnte, dass ich mir von einem französischen Dampfer, der direkt aus Marseille gekommen war, die letzten Nummern des ›Lloyd‹ ausbat, die ich noch nicht gelesen hatte, und ich war schon seit langer Zeit ganz aus dem Konzept gekommen.
Das Wort ›Lloyd‹ ist allgemein bekannt, besonders in Zusammensetzungen, wie Norddeutscher Lloyd, Österreichischer Lloyd und dergleichen, was mit dem Seewesen zusammenhängt.
Aber ich glaube, was das Wort ›Lloyd‹ eigentlich bedeutet, woher es stammt, das ist wohl den allerwenigsten bekannt, und das ist auch eine ganz merkwürdige Geschichte.
Frederic Lloyd war im 17. Jahrhundert Restaurateur. Um das Jahr 1680 machte er neben dem Börsengebäude in London ein Kaffeehaus auf, das bald der Versammlungspunkt aller Schiffsmakler, selbstständigen Kapitäne usw. wurde. Wer die schnellste und sicherste Auskunft über irgend etwas im Seewesen der ganzen Erde haben wollte, der ging zu Lloyd. Dann vor allen Dingen wurden hier die Versicherungen abgeschlossen.
Man ging nicht mehr zur Schiffsbörse, sondern man ging zu Lloyd, und schließlich veränderte sich die Bedeutung dieses Wortes ganz, sodass, als vierzig Jahre später für die Seeassekuranz ein eigenes Haus gebaut werden musste, dieses den Namen ›Lloyd‹ bekam. Und heute haben wir einen Norddeutschen Lloyd und einen Österreichischen Lloyd und noch viele andere Lloyds, alles abstammend von dem Namen jenes Budikers und Cafétiers, den selbst man aber gar nicht mehr kennt.
Vor allen Dingen haben wir ›Lloyds Paper‹, die internationale Schiffszeitung, obligatorisch für alle Kapitäne, und wenn im offenen Meere von einem Kriegsschiffe eine chinesische Dschunke angehalten und revidiert wird und der chinesische Kapitän, der dann aber das Kapitänspatent für große Fahrt haben muss, sonst darf er eben nicht aufs hohe Meer hinaus, ist nicht im Besitze der letzten Nummer des ›Lloyd‹, die er ausgerechneter Maßen besitzen kann, so wird er bestraft.
Im ›Lloyd‹ wird von Greenwich aus behördlich alles verkündet, was der Kapitän wissen muss. Dort und dort ist ein neues unterseeisches Riff entdeckt worden, dort ist ein Schiff gesunken, das noch gefährlich werden kann, dort treibt ein Wrack, dort ist ein neuer Leuchtturm errichtet worden, dort versagt ein Leuchtfeuer usw. usw. Danach werden die Seekarten verbessert, und wer erwischt wird, dass er's nicht getan hat, wird bestraft.
Dann ein großer Inseratenteil. Verkäufe von Schiffen und dergleichen. Und dann schließlich ein höchst interessanter Briefkasten.
Hier geben die heimatlosen Jachtsportsmen das nächste Ziel an, was sie aber in der nächsten Nummer widerrufen, hier korrespondieren sie untereinander, und da bekommt man in jeder Nummer merkwürdiges Zeug zu lesen. — —
Mehr als ein Dutzend Nummern waren es, die mir der französische Kapitän geschickt hatte.
Ich schlage zufällig den Inseratenteil auf, und da fällt mir auch gleich mein Name auf, der über einer ganzen Seite steht, und zu meinem Staunen lese ich:
An Mister Richard Jansen, Kapitän der ›Sturmbraut‹.
Hochgeehrter Herr Kapitän!
Ich Endesunterzeichneter, Taylor P. Barnum, entbiete Ihnen als Ihr aufrichtigster Bewunderer meinen devotesten Gruß und erlaube mir, Ihnen folgendes zu unterbreiten:
Jedenfalls wissen Sie gar nicht, hochverehrter Herr Kapitän, was für zahllose Bewunderer Sie in allen Ländern der Erde haben. Seit ich einmal öffentlich den Gedanken aussprach, dass mir vielleicht möglich sei, mit Ihnen eine Tournee zu machen, erhalte ich täglich Tausende von Briefen, welche alle anfragen, wann und wo der König aller Seekönige einmal zu sehen, zu sprechen, zu fotografieren und ... zu küssen sei. Von diesen Briefschreibern will ich nur den Herzog von Canterbury, den Fürst von Rossadelsky und den Milliardär H. L. Augsten hervorheben, von den Damen die Herzogin von Lammermore, die Fürstin Lacroix, die bekannte Minenkönigin da Rosa.
Im Namen all dieser Ladies und Gentlemen spreche ich die ergebene Bitte aus, dass Sie einen bestimmten Punkt auf dem Meere angeben, wo Sie sich zu einer bestimmten Zeit mit Ihrer berühmten ›Sturmbraut‹ einfinden. Dazu ist nur nötig, dass Sie mir von Ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort einen eingeschriebenen Brief zuschicken — einfach an Taylor P. Barnum, New York — oder noch besser eine Vertrauensperson. Nach Erhalt Ihrer Zusage bedarf ich nur noch einer Zeit von vier Wochen, um alle Vorbereitungen zur Abreise getroffen zu haben. Oder, wenn Sie wünschen, werde ich den Tag meiner Abreise im ›Lloyd‹ bekannt geben. Alles übrige können Sie sich ja selbst leicht berechnen.
Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, dass Sie, auf dessen Ergreifen oder Tod eine so hohe Prämie steht, nichts zu fürchten haben. Ich bin Geschäftsmann und als solcher ein Mann des Friedens. Außerdem werde ich auch meine Auswahl treffen und große Garantien fordern. Und dann brauche ich hier wohl auch nicht erst zu sagen, dass es Ihr eigener Vorteil sein wird.
Bitte, teilen Sie mir Ihre Bedingungen mit, schriftlich oder durch Vertrauensmann.
Als der Ihnen sicher bekannte Entrepreneur, der im Jahre 1843 mit dem Zwerge Tom Thumb 400 000 Dollar und im Jahre 1850 mit der Sängerin Jenny Lind während einer achtmonatigen Tournee 900 000 Dollar verdient hat, zeichne mit tiefster Hochachtung als Ihr ganz ergebener
Taylor P. Barnum.
So lautete der gedruckte Brief, welcher in großen Buchstaben eine ganze Seite einnahm, und wie oben angezeigt war, kostete diese nicht weniger als vierzig Pfund Sterling oder achthundert Mark, bei Wiederholungen steigender Rabatt, aber nicht über zwanzig Prozent.
Ich weiß nicht — mir stieg plötzlich eine Blutwelle der Scham ins Gesicht, schnell blätterte ich herum — nein, ich wollte, da sich auch meine Gäste in der Kajüte befanden, lieber einstweilen diese ganze Nummer verschwinden lassen.
»Hohohoho«, lachte da Karlemann, der in einem Lehnstuhl saß und ebenfalls solch eine LloydNummer vor sich hatte.
»Was haben Sie denn?«, fragte ich, schon von einer bösen Ahnung erfüllt.
»Hier, lesen Sie mal — der Humbugmacher Barnum will Sie fotografieren und küssen, hohoho!«
»Steht es da auch drin?«, fragte Mister Fairfax aus einer anderen Ecke.
»Hier auch«, ließ sich Mister Rug, der einmal seinen nüchternen Tag hatte, vernehmen.
Dreizehn Nummern hatte ich, und in den letzten sieben stand dieser an mich gerichtete Brief.
»Das machen wir!«, erklang es dann einstimmig.
»Aber, meine Herren, wir sind — ich bin doch kein...«
»Das wird selbstverständlich gemacht!«
Sie ließen nicht locker, und es dauerte auch gar nicht lange, so sah ich selber ein, wie eine Scham da ganz unangebracht war, dass das vielleicht ein Abenteuer so ganz nach meinem Geschmacke werden konnte.
Alsbald wurde eine Beratung abgehalten, an der von den Hauptpersonen nur Tischkoff nicht teilnahm, weil der wieder einmal ein bisschen tot war.
Jawohl, ein Vertrauensmann war besser als ein Brief. Die Gelegenheit war recht günstig. Heute schrieben wir den 6. April, morgen wurde hier der Postdampfer erwartet, welcher in drei Wochen in Kapstadt sein musste, und von dort war täglich Gelegenheit nach New York.
Wenn wir sehr mäßig rechneten, so konnte der Vertrauensmann — und ich will gleich erwähnen, dass sich hierzu wiederum Mister Fairfax erbot — spätestens am 1. Juni in New York sein, sodass die Begegnung der Schiffe Mitte des nächsten Monats stattfinden konnte, wenn sie nicht zu weit entfernt von New York stattfand.
»Sagen wir am 15. Juli auf dem 30. Breitengrade und dem 50. Längengrade«, entschied ich, ohne erst die Karte befragt zu haben. »Das ist außerhalb aller Dampferlinien, und da bin ich auch in der Nähe der Fucusbank.«
»Wollen Sie erst noch einmal nach der Fucusinsel, um die anderen zu holen?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Und was verlangen Sie dafür?«
Erst wollte ich davon nichts wissen, aber die anderen ließen nicht locker, und sie hatten recht.
Wenn Barnum, der damals als König des Humbugs die Höhe seines Ruhmes erlangt hatte, mit mir ein Geschäft machen wollte, so konnte auch ich etwas dabei verdienen, wenn ich gleich beabsichtigte, das Geld zu einem wohltätigen Zwecke zu verwenden.
»Also die Hälfte seines Gewinnes.«
Ich will nicht schildern, was wir noch alles besprachen, was für Instruktionen Fairfax sonst noch erhielt.
Am anderen Tage kam der englische Postdampfer richtig an, wir selbst lichteten die Anker, Mister Fairfax zurücklassend, und waren verschwunden, noch ehe die hatten erfahren können, dass das die berüchtigte ›Sturmbraut‹ gewesen war.
Als sich Tischkoff wieder an Deck zeigte, teilte ich ihm alles mit.
»Wie Sie wünschen«, sagte er, womit er diese ganze Angelegenheit erledigt hatte, und dann fuhr er fort: »Da wir dann noch genügend Zeit haben, möchte ich Sie bitten, erst einmal die Ostküste von Madagaskar anzulaufen. An der Flussmündung des Rangazarak liegt in erreichbarer Tiefe das Wrack eines deutschen Dampfers, der vor einigen Jahren dort gesunken ist. Ich möchte es gern einmal untersuchen.«
Sprach's und verschwand, um nicht eher wieder aufzutauchen, bevor ich fünf Wochen später dieses Ziel erreicht hatte.
Es war ein unbedeutendes Flüsschen, der Karte nach von der Quelle bis zur Mündung keine zehn Meilen lang, welches sich ins Meer ergoss. Die ganze Gegend, soweit wir sie überblicken konnten, war ebener, steriler Boden, nur mit der dürftigsten Vegetation bedeckt. Kein vierfüßiges Tier war zu sehen, geschweige denn ein Mensch.
Tischkoff bezeichnete ganz genau die Stelle, wo das Wrack liegen solle, eine Seemeile von der Flussmündung entfernt.
»Was für ein Dampfer war es denn? Was hatte er denn geladen?«
»Das weiß ich selbst noch nicht, das will ich eben erst untersuchen.«
Woher wusste er denn da überhaupt, dass hier ein Dampfer gesunken war? Nun, das hatte er auf eine ganz natürliche Weise erfahren können. Dann aber machte ich Beobachtungen, die mich sehr an der Offenheit meines Kommodore zweifeln ließen, oder hier lag eben ein für mich unergründliches Rätsel vor.
Ich selbst tauchte mit Tischkoff, von ihm dazu aufgefordert, hinab.
Bei elf Meter Tiefe fanden wir einen hölzernen Raddampfer von etwa achthundert Tonnen, dessen Leib von einem unterseeischen Riff aufgeschlitzt worden war.
Es war dies die zweite Angabe, welche ich während meiner Seeräuberperiode dann später nach Greenwich berichtete, und die im ›Lloyd‹ veröffentlicht wurde.
So kann auch ein Seeräuber der Menschheit unschätzbare Dienste leisten.
Es war der ›Fahrewohl‹ aus Bremen, der vor zwei Jahren hier gesunken war, mit Kopra befrachtet, das ist das getrocknete Fleisch der Kokosnuss, die wir natürlich schon ganz verrottet fanden.
Wie ich später erfuhr und auch schon jetzt ziemlich sicher konstatieren konnte, hatte sich die ganze Mannschaft in Booten noch rechtzeitig retten können, unter Mitnahme der Papiere und der Schiffskasse.
Sechzehn Tage blieben wir hier untätig liegen. Weshalb? Weil Tischkoff täglich hinabtauchte, mit Zwischenpausen stundenlang unter Wasser blieb. Wozu? Das sagte er nicht.
Am sechzehnten Tage mussten wir ein Tau hinablassen, und als wir es wieder heraufzogen, war ein kleiner Blechkoffer an ihm befestigt.
Bernhard, der Steward, hatte gesehen, wie Tischkoff ihn in seiner Kabine öffnete. Es waren außer Kleidungsstücken viele Briefe darin gewesen, und auf diese war es meinem Kommodore offenbar angekommen.
Was hatten nun diese Briefe zu bedeuten? Wie war Tischkoff zu der Kenntnis gekommen, dass sich solch ein Koffer, nach dem er sechzehn Tage lang gesucht hatte, in dem Wrack befand?
Er gab keine Aufklärung.
Vom Kap der guten Hoffnung aus hatten wir eine sehr ungünstige Fahrt, ständigen Gegenwind, an der Maschine brach etwas, tagelange Reparatur, wobei wir immer rückwärts anstatt vorwärts kamen, wir wurden bis in die südliche Eisregion verschlagen, und als die ›Sturmbraut‹ dann wieder nach Norden dampfen konnte, hatte ich überhaupt gar keine Zeit mehr, noch einmal durch die Fucusbank zu segeln, um unsere Insel aufzusuchen, falls ich dies beabsichtigt hätte.
Mit der Insel waren wir in ständiger Verbindung geblieben, dank Karlemanns Möwen. Für uns war das schon etwas ganz Gewöhnliches geworden, wir sahen nichts Wunderbares mehr darin, dass wir eine Möwe mit einem Gruße, mit einer Anfrage abgehen ließen, welche hier in dieser Gegend noch an demselben Tage mit der Antwort zurückkam.
Wir erhielten ja von der Fucusinsel genug mitgeteilt, aber es war nichts dabei, was erwähnenswert wäre.
Am Morgen des 14. Julis erreichten wir den Kreuzungspunkt des 30. und 50. Grades, nördlich von der Fucusbank gelegen.
Ich hatte unterdessen schon oft genug bereut, auf den Vorschlag des Humbugkönigs Barnum eingegangen zu sein. Was für einen Zweck hatte das alles? Mir war es noch immer schrecklich, so zwecklos in der Welt herumzukutschieren. Dann doch lieber, wenn man nichts weiter zu tun hat, Jagd auf Sklavenhändler machen, dabei gibt es ja auch immer etwas zu verdienen.
In der Nähe des unsichtbaren Zieles, nur auf dem Meere durch ideale Linien gedacht, ward mein Interesse aber doch wieder rege.
Es war ein herrlicher Sommermorgen, als ich nach der aufgehenden Sonne bestimmte, dass sich hier an diesem Punkte — wenn dieser ›Punkt‹ auf dem Meere auch etwas groß war — der 30. Breitengrad mit dem 50. Längengrade kreuzte.
Weit und breit kein Segel zu sehen. Ankergrund gab es nicht, wir ließen uns schaukeln, kreuzten etwas hin und her, konnten uns den Spielen der Phantasie hingeben.
Würde die Gesellschaft auch wirklich kommen? Barnum hatte gesagt, er wolle nur von dem Empfange meiner Zusage im Lloyd Nachricht geben. Aber da hätte ich einen weit späteren Termin bestimmen müssen. Das hätte er doch erst nach Greenwich an die Redaktion telegrafieren müssen, dann musste die Zeitung erst nach der Westküste von Südafrika kommen — kurz und gut, wollte ich solch eine Nachricht haben, so hätte ich einen weit späteren Termin bestimmen müssen.
So wollten wir einige Tage, meinetwegen auch einige Wochen hier warten, was ja dasselbe war, wie wenn wir planlos hin und her gesegelt wären. Dabei ersparten wir sogar noch Kohlen und Arbeitskraft.
Der Tag verging. Der 13. Juli brach an, und weder Segel noch Rauchwolke wollte am Horizont sichtbar werden. Wir befanden uns zwar zwischen Europa und Nordamerika, dem befahrensten Meeresteile der Erde, aber nicht innerhalb der bekannten Dampferlinien, und der Atlantische Ozean ist eben viel größer, als er auf der Karte aussieht. Ich bin einmal von Liverpool nach New York gefahren, auf einem Segler, immer Westwind, immer von Norden nach Süden und zurückgekreuzt, von Grönland bis in die spanische See hinauf, und da haben wir in diesem ›belebtesten Ozean‹ während sechs Wochen nicht ein einziges Segel zu sehen bekommen!
So wurde es Mittag.
»Ein Segel!«, erklang da der Ruf.
Es kam von Nordwesten, aber kein Segel, auch keine Mastspitze, sondern nur ein Rauchwölkchen war sichtbar. Ich selbst hatte vorhin von ›weder Segel noch Rauchwolke‹ gesprochen, sonst aber kennt der Seemann nur ein ›Segel‹, womit er überhaupt ein Schiff meint. Der Engländer lässt sogar den Dampfer segeln, wenn dieser auch kein einziges Segel führt.
»Ein Dampfer!«, ward erst dann noch erklärend hinzugesetzt. Dass er aus Nordwesten kam, sprach sehr dafür, dass er der erwartete war.
Doch wir durften uns noch keinen Illusionen hingeben. Warten! Die erste Mastspitze tauchte auf, eine zweite, eine dritte — nach einer Stunde hatten wir den Dampfer voll in Sicht, und er hielt direkt auf uns zu.
Ein Kriegsschiff war das nicht, das war für uns die Hauptsache — und wir konnten auch annehmen, dass Batnum den Termin pünktlich eingehalten hatte.
Flaggen gingen hoch.
»›Sultana‹, New York. Barnum.«
»Sturmbraut‹. Willkommen. Kapitän Jansen«, ließ ich zurücksignalisieren.
»Darf ich an Bord kommen? Barnum.«
»Immer.«
Ich hatte tatsächlich die ImmerFlagge gezeigt. Mir war überhaupt recht humoristisch zumute. Das ganze Wetter war auch danach beschaffen — blauer Himmel, die See wie ein Spiegel.
Der Dampfer, wenigstens dreitausend Tonnen, für damalige Verhältnisse ein recht stattliches Ding, schmuck getakelt und gemalt, kam bis auf eine Seemeile heran, stoppte.
An Deck wimmelte es von Menschen, Männlein und Weiblein. Ein intensives Taschentuchwedeln war schon immer gewesen, sobald man nur durch das Fernrohr etwas hatte unterscheiden können, jetzt ein endloses »Hipp hipp hurra!!«, — ich glaube, es war sogar mein Name dabei — und jetzt: tschin! — ein schmetternder Tusch, und dann ein schmetternder Marsch von Trompeten und Posaunen mit Paukenbegleitung.
Na, soll einem da nicht das Herz im Leibe lachen! Ich kam immer mehr in die animierte Jahrmarktsstimmung hinein.
Ein Boot wurde ausgesetzt; in einem der beiden einsteigenden Herren erkannte ich Mr. Fairfax, der andere konnte nur Barnum sein, der mir erst einmal eine Visite abstatten wollte. Mit sechs schmuck uniformierten Ruderern ging es nach der ›Sturmbraut‹.
Barnum! Der König des Humbugs! Wer kennt ihn nicht? Meine Mannschaft war mein Volk — nein, meine Jungen, meine Kinder, für deren geistige Ausbildung ich mich auch verpflichtet fühlte, an Bord der ›Sturmbraut‹ verging fast kein Tag ohne Instruktionsstunde; denn meine Jungen sollten nichts sehen, was sie sich nicht erklären konnten. Heute hielt ich ihnen eine Lektion über fliegende Fische, morgen über die Eisberge, und inzwischen kam ein Vortrag über die Entstehung der Bibel, wozu ich mich stets durch ernsthafte Studien erst präparierte. Das nennt man nun ein Seeräuberleben!
Und so hatte ich auch über Taylor P. Barnum eine ganze Anzahl belehrender Instruktionsstunden abgehalten. War oder ist er es nicht wert? Für mich, ja.
Man mag über diesen Schausteller und Humbugmacher denken, wie man will — von der richtigen, unparteiischen Seite aus betrachtet ist Barnum ein genialer Kerl, der Bewunderung verdient. Auch kann man ihm keine ehrlose Handlung nachweisen. Da gibt es ganz andere Geschäftsleute, vor deren Geldsack die Welt anbetend kniet, aber auf welch schmutzige Weise sie ihn gefüllt haben, danach wird gar nicht gefragt! Barnum hat siebenmal bankrott gemacht, fürchterliche Bankrotts, aber zuletzt sind seine Gläubiger doch immer zufrieden von ihm gegangen. Sonst hätte er ja auch nicht stets wieder solch kolossalen Kredit bekommen.
Ich konnte meinen Jungen etwas über Barnum erzählen, mehr als man im Konversationslexikon findet; denn mir war einmal eine Broschüre in die Hände gekommen, von ihm selbst verfasst: ›Wie man Millionär wird‹, seinen eigenen Lebenslauf schildernd. Ich hatte sie nicht völlig lesen, nur darin blättern können, es war aber doch viel sitzen geblieben.
Geboren am 5. Juli 1810 zu Danbury im nordamerikanischen Staate Connecticut von armen Eltern, wurde er mit vierzehn Jahren Diener in einem kleinen Laden auf dem Lande, heiratete im neunzehnten Jahre, dann gab er eine Zeitung heraus, wurde wegen politischer Pamphlete verhaftet und bestraft. Nach verschiedenen missglückten Spekulationen wurde er Schauspieler, dann Kunstreiter. Im Jahre 1842 kaufte er eine kleine Schaubude, entdeckte ein winziges Männlein, das er General Tom Thumb nannte und welches ihm schnell ein großes Vermögen einbrachte.
Nun blieb er bei der Schaustellerei. Aber auch wieder in besonderer Weise. Seinen Haupttreffer machte er, als er im Jahre 1850 die berühmte Sängerin Jenny Lind engagierte, die schwedische Nachtigall, mit ihr eine Tournee durch die nordamerikanischen Staaten machte, und obgleich er die Lind fürstlich bezahlte und ungeheuere Unkosten hatte, verdiente er in den neun Monaten noch 900 000 Dollar.
Mit diesen Millionen baute er sich bei seinem Heimatdorfe einen orientalischen Palast, den er Iranistan nannte, alles feenhaft eingerichtet, und als dies geschehen war, machte er... wieder einmal bankrott.
Unterdessen hat er sich immer wieder mit den großartigsten Unternehmungen beschäftigt, welche aber stets auf Humbug beruhten, dazwischen immer wieder einmal bankrott machend.
So stand in meinem Konversationslexikon zu lesen.
Zum Teufel noch einmal, ist denn das Humbug, wenn man eine schwedische Sängerin nach Amerika bringt?!
Pfui über solches Geschreibsel!
Ich konnte nun nach seiner Selbstbiografie etwas mehr über Barnum erzählen. Jene ›verschiedenen missglückten Spekulationen‹ in seiner Jugendzeit, das ist eben das Interessante dabei. Übrigens kann ich gar nicht sagen, dass sie ihm missglückt sind. Barnum hat als echtes Genie nur niemals das Geld zusammenhalten können. Verdient und wieder verpulvert. Nicht nur die Lind, sondern jeden seiner Angestellten hat er immer fürstlich honoriert. Er hat seine Gläubiger bezahlt, obwohl er es nach dem Offenbarungseide gar nicht mehr nötig gehabt hätte.
Sein Spekulationsgenie kam schon im zartesten Kindesalter zum Durchbruch. Er hat ja allerdings manches hahnebüchene Stückchen ausgeführt, aber... köstlich zu lesen!
Zuerst erzählt er, wie ihm im vierten Lebensjahre das ›Ich bin‹ zum Bewusstsein gekommen ist, und wie er da, hinten zum Höschen noch das Hemd heraus, sofort begann, seinen Spielkameraden die Marmelkugeln abzunehmen. Nur in einer Hand befindet sich die Kugel — links oder rechts — wo ist sie?
Hier nun entwickelt Barnum eine psychologischmathematische Theorie, welche wahrhaft klassisch zu nennen ist. Wie er sich immer ausrechnen konnte, in welche Hand der Spielkamerad das nächste Mal die Kugel nehmen wird, wie er also den Charakter des Betreffenden zu beurteilen verstand.
Und das ist es, was schon den vierjährigen Hosenmatz als den echten Barnum kennzeichnet, der dann zum Schausteller, zum Allerweltsunternehmer wird, wobei es darauf ankommt, den Geschmack, die Eigenart, die Gedanken des jeweiligen Publikums zu erraten.
Am köstlichsten dünkt mich aus seiner frühester Jugend die Geschichte mit den Ochsenhörnern.
In der benachbarten Stadt wurde ein lebhafter Handel mit Ochsenhörnern betrieben. Eines Abends wird ein kleiner Händler aus seiner Wohnung gepocht, es ist ein achtjähriger Junge, der den Mann scheu fragt, ob er ihm ein schönes Hörnerpaar abkaufen wolle, bringt es nach langem Zögern auch gleich zum Vorschein.
»Junge, woher hast du die Hörner?«
»Gefunden.«
»Das ist nicht wahr, die hast du gestohlen!«
Nach noch längerem Leugnen und Zögern gibt der kleine Barnum endlich zu, die Hörner wirklich gestohlen zu haben, drüben aus der Niederlage des reichen Grossisten.
Der Kleinhändler hat ein enges Herz, aber ein weites Gewissen. Die Hörner sind vielleicht fünf Dollar wert, er gibt dem kleinen Barnum einen dafür.
»Soll ich noch mehr bringen? Die sind dort drüben ganz leicht zu mausen.«
»Nur immer zu, aber lass dich bloß nicht erwischen, ich weiß von nichts.«
Also die beiden machen ›Kumpe‹, der kleine Barnum bringt jeden Abend ein gestohlenes Ochsenhorn, manchmal auch gleich mehrere Paare, er erhält seine Dollars, und alles geht gut.
Eines Tages revidiert der Händler, hier der Hehler, sein Lager, das er hinter seinem Hause hat. Da fällt ihm auf, dass doch recht viele Hörner fehlen. Gewiss, ihm sind eine ganze Menge gestohlen worden.
Er versteckt sich, lauert auf, der Dieb schleicht sich richtig ein — — im Scheine der Blendlaterne erkennt er seinen Lieferanten, den kleinen Barnum.
»Ha, jetzt weiß ich — du stiehlst meine eigenen Hörner!!«
Der kleine Barnum hat sich nicht erwischen lassen, und in gesicherter Weite steckt er die Hände in die Hosentaschen und sagt:
»Jawohl, das waren immer Ihre eigenen Hörner — hinten mause ich sie Ihnen und vorne verkaufe ich sie Ihnen — zeigen Sie mich nur an, wir wollen mal sehen, wer mehr hineinfällt, ich oder Sie.« — — —
Auch hierüber mag man denken wie man will — jedenfalls war es ein genialer Spitzbubenstreich, der kleine Barnum hatte eben seinen Mann gekannt, so wie er dann stets das Publikum zu beurteilen wusste — das Publikum, auch gleich Welt genannt, welche betrogen sein will.
Ich für mein Teil kann darin kein großes Verbrechen sehen. Da müsste auch das ein Verbrechen sein, wenn jemand Stiefel anpreist, in jedem anderen Geschäft fünf Taler kostend, bei ihm nur einen, und kauft man sie, so fallen einem beim ersten Regenwetter die angeleimten Sohlen ab. Wer da von Betrug spricht, der verdient auch noch Prügel, weil er für einen Taler ein Paar wasserdichte Stiefel haben wollte.
Barnum war also auch Zeitungsherausgeber. Das heißt, er schrieb, setzte, druckte und verkaufte die Zeitungen selbst. Er schaffte sich einen Gaul an und nannte sich stolz ›Gestütsbesitzer‹. (Übrigens ist er auch einmal ein gesuchter Jockey gewesen.) Er gründete eine Goldminenaktiengesellschaft, brachte deren Aktien tatsächlich an die Börse — und er selbst war der einzige Aktionär, der Direktor, vertrat das gesamte Schreiberpersonal, war der einzige Goldgräber in der Mine. Und dennoch soll das damals, als der Goldminenschwindel in Amerika in der höchsten Blüte stand, die einzige ›Aktiengesellschaft‹ gewesen sein, an der die Leute nichts verloren haben. Die meisten dieser Goldminen existierten damals ja nur in der Luft, der pure Schwindel, die Hauptsache war ein pompöses Büro — Barnum hat sich wenigstens redlich Mühe gegeben, irgendwo in der Erde Gold zu finden. — —
Und nun kam dieser Mann herangerudert, vor dem ich tatsächlich Bewunderung hegte, wenn auch eine etwas anderer Art als für Julius Cäsar oder Goethe.
Es war ein Zufall, dass ich noch nie sein Bild gesehen hatte, so freigebig er sich sonst auch auf Reklamezetteln konterfeite. Nun, er sollte mir ja gleich persönlich gegenüberstehen.
Ich hatte keine Vorbereitungen zu seinem und der anderen Herrschaften Empfang getroffen. Oder doch?
Mein Schiff war in tadelloser Ordnung, gemalt wie ein Schmuckkästchen, darauf hielt ich immer. Aber die Uniformen hatte ich meine Jungen sich nicht anziehen lassen, sie waren in Arbeitskleidung, manche mit Teer besudelt, ich hatte sie nicht erst sich waschen lassen, und ich selbst, der ich überhaupt den mit goldenen Streifen besetzten Affenrock hasste, mich seiner sogar schämte, trug ein der Hitze entsprechendes Kostüm, nämlich eine weiße Arbeitshose und ein baumwollenes Hemd, und da wir eben Deckwaschen gehabt hatten, wobei ich ein bisschen mit geholfen, langschäftige, bis an den Leib reichende Wasserstiefel, und die Hemdärmel waren bis über die Ellbogen aufgekrempelt — und dabei blieb es.
War das vielleicht etwas berechnende Eitelkeit? Gut, mag es sein! Jedenfalls fühlte ich mich so am behaglichsten.
Die Dampfermatrosen entwickelten beim Rudern und Beilegen gerade keine große Schneidigkeit, und dann stiegen die beiden Herren das Fallreep herauf.
»Mmmmmister Taylor Mmmmmmmmbarnum — Kakakakapitän Richard Janesen«, stellte M. Fairfax, dessen schiefe Nase heute ihren unglücklichen Tag zu haben schien, vor.
Na, da war er! Richtig, so hatte ich ihn mir auch vorgestellt! Ein kleiner, untersetzter Mann mit starker Anlage zum Bierbauch — das gehörte ja nicht gerade zu dem Bilde, das ich mir von dem König des Humbugs gemacht — aber der Kopf war ganz der erwartete. Ein bartloses, fleischiges Schauspielergesicht, in dem sich wahnsinniges Genie mit kühler Energie und spöttischer Überlegenheit paarte, und dieses Gemisch eingerahmt von einer wilden Fülle kurzer Locken.
Hatte ich nicht vorhin von Goethe gesprochen? Jawohl, das war ein sogenannter Goethekopf.
Und warum soll man denn nicht solch einen Mann wie Barnum mit einem Dichter vergleichen? Der eine begeistert das Publikum durch seine auf der Bühne zu Fleisch und Blut gewordenen Phantasiegestalten, der andere versetzt es durch Zwerge und andere Missgeburten in Entzücken. Der eine macht Gedichte, der andere macht künstliche Hühnereier und dergleichen.
Ja, unter Umständen steht solch ein Mann wie Barnum noch weit über dem produktivsten Dichter.
Ich hatte einmal Gelegenheit, einem Verleger einen Manuskriptband Gedichte anzubieten — — nicht meine, ich bin nicht so verbrecherisch veranlagt. Aber ich hatte sie gelesen, und ich tat mein möglichstes, den Verleger auf ihren Wert hinzuweisen, damit er sie drucken ließ, denn der Autor wollte sie nicht auf seine Kosten herausgeben, was für viele ein beschämendes Gefühl hat.
Es war ein Verleger aus Sachsen, auch einer mit einem Bierbauche, und nachdem ich von der edlen Dichtkunst im Allgemeinen und für meinen Freund im Besonderen gesprochen hatte, ihn als einen gottbegnadeten Dichter preisend, sagte dieser Herr aus Sachsen, die ersten Worte mit entsprechender Verachtung:
»Gedichte — — — Gedichte — — — ich gann ooch Gedichte machen — — — da is weiter nischt dabei... awwer se hinterher ooch vergoofen, das is de Gunst.«
Der Mann hatte recht, die Hauptsache bleibt immer 's Vergoofen.
»Herr Kapitän, Sie sehen vor sich Ihren größten Bewunderer.«
Er sprach noch mehr. Er sprach wie ein Buch — nein, wie ein Mann, der nicht nur Bücher machen, sondern sie hinterher ooch vergoofen kann.
Dann saßen wir in der Kajüte und tranken Champagner zusammen mit den anderen fünf Sportsmen, und Karlemann durfte natürlich nicht fehlen.
Er stierte den König des Humbugs immer mit einem eigentümlich wilden Blicke an, nicht merkend, dass seine Nase vier Knoten lief, bis ihm Lord Seymour mit väterlicher Güte sein rotes Taschentuch anbot.
Karlemann nahm es, wischte sich die Nase, dann sagte er »ft!«, und spuckte seinen aufgespeicherten Tabakssaft ganz dicht am Kopfe des ungekrönten Königs vorbei, in den dahinter befindlichen Wandspiegel hinein, gerade dorthin, wo der Spiegel zeigte, dass das Lockenhaupt in der Mitte sich schon ganz bedenklich zu lichten begann.
Ich wusste, woher dieser stille Hass Karlemanns kam. Konkurrenzneid!
Es waren noch viele Komplimente zu wechseln, ehe wir zur Sache kamen.
»Wie viele Passagiere haben Sie denn an Bord?«, fragte ich.
»Zweihundertunddreiundfünfzig. Bitte, hier ist die Liste.«
Und Barnum zog aus der Brusttasche ein Futteral, aus diesem eine Papierrolle, stand auf, ließ sie aufrollen, und da sein Stehen bei weitem nicht genügte, die ganze Rolle zum Entfalten zu bringen, stellte er sich erst auf den Stuhl, dann kletterte er auf den Tisch, und da die mit Namen beschriebene Rolle noch immer kein Ende nehmen wollte, kletterte der dicke Mann wieder herab und zog den ganzen Papierstreifen drei- oder viermal durch die Kajüte.
»Warum haben Sie denn die Namen nicht in ein Buch geschrieben?«, fragte Brown.
»Weil die Liste so übersichtlicher ist.«
Das war durchaus nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Aber ich wusste schon den Grund. Eben alles Reklame, auf den Trick kommt es an, das Publikum muss überrascht, frappiert werden. Hier bei uns hatte das ja gar keinen Zweck, aber solche Sensationsmacherei und Effekthascherei war diesem Manne schon in Fleisch und Blut übergegangen, und um die Rollenliste seiner Passagiere möglichst lang zu machen, hatte er zwischen den einzelnen Namen große Abstände gelassen.
»Darf ich Ihnen die Namen vorlesen?«
»Es ist wirklich nicht nötig«, wehrte ich lächelnd ab.
Ich blickte einmal darauf — die Reihe eröffnete tatsächlich der Herzog von Canderbury, dann kam die Herzogin von Lammermore, dann Fürst Rossadelsky, dann die Prinzess Lacroix...
»Ich habe die Namen nach dem Range geordnet, und nach reiflicher Überlegung habe ich eine englische Herzogin vor einer französischen Prinzessin rangieren lassen. Herr Kapitän haben doch nichts dagegen?«
»O, bitte sehr«, musste ich wiederum lächeln. »Und wer ist der letzte?«
Barnum zog den Schwanz der Papierschlange zu sich heran.
»Soweit ich die Vermögensverhältnisse der Herren und Damen nicht kannte, habe ich sie nach den Namen alphabetisch geordnet, abgesehen davon, dass der Adel vorangeht, wenn ich auch einen Millionär vor solch einem zerlumpten spanischen Hidalgo gehen lasse. Hier ist der letzte: Xaver Zsarlonitz aus Konstantinopel, ein junger Armenier, der das Erbe seines Vaters schnellstens durchzubringen sucht.«
»Aus Konstantinopel?«
»Jawohl, aus Konstantinopel.«
»Er hielt sich wohl gerade in New York auf?«
»Nein, er ist direkt aus Konstantinopel nach New York gereist, als ich die Ankündigung in allen Zeitungen Amerikas und Europas veröffentlichen ließ, dass Gelegenheit sei, den berühmten Kapitän Richard Jansen persönlich kennen zu lernen. O, was meinen Sie wohl, von woher da die Herren und Damen überall gekommen sind? Hier ist ein Herr aus Pernambuco in Brasilien, hier eine Dame aus Tomsk in Sibirien. Sie hatten ja die Güte, mir noch sechs Wochen Frist zu geben, oder, die Fahrt nach hier abgerechnet, doch noch fünf Wochen, und in dieser Zeit kommt man heutzutage schon aus dem Herzen Sibiriens bis nach New York. Diese Russin ist acht Tage mit PferdeExpress gefahren, ehe sie die nächste Eisenbahnstation erreichte, acht weitere Tage auf der Eisenbahn nach Hamburg; vierzehn Tage später war sie in New York, hatte dann bis zu unserer Abfahrt immer noch einige Tage Zeit.«
Gott im Himmel noch einmal, was für ein berühmtes Tier war ich doch geworden!
»Aber diese Leute müssen doch erst benachrichtigt worden sein!«
»Gewiss doch! Ich habe eben in allen Zeitungen annonciert.«
»Aber die Annonce muss doch erst hingeschickt werden?«
»Sicher!«
»Bis nach Sibirien?«
»Bis nach der russischen Zeitung, welche dort gelesen wird.«
»Ja, der Brief, welcher diese Annonce enthielt, hatte aber doch erst die lange Hinreise zu machen.«
»Kein Brief, wurde alles telegrafisch gemacht. Die telegrafische Verbindung auf der Erde ist ja weit besser als die durch Eisenbahnen. Spaltenlange Annoncen telegrafiert.«
»Das muss aber schreckliches Geld gekostet haben.«
»Was tut's? Kommt alles wieder ein. Danach sind die Preise berechnet.«
»Ja, wie steht's nun eigentlich mit dem...«, mischte sich da Karlemann ein, statt des Unvollendeten mit den Fingern die Geste des Geldzählens machend.
Ich hatte schon beobachtet, wie Barnum meinen kleinen Freund wiederholt scharf gemustert hatte. Er mochte von diesem deutschen Zigeunerknaben schon gehört haben, ganz bestimmt von dessen Zirkusschiff.
Jetzt aber blieb der Geschäftsmann bei der nächstliegenden Sache, diesmal brachte er aus der Brusttasche keine Papierrolle, sondern ein dickleibiges Notizbuch zum Vorschein, dessen etliche hundert Seiten mit Schrift und Zahlen von mikroskopischer Kleinheit bedeckt waren.
»Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Hauptbuche, aber schon genügend, um unseren Gewinn erkennen zu lassen. Bitte, wollen Sie prüfen.«
Nur ein kleiner Auszug! Mir ward schon jetzt grün und gelb vor den Augen.
»Was haben denn nun die Passagiere für dieses Vergnügen zu zahlen?«, musste sich Karlemann wieder einmischen.
»Das ist ganz verschieden, von zehntausend Dollar an bis zu zweihundert. Ich habe die verfügbaren Plätze auf dem Dampfer verauktioniert, und was nun meine Unkosten anbetrifft, so ersehen Sie alles aus diesem Konto.«
Auch Karlemann machte ein wahrhaft verzweifeltes Gesicht, als er in dem dickleibigen Notizbuche blätterte. Für den war Buchführung erst recht etwas nicht Existierendes.
»Na, was haben Sie denn nun an der ganzen Geschichte verdient, wenn Sie auch schon die Rückbeförderung der Passagiere berechnen?«
»Rund 20 000 Dollar.«
»Was, mehr nicht? Sie wollen uns doch nicht etwa weismachen, dass Sie mit einem Verdienst von 10 000 Dollar, der auf Ihren Teil kommt, da die andere Hälfte uns gehört, zufrieden sind?«
Außer in den Worten hatte die Beleidigung auch schon im Tone gelegen, mit dem Karlemann dies gesagt. Da aber der amerikanische Geschäftsmann ganz ungerührt blieb, wollte ich Karlemann noch weiter handeln lassen, ehe ich mich ins Mittel legte.
»Faktisch nicht mehr! Sehen Sie sich doch meine Unkosten an. Nun ist die Hauptsache aber die, dass der eigentliche Verdienst doch jetzt erst kommen soll.«
»Wieso erst jetzt?«
»Nun, indem sich der Herr Kapitän von den einzelnen Passagieren interviewen und fotografieren lässt.«
»Sie meinen, dass ich mir das bezahlen lasse?«, nahm jetzt wieder ich das Wort.
»Selbstverständlich!«
»O nein, das geht ganz gegen meinen Charakter.«
»Aber geehrter Herr Kapitän, das ist doch die Hauptsache vom ganzen Geschäft, da soll doch erst unser Verdienst anfangen!«
»Nehmen Sie Geld dafür, ich kann mich für so etwas nicht bezahlen lassen.«
»Aber warum denn nicht?! Sie können das Geld ja zu wohltätigen Zwecken verwenden.«
Barnum sprach noch weiter, und es gelang ihm, meinen Widerstand zu brechen. Es war dies sogar ein Beweis der großen Ehrlichkeit dieses Mannes. Denn da ich mich schon bereit erklärt hatte, mich interviewen und fotografieren zu lassen, aber kein Geld dafür anzunehmen, so hätte Barnum ja alles allein in die Tasche stecken können, was er jedoch eben zurückwies, er wollte mit mir teilen.
»So überlassen Sie also mir, die einzelnen Preise zu bestimmen?«
»Gut, machen Sie das alles!«
»Dann können wir ja gleich anfangen.«
»Well, lassen Sie die ›Sultana‹ hier beilegen.«
»Nein, das geht nicht. Jeder Passagier muss einzeln im Boote herübergerudert und dann wieder zurückgebracht werden.«
»Wozu denn das?!«
»Da bin ich Ihnen erst die Erklärung schuldig, dass ich in einem Punkte mein Versprechen, das ich Ihnen gegeben habe, nicht ganz halten kann. In der öffentlichen Aufforderung hatte ich gesagt, dass ich wegen Ihrer Sicherheit von den Passagieren Garantie fordern würde. Denn auf Ihre lebendige Ergreifung steht eine Prämie von 400 000 Pfund Sterling, auf Ihren Tod, sagen wir gleich auf Ihre Ermordung, eine Prämie von 60 000 Pfund...«
»Von 60 000? Ich dachte, es seien nur 50 000.«
»Diese Prämie ist wieder um 10 000 Pfund erhöht worden.«
»Von wem?«
»Es ist in England deshalb abermals eine Sammlung veranstaltet worden.«
»So so. Nun, fahren Sie fort in dem, was Sie vorhin sagen wollten.«
»Es war mir nicht möglich, eine Garantie zu fordern. Das hätte dann doch mehr sein müssen als 60 000 Pfund, und das ist doch nicht gut angängig. Ich habe es also so angeordnet, dass die Passagiere einzeln herübergerudert werden, jeder Herr oder Dame darf Sie nur allein in der Kajüte sprechen.«
»Ja, aber wozu nur diese Separierung?«, fragte ich in tatsächlicher Unwissenheit.
»Nun, sollte jemand doch ein Attentat geplant haben, um sich durch Ihre Ermordung die Prämie zu verdienen — na, dann dürfte es ihn wohl sein eigenes Leben kosten, also hätte solch ein Attentat doch gar keinen Zweck.«
»Ach, Sie glauben wohl gar, ich fürchte mich vor einem Attentat?«, lachte ich belustigt. »Nein, lassen Sie Ihr Schiff mal ruhig anlegen und die Herrschaften herüberspazieren.«
Ich selbst hatte wirklich noch gar nicht daran gedacht, dass solch ein Massenbesuch für mich gefährlich werden könnte, nur Mahlsdorf hatte einmal davon beginnen wollen, war aber von mir gleich abgewiesen worden.
»Und dennoch bitte ich Sie, die Besucher einzeln empfangen zu wollen.«
»Haben Sie denn solche rabiate Subjekte mitgebracht, denen so etwas zuzutrauen ist?«
»Das nicht, ich habe unter der großen Masse von Bewerbern eine gar sorgfältige Auswahl getroffen, habe gar manchen Herrn zurückgewiesen, mir zum Schaden — aber er war mir als Rowdy bekannt. Der Einzelempfang liegt doch in der Natur der Sache, wegen des Fotografierens und so weiter.«
»Nun gut. Ihr Schiff kann ja dennoch herankommen, und was für einen Preis soll ich nun fordern, wenn man mich fotografieren will?«
Barnum griff wieder zur Musterrolle »Sie sehen hier doch hinter jedem Namen zwei Zahlen verzeichnet.«
»Die sehe ich.«
»Die erste bezeichnet die Summe in Dollar, die Sie für jede Fotografie verlangen...«
»Was? 10 000 Dollar für eine Fotografie?!«, rief ich erstaunt.
»Weshalb nicht? Diese Zahl steht doch hinter dem Herzog von Canderbury, und der hat es, das kann der mit einer Hand zahlen. Ich habe mir natürlich meine Leute angesehen, hier der Graf von Mognili braucht, obgleich auch noch ein vielfacher Millionär, bloß 3000 Dollar zu zahlen, dann gibt es bloß noch Hunderte, bei den letzten hatte ich gemeint, uns nur noch mit fünfzig Dollar begnügen zu müssen, sonst könnte doch einmal einer abspringen.«
»Haben Sie denn das den Leuten nicht schon vorher gesagt?«
»O nein.«
»Weshalb nicht?«
»Anfangs hätten sie sich vor solchen Ausgaben doch sträuben können. Sie hätten es vielleicht für närrisch gefunden, hätten gefürchtet, ausgelacht zu werden. Sind sie aber erst einmal an Ort und Stelle, dann zahlen sie alles.«
Ich blickte den Sprecher an. Ja, dieser Mann verstand sein Geschäft. Übrigens ja ein ganz bekannter Trick aller Schausteller. Eintritt einen Groschen — und wenn man drin ist und mit einigem Wenigen abgespeist ist, so kommt die Schauder- und Schreckenskammer, Eintritt zwei Groschen — und dann vielleicht noch ein besonderes Kabinett, vor dem etwa eine dekolletierte Dame steht, Eintritt nur für Herren, fünf Groschen.
»Und was soll hier die zweite Zahl hinter dem Herzog, die 15 000?«
»15 000 Dollar, wenn er Sie während des Fotografierens umarmen will, oder auch nur Arm in Arm, überhaupt in einer vertraulichen Stellung, als wäre er Ihr Freund.«
Ich musste herzlich lachen.
»Und die Herzogin von Lammermore braucht nur 3000 Dollar zu zahlen?«
»Ja, die kann sich mit dem Herzog von Canderbury nicht messen.«
»Dahinter steht aber doch sogar eine 20 000.«
»20 000 Dollar, wenn sie Sie küssen will.«
»Wenn die Fotografie darstellen soll, wie ich sie küsse?«, lachte ich.
»Ob fotografiert oder nicht, jeder Kuss kostet bei der 20 000 Dollar.«
»Ist sie denn wenigstens hübsch?
»Geschmackssache!«, meinte Barnum achselzuckend. »Sie gehen doch hoffentlich darauf ein?«
»Meinetwegen, weil es für die Armen sein soll.«
»Aber halbpart!«
»Jawohl, wie ausgemacht!«, musste ich immer wieder lachen. Wollte der an meinen Küssen verdienen!
Dann hatten wir noch einiges zu besprechen, wie die einzelnen Zusammenkünfte arrangiert werden sollten und anderes mehr, worauf sich Barnum zurückrudern ließ.
Die ›Sultana‹ kam heran und wurde, wie verabredet, in einem Abstand von etwa fünf Metern mit der ›Sturmbraut‹ durch mehrere Balken und Reserverahen zu einem festen Ganzen verbunden.
Denn dicht Bord an Bord zu legen, das hatte auch ich nicht für gut befunden. Da hätte doch kein Verbot, kein Zurückhalten etwas genutzt, diese neugierigen, sensationslüsternen Herren und Damen hätten meine ›Sturmbraut‹ überschwemmt, alles durchstöbert, und daran war mir denn doch nichts gelegen.
So wurde durch ein Brett nur eine schmale Brücke hergestellt, diese war leicht zu bewachen, während die fünf Meter ohne Gefahr für sein Leben niemand zu überspringen wagen durfte.
Der erste, welcher herübermarschierte und zu mir in die Kajüte kam, brachte einen großen Kasten und ein Gestell mit. Es war der Fotograf, dem noch viele andere Kästen mit Platten nachgebracht wurden.
Damals war die Kunst des Fotografierens noch etwas anderes als heute, da gab es noch keine Taschenapparate, und einen Fotografen konnte man sich nicht anders vorstellen, als mit schwarzen Händen, nämlich dauernd geschwärzt durch Höllenstein, salpetersaures Silber. Ein anderes Mittel, um die Platten lichtempfindlich zu machen, gab es damals nicht.
Hierauf erschien Mr. Barnum in Begleitung eines älteren Herren, der nur als Seine Herrlichkeit der Herzog von Canderbury vorgestellt wurde.
Der Engländer fragte nicht viel mehr als nur, was es koste, wenn ich mich mit ihm zusammen fotografieren lasse.
»Zehntausend Dollar.«
Es war mir schwer gefallen, dies zu sagen, ich schämte mich fast — aber das war sofort vorbei, als ich sah, was für große Augen der Herzog da machte.
»Zehntausend Dollar? Sie sind wohl...«
»Was soll ich sein?«, fragte ich in entsprechender Weise. »Ist Ihnen das zuviel? Bitte, dort ist die Tür.«
Das genügte, der Widerstand war gebrochen, und der edle Herzog nahm es auch durchaus nicht übel, sondern zog sein Scheckbuch.
»Auf wessen Namen?«
»Auf Mister Taylor P. Barnum.«
Wir kamen zusammen auf eine Platte, und zwar wünschte der Herzog richtig, dass ich meinen Arm in den seinen legte, und ich tat es, ohne auf Barnums heimliche, aber erregte Zeichen zu achten, dass ich für solch eine intime Stellung eigentlich 5000 Dollar mehr zu fordern hätte.
Als dies geschehen war, wurde der Herzog von einem Matrosen in Empfang genommen, der ihn durch das ganze Schiff zu führen hatte, während Barnum schon den zweiten Besuch hereinbrachte, die Herzogin von Lammermore.
Aber der Leser braucht keine Angst zu haben, dass ich ihm so alle zweihundertdreiundfünfzig Passagiere vorführen werde, die Barnum mitgebracht hatte.
Als ich mich dieser Zahl erinnerte, begann es mir selbst zu grauen. Aber es sollte alles ganz anders kommen.
So will ich auch gar nicht erst die nachfolgenden fünf Personen beschreiben. Ich ließ mich fotografieren, ganz wie gewünscht wurde, meinetwegen hätte ich auch den Kopf zwischen die Beine gesteckt, ließ mich küssen, ganz egal, wie die Betreffende aussah, und wenn sie auch so eine Karpfenschnauze hatte wie die brasilianische Minenbesitzerin, und Barnum steckte immer die Schecks ein.
Nach der Brasilianerin kam Nummer sieben.
»Signor Mognili, Graf von Vidacoste«, stellte Barnum vor.
Ich sah einen schwarzbärtigen Herrn, sah zwei schwarze Augen, die plötzlich wie glühende Kohlen aufleuchteten, sah, wie der Kerl mit einer blitzschnellen Bewegung einen Revolver aus der Tasche riss, sah einen Feuerstrom...
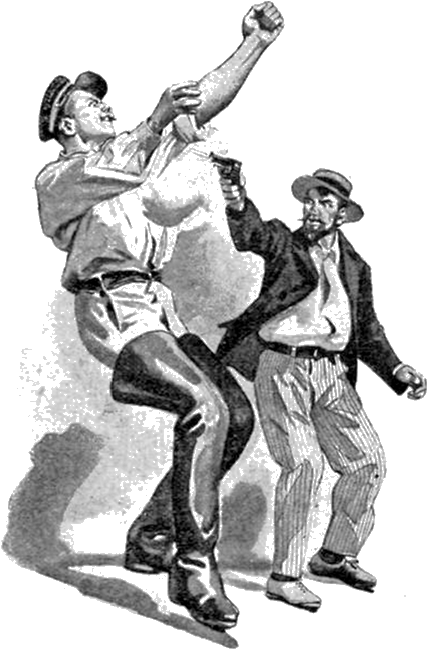
Mehr sah ich nicht, hörte nicht einmal den Knall, fühlte nur einen heftigen Schlag gegen die Herzgegend, im Herzen selbst einen stechenden Schmerz — ich brach zusammen.
Als ich erwachte, fühlte ich mich nach Borneo zurückversetzt, glaubte, soeben von Jokonda aus dem Sarge befreit worden zu sein, in dem man mich zu Tode hatte kitzeln wollen, und wo ich dann angesichts meines Schiffes ohnmächtig geworden war.
Denn wiederum sah ich mich in meiner Koje liegen und neben mir Tischkoff sitzen, aus einem Fläschchen etwas in einen Löffel tröpfelnd.
»Ist Jokonda gerettet?«, flüsterte ich.
Tischkoff sah mich prüfend an.
»Was sagen Sie da? Können Sie sich nicht erinnern, was mit Ihnen geschehen ist?«
»Ach so, ja — ich dachte, ich wäre in Borneo — nein, der Kerl hat auf mich geschossen.«
»Sie können sich auf alles besinnen?«
»Ich bin ganz klar im Kopfe, Signor Mognili, Graf von Vidacoste. Ich dachte, er hätte mich ins Herz geschossen — wenn man im Augenblick des Todes überhaupt noch etwas denken kann.«
»O ja, das kann man recht gut. Und die Kugel wäre Ihnen auch durchs Herz gegangen, wäre sie nicht gerade auf die große, metallene Verschlussplatte Ihrer Brieftasche aufgeschlagen, die Sie in der Innenseite Ihres Hemdes trugen.«
Seit mir Doktor Selo die Brieftasche entwendet, dadurch begünstigt, dass ich sie einfach in der ausgezogenen Jacke hatte stecken lassen, hatte ich mir in alle meine Hemden Taschen machen lassen, da konnte so etwas nicht wieder vorkommen.
Das hatte mir das Leben gerettet.
»Sie waren trotzdem dem Tode sehr nahe. Sie hatten eine hartnäckige Herzlähmung.«
»Hier riecht es recht nach gutem Kognak«, schnüffelte ich zunächst.
»Ja, wir haben Sie stundenlang mit Branntwein gerieben, frottiert und massiert, bis der Herzschlag mit voller Stärke zurückkehrte, worauf Sie in einen erquickenden Schlaf fielen.«
»Warum hat der Kerl eigentlich auf mich geschossen?«
»Eine Tat des Wahnsinns. Denn ist er wirklich der schwer begüterte Graf von Vidacoste, so kann ihm gar nicht viel an der Million gelegen sein. Hingegen ist dieser italienische Edelmann wegen seiner prahlerischen Eitelkeit bekannt, er hat sich durch Ihre Ermordung einen Namen machen wollen.«
»Was sagt er denn selbst über seine Tat?«
»Der konnte gar nichts mehr sagen.«
»Was?«
»Der war auf der Stelle tot.«
»Selbstmord? Oder er ist doch nicht etwa... gelyncht worden?«
»Sie könnten diesen Schuft wohl auch gar noch bedauern?«
»Es wäre mir wenigstens höchst unangenehm, wenn meine Jungen etwa Lynchjustiz ausgeübt hätten.«
»Nein, das haben Sie gleich selbst besorgt, und das gründlich.«
»Ich?«
»Sie sind doch auf ihn zugestürzt und haben ihm mit der Faust eins auf den Kopf versetzt, dass er gleich mit zerschmettertem Schädel niederstürzte.«
»Ich?!«, konnte ich nur nochmals wiederholen, denn dessen vermochte ich mich absolut nicht zu entsinnen. Hatte ich es aber getan, dann empfand ich auch keine Gewissensbisse darüber.
»Was sagt denn nun Barnum dazu?«
»Ja, was sollte der dazu sagen? Da halfen keine Entschuldigungen. Er ist sofort abgefahren.«
»Abgefahren?«
»Gewiss. Unter Ihren Leuten brach eine kleine Art Meuterei aus. Aber im besten Sinne gerechtfertigt. Schon beim siebenten Besuch war ein Mordanschlag geschehen, die Matrosen wollten das Leben ihres Kapitäns, ohne den sie nichts mehr sind, nichts mehr auf dieser Erde zu suchen haben, nicht fernerhin aufs Spiel setzen. Es wären ja noch zweihundertfünfzig solcher Besuche zu erledigen gewesen. Mahlsdorf trat im Namen aller ganz energisch auf. Und was sollte Barnum tun? Der war ja selbst ganz kleinlaut geworden. So wurde die Verbindung zwischen den Schiffen gelöst. Mahlsdorf hat wohl ganz recht gehandelt, wenn er sagte, Barnum solle das ganze Geld, welches er bisher verdient habe, allein behalten.«
»Natürlich, natürlich!«
»Barnum schied mit dem Versprechen, Ihnen die Hälfte dennoch zukommen zu lassen.«
»Never mind, sprechen wir doch gar nicht von diesem Gelde!«
»Lord Seymour und die anderen vier Gentlemen haben sich an Bord der ›Sultana‹ begeben.«
»Weshalb?«
»Sie wollen nach New York, um sich neue Jachten zu kaufen.«
»Gut, dass ich deren Gesellschaft endlich los bin, sie wurde mir schon langweilig. Was sagten denn aber die anderen Passagiere?«
»Na, Kapitän, ich denke, wie die die Sache auffassen, das kann Ihnen ebenfalls gleichgültig sein.«
Da fuhr ich empor. Erst jetzt fiel mir das Zittern der Schiffsplanken auf.
»Wir dampfen doch!«
»Schon seit acht Stunden, wir befinden uns bereits in der Fucusbank. Ja, Kapitän, nun etwas anderes, der Hauptgrund, weshalb wir die ›Sultana‹ sofort verlassen mussten. Sind Sie fähig, eine Nachricht zu vernehmen, die Sie mehr aufregen wird?«
Es war dies nur eine Vorbereitung gewesen, denn Tischkoff war sonst nicht der Mann, der unnütze Worte verschwendete.
»Sprechen Sie!«
»Wir haben ja nicht täglich Möwen nach der Fucusinsel abgeschickt. Die letzte vor vier Tagen, wir erhielten prompt die Antwort, dass dort alles gut stände. Als nun die ersten Besuche von der ›Sultana‹ herüberkamen, fiel es Karlemann ein, dem diese ganze Geschichte ein Dorn im Auge zu sein schien, sich mit seinen Möwen zu beschäftigen, eine nach der Insel zu entsenden. Nur mit einem Gruße. Die Möwe blieb recht lange aus. Nach seiner Berechnung hätte sie schon in drei Stunden zurück sein können, und sie kam erst in vier Stunden wieder, und zwar... mit demselben Zettel, er war ihr gar nicht abgenommen worden. Karlemann klopfte mich sofort heraus, wir schickten gleich mehrere Möwen mit Anfragen ab — es kehrten nicht einmal alle zurück, und diejenigen, welche wiederkamen, hatten noch denselben Zettel, er war ihnen nicht abgenommen worden. Ja, Kapitän, dort auf der Insel ist etwas nicht in Ordnung, wir müssen sogar das Schlimmste fürchten. — Kapitän, was ist Ihnen?!«, setzte Tischkoff erschrocken hinzu.
Ja, mit mir ging etwas ganz Merkwürdiges vor sich.
Ich fühlte plötzlich meinen Herzschlag aussetzen, alles in mir wurde eiskalt, ich wollte sprechen, aber vermochte es nicht, ich war bewusstlos, und dennoch hörte ich Tischkoff ganz deutlich sprechen.
Ich habe von den Empfindungen Scheintoter gelesen. Dieselben hatte ich. Ja, ich war tot — und dennoch lebte ich — aber die Ewigkeit war an mich herangetreten... anders kann ich es gar nicht beschreiben.
Ich habe schon früher häufig erwähnt, dass ich manchmal in einen eigentümlichen Zustand verfalle, und das von klein auf. Besonders wenn einmal eine große Gefahr an mich herantritt, oder wenn ich furchtbar gereizt werde.
Während da innerlich bei mir plötzlich alles kocht, werde ich äußerlich ganz ruhig, ich handle blitzschnell scheinbar mit kaltblütigster Überlegung, indem ich stets das Richtige treffe, genau den Handgriff ausführe, der am nötigsten ist, während ich in Wirklichkeit absolut nicht weiß, was ich tue.
Dieser Zustand hier war wiederum ein ganz anderer. Er mochte noch eine Folge der eben erst überstandenen Herzlähmung sein. Immerhin, es war ein anormaler Zustand, ich muss für Zustände dieser Art doch veranlagt sein.
Übrigens war er ganz plötzlich wieder vorüber, ich konnte wieder sprechen.
»Was mag da geschehen sein?«, fragte ich ganz ruhig, während sich mein Herz dabei schmerzhaft zusammenschnürte.
»Die Möwen könnten es erzählen — wir müssen uns noch vier Tage gedulden.«
»Ja, gedulden«, wiederholte ich, und dann brach ich in ein schreckliches Lachen aus.
Und mit diesem letzten Worte und mit diesem Lachen müssen wir Jansens persönliche Erzählung schließen, denn hiermit schließt auch sein eigenes Tagebuch.
Wohl hat er dann noch genug geschrieben, aber nur noch philosophische Reflexionen über die Nichtigkeit dieses Daseins.
Über seine eigenen Erlebnisse hat er dann selbst nicht mehr berichtet, konnte es gar nicht.
Nicht, dass er ständig in einem traumhaften Zustande gehandelt hätte, aber jedenfalls war sein ganzes Leben durch eine seelische Verschiebung in eine andere Phase eingetreten. Mag die vorübergehende Herzlähmung daran schuld gewesen sein, oder das, was er erst später auf der Fucusinsel erleben sollte.
Er hätte übrigens sein Tagebuch gar nicht weiter fortführen können. Denn anscheinend blieb er äußerlich noch ganz derselbe, Abenteuer und Gefahren suchend, lebenslustig, humorvoll, vielleicht mehr als zuvor, aber das entsprang jetzt alles einer anderen Quelle.
In der Hinterlassenschaft des alten Leuchtturmwächters wurden ja noch viele andere Manuskripte vorgefunden, von anderer Hand stammend, wahrscheinlich hat auch der Maler Harry van Zyl viel mit dazu beigetragen, und diesen Aufzeichnungen wollen wir von jetzt an folgen.
Es war Mitternacht, als Jansen an Deck kam. Seit vier Stunden schon durchschnitt die ›Sturmbraut‹ mit der Messervorrichtung den grünen Fucus, und sie würde das noch fünf weitere Tage zu tun nötig haben, ehe man die Insel in Sicht bekommen konnte; denn diesmal drang man von Norden her in die Fucusbank ein, und das war ein viel weiterer Weg als von Osten oder Westen.
Trotzdem brauchten die Möwen zu diesem Wege nur anderthalb Stunden, wobei allerdings zu bedenken ist, dass die ›Sturmbraut‹ durchaus nicht ihre ganze Schnelligkeit entwickeln konnte. Wohl dampfte sie mit voller Kraft, aber der zähe Seetang war doch äußerst hinderlich, zumal die Schraube ihn erst immer zerreißen musste, und die Wirkung des ständig herrschenden Gegenwindes empfand man hier doppelt. So machte die ›Sturmbraut‹ in der Stunde kaum sechs Knoten.
Die Offiziere gingen auf der Kommandobrücke abwechselnd Wache, Jansen selbst schritt zwischen Fock- und Kreuzmast hin und her, und das vier Tage und Nächte lang, seinen Spaziergang kaum einmal unterbrechend, jedenfalls sich niemals setzend, von Schlaf gar nicht zu sprechen.
Kann denn ein Mensch vier Tage und vier Nächte ohne Schlaf aushalten?
Ha, man lasse sich von einem alten Soldaten erzählen, der Feldzüge mitgemacht hat, besonders bei Belagerungen, wenn alle Nerven ständig angespannt sein müssen, um den stürmenden Feind rechtzeitig zu bemerken, da kommen noch ganz andere Perioden ohne Schlaf vor — man denke nur an die Belagerung von Port Arthur, da sind ganze Regimenter wochenlang ohne Schlaf gewesen — und jeder Seemann kann von solchen schlaflosen Perioden vieler Tage erzählen.
Die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ fand also gar nichts Besonderes dabei, dass ihr Kapitän so rastlos auf und ab wanderte, wie er das aushalten konnte. Sie alle litten ja selbst unter der fürchterlichen Ungewissheit über das Schicksal der auf der Insel Zurückgebliebenen.
Diese Ungewissheit oder vielmehr diese Qual ward auch noch dadurch immer frisch gehalten oder sogar verstärkt, dass man ab und zu eine Möwe abschickte, und kehrte sie überhaupt wieder zurück, so brachte sie keine Antwort, sondern denselben Zettel mit.
Etwas anderes war es, was die Matrosen nicht begreifen konnten, weshalb sie für ihren Kapitän fürchteten.
Jansen hat ja selbst oft genug gesagt, wie er wohl alle Strapazen mit Leichtigkeit aushalten konnte, Hitze und Kälte und Nachtwachen — nur den Hunger nicht. Es ist ja auch ganz leicht erklärlich, dass die stärksten Körper am leichtesten zusammenklappen, wenn ihnen nicht die genügende Quantität Nahrung zugeführt wird, um die verbrauchte Kraft zu ersetzen.
Und nun nahm dieser Hüne vier Tage und vier Nächte keinen Bissen zu sich. Und merkwürdig war dabei, dass sich sein Aussehen durchaus nicht änderte, da war von einem Zusammenfallen oder hohlen Augen keine Rede, und sein Schritt blieb stark und doch elastisch wie in seiner besten Zeit.
Das machte: alle Tätigkeit hatte sich auf die Seele konzentriert, nur diese arbeitete, die Tätigkeit des Körpers kam dagegen gar nicht in Betracht, und der Geist, die Seele, braucht keine konsistente Nahrung.
Aber beängstigend war es doch, gerade in den Augen dieser Matrosen, die wohl schwerlich oft über die Existenz einer Seele nachgrübelten.
Es war am dritten Tage, als Bernhard, der Steward, ihm in den Weg trat.
»Herr Kapitän!«
»Was gibt's?«
»Das Mittagsessen ist serviert.«
»Räume es wieder fort!«, sagte Jansen ungeduldig und wollte an dem Steward vorbei.
Aber dieser vertrat ihm zum zweiten Male den Weg.
»Ich habe es schon dreimal abgeräumt, Frühstück und Abendbrot auch.«
Mit großen Augen stierte Jansen den Sprecher an, und ein immer wilderer Ausdruck prägte sich darin aus.
»Was willst du?!«, stieß er dann mit heiserer Stimme hervor.
»Herr Kapitän, essen Sie doch, sonst ist man ja gar kein Mensch mehr.«
Der wilde Ausdruck verschwand, nur finster blieben die Augen. »Mensch, wenn jetzt ein Offizier, Mahlsdorf oder Martin, mir so wie du den Weg vertreten hätte, um mir zum Essen zu raten — es wäre vielleicht sein Tod. Bin ich denn ein Kind? Räume ab!«
Und Jansen setzte seinen Weg fort, der brave Steward hatte nichts erreicht.
Ein neuer Morgen brach an, der des vierten Tages.
Als Mahlsdorf nach der Kommandobrücke schritt, um den zweiten Steuermann abzulösen, ward er vom Kapitän angehalten.
Jansen hatte mit einem Male ein ganz anderes Gesicht, ein heiteres, fast lachendes, aber... es lag auch etwas Verzerrtes darin.
»Mahlsdorf, kennt Ihr den Prediger Salomo?«
»Den in der Bibel? Ja, so etwas, aus der Schule.«
»Wie lautet der zwölfte Vers im dritten Kapitel?«
»Nee, so weit geht meine Kenntnis nun freilich nicht.«
»Er lautet: Darum merke ich, dass nichts Besseres ist, denn fröhlich sein und sich gütlich tun. — Und dasselbe spricht der weiseste aller Weisen, zugleich der Liebling Gottes, immer wieder aus: dass es in dieser Welt nichts Besseres gibt, als fröhlich in seiner Arbeit zu sein und sich sonst vergnüglich zu tun, gut zu essen und zu trinken; denn alles, alles andere sei eitel. Wer weiß, sagt er, dem sonst nichts verborgen war, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes unterwärts unter die Erde? Mensch, genieße deine fröhlichen Stunden, solange du lebst, und kümmere dich nicht um das Spätere. Das sagt dieser gottweise König immer und immer wieder. So im vierundzwanzigsten Verse des zweiten Kapitels, im siebzehnten Verse des fünften Kapitels, das ganze zwölfte Kapitel ist ein Lobgesang auf das, was man heute Materialismus nennt.«
Mahlsdorf blickte seinen bibelfesten Kapitän etwas unsicher an. Aber er freute sich, dass dieser ihn überhaupt wieder einmal ansprach, freute sich über sein heiteres Aussehen — die Verzerrung der Züge übersah er dabei.
»Ei, Kapitän, seid Ihr aber in der Bibel bewandert! Das hätte ich Euch doch gar nicht zugetraut.«
»Nicht?«, lachte Jansen. »Ich habe doch Pastor werden sollen — hahahaha — ich Pastor — hahahaha — ich Pastor, ich Pastor, hahahaha — hahahaha!!«
Unter diesem Lachen ließ Jansen den Steuermann stehen, und dieser blickte ihm ganz verblüfft nach, sogar etwas ängstlich.
»Was für ein merkwürdiges Lachen! Das hat gar nicht natürlich geklungen.«
Die Hauptsache aber war, dass sich der Kapitän sofort ein ausgiebiges Frühstück bestellte. Aber dann hatte es hiermit doch eine besondere Bewandtnis. Als nach einer Viertelstunde die dampfenden und kalten Schüsseln auf dem Tische der Kajüte standen, sagte Jansen:
»Nein, trage es in meine Kabine. Ich will dann gleich schlafen gehen, ich bin hundemüde.«
Seit wann aß denn der Kapitän in seiner Schlafkabine?
Er kam erst in der Nacht wieder zum Vorschein, er hätte also fast zwanzig Stunden schlafen können, aber wenn der Steward an der Tür gelauscht, hatte er den Kapitän immer murmeln hören.
Als Bernhard dann die Kabine aufklarte — d. h. aufräumte — zeigte sich, dass der Kapitän wohl in der Koje gelegen hatte, aber wohl recht unruhig, alles war herausgerissen, die obere Decke gleich direkt zerfetzt. Und die sämtlichen Schüsseln waren wohl geleert, dann aber entdeckte Bernhardt an der Metalleinfassung des Bullauges, dass der Kapitän die Speisen zum Fenster hinausgeschüttet hatte, der Fensterrand verriet die ganze Speisekarte, und Jansen hatte vergessen, Messer und Gabel wenigstens zu beflecken.
Er hatte einfach wiederum nichts gegessen, dagegen wohl die ganze Flasche Portwein geleert.
Wieder während der ganzen Nacht ein ununterbrochener Spaziergang an Deck, dazu nur eine Zigarre nach der anderen geraucht, und dann, als die Sonne aufging, stand er auf der Kommandobrücke.
»Da liegt sie!«
Ja, da lag sie, nämlich ihre Heimat, die Fucusinsel mit dem Berge.
Von dieser nördlichen Seite aus aber hätte man auf ihr niemals Leben erblicken können, selbst die Möwenstation war von hier aus verdeckt.
Die ganze Insel musste umfahren werden, was wenigstens zwei Stunden in Anspruch nahm.
Die Erregung unter den Matrosen war natürlich eine ungeheuere, nur dem Kapitän war nichts von einer solchen anzumerken, er stand wie eine eherne Statue auf der Brücke, nach der Insel blickend, auch das tiefbraune Gesicht wie aus Erz gegossen.
Aber da ereignete sich etwas, was doch einmal seinen inneren Zustand verriet.
Zum ersten Male während dieser Fahrt kam Tischkoff wieder an Deck, und bei seinem Anblick schrak Jansen förmlich zusammen, und dann war er mit dem Sprunge eines Panthers von der Kommandobrücke herab, stand dicht vor dem alten Herrn.
»Mann, Sie sind doch allwissend — wenigstens wissen Sie mehr als andere Menschen — Sie haben schon genug Proben von fast übernatürlichen Fähigkeiten gezeigt — ja, Sie sind unbedingt ein Hellseher — — warum lassen Sie mich hier verzweifeln, warum sagen Sie nicht, was dort geschehen ist, warum sagen Sie es nicht, warum sagen Sie es nicht, warum sagen Sie es nicht...«
Die umstehenden Matrosen erschraken furchtbar.
Schon von Anfang an war das Gebaren des Kapitäns furchterregend gewesen; mit heiserer Stimme hatte er die ersten Worte hervorgestoßen, und immer kreischender wurde seine Stimme, und jetzt packte er Tischkoff mit seiner riesigen Faust vorn an der Brust, um ihm die Antwort herauszuschütteln.
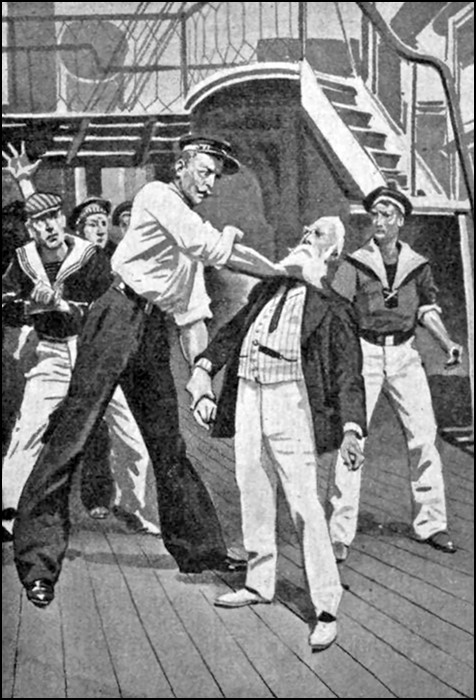
Da aber beobachtete man das Seltsame. Dieser Griff der herkulischen Faust hätte wahrscheinlich einen starken Eichbaum zum Wanken gebracht,
wenn dieser nur irgendwie zu packen gewesen wäre — der schlanke, schmächtige Russe aber stand unberührt, als wäre er von Stein und in das Deck eingemauert.
Ruhig blickte er den so furchtbar Aufgebrachten an.
»Kapitän Jansen, fassen Sie sich. Sie tun mir unrecht. Bei Gott, ich weiß es nicht — sonst würde ich es Ihnen schon gesagt haben.«
Und da war die seltsame Aufwallung ebenso schnell wieder vorüber. Nur noch ein Blick von schrecklicher Wildheit in das faltige Gesicht, dann verwandelte sich dieser Blick, er wurde eher schwermütig, und Jansen zog seine Hand zurück, um sich damit über die Stirn zu fahren.
»Ach, mein Kopf! Verzeihen Sie mir, Mister Tischkoff — ich wusste gar nicht, was ich tat.«
Mit diesen Worten kehrte er auf die Kommandobrücke zurück und blieb da nach wie vor ganz ruhig stehen.
Die Leute aber hatten etwas gesehen, was sie an ihrem Kapitän noch nie beobachtet hatten.
»Gerade, als ob er wahnsinnig geworden wäre!«, wurde scheu geflüstert.
Noch eine Drehung, und seitwärts vor ihnen lag die ›Indianarwa‹.
Ja, was war das? Weshalb wurden die Möwen nicht mit der Rückantwort abgesandt? An Deck des Riesendampfers bewegten sich doch Menschen, und wer konnte das anders sein als die zurückgebliebenen Matrosen?
So konnte man denken, wenn man nur seinen Augen trauen wollte.
Aber das Fernrohr erzählte alsbald etwas anderes.
»Englische MarineUniformen!! Und sie haben Geschütze aufgefahren!!«
Anders war es nicht. Die Zurückgebliebenen hatten gar keine Kanonen besessen, und dort standen zwei große Schiffsgeschütze, ganz abgesehen von den englischen Blaujacken.
»Mahlsdorf, Martin«, flüsterte Jansen mit blassen Lippen, »seht ihr nicht welche von unseren eigenen Leuten?«
»Nein, Herr Kapitän.«
»Keinen einzigen?«
»Nein.«
»Keines der Weiber?«
»Nein, nur fremde Matrosen, und zwar englische.«
»Dann ist's ein Faktum, dann leide ich doch nicht an Halluzinationen. Ein Glück, ein großes Glück!«
»Sie laden die Geschütze!!«, erklang da der Ruf.
Die englischen Kriegsschiffsmatrosen, deren Schiff aber nicht zu erblicken war, hatten sich schon an den beiden Geschützen zu schaffen gemacht, exerzierten regelrecht — und da zwei Feuerströme mit nachfolgendem, donnernden Krachen — die eine Granate flog weit über die ›Sturmbraut‹ hinweg, die zweite tiefer zwischen Groß- und Kreuzmast hindurch.
»Recht so, recht so, das nenne ich einen warmen Empfang, hahahaha!«, lachte Jansen. »Die sind wenigstens gleich ehrlich, das lobe ich mir. An die Geschütze!!«
Aber die ›Sturmbraut‹ sollte gar nicht dazu kommen, mit ihren Feuerschlünden zu sprechen.
Drüben waren die Geschütze nochmals geladen worden, das eine gab einen regelrechten Feuerstrom von sich, das andere war plötzlich von einem ganzen Feuermeere eingehüllt, ehe es durch Rauch unsichtbar wurde.
Außerdem gleichzeitig furchtbare Schreie, die man noch bis hierher vernahm.
»Da ist der Schuss hinten zum Verschlusskopf herausgefahren oder das ganze Rohr ist gesprungen«, lautete sofort das Urteil der Sachverständigen.
Als sich der Rauch verzogen hatte, sah man es auch sofort bestätigt. Nur das eine Geschütz war noch vorhanden, das andere war verschwunden, und ringsherum war das Deck mit liegenden Menschen bedeckt, andere hinkten, krochen davon, man vernahm noch immer ihr Schmerzgeheul. Was sonst noch lebte, stand vor Entsetzen gelähmt da.
»Feine Geschütze!«, sagte Jansen trocken. »Doch merkwürdig, dass die Engländer immer solches Pech haben!«
Gleich darauf ward dort drüben eine weiße Flagge gezeigt.
»Die Dummköpfe, konnten die das nicht eher tun, mussten sie erst auf uns feuern? Das kann ihnen das Leben kosten.«
Die ›Sturmbraut‹ dampfte heran, bis sie an dem Riesenschiff anlegte, an ihrer gewöhnlichen Stelle.
Von Weitem hatte man das Deck desselben übersehen können, in der Nähe war das nicht mehr möglich. Deshalb hatte Mahlsdorf einige Matrosen in die Takelage hinaufgeschickt.
»Wir müssen doch darauf gefasst sein, dass die uns eine Falle bauen«, sagte er zu Jansen.
»Deshalb eben haben Sie einen Beobachtungsposten hinaufgeschickt, und dass Sie diese Vorsichtsmaßregel getroffen, habe ich bei meinem ersten Offizier ganz selbstverständlich gefunden, und im Übrigen behalten Sie Ihre Bemerkungen für sich, wenn ich Sie nicht frage — wir sind jetzt im Kriege, die Gemütlichkeit hat ein Ende!«, war Jansens harte Entgegnung.
Dass aber so etwas an Bord nicht übelgenommen wird, ist schon häufig genug erwähnt worden. Jeder Soldat kann ja schon im Manöver manchmal beobachten, wie da so ein patentes Offizierchen, dessen Empfindsamkeit in bezug auf Ehre sonst der einer Jungfer gleicht, von seinem nächsten Vorgesetzten hochgenommen wird, und es darf mit keiner Wimper zucken.
Jansen stieg als erster das Fallreep empor, nicht einmal einen Revolver in der Hand, aber ebenso selbstverständlich findend, dass ihm Mahlsdorf, der von der Freiwache war, mit der Hälfte der ganzen Mannschaft folgte, und diese war nun allerdings bis an die Zähne bewaffnet.
An Deck standen vierzehn englische Kriegsschiffsmatrosen aufgebaut, darunter auch zwei Maate, Unteroffiziere, die meisten mehr oder weniger blutend, ohne Waffen, vor der Front ein junger Offizier, den gesenkten Degen an der Spitze mit der Linken gefasst, während der rechte Arm, aus dessen Schulter das Blut reichlich floss, schlaff herabhing.
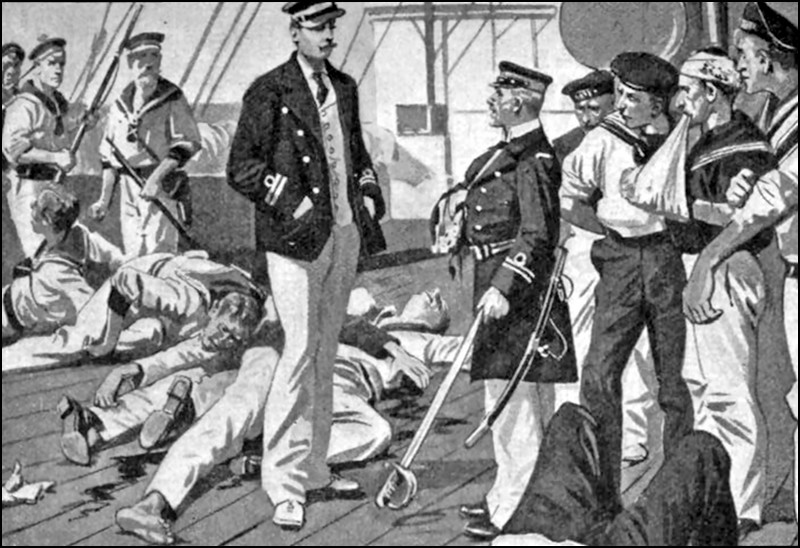
Dann lagen noch neun Mann da, die Opfer der Geschützexplosion, tot, schrecklich verstümmelt, verbrannt, noch röchelnd. Sonst hatte sich alles, was sich noch auf den Füßen halten konnte, aufgestellt.
Wie bei einem Spaziergange promenierte Jansen gemächlich auf den Offizier zu, blieb mit eiserner Ruhe vor ihm stehen.
»Nun? Wer sind Sie denn?«
»Leutnant Raleigh, dritter Wachoffizier der ›Glory of Scotland‹.«
»Wie kommen Sie denn eigentlich hierher?«
Es lag etwas Fürchterliches in dieser Ruhe, ja, fast Gemütlichkeit, mit welcher Jansen seine Fragen stellte, angesichts dieser blutbefleckten Soldaten, angesichts der ganzen Situation, da man ja noch gar keine Gewissheit über das Vorangegangene hatte.
Diese atemberaubende Fürchterlichkeit empfanden wenigstens seine hinter ihm stehenden Leute, und das ist es ja eben, weshalb wir Jansen gar nicht mehr sprechen lassen könnten, selbst wenn er dies beschrieben hätte. Aber ein Selbstbiograf kann so etwas, was seinen eigenen Gefühlen entspringt, gar nicht schildern, oder wie würde denn das klingen! Das geht einfach nicht. Es liegt ein tiefer Sinn dahinter, wenn der berühmte Philosoph Thomas Carlyle, der Scharfsinnigsten einer, sagt, dass auch die aufrichtigste Selbstbiografie ein frommer Selbstbetrug ist.
»Ja, wie kommen Sie denn eigentlich hierher?«, erklang es also so gemütlich, wie man das auf der Straße einen Bekannten fragt.
»Wir haben diese Insel gestürmt.«
»Ach was! Die ›Glory of Scotland‹?«
»Ja.«
»Ein englisches Linienschiff, nicht wahr, erst vor einigen Jahren erbaut?«
»Ja.«
»Na, wie ist es denn dabei gegangen? Wo sind denn nun die Verteidiger?«
»Sie sind... sie sind...«
Auch der junge Offizier empfand das Furchtbare dieser unnatürlichen Situation, sein sonst gebräuntes Antlitz hatte eine wächserne Leichenfarbe angenommen, seine Brust rang keuchend nach Atem, und das war nicht nur eine Folge seiner Verwundung.
»Geflohen? In der Luft verschwunden? Oder halten sie sich irgendwo auf der Insel versteckt?«
»Sie sind gefallen.«
»Alle?«
»Alle, alle! Wie die Löwen haben sie gekämpft.«
»Wie die Löwen haben sie gekämpft?«, wiederholte Jansen, immer in demselben nachlässiggleichmütigen Tone. »Na, das wollte ich auch meinen — ich, Richard Jansen war nämlich ihr Kapitän. So so, die sind also alle tot.«
»O, Kapitän, Kapitän, das ertrage ich nicht länger!!«, erklang es da hinter Jansen stöhnend. Die Stimme kam aus Mahlsdorfs Munde, und er drückte die Empfindungen aller anderen aus.
»Können's nicht ertragen?«, meinte Jansen, ohne sich umzublicken. »O, wir werden wohl noch etwas ganz anderes ertragen müssen, und was man nicht kann, lernt man eben. Was ist denn da weiter dabei?
Es geht dem Menschen wie dem Vieh, wie dies stirbt, so stirbt auch er, und haben alle einerlei Odem, und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh, denn es ist alles eitel, es fährt alles an einen Ort, es ist alles von Staub gemacht und wird wieder zu Staub — spricht der Prediger Salomo im dritten Kapitel Vers achtzehn... nein, Vers neunzehn bis zwanzig.«
»Der Käpt'n ist irrsinnig geworden!«, ward hinter ihm geflüstert.
»Wahnsinnig? I, Gott bewahre!«, erklang es so gemütlich wie immer. »Also tot, tot, alles tot! Ja, mein lieber Leutnant, da waren doch auch eine ganze Masse Frauen — gegen achtzig — unsere Frauen — sind die auch tot?«
»Alles, alles tot!«, brachte der Gefragte mühsam hervor.
»Totgeschossen? Mit Kaliber acht? Oder mit Kanonen? Mit dem Bajonett?«
»Nein, nein!«
»Was denn sonst?«
»Dort, dort!«
Der Offizier ließ den Degen fallen, um seine gesunde Hand ausstrecken zu können; alles drehte sich um, folgte der angegebenen Richtung — da sah man etwas, was man noch gar nicht bemerkt, weil alles vorhin nur die ›Indianarwa‹ im Auge gehabt hatte.
Da sah man, etwa einen Kilometer von der Küste der Insel entfernt, auf der schwimmenden Wiese es sich wie einen Hügel wölben, der früher nicht vorhanden gewesen.
»Hm, sieht fast wie ein Grabhügel aus«, meinte Jansen, und seine Gemütsruhe dabei kann gar nicht oft genug betont werden, denn das eben war ja das Furchtbare bei der ganzen Sache, »wie ein Hünengrab.«
»Dort liegt die ›Glory of Scotland‹ begraben«, stöhnte der Leutnant.
»Wie ist denn das gekommen?«
»Sie dampfte ab — sie kannte ja die Gefahr — plötzlich stoppte sie — ein Rennen an Deck — verzweifelte Versuche, sich von der grünen Umschlingung zu befreien — das Land auf andere Weise zu erreichen — Boote, Bretter wurden ausgesetzt — vergebens, alles vergebens — langsam wurden Schiff und Mannschaft in die Tiefe hinabgezogen, langsam, langsam, langsam, langsam...«
Jetzt war es der junge Offizier, vor dem man sich entsetzen konnte — wie er das ›langsam‹ mit immer mehr ersterbender Stimme fortwährend wiederholte, wie er dabei an allen Gliedern zu zittern begann... er machte etwas Schreckliches, das er erlebt, geschaut hatte, im Geiste noch einmal durch, und alle Zuhörer mit ihm.
Nur auf Jansen schien dies alles gar keinen Eindruck zu machen.
»Nun, und wo sind denn die Weiber?«
»Sie liegen ebenfalls dort begraben.«
»Alle?«
»Ja — nein — nicht alle konnten gefangen davongeführt und an Bord des unglücklichen Schiffes gebracht werden.«
»Weshalb nicht alle?«
»Sechs — sieben von ihnen begingen Selbstmord.«
»Aha, aha! Also sieben von ihnen haben Selbstmord begangen? Bravo! Sich erschossen?«
»Die meisten haben sich das Messer in die Brust gestoßen, oder — oder — sie haben die Matrosen aufgefordert, sie niederzuschießen, sie niederzustechen...«
»Und die dazu aufgeforderten Matrosen taten es?«
»Mann, Mann, Kapitän, nun lasst mich aus mit Euren Fragen, Ihr seid ja kein Mensch!!«, schrie da der Leutnant in tiefster Seelenqual auf, sich die gesunde Hand vors Gesicht schlagend.
»Und Ihr seid kein Waschlappen!!«, herrschte ihn Jansen an, nicht donnernd, vielmehr ganz leise, aber doch in einer Weise, dass er sofort die Hand wieder sinken ließ.
»Also die Matrosen kamen der Aufforderung nach?«
»Ja, ja, es waren die letzten, die noch gegen uns kämpften, bis sich auch diese in unsere Bajonette stürzten.«
»Hat sich denn keiner ins Gebirge geflüchtet, wo er euch doch besser aus dem Hinterhalte beschießen konnte?«
»Kein einziger. Der letzte fiel im offenen Kampfe.«
»Brav gemacht, brav gemacht!«
»Nicht einmal einen Verwundeten fanden wir dann. Der schon Sterbende hat sich noch das Schiffsmesser ins Herz gestoßen.«
»Bravo, bravo, Kinder!!«, wandte sich Jansen an seine Leute. »Klingt das, was wir da zu hören bekommen, nicht wie himmlische Sphärenmusik?«
Was sollten die Leute antworten, was überhaupt denken? Scheu starrten sie ihren Kapitän an, sie verstanden ihn ja gar nicht, mussten ihn doch für wahnsinnig halten.
»Hat denn keine der Frauen mitgekämpft?«
»Ja, eine, ein Mädchen.«
»Ein Mädchen? Welches?«
»Wir kannten sie ja fast alle — es war die...«
»Die Lady Maud Plantagenet, Prinzess von Suffolk«, fiel Jansen ein.
»Ja, sie war es. Sie kämpfte wie eine Löwin; wir wollten sie schonen, obgleich ihre Kugeln unsere Reihen lichteten — dann, als wir zum Sturme übergingen, rannte sie in unsere Bajonette.«
»Herrlich, herrlich!!«, jubelte Jansen mit einem Gesicht, als ob er den Himmel offen sähe. »Ja, sie war eine Enkelin des Königs Richard Löwenherz! Mann, Sie kommen mit mir an Bord, Sie müssen meinem Maler die einzelnen Szenen angeben, das muss für die Ewigkeit verherrlicht werden. — Und war da nicht eine Frau mit einem Kinde?«
»Die Lady von Leytenstone!«, flüsterte der Leutnant scheu.
»Nun?«
»Dort!!«
Wieder deutete der junge Offizier nach dem grünen Grabhügel auf der schwimmenden Wiese, Jansen blickte einmal hin, dann senkte er den Kopf, um... aufmerksam seine Stiefelspitzen zu betrachten.
Das war der ganze Eindruck, den die Nachricht von dem Tode des Weibes, das er so heiß geliebt, und seines Kindes auf ihn hervorbrachte... äußerlich!! Das hinzuzusetzen darf nicht vergessen werden.
Dann hob er mit einer raschen Bewegung wieder den Kopf.
»So. Alles tot! Dann wäre das erledigt. Ich kann niemanden wieder lebendig machen. Nun wollen wir die Sache von der geschäftlichen Seite aus betrachten. Wie kommt die ›Glory of Scotland‹ überhaupt hierher?«
»Korvettenkapitän Sir Falking erhielt am 10. Juni den Befehl, mit der ›Glory of Scotland‹, welche in Portsmouth lag, nach Kapstadt zu gehen. Unterwegs wurde Lissabon angelaufen. Hier kam ein Herr an Bord, den uns Kapitän Falking einmal bei Gelegenheit als Mister Hobby oder Holly vorstellte. Sonst sind wir mit dem Herrn, der uns dann begleitete, gar nicht mehr zusammengekommen, sodass ich nicht einmal seinen nur einmal gehörten Namen angeben kann. Er war Gast des Kapitäns, hielt sich nur in der Kapitänskajüte auf, war für uns ebenso unnahbar wie der Kapitän selbst. Die Hauptsache aber ist, dass in einer Lissaboner Werftschmiede auf Anordnung dieses Herrn einige lange Messer angefertigt wurden, deren Zweck uns zuerst durchaus unverständlich war. Da lag überhaupt ein Geheimnis vor. Dieser Mister Hobby oder Holly schien dem Kapitän Falking zuerst gar nicht bekannt gewesen zu sein, dann staken sie immer zusammen...«
»Fassen Sie sich kürzer! Wussten die Offiziere, dass die ›Glory of Scotland‹ hier in diese Fucusbank eindringen sollte?«
»Durchaus nicht. Angesichts der Fucusbank, etwa auf dem 28. Breitengrade, ließ Kapitän Falking zu unserem Erstaunen die sonderbare Messervorrichtung am Bug des Schiffes anbringen, die meisten hatten sie überhaupt noch gar nicht gesehen. Dann, als wir in die Fucusbank eindrangen, erkannten wir ihren Zweck. Vier Tage durchschnitten wir das grüne Gewinde, ohne dass Kapitän Falking ein Ziel angab. Erst als diese Insel im Fernrohr zu erkennen war, rief er uns Offiziere zusammen, teilte uns mit, dass diese Insel das Versteck des Seeräuberkapitäns Richard Jansen sei, des größten Feindes Englands. Das heißt, ich spreche mit seinen eigenen Worten...«
»Bitte, genieren Sie sich durchaus nicht. Sagte er denn, woher ihm das bekannt sei?«
»Nein, mit keinem Worte.«
»Wusste er, dass sich die Frauen darauf befanden?«
»Ja, das vermutete er wenigstens. Früher hatten sich die Nonnen, Damen aus der höchsten Aristokratie Englands, in einem hohlen Felsenberge der Südsee aufgehalten, waren dort gefangengehalten worden, wie sich Kapitän Falking ausdrückte; dieser Berg war durch ein Erdbeben zerstört worden, aber alle Bewohner hatten sich noch rechtzeitig retten können...«
»Woher war dies alles dem Kapitän bekannt?«
»Darüber verlor er kein Wort. Aber ganz sicher verdankte er all diese Kenntnisse dem fremden Herrn, dem Mister Hobby oder Holly...«
»Sie haben nicht erfahren, wer dieser Herr war, woher der alles wissen konnte?«
»Nein.«
Jansen blickte zurück, sah Tischkoff stehen.
»Mister Tischkoff, können Sie eine Erklärung geben?«
»Keine Ahnung!«
»So fahren Sie fort!«
Der Leutnant schilderte den Kampf noch einmal ganz ausführlich. Wir wollen uns dabei nicht mehr aufhalten.
Genug, die zurückgebliebenen Matrosen, die großen wie die kleinen, waren bis zum letzten Mann als Helden gefallen, auch die Lady Maud, sieben andere der Frauen hatten Selbstmord begangen, darunter die Priorin, die anderen waren an Bord des Schiffes gebracht worden.
»Ich erhielt den Befehl, mit zwei Geschützen und der dazugehörigen aus vierundzwanzig Matrosen bestehenden Bedienungsmannschaft hier zurückzubleiben. Dann dampfte die ›Glory von Scotland‹ wieder ab...«
»Halt! Weshalb sollten Sie hier zurückbleiben?«
»Falls Sie selbst hierher zurückkehren würden.«
»Sie sollten die Insel gegen mich verteidigen?«
»Ja.«
»Mit nur zwei Geschützen und vierundzwanzig Mann?«
»Ja.«
»Wusste denn Kapitän Falking nicht, dass Sie es in diesem Falle mit der ›Sturmbraut‹ zu tun bekommen würden?«
»Das sagte er.«
»Und er hielt diese Verteidigungsmannschaft für genügend?«
»Das sagte er gerade nicht — ich hatte einfach zu gehorchen.«
»Sagte er, wann er zurückkehren wollte?«
»In zehn bis vierzehn Tagen.«
»Wohin wollte er sich in dieser Zeit begeben?«
»Das erfuhr ich nicht.«
»Wohin wollte er die Frauen bringen?«
»Darüber machte er keine Andeutung. Sir Falking hielt zwischen sich und den Offizieren eine noch starrere Schranke aufrecht, als sonst an Bord der Kriegsschiffe üblich ist.«
»Und er hielt vierundzwanzig Matrosen unter einem Offizier mit zwei Geschützen für genügend, um die Insel gegen mich, gegen die zurückkehrende ›Sturmbraut‹, zu verteidigen?«, fragte Jansen nochmals.
»Indem er uns zurückließ, nicht mehr, mit dem Befehl, die Insel unter allen Umständen zu verteidigen, die ›Sturmbraut‹ in den Grund zu schießen, aber womöglich recht viele Gefangene zu machen, darunter auch den Kapitän, Sie selbst, muss er zwei Geschütze und vierundzwanzig Mann wohl für genügend gehalten haben.«
Jansen konnte nur den Kopf schütteln.
»Wenn Sie hierin ein Rätsel finden, Herr Kapitän«, ließ sich da Tischkoff vernehmen, »so dürfte ich es Ihnen wohl lösen können.«
»Nun?«
»Sir Falking hätte nie gewagt, sich mit der ›Sturmbraut‹ in einen Kampf einzulassen, er hat von allem Anfang gewusst, dass eine Verteidigung der Insel vergeblich sein würde, aber der Schein musste doch wenigstens gewahrt werden — so hat er diesen Leutnant mit einigen wenigen Männern auf einen sogenannten verlorenen Posten gestellt.«
»Aha! Leutnant Raleigh, sind Sie auch dieser Ansicht?«
Über das blasse Antlitz des jungen Offiziers ergoss sich eine dunkle Blutwelle.
»Nein«, sagte er dann, wobei er sich aber förmlich aufraffen musste.
»Sprechen Sie die Wahrheit, schon Ihr Erröten hat Sie entschuldigt. Glauben Sie, dass Kapitän Falking Sie auf einen verlorenen Posten gestellt hat?«
»Ich — ich — ich war bei dem Kapitän sehr unbeliebt, es waren die beiden schlechtesten Geschütze, die er mir zurückließ...«
Mehr brachte der junge Offizier nicht hervor, und es genügte auch schon, er hatte hiermit jene Frage bejaht.
Jansen stampfte mit dem Fuße auf.
»Schurke!«
Dann betrachtete er wieder angelegentlich seine Stiefelspitzen.
»Ja«, fuhr er dann aus seinen Gedanken empor. »Wann hat sich dieser Kampf eigentlich zugetragen?«
»Vor vier — vor fünf Tagen.«
»Am... wissen Sie das Datum nicht?«
»Am 15.«
Da ging in dem Gesicht des Kapitäns Jansen eine seltsame Umwandlung vor sich, es nahm einen unbeschreiblichen Ausdruck an; immer weiter quollen seine Augen hervor, mit denen er den Offizier anstierte, und plötzlich brach er in ein Lachen aus — lachte, lachte in einer Weise, dass sich seinen Leuten das Haar auf dem Kopfe zu sträuben begann.
»Am 15. Juli — hahahaha — am 15. — hahahahaha...«
Und so fort in unzähligen Wiederholungen, er konnte sich gar nicht wieder beruhigen.
»Er ist wirklich wahnsinnig geworden!«, wurde geflüstert.
Ja, Jansen musste unbedingt wahnsinnig geworden sein, und als dieses schreckliche Lachen gar nicht aufhören wollte, trat Mahlsdorf auf ihn zu, fasste ihn am Arm, bereit, ihn mit vereinten Kräften unschädlich zu machen; denn einem Wahnsinnigen ist ja alles zuzutrauen.
»Um Gottes willen, Kapitän, was ist Ihnen...«
Er kam nicht weiter; Jansen schüttelte den starken Mann durch eine leichte Armbewegung wie ein Kind von sich ab.
»Ich wahnsinnig? Hahahahaha! Kann ich denn dafür, dass Sie so geistlos sind, diesen famosen Witz nicht zu verstehen? Am 15. Juli, hahaha! Da lasse ich mich fotografieren — lasse mich küssen — für Geld — und hier — hahahaha — und hier — und hier — hahahaha — hahahahaha...«
Und unter diesem schrecklichen Lachen wandte sich Jansen und ging an Bord, in seine Kabine, und man hörte noch lange sein wahnsinniges Lachen, bis es endlich verstummte,
»Dann aber habe ich ihn weinen hören, schrecklich weinen,« konnte später der Steward in der Foxel erzählen.
Die ›Sturmbraut‹ blieb einige Tage hier liegen.
Als Jansen wieder zum Vorschein kam, zeigte er sich ganz vernünftig, und dennoch war sein Wesen kein normales, indem er alles, was zu tun war, gar so kaltblütig vornahm.
Kaltblütig besichtigte er das Massengrab, in dem die Gefallenen von den Kriegsschiffsmatrosen in aller Eile bestattet worden waren, ließ von seinen Leuten darüber einen ungeheueren Steinhaufen errichten, nichts weiter — dann fuhr er auf der Galeerenjacht nach dem grünen Hügel, gebildet von den Mastspitzen des gesunkenen Kriegsschiffes, die von dem Fucus überwuchert worden waren, untersuchte alles ganz kaltblütig, als ruhe darunter nicht sein Kind und das Weib seiner Liebe, überzeugte sich, dass es da kein Tauchen gab.
Dann musste er mit Tischkoff wohl eine Unterredung gehabt haben, von der seine Leute nur das Resultat erfuhren.
Die verwundeten Kriegsschiffsmatrosen waren von Goliath verbunden worden, einige starben bald, dann wurden auch sie, wie die Unverletzten, auf die ›Indianarwa‹ gebracht.
»Leutnant Raleigh, Sie und Ihre Leute bleiben hier auf dieser Insel interniert!«
Der Offizier schien schon etwas Ähnliches erwartet zu haben, er sagte gar nichts dazu.
»Es wird Ihnen die Möglichkeit genommen, die Insel wieder zu verlassen. Sie werden auch unter Bewachung stehen.«
»Es bleiben von Ihren Matrosen welche zurück?«
»Nein, nur der alte Herr, Tischkoff ist sein Name.«
Einige der englischen Matrosen baten, sie mit auf das ›Seeräuberschiff‹ zu nehmen, auch sie wollten ›Seeräuber‹ werden.
Es wurde ihnen kurzerhand abgeschlagen.
»Begeht Selbstmord, wenn ihr das einsame Leben hier nicht ertragen könnt. Übrigens wird euch Mr. Tischkoff schon zu beschäftigen wissen.«
»Was, Tischkoff soll hierbleiben?«, fragte Karlemann ganz erstaunt, als er dies vernahm.
»Er soll nicht, sondern er will.«
»Warum denn?«
»Das ist meine und seine Sache!«, entgegnete Jansen seinem kleinen Freunde schroff.
Karlemann nahm das nicht übel, er holte seine vergrabenen Schätze, die er von den Aschantis erworben, brachte sie an Bord der ›Sturmbraut‹.
Bei solchen Beschäftigungen wurde noch oft über die Einzelheiten des Kampfes gesprochen, da gab es ja noch viel nachzuholen.
So erfuhr man zum Beispiel erst jetzt, dass unter den Inselbewohnern, welche freiwillig oder gezwungen an Bord des Kriegsschiffes gegangen waren, sich auch ein Mann befunden hatte — Doktor Selo.
Doktor Selo hatte versucht, den Verräter zu spielen, indem er nämlich gewusst, dass Karlemann diese seine Schätze hier auf der Insel vergraben hatte. Nur hatte er leider nicht die geringste Ahnung, an welcher Stelle, ebenso wenig wie Blodwen oder sonst eine der Frauen, von den anderen, die es etwa wissen konnten, war keiner lebendig in die Hände der Engländer gefallen, und man hatte schnell genug eingesehen, wie aussichtslos es sei, auf der großen Insel nach einem unbekannten Versteck zu suchen.
So hatte auch Selo seinen Tod gefunden, aber nicht gegen Menschen kämpfend, sondern erstickt von der grünen Umschlingung, auf dem Schiffe, bei welchem etwas an der Maschine versagt haben mochte.
Unterdessen nahm die ›Sturmbraut‹ Wasser ein, wurde ganz mit Kohlen gefüllt, und nachdem dies geschehen war, segelte sie ab, außer einer Erinnerung an eine vergangene Periode Tischkoff mit all seinen Büchern zurücklassend.
Weshalb er zurückblieb, das erfuhr niemand, da zeigte sich Jansen als unnahbarer Kapitän.
Sagt, Mahlsdorf, kann es ein herrlicheres Leben geben? Endlich, endlich habe ich mein Ideal erreicht, von dem ich schon in frühester Kindheit geträumt. Ein schmuckes schnelles Schiff, die tüchtigste Mannschaft, den Safeschrank voll Geld, eine unerschöpfliche Geldquelle wissend, und so in der schönen Welt, auf dem freien Meere umherfahren können... sagt, Mahlsdorf, gibt es denn ein herrlicheres Leben?«
So sprach Jansen, auf der Kommandobrücke, auf einem Klappstuhle unter dem ausgespannten Sonnensegel liegend. Er hatte den wachegehenden ersten Steuermann zu einer Flasche Rotwein eingeladen, ihm eine Zigarre aus der Extrakiste angeboten.
Etwas misstrauisch blickte Mahlsdorf seinen Kapitän von der Seite an.
Wie dieser so bequem dalag, jetzt mit dem rotfunkelnden Bordeaux in dem erhobenen, fein geschliffenen Glase liebäugelnd, dann daraus schlürfend, dann die köstlich duftende Havanna zum Munde führend — ja, Jansen bot ein Bild vollkommenen Glückes, oder doch satter Zufriedenheit.
Und so konnte man ihn jetzt täglich beobachten.
Seit acht Tagen hatte die ›Sturmbraut‹ die Fucusbank hinter sich, trieb mit leichtgeschwellten Segeln dem Norden zu, und den ganzen Tag konnte man den Kapitän lustig pfeifen und singen hören, wenn er sich nicht an den Spielen der wenig beschäftigten Matrosen beteiligte, und dann war er erst recht die ausgelassene Lustigkeit selbst.
Wollte er seinen Schmerz betäuben? Nein, diese Lustigkeit war ganz ungekünstelt.
Oder sollte Richard Jansen mit einem Male wirklich ein so hartes Herz bekommen haben, dass er den Verlust von Frau und Kind als die Befreiung von einer lästigen Fessel empfand?
Der Steward konnte anderes erzählen. Der sonst so wohlerzogene Schiffskellner hatte sich seit einiger Zeit angewöhnt, an der Tür seines Herrn zu lauschen, besonders des Nachts.
»Der Käpt'n weint wieder wie ein Kind«, meldete er dann den Matrosen in der Foxel. »Es ist herzzerbrechend, ich kann's gar nicht mehr mit anhören.«
Dann ward es stets still in der Foxel. Die munterste Unterhaltung verstummte wie die ernsteste, dem Vorleser versagte die Stimme.
Die Matrosen stemmten die Ellbogen auf den Tisch und den Kopf in die Fäuste und simulierten vor sich hin.
»Bernhard, lat mi mal lauschen, ick möcht den Käpt'n mal wienen hiern«, sagte einmal ein Matrose, als der Steward um Mitternacht der Freiwache wieder solch eine Meldung brachte.
»Du bist verrückt, Emil, an der Tür des Kapitäns lauschen, weiter fehlte nichts!«
»Ich gebe dir tein Dollar.«
»Wenn du das noch einmal sagst...«, entgegnete der Schiffskellner, den Satz nicht vollendend, dafür aber schon die Jackenärmel zurückstreifend und dabei einen von Muskeln und Sehnen starrenden Arm zeigend, den man der schmächtigen, geschmeidigen Kellnergestalt nimmermehr zugetraut hätte.
»Ick gev di mien Piep.«
Emil hatte an Bord die schönste Tabakspfeife, ein kurioses Ding, mit heiligen, sogar historischen Erinnerungen verknüpft, der Stolz seines Besitzes, um den er von allen anderen beneidet wurde.
Diesem Angebote schien der ungetreue Steward doch nicht widerstehen zu können.
»Na, da komm mit!«
Als Emil nach einigen Minuten zurückkam, schnitzte er nicht weiter an dem Schiffchen, mit dem er gerade beschäftigt war, sondern legte sich gleich zur Koje, und lange Zeit schien er die Zudecke als Schnupftuch zu benutzen, obgleich der Steward dann seine Pfeife gar nicht hatte haben wollen.
Und nun schlich sich ein Matrose nach dem anderen unter Bernhards Führung durch die Korridore nach der heiligen Schlafkammer, um das Ohr an die Tür zu legen, um ›den Käpt'n mal wienen to hiern‹, und dann benahmen sie alle sich stets ebenso wie Emil.
Das geschah nicht in einer einzigen Nacht, sondern wiederholt, es musste den Matrosen einen förmlichen Ohrenschmaus bereiten.
Und warum nicht? Weshalb geht man denn in ein Trauerspiel?
Es nahm erst ein Ende, als solch eine Schleichpatrouille einmal in den Korridoren von Mahlsdorf erwischt wurde, wie zwei schon das Ohr gegen die betreffende Tür gelegt hatten.
»Was macht ihr denn da?!«, fragte Mahlsdorf mit maßlosem Staunen, an den Untergang des Schiffes, den Untergang der Welt, ja, mehr noch — vielleicht an eine Meuterei glaubend.
Vollständige Fassungslosigkeit der Matrosen!
Da aber passierte etwas Seltsames. Der erste Steuermann hob nur die Hand. »Fort!« Nichts anderes, keine einzige Frage.
Seit dieser Zeit also unterblieb das Lauschen. Aber es war doch geschehen, jeder hatte seinen Kapitän einmal weinen hören.
Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass sich der Kapitän, wenn er sich an Deck zeigte, auch des Nachts, immer in der vortrefflichsten Stimmung befand, so wie auch jetzt, und da war nichts von Künstelei zu bemerken.
»Aber eins gehört doch noch zum vollkommenen Glück«, fuhr Jansen fort.
»Hm!«, brummte Mahlsdorf.
»Nun, was meinen Sie?«
»Arbeit!«
»Ach, Arbeit!«, entgegnete Jansen geringschätzend. »Ich habe über die Arbeit in letzter Zeit etwas andere Ansichten bekommen. Es ist ein komisches Ding mit der Arbeit, mit dem Willen, der Menschheit nützliche Dienste zu leisten. Einer schon höher entwickelten Moral entspringt ja dieses Bestreben, ohne dessen Ausführung man sich unbefriedigt, sogar unglücklich fühlt, aber schließlich ist das nur ein Übergangsstadium zu einer noch höheren Lebensauffassung. Es laufen doch genug Menschen herum, welche scheinbar mit Recht hoch geehrt werden, weil sie Tausende von Händen beschäftigen — aber betrachtet man es näher, so erkennt man, dass auch das eitel ist. Dabei will ich gar nicht von Branntweinbrennern, Bierbrauern, Kanonenfabrikanten und dergleichen Großindustriellen, die Kommerzienräte werden, sprechen. Nehmen Sie einen Hutfabrikanten an. Einen guten Hut billig herzustellen, ist gewiss eine ehrbare Arbeit; aber nützlich für die allgemeine Menschheit ist sie nicht. Der den Kopf bedeckende Hut ist doch eigentlich ein völlig überflüssiges Ding, ebenso wie der Schlips und anderes mehr. Die hochentwickelten Griechen und Römer haben auch keine Kopfbedeckungen gekannt, so wenig wie heute noch die meisten Naturvölker, welche dafür auch nichts von Kahlköpfigkeit wissen. Lassen Sie darauf eine ärztliche Autorität hinweisen, oder noch besser: der in der Herrenmode tonangebende Prince of Wales soll auf die Idee kommen, keinen Hut mehr zu tragen, nur noch im bloßen Kopfe zu laufen — noch in derselben Woche sehen Sie in England keinen Hut mehr, zwei Wochen später keinen mehr in Frankreich und Deutschland, keinen mehr in der ganzen Welt, und wer noch einen trägt, dem laufen die Kinder nach. Alle Hutfabriken bleiben stehen — ein Zeichen, wie vollständig überflüssig sie gewesen sind.«
»Ja, was sollen dann aber die beschäftigungslosen Hutmacher anfangen?«
»Eben etwas anderes. Der vornehmste Stand ist der des Bauern. Wenn es keinen Bauern mehr gibt, müssen wir alle verhungern. Oder jeder muss sich sein eigenes Brot bauen, und wenn er Fleisch essen will, sich das Vieh dazu züchten. Solch ein Gemeindewesen von lauter kleinen Ackerbauwirtschaften, über die ganze Erde verbreitet — ein ideales Bild, und durchaus nicht unausführbar. Verwirklichen wird es sich allerdings niemals. Die Hälfte der Menschheit besteht aus Schmarotzern, wenn sie das auch nicht selbst empfinden. Na, lassen wir das. Das ist eine Schraube ohne Ende. Aber jedenfalls bin ich über meine frühere Ansicht über die Arbeit hinaus. Prost, Stürmann!«
»Auf Ihr Wohl, Herr Kapitän!«
»Nein, zum vollkommenen Glück ist noch etwas anderes nötig«, nahm Jansen dann wieder das Wort.
»Ein gutes Gewissen.«
Jansen betrachtete angelegentlich seine Hand, und im Augenblick wusste Mahlsdorf, woran der Kapitän jetzt dachte.
Dass nämlich an dieser Hand schon so manches Blut klebte.
»Ja, ein gutes Gewissen gehört zum ungetrübten Glück, und das habe ich«, entgegnete Jansen dann. »Nein, es ist etwas ganz anderes.«
»Gesundheit.«
»Das ist selbstverständlich. Oder doch nicht so ganz. Ich habe manchen kranken Menschen kennen gelernt, ständig von Schmerzen geplagt, und in seinem Herzen wohnte dennoch harmonischer Friede. Übrigens will ich hier ganz persönlich sein, ich spreche nur von mir. Nein — die Furchtlosigkeit vor dem Tode und der feste Vorsatz, sofort dieses Leben von sich abzuschütteln, sobald man es aus irgendeinem Grunde nicht mehr ertragen kann oder mag — das gehört für mich zum vollkommenen Glück.«
Mahlsdorf sah den Sprecher wieder einmal von der Seite an — Jansen sah ganz heiter aus, durchaus nichts von Schwermut.
Da Jansen nicht fortfuhr, schien dieses Thema erledigt zu sein. Dass es aber auch für uns nicht überflüssig war, werden wir bald erkennen.
Mahlsdorf blickte nach der Takelage, stand auf, musterte die Segel noch gründlicher.
»Was liegt an?«
»Nordost zu Ost, ein Viertel Ost«, meldete sofort der am Ruder stehende Matrose.
Der Steuermann braucht ja nur einen Blick auf den Kompass zu werfen, so weiß er es selbst, was anliegt, und ob der Matrose richtig steuert, die Nadel richtig spielen lässt — wenn es auch gar keine Nadel ist — doch wir wollen hier nicht technisch werden — aber die Frage, was anliegt, d. h., was der Kompass zurzeit anzeigt, wird an den steuernden Matrosen fortwährend gestellt, zur Probe, ob er nicht etwa träumt. Er muss im Moment antworten können. Zögert er, verspricht er sich, korrigiert sich, so gibt's beim zweiten Male eins zwischen die Zähne.
»Nordost zu Ost«, sagte hierauf Mahlsdorf.
»Nordost zu Ost«, wiederholte der Matrose, immer das Rad spielen lassend, denn dieses wird nie festgehalten, die Nadel muss immer ausschlagen, die Kunst des Steuerns ist nur die, sie nach beiden Seiten gleichmäßig ausschlagen zu lassen.
Um ein bis drei Striche kann man dabei nicht richtig steuern, nur soll der Matrose, wenn er gefragt wird, dann auch die Wahrheit sagen, worauf der Steuermann oder Kapitän den eigentlichen Kurs nochmals angibt.
»Recht so!«
Daraufhin trat Mahlsdorf an das Geländer der Kommandobrücke.
»Rrrreeeeeeee!!!«, schrie er mit allem Aufgebote seiner Lungenkraft, die Stimme dabei immer mehr sinken lassend, sodass eine Art von Gesang daraus wurde.
Und ›rrreeeeeeeeeeee!!!‹ hallte es allüberall wider, die Matrosen kamen angestürzt, fallen lassend, was sie gerade in Händen gehabt, um die an Deck aufgeschossenen Taue und alles andere laufende Gut zum kommenden Manöver zu klaren.
Dieses langgezogene ›Reee‹ ist seit uralten Zeiten auf den Handelsschiffen aller Nationen das vorbereitende Kommando zum Wenden oder überhaupt zum Richten der Rahen, nur von Deck aus, niemand braucht dazu in die Takelage — ohne dass ein Mensch sagen kann, was dieses Wort bedeuten soll.
Nun, es wird wohl vom englischen ›right‹ kommen, richtig, fertig, reit ausgesprochen, ein er kann man aber nicht in die Länge ziehen, es wird ein i daraus, und im Schiffsenglisch heißt es überhaupt ret.
»Was wollen Sie denn, Stürmann?«, fragte Jansen, ohne sich aus seiner bequemen Lage aufzurichten.
»Die Backbordtrossen müssen angeholt werden, die Segel stehen nicht mehr ganz voll.«
»Dann lassen Sie doch lieber ein paar Striche nördlicher steuern.«
»Ja«, lachte Mahlsdorf, denn für Seeleute war hier auch wirklich ein Witz vorhanden, »dann ist es aber nicht mehr Nordost zu Ost, wie Sie angegeben hatten, ich kann den Kurs doch nicht so eigenmächtig ändern.«
»Ach, das hatte ich damals doch nur gesagt, weil der Wind gerade danach stand. Lassen Sie die Leute nur wieder wegtreten. Ruder!«
»Ay ay.«
»Nordost!«
»Nordost.«
»Recht so!«
Das Kommando war belegt, die Leute klarten das Deck und traten weg, die ›Sturmbraut‹ schwenkte mit dem Schnabel mehr nach Norden, wodurch die Segel in volleren Wind kamen, es herrschte wieder die frühere Stille.
»Nein«, fuhr dann Jansen fort, »lassen Sie die Segel nur immer so stehen, danach wird immer gesteuert. Sie dachten, ich hatte ein Ziel?«
»Ich musste es doch annehmen.«
»Nein, wir segeln immer beim Winde. Wenn der Wind ganz umspringt, von der anderen Seite kommt, geht's eben nach Südwest. Der Himmel ist überall derselbe.«
Und Jansen schenkte die beiden Gläser wieder voll, brannte sich eine neue Zigarre an.
Eine lange Pause trat ein.
»Kapitän, darf ich mir eine Frage erlauben?«, nahm Mahlsdorf endlich das Wort.
»Und?«
»Es ist eine Frage, welche die Schranke der Bordroutine durchbricht.«
»Na, ich denke doch, wenn wir so gemütlich zusammensitzen.«
»Sie haben wirklich gar kein Ziel?«
»Nein. Ich bin von jetzt an eins mit dem Ozean, mit der Sonne, mit der ganzen Natur. Wie das Sonnenstäubchen, so will ich mich vom Winde treiben lassen.«
»Immer?«
»Immer!«
»Aber wir werden einmal Trinkwasser nehmen müssen.«
»Wir fangen den Regen auf.«
»Unser Proviant wird einmal ergänzt werden müssen.«
»Dass Sie Materialist mich daran erinnern müssen, dass ich kein bedürfnisloses Sonnenstäubchen, sondern ein dem Durst und Hunger unterliegender Mensch bin!«, sagte Jansen mit scheinbarem Ärger. »Nun gut, so will ich mich nicht mit einem Sonnenstäubchen, sondern mit einem Hirsche vergleichen, der seiner Atzung nachgehen muss. Oder lieber mit einem Schmetterlinge, der ebenfalls vor dem Winde treibt.
Ja, freilich, auch der Schmetterling braucht zur Erhaltung seines unsicheren Lebens Blumenstaub, den er nicht auf der See findet, so müssen auch wir einmal an Land, um Blumenstaub zu sammeln, und sei es auch aus einer so stinkigen Blume wie London oder Neapel.«
»Ja, da ist ein Schmetterling besser dran als wir«, ging jetzt Mahlsdorf auf den Vergleich ein, »der findet doch schließlich auch Wasserblumen.«
»Bravo, Mahlsdorf, lassen Sie mal Ihre poetische Ader fließen! Ja, und warum sollen wir uns nicht mit solchen Wasser- oder Seeblumen begnügen?«
»Weil wir eben keine Schmetterlinge sind, wir brauchen etwas Festeres als Blumenstaub.«
»Und ist das etwa nicht auf der See zu finden?«
»Da müssten wir uns gerade Seetang kochen. Na ja, und Fische.«
»Nichts weiter? Können Sie sich nicht mehr entsinnen, wie wir damals am Feuerland das Wrack ausnahmen?«
»Hm, Wracks ausnehmen, was man so das Brot des Meeres nennt. Das kommt aber nicht alle Tage vor.«
»Alle Tage ist das auch nicht nötig, nur wenn man den Proviant ergänzen muss.«
»Da wollen aber solche Wracks erst gefunden sein.«
»Haben wir nicht schon genug solcher Wracks gefunden? An der Küste von China, bei Madagaskar?«
»Ja, damals war noch der allwissende Tischkoff bei uns.«
»Er hat mir seine Allwissenheit in bezug auf die Lage solcher Wracks schriftlich mitgegeben.«
»Hat er?!«, stieß Mahlsdorf überrascht hervor.
»Ja, eine ganze Masse, über die ganze Erde verteilt.«
Auf des Steuermanns Lippen brannte eine Frage.
Woher nur ist diesem rätselhaften Manne das alles bekannt? Mahlsdorf unterdrückte sie.
»Freilich«, nahm dann Jansen wieder das Wort, »große Delikatessen werden wir in diesen Wracks, die für uns erreichbar sind, gerade nicht finden. Oder vielmehr kommen gerade Delikatessen in Betracht, präserviertes Fleisch und dergleichen — vorausgesetzt, dass man so etwas zu der Zeit, als das betreffende Schiff sank, schon kannte. Hartbrot und Salzfleisch, Mehl und Hülsenfrüchte, soweit es sich in wasserdichten Fässern befunden hat. Kurz und gut — die meisten Wasserblumen sind übelriechend, ich habe selten einen Schmetterling auf einer Wasserrose gesehen — die Lotos wird vielleicht nur deshalb so besungen, weil sie einmal eine wohlriechende Wasserblume ist — — und so dürfte auch der Blumenstaub, den wir auf oder im Meere sammeln wollen, meistenteils ebenfalls übelriechend sein. — Na, so pedantisch war das ja auch gar nicht gemeint, wir werden schon genug Häfen anlaufen.«
Jansen hob sein gefülltes Glas gegen die Sonne, und als er die Brechung der Strahlen durch den roten Wein betrachtete, trat immer mehr ein Lächeln auf seinem Antlitz hervor, und zwar ein sonniges Lächeln.
»Ich weiß nicht — seit einiger Zeit tauchen in mir fortwährend Jugenderinnerungen auf. Ach, diese holden Jugendtorheiten! Wie ich jetzt so den Rotwein funkeln lasse... waren Sie in Venedig?«
»Nein.«
»Nicht gerade schön, aber romantisch, historisch, denkwürdig.
Und dann dieses freie Leben! Besonders wenn man Geld hat. Es war in meiner ersten Matrosenzeit, schließlich noch gar nicht so lange Jahre zurück, und doch dünkt es mich wie ein Traum aus weiter, weiter Ferne. Wir kamen mit Petroleum von New York, wurden abgemustert. Ich bekam rund hundertfünfzig Dollar, achthundert Lire. Junge, was kostet Venedig!
Wie gewöhnlich machte ich mich gleich von den anderen los. Die gingen in die erste Hafenkneipe, wo es genau so aussah wie in jeder anderen Hafenkneipe zu Hamburg oder Kapstadt oder Valparaiso oder sonst wo in der Welt, wohin Seeleute kommen. Dort blieben sie sitzen, bis das letzte Kupferstück versoffen war, bis sie mit einem Tritt hinausbefördert wurden, schon nach zwölf Stunden.
So etwas gab es bei mir nicht. Mir brannte das Geld ja nicht minder in der Tasche, es wurde ebenfalls mit liederlichen Frauenzimmern durch die Gurgel gejagt. Zum Besichtigen von Sehenswürdigkeiten kam ich auch niemals, obgleich ich mir das stets vornahm — aber immerhin, etwas mehr hatte ich doch stets von meinem Gelde, als es in ein und derselben verräucherten Kneipe den Wirtsleuten an den Kopf geworfen zu haben, konnte hinterher immer etwas erzählen.
Ich hatte damals statt eines Kleidersackes einen Koffer, ein banniges Ding. Den auf die Schulter genommen und losmarschiert. Auf dem Kai erst ein Handgemenge mit zerlumpten Individuen, die meinen Koffer tragen wollten. Endlich ließ ich mich bewegen, ihn zwei solchen Lazzaroni anzuvertrauen, weil sie mir sonst die Sachen vom Leibe gerissen hätten, und tottreten wollte ich dieses Gewürm doch nicht gleich — als die beiden den Koffer aber gar nicht von der Stelle brachten, hatte ich Ruhe vor ihnen. Dafür wurde ich jetzt von Fremdenführern in die Mitte genommen. Einem von ihnen vertraute ich mich an, einem kleinen Kerlchen von schäbiger Eleganz, wohl ein Österreicher.
Jawohl, herumführen in Venedig, Dogenpalast, Markuskirche, Glasspinnerei — will alles sehen. Erst aber ein Logis, wo ich schlafen kann, keine Kneipe, privat, fein, vornehm, nicht über fünfte Etage, Aussicht nach vorn, auf dem Balkon Wasserklosett mit Musik.
Wir marschierten los. In Venedig muss man nicht etwa unbedingt immer in der Gondel fahren. Wohl überall Lagunen, Wasserstraßen, das ganze Leben wickelt sich auf dem Wasser ab, auch der Möbelwagen beim Umzug ist eine Gondel, aber längs dieser Lagunen laufen auch immer Fußwege. Nur wegen der Treppenbrücken kann es keine Pferde und Wagen geben.
Weit kamen wir nicht. ›Hier wollen wir erst mal innen gehen, hier gibt's halt a fein's Weinchen,‹ sagte mein Führer an der ersten Ecke. Gut, wir kehrten ein, aßen und tranken, und als wir wieder heraus waren, sagte mein Führer an der nächsten Ecke: ›Hier wollen wir erst mal innen gehen, hier gibt's halt a fein's Weinchen.‹ Und das sagte er an jeder Ecke, so noch vier- oder fünfmal. Und dann, wenn wir drin saßen, setzte er stets noch hinzu: ›Hier gibt's halt auch was fein's zu babbeln.‹ Nebenbei bemerkt, mein Mentor bestellte sich immer Limoneees, mit Vorliebe PaprikaLimoneeees. Wissen Sie, was das ist, Limoneeeeees? Nein? Ich glaubte damals zuerst, der Kerl wollte Limonade haben, PaprikaLimonade. Nein, es war Schöpsenfleisch, Lämmernes. Dieser Österreicher hatte aber so eine merkwürdige Aussprache, er sagte immer Limoneeeeees. Es ist mir unvergesslich, jedenfalls gehört es mit zu meinen Erinnerungen.
So soffen und fraßen wir uns — oder feiner ausgedrückt: babbelten wir uns bis in die innere Stadt durch. Endlich kamen wir doch zur Hauptsache. Wir erkletterten in einem alten Hause drei Treppen, ein kleines, ältliches Weiblein mit einem mächtigen Buckel machte auf, zeigte mir ein Zimmer. Sehr hübsch, sogar fein, pro Tag nur ein Lire. Ich bezahlte gleich für sieben Tage, gab ein Goldstück, zwanzig Lire, und ich konnte mir doch von der armen Buckligen nichts wieder herausgeben lassen. Na, wie die knickste und mir die Hand ableckte! 's war noch eine Signorina, ein Fräulein. Sogar ihren Namen weiß ich noch, Signorina Rosalia Ferroni.
Ich musste wegen der polizeilichen Anmeldung meinen Namen aufschreiben: sie gab mir ihre Adresse, dann trotteten wir wieder ab, ohne Koffer, den ich bisher treulich auf dem Buckel geschleppt hatte.
›Nun wollen wir erst die Glasspinnerei besichtigen, sie ist gleich hier nebenan,‹ sagte mein Führer, ›aber erst wollen wir mal hier innen gehen, hier gibt's halt a fein's Weinchen und halt was fein's zu babbeln.‹
»Und bei der Babbelei von Limoneeeeees mit vino blanco oder nero blieb es. Die Glasspinnerei habe ich nicht zu sehen bekommen, geschweige denn die Markuskirche oder den Dogenpalast. Von außen, ja. Dann war mein Führer fertig, machte den schmalen Fußsteig voll mit PaprikaLimoneeees und dem anderen Inhalte seines Magens, und als er damit fertig war, legte er sich in diese Schmiere, um zu schlafen. Ich gab ihn in einer Kneipe auf, machte mich allein auf den Weg, um die Sehenswürdigkeiten der Lagunenstadt zu besichtigen.
Aber auch ohne Führer kam ich in keine Glasspinnerei und in keine Kirche. Immer aus einer Trattoria und Birraria in die andere. Trattoria ist eine landesübliche Restauration, in der Birraria gibt es kein Essen, aber, wie der verzerrte Name schon ausdrückt, außer Wein auch Bier. Und in der Birraria sind stets Kellnerinnen. Diese Bierstuben in Italien entsprechen überhaupt ganz unseren Weinstuben mit Damenbedienung. Wenn man dort eine Kellnerin traktieren will, spendiert man ihr eine Pulle Bier. Wein hat sie immer, das fremdländische Bier ist etwas Rares. Dabei ist es nicht etwa teuer. Fünfzig Centesimi die Flasche, vier Groschen. Teuer nur im Gegensatze zum Wein, und dort ist eben das Geld rar. Der Italiener arbeitet nicht gern, deshalb verdient er nichts. Ich habe einmal auf dem Markusplatze beobachtet, wie ein Arbeiter eine Granitplatte durchsägte, vier Stunden sägte er daran, bis er sie durch hatte, und vier Stunden lang war er dicht von Menschen umringt, die ihm zusahen, und zwar immer von denselben, die gingen nicht eher, als bis der die Steinplatte durch hatte. Mitten auf dem eiligsten Geschäftswege waren sie stehen geblieben, alles andere war vergessen, stundenlang, die mussten unbedingt warten, bis der die Steinplatte durch hatte. Das ist so echt italienisch. Zeit kostet ja nichts. Ich Germane blieb allerdings auch vier Stunden stehen, aber bei mir war das doch etwas ganz anderes, ich hatte wirklich Zeit, und ich beobachtete nicht den Steinsäger, sondern das italienische Volk in diesen Zuschauern. Da war zum Beispiel ein Mann, wahrscheinlich ein Hoteldiener, der hatte einen Sack auf dem Rücken, durch ein Loch konnte man sehen, dass Eis drin war, das Wasser lief auch unten heraus — und auch dieser Mann stand mit seinem Eissacke vier geschlagene Stunden lang da, in der glühenden Augustsonne, das Eiswasser lief ihm immer die Kniekehlen herunter — aber der merkte nichts, wie sein Sack immer leichter wurde — der musste unbedingt dabeisein, wenn der Säger die Steinplatte durch hatte, und wenn dabei auch alle Alpengletscher zu Wasser wurden. Das muss eine Lust sein, solch einen italienischen Diener zu haben.
Im Laufe des Tages war ich mehrmals bezecht gewesen und wieder nüchtern geworden. Gegen Abend packte mich der Schlaf. Ich will nach meinem Logis. Da habe ich die Adresse verloren. Heute weiß ich sie noch im Kopfe — Via della Pisa Nummer hundertachtundsiebzig dritte Etage bei der Signorina Rosalia Ferroni — an jenem Abend war sie in meinem Gedächtnis ausgelöscht. Umwerfen kann mich kein Spiritus, nur mit dem Gedächtnis wird's dann manchmal mau. Kurz, ich kann mich nicht mehr auf die Adresse entsinnen. Na, wird schon morgen kommen, ich schlafe anderswo.
Wie ich so durch eine Straße wandle, denke ich, das ist doch diejenige, welche? Jawohl, das ist das alte Haus, unten ist auch das Schuhwarengeschäft.
»Zufällig habe ich mein Haus wiedergefunden. Ich ziehe die Klingel, oben geht ein Fenster auf, an einem Stricke wird mir ein Schlüssel heruntergelassen, ich leuchte mir mit Streichhölzern die Treppen hinauf, die schon am Morgen so finster waren.
»Oben in der dritten Etage steht mit einer Ölfunzel ein junges, pompöses Weib, die ihren Buckel vorn hat, wohin er beim Weibe gehört. Eigentlich hätte ich diese Bemerkung jetzt nicht machen sollen, denn dieser Ausdruck ward dann später noch wirklich gebraucht. Nun ist es aber einmal geschehen.
›Ah, Signor Capitano — salute, salute!‹
Das war gewiss eine Schwester oder sonst eine Verwandte von der Alten, welche den Buckel hinten hatte — jedenfalls stand sie schon bereit, um den freigebigen Logierer zu empfangen.
Sie schwadronierte auf mich ein, wovon ich kein Wort verstand — ein bildschönes Mädel, groß und stramm — komplimentierte mich in mein Zimmer hinein, brannte ein Wachslicht an — ›buona notte, Signore — verschwand.
Ich hose mich aus, will ins Bett steigen, da merke ich erst, wie durchschwitzt ich bin, will ein anderes Hemd anziehen, sehe mich nach meinem Koffer um, suche ihn vergebens.
Ich öffne die Tür. ›Signorina?!!‹ — ›Si si si si si, Signore!‹, erklingt es zurück.
Ich hatte die alte Frau erwartet, vor der ich mich weniger geniert hätte — Herrgott im Himmel, Mahlsdorf, Sie wissen doch, wie ich bin — steht da plötzlich vor mir das statiöse Frauenzimmer — und ich im Hemd!
Also mit einem Satze ins Bett hinein und die Decke bis an die Ohren gezogen.
Nun war ich gesichert. Ich brachte mein Verlangen nach dem Koffer vor, französisch, englisch — was der Koffer auf italienisch heißt, wusste ich nicht.
›Niente capito, Signore.‹
Ich versuchte einen Koffer zu beschreiben, fing auch einmal auf deutsch an, und da wurde ich zufällig verstanden.
›Ah, coffera, coffera — si si si si, Signore!‹
Sie eilt hinaus, kommt wieder und bringt... na, was meint Ihr, Mahlsdorf, was sie hereingeschleppt bringt? Einen Nachtstuhl. Der Nachtstuhl heißt nämlich auf italienisch coffera.
›Nein, einen Nachtstuhl will ich nicht, den Koffer, meinen Koffer!‹
›Si si si si, Signore, coffera, coffera, buona coffera!‹
Und um zu beweisen, was für ein guter Nachtstuhl das ist, dass ich mich ihm ruhig anvertrauen kann, macht sie die Klappe auf, wischt mit ihrer Hand vorn über das Sitzbrett, zeigt sie mir — hier, ganz sauber — und Papier hat sie auch gleich mitgebracht.
Na, in so etwas bin ich nun weniger genierlich.
›Fräulein, Sie sind ein Original!‹ lache ich.
›Ah, orinale, orinale — si si si si si, Signore!‹
Sie wieder hinaus — und was bringt sie diesmal mit? Einen Nachttopp! Orinale heißt das Nachtgeschirr. Sie hatte mein Wort Original falsch verstanden.
Ja, Sie haben gut lachen, Mahlsdorf! Erst lachte ich auch, dann aber wurde ich wild. Ich wollte doch meinen Koffer haben!
Es kam noch eine andere Frau herein, klein und alt, nur leider ohne Buckel, ich gestikulierte den beiden vor, was ich haben wollte, meinen Koffer, den ich der Frau mit dem Buckel gegeben, die mich heute früh hier empfangen, mir hier dieses Zimmer vermietet hatte — die beiden verstanden mich nicht.
Dann aber beschwichtigende Handbewegungen, die Alte ging, kam bald mit einem jungen Herrn wieder zurück.
Nicht Englisch, nicht Französisch, wohl aber Deutsch.
›Ick — habben — gedient — sibben — Wocken — in — preußick Berlino. Ick — sprecken — perfekt — Deitschland tun.‹
Na, ich wurde mit ihm fertig, er verstand mich.
Italienisches Gespräch mit den beiden Weibern, seitens dieser verwundertes Kopfschütteln, dann, als ich auf meinen Koffer bestand, energischer Protest.
›Nein — Sie — habben — nix Koffer — geben ab.‹
›Nanu!‹
›Wie — sein — Ihr — wertiges Name?‹
›Richard Jansen.‹
›Nein — Sie — heißen — Walter Formann.‹
›Nein, ich heiße Richard Jansen.‹
›Nein — Sie — heißen — Walter Formann.‹
›Nanu, ich werde doch wissen, wie ich heiße!‹
›Dann — Sie — sein — Andermann.‹
›Sehr richtig, dann werde ich wohl ein anderer sein.‹
›Und — Sie — habben — mir — geben ab — äääääääh — Koffer?‹
›Ich bin heute früh hier gewesen: eine Frau hat mir hier dieses Zimmer vermietet, ich habe ihr für eine Woche zwanzig Lire gegeben, sie bekam wegen polizeilicher Anmeldung schriftlich meinen Namen.‹
Italienischer Austausch mit den beiden Frauen, verwundertes Kopfschütteln.
›Sie — hat — machen — Ihnen auf?‹
›Jawohl, sie hat mir die Saaltür geöffnet.‹
›Dieses — Frau — hier?‹
Er deutete dabei auf die Alte.
›Nein, diese nicht.‹
›Wer — sonst? Wie — sie aussehen — tun?‹
›Nun, vor allen Dingen hatte sie einen Buckel.‹
›Buckel? Was das sein, Buckel?‹
›Na, einen Höcker, einen Ast, hinten so ein Ding.‹
Ich, der ich im Bette aufrecht saß, hatte dabei bezeichnende Bewegungen hinter meinem Rücken gemacht, und da leuchteten die Augen des jungen Herrn verständnisvoll auf.
›Aaaaah — das Frau — hat gehabben — eine Bussen hinten!‹
Das war es gewesen, was ich vorhin gemeint hatte, hier hörte ich diesen Ausdruck überhaupt zum ersten Male in meinem Leben.
›Jawohl,‹ lachte ich, ›sie hatte ihren Busen hinten, und sogar einen ganz mächtigen Bussen.‹
›Nein — hier — nix Frau — mit — Bussen hinten. Sie sein in — falsches Haus — in falsches Zimmer.‹
Ha, da ging auch mir endlich eine Ahnung auf. Unterdessen war mir die Erinnerung wieder etwas zurückgekehrt, ich kiekte mich um — jawohl, dieses Zimmer hatte nur ein Fenster, und ich wusste ganz bestimmt, dass jenes zwei besessen hatte.
›Aber dasselbe Haus muss es doch sein,‹ sagte ich kleinlaut. ›Unten ist doch ein Schuhwarengeschäft.‹
›Si si, unten — sein — Schuckwarren. Weißen Sie — nix mehr — Straße?‹
Die Erinnerung ward mir immer lichter.
›Jawohl, die Signorina Rosalia Ferroni, via della Pisa Nummer 178, dritte Etage.‹
›Via della Pisa? Ooooh, Signore, das sein — ganz andere Seit von Venetia — weit, serr weit — halbe Stunde gondola.‹
Ach du griene Neine!! Ich hier im Hemd in einem fremden Bette — mein richtiges steht auf der anderen Seite von Venedig — halbe Stunde gondola — und hier bringt man mir Nachtstuhl und Nachttopp.
Den beiden Frauen ward der Irrtum aufgeklärt, erstaunte Blicke, die schmucke Dirne verzog das Mäulchen, und beide machten, dass sie hinauskamen.
Ja, was sollte ich nun tun?
›Signore, ich bitte Sie tausendmal um Entschuldigung!‹
›Oooh, bitte serr — sehr angenehm gewesen sein — abber — wenn Sie nix sein — Signor Capitano Walter Formann — Sie müssen — Bett verlassen — Bett besetzt sein — wir — erwarten.‹
›Ja ja, ich stehe sofort auf.‹
Der Herr, wirklich ein überaus höflicher Gentleman, verließ mich, ich heraus, mich wieder angehost. Jetzt kam mir die ganze Komik zum Bewusstsein, ich musste furchtbar an mich halten, um nicht laut aufzulachen. Das hätte die doch auch noch beleidigt.
Ich war schon ziemlich wieder in großer Toilette, als es an der Tür klopfte, der Herr kam wieder herein, einen Zettel in der Hand.
›Verrrzeihung, ick — sprecken — und skreiben — perfekt — Deitsland — abber — kein — England. Können Signore — das — setzen über?‹
Das englisch abgefasste Telegramm war von keinem anderen als von Kapitän Walter Formann, in dessen Bette ich gelegen hatte, und ein Zufall war es, dass es — zwar nicht in der via della Pisa, wo ich jetzt sein sollte, sondern in der Stadt Pisa selbst aufgegeben worden war.
Er meldete darin in respektvollsten Grüßen, dass er leider erst morgen Abend hier eintreffen könne.
Na, dann hätte ich eigentlich gleich wieder in sein Bett steigen können. Aber ich dachte nicht daran, mir war dies alles doch recht fatal gewesen, zumal das mit dem coffera und dem orinale, von dieser statiösen Frau hereingebracht, die wirklich einen ganz aparten Eindruck machte, die mich für einen anderen gehalten, gegen den, wenn er ihr auch fremd, sie sich doch vielleicht so etwas hätte erlauben können. Vielleicht der erwartete Goldonkel aus Amerika.
›Großen Dank!‹› sagte der Herr, als ich ihm den Inhalt der Depesche plausibel gemacht. ›Serr großen Dank — merr noch größer Dank, Signore!‹
»Er wollte, sich immer verbeugend, gehen, ich hielt ihn zurück.
›Was bin ich schuldig?‹
›Oooooh, Signore — nix, nix — serr freuen — Irrtum menslick — nix, nix.‹
›Nein, das Bett muss ich mindestens bezahlen.‹
›Ooooh, Signore — nix, nix — nun... wenn Sie wollen durkaus — einne — Flasche Birr — Damen sick — serr freuen sick!‹
Ich griff in die Tasche, holte ein Goldstück hervor und gab es ihm.
›Oooooh, swansik Lire — ick nix wechseln kann!‹
›Bitte sehr, ich will nichts wieder heraushaben.‹
Denn ich war doch ein feiner Bengel, der sich nicht lumpen ließ, und seitdem ich die Hose wieder anhatte, brannten mir die Goldfüchse wieder wie glühendes Eisen in der Tasche, hatte ich heute doch auch gar keine rechte Gelegenheit gehabt, Geld auszugeben.
Na, dieser Italiener heulte sein ›oooooh‹ wie ein angeschossener Kettenhund, wollte das Goldstück wirklich durchaus nicht annehmen, bis er endlich doch nachgab.
›Abber — Signore — Sie werrden uns gebben — das Ehrre — bissken — mit uns — mangare, mangare — Abbend essen.‹
Gut, das nahm ich dankbar an. Der Abendbrottisch war schon gedeckt, mit dem üblichen Wein, die Alte ging noch einmal fort, brachte noch Fleisch und einige Flaschen Bier mit, wir ließen uns nieder, parlierten zusammen, dass man davon Bauchkneipen bekommen konnte.
Wie ich nach und nach erfuhr, war es Mutter, Sohn und Tochter. Die letztere, das statiöse Frauenzimmer, erst achtzehn Jahre, war eine ganz frischbackene Witwe, nach dem Tode des Gatten, eines italienischen Steuermanns, war sie wieder in das Haus der Mutter gezogen, der Sohn Buchhalter, Kommis. Auch über meinen zukünftigen Bettnachfolger suchte ich mich zu erkundigen.
›Oooooh — gutt Freund von ander Freund — ganz fremd in Venetia — Freund hat Freund geben unsere Adresse — kein Logierhaus — nix gutt Logierhaus — abber hier bei uns gutt aufgehoben — und — wir nix reich — einige Lire gern mitnemmen habben.‹
Diese Offenheit gefiel mir außerordentlich. Überhaupt eine solide, hochanständige Familie, das merkte man bei jedem Worte, bei jeder Geste.
Was mich anbetrifft, so war ich weniger anständig.
Die Mutter wollte von dem Gelde des Gastes noch mehr Bier holen, ich ließ nicht locker, sie musste von mir anderes annehmen, musste alles auf meine Kosten holen, ich ließ Champagner und Mastika anfahren, einen sehr starken, süßen Schnaps, und... wir kamen immer mehr in die richtige Stimmung.
Und an meiner Seite saß die junge Witwe. Ich sage Ihnen, Mahlsdorf — ein Weib — wie Milch und Blut — achtzehn Jahre alt — dabei gebaut wie eine Juno — erst von der Ehe einmal genippt... kurz und gut — ich trat ihr einmal mit meinem Latschen auf die Hühneraugen.
Sie zog ihren Fuß nicht zurück! Ich wurde kühner, trampelte noch ein paarmal auf ihrem Schuhchen herum, und sie zog den Fuß noch immer nicht zurück. Ich krabbelte mit meiner Stiefelspitze ihr ein bisschen weiter an der Wade herauf, und sie duldete es. Ich suchte unter dem Tischtuch ihre Hand, drückte sie, und sie erwiderte den Druck.
Aha, aha! Ja, aber Mutter und Sohn! Die schwatzten immer ahnungslos zusammen, auch mit der Tochter, die ganz unbefangen war, nicht röter werden konnte, da ihr die Getränke schon etwas zu Kopfe gestiegen waren, und wir alle befanden uns in der Laune, wo man so etwas gar nicht mehr merkt, was unter dem Tische vor sich geht.
›Nun — ooooh, Signore — Sie bleibben wohl hier — die Nacht?!‹
Ja, ich wollte gleich hier bleiben.
›Gute Nacht allerseits!‹
Die junge Witwe und die Mutter leuchteten mir ins Schlafzimmer, machten das Bett wieder — die Mutter ging, die Tochter blieb.
Eine zweite Nacht konnte ich nicht bleiben, weil da mein Ersatzmann aus Pisa kam, der mich ablöste.
Auch der englische Kapitän Formann war ein ganz stockfremder. Aber er war der Freund eines Herrn, der hier schon öfters aus- und eingegangen war, hatte die Adresse dieses pikanten Nachtquartiers erhalten und — was nämlich die Hauptsache ist, um diese ganze Geschichte zu verstehen — war von jenem der Familie empfohlen worden, jener schon bekannte Hausfreund hatte für ihn gebürgt. Das ist ein Gentleman, den könnt ihr ruhig aufnehmen.
Denn, wie gesagt, im Grunde genommen eine ganz anständige Familie. Das sind eben italienische Verhältnisse, die wir bei uns gar nicht kennen. Darin ähneln die Italiener fast einem unschuldigen Naturvolke, für welches die Sünde gar nicht existiert. Wäre ich ein unflätiger Geselle gewesen, oder hätte ich mich nur etwas unhöflich, brüsk gezeigt — die hätten mein ganzes Gold nicht angenommen, hätten mich hinauskomplimentiert. So aber machte ich einen guten Eindruck — da war ich empfohlen, ich wurde direkt zum Bleiben aufgefordert.
Goethe hat in seiner italienischen Reise ein Urteil über die Italienerinnen gefällt, was ich ganz bestätigt gefunden habe, sogar noch mehr in der folgenden Geschichte.
Ich bummelte wieder aus einer Kneipe in die andere. Nicht einmal in eine Gondel kam ich. Am dritten Tage aber hatte ich meine Stammkneipe. Eine Birraria. Mit sechs Kellnerinnen — und dann die Patrona, die Wirtin, eine unförmliche Maschine, die aber nur hinter der Bar stand oder saß.
Na, ich spendierte die Bierpullen dutzendweise. Ich wurde mein Geld gar nicht los, diese Mädels dort sind so überaus bescheiden, sogar in den Animierkneipen. Die eine konnte ein bisschen Französisch, die musste immer die Dolmetscherin machen. Es war eine faule Zeit, ich war immer der einzige Gast.
›Kinder,‹ sagte ich an einem frühen Nachmittage, ›was fangen wir jetzt an?‹ Ich dachte so an Bockspringen oder Schinkenkloppen oder so was Ähnliches. — ›Wir fahren nach dem Lido, ach ja, nimm uns alle mit, Riccardo!‹ — So erklang es im Chore. Und wie diese Italienerinnen nun das ›Riccardo‹ aussprechen — Ridschardo — das kann aber ein anderer gar nicht nachmachen — als wenn süße Butter auf der Zunge zerschmilzt. — ›Was ist denn das, der Lido?‹ — ›Na, die Insel, wo Tag und Nacht Klimbim ist. Ach ja, Riccardo, nimm uns doch mit nach dem Lido, bitte, bitte!‹
So erklang es im Chore, die kleinen Mädels schmeichelten wie die Kätzchen. Auf diese Weise lernt man gar schnell eine fremde Sprache. Ich verdanke meine ganzen Sprachkenntnisse überhaupt nur Kellnerinnen.
›Na, warum denn nicht?‹ — ›Ja, aber du musst erst die Patrona fragen, da muss doch das Lokal geschlossen werden, wenn wir alle mitgehen, das hast du natürlich zu bezahlen.‹
Au! Meine Geldverschwendung bewegte sich immer innerhalb gewisser Grenzen. Etwas wollte ich denn doch dafür haben, und wenn ich gleich alle sechs Mädels mitnahm, hatte ich gewiss nichts davon, und dann auch noch dafür bezahlen, weil dann die ganze Bude geschlossen werden musste? Das konnte eine teure Schmiere werden.
Na, ich ging hin zu der Patrona. Und wissen Sie, was die verlangte, wenn die ganze Bude geschlossen würde? Ich hatte schon einen HundertLireSchein bereit gemacht. Fünf Lire. Dann machte sie die ganze Bude zu.
Doch wie gesagt, es war eben eine faule Zeit, es kam sowieso niemand, außerdem mussten die Mädels am Abend wieder zurück sein, da fing sich eher ein Grünfink, und dann machte die Wirtin zur Bedingung, dass ich auch sie mitnehme.
Also die Klappe zugemacht und losgezittert mit den sieben Frauenzimmern, nach dem Lido. Unterwegs, als wir an einem Schokoladengeschäft vorbeikamen, bettelte mich die eine an, ich gab ihr eine Lire... ach, dieser Jubel von den kleinen Mädels, wie die in den Laden hineinrannten, um sich Bonbons zu kaufen. Und ich hatte eigentlich jeder einen Lire geben wollen. Aber ich war eben gar nicht dazu gekommen. Überaus bescheiden — oder eben noch nicht so verwöhnt.
1 Bei dieser Aussprache müsste der Name »Ricciardo« geschrieben werden.
Eine Gondel genommen und über die blaue Adria gefahren. So bin ich in Venedig wenigstens einmal in eine Gondel gekommen. Und hätte ich die Mädels nicht bei mir gehabt, die doch Bescheid wussten — ich hätte dem Gondolieri für mich allein für die halbe Stunde den zehnfachen Preis bezahlen müssen. Diese Spitzbuben kennen doch ihre Pappenheimer.
Eine reizende Insel mit lauter Restaurationen und überall Klimbim, Jahrmarktstrubel. Und am Strande alles wimmelnd von badebehosten Männlein und Weiblein, die sich an den Händen fassten und sich jauchzend den blauen Wellen entgegenwarfen, wenn sie nicht im Sande lagen und sich von der Sonne schmoren ließen. Doch dass so Männlein und Weiblein zusammen badeten, war mir nichts Neues mehr.
›Nicht wahr, Riccardo, jetzt wollen wir erst etwas essen?‹, hieß es.
Wir promenierten den Strand entlang, gingen in das Hotel von hinten hinein, die Weiber sprachen mit dem Portier, wir wurden geführt, vor uns wurde eine Tür aufgemacht.
Ich denke doch, die wollen ein Chambre separée. Na ja, ein solches war es ja auch, mit Stühlen und gedecktem Tisch, mit vielen Kleiderhaken zum Ablegen der eventuellen Überkleider — aber da war am Boden auch ein großes Wasserbassin, welches durch eine Gitterwand offenbar mit dem Meere in Verbindung stand.
Und eins, zwei, drei — die Frauenzimmer reißen ihre Kittel ab.
›Nanu, nanu, was macht ihr denn da?‹
›Na, wir wollen uns doch baden, wozu geht man denn sonst auf den Lido?‹
›Ja, draußen im Meere!‹
›Ach, da draußen muss man ja Badekostüme anhaben — und da bekommt man auch nichts zu essen — erst wird hier gebadet und dann diniert.‹
Mahlsdorf Sie kennen mich. Ich bin ein kurioser Kauz. Mit einer, ja, allemal — aber wie sich die sechs Heben vor meinen Augen immer mehr in feigenblattlose Evas verwandelten, und die dicke Maschine von Patrona dazu — ich denke doch jeden Augenblick, mich muss der Schlag treffen.
Aber es half alles nichts, sie zogen mir die Stiefel aus, zogen mir alles andere vom Leibe — na — und da hopste auch ich mit ins Bassin, und nun ging's in dem brühwarmen Wasser los.
Mahlsdorf, es sind eigentümliche Weiber, diese Italienerinnen. Man kann sich mit einer wirklich feinen, hochgebildeten Italienerin, oder, was noch mehr sagen will, mit der sittsamsten Tochter einer mittleren Bürgersfamilie ganz offen über Dinge unterhalten, welche man bei uns in Deutschland selbst in einer Gesellschaft, wo es schon freier zugeht, nicht einmal anzudeuten wagt, und das Mädchen selbst bleibt ganz unberührt davon, verliert dadurch von dem Heiligenscheine ihrer Keuschheit keinen Schimmer. An der Italienerin bewahrheitet sich, dass dem Reinen alles rein ist. Das ist es, was Goethe so stark betont hat. Ich hab's erlebt. Es waren doch Kellnerinnen der gewöhnlichsten Sorte, mit denen ich hier zusammen badete, es waren ganz einfach Dirnen — von einer platonischen oder idealen Liebe natürlich keine Rede, das wäre doch lächerlich, im Gegenteil, von glühender Sinnlichkeit, aber... frei von jeder Gemeinheit, ich habe nie ein unflätiges Wort gehört, immer graziös, immer naiv dabei. Es sind unschuldige Kinder der Sünde — nein, da kann man überhaupt gar nicht von Sünde sprechen.
Es ist der Hauch der uralten Kunst, der noch immer durch ganz Italien weht, alles veredelnd, selbst das, was wir überkultivierten Nordländer als gemein bezeichnen, und wenn es bei uns genug Männer gibt, besonders Schwarzröcke, welche die Venus mit einem Mantel bekleidet haben wollen, so verraten sie dadurch nur ihre eigene Geniertheit, die Unsauberkeit ihrer innersten Gedanken, die sie vergebens zu bemänteln suchen. Dort in Venedig ist mir das voll und ganz zum Bewusstsein gekommen.
Na, wir plätscherten wie toll in dem Bassin herum. Und nun der ungeheuere Fleischklumpen von Wirtin — ach Gott, ach Gott, was haben wir über die gelacht!
›Jetzt wollen wir essen‹, hieß es dann, als wir uns ausgetobt hatten. ›Piccolo, Piccolo!‹
Richtig, es kam ein befrackter Kellner, nahm die Bestellung in Empfang, verzog keine Miene, wie wir acht nackten Menschen da so im Wasser standen. Selbstverständlich nicht. Der kannte das ja eben gar nicht anders.
Das Essen kam sofort, das Hauptgericht bildete Maccaroni, und wir speisten — aber nicht etwa oben an dem Tische, sondern hier unten im Wasser, das war alles gleich danach eingerichtet, Holzschüsseln, die schwammen, wir standen herum, und die Mädels beugten sich zurück, sperrten den Schnabel auf und ließen die langen Nudeln die Kehle hinabgleiten. So im Wasser stehend zu essen, das gehört nämlich mit zum Hauptvergnügen beim Besuche des Lidos.
Dann bekamen wir Kostüme, und nun ging die Baderei erst noch einmal richtig im offenen Meere los. Dazu hatten wir aber erst noch ein Stückchen Weg zu gehen, und noch einmal kam mir die Komik der ganzen Situation recht zum Bewusstsein, wie ich mit meinen langen Storchbeinen über den Strand stolzierte, hinter mir her gackernd meine sieben Hennen.« — —
Jansen schwieg.
Traumverloren blickte er in die Ferne, noch ein glückliches Lächeln um den Lippen.
»Ja, es war eine schöne, schöne Zeit!«
Nach und nach erstarb das Lächeln.
»Und warum soll sie nicht wiederkommen? Bin ich nicht ein freier Mann, freier denn je? Bin ich nicht noch immer jung? Sagt, Mahlsdorf, wer will mich daran hindern, mich wieder in den Strudel des Lebens zu stürzen und es mit vollen Zügen zu genießen? Wer will mich daran hindern, wer will mich daran hindern...«
Mahlsdorf hatte zuletzt auf einer Seekarte mit dem Zirkel gemessen — plötzlich kam ihm die Stimme des Kapitäns so ganz anders vor, sie wurde heiser, es klang immer wilder — und noch ehe er erschrocken nach dem sich so veränderten Sprecher blicken konnte, ward er hart an der Schulter gepackt und heftig geschüttelt. Vor ihm stand Jansen, total verändert, mit wild rollenden Augen, das Gesicht fast verzerrt.

»Wer will mich daran hindern?!«, stieß er zwischen den knirschenden Zähnen hervor. »Sprecht, Mahlsdorf, wer will mich daran hindern, wieder jung wie damals zu werden — wieder der lustige Richard — wer will mich daran hindern, wer — will — mich — daran — hindern?? Sprecht oder es ist Euer Tod!!«
»Um Gott!!«, rief der zu Tode erschrockene Mahlsdorf, »Kapitän, was ist Euch denn?!!«
Jansen hörte auf zu schütteln, er schien zu lauschen, sein Gesicht glättete sich wieder, er zog die Hand zurück.
»Dummes Zeug«, sagte er dann ganz ruhig, sich mit der Hand über die Stirn fahrend, »ich glaube, ich habe geträumt. Na, was gibt's denn da unten?«
Es waren Karlemann und der Steward, welche sich streitend der Kommandobrücke näherten. »Bernhard will mir kein Öl geben.«
»Ich habe nur noch eine einzige Flasche!«, verteidigte sich der Steward.
»Ja, aber eine Zehnliterflasche, eine ganze Kruke.«
»Mister Algots will aber einen großen Kochtopf voll haben, in den mindestens die Hälfte hineingeht.«
»Dann hat er noch immer die Hälfte, das reicht zu dem bisschen Salat.«
»Wer weiß, wann ich wieder Öl bekomme!«
»Wozu brauchen Sie denn so viel Öl?«, fragte Jansen.
»Das ist meine Sache!«, wurde der Knirps wieder einmal unverschämt.
»Wenn Sie so antworten, dann mag es auch Ihre Sache sein, woher Sie das Öl bekommen. Kann es denn nicht Maschinenöl sein?«
»Jawohl, fressen Sie mal das, was ich kochen will, mit Schmieröl.«
»Ach so, eine Speise wollen Sie kochen!«, konnte Jansen schon wieder lachen.
»Ganz richtig.«
»Was für ein Gericht denn?«
»Was Sie sogar gern essen. Warten Sie, ich komme gleich hinauf.«
Karlemann verschwand noch einmal unter der Kommandobrücke.
»Steward«, rief Jansen dem sich ebenfalls entfernenden Proviantmeister nach, »schreibe einmal alles auf, was ergänzt werden muss.«
»Das habe ich bereits getan, und das ist bis auf Fleisch und Hülsenfrüchte so ziemlich alles, sogar das Salz wird knapp.«
»So bring mir die Liste!«
Karlemann kam die Treppe herauf, steckte gleich die Hände in die Hosentaschen und begann hin und her zu marschieren.
»Käpt'n, ich habe was.«
»Nun, was denn?«
»Eine Idee, eine Idee, eine Idee — eine großartige Idee!«
»Was für eine Idee?«
»Das wird nicht verraten.«
»Na, dann verschonen Sie mich mit Ihren Andeutungen.«
»Ich muss Sie aber doch erst um einen Rat fragen.«
»So fragen Sie los!«
»Sie wollen doch immer gern arbeiten.«
»Na, darauf bin ich nicht mehr so versessen.«
»Sie wollen doch nicht nur so planlos hin und her gondeln, sondern dabei einen nützlichen Zweck verfolgen.«
»Wären Sie vorhin oben gewesen, so hätten Sie gehört, wie ich Mahlsdorf auseinander setzte, dass sich darin meine Ansichten bedeutend geändert haben.«
»Aber die Matrosen müssen beschäftigt werden.«
»Die sind beschäftigt genug.«
»Durchaus nicht! Die haben viel zu viel Freizeit. Und was tun sie in dieser Freizeit? Gegen das Turnen will ich ja gar nichts einwenden, aber da sitzen sie da und spielen Karten...«
»Oho, oho!! Haben Sie denn überhaupt schon einmal gesehen, dass Matrosen Karten gespielt haben? Das gibt es an Bord meines Schiffes nicht.«
»Na, da spielen sie nicht Karten, aber — aber — da sitzen sie da und lesen egal in Büchern, tun gerade, als ob sie das nicht schon in der Schule gelernt hätten.«
Jansen musste herzlich lachen ob dieser eigentümlichen Ansicht über das Lesen.
»Na ja«, verteidigte sich Karlemann, »wenn man's in der Schule gelernt hat, was braucht man denn da noch zu lesen? 's ist ja doch nur alles Unsinn, was in den Büchern steht.«
Dann kratzte er sich nachdenklich in seinen langen Haaren, die, wie schon einmal erwähnt, bei dem jetzt fünfzehnjährigen Jungen schon weiße Fäden zeigten.
»Ja, manchmal ist's aber doch ganz gut, wenn man so was kann. Sie haben doch hier oben so, ein Prä — Prä — Prä... na, wissen Sie denn nicht, was ich meine?!«, schnauzte Karlemann seinen langen Freund zuletzt an.
»Ein Prä... wenn Sie nicht wenigstens noch eine Silbe hinzusetzen, da ist wirklich schwer etwas zu erraten.«
»Prä — Präpa... na, da haben Sie die zweite Silbe.«
»Präparat.«
»Ach, ist denn ein Präparat etwa ein Buch?!«
»Ach so, ein Buch soll es sein. Ein Buch, das mit Prä anfängt?«
»Na, wie heißt denn solches Fleisch und Gemüse, das man so lange in Büchsen aufheben kann, bis es drin stinkig wird?«
»Ach, präserviert!«
»Richtig, richtig, präseverariert! Na, wissen Sie nun, was für ein Buch ich meine?«
»Ein Buch, das präserviert ist?«
»Nicht präserviert, dafür gibt es doch auch noch einen anderen Namen. Herrgott, Käpt'n, sind Sie aber heute schwer von Verstehstemich! Da sieht man nun, was das ganze Lesen nütze ist!«
Jansen sah seinen kleinen Freund starr an, dann legte er den Finger an die Nase.
»Hören Sie mal, Karlemann — Sie meinen doch nicht etwa ein Konversationslexikon?«
»Na, endlich! Das hat aber lange gedauert! Ja, das ist das Buch, welches ich meine.«
Auszusprechen wagte Karlemann dieses Wort nicht, jetzt nicht und niemals.
Und unser Held hatte eine großartige Probe seines Scharfsinnes gegeben. Präserviertes Gemüse und Konversationslexikon — präserviert, konserviert, Konversationslexikon — es ist doch ein gar weiter Umweg, den der suchende Geist machen muss.
Karlemann sah es selber ein, er reckte sich auf den Zehenspitzen empor, um seinen langen Freund wohlwollend auf den Bauch klopfen zu können.
»Neneee, alter Junge, ich erkenne Ihren Scharfsinn ganz an — Sie sind wirklich ein Rateluder. Also Sie haben so ein Ding hier oben?«
»Gewiss, hier im Kartenhaus. Aber unten in der Bibliothek ist auch eins, gleich zwei.«
»Ich weiß, aber ich, Kapitän Karl Algots, kann mir doch nicht von so einem ungebildeten Matrosen zeigen lassen, wie man da nachguckt. Das kann nur ein anderer Kapitän. Ist es wahr, dass da alles drinsteht?«
»Alles — was heißt alles?«
»Alles muss drinstehen, sonst ist es nicht so ein richtiges Buch, wie ich meine.«
»Na ja, es steht alles Wissenswerte drin — alles was der Mensch wissen muss.«
»Zum Beispiel, zum Beispiel... wie man saure Nieren kocht?«
Diesmal war es Jansen, der sich hinter den Ohren kratzte.
»Nee, Karlemännchen — wie man saure Nieren kocht, das steht nun allerdings nicht im Konversationslexikon.«
»Na, da sehen Sie, was Ihre ganzen Bücher wert sind!«
»Ja, das ist etwas anderes. Da gibt es Spezialbücher. Das finden Sie im Kochbuch.«
»Kochbuch? Was ist denn das?«
»Nun, ein Buch, in dem alle Rezepte verzeichnet sind, wie man die Speisen kocht.«
Karlemann reckte seinen Oberkörper vor.
»Wie man kocht? Sie denken wohl, Sie können mich veralbern? So ein Buch gäbe es? Na, nun lassen Sie mich aber aus!«
»Faktisch, solche Kochbücher gibt es genug. Da wird ganz genau beschrieben, wie man die Geschichte anrührt, was für Zutaten man hinzusetzt, wie lange man es kochen lässt...«
»Wirklich? Gut, ich will's glauben. Aber nur glauben! Meinetwegen auch zusehen. Aber essen mag ich's nicht. Nenee, Jansen, mir machen Sie nichts vor, da bin ich doch zu helle. Das hätten Sie mal meiner Mutter sagen sollen, die hätte Ihnen nicht schlecht den Kochlöffel um die Ohren gehauen. Oder wenn in einem Buche ganz genau beschrieben wird, wie man schwimmt, oder wie man die Riesenwelle macht — können Sie da etwa schwimmen und die Riesenwelle machen? Nenee, Jansen, mich veralbern Sie nicht.«
»Na, was wollen Sie nun im Konversationslexikon nachsehen?«
»Sie sollen mir nur zeigen, wie's gemacht wird, dass man's drin findet. Probiert habe ich's, aber es ging nicht. Da habe ich von vorne angefangen, einmal, dachte ich, muss es doch kommen, aber das dauerte doch ein bisschen gar zu lange, da ließ ich's sein.«
»Sie wollen mir das Wort nicht sagen?«
»Auf keinen Fall. Es wird nichts verraten.«
»Mit welchem Buchstaben fängt das Wort wenigstens an?«
»Mit welchem Buchstaben? Hm, wollen gleich mal sehen.«
Und Karlemann hob die Hand und begann mit dem ausgestreckten Zeigefinger in der Luft zu malen; es war köstlich anzusehen, am köstlichsten aber, wie er plötzlich kopfschüttelnd die Hand zurückzog, schnell in sie hineinspuckte und dann tat, als ob er das in die Luft Geschriebene wieder auswische, als hätte er also etwa eine große Schultafel vor sich, worauf er wieder langsam zu malen begann, abermals in die Hand spuckend, und auswischend, und das so fort.
»Schreibt man das Wort groß?«
»Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie schreiben wollen. Ist es denn ein Hauptwort?«
»Ein Hauptwort? Nee, 's ist was zu essen.«
»Na, dann wird's groß geschrieben«, lachte Jansen.
Er hatte schon längst gesehen, dass es ein S und ein a war, was Karlemann in die Luft malte.
»Es fängt mit dem S an, also mit dem großen«, entschied Karlemann dann auch endlich.
»Und was ist der nächste Buchstabe?«
»Dann kommt — kommt — warten Sie mal, da muss ich erst nachsehen.«
Und Karlemann fing wieder an, in die Luft zu schreiben, auch noch mehrmals auswischend, obgleich es immer ein a war, das er unsichtbar hinschrieb.
»Ja, jetzt weiß ich es, aber ich sag's nicht. Sonst könnten Sie es gleich wissen. Sie sind ja eben so ein Rateluder.«
»In welchem Bande haben Sie denn vorhin nachgelesen, als Sie das Wort suchen wollten?«
»Nu, ich fing eben mit dem ersten an.«
»Mit dem A?«
»Ja, erst kam das große A. Und da stand schon ein Meerrettich drinne! Was für einen Sums die nur mit so einem einzigen Buchstaben machen!
Und dann kam ein großes A mit einem kleinen a. Nu, das war aber erst ein Haufen. Da habe ich lieber aufgehört.«
»Und Sie wollten ein Wort suchen, das mit dem S beginnt? Wollten deshalb das ganze Konversationslexikon durchlesen, so an die sechzehn Bände? Na, das hätte nun freilich ein bisschen lange gedauert.«
»Deshalb komme ich eben zu Ihnen! Sie sollen mir zeigen, wie das gemacht wird.«
Sie gingen ins Kartenhaus, wo auch ein sechzehnbändiges Konversationslexikon aufgebaut war. Karlemann hatte das Nachschlagen gar schnell begriffen. Denn dass dieser deutsche Zigeunerknabe sonst ein gar aufgeweckter Kopf war, daran wird wohl nicht gezweifelt. Er hatte wegen seiner Wilddieberei und sonstigen Beschäftigungen, die ihm Geld einbringen mussten, nur immer zu wenig Zeit für die Schule übrig gehabt, hatte diese ja ganz vorzeitig verlassen, war auch sonst immer zurückgeblieben. Seine Schulbildung — was man so jetzt Schulbildung nennt, worüber einst unsere Nachwelt das Urteil fällen wird — entsprach kaum der eines neunjährigen Jungen, selbst mit seinem Schreiben sah es noch ganz mangelhaft aus, von Orthografie gar nicht zu sprechen — — und der Dorfschulmeister, der ihn verprügelt, hatte nicht geahnt, dass dieser faule Schlingel schon die schwierigsten trigonometrischen Formeln mit Logarithmen lösen konnte.
»So, jetzt weiß ich, wie es gemacht wird. Nun gehen Sie mal weg, jetzt will ich's mal allein machen.«
Während Jansen auf der Brücke hin und her ging, beobachtete er, wie Karlemann den BBand nahm, darin blätterte, suchte, bis er zu lesen begann, mit dem schmutzigen Finger immer die Zeilen verfolgend.
Es dauerte lange, ehe er eine Spalte herunter hatte, denn auch mit dem Lesen sah's bei Karlemännchen mau aus, und es war ein Artikel von vielen Spalten.
»So, nun können Sie wieder hereinkommen. Sehen Sie, nischt ist es mit Ihren Büchern! Gleich über Bord schmeißen sollte man sie. Da lese ich eine halbe Stunde, dass mir die Augen triefen — kein Wort steht darin.«
»Was wollten Sie denn wissen?«
»Bruch habe ich aufgeschlagen. Da steht was drin von Nenner und Zähler, von Dezimalbrüchen und gemischten Brüchen — dann schwatzen die etwas von Moorbruch und Blätterbruch — dann fangen die gar an von Schenkelbruch und von Unterleibsbrüchen, dass man gleich das Brechen kriegen kann — — aber von dem Bruch, von dem ich was wissen will, da steht kein Sterbenswörtchen drin.«
»Ja, was für einen Bruch meinen Sie denn?«
»Bruchschokolade.«
Jansen krümmte sich vor Lachen.
»Nein, Bruchschokolade steht allerdings nicht drin«, sagte er dann. »Da müssten Sie schon unter Schokolade nachschlagen, würden es aber auch dort nicht finden. Ja, wenn die Fabrikation von Bruchschokolade eine eigene Industrie wäre...«
»Bruchschokolade keine eigene Industrie? Na, ich danke!«
»Aber Karlemännchen, Bruchschokolade ist doch nur ein Abfall bei der Schokoladenfabrikation! Was so beim Einpacken zerbricht, das wird in eine besondere Kiste geworfen...«
»Oho, oho!! Nur man sachte! In Hamburg gibt's eine große Fabrik, mit ein paar hundert Arbeitern, die macht nichts weiter als Bruchschokolade.«
»Das ist ja gar nicht möglich, das ist...«
»Wenn ich Ihnen sage! Ja, die machen auch erst die Schokolade in großen Tafeln, aber dann werden die zerschmissen, zerhauen, oder es gibt gleich eine Maschine dazu, die das besorgt, und dann wird das Zeug billig verkauft, das soll aussehen, als wäre es Abfall, den man eigentlich gar nicht mehr verkaufen könnte, oder nur so nebenbei, wobei man noch Geld zusetzt — aber in Wirklichkeit wird diese Bruchschokolade erst künstlich fabriziert. Na, was sagen Sie nun? Ist das keine Industrie?«
Ja, da freilich konnte Jansen nichts mehr sagen. Mit diesem Jungen war eben auch gar nichts anzufangen.
»Sie wollen also Bruchschokolade fabrizieren?«
»Bruchschokolade?«, wiederholte Karlemann in seinem ihm eigentümlichen, impertinenten, höhnischen Tone, den man ihm aber unmöglich übel nehmen konnte. »Na, wie in aller Welt soll ich denn hier an Bord Schokolade machen können? Jansen, Sie haben heute unbedingt Ihren unglücklichen Tag, Sie sind rein borniert! Wissen Sie denn gar nicht, was man dazu alles braucht, um Schokolade zu machen? Da braucht man vor allen Dingen Kartoffelmehl — und und und — Zucker — und und und — Fannilsche — und und und — eine braune Farbe...«
»Und vor allen Dingen doch wohl Kakao.«
»Was soll man zur Schokolade brauchen?«
»Kakao; das ist doch der Hauptbestandteil der Schokolade.«
»Kakao? Nee. In der großen Hamburger Schokoladenfabrik, in der mein Onkel arbeitet, der mich mal mit reinnahm und mir alles zeigte, da kam keen Kakao in de Schokolade. Und der Fabrikant muss es doch besser wissen als wie Sie, wie man Schokolade macht — der ist Kommerzienrat und hat einen ganzen Haufen Orden.«
Jansen machte, dass er hinaus kam. Bald aber wurde er wieder ins Kartenhaus gerufen. Schützend hielt Karlemann die Hände über das aufgeschlagene Buch.
»Ich glaube, jetzt hab' ich's. Was ist denn das, Ismus?«
»Ismus? Das verstehe ich nicht. Isthmus.«
»Nee. Ismus. Das Wort selber finde ich nicht, aber doch den Anfang, und da hängt ein Ismus dran.«
»Aha, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ja, Karlemann, das — das — kann ich Ihnen auch nicht recht erklären. Ich bin in den technischen Ausdrücken des Sprachenaufbaues auch nicht bewandert. Es ist — es ist — eine sächliche Verallgemeinerung... oder ich will Ihnen doch Beispiele geben. Katholik, Katholizismus; Buddhist, Buddhismus; Anarchist, Anarchismus...«
»Aha, aha, aha!! Jetzt weiß ich schon. Ja, dann stimmt's, dann habe ich das Wort auch gefunden, nur mit einem Ismus. Sie können wieder nausgehen.«
Und Karlemann begann abermals, mit der Fingerspitze unter den Zeilen zu rutschen. Man sah ganz deutlich, wo er gelesen hatte, er ließ eine geistige Spur zurück, materialisiert durch seinen schmutzigen Finger.
Er las wieder sehr lange, dann hörte man ihn fluchen.
»Na Krrreiz und Krrruzifix noch einmal! Ist denn das Buch besoffen oder bin ich's! Da werde doch der Teifel draus klug! Das kann man doch nicht essen!«
»Soll ich Ihnen helfen?«, fragte Jansen.
»Ja, kommen Sie her, und nun habe ich die Geschichte satt, Sie erfahren's doch sowieso, sobald ich das Öl habe. Nun lesen Sie mal das hier. Welches Schwein soll denn das fressen? Ich werde überhaupt gar nicht draus klug, was da eigentlich geschwatzt wird.«
Jansen trat näher, beugte sich über das Buch.
»Was meinen Sie denn?«
»Na hier, hier, das fettgedruckte Wort, wo die Geschichte anfängt.«
»Sadismus?«, fragte Jansen in grenzenlosem Staunen.
»Jawohl, Sadismus.«
»Ja, Mensch, wie kommen Sie denn auf Sadismus?!«, staunte Jansen immer mehr.
»Na, ich will hier Sadismus machen.«
»Was? Sie wollen hier an Bord meines Schiffes den Sadismus einführen?! Sie sind wohl... nicht recht bei Troste?! Wissen Sie denn überhaupt, was Sadismus ist?«
»Freilich, sonst würde ich's doch nicht machen. Dazu brauche ich doch das Öl. Hier steht nun allerdings etwas ganz anderes, das verstehe ich überhaupt gar nicht.«
Jansen merkte schon, dass hier ein kolossaler Irrtum vorlag.
»Nun sagen Sie mal, was Sie eigentlich aufsuchen wollten.«
»Na, Sadine.«
»Sadine, was ist denn das?!«
»Mensch, stellen Sie sich doch nicht so dumm!! Sie wissen nicht, was eine Sadine ist? Die schwimmt im Meere — und dann kommt sie in Blechdosen — mit Öl — die ganze Dose fünf Silbergroschen — es gibt auch noch größere — die einzelne Sadine kostet immer einen Groschen.«
»Ach, Sardine meinen Sie, Sarrrdine!«
»Meinetwegen Sarrrdine, das ist doch ganz egal, auf so einen lumpigen Buchstaben kommt's doch nicht drauf an. Und sehen Sie — Sardine habe ich nicht gefunden — aber hier Sardismus — und das stimmt
ja auch ganz, wie Sie sagten — — Katholik, Katholizismus; Buddhist, Buddhismus; Nihilist, Nihilismus; Sardine, Sardismus. Aber was nun hier drin steht, das stimmt nicht. Da ist von Fischen und Blechbüchsen gar nicht die Rede. Das ist ja Luderzeig, das kann man doch nicht essen.«
»Ja, lieber Karlemann, das ist aber doch auch ein Unterschied, Sardine und der Graf de Sade, auf den einzigen lumpigen Buchstaben kommt es recht wohl an, die Sardine schreibt sich eben mit dem r.«
»Tut sie?«
Karlemann fing wieder mit dem Zeigefinger in der Luft zu schreiben an, manchmal auch wieder mit der nassen Hand auswischend und neu beginnend, bis er seiner Sache sicher war.
»Weeß Kneppchen, Käpt'n, Sie haben recht, die Sardine hat in der Mitte ein r, ein kleines r. Wissen Sie, Käpt'n, wo ich das nun weiß, da brauche ich auch erst gar nicht davon zu lesen. So ein Buch kann doch überhaupt nicht mir, dem Kapitän Karl Algots, erzählen, wie man Sardinen in Öl kocht und dann in Blechkästen einsperrt.«
»Also Sardinen wollen Sie in Öl präservieren? Das ist das große Geheimnis, die große Idee?«
»Jawohl, ich will hier eine Ölsardinenfabrik begründen.«
»Hier auf dem Schiffe?«
»Gewiss, hier an Bord. Das ganze Zwischendeck wird als Küche eingerichtet, für die Fische werde ich sorgen — das verstehe ich, das wissen Sie doch, ich fange sogar dort Fische, wo gar keine sind
— Ihre Leute kochen sie in Öl, packen sie in Blechbüchsen ein, löten diese zu und so weiter. Vielleicht können wir ja auch noch gleich eine Blechbüchsenfabrik betreiben. Doch das will überlegt sein. Sehen Sie, da haben Ihre Matrosen immer etwas zu tun — und die Hauptsache ist: wir verdienen schweres Geld dabei.«
»Hm«, brummte Jansen, sein Lächeln unterdrückend. »Und wer soll uns denn diese Sardinen abkaufen?«
»Na, die Menschen, die Menschen! Oder doch alle die, welche Ölsardinen gern essen. Und das sind doch die meisten. Oder essen Sie keine Ölsardinen?«
»O ja, ab und zu ganz gern.«
»Ich nicht. Wenn ich eine Ölsardine sehe, nur eine verschlossene Büchse, kriege ich allemal gleich den Durchfall. Ich musste nämlich einmal als Kind immer Rhinozerosöl nehmen. Und ich kann überhaupt nichts Öliges in den Mund nehmen. Da mache ich meinem Namen Algots alle Ehre. Und wenn ich nun eine Flasche mit Öl sehe, oder eine Ölsardine, oder sonst etwas Öliges — da muss ich allemal an das Rhinozerosöl denken, und ich kriege sofort den Durchfall.«
»Hm, und bei dieser Abneigung gegen alles Ölige wollen Sie Ölsardinen en gros fabrizieren?«
»Nu warum denn nicht? Oder denken Sie etwa, der Kommerzienrat frisst seine Schokolade selber? Ebenso wenig wie ich früher meine eigenen Gier.«
»Aber, Karlemann, Sie müssen doch bedenken, dass es schon Ölsardinenfabriken genug geben wird, die wegen der Konkurrenz ganz rationell arbeiten müssen — da können wir sie wohl schwerlich billiger herstellen.«
»Da können Sie recht haben, aber bei uns ist das doch wieder etwas ganz anderes. Wollen Sie jetzt ein richtiger Seeräuber werden?«
»Was sagen Sie da?!«, fuhr Jansen empor.
»Na na — antworten Sie mir nur ganz ruhig.«
»Ob ich Seeraub treiben will? Nein, niemals!«
»Ganz meine Ansicht. Mit der richtigen Seeräuberei ist heutzutage nicht mehr viel los, es kommt nischt dabei heraus. Aber nun nehmen Sie mal an — Sie sehen ein Schiff, Segler oder Dampfer — Sie signalisieren: ›Sturmbraut‹, Kapitän Richard Jansen, streicht die Segel!!! — glauben Sie nicht, dass da jedes Schiff sofort stoppen wird?«
»Hm. Jedes gerade nicht. Aber die meisten doch wohl.«
»Und werden wohl an keinen Widerstand denken.«
»Ein Handelsschiff so leicht nicht.«
»Na, sehen Sie. Und nun gehen Sie hinüber an Bord, aber nicht etwa als Seeräuber, sondern Sie ziehen vor dem Herrn Kapitän höflich die Mütze, stellen sich vor — mein Name ist Richard Jansen, Sie kennen mich wohl schon, ich bin gegenwärtig Ölsardinenreisender, meine Firma ist höchst leistungsfähig — nicht wahr, Herr Kapitän, Sie nehmen mir etwas ab, es ist meine erste Geschäftsreise — vielleicht tausend Büchsen gefällig? Ach, nehmen Sie doch lieber gleich zehntausend. Sie kommen dabei viel billiger weg, werden selbst ein Bombengeschäft damit machen. Aber ich verkaufe nur gegen bar. — Glauben Sie, Jansen, dass der Kapitän Ihnen mit Freuden zehntausend Büchsen abkaufen wird?«
Vorläufig konnte Jansen nur lachen.
»Sie brauchen ihm deshalb keine Kanone auf die Brust zu setzen«, fuhr Karlemann fort, »nicht einmal eine Pistole. Das ist ein ganz ehrliches Geschäft.«
»Nein, das ist es nicht! Dann treibe ich lieber gleich ganz offen Seeraub.«
»Machen Sie es — ich mache dazu Ölsardinen. Nun will ich Ihnen aber etwas anderes sagen, Jansen. Halten Sie mich für dumm?«
»Ganz das Gegenteil.«
»Habe ich nicht immer nur originelle Ideen gehabt, die was einbrachten?«
»Ja, Karlemann, das haben Sie, Sie sind ein wirkliches Genie.«
»Na, und da können Sie glauben, ich wollte Ölsardinen machen?«
»Sie wollen's gar nicht?! Ja, was zum Teufel zerren Sie mich denn da erst mit den Ölsardinen so lange herum?!«
»Ruhig, ruhig. Etwas ist schon dabei. Sie sagten vorhin, Sie hätten über die Arbeit andere Ansichten bekommen. Ich ebenfalls. Nur ist's bei mir gerade umgekehrt als wie bei Ihnen. Sie gehen hinab, ich hinauf. Ich will mich veredeln. Ja, ververedeln will ich mich. Ich habe früher Hühnereier fabriziert, auch viel Geld damit verdient. Aber waren diese Hühnereier etwas wert für die allgemeine Menschheit? Nein, denn diese meine selbstgelegten Hühnereier waren Schwindel. Sie enthielten keine Spur von Eiweiß, sie enthielten keine Spur von Fett — außerdem bekam man nach ihnen den Durchfall. Jetzt aber habe ich etwas erfunden, womit ich die ganze Menschheit beglücken werde. Ja, Jansen, ich will ein Wohltäter der Menschheit werden.«
»Na, nun schießen Sie los mit Ihrer Beglückerei, Sie Wohltäter der Menschheit!«
Karlemann holte tief Atem, ehe er fortfuhr:
»Im Meere leben bekanntermaßen eine ganze Masse Fische. Es werden ja auch genug gefangen; aber was ist das im Gegensatz zu der Unmenge von Menschen, die auf der Erde herumlaufen. Nur die Küstenbewohner wissen etwas von richtiger Fischnahrung. Das macht, man kann die Fische nicht weit verschicken, nicht lange aufbewahren. Gefangen, geschlachtet, gebraten oder gekocht und gegessen. Was nicht bald gegessen wird, fängt an zu stinken. Es gibt ja einige Ausnahmen — Hering, Bückling, Sprotte, Sardine. Aber was ist das, was da verkonsumiert wird, im Gegensatze zu der ungeheueren Menge von Fischen, die im Meere herumschwimmen? Durch diese Einseitigkeit, die sich nur auf gewisse Fische erstreckt, beginnen sich denn auch schon die Reihen des Herings und seiner kleineren Kollegen ganz bedenklich zu lichten, aus der Ostsee ist er bereits herausgefressen, und doch immer nur von einigen wenigen Liebhabern eines gesalzenen oder marinierten Herings. Eine wichtigere Rolle als Volksnahrungsmittel spielt schon der Stockfisch, der getrocknete Kabeljau, der sich in diesem Zustande ewig hält, aber doch auch nur für die obersten Nordländer, und überhaupt ist Stockfisch ganz einfach Luderzeug.
Aber haben Sie schon einmal einen geräucherten Delfin gesehen? Oder einen marinierten Haifisch? Oder einen Walfisch in Öl? Sehen Sie, das ist es, was ich meine. Die Menschheit weiß die Fische noch gar nicht zu verwerten. Es sind nämlich auch herzlich wenig Fische, die wir essen können. Das heißt, wir verstehen sie nicht zuzubereiten. Kabeljau, Schellfisch, Flunder, Makrele, Aal — mehr kommt für uns als Nahrung aus dem Meere kaum in Betracht. Und was für ungeheuere Scharen anderer Fischarten streichen nun durch das Meer! Der Fischer geht ihnen aus dem Wege, denn wo diese sind, kommen die nicht vor, auf die er es abgesehen hat, und geraten sie zufällig in sein Netz, wirft er sie ärgerlich wieder über Bord. Sie kommen für die Menschheit nicht in Betracht, ihr Fleisch ist zu hart, zu zäh. Denken Sie nur, wie man mit dem Walfisch verschwenderisch umgeht. Ich weiß schon, es ist kein Fisch, aber auch er schwimmt doch im Meere. Man löst ihm nur die Barten ab, den Speck — und die übrigen hundert Zentner Fleisch überlässt man den Möwen und den Haien. Das ist ein Skandal! Aber welcher Segen, wenn der Haifisch genießbar wäre! Die im Süden segelnden Schiffe hätten immer frisches Fleisch, und unter dem furchtbarsten Räuber des Meeres würde bald aufgeräumt sein, was man wieder an dem Fischreichtum merken würde. Dasselbe gilt ja auch von allen anderen Raubfischen, deren Fleisch wegen ihrer Zähigkeit fast immer ungenießbar ist.
Man hat schon viel versucht, dieses harte Fleisch weich zu bekommen, dass man es verdauen kann, zunächst kauen. Man hat es immer mit überhitztem Dampfe probiert, besondere Kochtöpfe dazu gemacht — ganz vergebens. Aber auf eine ganz einfache Idee ist man noch nicht gekommen.«
»Auch die großen Fische in Öl zu kochen«, sagte Jansen, der jetzt wirklich mit Interesse zuhörte.
»Ja, das ist es. Wissen Sie, bei welcher Temperatur Öl — Pflanzenöl — zu sieden anfängt?«
»Ich weiß es nicht aus dem Kopfe, aber...«
»Ich kann es Ihnen sagen. Die Pflanzenöle sieden alle zwischen 250 und 300 Grad. Woher ich das weiß? Nicht etwa aus Ihren dämlichen Büchern. Weil ich der Sohn eines Schmiedes bin. Stahl wird oft in Öl gehärtet. Anstatt den ausgeschmiedeten und gefeilten Meißel in Wasser zu löschen, wodurch er glashart wird, und ihn dann auf einem rotglühenden Eisen wieder anlaufen zu lassen, gelb, rot oder blau, löscht man ihn lieber in Öl, in kaltem oder in heißem, je nachdem man ihn hart haben will, wozu man ihn braucht. Aber das will gelernt sein, das kann man nicht aus Büchern studieren. Und in so etwas war mein Vater ein Luder. Das war überhaupt ein Diftelmaier. Der hätte kein Dorfschmied zu bleiben brauchen. Er wusste nur nichts aus sich zu machen. Ein gar heller Kopp! Deshalb habe ich ihn auch zu meinem Vater erwählt. — Doch Spaß beiseite! Man kocht bereits Fische in Öl, um sie aufheben zu können, aber nur solche, welche an sich schon ein ganz zartes Fleisch haben. Ja, man hat auch schon immer Rindfleisch gekocht und Bouillon getrunken. Aber auf den Gedanken, die ungeheueren Rinderscharen, welche auf den Prärien Südamerikas weiden, bisher fast ganz wertlos, für die allgemeine Menschheit nutzbar zu machen, indem aus ihrem Fleische der Extrakt gezogen wird — auf diesen eigentlich doch so einfachen Gedanken ist erst Justus Liebig gekommen, der musste die Menschheit erst mit der Nase draufdrücken. Ja ja, Jansen, Sie brauchen mich nicht so anzukieken, ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Und was Professor Justus Liebig für das Rindvieh gewesen ist, das werde ich, Kapitän Karl Algots, für die Fische sein.«
Karlemann erhob sich, nahm eine möglichst gravitätische Miene an.
»Ja, Jansen, ich will ein Wohltäter der Menschheit werden! Und passen Sie auf, ich werd's. Es wird die Zeit kommen — Sie sind noch jung, Sie können's noch erleben — wo man mir allüberall in der Welt ein Denkmal aus Stein setzen wird — und da werden Sie sehen, wie ich so dastehe — so — oder so — etwa den rechten Fuß auf einen Delfin gesetzt, in die Wade kneipt mich ein Krebs — unter dem linken Arm habe ich ein dickes Buch, in der rechten Hand eine Angel — als Bekleidung würde ich ein Fischernetz vorschlagen — oder die eine Hand habe ich sinnend vor die Stirn gelegt — oder den Finger an die Nase — und darunter wird man lesen können: Karl Algots, der Wohltäter der Menschheit, welcher uns den in Öl gesottenen Walfisch schenkte — und wenn mein Geburtstag ist, da wird man vor meinen Denkmälern Freudenfeuer anzünden — und man wird Freudentränen weinen — und die Gesangvereine werden kommen — links stehen die Frauen und Jungfrauen, rechts die Männer — und man wird eine auf mich gedichtete Hymne singen: Heil — dem — Ölfischkocher Algots — und nun im Chor: Algots, Aalgots, Aaaalgoooots — und nun fangen die Jungfrauen mit ihrer lieblichen Stimme an: Aal Aal Aal Aal — und jetzt fallen die Männer mit ihrem Basse wuchtig ein: gots gots gots gots...«
Der an der Tür lauschende Mahlsdorf wurde nur dadurch daran verhindert, vor Lachen umzufallen, dass in diesem Augenblicke ein von Osten kommender Dampfer gesichtet wurde.
»Karlemann, Sie hätten Schauspieler werden sollen, Komiker, Sie würden nicht weniger verdienen, als mit Ihren genialen Ideen«, sagte Jansen nur noch, sich die Tränen aus den Augen wischend, dann war er wieder Kapitän.
Es war ein großer Raddampfer, welcher schnell aufkam, und nach den vielen Menschen, die an Deck standen, musste es ein Passagierdampfer sein, und zwar wohl ein französischer oder italienischer, denn man befand sich in der Dampferlinie Gibraltar—Südamerika.
Wenn das auch nur ideale Linien sind, nur gedachte, so kann man das doch ziemlich genau bestimmen. Schon ein von Lissabon kommender Dampfer hätte ganz anders gesteuert, und dieser hier hielt offenbar den Kurs nach Cap Branco.
Die beiden Schiffe waren nahe genug zusammengekommen, um Signale wechseln zu können.
Es ist durchaus keine Vorschrift des internationalen Seegesetzes, dass sich begegnende Schiffe einander Namen, Heimathafen und Ziel nennen müssen. Das gehört nur zur Seeroutine, ist eine Pflicht des Anstandes.
Wohl aber wird dem Kapitän von der Reederei direkt vorgeschrieben, sich jedem Schiffe, das ihm begegnet, vorzustellen, ihm alles Bemerkenswerte zu melden, was an Bord in letzter Zeit vorgefallen ist.
Der Grund hierzu liegt klar auf der Hand. Es kann ja vielleicht die letzte Kunde sein, welche das betreffende Schiff von sich zu geben vermag, in der nächsten Stunde liegt es vielleicht mit Mann und Maus geborsten auf dem Meeresgrunde, und der Reeder will doch natürlich immer möglichst viele Nachrichten von seinem oder über sein Schiff haben.
Denn was einem Schiffe zusignalisiert wird, das muss wörtlich ins Logbuch eingetragen werden, das ist gesetzliche Vorschrift.
So hisste jetzt der Passagierdampfer eine Reihe von Signalflaggen.
»›Apulia‹, Genua, Kapitän Garzotti.«
So, nach dieser ersten Vorstellung erwartete der Dampfer die des Seglers.
»Was für einen Namen soll ich signalisieren?«, fragte Mahlsdorf.
»›Sturmbraut‹, natürlich ›Sturmbraut‹ — und dann meinen ehrlichen Namen.«
Gut, die Flaggen gingen hoch.
»›Sturmbraut‹, Kapitän Richard Jansen.«
Hei, gab das dort drüben eine Überraschung auf der Kommandobrücke! Von da aus verpflanzte sie sich, von Matrosen oder Offizieren, über das ganze Deck, in aller Schnelligkeit mochten von denen, welche von diesem Desperadoschiffe schon mehr wussten, Schaudergeschichten erzählt werden — die Passagiere schwirrten durcheinander, verschwanden unter Deck, kamen wieder zum Vorschein, und besonders auf dem Promenadendeck, nur den Passagieren erster und zweiter Kajüte zugänglich, sah man, wie schon Hände gerungen wurden, und nicht nur von Damen, durch das Fernrohr erkannte man ganz deutlich einen Mann, der ein Gewehr lud.
»Was nun?«, fragte Mahlsdorf weiter.
»Ob uns die ›Apulia‹ mit kleinem Proviant aushelfen kann. Seht, Mahlsdorf, auch auf dem Meere gibt es wohlriechende Lotosblumen, und das massenhaft, wir werden immer genug Blumenstaub sammeln können.«
»Soll ich befehlen, dass sie die Segel streichen?«, fragte Mahlsdorf ganz verwirrt. Denn jetzt schien doch die Seeräuberei anzufangen, der Kapitän handelte doch etwas anders als er vorhin gesprochen hatte.
Aber Jansen machte Mahlsdorfs Ansicht sofort zunichte. »Segel streichen? O nein, ich will kein Seeräuber werden. Ob die ›Apulia‹ uns kleinen Proviant abgeben kann. Ganz höflich. Das kann doch auch jedes andere Schiff anfragen. Jawohl, nur immer höflich.«
Aber es hatte doch etwas Besonderes in Jansens Stimme gelegen, etwas Höhnisches, zumal in der letzten Wiederholung, ganz höflich sein zu wollen. Die Frage wurde gestellt. Unter kleinem Proviant versteht man Zutaten, wie Zucker, Salz, Essig und dergleichen.
»Und ob er Öl hat, Salatöl«, setzte Karlemann noch hinzu.
»Unsinn!«, meinte Jansen. »Das wird sich doch zeigen, wenn wir an Bord sind.«
Und das war eine starke Andeutung, dass Jansen auf alle Fälle beabsichtigte, den Passagierdampfer zu betreten, also zuletzt doch zu Gewaltmitteln gegriffen hätte, obgleich, wie wir gleich sehen werden, die ›Sturmbraut‹ jetzt dazu wenig in der Lage war.
Große Unruhe auf der Kommandobrücke wie auf dem ganzen Schiff, die Offiziere berieten sich schnell, dann wurde die Frage bejaht, worauf die Offiziere wieder die Köpfe zusammensteckten.
»Na — na — wird es nun bald?«, sagte Jansen spöttisch. »Ah, da ist es ja schon.«
Die Schaufelräder hörten auf zu arbeiten, und das war es, worauf Jansen gewartet hatte.
»Sollen wir den Proviant hinüberbringen?«, wurde drüben angefragt.
»Gar keine Antwort«, entschied Jansen. »Die werden sofort erkennen, auf welche Weise ich mir das Gewünschte selbst holen werde.«
Und schnell folgte Kommando auf Kommando, die Matrosen flogen die Wanten hinauf.
Wenn der Dampfer nicht gestoppt hätte, so wäre die ›Sturmbraut‹ gar nicht fähig gewesen, ihn einzuholen. Seit sie die Fucusbank verlassen, hatte sie nämlich noch keine Schaufel Kohlen verfeuert. Jansen war mit einem Male überaus sorglos geworden.
Jetzt wollte er den Dampfer ansegeln, neben ihm beilegen, nur unter Zuhilfenahme der Segel, und da bekamen die Offiziere und Matrosen des Dampfers nun allerdings etwas zu sehen, ein heutzutage höchst seltenes Kunststück.
Es ist gar kein Zweifel, dass die Segelkunst früher auf einer weit höheren Stufe gestanden hat. Denn das Segeln ist wirklich eine Kunst, sogar eine Wissenschaft. Es sind Gelehrte, Physiker und Mathematiker, welche in der Studierstube die Form des neu zu bauenden Segelschiffes entwerfen, jedes einzelne Segel nach dem Parallelogramm der Kräfte anordnen, und unter den Kapitänen wieder gibt es Segelmeister, deren Kunst eine göttliche Inspiration genannt werden kann, denn wem es nicht gegeben ist, der lernt es nie.
Dies alles gilt noch für heute, da es noch immer achtmal so viele Segler wie Dampfer gibt, und es werden noch genug Segelschiffe gebaut, die immer größere Dimensionen annehmen.
Aber die Manöver, welche früher von den Seglern ausgeführt wurden, die wie die weißen Schwäne über die Ozeane flogen, werden heute gar nicht mehr gewagt, sind nicht mehr auszuführen. Der Pfiff des ersten Dampfers war das Grabgeläute für die edle Segelkunst. Früher konnte kein Segelschiff in den Hafen geschleppt werden, da hieß es: selbst ist der Mann! — und wollte es draußen im Sturm nicht an der Küste zerschellen, so musste es eben den Hafen zu gewinnen suchen, und da musste alles riskiert werden.
Früher waren die Kräfte in der Seeschlacht viel gleicher verteilt, und da kam es weniger darauf an, das feindliche Schiff in den Grund zu schießen, als es vielmehr durch Entern zu nehmen, die Schiffe suchten sich also stets anzusegeln, oder aber das schwächere suchte dem stärkeren durch geschicktes Manövrieren auszuweichen, um wieder Luft zum Abfeuern der Kanonen zu bekommen. Dabei aber war die Schießerei viel harmloser. Die Kaliber allerdings gaben unseren heutigen nichts nach, aber nur Kugeln, keine Granaten, und dann waren die Schiffe doch aus Holz, nicht aus Eisen, das Loch konnte fast immer wieder zugestopft werden, während die Eisenplatten selbst unter einer Spitzkugel zersplittern. Es gibt Sachverständige, welche deshalb noch heute den Bau von hölzernen Kriegsschiffen befürworten, die ganze Panzerung weglassen wollen. Erst durch das Aufkommen der wasserdichten Schotten, welche das Schiff in viele einzelne Abteilungen zerlegen, die sich unbeschädigt mit Wasser füllen können, hat sich das etwas geändert.
Die Hauptursache der Ungelenkigkeit der heutigen Segler aber ist wohl, weil man möglichst Leute zu sparen sucht, indem man sich beim Anlaufen des Hafens und bei anderen Gelegenheiten immer auf den Dampfer verlassen kann, während früher dazu unbedingt viel mehr Matrosen nötig waren.
Nun, an Bord der ›Sturmbraut‹ waren überreichlich Matrosen vorhanden, zweiundzwanzig große und fünfundzwanzig kleine, die aber vollständig ihren Mann standen, zu den ersteren zählten auch die Heizer, die ebenfalls im Takelagedienst ausgebildet worden waren, so hatte jede einzelne Rahe ihre Bedienungsmannschaft, und Jansen hatte sie so sicher am Schnürchen wie seine Signalpfeife.
Und diese gab schrillend die einzelnen Kommandos, von den beiden Bootsmannspfeifen wiederholt, das Schiff wurde mehr in den steifen Wind gedreht, mit geschwellten Segeln schoss es auf den Dampfer zu, drehte bei und kam von hinten auf, ein Segel verschwand nach dem anderen, wurde gerefft und festgemacht, und dennoch sah es aus, als ob die ›Sturmbraut‹ den Dampfer hinten in die Seite rammen müsse — — da noch ein gellender Pfiff, die ›Sturmbraut‹ schwenkte herum, gleichzeitig rollte sich das letzte Segel zusammen, und trotz der ganz ansehnlichen See legte sich der stattliche Segler so sanft neben den Dampfer, als wenn ein Kind seine Spielschiffchen auf dem Tische zusammenrückt.
Im Nu war von den an Deck gebliebenen Matrosen die Verbindung mittels Tauen hergestellt, ohne Enterhaken und dergleichen, die beiden Schiffe bildeten ein festes Ganzes.
Während die Passagiere in diesem Manöver des vermeintlichen Piratenschiffes nichts weiter als einen Überfall sahen und daher zeternd durcheinander liefen, wenn sie nicht auf den Knien lagen, einige sogar schon Uhr und Geldbeutel ziehend, weil ihnen ihr Leben lieber war, standen die Offiziere und zum größten Teil auch die Matrosen wie die Statuen da und sperrten Maul und Nase auf.
War denn das Zauberei? Sie hatten das Segelschiff soeben noch mit voller Leinwand in ziemlicher Entfernung gesehen, plötzlich schoss es auf sie los, segelnd, nicht dampfend, was sie sofort erkannten, und nun lag es plötzlich mit festgemachten Segeln neben dem Dampfer.
So etwas gab es eben nicht mehr!
Mahlsdorf sah, wie sein Kapitän hinüber wollte, so wie er ging und stand, allein, er hielt ihn zurück.
»Kapitän«, bat er, »bedenken Sie, was Sie tun, Sie sind...«
»Ich will solch eine Warnung nicht noch einmal hören, auch nicht in bittendem Tone. Passiert mir doch etwas, dann tun Sie, was Sie vor Ihrem Gewissen rechtfertigen können.«
Mit diesen Worten sprang Jansen auf die Bordwand und war an Deck des nur um ein wenig höheren Dampfers.
»Wo ist der Signor Capitano?«
Noch wollte kein Leben in die Erstarrten kommen. Unbeweglich stierten sie alle die hünenhafte Gestalt des Mannes an, von dem jetzt alle Welt wusste, dessen Person jetzt das Gespräch aller Menschen bildete, so weit diese im Schweiße ihres Angesichts das endlose Meer pflügen müssen.
Und immer spöttischer blickten die Augen, als sie diese erstarrte Menge musterten.
»Leute, auf meinen Kopf steht eine Prämie von 50 000 Pfund Sterling, oder sogar 60 000 — anderthalb Millionen Lire. Will sie sich niemand verdienen? Es kostet ja nur einen Schuss.«
Sie alle hatten ihn verstanden, er hatte es im besten Italienisch gesagt, sie mochten auch schon vorher von allein daran gedacht haben, wurde doch jetzt über diese immense Prämie, die auf des Seedesperados Vernichtung stand, in allen Kajüten, Offiziersmessen und Matrosenfoxeln ständig gesprochen.
Aber... es fiel eben kein Schuss! Niemand wagte, sich zu rühren.
Endlich raffte sich der Kapitän auf, als der eines erstklassigen Passagierdampfers ein Kavalier, kam die Treppe herab.
»Kapitän Garzotti?«
»Ich bin es.«
»Richard Jansen, Kapitän der ›Sturmbraut‹.«
»Es ehrt mich ungemein.«
Es sah fast aus, als wolle Jansen ihm ins Gesicht lachen.
»Mir ist der kleine Proviant ausgegangen.«
»Es steht Ihnen alles zur Verfügung. Darf ich Sie bitten?«
Der Kapitän hatte gemerkt, dass er doch nicht einen solchen Seeräuber vor sich hatte, der gleich mit Gewalt vorgehen wollte, er lud ihn in die Kajüte ein.
Gleich darauf musste Bernhard mit der Kiste kommen, er fand die beiden schon beim unumgänglichen Champagner sitzen.
So sehnlichst wohl auch Karlemann dieser Unterredung beizuwohnen wünschte, so wusste er doch, wie weit er in seiner Dreistigkeit gehen durfte. Die Grenzen, welche die Bordroutine zieht, sind eisern.
Nicht lange dauerte es, so brachten Matrosen des Dampfers Kisten und Säcke angeschleppt. Bernhard war wieder dabei, als sie über die beiden Bordwände auf die ›Sturmbraut‹ wanderten, die einzelnen Stücke waren gekennzeichnet, was sie enthielten, und es handelte sich nicht nur um kleinen Proviant, also um Zucker, Salz und dergleichen, was die Hausfrau wohl als Zutaten bezeichnet, sondern es wurde auch großer Proviant in schwerer Menge übergenommen, unter anderem viele Kisten mit Eiern, in Dosen präserviertes Fleisch und Gemüse aller Art, einige Dutzend riesiger Salamiwürste, ungeheuere Blöcke von Stracchino und Gorgonzola, die in Italien beliebtesten Käsearten, Dosenbutter, aus dem Eisraum kommend, für Passagierdampfer damals eine ganz neue Errungenschaft, während sich die ›Sturmbraut‹ noch mit dem wasserumspülten Kielraum begnügen musste, einige Fässer mit gepökelten Ochsenzungen, schließlich auch ganze Käfige voll lebender Tauben, Hühner, Enten und Gänse.
Solche Passagierdampfer sind ja überreichlich verproviantiert, die Gäste der ›Apulia‹ brauchten diese Abgabe von Nahrungsmitteln wahrscheinlich gar nicht zu merken.
Schließlich noch große Kisten mit Wein aller Art, und den Schluss der Vorstellung machte eine endlose Kette von Bratwürsten, die soeben in der Fleischerei frisch gestopft worden waren. Auf diesen Genuss mussten die Passagiere erster und zweiter Kajüte heute nun freilich verzichten.
»Na, solchen Blumenstaub lasse ich mir gefallen«, schmunzelte Mahlsdorf, und alle Matrosen schmunzelten mit ihm.
Die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ hatte stets das beste bekommen, was im Hafen zu haben gewesen war, nicht gerade Austern und Kaviar und Champagner, aber doch an Fleisch und Gemüse. Nun aber ist die Art des Schiffsproviants, welcher nicht verdirbt, doch nur eine beschränkte, so war die ›Sturmbraut‹ während ihrer langen Reisen meistenteils auf Hülsenfrüchte und Salzfleisch angewiesen, abgesehen von Hartbrot, und merkwürdig ist, dass man diese Nahrung trotz ihrer schweren Verdaulichkeit längst nicht so schnell überdrüssig bekommt wie Büchsenfleisch und anderes präserviertes Zeug, dem man durch künstliche Mittel den Anschein der Frische wahren will.
Auf einige Delikatessen hielt Jansen ja immer, und diese verbrauchte er allerdings dann nur für sich, höchstens die Offiziersmesse bekam ab und zu davon etwas ab, sonst aber begnügte er sich mit einfacher Mannschaftskost, während er andererseits, wenn eben das beste zu haben war, auch seine Matrosen darin schwelgen ließ, und da er doch nicht die ganze Bratwurstschlange allein aufessen konnte, auch die Ochsenzungen bald überdrüssig bekommen hätte, so durften die Matrosen jetzt mit Recht schmunzeln.
»Das wird hüt all upfräten!«, grinste Meister Pieplack, welcher, seitdem ihm durch jenen unglücklichen Schuss die Möglichkeit genommen worden war, noch einmal Familienvater werden zu können, ein ausgesprochener Gourmand geworden war oder doch nur noch Sinn für Fresserei hatte.
»Das kostet aber auch alles schweres Geld — Seepreise«, sagte der Steward.
»Was, der Käpt'n bezahlt?!«, fragte Mahlsdorf erstaunt.
»Na, was dachten denn Sie, Stürmann?«, durfte der Steward, der, obgleich in der Musterrolle nur als Matrose geführt, doch an Bord eine Ausnahmestellung einnimmt, den ersten Offizier geringschätzend fragen. »Sie dachten wohl, wir wären wirklich Seeräuber, die hier plünderten? Nee, bezahlen wir alles mit einer Hand!«
Mahlsdorf kratzte sich hinter den Ohren.
»Hm, dann ist der Vergleich mit dem Blumenstaub doch nicht ganz zutreffend, die Schmetterlinge bezahlen dafür nischt.«
»Und wo bleibt denn mein Öhhhl?!«, ließ sich jetzt Karlemann vernehmen.
»Nur ruhig, die sind noch nicht fertig, und unser Käpt'n denkt an alles.«
So war es auch. Jetzt hatte Jansen erst alles eingehandelt, worüber der Kapitän des Dampfers verfügen konnte.
»Mehr als drei Kruken Öl können Sie mir nicht abgeben? Ich glaubte, ein Schiff, welches italienische Passagiere befördert, sei gerade recht reichlich mit Öl versehen; die Italiener wollen doch alles in Öl gebraten haben, lieben Bohnensalate und dergleichen, alles in Öl schwimmend.«
»Eben deswegen kann ich nicht viel Öl abgeben; denn der Herr Kapitän sagten doch selbst, meine Passagiere sollten unter der Entnahme nicht leiden...«
»Ach, natürlich. Sie haben recht, ganz recht. Das war ja Torheit, was ich vorhin sprach. Na, da muss sich Karlemann vorläufig eben mit drei Kruken Öl begnügen.«
»Und dennoch könnte ich Ihnen vielleicht eine große Quantität feinstes Olivenöl verschaffen.«
»Sofort?«
»Jawohl. Unter der Fracht befinden sich hundert große Flaschen feinstes Olivenöl, die Flasche zu zehn Litern, und sie sind leicht erreichbar. Ich war zufällig dabei, als sie verstaut wurden, stehen gleich obenauf.«
»Können Sie aber auch darüber verfügen? Unannehmlichkeiten sollen Sie nicht davon haben.«
Der italienische Kapitän blickte den Mann an, der zwei englische Kriegsschiffe vernichtet hatte, über den die ungeheuerlichsten Gerüchte umliefen, und der jetzt das zarteste Gewissen zeigte.
Von der Fracht, über welche der Kapitän doch nicht frei verfügen konnte, hatte Jansen bisher durchaus nichts haben wollen. Zum Beispiel hatte er zuerst auch mehr Wein begehrt, unter der Fracht befanden sich viele Fässer italienischen Weines, aber der Kapitän kannte den Preis nicht, und Wein ist ein Spekulationsobjekt, eine Liebhaberei, deren Wert niemand beurteilen kann. So hatte Jansen davon abgesehen.
»O, bei Öl ist das doch etwas ganz anderes, und wenn Sie dafür den höchsten Marktpreis zahlen...«
»Nun gut, wenn Sie es verantworten können. Und wie ist wohl der höchste Marktpreis?«
Der Zahlmeister musste kommen, der kaufmännische Leiter des Schiffes, er sah erst im Frachtbuche nach.
»Diese hundert Glaskruken Olivenöl sind der Firma Steffenson und Kompanie in Rio de Janeiro überhaupt nur gegen Nachnahme abzugeben.«
»Gegen wie viel?«
»Gegen fünfhundert Dollar. Das ist... ein ganz normaler Preis für bestes Olivenöl.«
»Wenn ich das Doppelte zahle, dürfte Empfänger oder Absender wohl zufrieden sein.«
»Aber selbstverständlich!«, lachte der Zahlmeister, wie auch der italienische Kapitän gern lachte — nämlich ein Lachen der Erleichterung, dass dieser gefürchtete Seeräuberkapitän so ganz anders auftrat, als erwartet.
Es wurde Anweisung gegeben, die in Kisten verpackten Ölflaschen aus dem Frachtraume, wo sie zufällig leicht erreichbar waren, heraufzubefördern.
»Was macht das nun alles zusammen?«
Die Rechnung wurde ausgestellt — etwas über 9000 Lire, — Jansen hatte tüchtig eingekauft, und dazu kamen noch 1000 Dollar oder 4000 Lire für das Öl.
Jansen zog seine Brieftasche, die er vor dem Betreten des Dampfers in seiner Kabine, die den Panzerschrank enthielt, gefüllt hatte, entnahm ihr eine Hundertpfundnote nach der anderen.
Dann sah er nach seiner Uhr.
»Sie haben drei Viertelstunden Aufenthalt durch mich gehabt.
Sagen wir eine Stunde. Was berechnen Sie dafür?«
Das hätte etwas Tüchtiges gekostet, aber der Kapitän wollte davon nichts wissen, und er hatte auch das freie Recht, darauf zu verzichten.
»Ich schätze es mir zur höchsten Ehre, Sie kennen gelernt zu haben, und ich werde der Welt berichten, dass Kapitän Richard Jansen durchaus nicht...«
»Genug!«, unterbrach Jansen ihn mit weniger Höflichkeit, als er bisher gezeigt. »Dass ich hier einmal Proviant gekauft und die Rechnung bezahlt habe, kann mich nicht weiß brennen. Wenn man genug Geld hat, weshalb soll man denn da rauben?«
Mit dem tiefsten Respekt blickten Kapitän und Zahlmeister auf die dicke Brieftasche, deren Umfang durch die Bezahlung der großen Summe noch nicht im geringsten abgenommen hatte.
»Ist es wahr, Herr Kapitän«, platzte da der Zahlmeister heraus, »dass Sie eine noch unbekannte Perlenbank kennen?«
»Woher wissen Sie denn das?«
»Das — das — ist doch allgemein bekannt; in jeder Zeitung ist davon zu lesen.«
Es war die Folge von Atlantas Geschwätzigkeit, viel hatte sie freilich nicht erzählen können.
»Ja, ich kenne eine solche.«
»An der chinesischen Küste?«
»Ja.«
»Wo da?«
»Na, nun hören Sie aber auf!«, lachte Jansen belustigt, und die anderen beiden stimmten mit ein, froh, dass der gefürchtete Mann die dreiste Frage nicht übelgenommen hatte, was sie nun aber auch zu weiteren Fragen ermutigte.
»Ist die Perlenbank leicht zugänglich?«
»Sehr leicht.«
»Schöne Perlen?«
Jansen zog unter seiner Weste ein Beutelchen hervor, schüttete es aus — und Kapitän und Zahlmeister konnten einen Ruf des Erstaunens nicht unterdrücken.
Das Lederbeutelchen hatte nicht nur Perlen, sondern auch Diamanten und andere Edelsteine aller Farben enthalten, wundervolle Exemplare, jeder einzelne ein Vermögen repräsentierend, und unter den Perlen waren solche von der Größe eines Kirschkernes.
Wenn die Augen des italienischen Kapitäns und des Zahlmeisters jetzt so auffunkelten, so brauchten sie deswegen noch keine habgierigen Menschen zu sein.
»Es sind keine ausgesuchten Exemplare, ich habe nur so in den Kasten gegriffen.«
Nur so in den Kasten gegriffen — wie das klang!
Und Jansen hatte es so nachlässig gesagt — offenbar mit Berechnung, er beabsichtigte etwas dabei, denn unser Held war doch alles andere als ein Renommist oder eitel auf solchen Tand, und er hatte wohl auch nicht umsonst vorhin das Lederbeutelchen mit diesen Kleinodien gefüllt und es mitgenommen. Er selbst hätte wahrscheinlich das Gespräch darauf gebracht, um sie zeigen zu können.
»Verkaufen Sie diese Steine und Perlen?«, fragte der Kapitän.
»Wenn ich einmal Geld brauche, gewiss.«
»In der ersten Kajüte ist ein Passagier, ein Diamantenhändler...«
»Nein, ich benötige jetzt keines baren Geldes.«
»Diese Perlen stammen von jener Bank?«
»Jawohl.«
»Prachtvoll! Unschätzbar! Und die Edelsteine, wenn ich fragen darf?«
»Ebenfalls von dort.«
»Aber Diamanten findet man doch nicht im Meere!«
»Weshalb nicht?«
»Wie? Sie wissen eine unterseeische Diamantengrube?«
»So ist das nicht gemeint. Als ich auf die Perlenbank niedertauchte, fand ich zufälligerweise auch ein Wrack. Es war ein Schiff gewesen, welches von Indien kam, viele indische Diamantenhändler, welche ihren Tod gefunden... ich beförderte die glitzernden Steinchen eimerweise herauf.«
Immer fassungsloser blickten die beiden auf den Sprecher.
»Und der Aschantischatz?«, flüsterte der Zahlmeister.
Schon diesem bündigen Ausdrucke konnte man entnehmen, dass der › Aschantischatz‹ bereits ein populäres Wort geworden war.
»Dieser gehört zwar nicht mir, aber er befindet sich bei mir an Bord.«
»Wenn Ihr Schiff aber nun einmal untergeht?«
»Nun, was dann? Dann werde ich neben ihm auf dem Meeresgrunde ruhen.«
Jansen entnahm seiner Brieftasche eine weitere Hundertpfundnote.
»Da Sie die versäumte Zeit nicht bezahlt haben wollen, so gestatten Sie wenigstens, dass ich Ihnen dies zur Verteilung an Ihre Mannschaft gebe.«
»Ich nehme es im Namen meiner Leute mit Dank an, werde es verteilen.«
»Aber nicht rangmäßig, sondern ganz gleichmäßig, wenn ich bitten darf.«
»Wie Sie wünschen. Vor Gott sind ja auch alle Menschen gleich.«
»Und vor einem Desperadokapitän, der, wenn nicht aus Not, so doch vielleicht aus Sport, aus Liebhaberei zum Seeräuber werden kann, ebenfalls.
Wie viele Zwischendeckpassagiere haben Sie an Bord?«
»Dreihundertachtunddreißig«, konnte der Kapitän aus dem Kopfe sagen.
»Italiener?«
»Fast nur Italiener, armes Volk, Bauern und Handwerker, die sich in Brasilien, welches immer viele Leute sucht, als Arbeiter verdingen wollen.«
Jansen hatte außer einer ganzen Reihe von Hundertpfundnoten auch noch einige Goldstücke aufgezählt.
»Hier, dreitausendachthundertdreißig Pfund. Auf den Kopf kommen zehn Pfund. Sie haben wohl die Güte, das Geld unter die Zwischendeckpassagiere zu verteilen.«
»O, Herr Kapitän, für jeden zehn Pfund Sterling — zweihundertfünfzig Lire — das bedeutet für diese durchweg bettelarmen Leute ja ein Kapital!!«
»Eben deswegen halte ich zehn Pfund für genügend, man soll die Armut nicht verwöhnen.«
»Ich will die Leute gleich davon in Kenntnis setzen, dass sie sich wenigstens bedanken können«, sagte der Zahlmeister und wollte die Kajüte schnell verlassen.
Aber Jansen hielt ihn zurück.
»Nein, nein, unter keinen Umständen! Sie sollen es erst erfahren, wenn wir uns schon wieder entfernt haben.«
Die Unterredung war beendet, die Herren verabschiedeten sich aufs höflichste, Jansen begab sich an Bord seines Schiffes zurück.
Wäre schon bekannt gewesen, was er angeordnet, so wäre er jetzt von mehr und minder zerlumpten, braunen Gestalten umringt worden, die ihm die Hand zu küssen versucht hätten. So wurde der vermeintliche Seeräuberkapitän nur noch immer angsterfüllt angeblickt.
Die Verbindung wurde gelöst, mit demselben staunenswerten Manöver kam die ›Sturmbraut‹ wieder frei, schoss mit geschwellten Segeln davon.
Aber sie war noch in Rufweite, als dort drüben auf dem Dampfer ein donnerndes ›Eviva!!‹ erscholl, das gar kein Ende nehmen wollte, und Hunderte von bunten Tüchern winkten der ›Sturmbraut‹ den Abschiedsgruß nach.
Jetzt hatten die Zwischendeckpassagiere erfahren, was für ein edler Pirat das war, er konnte nur mit Rinaldo Rinaldini verglichen werden, der ja auch nur den Reichen nahm, um es den Armen zu geben, was ja überhaupt jeder brave Räuber tun muss. Und wer nicht kapiert, dass solche Räuber stets die Helden in der Volksliteratur bleiben werden, und das mit gutem Rechte, wie schon unser Schiller bewiesen hat — der gehört jedenfalls zu denen, welche als Romanhelden einen Schwindsüchtigen mit zerfressenem Rückenmark haben wollen.
Mahlsdorf konnte sich diese enthusiastischen Abschiedsgrüße nicht erklären, er wusste ja noch gar nichts von der wohltätigen Stiftung seines Kapitäns, er dachte höchstens, die Zwischendeckpassagiere, an Bord des eine kleine Welt bedeutenden Schiffes das breite Volk vertretend, zollten im allgemeinen dem Seeräuberkapitäne ihre Hochachtung — — und im Übrigen kümmerte ihn das auch sehr wenig, er sog mit Behagen den Duft der Bratwürste ein, die schon zu Dutzenden in einer Riesenpfanne unter Smutjes Aufsicht bratzelten, und dabei wurden in Mahlsdorf ganz andere Gedanken ausgelöst.
»Ha, wenn die geahnt, dass wir nicht einmal unsere Kanonen geladen hatten! Aber das musste für die ja so selbstverständlich sein, dass unsere Kanonen geladen waren, dass wir sie gar nicht erst zu laden brauchten.«
Es war eine verzwickte Logik, aber Mahlsdorf hatte ganz recht. Nur, dass der Urheber dieses verzwickten Gedankenganges der Kapitän gewesen war.
Während die ›Sturmbraut‹ neben dem Dampfer gelegen hatte, war von der Mannschaft der ersteren ein Haifisch gefangen worden, der sich mit einigen anderen Kollegen um die beiden stilliegenden Schiffe herumgetrieben hatte.
Es wird ja nicht etwa jeder Haifisch gefangen, der einem Schiffe nachfolgte. Da würden die Matrosen in den südlichen Breiten doch niemals fertig. Der Schreiber dieses glaubt sogar, dass in Jugendschriften mehr Haifische gefangen werden als in Wirklichkeit.
Einmal macht's Spaß, ein zweites Mal — lässt man die Bestien schwimmen.
Erst nachdem Karlemann seine hundert Flaschen Olivenöl in Empfang genommen, hatte er die Matrosen sofort veranlasst, einen der Haie zu ködern, der an Deck gleich regelrecht zerwirkt wurde.
Wir wissen, zu welchem Zwecke. Karlemann wollte gleich sein Experiment beginnen. Ölhaifisch, entsprechend der Ölsardine. Doch es handelte sich vorläufig weniger um eine Präservierung des Fleisches, wie bei der Sardine, sondern überhaupt um das schrecklich zähe Fleisch des Haifisches in Öl, dessen Siedepunkt also noch über 250 Grad Celsius liegt, weich zu bekommen, und gelang ihm das, war das Fleisch dann genießbar oder überhaupt kaubar, dann hatte Karlemann tatsächlich zum Wohle der Menschheit ein wichtiges Problem gelöst, dann musste man durch Kochen in Öl auch jeden anderen Fisch weich bekommen, der sonst wegen seines zähen Fleisches den besten Zähnen widersteht.
Denn widerwärtig schmeckt das Fleisch des Haifisches sonst nicht etwa, das weiß man von ganz jungen Exemplaren, und auch das Fleisch der alten schmeckt ganz gut, wenn man es vorher fein gewiegt hat. Nur ist es vollständig unverdaulich, liegt im Magen wie Blei, wird wie solches wieder ausgeschieden. Es handelte sich also mehr um eine ›Aufschließung‹, wie der technische Ausdruck lautet, um das unverdauliche Fleisch angreifbar für den Magensaft zu machen.
Es ist tatsächlich deshalb schon viel experimentiert worden, aber immer nur mit überhitztem Dampf, der auch bei den höchsten Temperaturen nicht genügt hatte.
Die Idee, statt des Wassers das viel schwerer siedende Öl zu benutzen, liegt eigentlich so nahe, und doch war noch niemand darauf gekommen, dieser deutsche Zigeunerknabe musste wieder einmal diesen Gedanken ausgeheckt haben.
Etwas ganz Ähnliches liegt mit dem Stroh vor. Es füllt den Magen der Rinder und Pferde, hat aber gar keinen Nährwert, wird nicht verdaut. Da kommt vor einigen Jahren ein amerikanischer Offizier auf den Gedanken, das gehäckselte Stroh durch Kochen mit Natronlauge ›aufzuschließen‹, und gewinnt hierdurch ein wertvolles Futter. Denn viele Nährstoffe hat das Stroh schon, diese sind nur im gewöhnlichen Zustande unverdaulich.
Auf diesen so einfachen Gedanken hätte jeder Chemiker kommen können — nein, es war ein Infanterieoffizier, der sich sonst gar nicht mit Chemie abgab.
Also Karlemann traf seine Vorbereitungen. In der Kombüse war auf dem großen Herde neben der Bratwurstpfanne noch genug Platz für seine Manipulationen.
Zwar duldet kein Koch gern einen Rivalen in seinem Reiche, am wenigsten ein Schiffskoch. Smutje sprach etwas von ›Swienerie‹ und dergleichen, aber Karlemann war eine Respektsperson, nicht nur dem Range nach, sondern alles blickte in aufrichtiger Bewunderung zu dem Knirpse... nicht empor, sondern hinab.
Er nahm den größten Topf, füllte ihn zur Hälfte mit Öl, was schon zwei der großen, dickbauchigen Flaschen verschlang, zwanzig Liter, legte einige Stücke von dem Haifischfleische hinein, machte ein tüchtiges Feuer darunter.
»Erst will ich es kalt ansetzen, das muss alles ausprobiert werden.«
»Sie hätten das Fleisch erst wiegen oder doch wenigstens in kleine Stücke schneiden sollen«, meinte der Koch.
»Nee, das wäre doppelte Arbeit. Wird das Fleisch so weich, dann braucht es nicht erst gewiegt zu werden, und würde das gewiegte Fleisch nicht weich, dann erst recht nicht das ganze.«
»Sie müssen in mehreren kleinen Kesseln verschiedene Proben zugleich machen.«
»Nee«, wehrte Karlemann wiederum ab, »im kleinen fällt alles gewöhnlich ganz anders aus, als hinterher im großen, wenn man's wirklich machen will.«
Karlemann sprach da eine Weisheit aus, welche viele unserer heutigen Chemiker und Techniker nicht einsehen wollen, weshalb sie dann ihre Patente niemals verwerten können.
»Das wird aber eine teure Schmiere«, musste der Koch seinem Misstrauen immer wieder Luft machen.
»Wieso denn? Öl verdampft nicht, und das kann doch immer wieder benutzt werden, gerade wie beim Pfannkuchenbacken, und hier dringt das Öl nicht einmal in das Fleisch ein.«
So unterhielten sich die beiden, während Karlemann immer brav das Feuer schürte und manchmal seinen schmutzigen Finger in den Topf steckte, um zu sehen, wie weit sich das Öl schon erwärmt habe, so wie es ganz unschuldige Dienstmädchen mit dem Kaffeewasser machen — »ob's bald kocht.«
Lange durfte er das nicht mehr probieren, das Öl ward schon zu heiß.
Da, als Karlemann wieder einmal den Finger zurückzog, schon schlenkernd, fiel ein Tropfen auf die bereits glühende Ofenplatte. Puff, ging es, mit einer kleinen Feuererscheinung.
»Nanu, was war denn das?«, rief Smutje erschrocken, denn die kleine Detonation war auch wirklich zum Erschrecken gewesen.
»Das Öl ist auf der heißen Ofenplatte verpufft.«
»Das macht kein Öl, und — und — das riecht auch gar nicht wie verbranntes Öl, das — das — riecht auch ganz merkwürdig.«
»Das ist feinstes Olivenöl.«
»Haben Sie es schon gekostet?«
»Ich werde mich hüten, pfui Deiwel!«
Smutje steckte in den Hals einer der geleerten Glasflaschen den Finger, leckte das daran haften gebliebene Öl ab.
»Das schmeckt ja ganz süß.«
»Na ja, schmeckt denn Olivenöl nicht süß wie Nuss?«
»I wo. Das sagt man wohl so, aber Olivenöl schmeckt doch nicht süß, überhaupt kein Öl. Und das hier schmeckt wie Zuckerwasser. Nee, das ist überhaupt gar kein Öl.«
»Was denn sonst?«, fragte Jansen, der in diesem Augenblicke an der offenen Kombüsentür vorbeigegangen war und die letzten Worte gehört hatte.
»Herr Kapitän, was Sie da eingekauft haben, das ist gar kein Olivenöl.«
»Ja, was denn sonst?«
»Das weiß ich nicht; aber Olivenöl ist es nicht, überhaupt kein Öl, das schmeckt ganz zuckersüß.«
»Es ist mit Zucker versetzt.«
»Olivenöl? Das gibt es ja gar nicht! Es schmeckt überhaupt ganz eigentümlich.«
Jansen hob die eine Flasche auf, in der sich durch Stehen wieder genug Öl angesammelt hatte. Dieses war hellgelb und dickflüssig, glich sonst ganz gutem Olivenöl.
Auch er netzte den Finger, kostete.
»Wahrhaftig, das schmeckt süß wie Zucker, und — und — auch sonst ganz eigentümlich. Nein, das ist kein Speiseöl.«
»Und wenn es auf die heiße Herdplatte kommt, dann pufft's.«
»Was tut's?«
»Es verpufft mit Feuer, gerade wie Pulver.«
Jansen versuchte das Experiment, nur mit einem Tropfen, den er auf die Herdplatte fallen ließ, und prallte vor der Explosion zurück, so klein diese auch war.
»Kienock, kommt mal herein!«, rief er dem vorbeigehenden zweiten Maschinisten zu. »Sie sind doch so ein halber Chemiker.«
Wir haben schon häufig erwähnt, dass Kienock früher Artillerieoffizier gewesen war, der ja sowieso über ziemliche Kenntnisse aus der technischen Chemie verfügen muss, und an Bord stand er um so mehr in dem Rufe eines Chemikers, weil er einen fotografischen Apparat besaß, da viel mit Säuren und anderen Chemikalien hantierte.
Der Maschinist kam herein, betrachtete den Rest in der Flasche, roch hinein, kostete, schüttelte den Kopf, und dann wollte auch er das Experiment mit dem Entzünden machen. Hierzu aber zog er einen Faden aus seinem Wollrock, feuchtete ihn an, brachte ihn an das Herdfeuer.
Kein Brennen, sondern wieder ein Verpuffen mit Feuererscheinung.
Ganz blass war Kienock zurückgefahren, die Hände zitterten, mit denen er die Flasche hinaustrug.
Er begehrte einen Hammer, wischte einen Eisenboller ab, ließ aus der Flasche vorsichtig einen Tropfen darauf fallen, stellte die Flasche weg, schlug mit dem Hammer auf den Tropfen.
Ein ganz gehöriger Knall, mindestens wie der eines Zündhütchens.
Und Kienock verfärbte sich noch mehr.
»Um Gottes willen«, stieß er keuchend hervor, »fort mit dem Topfe vom Feuer — aber Vorsicht, Vorsicht — das ist nichts anderes als Nitroglyzerin!!«
Wenn die anderen noch nicht wussten, was Nitroglyzerin ist, so wusste es doch Jansen, und dem fuhr der Schreck auch nicht schlecht in die Beine.
Nitroglyzerin ist eine chemische Verbindung von Salpetersäure und Glyzerin und bildet den wirksamen Bestandteil des heutigen Dynamits, welches man aber damals noch nicht kannte. Dynamit ist nichts weiter als Kieselgur oder sonst ein poröser Stoff, der mit Nitroglyzerin getränkt wird. Nur weil ein pulverisierter oder gar fester Stoff handlicher ist als eine Flüssigkeit, wird Dynamit heute bevorzugt. Sonst übertrifft Nitroglyzerin es eigentlich noch an Wirkung.
Nun, Jansen hatte die Kraft seiner Beine schnell wiedererlangt — den mächtigen Kessel bei den Henkeln gepackt, vom Feuer gehoben und hinausgetragen.
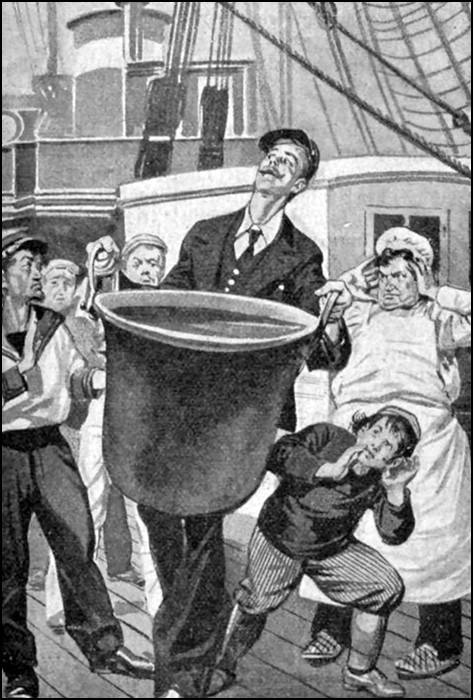
Dass er dabei auf den Zehenspitzen schlich, war nicht gerade nötig, aber das charakterisierte seine innere Verfassung dabei, — und außerdem gehörte Jansens Kraft dazu, um den zentnerschweren Kessel so tragen zu können, zwei hätten beim Tragen leicht etwas verschütten können, der Kessel war ziemlich bis zum Rande voll, und wer weiß, was dann passiert wäre.
»Nicht über Bord gießen!«, warnte Kienock. »Lassen Sie es sich lieber hier abkühlen, nun ist die Gefahr vorbei. Bei Vermischung mit Wasser könnte sich das Öl vielleicht erst recht erhitzen, so wie rauchende Schwefelsäure mit Wasser, so genau bin ich mit den Eigenschaften des Nitroglyzerins doch nicht vertraut.«
Jansen hatte den Kessel an Deck gesetzt, jetzt wischte er sich den Schweiß von der Stirn, der ihm plötzlich hervorgebrochen war.
»Himmel und Hölle, das hätte ja einen netten Spaß gegeben! Sie sind überzeugt, dass es wirklich Nitroglyzerin ist?«
»Ohne jeden Zweifel. Ich erkannte es gleich am Geschmack. Es kam mir nur gar zu ungeheuerlich vor, als ich den großen Topf auf dem Feuer sieden sah, ich wollte es gar nicht glauben.«
»Wie lange lässt sich denn Nitroglyzerin erhitzen, ehe es explodiert?«
»Bis zum Siedepunkt, dann zersetzt sich alles mit einem Schlage.«
»Und wo liegt sein Siedepunkt?«
»Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls gar nicht so sehr hoch.
Und da hätte nur ein Funke hineinzufallen brauchen — da, Smutje raucht neben dem offenen Pulverfasse ganz gemütlich seine Pfeife! — oder es hätte nur etwas an dem Kessel herunterzulaufen brauchen — — um Gott, um Gott!! Herr Kapitän, setzen Sie einen allgemeinen Gebetstag mit Fasten an!«
»Das ganze Schiff wäre in die Luft geflogen?«
»Nein, da müsste sich der Explosivstoff schon im Innern des Schiffes befinden.«
»Aber auseinandergeborsten.«
»Auch das nicht. Wohl explodiert das Nitroglyzerin ganz anders als Pulver, nach allen Seiten, vornehmlich auch nach unten, weswegen es nicht das Pulver zum Schießen ersetzen kann — aber die Wirkung hat doch ihre Grenze, die Gase suchen sich immer den freiesten Weg. Diese Kombüse wäre natürlich weggewesen, das ganze Deck wäre reingeblasen worden, Boote weg, Masten weg — von den Menschlein gar nicht zu sprechen.«
»Also... auch... ich!!«, ließ sich Karlemann vernehmen und sich gleichzeitig auf eine Bank fallen. »Haifisch in Nitroglyzerin — und das nennt man nun Sardinen in Öhhhl!«
Schnell verbreitete sich diese Kunde durch das ganze Schiff, und der Kapitän demonstrierte den Leuten dann an Beispielen, was Nitroglyzerin zu bedeuten hat, in was für einer furchtbaren Gefahr sie alle bei Karlemanns Haifischkocherei geschwebt hatten.
Dass die sämtlichen hundert Flaschen Nitroglyzerin enthielten, daran war gar kein Zweifel, deshalb brauchte nicht erst jede Flasche geöffnet und untersucht zu werden.
Die Frage war nun, wie der italienische Kapitän dazu gekommen war, diese Flaschen für Olivenöl auszugeben.
Ein Verdacht lag da sehr nahe. Man hatte das Seeräuberschiff auf diese Weise vernichten wollen.
Aber das war gar weit hergeholt, das wäre ein ganz plumper Versuch gewesen, und Jansen wies denn auch solch einen Verdacht gegen die Ehre des italienischen Kapitäns sofort energisch zurück.
Nein, die Sache lag ganz anders. Es hatte jemand Nitroglyzerin nach Rio de Janeiro schicken wollen. Wozu solch eine große Menge dort gebraucht wurde, tut hier nichts zur Sache.
Passagierschiffe dürfen überhaupt keine Explosivstoffe als Fracht mitnehmen, nicht einmal Streichhölzer — Frachtschiffe nur in Ausnahmefällen, und dann muss gleich das ganze Fahrzeug eine außerordentlich hohe Versicherungsprämie bezahlen, die natürlich die Auftraggeber zu tragen haben.
Deshalb gehen ab und zu besondere Frachttransporte über das Wasser, man nennt sie gleich Pulverschiffe, welche eben nichts weiter als solche Explosivstoffe mitnehmen. Dann verteilt sich die Versicherung mehr, dem Schiffe wird im Hafen eine besondere Stelle angewiesen, oder es wird noch auf Reede gelöscht, wird besonders behandelt usw.
Dass der italienische Passagierdampfer hundert Flaschen Nitroglyzerin mitgenommen hatte, wovon ihm bekannt, das war gänzlich ausgeschlossen. Nicht eine einzige wäre angenommen worden.
Nein, da hatte jemand die hohe Versicherung und alle anderen Umstände sparen wollen, hatte das ganz gleich aussehende Nitroglyzerin als Olivenöl signiert, und er war damit durchgekommen.
Das war die einfache Erklärung der Sache.
Jansen ließ sich über die Eigenschaften des Nitroglyzerins durch Kienock belehren, las darüber nach und stellte dann einige Versuche an.
Er füllte ein Fläschchen mit der öligen Flüssigkeit, schleuderte es, hinten am Heck stehend, weit in die Luft hinaus und schickte schnell eine Revolverkugel nach, mit jener Sicherheit, um die ihn jeder Cowboy beneidet hätte, während sich Jansen in dieser Schießfertigkeit niemals besonders geübt haben wollte. Die Revolverkugel traf das Fläschchen, die Folge war ein Feuerkreis und eine furchtbare Detonation.
Noch augenscheinlicher ward die Wirkung des Nitroglyzerins, als er auf dieselbe Weise ein Fläschchen in einiger Entfernung vom Schiff im Wasser zur Explosion brachte.
Da zeigte es sich, wie das Nitroglyzerin nach allen Richtungen, besonders auch nach unten wirkt.
So klein das Fläschchen auch gewesen, wühlte es doch einen ungeheueren Wasserberg auf, der erst nachträglich zerrissen wurde, wobei sich im Meere eine förmliche Schlucht bildete, in die sich rauschend und schäumend das zurückstürzende Wasser ergoss.
Hierauf hatte Jansen eine einsame Viertelstunde des Nachdenkens, und die Folge davon war, dass er alle Mann zusammenrief, ihnen eine Rede hielt, zu ihnen wie zu Freunden und Brüdern sprach.
Wir wollen die Ansprache nicht wiedergeben.
Das Hauptthema bestand in der Frage: ›Was soll aus uns werden?‹
Ja, was sollte aus ihnen werden? Es war wirklich einmal wert, darüber zu sprechen.
Wenn die ›Sturmbraut‹ nun einmal Schiffbruch erlitt oder auf ein Riff lief, wo sie festgebannt saß — die Mannschaft konnte sich vielleicht in den Booten retten — aber was dann? Sollte sie auf einem anderen Schiffe ein ganz gleiches Leben von vorn beginnen?
Oder wenn die ›Sturmbraut‹ im Gefecht mit einem Kriegsschiffe zum Wrack geschossen wurde, oder nur einen einzigen Unterwasserschuss bekam — ja, dann konnte die Mannschaft vielleicht noch immer in die Boote gehen; aber sollte sie sich aus diesen als Gefangene nehmen lassen, derer ganz sicher der Galgen wartete?
Jansen hatte seine Fragen derartig gestellt, dass seine Absicht sofort verstanden werden musste.
Zunächst indes erfolgte noch keine Antwort, in finsterem Schweigen blickten die wetterharten Männer alle ihren Kapitän an.
»Oder wollen wir unsere Gemeinschaft lieber auflösen? Wollen wir das Schiff verlassen? Ich habe genug Geld und anderes an Bord, um jeden von euch zum reichen Manne zu machen...«
»Niemals, Kapitän, die ›Sturmbraut‹ verlassen wir niemals!!«, erklang es da einstimmig im Chore.
»Wenn wir sie aber nun, wie ich vorhin geschildert, gezwungen verlassen müssen...«
»Wir verlassen sie nicht, da sprengen wir sie und uns lieber in die Luft!«, erklang es ebenso einstimmig, als hätten diese fünfzig Mann nur einen Gedanken und einen Mund.
Das Folgende wollen wir nicht wiedergeben, können es gar nicht.
Kurz, mit wildem Jubel wurde des Kapitäns Vorschlag angenommen, das zufällig in die Hände bekommene Nitroglyzerin, fast zwanzig Zentner, derartig im Schiff noch unter der Wasserlinie zu verteilen, dass ein einziger Schuss unter der Wasserlinie genügen musste, um das ganze Schiff in die Luft zu sprengen.
Und alsbald wurde der Plan ausgeführt, sich einen Vulkan zu schaffen, auf dem man fernerhin tanzen wollte. Die großen Flaschen wurden in viele Hunderte von kleinen umgefüllt, die sich von einer früheren Proviantlieferung noch an Bord befanden, und so das furchtbare Sprengöl allüberall an den Bordwänden verteilt, soweit sich diese noch unter der normalen Wasserlinie befanden, und nur eine einzige dieser Flaschen brauchte durch einen feindlichen Schuss oder durch Aufrennen auf ein Riff zur Explosion gebracht zu werden, das entzündete im Nu auch alle anderen — die ›Sturmbraut‹ würde spurlos von der Meeresoberfläche verpufft sein.
Während dieser Arbeit, während sich die Matrosen also gewissermaßen ihr eigenes Grab bereiteten, allerdings eine ganz besondere Art von Grab, zeigten sie auch ein ganz merkwürdiges Verhalten.
Es wurde schon vorhin angedeutet, durch den bekannten Vergleich mit einem Vulkan, auf dem man tanzt.
Eine wilde Lustigkeit bemächtigte sich aller, während sie mit den gefährlichen Flaschen hantierten, die Witze flogen nur so hin und her, und sie forderten das Schicksal nicht nur mit Worten heraus, sondern sie mussten sogar durch Befehl davon abgehalten werden, dass sie nicht dazu rauchten. Einige hatten sich, sogar während sie das fürchterliche Sprengöl umfüllten, wirklich schon ihre Pfeifen angebrannt gehabt.
Galgenhumor! Was ist das, Galgenhumor? Eine trotzige Verhöhnung des Schicksals — die furchtbarste Auflehnung des Menschen gegen die himmlischen Mächte — der an den Felsen geschmiedete Prometheus verspottet noch die Götter, wenn ihm die Geier die immer wieder nachwachsende Leber ausfressen — und so kann der sogenannte Galgenhumor sogar echt sein — jedenfalls die gewaltigste Äußerung, deren der Mensch fähig ist, um seine freie Unabhängigkeit gegenüber dem Schicksal zu beweisen — selbst etwas Göttliches, so entsetzlich es auch sonst sein mag.
Unterdessen hatte Smutje in der Kombüse sein viel harmloseres Werk vollendet, es wurde aufgetafelt, und der Kapitän gab noch mehr dazu, spendierte auch den ganzen Wein, den er von dem Passagierschiff bekommen — ja, es war eine Art Henkersmahlzeit — so wilde Gesänge hatten die Planken der ›Sturmbraut‹ wohl noch niemals von der sonst so gesitteten Mannschaft zu hören bekommen — dann aber schien auch wieder echte Lustigkeit durchzuklingen.
Nur einer war mit dem allgemeinen Abkommen nicht zufrieden.
Bei der ersten Gelegenheit nahm Karlemann den Kapitän zur Seite.
»Hören Sie, Sie wollen sich mit der ganzen ›Sturmbraut‹ in die Luft sprengen?«
»Wenn es sein muss — ja.«
»Da bin ich aber gar nicht damit einverstanden — habe noch keine Lust, gen Himmel zu fliegen, möchte lieber noch ein bisschen auf dieser schönen Erde bleiben.«
»So verlassen Sie das Schiff«, sagte Jansen kurzerhand.
»Nee, dazu habe ich auch keine Lust. Nur in die Luft fliegen mag ich nicht. Wenn Sie durchaus wollen — fliegen Sie alleine, ich fliege nicht mit.«
Wie sich Karlemann das vorstellte, darüber sprach er sich nicht weiter aus.
Die Geschichte mit dem Nitroglyzerin sollte aber noch nicht alle sein.
Beim Mittagstisch wurde Madam Hullogan vermisst, und erst jetzt erinnerte man sich, sie schon seit längerer Zeit nicht gesehen zu haben. Da sie trotz ihres Schnauzbartes und trotz ihrer Seestiefel doch kein richtiger Mann war, war ihr Fehlen auch nicht aufgefallen, als alle Mann zusammengerufen wurden.
Enoch suchte sein holdes Ehegespons und fand es in der gemeinschaftlichen Schlafkabine stöhnend in der Koje liegen.
»Was ist denn los, Hullogan?!«, fragte Enoch zuerst erschrocken.
»Wird sich sterben, wird sich arme Hullogan verrecken elendiglich!«, erklang es ächzend und winselnd.
Durch diese Erklärung ihres Zustandes ward der brave Bootsmann zunächst auf einen anderen Gedanken gebracht.
Schnell ging er wieder hinaus, machte die Tür hinter sich zu, begab sich in die Foxel zurück.
»Se stärvt«, verkündete dieser Mustergatte mit glückstrahlender Miene, »lat se stärven.«
Aber damit waren die Matrosen nicht einverstanden. Wenn sie Madam Hullogan nicht dem Leben erhalten konnten, so wollten sie doch wenigstens bei ihrem Tode zugegen sein.
Also marschierte alles in feierlicher Prozession nach der Sterbekammer, die meisten noch ihre Backentaschen mit Bratwurst gefüllt.
»Aber seht euch vor«, warnte Enoch noch einmal, »dau is dee Düwel ok dabie.«
Ja, mit Madam Hullogan schien es recht schlimm zu stehen. Sie hielt sich den Bauch und wand sich in Todeszuckungen, sonst war sie nicht zum Sprechen zu bringen.
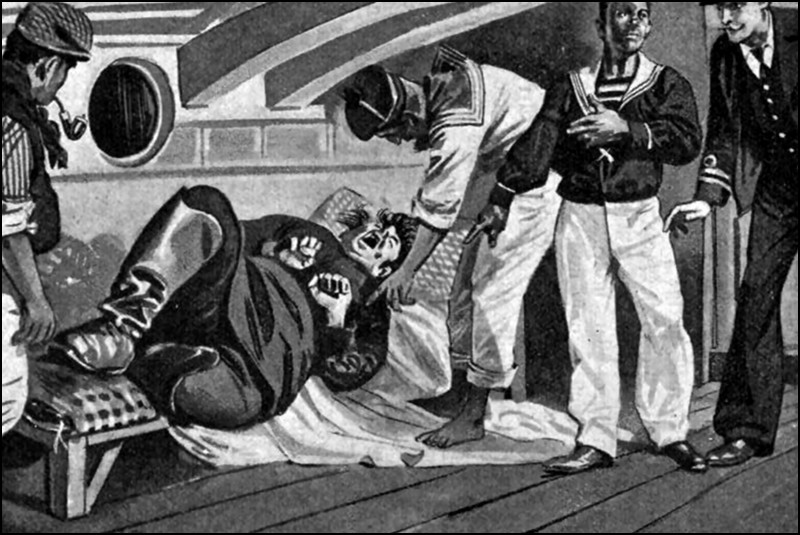
Goliath war als Arzt schon zur Stelle, auch der Kapitän ward gerufen.
Endlich gestand sie. Es war nämlich ein kleiner Diebstahl zu gestehen. Madam Hullogans Vorliebe für Olivenöl wurde schon einmal erwähnt, und dieses brauchte nicht gerade aus Sardinenbüchsen zu stammen.
Also die hundert Flaschen feinstes Olivenöl hatten es ihr angetan, und in einem unbewachten Moment, als sich Smutje und Karlemann nicht in der Kombüse befanden, hatte sie sich hineingeschlichen, hatte die eine Flasche, die erst zur Hälfte in den Topf entleert worden, an den Mund gesetzt, hatte einmal tüchtig getrunken, und wenn Madam Hullogan einmal tüchtig trank, so durfte man annehmen, dass es mindestens ein Liter gewesen war.
»Es schmeckte sich so lieblich und süß, aber ist sich Sauluderzeug elendigliches, liegt sich wie Blei im Bauche!«, wimmerte die Unglückliche.
Hatte die also Nitroglyzerin getrunken, wohl gleich einen ganzen Liter!
Nun, ein direktes Gift ist Nitroglyzerin nicht, so wenig wie eine Stiefelsohle oder ein Kilogramm Hufeisennägel, und Madam Hullogans Magen musste auf Hufeisennägel und dergleichen Stoffe geeicht sein — sie vertrug das Liter Nitroglyzerin, nicht einmal wieder herausgeben wollte ihr Magen das, was er einmal gefasst hatte, sie verschluckte sogar den Brechweinstein tassenweise mit dem größten Behagen, die Folge davon war nur, dass die Magenschmerzen aufhörten, und dann war Madam Hullogan auch gerettet.
»I drrr Deiwel, i drrr Deiwel!«, sagte der krummbeinige Ehemann niedergeschlagen, als er dieses Resultat erfuhr.
Aber erledigt war die Sache hiermit noch lange nicht.
Von dieser Zeit an war und blieb Madam Hullogan eine unkrepierte Granate oder, um mehr nach Enochs Ansicht zu sprechen, eine Höllenmaschine, bei der es nur eine Frage der Zeit war, wann sie einmal losplatzte, und so sorglos die Matrosen auch damals mit dem Sprengöl umgegangen waren, so ängstlich zeigten sie sich im Falle der sprengölgeladenen Madam Hullogan.
Einen Kommentar zu diesem Verhalten braucht der Leser natürlich nicht — Witzblätter gab es ja an Bord der ›Sturmbraut‹ nicht, so musste man die Witze selber machen — dagegen ist das Verhalten der lebendigen Höllenmaschine gegenüber selbst etwas näher zu beschreiben.
Eine schwarze Tafel hatte es in der Foxel schon immer gegeben, wo angeschlagen wurde, was man auf der Kommandobrücke nicht zu wissen brauchte — obgleich es auch dort immer bekannt und herzlich belacht wurde — und so stand da jetzt zu lesen, wie man sich gegen diese lebendige Höllenmaschine vorsichtig zu verhalten habe.
Vor allen Dingen in ihrer Nähe kein Streichholz anritzen, nicht mit brennender Pfeife an ihr vorübergehen — auch nicht einmal ein zündendes Wort durfte in ihrer Gegenwart fallen, keine feurigen Blicke durfte man nach ihr werfen usw.
Mit Mutterwitz ist ja der Matrose reichlich gesegnet, ja, in Matrosenfoxeln findet man oft genug wirklichen Geist, ausreichend, um jahraus jahrein ein Witzblatt zu füllen, dessen Inhalt sonst mühsam zusammengestohlen werden muss — aber die Hauptsache war doch, wie das nun die Matrosen getreulich ausführten, wie sie vorsichtig die Hand über die brennende Tabakspfeife hielten, wenn sie an Madam Hullogan vorübergingen, wie sie mit einem erschrockenen Sprunge vor ihr zurückwichen, was sich hier nur leider nicht wiedergeben lässt.
Und das Beste oder das Gefährlichste an der ganzen Sache war nun, dass Madam Hullogan als echte Irländerin vom alten Schlage selbst nicht ohne qualmenden Kalkstummel zu denken war, und ob sie nun an ihre Explosivgefährlichkeit glaubte oder nicht — ganz egal, sie paffte nach wie vor weiter. Da war es nun allerdings gefährlich, in ihrer Nähe zu weilen.
Nur einen gab es an Bord, der hierbei keinen Witz fand, der eben die Sache wirklich ernsthaft nahm: Enoch, ihr Ehegatte.
Dieses Missverstehen der Sachlage hatten die Matrosen natürlich sofort heraus, und nun begannen sie auch noch ihren krummbeinigen Bootsmann zu martern, und der hatte um so mehr Grund zur Besorgnis, weil doch die explodierbare Höllenmaschine neben ihm schlief, und Madam Hullogan hatte wie so mancher männliche Seemann die Gewohnheit, sich auch mit qualmender Tabakspfeife in die Koje zu legen, diese noch im Schlafe auszurauchen.
Kurz, Enoch verrannte sich so in eine fixe Idee, dass er die Sache bis vor den Kapitän brachte. Er wollte von seiner Frau getrennt sein, wenn nicht vom Tische, so doch vom Bett.
»Die geht mal ffft, ich warte immer drauf, und da kann ich keine Nacht mehr auch nur ein einziges Auge zutun.«
Jansen suchte seinem Bootsmann durch ernsthafte Erklärung und durch Spott diese fixe Idee auszutreiben — Enoch ging davon, schlief noch bei seiner Frau, aber von seinem Wahne war er jedenfalls nicht geheilt worden. Na, dann war er eben bereit, als treuer Ehegatte mit in die Luft zu fliegen. Der Kapitän und die anderen würden es schon noch erleben.
Und so sollte es denn wirklich kommen!
Eines Nachts, da Jansen auf der Kommandobrücke stand, hörte er wie die anderen einen dumpfen Knall, aus dem Innern des Schiffes kommend.
So sehr bedeutend war er nicht gewesen — aber immerhin, es hatte geknallt, es musste untersucht werden, was das gewesen war, wenn sich nicht sofort eine Wirkung zeigte.
Als alles noch so dastand und wartete, ob da noch etwas anderes nachkäme, stürzte Enoch, als Bootsmann Freiwächter, in Hemd und Unterhosen an Deck.
»Mien Fru is in de Luft gefffft!«, schrie er, das Verschwinden von der irdischen Bildfläche durch eine entsprechende Armbewegung markierend.
Dem Kapitän schlossen sich noch viele Matrosen an, um die Sache zu untersuchen. Denn etwas Bedenkliches war es doch, den Knall hatte man wirklich gehört.
»Ich liege ganz ruhig da und schlafe mit einem Auge«, erklärte unterwegs Enoch ganz verstört, »neben mir schnarcht Hullogan — da plötzlich sehe ich einen Feuerschein, die ganze Kabine ist voll Feuer, gleichzeitig ein furchtbarer Knall — und wie ick hinkieke, is mien Fru futsch. Se is in de Luft gefffft. Ick hävv's ja glicks geseggt.«
»Seid Ju denn da nich mitflogen?«, fragte Meister Pieplack.
»Nee! Worum soll ick?«
»Seid Ju denn da aber nich wenikstens en bäten ahngebrannt?«, beharrte Pieplack als Untersuchungsrichter.
Der Bootsmann betastete erst seine Unterhosen und dann sein Riechorgan.
»Nee! Worum soll ick?«
»Nu, wenn die ganze Kabine in Flammen gestanden hat.«
»Et war tjo keen Pulver, et war tjo Nierenglüsserüüühn.«
So weit war man mit dem Hin und Her gekommen, als man die Kabine erreichte.
Das Auffallende war eigentlich nur das, dass Madam Hullogan sich nicht darin befand. Nur ihr buntgestreifter Rock und ihr anderes bisschen Gelumpe hing noch da.
Jansen glaubte ja überhaupt an die ganze Geschichte nicht.
»Die ist einfach mal hinausgegangen«, meinte er.
»Ja, aber ich habe sie doch knallen hören«, verteidigte sich Enoch.
»Dat kann schon stimmen, se hädd geknallt!«, meinte Pieplack. »Du hast wirklich eine Feuererscheinung gesehen?«, fragte Jansen misstrauisch.
Enoch schilderte den Vorgang nochmals. Nur mit einem Auge geschlafen, plötzlich ein ganzes Feuermeer, ein furchtbarer Knall, und wie er sich nach seiner Frau umgewendet, da war die eben verschwunden gewesen. Einfach in die Luft gefffft.
»Es ist ja aber gar kein Qualm hier«, sagte Jansen, sich gleich über diese Worte als über etwas recht Dummes ärgernd.
»Tjo, es is awwer doch ok Nierenglüsserüüühn. Tjo tjo, Käpt'n, min Fru is ffft. Nor ehrn Rock hat se dalaten.«
Jansen konnte sich dieses schnauzbärtige Frauenzimmer auch im Geiste nicht anders vorstellen als mit ihren unverschämten Seestiefeln.
»Wo hat sie denn ihre Seestiefel?«, fragte er daher, weil er diese nicht sah.
»De hädd se mitnommen.«
»Mitgenommen? Wohin denn?«
»Na, in de Luft. In'n Himmel. In de Höll.«
»Ja, die hat aber doch nicht die schweren Seestiefel beim Schlafen an!«
»Immer.«
Der Mensch lernt eben nie aus. Jansen glaubte doch, während der langen Jahre alle Geheimnisse seiner ›Sturmbraut‹ kennen gelernt zu haben, und er wusste noch nicht einmal, dass Madam Hullogan auch in ihren großen Seestiefeln zur Koje ging! Einfach aus dem Grunde, weil sie diese Seestiefel überhaupt nicht mehr abbekam. Sie hatte diese kolossalen Stiefel vor einem Dutzend Jahren einmal anprobiert und hatte sie nicht wieder von den Füßen bekommen, mit dem besten Willen nicht.
»Vor wie viel Jahren?!«, fragte Jansen förmlich erschrocken.
»Vor nem dossend Johren.«
»Vor zwölf Jahren?«
»Jau jau, Käpt'n. 's mag ok noch länger her sünt. Damals hädd se ok noch Strümpf anhatt — wo de bläm sind, weet se nich.«
Jansen starrte den Sprecher wie eine Erscheinung aus dem Jenseits an.
»Sie kriegt die Seestiefel überhaupt nicht mehr ab, kann sie nicht mehr abbekommen?«
»Never, Käpt'n.«
»Wenn sie aber nun einmal besohlt werden müssen?«
»Werd glicks an de Feut besorgt.«
Und Jansen sah im Geiste ein Bild — wie der Schuster die Beine Madam Hullogans auf dem Schoße hatte und ihr die kolossalen Seestiefel gleich am Leibe besohlte...
»Ja, warum schneidet sie sich denn da nicht die Schäfte ab?«
»Afsneeden? Do geihn see dock kaputt. Un dat's goot Rossleder, mien Fru smart se jeden Obend mit Swiensfett in, eh se in de Koje krägt.«
Jansen wollte offenbar zusammenschaudern — da ward er durch wuchtige Tritte aus seinen Träumen gerissen — Madam Hullogan kam hereinmarschiert, im Hemd und in ihren unsterblichen Seestiefeln.
Also sie war nicht in die Luft geffft, weder in den Himmel, noch in die Hölle. Es löste sich alles auf natürliche Weise.
Nicht einmal geknallt hatte Madam Hullogan, sondern in der benachbarten Kammer hatte sich eine Kiste von der Laschung gelöst, war umgefallen. Kurz vorher hatte Hullogan die Seite ihres Ehegemahls und die Kabine verlassen. In Enochs Gehirn nun, der fortwährend von einer Explosionsgefahr seines Ehegesponses träumte, hatte sich der Knall im Geiste mit einer Feuererscheinung verbunden, seine Frau war verschwunden gewesen — so war es gekommen.
Ja, auf natürliche Weise gelöst war dieser schwierige Fall. Nun aber brauchte Enoch nicht dafür zu sorgen, dass der Spott einmal einschlafen würde.
Im Long-Island-Sund, der Bucht von New York, segelten zwei Lotsenkutter um die Wette auf den dreimastigen Schoner zu, der durch Flagge einen Lotsen wünschte.
Am geordnetsten in der Welt geht es doch wohl in Deutschland zu. Es ist eben ein Polizeistaat. Aber so geregelt auch an den deutschen Küsten das Lotsenwesen sein mag, so sehr auch jede Überschreitung der Vorschriften durch schwere Strafen geahndet wird, so kommen doch auch hier zwischen den Lotsenfahrzeugen, welche nach Schiffen ausspähen, förmliche Wettfahrten auf Tod und Leben vor.
Abgeteilt können sie nicht werden, jeder muss für sich selbst ausspähen, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, und es geht eben um die hohe Lotsenprämie, es geht um all das, was man sonst noch an Bord des aus weiter Ferne kommenden Schiffes zu erwarten hat, es geht um die Ehre.
Wenn das nun schon von dem soliden Deutschland gilt, wie da erst in anderen Staaten, zumal in England und gar in Nordamerika, wo der Kampf ums Dasein überhaupt jede Rücksicht aufhebt, wo man die an Wahnsinn grenzende Wettsucht des Engländers und Amerikaners bei jeder Gelegenheit hervorbrechen sieht?
Ein Wettsegeln zwischen zwei konkurrierenden Lotsenfahrzeugen wird hier tatsächlich stets zum Kampfe um Tod und Leben. Da wird alles riskiert, was nur zu riskieren ist, um dem Rivalen zuvorzukommen, und ist ein Dampfer dabei, so ist es noch das unschuldigste Mittel, wenn die Mannschaft ihre Buttertöpfe ins Feuer wirft und sich an die Ventile hängt. Wie oft hat da schon ein Kollege den anderen mit Absicht gerammt und übersegelt!
Zu solch einem Endkampf sollte es hier nicht kommen. Der eine Kutter sah sich zu sehr im Nachteil, mit ein paar fürchterlichen Flüchen gab er auf. Dabei soll hier, wenn wir das Fahrzeug fluchen lassen, gezeigt werden, wie Schiff und Mannschaft eins sind.
Der siegreiche Kutter kam dicht an den großen Schoner heran, die See ließ es zu; an einem zugeworfenen Tau schwang sich der Lotse, an dem zur Zeit die Reihe war, an Deck des fremden Schiffes, der Kutter steuerte sofort wieder davon, um nach anderen einlaufenden Schiffen zu spähen.
Denn jedes solches Fahrzeug hat mehrere Lotsen an Bord, oder, wenn die staatlichen Beamten diesen Titel auch noch nicht verdienen, so doch Gehilfen, welche denselben Dienst schon tun dürfen, LotsenAssistenten, LotsenAspiranten, alle schon nach langjähriger Praxis auf einer Lotsenschule ausgebildet, geprüft und vereidigt.
Trotz seiner grauen Haare hatte sich der Lotse mit der Behändigkeit eines Affen an das hohe Deck des großen Dreimasters geschwungen. Seestiefel und Ölanzug, obgleich das Wetter gegenwärtig sehr gut war, und auf dem Rücken hatte er einen wasserdichten Sack, der außer einiger Wäsche auch Mundvorrat für mehrere Tage enthielt. Denn das Wetter konnte sich ja ändern, nur der Wind brauchte umzuspringen, so musste der Lotse, wenn der Kapitän sich von keinem Dampfer einschleppen lassen wollte, diese Tage an Bord bleiben, und der Lotse darf nichts anderes verlangen als Trinkwasser. Natürlich ist diese Mitnahme von eigenem Mundvorrat nur ein Hohn, diese Lotsen sind manchmal sogar ganz unverschämte Kerls.
Der an Bord Gekommene stand vor der hünenhaften Gestalt eines Mannes, den er wohl für den Kapitän nehmen musste.
»Was für ein Schiff ist das, Käpt'n?«
Dabei blickte er sich um, er suchte nach dem Schiffsnamen, der doch sonst gewöhnlich an Rettungsringen, Holzeimern und dergleichen beweglichem Gut zu lesen ist, und dann, weil er gar nichts sah, blickte er verwundert den vor ihm stehenden Riesen an, verwundert vielleicht auch deshalb, weil sich dieser so stumm stellte.
»Seid Ihr der Kapitän?«
»Ich bin's.«
»Was für ein Schiff ist das?«
»Solltet Ihr mich und mein Schiff nicht kennen?«
Dem Lotsen war so etwas noch nicht passiert, ganz verwirrt blickte er um sich, und seine Verdutztheit nahm nur noch zu, als er überall solche ernste, stumme Männer stehen sah.
»Ja, bin ich denn hier auf einem verhexten Gespensterschiffe...«
»Nein, aber auf der ›Sturmbraut‹, und ich bin Kapitän Richard Jansen.«
Dieser wetterharte Lotse war sonst gewiss nicht leicht zu erschrecken, aber bei dieser so gelassen ausgesprochenen Erklärung prallte er doch zurück, machte eine Bewegung, als wolle er über Bord springen.
Jansens eiserne Faust fasste ihn bei der Schulter.
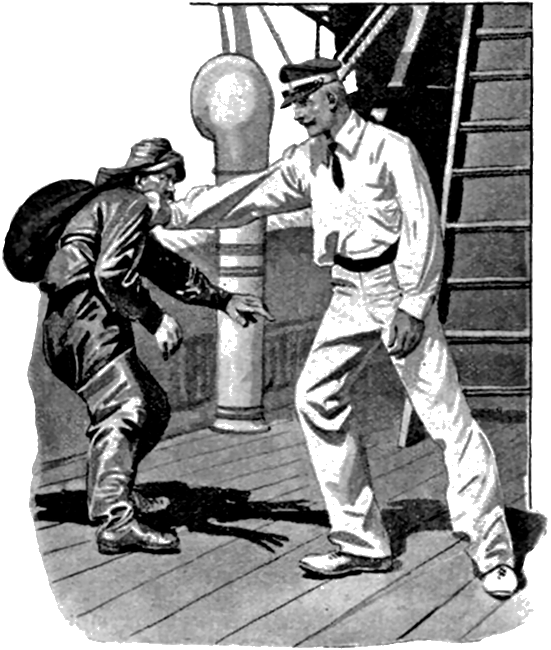
»Was wollt ihr von mir?«, stieß jener hervor, sich schon nicht mehr rühren könnend.
»Ihr sollt mich unter Eurer Flagge in den Hafen bugsieren.«
»Ihr gebraucht Gewalt?«
»Ja.«
Mit einem Male war der Lotse wieder ganz ruhig.
»Ich bin Beamter.«
»Deshalb eben wollte ich Euch an Bord haben, sonst aber seid Ihr nur ein Mensch.«
»Und wenn ich mich nun weigere?«
»Dann werde ich Euch zwingen.«
»Wie wollt Ihr denn das anfangen?«, höhnte der Alte jetzt ganz unerschrocken.
»Mann, nehmt Vernunft an! Solltet Ihr nicht verheiratet sein?«
»Ich bin's.«
»Habt Ihr Kinder?«
»Ja.«
»Na, dann gebt Euren Kindern einen reichen Vater«, sagte Jansen ganz gemütlich, und einen entsprechenden Ausdruck nahm auch gleich das verwitterte Gesicht des Alten an.
Es war ein amerikanischer Beamter, und wenn nicht etwa verächtlich von den Yankees im Allgemeinen gesprochen werden soll, so ist ein amerikanischer Beamter doch etwas Besonderes, auch er muss sich seine Stelle erst erkaufen.
»Well, was gebt Ihr mir, wenn ich Euch in den Hafen bugsiere?«
»Wie viel verlangt Ihr?«
»10 000 Dollar.«
»Das ist sehr viel für einen so kleinen Dienst.«
»Ihr wollt meinen Kindern doch einen reichen Vater geben, und 10 000 Dollar ist eigentlich noch kein Reichtum, ich bin also noch sehr bescheiden, während Ihr sonst doch kein Knauser sein sollt.«
»Gut, 10 000 Dollar!«
»Her damit!«
»Na, na!«, lachte Jansen. »Traut Ihr mir nicht?«
»O ja. Euch traue ich.«
»Aber ich traue noch nicht so ganz Euch. Also Ihr habt zwischen 10 000 Dollar und einer Revolverkugel zu wählen. Ich weiß, Ihr Lotsen habt Eure geheimen Zeichen. Bei der ersten Bewegung, die ich mir nicht erklären kann, seid Ihr eine Leiche, verstanden?«
»Well, 10 000 Dollar lebendig ziehe ich mir vor.«
»So hisst zunächst Eure Flagge, dann kommt auf die Brücke.«
Jansen zog seine Hand zurück, dafür ward der Lotse von zwei Matrosen in die Mitte genommen, die ihn nicht wieder verließen, und wenn sie auch keine offenen Waffen zeigten, so musste der Lotse wohl wissen, dass hier eine Gegenwehr nicht mehr möglich war.
Zunächst hisste er am Kreuzmast, dem hintersten, seine Flagge, welche durch die auffallendste Farbe ausdrückte, dass sich an Bord dieses Schiffes überhaupt schon ein amtlicher Lotse befand, und durch ein besonderes Zeichen ward noch der Name dieses Lotsen angegeben, falls eine Unregelmäßigkeit oder sonst etwas passierte.
Die Anwesenheit solch eines amtlichen Lotsen befähigt das Schiff, direkt in den Hafen einzulaufen, mit Umgehung aller sonstigen Förmlichkeiten, es hält die Zollbeamten und die Gesundheitspolizei fern, bis es im Hafen vor Anker oder am Kai liegt, und darauf eben war es Jansen nur angekommen, der sonst zur Einfahrt in irgendeinen der New Yorker Häfen keinen Lotsen gebraucht hätte.
Dann begab sich der Pilot auf die Kommandobrücke, um die Führung zu übernehmen. Doch hatte man noch gut eine Stunde zu segeln.
Auch der Lotse steuert nicht selbst, so wenig wie der Kapitän oder Steuermann, wogegen besonders in Jugendschriften so oft gesündigt wird. Auch er gibt nur dem am Steuerrad stehenden Matrosen immer die Richtung an, selbst wenn die Fahrt zwischen Klippen und Sandbänken hindurch geht, etwa wie im Roten Meere.
»Alles gesund an Bord?«
»All right.«
»Wann ist die letzte Krankheit vorgekommen?«
»Haben seit Jahren keinen Fall einer epidemischen Krankheit gehabt.«
»Mit was befrachtet?«
»Kohlen.«
»Kein reglementwidriges Gut an Bord?«
»Nein.«
»Auch keine Explosivstoffe?«
Diese Frage war in einem Tone gestellt und von einem Blicke begleitet, dass Jansen stutzte.
»Pulver und sonstige Geschützmunition vorschriftsmäßig untergebracht.«
»Kein Nitroglyzerin?«
»Mann, woher wisst Ihr?!«
Möglich wäre es allerdings gewesen. Die ›Sturmbraut‹ hatte sich unterdessen lange genug auf offener See umhergetrieben, jenes italienische Auswandererschiff musste schon längst sein Ziel, Rio de Janeiro, erreicht haben.
Aber wie war das herausgekommen, dass jene Flaschen nicht Olivenöl, sondern Nitroglyzerin enthalten hatten? Der Empfänger musste doch allen Grund gehabt haben, nicht davon zu sprechen, mochte er auch noch so sehr geschädigt worden sein.
Nun konnte der Lotse Aufklärung geben. Die ›Apulia‹ erzählte, wie sie unterwegs von dem berüchtigten Seeräuberschiffe angehalten worden war, die Sensation war groß, noch größer aber die Aufregung jener Firma, welche aus Italien die hundert Riesenflaschen Olivenöl erwartet hatte.
Das Geheimnis war eben doch nicht gut gewahrt worden, auch Angestellte waren eingeweiht gewesen, es wurde geschwatzt, die ganze Sache verraten.
Diese ganze Geschichte war von Zeitungsberichterstattern sofort nach New York telegrafiert worden. Wie man nun gegen jene englische Firma vorgegangen war, das wusste auch der Lotse noch nicht, der sich schon seit einigen Tagen wieder auf dem Wasser befand — und die Hauptsache war doch auch, wie jetzt dieses Seeräuberschiff zwanzig Zentner Nitroglyzerin an Bord hatte, genug, um eine ganze Flotte in die Luft zu sprengen.
»Ja, aber woher wisst Ihr denn, dass auch mir bekannt ist, wie diese Flaschen Nitroglyzerin enthalten? Ich hatte doch Olivenöl gefordert und solches zu bekommen geglaubt.«
Es war eine etwas schwer zu verstehende Erklärung, welche der Lotse hierfür gab, zumal, da er sich auch noch unbeholfen ausdrückte.
Wozu hatte der Piratenkapitän solch eine ungeheuere Quantität Olivenöl gebraucht? Sollte er nicht gewusst haben, dass es sich um Nitroglyzerin handelte? Woher er dies gewusst? Nun, er hatte eben seine Spione überall an Land — oder aber, hatte dieser Piratenkapitän nicht schon oft genug gezeigt, dass er mit dem Teufel im Bunde stand, konnte er daher nicht allwissend sein?
Kurz und gut, es wurde allgemein angenommen, dass der Kapitän der ›Sturmbraut‹ recht gut gewusst habe, was sich in Wirklichkeit in jenen Ölflaschen befand.
Jansen hielt nicht für nötig, den Lotsen über die Wahrheit aufzuklären.
»Ja, ich habe die zwanzig Zentner Nitroglyzerin an Bord.«
»Wozu?«
»Um gelegentlich in die Luft zu fliegen und vielleicht noch andere mitzunehmen.«
Der Lotse war zunächst mit dieser Antwort zufrieden, er hatte einige Ruderkommandos zu geben, auch mussten die Segel gerichtet werden, was jetzt von Deck aus geschehen konnte, da die ›Sturmbraut‹ als Schoner getakelt war, also nur große Besansegel führte, von den Masttoppen bis an Deck reichend.
»Ich habe die ›Sturmbraut‹ noch nicht selbst gesehen, nur auf Abbildungen, und da hat sie immer ganz anders ausgesehen«, meinte der Lotse dann, prüfend um sich schauend.
»Ich habe einfach die Takelung verändert.«
»Ja, das ist wohl leicht zu machen, aber der Bau war auf den Bildern ein ganz anderer.«
»Das hinten und vorn sind nur hölzerne Aufbaue, aus Kisten und Brettern hergestellt, mit Leinwand verkleidet.«
»Das ist doch nicht möglich!«
Der Lotse verließ einmal die Brücke, um sich mit eigenen Augen in der Nähe davon zu überzeugen, selbst mit den Händen greifen musste er, ehe er glauben konnte, dass das wirklich nur ein Maskenkostüm aus Holz und Leinwand war, so geschickt war diese Theaterdekoration gemacht. Einem schlechten Wetter freilich hätte sie nicht standgehalten, doch dann wäre sie eben solider hergestellt worden. Jetzt genügte sie vollkommen. Die ›Sturmbraut‹ war eben nicht wiederzuerkennen, nicht von den eigenen Leuten, wenn sie nach einiger Abwesenheit ihr Schiff so wiedergefunden hätten.
Die letzte Spitze von Long Island war passiert, jetzt kam es bald darauf an, in welchen der vielen Häfen von New York einzusteuern sei. Denn hierzu rechnet man auch die Häfen von Hoboken, von Brooklyn und noch andere.
»In den Petroleumhafen!«, entschied Jansen auf des Lotsen diesbezügliche Frage.
Damals legten alle Petroleumschiffe noch direkt in New York an, wo schon die Hauptstraßen beginnen, wie die Wallstreet, und erst eine furchtbare Feuersbrunst musste ganz New York bedrohen, ehe man diesen gefährlichen Schiffen einen entlegenen Platz anwies — nach der alten Regel, dass man den Brunnen erst zudeckt, wenn ein Kind darin ertrunken ist.
»Was? In den Petroleumhafen?!«, stutzte der Lotse denn auch gleich.
»Jawohl, mitten zwischen die Petroleumschiffe, möglichst am Kai!«
»Mit Eurem Nitroglyzerin?!«
»Eben deswegen! Mann, versteht Ihr denn nicht, was ich will? Und Ihr habt überhaupt nur zwischen Eurer Belohnung und dem Tode zu wählen.«
Ja, jetzt verstand der Lotse, und er gehorchte, wahrscheinlich nur gar zu gern.
Die Reede wurde passiert, schon hier von Schiffen aller Art und aller Nationen wimmelnd, dann tauchte erst recht ein Mastenwald auf, und dann zeigte sich das eigentümliche Bild New Yorks von der Hafenseite aus, welches man nicht weiter beschreiben kann, das muss man selbst gesehen haben. Die Grenze zwischen Wasser und Land scheint nämlich ganz wegzufallen, die Schiffe liegen noch zwischen den Häusern, ragen mit ihren Rahen bis in die Fenster hinein, und nun dazu die ungeheueren Gebäude, wenn es damals auch noch keine solchen mit zwanzig und mehr Etagen gab — immerhin, ganz kolossale Geschäfts- und Wohnhäuser, alles übersät mit schreienden Reklameplakaten, und dazwischen also die bewimpelten Schiffe — — wie gesagt, ein ganz merkwürdiges Bild, welches man in keinem anderen Hafen der Welt findet. Es ist durch die kolossale schnelle Entwicklung New Yorks entstanden, nichts hat systematisch geregelt werden können, so hat sich eines immer zwischen und über das andere geschoben.
»Brisbane, Adelaide, Kapitän Oglas«, hatte die ›Sturmbraut‹ durch Flaggen gemeldet, und diese fingierten Namen, ganz aus der Luft gegriffen, waren auch hinten am Heck zu lesen, zwar nur auf schwarzgeteerter Leinwand geschrieben, was aber nicht zu bemerken war.
Jetzt war ein Segeln nicht möglich; einer der zahllosen kleinen Schleppdampfer ward angerufen, er spannte sich vor.
Es war an Bord der ›Sturmbraut‹ wohl kein Matrose, dem nicht das Herz mächtig schlug, als man jetzt so zwischen den vielen Schiffen und Fahrzeugen durchgeschleift wurde.
Oftmals kam man einem anderen so nahe, dass man hätte hinüberspringen können.
Ja, das war noch etwas ganz anderes als damals, da man durch den Hafen von Bantang direkt in den Strom eingedrungen war.
Jansen selbst hielt seine riesige Gestalt in dem Kartenhaus verborgen, von wo aus er alles übersehen und auch noch kommandieren konnte; aber wie leicht konnte einer der Matrosen erkannt werden, die doch noch von früher her Kameraden hatten, und man wusste von ihnen, dass sie sich gegenwärtig nur auf der ›Sturmbraut‹, auf diesem vogelfreien Piratenschiffe, befinden konnten.
Doch das tollkühne Stückchen sollte wiederum glücken. Eine halbe Stunde später lag die ›Sturmbraut‹ am Kai, von der eigentlichen Mauer allerdings noch durch ein anderes großes Segelschiff getrennt, welches bereits seine Tanks mit Petroleum füllte, und schon legte sich ein drittes Schiff vor die ›Sturmbraut‹, diese war eingekeilt, das Piratenschiff saß wie in einer Mausefalle.
Doch dass Jansen dies gewollt, wenigstens nichts weiter darauf gab, ist selbstverständlich.
Unten in der Kajüte erhielt der Lotse seine 10 000 Dollar.
»Nun macht, dass Ihr von Bord kommt. Ihr werdet doch wohl sowieso spurlos verschwinden.«
»Das werde ich allerdings«, grinste der Lotse; »aber wenn Ihr wünscht, kann ich ja noch verkünden, was für ein Schiff das ist.«
»Ist nicht nötig, das werde ich gleich allein tun.«
Es gab an Land Personen genug, welche für das neu angekommene Schiff das größte Interesse hatten: Hafenbeamte, die Vertreter der Firmen, welche Schiffe ausrüsten, Händler und Hausierer der verschiedensten Art, müßige Neugierige im allgemeinen, und sobald ein Schiff einmal im Hafen ist, ist sein Betreten jedem Menschen erlaubt, man kennt es gar nicht anders. Nur Passagierdampfer und natürlich Kriegsschiffe haben dagegen ein Verbot, und sonst ist auch noch ein Hindernis, wenn das Schiff noch im freien Wasser liegt, sodass man erst ein Boot benutzen muss.
So ergoss sich auch jetzt sofort, das am Kai liegende Petroleumschiff als Brücke benutzend, eine Schar Menschen über das Deck der ›Sturmbraut‹, vor allen Dingen Agenten und Hausierer, die es noch eiliger hatten als die Hafenbeamten.
Jansen hatte die Kajüte wieder verlassen, trat ihnen entgegen. Ein Herr, der an die Matrosen schon Karten austeilte, welche zum Besuchen eines verrufenen Tingeltangels einluden, die paradiesischen Freuden dieser Hölle priesen, war wohl der erste, in dem beim Anblick der hünenhaften Gestalt eine Ahnung aufging.
Er prallte vor ihr zurück, musterte sie mit weitaufgerissenen Augen.
»By Jove, ist das nicht — ist das nicht...«
»Nun?«
»Der Kapitän Richard Jansen?«
»Ich bin's, und das ist mein Schiff, die ›Sturmbraut‹.«
Seine Zettel fallen lassen, kehrt machen und über die beiden Bordwände zurückvoltigieren, das war für den Gentleman das Werk eines Augenblicks. Und dann verkündete sein Schreien, was für eine Bewandtnis es mit diesem Schiffe hatte, abgesehen davon, dass auch die anderen von allein zu derselben Erkenntnis kamen und schleunigst machten, dass sie von diesem schwimmenden Vulkan herunterkamen.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde durch ganz New York. Was für einen Eindruck sie hervorbrachte, lässt sich gar nicht schildern. Dazu ist New York zu groß.
»Der Piratenkapitän Richard Jansen — mit seiner ›Sturmbraut‹ im New Yorker Hafen — mit seinen zwanzig Zentnern Nitroglyzerin mitten zwischen den Petroleumschiffen, dicht an den Petroleumschuppen!!«
Lähmendes Entsetzen oder wilde Hast, in den Straßen drängten die einen vorwärts, die anderen rückwärts — ganz New York glich einem aufgestachelten Ameisenhaufen. Einen direkten Vorteil hatten nur die PublicHäuser, die Restaurationen aller Art — die machten die besten Geschäfte.
Der erste Beamte, der die ›Sturmbraut‹ betrat, war der Polizeidirektor von New York in eigener Person, und das machte diesem Manne alle Ehre.
Er kam allein, woraus man schließen durfte, dass er keinen anderen Begleiter gefunden hatte.
Er wurde vom Kapitän in der Kajüte empfangen, brauchte nicht zum Sitzen eingeladen zu werden, er sank gleich auf einen der drehbaren Stühle und musste sich zunächst den perlenden Schweiß von der Stirn wischen.
»Sie sind der Kapitän Richard Jansen?«
»Ja!«
»Ich weiß es, Sie sind's.«
»Kennen Sie mich?«
»Barnums Fotografien!«, stöhnte der Polizeidirektor.
Ja, unseres Helden Aussehen war nun schon bekannt geworden.
»Das ist Ihre ›Sturmbraut‹?«, fuhr der Direktor fort, sich mit Gewalt zusammenraffend.
»Sie ist es.«
»Sie sieht ganz anders aus, als sie sonst immer in Wort und Bild beschrieben wird.«
»Meine Leute entfernen bereits das Maskenkostüm.«
»Mann, Kapitän — — was wollen Sie hier in New York?«
»Ich komme in geschäftlicher Angelegenheit hierher.«
»In welcher?«
»Sprechen wir erst über etwas anderes. Sie wissen doch, dass ich zwanzig Zentner Nitroglyzerin an Bord habe?«
»Ich weiß es, ich weiß es!«, konnte der Mann immer wieder nur stöhnen, sich auch noch immer den Schweiß abtrocknen müssend.
»Es ist wirklich Nitroglyzerin, was mir der italienische Kapitän ohne sein Wissen als Olivenöl verkaufte.«
»Ich weiß es, ich weiß es!«
»Wollen Sie sich davon überzeugen?«
»Nein, nein — ich glaube es, ich glaube es!«
»So kommt dieser Sprengstoff noch zu dem Pulver hinzu, welches ich sonst im Schiffe habe, und ich bin reichlich mit Munition für meine Geschütze versehen.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Diese tausend Liter Sprengöl sind in kleinen Flaschen im Innern des Schiffes verteilt, besonders unter der Wasserlinie.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, konnte der Beamte nur wiederholen.
»Dass man nicht ungestraft irgend etwas gegen mich und mein Schiff unternehmen darf. Ich bin entschlossen, wenn man irgendwie gegen mich vorgehen will, einem meiner Matrosen, den ich etwa an Land schicken werde, auch nur ein Haar krümmen sollte, sofort das ganze Schiff in die Luft zu sprengen; das heißt, ehe ich mich der Gewalt ergebe. Ich bin ein Desperado, habe nichts mehr zu verlieren, und so denken alle meine Leute. Ja, ehe wir unsere Freiheit verlieren, wollen wir lieber mit einem kolossalen Knalleffekt sterben, wie die Welt ihn vielleicht noch gar nicht erlebt hat. Und was solch eine Explosion hier im Petroleumhafen für New York zu bedeuten hätte, können Sie sich wohl vorstellen.«
»Um Gottes willen, um Gottes willen!«, konnte der Polizeidirektor wiederum nur murmeln, und zu seiner Todesangst mochte vielleicht auch viel beitragen, dass sich das Polizeipräsidium ganz in der Nähe befand, dass er darin seine Wohnung besaß, dass er erst vor Kurzem geheiratet und die reiche Ausstattung seiner Frau wie die ganze sonstige Einrichtung noch nicht versichert hatte.
»Was wollen Sie hier?«, fragte er sachgemäß, nachdem er sich wieder gefasst hatte.
»Ich komme nicht etwa als Räuber.«
»Nicht?«, erklang es ebenso mit ungläubigem Staunen, wie erleichtert.
»Sie glauben, ich würde durch solch eine Drohung mit einer eventuellen Explosion eine Erpressung ausüben wollen?«
»Ja, ich hatte es fast geglaubt«, gab der biedere Beamte unumwunden zu.
»Woraus schließen Sie das?«
»Weil — weil...«
Der Direktor fand doch nicht gleich einen Grund, diesem sogenannten Seeräuber war eigentlich doch gar nichts Schlechtes nachzusagen.
Die Vernichtung der englischen Kriegsschiffe hatte nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun; durch die Erstürmung des Forts von Charleston hatte sich dieser Seeräuber wohl als Feind der Union gezeigt, doch mehr indirekt, das war für ihn nur eine private Handlung gewesen, wie nun schon längst bekannt geworden.
»Haben Sie die näheren Einzelheiten gehört, wie ich den italienischen Passagierdampfer angehalten habe?«
»Ich glaube wohl. Gestern ist schon der schriftliche Bericht angekommen, der in den Zeitungen veröffentlicht worden ist.«
»Bin ich da irgendwie als ein Räuber aufgetreten?«
»Ganz im Gegenteil, Sie haben sich als großmütiger Gentleman gezeigt, mehr als dreihundert arme Italiener gedenken Ihrer als ihres Wohltäters.«
»Nun, auch in New York werde ich nicht sengen und plündern«, lächelte Jansen. »Ich komme hierher, um meine braven Jungen nach langem Aufenthalt auf See einmal wieder die Freuden des Landes kosten zu lassen, die Freuden einer großen Hafenstadt — nach ihrem Geschmacke. Verstehen Sie, Herr Direktor?«
»Ich verstehe vollkommen«, erklang es noch erleichterter.
»Da können wir uns nicht heimlich einschmuggeln, das ist überhaupt nicht unser Fall. Offen sind wir hier in den Hafen gesegelt — allerdings mit einer kleinen List, unter einer falschen Flagge, das war doch nicht zu vermeiden — aber da wir nun einmal hier liegen, zeigen wir auch offenes Visier. Können Sie als Polizeidirektor nun für die Sicherheit meiner Leute garantieren, wenn ich sie an Land lasse, dass sie sich nach Matrosenweise einmal austoben?«
»Ich glaube, es zu können. Das heißt — da ist schwer von einer Garantie zu sprechen. Sie selbst sind es ja, der den Druck ausübt.«
»Nun gut. So machen Sie den Vermittler zwischen mir und der Öffentlichkeit. Ich werde also meine Mannschaften wachenweise an Land lassen, dass sie sich einmal amüsieren können. Glauben Sie ja nicht etwa, dass ich meinen Matrosen die Erlaubnis gegeben habe oder geben werde, in der Stadt wie die Vandalen zu hausen, weil wir, wenn wir es nicht sind, so doch für vogelfreie Seeräuber gehalten werden. Vogelfreie Desperados sind wir ja übrigens wirklich. Amüsieren sollen sie sich, sich austollen, austoben — aber nicht mehr, als jedem anderen Matrosen erlaubt ist, der sein schwerverdientes Geld möglichst schnell durchbringen will. Sonst ist nur jede polizeiwidrige Überschreitung der öffentlichen Ordnung zu melden. Allerdings möchte ich nicht gern haben, dass sich in solch einem Falle die Polizei selbst gleich einmischt, etwa den oder die Übeltäter zur Wache bringt. Angetrunken könnten die Burschen doch etwas sein, sie halten zusammen und... wir sind nun eben einmal ganz andere Menschen geworden, die außerhalb aller Gesetze stehen. Daher bitte ich, von solch einer polizeilichen Einmischung absehen zu wollen. Ich bitte sehr höflich darum.«
»Ganz, wie Sie bestimmen, Herr Kapitän!«, entgegnete der Polizeidirektor mit einer kleinen Verbeugung.
»Wenn mir solch eine Überschreitung sofort gemeldet wird, werde ich mit einem Teile der Wache schnellstens zur Stelle sein und die Übeltäter dingfest machen, und dann wird man sehen, wie auch ein Seeräuber auf Wahrung der öffentlichen Ordnung hält. Hier öffentlich an Deck dieses meines Schiffes werde ich den Übeltäter bestrafen lassen, und zwar wahrscheinlich viel, viel härter, als Polizei oder Gericht tun würde.«
»Herr Kapitän, auch ich habe eine vorgesetzte Behörde, vor allen Dingen den Magistrat, den ich sofort von alledem benachrichtigen werde.«
»Und Sie glauben, dass diese Bedingungen angenommen werden?«
»Aber selbstverständlich, selbstverständlich!«
Jansen musste bei dieser Diensteifrigkeit ein Lächeln unterdrücken. Freilich, New York, befand sich da in einer schlimmen Lage; es blieb den Vertretern der Stadt ja gar nichts anderes übrig, als auf alles einzugehen, wollte man nicht die ganze Stadt in Flammen sehen. Sommerhitze und Wind waren gerade günstig dazu.
»Gut, so wäre dies erledigt! Nun sagte ich Ihnen schon, dass ich auch in geschäftlicher Angelegenheit hierher komme. Würden Sie die Güte haben, auch hierbei den Vermittler zu spielen?«
»Bitte, sehr gern!«
»Es handelt sich um das Vermögen meiner Frau, welches bei der New Yorker Bodenkreditgesellschaft angelegt ist und von ihr schon zum 1. April dieses Jahres gekündigt... was ist Ihnen denn?«
Ja, der Polizeidirektor hatte plötzlich ein ganz merkwürdiges Gesicht gemacht.
»Ihrer... Frau?«, wurde zögernd wiederholt.
»Nun ja, die Lady Blodwen von Leytenstone, Sollte Ihnen mein Verhältnis zu ihr nicht bekannt sein?«
»Doch.«
»Ich bin mit ihr regelrecht getraut worden.«
»Ich weiß es.«
»Durch die Priorin einer englischen Schwestergemeinschaft, welche zur gesetzlichen Trauung berechtigt war.«
»All dies wurde ja durch den englischen Kriegsschiffskapitän bekannt, der Sie damals in dem hohlen Vogelberge besuchte.«
»Nun, und was haben Sie da zu staunen?«
»Ich staune nicht, ich fürchte nur, dass Sie da auf die größten Hindernisse stoßen werden.«
»Wieso?«
»Wissen der Herr Kapitän denn nicht, was sich unterdessen zugetragen hat?«
»Was hat sich zugetragen?«, Jetzt war es Jansen, welcher stutzte.
»Die englische Regierung hat schon vor langer Zeit bekannt gemacht, dass alle Ehen, welche jene Priorin, eine geborene Herzogin von Manchester, nach ihrem Verlassen Englands geschlossen hat, null und nichtig sind.«
Es sah fast aus, als wollte Jansen wild in die Höhe fahren, aber er beherrschte sich, blieb sitzen und nagte nur einige Zeit finster an seiner Unterlippe.
»Tatsache?«
»Das ist allgemein bekannt, ist zur Kenntnis aller Behörden gelangt.«
»Ist da auch schon von einer Erbschaft gesprochen worden?«
»Oft genug! Das müßige, sensationslüsterne Publikum hat ja immer Zeit zu so etwas und wird darin von den Zeitungen unterstützt.«
»Nun?«
»Als Erben kämen natürlich die nächsten Verwandten in Betracht.«
»Wer sind diese?«
»Die Brüder und eine Schwester ihres verstorbenen Gatten, ein Lord Hektor von Leytenstone, ein Lord James, eine Lady...«
»Ich weiß, ich weiß!«, stieß jetzt Jansen doch mit einigem Ingrimm hervor. »Ich muss diese Verwandten doch am besten kennen. Ich meine, ob sie schon Ansprüche auf diese Erbschaft gemacht haben?«
»Das können sie ja noch gar nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Da müsste Lady Blodwen doch erst verstorben sein.«
»Jene Verwandten haben ihre Erbschaftsansprüche doch schon einmal geltend gemacht.«
»Da galt Lady Blodwen eben für tot.«
»Wann denn?«
»Damals, als sie auf der Osterinsel verschwunden war, von einem reißenden Tiere...«
»Ach, richtig, richtig!«, fuhr Jansen aus seinem Sinnen empor. »Und unterdessen ist sie ja selbst wieder in New York gewesen, eben um ihr Kapital zu kündigen. Ja, da werde ich allerdings Schwierigkeiten haben. Nun, ich danke Ihnen, Herr Direktor.«
Es war in einem Tone gesprochen worden, dass sich der Besuch unweigerlich erheben musste. Jansen beachtete ihn gar nicht weiter, bemerkte auch nicht, wie jener an der Tür zögernd stehen blieb.
»Herr Kapitän!«
»Was gibt es?«
»Es handelt sich um dreißig Millionen Dollar.«
»Ganz richtig! So hoch beläuft sich die Summe, die bei jener Bank angelegt ist.«
»Das ist eine riesige Summe.«
»Vielleicht für den, der sich durch Zahlen blenden lässt. Mir kann so etwas nicht imponieren.«
»Alle diese Petroleumschiffe, die ganzen PetroleumMagazine dürften keinen Wert von dreißig Millionen repräsentieren.«
Jäh fuhr Jansen auf seinem Stuhle herum.
»Mann, was wollen Sie damit sagen?!«
Der Polizeidirektor wurde so verlegen, dass er keine Antwort fand.
»Sie meinen, ich wäre fähig, mit Brandstiftung und dergleichen zu drohen, falls man mir dieses Geld vorenthält? Und Sie machen mich darauf aufmerksam, dass diese ganzen Hafenanlagen keine dreißig Millionen wert sind, sodass ich gar keinen genügenden Druck ausüben könne? Nein, geehrter Herr, ein Mordbrenner bin ich nicht. Will ich jenes Geld haben, werde ich es mir auf andere Weise zu verschaffen wissen, aber nicht so, dass Unschuldige darunter leiden. Sorgen Sie nur dafür, dass dieses mein Pulverschiff hier nicht in die Luft fliegt, dafür könnte ich allerdings nichts.«
Jansen war hauptsächlich nach New York gekommen, um die dreißig Millionen zu erheben, welche Blodwen damals von dem Maharadscha oder dessen Stellvertreter als Preis für jenes geheime Dokument erhalten hatte.
Daraus wurde nun nichts. Die Regierung des schlauen Englands hatte ihm einen Riegel vorgeschoben. Und zum Mordbrenner wollte Jansen, wie er selbst gesagt, denn doch nicht werden.
Außerdem kennen wir den Charakter unseres Helden und besonders seine Ansicht über Geld und dergleichen schon genug, um zu wissen, wie wenig ihn dies im Grunde genommen berührte. Seine Absicht war gewesen, über Blodwens Tod zu berichten, wenn auch nicht ganz der Wahrheit gemäß — wenigstens nicht von jener Insel in der Fucusbank hätte er gleich gesprochen — aber seine ganze Mannschaft konnte doch Blodwens Tod bezeugen, und genügte das noch nicht, so wäre Jansen vielleicht auch erbötig gewesen, die auf der Fucusinsel lebenden englischen Soldaten als Zeugen zu bringen.
Jetzt dachte er an so etwas nicht mehr. Nun mochte Blodwen auch noch als lebend gelten, damit jene rechtmäßigen Erben, denen unser Held doch durchaus nicht hold gesinnt war, wenn er auch einmal ihre Verteidigung ergriffen hatte, keine Ansprüche auf die Hinterlassenschaft machen konnten. Bevor diese nur auf den Gedanken kamen, dass die Schwägerin wieder einmal tot sein könnte, würde doch schon einige Zeit vergehen, dann waren wiederum fünf Jahre nötig, ehe sie für verschollen erklärt resp. die Ansprüche der Erbberechtigten gültig wurden — kurz, da war noch lange Zeit, um einen Entschluss zu fassen, und unterdessen lag das Geld doch ganz sicher, wenn auch unverzinst.
Dass Jansen seine Leute im Zwischendeck noch einmal vornahm und ihnen Verschwiegenheit betreffs der Vorgänge auf der Fucusinsel einschärfte, war eigentlich ganz überflüssig; aber er tat es. Dann schickte er sie wachenweise an Land, auf dass sie sich einmal nach Matrosenart amüsieren konnten.
Auch in dieser Hinsicht hatte sich Jansen auf Schlimmeres vorbereitet, als es sich dann in Wirklichkeit zeigte. Die Matrosen, die großen wie die kleinen, gingen in die Kneipen, in Tingeltangels, ins Theater, amüsierten sich und ließen sich anstaunen und kehrten ohne besondere Vorfälle immer wieder in geschlossenen Trupps zurück, so, wie sie ausgerückt waren. Eben dieser feste Zusammenhalt machte ja alle bösen Zufälle unmöglich.
Immerhin, über diese ganze Sache lag doch etwas von Ungeheuerlichkeit gebreitet. Das freie Amerika und besonders New York hatten schon manches an Terrorismus erlebt, aber so etwas denn doch noch nicht.
Kommt da ein Schiff, welches einfach als Piratenschiff gilt, welches überall in der Welt gesucht wird, weil man es vernichten will, legt sich mitten in New York in den Hafen und schickt seine Seeräubermannschaft an Land, damit sie sich da belustigen kann!
Ja, aber was sollte man dagegen tun? Diesen Fall als eine Lektion hinnehmen, um später besser aufzupassen, dass so etwas nicht noch einmal passierte?
Mit zwanzig Zentnern Nitroglyzerin mitten zwischen den Petroleumschiffen, o weh!! Die New Yorker Polizei hielt ihre zahllosen Hände nicht nur schützend über die Matrosen der ›Sturmbraut‹, wenn sie zechend in den Kneipen saßen, mit geschminkten Frauenzimmern Champagner aus Eimern tranken und mehr oder minder johlend durch die Straßen zogen, sondern in Uniform und Zivil wurde auch von Polizisten und Kriminellen das Pulverschiff selbst und mehr noch dessen Umgebung bewacht, das andrängende Publikum zurückgehalten und beobachtet.
Denn da lagen einige spekulative Gedanken sehr nahe.
Der Kapitän des Pulverschiffes — wie die ›Sturmbraut‹ jetzt allgemein genannt wurde, wenn es sich auch um Nitroglyzerin handelte — ging zwar nicht an Land, mit keinem Schritt, aber sicher nicht aus Angst, denn er zeigte sich ganz sorglos an Deck, und auch ein ungeübter Schütze hätte ihn vom Kai aus wegknallen können, so nahe lag das Schiff an der Landungsmauer.
Dann hätte sich der glückliche Schütze 60 000 Pfund Sterling verdient gehabt. Ja, aber lebendig hätte er sie wohl nicht bekommen. Nicht nur die sämtlichen New Yorker und auswärtigen Versicherungsgesellschaften hatten ihre Wachen um das Pulverschiff postiert, immer zum Zuhauen bereit — jeder brave Bürger wünschte dem Herrn Piratenkapitän doch lieber von ganzem Herzen gesegnete Mahlzeit und angenehme Ruhe, als dass die Mannschaft dann aus Rache ganz New York in Flammen setzte.
Aber auch noch eine andere Spekulation war zu bedenken.
Nicht nur in Verbrecherspelunken — nein, gerade in den solidesten Geschäftskreisen ward jetzt ganz ernsthaft besprochen, ob es sich nicht vielleicht doch lohne, das Pulverschiff mit Absicht in die Luft zu sprengen.
Der Aschantischatz — Diamanten und Perlen — das waren jetzt die Schlagworte.
Bekannt war dies ja alles schon früher gewesen, nun aber hatte der Kapitän der ›Apulia‹ dies alles noch einmal aufgerührt.
Würde es sich nicht lohnen, eine furchtbare Feuersbrunst zu verursachen, wenn man dann hoffen durfte, dort, wo das in die Luft gegangene Pulverschiff gelegen, und in der weiteren Umgebung im Schlamme des nicht allzu tiefen Wassers das Geschmeide der Aschantihäuptlinge und die sonstigen Diamanten und Perlen zu finden? Würden diese Schätze den verursachten Schaden nicht reichlich decken?
Aber da gab es wiederum etwas anderes zu überlegen.
Was die Yankees da ausgrübelten, das hatte eine große Ähnlichkeit mit jener verzwickten Logik, welche Mahlsdorf damals wegen der ungeladenen Kanonen der ›Sturmbraut‹ aufgestellt, als diese neben der ›Apulia‹ gelegen hatte.
Sollte der Piratenkapitän nicht dasselbe bedacht haben, was für eine Freude er da der Einwohnerschaft bereiten konnte? Sollte er seine Schätze nicht erst irgendwo geborgen haben? Sollte er aber seine Leute nicht instruiert haben, dass diese auf Befragen aussagten, er hätte die Schätze an Bord, auf dass man sein Schiff in die Luft sprenge und dann im Schlamm nichts weiter fände als Pfahlmuscheln?
Also hatte es gar keinen Zweck, seine Matrosen deswegen erst auszufragen, im Guten oder im Bösen.
Also wollte man auch lieber nicht sprengen.
Und so kam es, dass das Pulverschiff nach einigen Tagen mit heilen Planken und vollzähliger Mannschaft wieder den Hafen von New York verließ.
Vorläufig aber lag es noch da, bewacht und angestarrt.
Wie gesagt, Jansen begab sich mit keinem Schritt an Land, ohne sonst für seine Person irgendwelche Vorsicht zu zeigen.
Die Sehnsucht, die er jüngst für die Genüsse des Lebens gezeigt, schien sich nicht auf New York zu erstrecken, dies gönnte er nur seinen Leuten.
Aber amüsieren hätte er sich jedenfalls können, wenn er gewollt. Gleich die erste Post hatte ganze Körbe voll Briefe gebracht, viele, sehr viele davon in rosafarbenen Kuverts. Sie waren gar nicht angenommen worden, kein einziger. Dann meldeten sich Besuche, bei Tage wie bei Nacht, zu letzterer Zeit besonders Damen — sie wurden kurzerhand abgewiesen.
Nur Zeitungen kamen an Bord.
»Mahlsdorf, was halten Sie vom Spiritismus?«
Ja, der Spiritismus!
Der uralte Spiritismus — schon in der Bibel erwähnt, wie Saul durch die Hexe von Endor Samuels Geist zitieren lässt, abgesehen von den alten Ägyptern, Chaldäern, Medern usw. — war einem hochverehrlichen Publikum wieder einmal aufgewärmt als etwas ganz Neues vorgesetzt worden.
Ihren Ausgang hatte die neue Geistertheorie mit Praxis in Amerika genommen, war zunächst nach England gegangen, wo der ›Spiritualismus‹, wie damals genannt, hoffähig wurde. Die Gräfin van Beirac, erste Hofdame und intimste Freundin der Königin Victoria, war eifrigste Spiritistin, die Leibkammerzofe der englischen Königin ein geschultes Medium. Gladstone war überzeugter Spiritist. Wissenschaftliche Vertreter wurden in England zuerst Professor William Crookes, seinerzeit der berühmteste Physiker, Entdecker des Thalliums, und Professor Barley, Elektrotechniker, welcher ein Instrument erfand, wie man bis zum Meter bestimmen kann, wo das transatlantische Kabel gerissen ist, sodass es eben dort aufgefischt wird, wodurch die Kabelgesellschaften jährlich Hunderttausende ersparen. In Deutschland wurde als wissenschaftlicher Verfechter des Spiritismus am bekanntesten der Leipziger Professor Zöllner, Astronom, als Kometenforscher weltberühmt.
Was ist denn nun eigentlich am Spiritismus?
Hast du, geneigter Leser, schon einmal einer spiritistischen Sitzung beigewohnt? Das kostet allerdings ein paar Taler.
Nicht? Dann hast du auch kein Recht, darüber zu urteilen! Kann man denn aber wirklich glauben, dass sich solche Männer, wie die oben genannten, zu denen in neuerer Zeit noch Edison kommt — Edison, der Erfinder des Telefons, des Phonografen, der lebenden Fotografien, dieser Edison ist der gläubigste Spiritist! — dass sich solche Männer, welche jeder neuen Erscheinung in der Natur mit strengster mathematischer Gründlichkeit zu Leibe gehen, in ihrem eigenen Laboratorium von einem Taschenspieler oder gar von einem kleinen Mädchen jahrelang an der Nase herumziehen lassen?!
O sancta simplicitas!
Ebenso bedauernswert aber sind auch alle die, welche aus dem Spiritismus nun gleich eine Religion machen, an Geister oder gar an das Wiedererscheinen von Verstorbenen glauben.
Ja, es passieren in den spiritistischen Sitzungen, wenn ein gutes, zuverlässiges Medium dabei ist, rätselhafte Dinge. Durch Tischklopfen werden Fragen über Dinge beantwortet, von denen nur der Frager etwas wissen kann. Gegenstände fliegen durch die Luft; es zeigen sich rätselhafte Lichterscheinungen; es zeigen sich sogar leuchtende Gestalten, welche unter Umständen sprechen, sich anfassen lassen, und welche verstorbenen Personen ganz ähnlich sehen.
Aber wer sagt denn, dass das Geister oder die Seelen Verstorbener sind? Hierfür ist noch nicht ein einziger Beweis erbracht worden! Und das ist es eben, was auch alle jene doch gewiss bedeutenden, scharfsinnigen Männer gesagt haben und noch sagen: ja, es gibt etwas in der Welt, was wir noch nicht in wissenschaftliche Formeln zwängen können; in den spiritistischen Sitzungen kommen Phänomene zustande, welche scheinbar mit den Naturgesetzen im Widerspruch stehen, soweit wir diese kennen; trotzdem sind sie reell, aber dass sie von Geistern hervorgebracht werden oder selbst Geister oder die materialisierten Seelen Verstorbener sind, dafür fehlt noch jeder Beweis.
Wie sich diese sachlichen Forscher die rätselhaften Vorgänge nun aufzuklären suchen, das werden wir später aus anderem Munde erfahren. — — —
Bis zu den vollständigen Geistererscheinungen hatte der Spiritismus es in Amerika damals noch nicht gebracht, so weit war die Mediumschaft, die tatsächlich der Entwicklung fähig ist, noch nicht ausgebildet. Es kam nur zu undeutlichen Lichterscheinungen, die höchstens die Form einer Hand annahmen. Dagegen flogen überall in Amerika Messer, Gabeln und andere Gegenstände durch die Luft, in manchen Zimmer wurden alle Möbel rebellisch, und dann vor allen Dingen wurden das harmlose Tischrücken und noch mehr das weniger unschuldige Tischklopfen gepflegt.
Denn dass sich die Klopfgeister als Engel, Teufel oder als Seelen Verstorbener ausgeben, was dann gläubig als Offenbarung aus dem Jenseits angenommen wird, das ist eben bei weniger selbstdenkenden Köpfen das Gefährliche bei der Sache.
Also, der Spiritismus stand damals schon in Amerika in herrlichster Blüte, man zählte bereits ums Jahr 1860 in den Vereinigten Staaten an die neun Millionen Spiritisten, die über zweihundert Vereine mit großartigen Klubhäusern bildeten, und wohin man spuckte, da spuckte man auf ein Medium. Diese Medien, meist Weiber, priesen ihr Gewerbe in Plakaten und Zeitungsannoncen wie die Hebammen an, mit denen sie in gewisser Hinsicht ja auch große Ähnlichkeit haben; nur dass sie Geister heben.
Durch diese zahllosen Annoncen in jeder Zeitung war Jansen auf seine Frage gekommen.
»Was halten Sie vom Spiritismus, Mahlsdorf?«
»Nischt!«, war die prompte Antwort.
»Na, sprechen Sie sich mal etwas deutlicher aus«, lächelte Jansen.
»Unsinn, Mumpitz, Gehirnerweichung, amerikanischer Humbug!«
»Haben Sie schon einmal einer Sitzung beigewohnt?«
»Nein, Gott sei Dank nicht, werde mich auch schön hüten.«
Aber gehört und gelesen hatte Mahlsdorf doch schon viel davon, ebenso Jansen. Darüber unterhielten sich die beiden, was nicht der Wiedergabe wert ist.
»Ich möchte doch einmal solch einer Sitzung beiwohnen«, meinte dann Jansen.
»Dazu haben Sie hier überall Gelegenheit, in jedem Hause wird sogenannter Circle gehalten.«
»Auch öffentlich?«
»Auch öffentlich gegen Eintrittsgeld.«
»Ich möchte doch lieber so ein Medium hier an Bord haben, hier in meiner Kajüte muss die Sitzung stattfinden. Denn dass sehr viele Medien Taschenspielerei und überhaupt Schwindel treiben, das gestehen ja sogar die gläubigsten Spiritisten ein. Das Geisterbeschwören ist eben ein einträgliches Geschäft geworden.«
»Es wird nur kein Medium an Bord der ›Sturmbraut‹ wollen.«
»Warum nicht? Es können ja hier dieselben erforderlichen Bedingungen geschaffen werden, Dunkelkabinetts und sonst alles, und alle Geister werden doch nicht wasserscheu sein?
»Ja, aber es ist das Pulverschiff!«
»Ach so — nun, es wird sich schon ein Medium gegen Geld und gute Worte bereit finden lassen. Einen guten Leumund habe ich ja sonst.«
Schön, Mahlsdorf wollte sich auf die Suche machen.
»Soll es ein Mann oder eine Frau sein?«, fragte er noch.
»Gibt es denn auch männliche Medien?«
»Ei gewiss.«
»Ich dachte, weil hier lauter Weiber annoncieren.«
»Meistenteils sind es allerdings Frauen und Mädchen, weil die eben mehr zur Hysterie veranlagt sind als Männer.«
»So holen Sie ein Mädchen.«
»Soll es jung und hübsch sein?«
»Machen Sie, dass Sie fortkommen! Bringen Sie ein Medium, das Geister rufen kann!«
Diese Unterredung und vor allen Dingen Mahldorfs letzte Frage charakterisiert die Stimmung, in der sich die beiden befanden und wie sie den ganzen Spiritismus auffassten — lächerlich!
Jansens letzte Worte hatte der soeben eintretende Karlemann gehört.
»Was? Sie wollen ein Medium holen lassen?«
»Ja, ich möchte mir den Mumpitz doch einmal in der Nähe betrachten. Haben Sie auch schon etwas von Spiritismus gehört?«
»Ei nun freilich, allemal!«
»Waren Sie auch schon in einer Sitzung?«
»Das noch nicht, habe es auch gar nicht nötig, ich kann selber Geister rufen.«
»Was können Sie?«
»Geister rufen. Jawohl, ich kann Geister rufen — aber ob sie auch kommen, das freilich ist eine andere Frage.«
Eine Stunde später war es wiederum Karlemann, welcher die Botschaft brachte:
»Mahlsdorf kommt und bringt wirklich eine mit — sie ist nicht gerade jung und hübsch, dafür aber hat sie den Tadderich und wackelt mit'm Koppe.«
Karlemann sprach nur die allgemeine Ansicht aus, welche die sogenannten Aufgeklärten, die aber noch nie eine spiritistische Sitzung besucht, sich über ein Medium gebildet hatten und noch heute haben — dass es nämlich unbedingt ein bleichsüchtiges, überhysterisches Frauenzimmer sein muss.
Der Junge konnte die Kommende noch gar nicht gesehen haben, er hatte eben nur die allgemeine Ansicht ausgesprochen — und so war Jansen nicht wenig überrascht, als in die Kajüte eine weibliche Person eintrat, die durchaus keine Ähnlichkeit mit solch einem Medium besaß, wie er es sich bisher immer gedacht hatte.
Obgleich elegant gekleidet, passte der Ausdruck ›Dame‹ nicht recht auf sie — auch nicht Frau oder Mädchen — es war eine einfache Vornehmheit in schwarzem Tuchkleid, ohne jeden Schmuck, durch einen breiten, weißen Kragen und weiße Manschetten sehr an eine barmherzige Schwester erinnernd.
Man kann solch eine Schwester, die es ernst mit ihrem Berufe nimmt, ganz in der Nächstenliebe aufgeht, auch in jedem anderen Kostüm stets erkennen. Es ist eben die Seele, welche die Gesichtszüge formt, und das Auge ist nun vollends der Spiegel der Seele. Und da wird man finden, dass diese Pflegerinnen trotz ihrer vielen Nachtwachen am Krankenbett meistenteils durchaus kein bleiches, ungesundes Aussehen haben, gerade bei diesen barmherzigen Schwestern sieht man unter dem weißen Häubchen so viele frische, rosige Gesichter, und der Ernst des Auges wird durch eine innere Heiterkeit verklärt.
Und solch eine Gestalt war die Eintretende, vielleicht eine Frau mittleren Alters, an der aber die Flucht der Jahre spurlos vorübergegangen war, ohne in der reinen, weißen Stirn eine Falte zu hinterlassen, die braunen Augen blickten klar wie die Sterne, und die runden Wangen blühten wie die Pfirsiche.
»Missis Nightingale«, stellte Mahlsdorf in höflichster Weise vor. Jansen war vollständig verblüfft. Vor allen Dingen aber unterlag er der Wirkung, welche stets reine, durchgeistigte Frauen gerade auf die stärksten, robustesten, selbst rohsten Männer ausüben. Er wurde plötzlich hilflos wie ein Kind, brachte es nur zu einer linkischen Verbeugung.
»Sie sind der Herr Kapitän dieses Schiffes?«, fragte eine sanfte, wohllautende Stimme.
»Ja — jawohl — gewiss doch«, stammelte der riesenhafte Mann.
»Sie wünschen sich mit einer verstorbenen Person in Verbindung zu setzen?«
»Es wäre mir äußerst angenehm.«
»Ich bringe aber keine Materialisationen fertig.«
»O, bitte, bitte, hat gar nichts zu sagen.«
»Ich bin nur ein Klopfmedium.«
»Sehr angenehm — Richard Jansen ist mein Name.«
Da endlich hatte Jansen seine Verlegenheit überwunden, es kam ihm zum Bewusstsein, wie tölpisch er sich benahm, was ihn aber nun hinterher nicht von neuem verlegen machte.
»Also Geistererscheinungen können Sie nicht hervorbringen?«
»Nein, die Spirits melden sich bei mir nur durch Klopfen an.«
»Durch Klopfen im Tisch?«
»Das ist nicht unbedingt nötig, aber gewöhnlich sitzt man um einen Tisch. Eine magnetische Kette muss unbedingt gebildet werden, und das geschieht am besten auf einem Tisch.«
»Die magnetische Kette, ich verstehe. Welcher Bedingungen bedarf es sonst?«
Die Frau blickte sich in der Kajüte um.
»Gar keiner weiter. Nun ja, ein Tischchen, um das wir uns setzen können.«
»Wird sofort besorgt werden.«
»Wie viele Personen werden an der Sitzung teilnehmen?«
»Können es nicht nur zwei sein, ich und dieser Herr hier?«
»Nur zwei? Da ist der Erfolg sehr zweifelhaft.«
»Wie kommt das?«
»Das weiß ich selbst nicht. Ich habe nur meine Erfahrungen, um die Theorien der Spiritualisten kümmere ich mich gar nicht. Es dürfen nicht zu wenige und nicht zu viel sein. Mein Schutzgeist hat mir wiederholt gesagt, dass die Spirits am meisten die Sieben als eine heilige Zahl lieben.«
Hier kam schon das Religiöse zum Vorschein, wodurch sich die Spiritisten selbst so schaden.
»Sind Sie schon von Kind an Medium gewesen, wenn ich fragen darf?«, erkundigte sich Jansen nun zunächst.
»O nein, erst vor vier Jahren überkam es mich plötzlich.«
»Wie geschah das, wenn ich fragen darf?«
»Mein Mann wurde bei der Arbeit in einer Sandgrube verschüttet...«
»Ihr Gatte war Baumeister, Ingenieur?«, wurde Jansen jetzt immer dreister, oder aber: Seine Wissbegierde siegte.
»Nein, Erdarbeiter.«
»Ein gewöhnlicher Erdarbeiter?«, fragte Jansen erstaunt.
»Nur ein Arbeiter, er verdiente sehr wenig, aber es genügte, um uns und die Kinder gut zu ernähren, und wir führten das glücklichste Leben, bis es einem allweisen Gott gefiel, mir Mann und alle drei Kinder innerhalb einer Woche zu nehmen. Wir waren Quäker.«
Was dieser Nachsatz sollte, wusste Jansen nicht recht, und doch gab er ihm den Schlüssel zu dem vorliegenden Rätsel.
Diese Arbeiterfrau war von jeher eine tiefreligiöse, geistig hochstehende Natur gewesen — welches geistige Niveau nun allerdings absolut nichts mit der sogenannten Schulbildung zu tun hat — durch die Schicksalsschläge war ihr Charakter erst recht veredelt worden, die geistige Tätigkeit übertraf die körperliche — daher auch diese Durchgeistigung des Äußerlichen. Und dann war sie eben unter die Spiritisten geraten.
»Ja«, fuhr sie fort, mit einer Heiterkeit, die merkwürdigerweise gar nichts Unnatürliches an sich hatte, »doch in derselben Woche starben auch meine drei Kinder — im Alter von vier bis neun Jahren — an der Diphtheritis. Und ich bekam ein schweres Nervenfieber. Da hörte ich in der Wand immer klopfende Töne. Auch später noch, als ich wieder gesund war. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich fürchtete mich, bis eine fromme Dame zu mir kam, welche Spiritualistin war. Die erklärte es mir. Sie sagte, ich sei ein Medium. Ein Geist wolle mich sprechen. Es war meine älteste Tochter, die Nancy, die mich trösten wollte. Sie ist seitdem mein Schutzgeist.«
»Haben Sie sich auch mit Ihrem Manne und mit Ihren anderen Kindern verständigen können?«
»Ja. Wollen wir beginnen?«
Kleine Vorbereitungen waren doch nötig. Ein Kartentisch wurde hereingetragen, auch einige lose Stühle, die Bullaugen mussten geschlossen werden, und die Hängelampe wurde so niedrig geschraubt, dass sie nur ein ganz schwaches Licht verbreitete.
»Weshalb kommen die Geister immer im Dunklen?«, fragte Jansen mit einigem aufsteigenden Spott.
»Wohl weil ihnen helles Licht unangenehm ist. Aber bitte, stellen Sie an mich nicht solche Fragen. Gelehrte Spiritualisten können Ihnen da viel bessere Auskunft geben.«
Als Teilnehmer erwählte Jansen seine vier Offiziere, außer den Steuerleuten also auch die beiden Maschinisten, Jansen und Karlemann, und da das Medium selbst mit an dem Tische Platz nehmen wollte, so war die gewünschte heilige Zahl Sieben vorhanden.
Außer Jansen und Kienock, dem zweiten Ingenieur, schienen alle anderen Teilnehmer die ganze Sache von der spaßhaften Seite zu nehmen. Das drückten sie nicht mit Worten aus, noch weniger durch Lachen oder Witze — aber es war ihnen doch anzumerken, die Gesichter so halb spöttisch, halb misstrauisch.
Nur Kienock zeigte sich ganz tiefsinnig.
»Es ist nichts weiter zu tun, wir wollen uns setzen«, sagte das Medium.
Sie setzten sich also um den runden Tisch und bildeten nach Anweisung die sogenannte magnetische Kette.
Wenn man dabei an einen elektrischen Strom denkt, der geschlossen durch die Körper der Teilnehmer gehen soll, so genügt eigentlich, dass sich alle bei den Händen fassen, und wirklich geben sich viele Medien hiermit zufrieden. Die meisten aber wollen die Kette noch geschlossener haben, sodass der Strom den kürzesten Weg hat. Dazu legen alle Teilnehmer die Hände auf den Tisch, ihre Daumen aneinander, während die kleinen Finger die der Nachbarn berühren.
So geschah es auch hier. Neben dem Medium saß auf der einen Seite Jansen, auf die andere hatte sich gleich Karlemann gedrängt.
»So, sonst ist nichts weiter nötig. Nun müssen wir warten, bis sich ein Geist durch Klopfen meldet«, sagte Mrs. Nightingale.
Das Licht genügte noch, dass einer die Züge des anderen sehen konnte, und man sah fast nur fidele Gesichter.
»Darf man sprechen?«, fragte Karlemann nach einer Weile. »Jawohl. Die Geister lieben sogar eine Unterhaltung.«
»Do you speak German?«
Nein, die Frau verstand kein Deutsch.
»Käpt'n, passt auf, dass sie nicht mit dem Fuße kloppt«, meinte da Karlemann, sich des Deutschen bedienend, »ich passe hier auf.«
»Haben Sie den Fuß auf ihren gestellt?«
»Nein. Sie?«
»Ich auch noch nicht.«
»Tun Sie es auch noch nicht, sonst kloppt sie mit was anderem.
Ich will schon aufpassen.«
Eine Weile verging, kein Klopfen wollte hörbar werden.
»'s kommt nischt«, meinte Karlemann.
»Ja, es dauert etwas lange«, bestätigte das Medium.
Na, da will ich einmal ein bisschen nachhelfen, dachte Karlemann mit vergnügtem Sinn, hob das Bein und — bumberrumbumbum — stieß mit der Stiefelspitze unten gegen die Tischplatte.
Die anderen waren nicht schlecht zusammengefahren, selbst Mahlsdorf, der die spöttischste Miene aufgesetzt hatte. Der Mensch bleibt eben immer ein Mensch — auch der aufgeklärteste ist der Abkömmling eines Geschlechtes, das sich seit Jahrtausenden mit Teufeln, Hexen und Geistern herumgeplagt hat — und nun hier das düstere Licht, die ganze Spannung, man hatte sich doch nicht zum fröhlichen Mahle um den Tisch gesetzt — — es hat doch etwas auf sich.
»Da — da hat sich ein Geist gemeldet«, erklärte das Medium vertrauensvoll, und fast bewundernswert war, dass auch Karlemann ein ängstliches Gesicht machen konnte.
»Nun müssen wir Fragen stellen«, erklärte das Medium ganz ruhig, als habe noch kein Geist seinen Besuch angemeldet; oder der konnte eben warten, Geister haben vielleicht viel Zeit. »Wie man sich mit den Geistern unterhält, ist ganz verschieden. Aber es ist allgemein eingeführt, und auch ich habe das mit den mich besuchenden Geistern ausgemacht, dass man langsam das Alphabet hersagt, und wenn der betreffende Buchstabe kommt, der an der Reihe ist, so lässt der Spirit im Tisch einen Klopfton erschallen, nur einen. Stellt man eine Frage, und er bejaht sie, so klopft er zweimal. Verneint er, so schweigt er entweder, oder er lässt Poltertöne erschallen, eine Art Trommeln.«
»So, nun bin ich orienteriert«, dachte Karlemann vergnügt, »nun kann's losgehen.«
»Ist ein Geist da?«, fragte das Medium mit lauter Stimme, als wären die unsichtbaren Bewohner einer anderen Welt schwerhörig.
Bumbum, bejahte Karlemann mit seiner Stiefelspitze.
»Es wird mein Schutzengel sein, er meldet sich stets zuerst, führt die anderen Spirits gewissermaßen ein. Bist du es, meine Nancy?
Karlemanns Entschluss war gefasst. So etwas wie Gemüt kannte dieser deutsche Zigeunerknabe ja nicht. Mit einem Bumberrumbumbum verneinte er die Frage.
»Nicht? Das wundert mich. Doch es ist möglich. Da muss ich den Herren erst noch eine Erklärung geben. Es ist eigentlich ganz selbstverständlich, dass nur die Geister erscheinen, mit denen man zu sprechen wünscht, an die man also denkt, und zwar muss das ganz lebhaft geschehen, mit aller Kraft der Sehnsucht. Eine Seele, die man bei Lebzeiten gehasst hat, wird kaum kommen. Wird nun von den verschiedenen Teilnehmern gleichzeitig an mehrere Verstorbene gedacht, so wird natürlich die Seele herbeigezogen, an welche am stärksten, am sehnsüchtigsten gedacht wird. Verstehen die Herren?«
Ja, die Herren verstanden — oder auch nicht. Was dieses Medium so selbstverständlich und natürlich fand, das ging ja über ihre Begriffe, und der erste Schreck über das Klopfen hatte sich schnell in offenes Misstrauen verwandelt. Karlemann hatte auch so gar nicht geisterhaft geklopft.
»Denkt jeder der Herren lebhaft an eine verstorbene Person, die ihm im Leben teuer war?«, fragte das Medium.
»Ja!«, erklang es einstimmig in der Tischrunde.
»So wollen wir sehen. — Wie heißt du? Nenne deinen Namen, den du bei Lebzeiten führtest, auf die dir doch sicher bekannte Weise. Ich sage jetzt das Alphabet her, und wenn der erste Buchstabe deines Namens kommt, so klopfst du mit einem Schlage. Also pass auf: a — b — c — d — e...«
Bums, machte Karlemann schlagfertig mit dem Fuße.
»Also mit E beginnt der Name. Weiter: a — b — c — d...«
Bis m kam die Zählende, dann stoppte Karlemann das Alphabet mit einem Donnerschlage gegen die untere Tischplatte.
»Em. Weiter: a — b...«
»Darf ich einmal unterbrechen?«, fragte Jansen.
»Gewiss.«
»Kann nicht auch der Geist das Alphabet klopfen? Ich habe einmal davon gehört?«
»Jawohl, das geht. Er klopft so lange, bis der betreffende Buchstabe kommt, und wir zählen immer mit. Aber ich finde die andere Art besser, dass wir zählen und der Geist klopft.«
»Wäre es da nicht viel einfacher, wenn der klopfende Geist morste?«
»Morste? Was ist das?«
»Morsen, die Telegrafensprache, aus Punkten und Strichen bestehend. Der Punkt könnte durch einen einfachen Klopfton, der Strich durch einen doppelten ausgedrückt werden.«
»Ah so, ich weiß, ich habe wenigstens schon davon gehört. Ja, das wird manchmal angewendet. Aber ich selbst verstehe diese Telegrafensprache nicht. Außerdem muss es ein Geist sein, welcher das bei Lebzeiten verstanden hat.«
»Dann würde er morsen?«
»Jedenfalls.«
»Auch ohne dass Sie selbst es können?«
»Gewiss, ich bin ja nur ein willenloses Werkzeug, dessen sich der Spirit bedient.«
»Ja, meine Herren, wer von Ihnen hat denn einen Verstorbenen zitiert?«, wandte sich Jansen an die Umsitzenden.
»Das kann man doch noch nicht wissen«, erklärte das Medium. »Es ist eben der Geist, an den mit der intensivsten Sehnsucht gedacht worden ist, aber wer das ist, das muss doch nun erst konstatiert werden.«
»Gut, so fahren Sie nach Ihrer Methode fort.«
»Ich kann ja gleich einmal fragen. — Geist, der du dich angemeldet hast, kannst du morsen?«
Karlemann verschmähte eine Antwort.
»So wollen wir mit dem Hersagen des Alphabetes fortfahren. E und M hatten wir. Also weiter: a—b—c—d...«
Sie sagte das ganze Alphabet her bis zum Z, ohne dass ein Klopfton erschollen wäre.
Es war nicht, dass Karlemann einmal die Wirkung erproben wollte, wenn er mit der Stiefelspitze keinen Klopfton hervorbrachte, sondern Karlemann war plötzlich ganz tiefsinnig geworden.
Hier lag eigentlich doch etwas ganz Merkwürdiges vor. Das Medium ließ sich betrügen, es glaubte selbst, dass die Klopftöne von einem Wesen aus der vierten Dimension herrührten.
Rechnete denn diese Frau stets damit, dass sie unter den fremden Teilnehmern einen Helfershelfer habe, der auch ohne Verabredung das Klopfen besorgte? Oder wie machte sie das sonst?
So ganz klar kam das Rätsel des vorliegenden Falles dem Jungen nicht zum Bewusstsein, aber es genügte schon, dass er dabei etwas Unbegreifbares fand.
»Merkwürdig«, sagte das Medium, nachdem es den vermeintlichen Geist wiederholt aufgefordert hatte, wenigstens ein Klopfzeichen zu geben, »so etwas ist mir noch gar nicht passiert! Sonst kommt auch immer mein Schutzgeist zuerst, um...«
Rumberrrumbumbumbum, ging es da wieder in der Tischplatte, auf eine Weise, dass diesmal auch Karlemann zusammenschrak.
Denn von diesem ging das Klopfen nicht aus, und es klang auch so ganz anders, als wenn jemand mit dem Fuß gegen die untere Seite der Tischplatte stößt.
»Da — das ist meine Nancy, die erkenne ich sofort am Klopfen«, sagte die Frau mit einem glücklichen Lächeln. »Nancy, bist du's?«
Bumbum, wurde bejaht.
»Soll ich das Alphabet hersagen?«
Bumbum.
Jetzt ging das schneller, als man das nach der Schilderung glaubt, und so wurden nach und nach folgende Buchstaben festgelegt:
E—i—n—s—p—i—r—i—t—w—i—l—l—s—i—c—h—m—a—n—i—f—e—s—t—i—e—r—e—n. Ein Spirit will sich manifestieren.
Das heißt, es wurde im Englischen ausgedrückt, doch wir bleiben beim Deutschen.
Es gehörte die langjährige Übung des Mediums dazu, da die Worte immer hintereinander ohne besonderes Abtrennungszeichen gegeben wurden, sie sinngemäß zusammenzusetzen.
Dabei ermunterte das Medium die Herren auch noch immer, nur nach der Ursache dieser Klopftöne zu forschen, sie sollten die Füße auf die ihren setzen, sie könnten auch getrost unter den Tisch blicken, sich unterhalten — nur die magnetische Kette dürfe nicht gelöst werden.
Und die sechs Männer verfolgten auch weniger das Hersagen der Alphabete, was doch ziemliche Zeit in Anspruch nahm, als vielmehr suchten sie wirklich die Ursache dieser Klopftöne zu erforschen, und immer unheimlicher ward ihnen dabei zumute.
Denn dass diese Klopftöne unmöglich von dem Medium ausgehen konnten, das war schnell festzustellen. Ihr ganzer Körper war unbeweglich. Man hätte denn gerade annehmen müssen, dass sie mit den Zehen in ihren Stiefeln solche Töne hervorbringen könnte, wiederum war es aber doch ganz deutlich zu hören, wie das Klopfen im Tische selbst erscholl, und da hätte man ebenso gut an Bauchrednerei glauben können, was aber ebenfalls ganz ausgeschlossen war. Wenn man an einem Tische sitzt, so kann man doch wohl unterscheiden, ob es in diesem klopft, oder ob der Schall von anderswoher kommt.
Am eifrigsten blickte Karlemann unter den Tisch, in der Annahme, dass jetzt ein anderer das Klopfen besorge. Das Licht der Lampe reichte noch aus, um auch unter dem Tische alles erkennen zu lassen, und da standen sechs Beinpaare unbeweglich, wie sich auch die anderen durch Bücken nach und nach überzeugten, während es in der Tischplatte immer lustig weiterklopfte.
Der erste Satz war vollendet. Ein Spirit will sich manifestieren. »Wie heißt dieser Spirit? A—b—c—d—e...«
Bum!
»A—b—c—d—e—f—g—h—i—k—l—m...«
Bum!
Und Karlemann bekam mit einem Male eine ganz blasse Nase! Es waren die beiden ersten Buchstaben, welche er vorhin selbst geklopft hatte.
Und weiter ging es.
»A—b—c—d—e—f—g—h—i...«
Bum!
Und so fort, bis die zwei Namen fertig waren: Emil Nauke.
»Kennt einer der Herren eine Person dieses Namens?«, fragte das Medium.
Und ob sie ihn kannten, sie alle zusammen!
Emil Nauke war als Hüter der Möwenstation auf der Fucusinsel zurückgelassen worden und hatte ebenfalls seinen Tod gefunden.
Am allerbetroffensten aber war Karlemann. Emil Naukes Name war es gewesen, den er vorhin hatte angeben wollen, und nun wurde er von einer ganz anderen Seite her genannt!
»Wer hat diesen Geist zu sprechen gewünscht?«, fragte das Medium.
»Ich!«, flüsterte Karlemann ganz scheu.
»So setzen Sie sich mit ihm in Verbindung, indem Sie den Geist laut fragen. Das Laute ist nicht gerade nötig, man braucht sogar alles nur zu denken, auch die Fragen, die Spirits lesen die Gedanken, aber durch das laute Sprechen konzentrieren sich diese mehr, und das ist unbedingt nötig.«
Es dauerte einige Zeit, ehe der vollständig eingeschüchterte Karlemann dessen fähig war.
»Emil, bist du es?«, fragte er dann laut, wenn auch mit zitternder Stimme.
Bumberrrumbumbumbum, ging es in der Tischplatte, was, wie das Medium schnell erklärte, diesmal nicht als Verneinung aufzufassen war: Nur ein neuer Geist hatte sich angemeldet.
»Fragen Sie noch einmal.«
»Emil, bist du es?«
Diesmal erscholl ein ganz anderes Klopfen, einzelne Schläge und doppelte in Zwischenpausen.
»Er morst! Es war das Bejahungszeichen!«, erklang es atemlos im Chor.
»Missis Nightingale«, sagte Jansen ganz außer sich, »ich beschwöre Sie — Sie verstehen das Morsen wirklich nicht?!«
»Nein, habe nicht die geringste Ahnung davon.
Oder glauben Sie denn, ich will Sie betrügen? Vermuten Sie, dass ich selbst diese Klopftöne hervorbringe? Schade nur, dass die magnetische Kette nicht gelöst werden darf, sonst würde ich den Tisch verlassen.«
»Wir können uns ja gleich überzeugen, ob es wirklich unser Freund ist«, meinte Karlemann, der vielleicht zuerst seine Ruhe wiedergefunden hatte, denn wie aufgeregt die anderen waren, lässt sich denken. Nur Kienock schien eine Ausnahme zu machen.
»Bestätige noch einmal, dass du wirklich Emil Nauke bist«, fuhr Karlemann fort, sich jetzt wie fernerhin des Deutschen bedienend, welche Sprache das Medium ebenfalls nicht verstehen wollte, kaum einige Brocken davon.
Das telegrafische Bestätigungszeichen erfolgte. Nauke war wie alle anderen Matrosen auch im Morsen ausgebildet worden.
»Du hast doch auch noch einen anderen Vornamen.«
»Ja.«
»Wie lautet dieser?«
»Max Ferdinand«, wurde gemorst.
»Stimmt! Max Ferdinand Emil Nauke, ich entsinne mich.«
Die anderen Teilnehmer, mit Ausnahme Kienocks, sahen sich verständnislos an. Dass diese Frau diesen Jungen so genau gekannt hatte, war doch wohl ganz ausgeschlossen.
»Du bist tot, Emil?«, fragte Karlemann weiter, und niemand fand etwas Komisches dabei.
»Ja.«
»Du bist ein Geist?«
»Ja.«
»Seit wann?«
»Seit — seit — ich weiß es nicht«, wurde geklopft.
»Es ist für die Spirits ungeheuer schwer, Zeitbestimmungen zu machen«, erklärte das Medium, aber erst, als ihm diese scheinbare Unwissenheit des ›Geistes‹ mitgeteilt worden war. »Nach dem Tode ändert sich doch gar vieles. Hier trifft zu, was in der Bibel von Gott gesagt ist: Tausend Jahre sind ein Augenblick, und ein Augenblick sind tausend Jahre.«
»Nun, ich will dem seligen Emil schon auf seine unsterblichen Zähne fühlen«, meinte Karlemann. »Aber wo du deinen Tod gefunden hast, das weißt du doch wenigstens.«
»Ja.«
»Nun, wo denn?«
»Auf der Fucusinsel«, wurde geklopft.
Erschrocken wollten alle Teilnehmer emporfahren, diesmal auch Kienock. Sie sahen ihr größtes Geheimnis in Gefahr.
»Lösen Sie nicht durch Zurückziehen der Hände die magnetische Kette!«, warnte das Medium. »Nach einer so plötzlichen Unterbrechung, welche die Sprints schmerzhaft empfinden, ist es sehr schwer, die Verbindung nochmals herzustellen.«

Die Offiziere blieben sitzen, sie beruhigten sich. Man musste der Frau glauben, dass sie weder Deutsch noch überhaupt das Morsen verstand.
»Wo liegt diese Insel?«, fragte Karlemann weiter.
»21 bis 38 nördliche Breite, 44 bis 5 westliche Länge.«
»Himmelkrrreiz und Krrruzifix!«, brachte Karlemann fast ächzend hervor. »Das ist ein Beweis — jetzt muss ich in meinen alten Tagen auch noch an Gespenster glauben!«
Er sprach die Gedanken aller aus.
»Wo hatte ich damals meinen Schatz vergraben?«
»Auf der Insel.«
»Ja, aber wo da, alter Junge?«
»Neben dem kleinen Wasserfall.«
»Himmelbombenelement noch einmal!«, ächzte Karlemann wiederum. »Jetzt gefällt's mir aber nicht mehr auf dieser Erde, jetzt gehe ich lieber selber unter die Geister.«
Da erscholl in der Tischplatte wieder jenes trommelnde Klopfen.
»Ein neuer Geist meldet sich an«, sagte das Medium.«
»Ich will aber noch mit meinem toten Emil sprechen.«
»Das geht nicht, es kann sich nur immer ein einziger Spirit manifestieren, und das ist stets der, an den am stärksten gedacht wird.«
»An wen wird denn so stark gedacht?«
Es erfolgte seitens der anderen keine Antwort, alle waren mit sich selbst beschäftigt.
»Wer ist da?«, fragte das Medium, nachdem es noch mehrmals so getrommelt hatte.
Es wurden sofort Buchstaben gemorst: b—l—o—d—w—e—n. »Blodwen, Blodwen!!«, schrie Jansen auf.
Das telegrafische Bejahungszeichen erfolgte. Dann aber sollte die ganze Sitzung unterbrochen werden.
Plötzlich schlug das Medium vom Stuhle und wälzte sich in fürchterlichen Krämpfen am Boden. Die Frau wurde von den erschrockenen Männern aufgehoben und auf das Polster gelegt, welches sich längs der Kajütenwand hinzog, wo die Krämpfe schnell nachließen; aber die Frau schien eingeschlafen zu sein.
Man wagte nicht, sie zu stören. So war die Sitzung beendet. Doch man stand noch ganz unter dem Banne der Erfolge.
»O, Blodwen, Blodwen!«, stöhnte Jansen wie zuvor. »Also die Gespenstermärchen werden zur Wirklichkeit, es gibt ein Leben nach dem Tode, es gibt ein Geisterreich!«
»Nein, das gibt es nicht!«
Kienock war es gewesen, der das gesagt.
Jansen stierte ihn groß an.
»Was sagen Sie da?«
»Es war ein Lügengeist, der uns genarrt.«
»Ein Lügengeist? Wie meinen Sie das?«
Kienock gab eine Erklärung, wie sie schon damals angewendet wurde, selbst von solchen, die sich selbst Spiritisten nannten, die aber trotzdem nichts mit ›Geistern‹ zu tun haben wollten.
Man muss annehmen, dass der Mensch eine besondere Eigenschaft besitzt, welche nur für gewöhnlich latent ist, gewissermaßen schlafend.
Dieser geheimnisvollen Eigenschaft sind die verschiedensten Namen gegeben worden: unbewusstes Ich, Astralleib, psychische Kraft usw.
Wir bleiben bei dem letzteren Namen, bei der psychischen Kraft, Seelenkraft.
Durch diese sonst noch undefinierbare Kraft der Seele, so undefinierbar wie z. B. die Elektrizität oder der Magnetismus, sollen die indischen Fakire und die modernen Medien ihre wunderbaren Phänomene zustande bringen, darauf beruht das Erscheinen des Doppelgängers, alles Fernsehen, Prophezeien und dergleichen, was ins Gebiet des Übersinnlichen gehört.
Wer an so etwas überhaupt nicht glaubt, dem ist nun freilich nicht zu helfen, der wird auch nicht an solch eine psychische Kraft glauben. Er kann nur daran erinnert werden, dass schon der Traum uns Rätsel genug aufgibt. Wenn ich träume, ich sitze in der Schule, der Lehrer stellt an mich eine Frage, ich kann sie nicht beantworten, wie ich mein Gehirn auch anstrenge, was man auch im Traume ganz reell empfinden kann — da steht mein Nachbar auf und gibt die regelrechte Antwort — — das ist ein Vorgang, bei dem wir uns gar nichts Besonderes denken, weil uns so etwas eben ganz geläufig ist. Im Grunde genommen aber liegt hier ein tiefes Rätsel vor.
Ebenso rätselhaft ist es, wenn man sich im Traume an Personen und Ereignisse erinnert, sie mit voller Naturtreue sieht, resp. noch einmal durchmacht, an die man im wachen Zustande gar nicht mehr gedacht hat, sie waren der Erinnerung schon längst entschwunden.
Hier im Traume, sagen die Theoretiker, arbeitet das zweite, das unbewusste Ich.
Wie nun bei jedem Menschen dieses unbewusste Ich nur im Schlafe zum Erwachen kommt, so gibt es Personen, bei denen es sich auch im wachen Zustande betätigt. Allerdings fallen auch diese dann oft in einen Schlaf, der dann ein magnetischer oder Trance genannt wird. Jedenfalls aber haben alle diese Personen, Fakire wie Medien, etwas Anormales, etwas Krankhaftes an sich. Auch diese Frau war trotz ihrer scheinbaren Gesundheit plötzlich in Krämpfe gefallen.
»Man muss an eine Gedankenübertragung glauben können«, suchte Kienock weiter zu erklären. »Wenn wir nicht dazu aufgefordert worden sind, einen Geist herbeizuwünschen, so ist doch ganz selbstverständlich, dass wir uns, während wir um den Tisch herumsitzen, mit solchen Gedanken beschäftigen. Das Medium empfindet unsere Gedanken, diese gehen auf sie über. Und zwar stets der am stärksten gedachte Gedanke, was sie ja oft genug ausgesprochen hat, nur mit anderen Worten, ihrem eigenen Glauben angepasst. Karlemann, haben Sie nicht recht lebhaft an Emil Nauke gedacht?«
»Ja«, gab dieser zu, hütete sich aber, zu gestehen, dass er selbst die ersten Klopftöne hervorgebracht hatte.
»Sehen Sie. Diese Gedanken gingen auf das Medium über, und weil diese Frau nun einmal bedingungslos an die Existenz von Geistern glaubt, meldete sich auch sofort der angebliche Geist unseres kleinen Freundes durch Klopftöne...«
»Und wie brachte sie diese Klopftöne hervor?«, fragte Jansen.
»Durch ihre psychische Kraft.«
»Wollen Sie mir noch etwas näher erklären, wie das möglich ist, durch die Kraft des Willens oder der Seele solche Klopftöne zu erzeugen?«
»Das kann ich nun freilich nicht«, meinte Kienock achselzuckend.
»Und das nennen Sie überhaupt eine Erklärung?«, lachte Jansen spöttisch. »Nein, da glaube ich doch lieber ganz einfach an Geister.«
Das ist es! Jansen hatte im Namen aller gesprochen, welche aus dem Spiritismus eine Religion machen.
Ja, es gibt eine erklärende Theorie, aber die ist so kompliziert, spielt erst recht so auf das Gebiet des Übersinnlichen oder Übernatürlichen hinüber, dass man besser dabei wegkommt, alles den ›lieben Geistern‹ in die Schuhe zu schieben, jede richtige Geistererscheinung sowohl wie das unschuldige Tischrücken.
»Und doch kann ich Sie vielleicht überzeugen, dass hierbei keine Geister im Spiele sind«, nahm Kienock wieder das Wort.
»So tun Sie es doch.«
»Zunächst ist uns nichts anderes mitgeteilt worden, als was nicht wenigstens einer von uns selbst gewusst hätte. Hätten wir etwas gefragt, was wir nicht selbst gewusst, so hätte uns der Geist auch nicht antworten können...«
»Sie glauben also, abgesehen von den unerklärlichen Klopftönen, an eine Gedankenübertragung oder ein Gedankenlesen?«
»So ist es.«
»Wenn ich also an eine Person lebhaft denke, von der ich bestimmt weiß, dass sie noch lebt, ich aber bilde mir mit aller Kraft ein, sie sei schon gestorben, und ich wünsche ihren Geist zu sprechen — so würde sich dieser wirklich durch Klopftöne anmelden?«
»Das ist es, was ich Ihnen eben vorschlagen wollte! Denn dadurch bin auch ich zur Überzeugung gelangt, dass alles nur Gedankenübertragung ist, ein unbewusster Betrug des Mediums.«
»Sie haben ein derartiges Experiment schon einmal gemacht?«
»Ich war wenigstens zugegen, als ein solches gemacht wurde.
Auch ich war einst ein gläubiger Spiritist, versäumte keine Sitzung, die mir zugänglich war. Einmal wohnte ich einer solchen in Berlin bei. Es kamen kleine Materialisationen vor, hauptsächlich aber arbeitete das Medium ebenfalls in Klopfen. Alle verstorbenen Personen, die nur gewünscht wurden, meldeten sich, standen Rede und Antwort. Ich hatte meine vor kurzem verstorbene Mutter zu sprechen begehrt, sie kam, teilte mir Sachen mit, die nur sie und ich wissen konnten. Mit solchen Theorien gab ich mich damals gar nicht ab, ich war eben ein bedingungsloser Geistergläubiger. Soll man da das auch nicht werden?
Unter den Teilnehmern befand sich nun ein Franzose. Ich weiß seinen Namen noch recht gut — er war als Monsieur de Pailleterin vorgestellt worden. Kennen Sie diesen Namen?«
»Nein, gänzlich fremd.«
»Dieser Franzose, welcher ziemlich gut Deutsch sprach, wünschte seine Frau zu zitieren, die erst vor zwei Wochen gestorben war. Gut, ihr Geist meldete sich — Alice war ihr Vorname — der Herr unterhielt sich mit ihr, beim Abschied gab sie dem Gatten auf, die Kinder von ihr zu grüßen. Und nachdem dies geschehen war, erhob sich der Franzose: ›Da sehen Sie, was von dem ganzen Spiritismus zu halten ist! Meine Frau lebt, ist hier in Berlin im Hotel, ich habe mir ihren Tod nur eingebildet.‹
Aber nun will ich gleich sagen: ich selbst habe dieses Experiment später wiederholt vergebens nachzuahmen versucht. Wenn ich mir einbildete, eine noch lebende Person sei gestorben, ich wünschte den Geist zu sprechen, so bekam ich doch nie ein Zeichen. Das machte, meine Phantasie reichte dazu nicht aus. Ein Hintergedanke, dass dies ja alles gar nicht wahr sei, ist doch immer dabei, und das genügt schon, um den Erfolg aufzuheben. Wissen Sie nun, wer dieser Monsieur de Pailleterin gewesen ist?«
»Nun?«
»Kein anderer als der berühmte Romancier Alexandre Dumas.
Der heißt eigentlich de Pailleterin. Dumas ist nur sein Pseudonym.«
»Und warum soll das Experiment nun gerade dem gelungen sein?«
»Weil es eben Dumas war, der Dichter mit glühender Einbildungskraft. Dumas gehörte oder gehört noch zu jenen Schriftstellern, welche beim Schreiben weinen, lachen, fluchen und toben, je nach dem, was sie gerade schildern. Sie erleben alles in Wirklichkeit mit. Das soll ja den echten Dichter ausmachen, wie den echten Schauspieler, und nicht umsonst beschließen so viele Schriftsteller und Schauspieler ihr Leben im Irrenhause. Sie können zuletzt Phantasie und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden. Und dass sich ein Dumas den Tod seiner Frau oder sonst einer Person so lebhaft vorstellen, sich alle Einzelheiten ausmalen konnte, bis er selbst daran fest glaubte, das vermag ich zu begreifen.«
»Ja, ich auch. Sollten wir so etwas aber nicht auch fertig bringen?«
»Wir können noch einmal probieren. Ich habe mir unterdessen überlegt, dass es vielleicht auf andere Weise gelingt.«
»Auf welche?«
»Indem alle Teilnehmer zugleich an den eingebildeten Tod einer noch lebenden Person denken, und dem Ganzen muss eine dramatische Handlung zugrunde gelegt werden.«
»Wie meinen Sie das?«
Kienock blickte nach der Frau, welche noch immer schlafend auf dem Polster lag.
»Nicht hier, sie könnte es doch hören.«
Die sechs Männer, wozu wir auch Karlemann rechnen wollen, begaben sich in einen anderen Raum. Hier eröffnete Kienock seinen Vorschlag, den wir durch die Ausführung erfahren werden.
»Gut!«, sagte Jansen nach der längeren Auseinandersetzung. »Machen wir das. Es fragt sich nur, ob diese Frau noch willens oder imstande ist, die Sitzung fortzusetzen.«
»Dann besorgen wir eben ein anderes Medium, es gibt deren ja noch genug.«
»Sie meinen, wir sollen uns die Einbildung, oder wie man es nun nennen mag, schon jetzt einüben?«
»Jawohl, und das um so mehr, als dieses Medium ja doch vielleicht die Sitzung fortsetzen kann.«
Es wurden zwei Matrosen, welche man für die intelligentesten hielt, in die Offiziersmesse gerufen, Ernst und Oskar.
Kienock machte ihnen klar, was man von ihnen verlangte, und die beiden Burschen begriffen schnell genug; mit verhaltenem Lachen willigten sie ein, dass Oskar scheinbar seinen Kameraden ermorde, ihm von hinten das Messer in das Herz stoße.
Diese dramatische Szene wurde sofort ausgeführt, und die beiden Matrosen zeigten sich als geborene Schauspieler, sie brauchten gar keine weitere Anleitung.
Ernst saß auf einem Stuhle und las, da kam Oskar zur Tür herein, ein Stutzen, ein wildes Augenrollen, das Schiffsmesser heraus, mit verzerrtem Gesicht schlich Oskar heran und stieß dem anderen scheinbar das Messer in den Rücken.
»Da, du Lump, weil du mien Diern verführt hast.«
Ernst stürzte vom Stuhle, röchelnd wälzte er sich am Boden, richtete sich noch einmal auf, schüttelte die Faust nach dem Mörder, und dann tat er seinen letzten Seufzer.
»Ausgezeichnet gemacht!«, sagte Kienock. »Haben die Herren genau beobachtet?«
Ja, das hatten sie. Niemand hatte auch an ein Lächeln gedacht.
»Wollen wir das noch einmal wiederholen?«, fragte Jansen.
»Lieber nicht. Jede Veränderung nur der kleinsten Bewegung könnte auf die Einbildungskraft störend wirken. Aber noch etwas anderes. Wissen die Herren, wie Ernst mit Vatersnamen heißt? Aber nicht sagen, Ernst!«
»Nee, ick bin tut«, sagte zunächst der noch am Boden Liegende. Nein, niemand kannte seinen Vatersnamen.
»So nenne ihn, Ernst — aber nicht deinen richtigen, irgendeinen anderen. Verstehst du, Ernst?«
»Jawoll, als ick noch leben deit, tat ick Hase heeßen.«
»Also Ernst Hase. Hast du sonst noch andere Vornamen?«
»Jawoll, Fürchtegott Nebukadnezar Ernst Hase.«
»Fürchtegott Nebukadnezar Ernst«, wiederholte Kienock. »Bitte, meine Herren, nicht lächeln! Fürchtegott Nebukadnezar Ernst. Und wann bist du geboren? Irgend einen Datum.«
»Am 30. Februar 1473.«
»Halt, keinen Unsinn! Du bist am 29. Februar 1846 geboren, nicht wahr? An einem Schalttage.«
»Jawoll.«
»Also am 29. Februar 1846. Es ist tatsächlich ein Schaltjahr. Haben es sich die Herren gemerkt?«
Das vorbereitete Theaterstück war beendet, und gleichzeitig meldete der Steward, dass die Frau erwacht sei.
Die Herren kehrten in die Kajüte zurück, Mrs. Nightingale zeigte sich etwas verlegen, sie gestand, das sie öfters von Krämpfen befallen würde, was aber sonst gar keinen Einfluss auf ihre Gesundheit habe. Im Gegenteil, von den Krämpfen selbst wisse sie gar nichts, und aus der nachfolgenden kurzen Ohnmacht erwache sie stets wie neugeboren — etwas, was man so oft bei Medien und überhaupt bei hysterischen Personen findet. Sonst aber erklärte sie sich sofort bereit, die unterbrochene Sitzung wieder aufzunehmen.
Also die Herren gruppierten sich wieder um den Tisch, konzentrierten ihre Gedanken auf die Ermordung jenes Matrosen, wünschten seinen Geist zu sehen.
Es dauerte ziemlich lange, dann polterte es im Tisch.
»Mein Schutzgeist, meine Nancy!«, sagte das Medium, vergnügt wie zuvor.
Der Schutzgeist kam nur, um einen Neuling aus der vierten Dimension anzumelden.
»Wie heißt er? A — b — c — d — e — f — g — h — —«
Bum.
»A...«
Bum!
Diesmal ging es bis zum s, dann bis zum e, und der Name Hase war fertig.
»Kennt einer der Herren einen Verstorbenen namens Hase?«
»Jawohl«, entgegnete Jansen, »ein Matrose von mir, er starb eines rätselhaften Todes.«
»Sein Geist ist da, setzen Sie sich mit ihm in Verbindung.«
»Hase, bist du es?«
Der Geist fing, wie es die Anwesenden erwarteten, sofort zu erwachen an, bejahte zunächst.
»Wie heißt du mit Vornamen?«
»Ernst«, wurde geklopft.
»Hast du noch mehr Vornamen?«
»Fürchtegott, Nebukadnezar«, kam es prompt zur Tischplatte heraus.
»Wann bist du geboren?«
»Am 29. Februar 1846.«
»Wie starbst du?«
»Ich bin ermordet worden.«
»Von wem?«
»Von Oskar.«
»Von meinem Matrosen Oskar?«
»Ja.«
»Wie hieß dieser mit Vatersnamen?«
Es kam keine Antwort, dagegen wurde das Medium sehr unruhig, erblasste, stöhnte wie unter Schmerzen.
»Es kommt häufig vor, dass Spirits die einfachsten Dinge vergessen, dann quälen sie sich, und das quält auch mich«, erklärte sie, wie sie wohl für alles eine Erklärung wusste, ohne sich dadurch eines bewussten Betruges schuldig zu machen.
»Wie hat Oskar dich ermordet?«, fragte Jansen weiter.
»Er hat mir ein Messer in den Rücken gestoßen.«
»Weswegen?«
»Wegen eines Mädchens.«
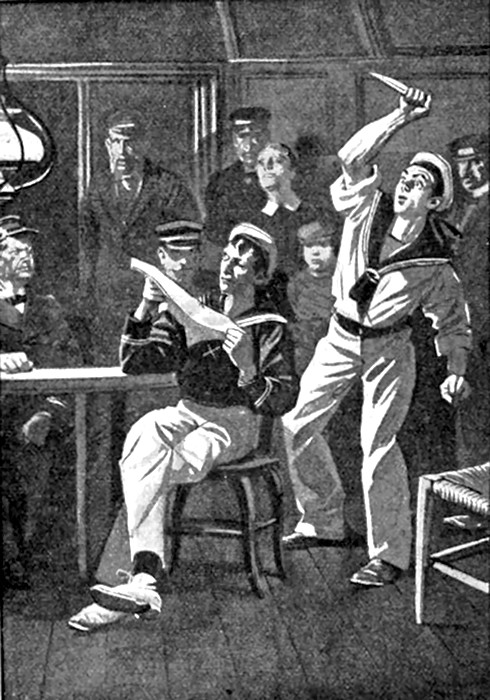
»Es ist genug, ich bin kuriert«, sagte Jansen, zog die Hände zurück und stand plötzlich auf, zur Verwunderung des Mediums. Aber er ließ sich auf keine weiteren Erklärungen ein, fragte, was er schuldig sei und zahlte der Frau die verlangten zehn Dollar.
»Das Rätsel, wie das Klopfen zustande kommt, bleibt bestehen«, sagte Jansen nur noch zu seinen Offizieren, »ebenso, wie das Medium unsere Gedanken lesen kann und anderes mehr. An Somnambulismus habe ich überhaupt immer geglaubt, aber von den Geistern bin ich ein- für allemal kuriert, und nie wieder will ich mit dem Spiritismus etwas zu tun haben.«
So sprach Jansen. Er ahnte nicht, dass das Schicksal ihn in dieser Hinsicht bald auf eine ganz andere Probe stellen würde.
Die ›Sturmbraut‹ hatte den Hafen von New York verlassen, ohne aufgehalten worden zu sein. »Fahre wohl und komm nie wieder!« In drei Wochen durchkreuzte sie den Atlantischen Ozean und passierte unter den englischen Kanonen die Straße von Gibraltar, aber wohlweislich bei Nacht, wie Jansen seinem Schiffe auch wieder ein Maskenkostüm angelegt hatte und beim Signalwechsel oder bei Aufforderung durch ein Kriegsschiff einen falschen Namen angab.
So befand man sich jetzt im Mittelländischen Meer. Dieses, welches nur
einen schmalen Ausgang besitzt, eben die Straße von Gibraltar — am Suezkanal wurde damals noch gebaut — kann man ja mit einem Binnenmeer vergleichen, es ist auch ziemlich belebt; aber das Mittelmeer ist doch immerhin so groß, dass man Tage segeln kann, ohne ein anderes Schiff zu erblicken, auch im Mittelmeer ist bewiesenermaßen die Mannschaft so manches Seglers bei anhaltender Windstille verdurstet oder doch dem Verschmachtungstode nahe gewesen — was selbst in der Nordsee mehrmals passiert ist — und zudem ist die Straße von Gibraltar doch immerhin so breit, dass zu ihrer erfolgreichen Absperrung eine ganze Flotte notwendig wäre. In eine Falle hatte sich die ›Sturmbraut‹ also nicht etwa begeben.
»Passt auf, jetzt geht's nach Venedig! Dort wollen wir uns wieder das Le
ben schön machen«, sagten die Matrosen, denen der damals am Ruder stehende Mann berichtet, wie der Käpt'n dem ersten Steuermann seine lustigen Abenteuer in Venedig erzählt hatte, wie er dann auch in so eigentümlicher, wilder Weise gefragt hatte, warum er denn sein junges Leben nicht mehr genießen solle.
In New York hatte man von dieser Absicht freilich nichts gemerkt. Da
hatte er, wie gesagt, sein Schiff mit keinem Schritte verlassen, auch nichts an Bord genommen, mit Ausnahme von gutem Proviant.
Der Käpt'n wollte eben nach Venedig, oder sonst nach einem italieni
schen Hafen, wohin ihn die schönen Erinnerungen am stärksten zogen, und wo es doch auch viel lustiger zugeht als in New York.
So disputierten die Matrosen in der Foxel. Sie mussten doch ihre Unterhaltung haben. Und nicht viel anders ging es in der Offiziersmesse zu. Es war eben eine wilde Reise, bei der das unbekannte Ziel immer das Hauptthema abgibt.
Eine ›wilde Reise‹ hat aber nichts mit Wildheit zu tun, etwa gar mit Piraterie oder dergleichen abenteuerlichen Unternehmungen. In jedem größeren Hafen der Erde, also auch in Hamburg und Bremen, werden täglich Mannschaften zum Antreten einer ›wilden Reise‹ angemustert.
Es gibt zwei Formen der Anmusterung, das heißt zweierlei Arten von Kontrakten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf See. Entweder wird für Fall zu Fall angemustert, das heißt von Hafen zu Hafen und zurück, sodass die Abmusterung stets im Heimathafen stattfindet, woselbst der Matrose das volle Gehalt für die ganze Hin- und Herreise ausgezahlt bekommt, oder er wird für eine wilde Reise auf Zeit angemustert, auf zwei, drei und noch mehr Jahre.
Das sind dann die Schiffe, welche kein bestimmtes Ziel haben. Nun ja, das erste. Es geht von Hamburg etwa nach New York; hier wird die mitgenommene Fracht gelöscht, der Kapitän erhält Anweisung, durch Agenten oder von seiner Reederei, demnach telegrafisch, was er hier einzukaufen und wohin er sich zu wenden hat, und das geht so immer weiter, bis der Kontrakt mit den Matrosen abgelaufen ist, worauf diese entlassen oder neu angemustert werden müssen.
Das Merkwürdige ist, dass die Mannschaft bis zum ersten Offizier hierbei niemals das Ziel erfährt. Das mag damit zusammenhängen, dass eine derartige Reise eine Art Spekulationsgeschäft ist, es heißt, den Konkurrenten im unklaren zu lassen, um ihm zuvorzukommen. Aber diese Geheimnistuerei wird auch eingehalten, wenn sie gar nicht nötig ist. Das ist den Seeleuten in Fleisch und Blut übergegangen, gehört mit zur Bordroutine. Es wird für hohe See angemustert und damit basta. Und die Bordroutine ist ein wohlgeregeltes Anstandsgesetz, welches geschrieben ein dickes Buch ausfüllen würde. Aber es ist ungeschrieben, seine Paragrafen sind für jeden Seemann selbstverständlich. Wenn ein Steuermann fragen wollte: »Hören Sie, Herr Kapitän, wohin segeln wir eigentlich?« — Das wäre ebenso ungeheuerlich, als wenn man einen Herrn, von dem man als Neuling angestellt wird, gleich über seine intimsten Geschäftsgeheimnisse befragen wollte.
Diese Auseinandersetzung war nötig, um zu erklären, wie Jansen seine Leute so über sein nächstes Ziel im Unklaren lassen konnte. Er war ganz derselbe wie früher, verkehrte mit seinen Matrosen kameradschaftlicher, als sonst auf Schiffen üblich ist — aber auch nur seinem ersten Steuermann das beabsichtigte Ziel zu nennen, das wäre ein Verbrechen gegen die Bordroutine, gegen jeden Seemannsanstand gewesen. Wenn Grund dazu vorhanden war, ja, warum denn nicht, aber nur nicht so ohne Weiteres!
So ging es durch das Mittelländische Meer, immer in östlicher Richtung.
Die Küste von Algier hatte man hinter sich, ohne sie in Sicht bekommen zu haben, als auf der Höhe von Ras Addar, dem nördlichen Kap von Tunis, Jansen einen direkt südlichen Kurs einschlagen ließ, und bald segelte die ›Sturmbraut‹ an der östlichen Küste von Tunis entlang, durch die große Bucht gebildet, an dieser Stelle Golf von Kabes genannt.
Sie ist trostlos, diese tunesische Küste, und dennoch großartig. Das Gebirge tritt bis dicht an das Meer heran, völlig nackt, ohne die geringste Vegetation, wild, zerrissen, und in den ausgewaschenen Höhlen tost furchtbar die Brandung.
Ab und zu in einer geschützten Bucht eine kleine Ansiedlung von weißen Häuserchen und Hütten mit spärlichen Dattelbäumen.
Die arabischen Bewohner fristen ihr Leben ausschließlich durch Fischfang, hoffen auf antreibendes Strandgut von gescheiterten Schiffen, wobei sie es hauptsächlich auf Brennholz abgesehen haben, und nebenbei wird Seeräuberei getrieben.
Aber da kommen doch nur kleine italienische und griechische Feluken in Betracht, welche von diesen armseligen Hafennestern noch angelockt werden können, mit ihnen Handel zu treiben, größere Schiffe verirren sich nicht hierher, das Wasser ist ihnen auch zu gefährlich.
Dann tauchte vor der ›Sturmbraut‹ eine ansehnliche Insel auf, hinter der sich noch andere zeigten — nackte Felseneilande, wie man schon jetzt durch das Fernrohr erkannte.
»Die Gruppe der Kerkenainseln«, sagte der wachegehende Martin zum ersten Offizier, der seine Freizeit auf der Kommandobrücke verbrachte.
Auf der speziellen Seekarte war diese ganze Inselgruppe mit warnenden Kreuzen umgeben, ferner verkündete noch ein besonderes Zeichen, dass hier totes Wasser war.
Es gibt auf dem Meere und besonders an den Küsten Gebiete, gewöhnlich nur ganz kleine, wo das Schiff plötzlich nicht mehr dem Steuerruder gehorcht. Das Rad lässt sich spielend leicht hin und her bewegen, aber das Schiff treibt, wie es will, gerade als wenn am Steuerapparat etwas gebrochen wäre, was aber nicht der Fall ist, und dann mit einem Male funktioniert das Steuer wieder.
Da dieses gefährliche Phänomen hauptsächlich an Flussmündungen auftritt oder im offenen Meere dort, wo auf dem Grunde süße Wasserquellen hervorbrechen, so wird es daher kommen, dass das leichtere Süßwasser und das schwerere Salzwasser verschiedene Schichten bilden, womöglich auch noch nach verschiedenen Richtungen fließend, wodurch das Ruder ohnmächtig wird.
Diese Theorie wird aber dadurch hinfällig, dass dann bei Flut wohl alle Flussmündungen in Betracht kommen müssten, was nicht der Fall ist; diese Erscheinung zeigt sich glücklicherweise sogar nur sehr selten, fast nur bei den westafrikanischen und einigen mexikanischen Flüssen, und dann auch nicht immer, nur zu gewisser Zeit, die man nicht berechnen kann, und dann weiß man mitten im Meere viele süße Quellen, wo die verschiedenen Wasserschichten nachgewiesen werden können, und das Phänomen des ›toten Wassers‹ zeigt sich doch nicht.
Kurz, die Wissenschaft steht hier noch vor einem Rätsel. Hierüber unterhielten sich die beiden Steuerleute, in der Naturwissenschaft doch schon obligatorisch ziemlich gebildet; jeder vertrat seine eigene Ansicht, als Jansen aus dem Kartenhaus kam.
»Ja, es mag jeder recht haben, aber in der Umgegend dieser Kerkenainseln oder zwischen ihnen gibt es gar kein totes Wasser.«
»Es steht aber hier auf der Seekarte angegeben.«
»Das ist ein Irrtum. Die Araber nennen diese Inseln Lomi el Gehna, das ganze Wasser Moia el Gehna, das ist die Insel respektive das Wasser des Teufels oder des Todes, daraus haben die Franzosen l'eau de mort gemacht, das ist den Geografen zu Ohren gekommen, die haben die Bezeichnung ›totes Wasser‹ in seemännischem Sinne eingetragen, ohne die Gegend untersucht zu haben. Nein, solches totes Wasser, wo das Ruder wirkungslos wird, gibt es hier gar nicht.«
»Weshalb haben dann die Araber diese Bezeichnung gebraucht?«
»Die Kerkenainseln gelten den hiesigen Bewohnern für den Aufenthalt des Teufels oder des Todes, alles Lebendige, was in die Nähe dieser Inseln kommt, muss sterben. Den Anlass zu dieser Fabel mag die Tatsache gegeben haben, dass in der Umgegend dieser Inseln so viele Fische sterben. Vielleicht eine unterirdische Quelle, welche die Umgegend vergiftet. Die Araber haben nun gleich die Fabel ersonnen, dass sich hier zwischen den Kerkenainseln die Geister aller derjenigen aufhalten und ihr Wesen treiben, welche den Tod im Meere gefunden haben. Es ist eine gefeite Stätte, oder vielmehr sie wird wie die Pest, wie die Hölle gemieden.«
»Sind Herr Kapitän schon einmal hier gewesen?«, erlaubte sich Mahlsdorf zu fragen.
»Nein, noch niemals.«
Woher war ihm da dies alles bekannt, wenn es auch nicht in den nautischen Büchern stand? Jansen hatte ein ziemlich dickes Buch in der Hand, den Finger zwischen den Seiten, jetzt hob er es und schlug es auf. Mahlsdorf tat zufällig einen Blick hinein, es war geschrieben, und sofort erkannte Mahlsdorf die steile Handschrift Tischkoffs.
»Ich werde diese Kerkenainseln aufsuchen, sie sind mein Ziel!«, wurde jetzt Jansen zum ersten Male über dieses etwas mitteilsamer, ohne aber vorläufig zu sagen, was er dort wollte.
Er gab einen anderen Kurs an, mehr westlich, die Inselgruppe kam wieder außer Sicht, dafür tauchten an der gelben Küste bald die weißen Häuserchen eines arabischen Hafens auf, auf der Karte als Sfaks bezeichnet, sonst ohne jede Bedeutung für den Weltverkehr.
Einige Fischerboote warfen ziemlich weit draußen auf See ihre Netze aus. Die beturbante Besatzung wusste noch nicht recht, ob sie vor dem stattlichen Segler, der aber einen qualmenden Schornstein führte, fliehen sollte oder nicht, und seine Erscheinung war dazu angetan, auch unter der sonst so phlegmatischen Bevölkerung des Hafennestes Aufregung hervorzurufen. Die meisten der hiesigen Küstenbewohner hatten ja noch gar kein solch großes Schiff gesehen, geschweige denn einen Dampfer.
Aber sie waren doch eben Bewohner der Küste eines der befahrensten Meere, es gab doch unter ihnen welche, die als Seeleute schon in der Welt herumgekommen waren, deren Erzählung man lauschte, und deren Vorschlag war wohl zu danken, dass aus der Bucht alsbald einige jener uralten arabischen Segelfahrzeuge abgingen, Sambuk genannt, noch genau dieselben, wie die Araber vor Tausenden von Jahren hatten.
Jetzt zeigte das große Schiff durch Einreffen der Segel, dass man es tatsächlich auf dieses Hafennest abgesehen hatte, und nun begann erst recht ein Wettfahren mit Segeln und Riemen.
Man brauchte an keine Seeräuber zu denken. Die ›Sturmbraut‹ hatte auch gar keinen Dampf nötig, bei diesem frischen Winde segelte sie alles über den Haufen, das mussten auch diese seekundigen Araber wissen. Sie kamen einfach als Bettler, vielleicht wollten sie auch Fische verkaufen, im übrigen diesem Schiffe eben einen Besuch abstatten.
Die ersten Boote hatten die ›Sturmbraut‹ erreicht, ein allgemeines Geschnatter, wahrscheinlich wurde um Taue gebeten, an denen man das Deck erreichen konnte, was es aber nicht gab.
»Spricht jemand von euch Englisch oder Französisch?«, überschrie Jansen den Tumult.
»Moi, moi, moi, moi aussi!!«, erklang es aus vielen Booten.
Der französische Einfluss ist in diesen Gegenden doch eben gar groß, noch in den entferntesten Winkeln wird Französisch gesprochen.
Ein älterer Araber in schmutzigweißem Kaftan, der sich durch einen mächtigen Turban und durch einige schöne Pistolen und Dolche im Gürtel auszeichnete, hatte sich durch gebietende Handbewegungen endlich Ruhe verschafft.
»Ich bin der Scheich el Belle«, rief er hinauf, »und wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, so können Sie es mir mit mir.«
»Der Dorfschulze oder gar der Bürgermeister dieses Raubritternestes — vortrefflich — und er spricht Französisch! Kommen Sie an Bord!«
Das Fallreep ward hinabgelassen und Sorge dafür getragen, dass außer dem Scheich kein anderer mit heraufkam. Jansen ordnete an, dass unter die Insassen der Boote Tabak, Kaffeebohnen, Hartbrot und, wenn sie es annahmen, auch ein Fass Salzfleisch verteilt würde, auch Zucker und noch mehr Salz waren wohl angenehm, und dann empfing er den Scheich in der Kajüte.
Dieser berührte unter fortwährenden Verbeugungen mit der Hand Brust, Mund und Stirn und legte los:
»Salem aleikum, sellem aleina baraktat — begnadige mich mit deinem Segen — Allah sei mit dir und lasse deine Frau fruchtbar sein wie...«
Jansen kürzte die Begrüßung dadurch ab, dass er dem Scheich eine seiner längsten holländischen Zigarren überreichte, was auf dessen edlem Halunkenantlitz alsbald ein verklärtes Lächeln hervorzauberte.
»Allah lasse deinen Feinden Steine wachsen im Bauch«, musste er aber doch noch sagen, ehe er sich die lange Giftnudel an dem vorgehaltenen Streichholz anzündete.
Dann kauerte der Scheich mit untergeschlagenen Beinen auf einem Sessel dem Kapitän gegenüber. Die ›Sturmbraut‹ hatte gestoppt; auch wenn dies nicht der Fall, es wäre dem Scheich wahrscheinlich ganz gleichgültig gewesen. Hier auf diesem großen Schiffe war doch gut sein.
»Bist du ein Seeräuber?«, war dann seine erste Frage.
Jansen lächelte. Er wusste sofort die Erklärung für diese Frage.
Dieser Araber fasste das ja ganz anders auf, als die ›Sturmbraut‹ sonst betrachtet wurde. Bei dem war Seeräuberei ein ganz ehrlicher Beruf.
»Weshalb glaubst du, dass ich ein Seeräuber sei?«
»Ja, weshalb kommst du sonst hierher?«
»Und wenn ich nun ein Seeräuber wäre und deine Stadt plündern wollte?«
»So würde ich dir raten, es nicht zu tun, dich nicht erst zu bemühen, nicht deine Zeit zu vergeuden, dein schönes Schiff nicht am Strande in Gefahr zu bringen. Denn in Sfaks, dessen Regierung Allah in meine Hände gegeben hat, würdest du nichts finden, was des Mitnehmens wert ist oder was sonst deine Sinne erfreuen könnte. Sieh hier meine Hand, meinen Arm, mein Bein, wie mager meine Gliedmaßen und mein ganzer Leib sind! Und ich bin noch einer der fettesten Männer in dieser Stadt. Hier sterben fast täglich Leute vor Hunger. In ganz Sfaks wirst du keine Unze Gold finden. Unsere Weiber sind klapperdürr, und auch die schönste unserer Töchter hat ein von Pocken zerfressenes Gesicht, und unsere Kinder haben die Dysenterie. Also, ich bitte dich, edler Fremdling, lass ab von dem Städtchen, dessen Untergang Allah schon beschlossen hatte, als er es in seiner Weisheit an die Grenze des toten Wassers verlegte.«
»Ich danke dir für deine gütige Warnung«, lächelte Jansen. »Aber ich beabsichtige auch wirklich nicht, hier einen Raubzug auszuführen. Ist denn hier ein solcher schon einmal vorgekommen?«
»Ja.«
»Wann?«
»Vor zwei Jahren.«
»Wie war das?«
Der Scheich erzählte. Ein französischer Kaper hatte diese arabischen Hafenstädte heimgesucht, aber der Scheich konnte nicht genug betonen, wie der Beutezug absolut keinen Zweck gehabt hatte. Mit Abscheu war der französische Freibeuter wieder davongefahren.
Dass solche Freibeuterzüge, von Privatpersonen ausgeführt, noch heute vorkommen, daran zweifelte Jansen nicht. Ach, was passiert nicht alles auf der Erde, was niemals in eine Zeitung kommt! Der aufgeklärte Leser würde so etwas doch gar nicht glauben, und wo kein Kläger ist, da ist bekanntlich auch kein Richter.
Sonst aber übertrieb der Scheich wohl seine Armut. Sehr dick war er allerdings nicht, aber in den Booten hatte Jansen ganz wohlgenährte, kräftige Gestalten erblickt, und auch die Pistolen und Messer des Scheichs waren recht reichlich mit Silber und selbst mit Halbedelsteinen ausgelegt. So strafte er sich selbst Lügen, was aber ein echter Araber gar nicht empfindet.
»Nein, ich bin kein Seeräuber.«
»Weshalb kommst du sonst hierher in das Gebiet der toten Wasser?«
»Ich bin ein Gelehrter, ein Forschungsreisender...«
»Ah! So kennst du auch meinen Freund, den Professor Gulliard?«
Jansen hörte den Namen eines damals bekannten Altertumsforschers, der besonders afrikanische Ruinen untersuchte.
»Hast du diesen Professor etwa einmal geführt?«
»Nein, ich habe ihm die Stiefel geputzt und hatte auch einmal die Ehre, ihm den Kaffee auf sein Zimmer zu bringen.«
Durch weitere Fragen stellte sich heraus, dass dieser jetzige Scheich in jungen Jahren in die Fremde gegangen war, auf französischen Schiffen Dienste genommen hatte, bis er in Marseille in einem Hotel Hausknecht geworden war. Dann hatte ihn das Heimweh gepackt, er war in seine einsame Geburtsstadt zurückgegangen, und hatte es dank seiner in der Fremde gesammelten Kenntnisse bis zum Scheich gebracht.
Dies alles erzählte der alte Araber mit Stolz, und er hatte ja auch durchaus keinen Grund, sich deshalb zu schämen, weil er einmal Stiefel geputzt hatte. Sonst wäre er jedenfalls auch nicht Bürgermeister geworden.
»Hier gibt es keine alten Ruinen.«
»Auf diese habe ich es auch nicht abgesehen, sondern ich will das Gewässer erforschen, welches ihr Moia el Gehna nennt.«
Ein erschrockener Blick auf den Sprecher, dann spuckte sich der edle Scheich schnell in die Hand und salbte damit seine Stirn ein — eine Art der Bekreuzigung bei den Mohammedanern.
»Allah il Allah, was willst du in dem Wasser, welches Gott verflucht hat?«
»Eben erforschen, weshalb dort alle Fische sterben.«
»Es ist die Dschehenna, die Hölle für alle die, welche als Ungläubige ihren Tod im Meere gefunden haben. Ich will dich nicht beleidigen, weil du ein Christ bist, aber es ist so — und es gibt ja auch genug ungläubige Mohammedaner, gerade unter denen, welche auf Schiffen fahren, wo sie dann vergessen, ihre täglichen Gebete zu verrichten. Auch diese müssen dort ihr Wesen treiben.«
»Auf welche Weise treiben sie dort ihr Wesen?«
»Als Geister müssen sie dort im Wasser bis in alle Ewigkeit alles noch einmal durchmachen, wie in jener Stunde, da sie im Meere ertranken, bei Schiffbruch oder als sie über Bord fielen.«
»Hast du schon einmal solch einen Geist gesehen?«
»Allah beschütze mich! — Wer diese Inseln betritt, nur in ihre Nähe kommt, der ist des Todes. Aber andere Fischer haben die Geister sich im Wasser winden sehen, die können davon erzählen.«
»Und diese Fischer sind lebendig geblieben? Wie kommt denn das?«
»Sie haben die vierzehnte Sure aus dem Koran gebetet, welche gegen böse Geister schützt.«
»So werde auch ich diese Sure beten.«
»Du bist ein Christ.«
»Auch wir haben Bannsprüche in unserer Bibel, ich werde sie anwenden.«
»Sie werden nichts nützen.«
»Weshalb nicht?«
»Die Fischer, welche von den unseligen Wassergeistern erzählen können, sind bei Sturm nur durch Zufall in das tote Wasser verschlagen worden; deshalb ließ Allah ihren Bannspruch wirksam sein. Aber wer freiwillig dieses Gebiet aufsucht, dem hilft keine Sure, der kehrt nicht wieder zurück.«
»Du meinst, er findet dort seinen Tod?«
»Er muss dort mit den Geistern auf dem Meeresgrunde tanzen.«
»Wohnt in dieser Stadt nicht ein Omar ben Jussuf, welcher stumm ist?«
Der Scheich riss vor Staunen seine Augen weit auf.
»Herr, warst du denn schon hier?«
»Nein.«
»Woher kennst du da diesen Mann, den Allah geschlagen hat?«
Jansen wusste nicht gleich eine Erklärung, er hätte überhaupt gar keine geben können, für ihn war selbst ein unergründliches Rätsel dabei, nämlich das mit Tischkoff verknüpfte, und so schlug er, während er nach einer Antwort suchte, mit dem Buche, welches er noch immer in der Hand hielt, spielend auf sein Knie.
»Du weißt es aus diesem Buche!«, sagte da der Scheich, scheu nach dem schwarzeingebundenen Buche blickend.
Mit einiger Überraschung bejahte Jansen. Die Erklärung sollte sofort kommen.
»Das ist das siebente Buch Mosis, welches das Geheimnis aller Geheimnisse enthält, nicht wahr?«
Wiederum war Jansen überrascht. Es wurde damals und schon seit langen Jahren, wie aber noch heute, in vielen Zeitungen ein Buch annonciert, das siebente Buch Mosis, geheime Rezepte enthaltend, Geisterbeschwörungen und dergleichen, strotzend von dem unsinnigsten Aberglauben, einfach eine Verlagsspekulation. Merkwürdig aber, welche Lebenskraft dieses Schundbuch hat! Es mag im Titel liegen.
»Du sagst es, es ist das siebente Buch Mosis«, entgegnete Jansen ohne Zögern und mit einiger Belustigung. »Woher aber kennst du denn dieses Buch?«
»Als ich in Marseille war, stand es in allen Zeitungen zu verkaufen, es kostete nur fünf Francs, und wer es kauft, der erfährt alle Geheimnisse des Himmels und der Erden, weiß alle vergrabenen Schätze und kann sie heben, kann alle Krankheiten heilen, kann sich alle Engel, Geister und Teufel untertänig machen.«
»Warum hast du es dir denn da nicht gekauft?«
»Ich habe es mir gekauft.«
»Nun, dann musst du doch auch alle Geheimnisse des Himmels und der Erden kennen.«
»Das Buch war versiegelt.«
Das stimmte, das Buch wird noch heute unter einem geheimnisvollen Siegelschutz verschickt.
»Das braucht man doch nur aufzubrechen.«
»Ja, dann kann man es aber noch immer nicht lesen. Lesen wohl, die Buchstaben — aber den Sinn versteht man nicht. Man kann die Geister beschwören, aber sie kommen nicht. Das Papiersiegel ist doch nur etwas Äußerliches, eine Andeutung, dass auch ein inneres Siegel gebrochen werden muss. Und wer das kann, der hat die Erleuchtung, die man auch zum Lesen des Korans haben muss, sonst stehen auch hier nur Buchstaben drin — der weiß dann alles, was sonst nur Allah weiß. Aber wie wenige Menschen wird es geben, die dieses Siegel brechen können!«
Es war gar nicht so dumm, was der ehemalige Stiefelputzer da sprach. Er wusste schon etwas von Symbolik. Deshalb war er auch Scheich geworden.
Doch weiter wollte sich Jansen nicht hierauf einlassen.
»Nun gut, in diesem siebenten Buche Mosis habe ich gelesen, dass ein Mann namens Omar ben Jussuf lange Zeit, fast einen Monat, auf diesen Geisterinseln zugebracht hat.«
»Das Buch des Propheten Mosis, den auch wir verehren, wenn auch weit unter Mohammed, spricht die Wahrheit«, entgegnete der Scheich, mit noch größerem Respekt nach Tischkoffs Schwarte blickend.
»Dieser Mann lebt in deiner Stadt.«
»Du sagst es.«
»Und du sagtest vorhin, es wäre noch niemand aus den Wassern des Todes lebendig zurückgekehrt. Wie reimt sich das zusammen? Denn dieser Mann ist nicht nach jenen Inseln verschlagen worden, sondern er hat sich freiwillig hinbegeben, um nach einem Wrack zu suchen, welches ihr vor sechs Jahren dort scheitern saht.«
»Omar ben Jussuf kehrte stumm und gelähmt zurück — ist das ein Leben? Er ist schon ein toter Mann.«
Auf diese Weise war der Scheich freilich nicht zu widerlegen.
»Wie war das mit dem Schiffbruch?«
»Fischer, welche in der Nacht auf dem Meere geblieben waren, hörten Kanonenschüsse. Sie näherten sich den Inseln, so weit sie das wegen des toten Wassers wagen durften, sie sahen die Lichter eines großen Schiffes, bis sie verlöschten. Der dort hausende Teufel hatte es in sein Reich hinabgeholt mit allen Menschen.«
»War es denn eine stürmische Nacht?«
»Durchaus nicht, die See war ganz ruhig.«
»Wie mag denn da das Schiff zugrunde gegangen sein?«
»Steht das nicht in deinem Buche?«
»Ja; aber ich will wissen, ob du es weißt.«
»Es wird ein Dampfer gewesen sein, denn die Schiffer sahen Funken sprühen. Die Nacht war stockfinster, da ist der Dampfer zwischen die Riffe gerannt.«
»Habt ihr niemals etwas von Schiffbrüchigen gehört?«
»Niemals. Wie sollten wir! Der Teufel hat die Lebenden, die in seinen Bereich gerieten, sofort zu sich hinabgeholt.«
»Und Omar ben Jussuf fuhr dann in seinem Boote hin, um nach dem Wrack zu suchen?«
»Er war so verwegen.«
»Einen Monat ist er dort gewesen?«
»Länger noch.«
»Hat mit Schleppnetzen gefischt?«
»Ohne etwas zu finden.«
»Was hat er sonst erzählt?«
»Er konnte nichts erzählen, Allah hatte ihn stumm gemacht, auf dass er nicht berichte, was er Fürchterliches geschaut.«
»Hat er nicht unterdessen eine Zeichensprache gelernt?«
»Was ist das, eine Zeichensprache?«
Wenn der Scheich das nicht wusste, brauchte ihm Jansen nicht erst eine Erklärung zu geben.
»Kann er nicht schreiben?«
»Nein.«
»Aber irrsinnig ist er nicht.«
»Ich weiß nicht. Er flicht von früh bis abends Matten, ohne einmal aufzublicken.«
»Wird er gefüttert?«
»Er bereitet sich sein Essen selbst.«
»Hole mir diesen Omar ben Jussuf hierher an Bord!«
Verwundert blickte der Scheich auf.
»Was willst du von ihm?«
»Er soll mir Näheres erzählen, wie es dort zwischen den Inseln aussieht.«
»Omar ist ja stumm.«
»Auch taub?«
»Nein, hören kann er.«
»So werde ich ihm die Zunge lösen.«
»Das kannst du?«
»Ja. Hole ihn!«
»Er ist lahm.«
»Aber er bewegt sich auf Krücken.«
Jansen wusste, warum der Scheich so lange zögerte, er nahm ein Goldstück aus der Tasche.
»Du erhältst zehn solcher Goldstücke, zehn Pfund Tabak und einen halben Sack Kaffee, wenn du mir den Mann schnellstens bringst.«
Ein Aufleuchten der Augen, der Scheich sprang auf und begann gleich zu rennen. Schon ein einziges Goldstück hätte genügt, aber es war eben Richard Jansen gewesen, der das Angebot gemacht hatte.
Er begab sich auf die Kommandobrücke.
»Entsinnen Sie sich, wie vor sechs Jahren der französische Dampfer › Renaissance‹ verschollen ist?«
Nein, die beiden Steuerleute hatten gar nichts von einem ›Renaissance‹ gehört. Der Schiffe sind gar zu viele, auch derer, welche niemals wieder einen Hafen erreichen, ohne dass man je etwas von ihrem Verbleib erfährt.
»Aber vielleicht von den Ausgrabungen, welche damals in den Ruinen von Karthago vorgenommen wurden?«
Ja, davon hatten sie gehört.
»Es wurden nach jahrelangem Bemühen viele Inschriften gefunden, selbst noch wohlerhaltene
Papyrusrollen, ferner Waffen, Hausgerätschaften, Münzen und anderes mehr, nicht nur für die Wissenschaft von unschätzbarem Werte. Der ›Renaissance‹ sollte die ganze Sammlung nach Frankreich bringen. Der Dampfer hat Marseille nie erreicht. Dort zwischen den Kerkenas hat er seinen Untergang gefunden.«
»Hat man ihn nicht heben oder wenigstens etwas bergen können?«, fragte Martin, der zweite Steuermann.
»Niemand hat berichten können, wo er gesunken ist, er muss mit Mann und Maus untergegangen sein, oder die sich auf die Klippen rettende Mannschaft konnte diese nicht verlassen, ist verhungert, verschmachtet.«
»Ja, woher ist denn da Ihnen diese Stelle bekannt?«, fragte Martin erstaunt.
Da machte es der Kapitän ganz ebenso, wie es sein Kommodore so oft getan hatte, wenn er gefragt worden war: er wandte sich etwas seitwärts und schwieg. Und Martin bekam vom ersten Steuermann wegen seiner naseweisen Frage einen tüchtigen Puff in den Rücken.
»Mister Tischkoff hat mir davon erzählt, es schriftlich in diesem Buche niedergelegt«, gab Jansen dann doch eine Erklärung, die freilich noch viel zu wünschen übrig ließ. »Arabische Fischer aus Sfaks beobachteten, wie eines Nachts zwischen jenen Inseln ein Schiff seinen Untergang fand. Von jenem französischen Dampfer ahnten die natürlich nichts, die waren auch gleich mit ihrer Geistertheorie bei der Hand. Der Teufel hatte das Schiff, das sich seinem Bereiche unvorsichtig genähert, vollends angelockt und zu sich hinabgezogen.
»So dachte auch keiner dieser mutigen Araber daran, nach dem Verbleibe des Schiffes oder Wracks zu forschen. Die Gespensterfurcht war größer als die Beutesucht. Nur ein einziger Bewohner von Sfaks schien anders zu denken, gespensterfester zu sein. Omar ben Jussuf hieß der Mann, der sich allein mit einem Boote aufmachte, um nach Strandgut zu suchen. Länger als vier Wochen ist er fortgeblieben, und als er zurückkehrte, hatte er die Sprache verloren. Der Mann hat ganz einfach Unglück gehabt, er kehrte auch nicht in seinem Boote zurück, sondern auf einigen zusammengebundenen Planken, er war zum Skelett abgemagert — er hat eben selbst als Schiffbrüchiger dort auf einer der völlig nackten Inseln hausen müssen, hat während der vier Wochen so viel der Leiden ausgestanden, dass er darüber die Sprache verlor.
»So konnte er auch nichts von seiner Leidenszeit erzählen, die Kunst des Schreibens versteht er nicht, von einer Taubstummensprache, die er sich während der sechs Jahre doch hätte aneignen können, wissen diese Araber hier ebenfalls nichts. Nun war aber für seine abergläubischen Landsleute auch ganz selbstverständlich, dass Omar Schreckliches geschaut habe, also Gespenster und dergleichen, worüber er vor Grauen die Sprache verloren — oder aber Allah habe ihn stumm gemacht, damit er eben nichts davon erzählen könne. Außerdem bekam er dann noch eine böse Gicht, die ihn vollständig lähmte — erst recht ein Zeichen, wie Allah den Frevler bestraft, der sich in das tote Wasser wagt, in dem der Teufel herrscht.
»Dieser Mann lebt noch. An ihn soll ich mich wenden, hat Tischkoff mir geraten. Ich weiß nach geografischer Bestimmung wohl genau die Stelle, wo der Dampfer gesunken ist, aber um mit der ›Sturmbraut‹ dorthin zu gelangen, wäre ein endloses Peilen und Loten nötig, während Omar diese ganze Gegend schon mit dem Fischernetz aussondiert hat, er kann uns als Lotse dienen.«
So, nun wussten die Offiziere, um was es sich handelte. Aber woher nun Tischkoff dies alles wusste, das erfuhren sie nicht, und das hätte ihnen wohl auch Jansen nicht sagen können.
Der Scheich kehrte in seinem Boote zurück und brachte einen ältlichen Araber mit, welcher mittels einer Schlinge an Deck gehievt werden musste. Von Schmerzen wurde er wohl nicht mehr geplagt, aber während sein Oberkörper und die Arme noch ganz normal, sogar muskulös waren, waren seine Beine bis auf die Knochen ausgetrocknet, sodass er sich nur auf Krücken fortbewegen konnte, lieber aber sich der Länge nach auf dem Leibe mittels der Arme fortschleifte.
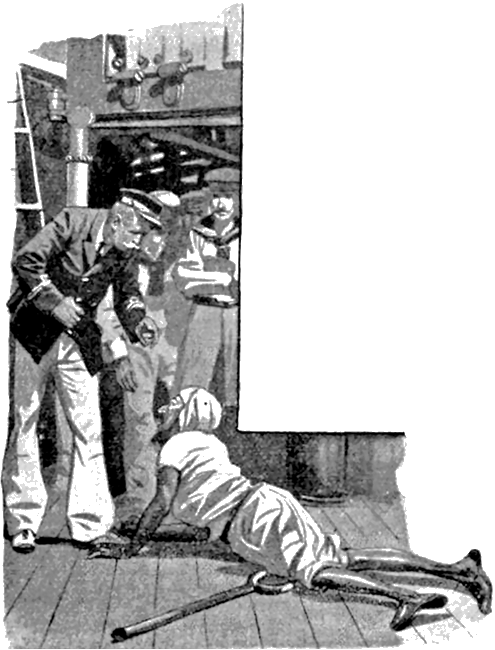
Der Scheich erhielt seine Prämie und wollte zum Danke dafür nochmals vor den Geistern des toten Wassers warnen, wurde aber baldigst von Bord gebracht.
Omar ben Jussuf war früher in einem größeren tunesischen Hafen Lotse gewesen, verstand Französisch und war auch sonst ein ganz intelligenter Mensch.
Indem Jansen immer die richtigen Fragen stellte, hatte er bald alles aus ihm herausgebracht, was er von ihm wissen wollte.
Es war so, wie Jansen seinen Offizieren erklärt hatte. Omar hatte damals die Stelle gefunden, wo der Dampfer gescheitert war, wozu er wenigstens acht Tage hatte suchen müssen, mit einem Schleppnetz, dann war er am Fieber erkrankt und war die meiste Zeit bewusstlos gewesen; nur dadurch, dass damals gerade die Regenzeit herrschte, war er auf der nackten Insel dem Verschmachtungstode entgangen; dann, als seine Lebenskraft wieder etwas zurückkehrte, hatte er, sein Boot vermissend, auf einigen zusammengebundenen Planken den Heimweg angetreten, halbverhungert, durch die Krankheit die Sprache verloren, dann auch noch gelähmt werdend und so ein für allemal davon kuriert, noch einmal solch eine Expedition nach dem gesunkenen Schiffe zu machen.
Aber den hundert Goldstücken, welche ihm Jansen anbot, konnte der Mann doch nicht widerstehen, und auf solch einem großen Schiffe war das ja auch etwas ganz anderes.
»Glaubst du, dass dieses Schiff bis an jene Stelle gelangen kann, ohne auf Grund zu geraten?«
Omar nickte. Er hatte ja die ganzen Gewässer zwischen den Inseln mit dem Schleppnetz erforscht, kannte alle Tiefen.
»In welcher Tiefe liegt das Wrack?«
Der Araber zeigte erst zwölf, dann vierzehn Finger.
»In einer Tiefe von zwölf bis vierzehn Metern?«
Ja.
»Hast du nicht auch Geister gesehen?«, fragte Jansen dann noch einmal scherzhaft.
Der Mann schüttelte verächtlich den Kopf, und die Reise nach dem toten Wasser konnte beginnen. —
Am anderen Tage zu derselben Zeit durchfuhr die ›Sturmbraut‹ mit Vierteldampfkraft die schmalen Wasserstraßen, welche die Kerkenainseln voneinander trennen.
Es sah trostlos hier aus. Niedrige Felseneilande, auf denen auch nicht ein Grashalm gedieh.
Es war gegen Mittag, als der auf der Kommandobrücke liegende Araber grunzende Laute ausstieß und mit dem ausgestreckten Arm deutete.
»Dort liegt das Wrack?«
Bejahende Bewegungen.
Jansen hatte soeben wieder eine geografische Ortsbestimmung nach der fürchterlich brennenden Sonne gemacht.
»Stimmt genau mit Tischkoffs Angabe«, sagte er dann.
Keine Planke verriet, dass hier ein großes Schiff gescheitert sei.
Freilich war das ja auch nun schon sechs Jahre her.
Die ›Sturmbraut‹ warf zwei Anker aus, welche Halt fanden, und wenn die Berechnung stimmte, so musste sie gerade über der gesunkenen ›Renaissance‹ liegen.
Vom Grunde war nichts zu erkennen. Wohl war das ruhige Wasser ziemlich klar, allein das Auge vermochte es doch nur wenige Meter zu durchdringen, dann wurde es finster, was wohl daher kam, dass der Meeresboden aus schwarzem Basalt bestand.
Zuerst versuchte man sich durch Hakenstangen zu orientieren, was sich dort unten wohl befände, allein da so gar nichts heraufbefördert wurde, musste man wohl gleich zum Tauchen übergehen.
Die Luftpumpe ward an Deck gebracht, Jansen selbst wollte tauchen. Es befand sich noch ein zweites Tauchkostüm an Bord, aber der Kapitän forderte niemanden auf, ihn zu begleiten.
Der Taucherhelm ward ihm festgeschraubt, vorn am Gürtel die brennende Petroleumlampe befestigt, die durch einen besonderen Luftschlauch gespeist werden muss, aber doch erst vom Tornister des Tauchers aus. Jansen kletterte schwerfällig das starke Fallreep hinab und verschwand langsam in dem finsteren Wasser.
In dieses finstere Wasser starrten nun mehr denn vierzig Augenpaare.
Es hat ja schon mit dem Tauchen eine ganz besondere Bewandtnis. Der Mensch ist eben kein Amphibium, und nun in solch einem panzerartigen Kostüm stecken, viele Meter, manchmal haushoch unter dem Wasserspiegel, von einem Luftschlauche abhängig sein, von den Armbewegungen der Arbeiter an der Luftpumpe — es ist ein grausiges Gefühl, und zwar nicht nur für den Taucher selbst — für den vielleicht noch weniger — mehr noch für den Zuschauer, welcher gar nichts zu wissen braucht von dem schrecklichen Ohrensausen und dergleichen, was alles der kolossale Wasserdruck erzeugt.
Umsonst wird der Taucher doch auch nicht so hoch bezahlt, hundert Mark und weit mehr noch pro Stunde, wobei er gar nicht unter Wasser zu arbeiten braucht. Schon der Rekrut in der Marine, der zum Taucher ausgebildet wird, bekommt für je fünf Minuten zwanzig Pfennig.
Ist es also schon für jeden mit nur etwas Phantasie begabten Zuschauer ein grausiges Gefühl, wenn er so einen Menschen in seiner Gummipanzerung in dem balkenlosen Wasser verschwinden sieht, zuletzt den unförmlichen Helm, so lag hier doch noch etwas ganz anderes vor.
Das tote Wasser! Von jenem toten Wasser, welches der Seemann fürchtet, hatte man hier nichts gemerkt, immer hatte die ›Sturmbraut‹ dem Ruder gehorcht. Auch tote Fische waren bisher noch nicht zu sehen gewesen, Omar wusste ebenfalls nichts davon zu erzählen.
Aber der echte Seemann fürchtet sich noch vor etwas anderem. Seit uralten Zeiten ist für ihn das Meer mit Gespenstern und Nixen und Kobolden aller Art bevölkert, zahllos sind die Märchen, die man sich in der Foxel darüber erzählt — dazu kommen noch der Klabautermann, der fliegende Holländer und andere Seegeister, böse wie gute — der Matrose sagt, er glaube nicht daran, das seien nur Ammenmärchen, er lacht darüber — und doch, er glaubt daran, das ist ihm eben in Fleisch und Blut übergegangen.
Und unterdessen war unter der ganzen Mannschaft bekannt geworden, was der Käpt'n seinen Offizieren berichtet, was für eine Bewandtnis es mit diesem toten Wasser haben solle, dass sich hier die Seelen aller im Meere Ertrunkenen als Geister ein Rendezvous gäben. Das war ja nur ein Märchen von diesen dämlichen Arabern, aber... auch diese Matrosen, die sich selbst für aufgeklärt hielten, glaubten nur zu gern an so etwas. Das Gruseln ist ja so schön, es liegt ein für allemal in der Natur des Menschen, der Schöpfer selbst hat es ihm hineingegeben.
So blickten sie jetzt also sämtlich mit starren Augen auf das finstere Wasser, dorthin, wo der Taucherhelm ihres Käpt'ns verschwunden war.
Dann konnten sie noch einige Meter weit den Lichtschein verfolgen, bis auch dieser verschwand.
Und dann starrten sie immer noch mit weit geöffneten Augen auf die dunkle Flut.
»Wenn er da unten nun welche sieht? Ob da unten auch unsere Kameraden von der Fucusbank sind?«
Das wurde nicht nur gedacht, sondern auch geflüstert, sogar laut gesagt.
»Schämt euch etwas, Kerls!«, ließ sich da Mahlsdorf vernehmen. »Ich glaube gar, ihr fürchtet Gespenster...«
Erschrocken brach er ab. Mahlsdorf hatte die Signalleine zu bedienen, und in diesem Augenblick, etwa fünf Minuten später, nachdem Jansen hinabgetaucht war, ward an ihr heftig gerissen, dass sie fast Mahlsdorfs Händen entglitten wäre.
»Hievt up!«
Ja, da musste etwas passiert sein! Nochmals wurde so heftig gerissen, und das war kein anderes Signal, als der Wunsch, so schnell wie möglich emporgezogen zu werden.
Also schleunigst das stärkere Tau heraufgezogen, welches Emporziehen der Taucher dadurch unterstützen kann, dass er im Helm und im ganzen Anzug die Luft sich ansammeln lässt.
Der Taucherhelm erschien, Jansens Hände tasteten über der Wasseroberfläche, und aus allem und jedem war sofort zu erkennen, dass ihm irgend etwas zugestoßen sein musste.
Er musste ganz die Besinnung verloren haben, er fand das Fallreep nicht, griff immer daneben, dann beim Emporsteigen, das mit außergewöhnlicher, sinnloser Hast geschah, verfehlte er immer die Sprossen, glitt aus, stürzte nochmals ins Wasser, glitt immer wieder aus, stürzte über die Bordwand und dann wollte er sich den Helm nicht abschrauben lasen, sondern ihn gleich losreißen.
Als man den Helm endlich abhatte sah man das sonst so gesunde, bronzefarbene Gesicht des Kapitäns aschgrau gefärbt, die Augen weit hervorgequollen, auch sonst verriet er alle Zeichen des Entsetzens.
»Um Gottes willen, Kapitän, was ist Euch, was ist passiert?!«, schrie Mahlsdorf.
Nur ein Stöhnen antwortete, dann schleuderte Jansen den Helm von sich und stürzte, so schnell ihm die schweren Bleisohlen erlaubten, der Kajüte zu, verschwand darin. Jetzt waren es die Matrosen und Offiziere, die sich nicht minder erschrocken anblickten.
»Er hat was gesehen — Geister.«
Kienock war der erste, der den lähmenden Schreck von sich abschüttelte.
»Unsinn, es gibt keine Geister und Gespenster! Ja, passiert ist ihm etwas dort unten, nur ein Gespenst ist ihm nicht begegnet.«
Der zweite, der seine Besinnung wiederfand, war Mahlsdorf.
»Ich muss ihn sprechen. Bleibt zurück, ich will allein hineingehen, er kann nichts weiter tun, als mich zurückweisen.«
Mahlsdorf begab sich in die Kajüte. Jansen saß, triefend wie er war, auf einem der Drehsessel, die Ellenbogen auf dem Tische, und stierte jetzt den Eintretenden an, als wäre auch dieser ein Gespenst.
»Um Gott, Kapitän, was ist Euch begegnet?«
»Blodwen, Blodwen!!«, erklang es ächzend.
»Was? Die Lady wollt Ihr im Wasser gesehen haben?«
»Und Darling — unser Kind — auf dem Arm — und sie winkte mir — komm, Richard, komm, du gehörst zu mir — so winkte sie.«
Und das brachte Jansen auf eine Weise heraus, dass auch den Steuermann eine Gänsehaut nach der anderen überlief.
Endlich raffte er sich zusammen.
»Ihr habt geträumt, Kapitän.«
»Geträumt, hahaha!!«
»Ihr habt eine Vision gehabt.«
»Eine Vision, hahaha!!«, erklang es nach wie vor unter einem schrecklichen Lachen.
»Ja, ja, Kapitän, so wird es schon sein. Ihr seid das Tauchen doch nicht so recht gewöhnt, und dreizehn Meter ist ja schon eine ganz beträchtliche Tiefe, da muss auch Euer Körper unter dem Wasserdruck leiden — Ohrensausen und Atemnot, dazu die Fabeln vom toten Wasser, die uns nun einmal suggeriert worden sind...«
»Ruft mir Kienock!«, wurde der Sprecher ungeduldig unterbrochen. »Kienock hat mir schon einmal die scheinbare Anwesenheit von Geistern auf natürliche Weise erklärt, er soll es auch diesmal tun.«
Der zweite Maschinist kam. Jansen hatte wenigstens etwas seine Ruhe wiedergefunden.
»Kienock, ich habe Lady Blodwen gesehen, mit dem Kinde auf dem Arme!«
»Unten auf dem Meeresboden? Es ist nicht möglich!«
»Wie ich Euch sage. Und fangt nicht etwa wie Mahlsdorf hier davon an, dass ich nur geträumt oder eine Vision gehabt hätte.«
»Wie war die Erscheinung?«, fragte Kienock ganz ruhig.
»Ich erreichte den Boden, fand richtig ein Wrack, den Rumpf eines Schiffes, soweit sich das beurteilen lässt. Denn alles ist mit Schlamm bedeckt, mit Muscheln überwachsen. Als ich noch so mit den Füßen herumstöbere, mich bücke und mit den Händen fühle, den Schein der Blendlaterne herumwandern lasse, da fällt der Lichtschein plötzlich auf eine Gestalt — es ist ein Weib — sie hat ein Kind auf dem Arm — und den anderen Arm hebt sie und winkt mir — winkt mir in einem fort...«
Neues Grausen bemächtigte sich des Kapitäns, ein Zittern ging durch seinen ganzen Körper.
»Ihr könnt nicht an eine Vision glauben?«, fragte Kienock sachgemäß wie zuvor.
»Nie, niemals!«
»Habt Ihr noch andere Gestalten gesehen?«
»Nein, nur diese eine.«
»Und es war Lady Blodwen?«
»Ja!«
»Woher wisst Ihr das?«
»Ich kenne doch Blodwens Züge!«
»Und es waren ihre Gesichtszüge?«
»Ganz genau dieselben!«
»Wie weit war die Gestalt von Euch entfernt?«
»Das lässt sich schwer beurteilen. Weiter als zehn Meter reicht der Blendstrahl ja nicht, und es war mir, als ob die Gestalt ganz im Hintergrunde stände. Und nun überhaupt meine Verfassung, als ich die Gestalt plötzlich erblicke...«
»Kapitän, da bin auch ich doch wie Mahlsdorf der Ansicht, dass Ihr nur eine Halluzination gehabt habt.«
Wie von einer plötzlichen Wut gepackt sprang Jansen auf, fasste den Maschinisten beim Arm und schüttelte ihn derb.
»Was, auch Ihr?! Und ich sage Euch, ich habe Blodwen mit diesen meinen Augen gesehen — mit dem Kinde auf dem Arme — und ihr goldenes Haar schwebte ihr nach — und sie winkte mir, winkte mir... und da soll ich eine Halluzination gehabt haben? Hahahaha!!«
Er gab Kienock wieder frei, der sich ruhig hatte abschütteln lassen. Erschöpft sank Jansen auf den Stuhl zurück.
»Wie lange hat die Erscheinung gewährt?«
»Ich war es, der sich entfernte.«
»Wie lange habt Ihr die Erscheinung betrachtet?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht nur einen Augenblick, der aber für mich eine Ewigkeit währte. Stellt Euch nur meine Empfindungen vor, wie ich da plötzlich Blodwen vor mir stehen sehe, mit ihrem goldenen Haar, das Kind auf dem Arme, das ebenfalls dort in der Fucusbank seinen Tod gefunden hat — und sie blickt mich mit ihren geisterhaften Augen an — und sie winkt mir, winkt mir — was Wunder, wenn ich da, von Entsetzen gepackt, an der Signalleine riss. Ich bin doch auch nur ein Mensch, der als Kind ebenfalls Ammenmärchen zu hören bekommen hat.«
»Das eben ist es! Kapitän, werdet nicht gleich unmutig, wenn ich Euch meine offene Ansicht über den Fall sage...«
»Sprecht frei heraus! Ich habe mich vorhin töricht benommen.«
»Es ist dennoch nur eine Vision gewesen. Alle Umstände treffen zusammen, um eine solche in Euch hervorzubringen, die Ihr dann scheinbar außerhalb von Euch seht. Das ist die Theorie aller Geistererscheinungen, von denen sogar durchaus glaubwürdige Menschen erzählen können. Zunächst seid Ihr durch jene spiritistische Sitzung damals seelisch auf Geistererscheinungen vorbereitet worden, und wenn Ihr auch das Tischklopfen nicht auf Menschenhände zurückführen konntet, so ändert das daran doch nichts. Ihr habt nun einmal das Gebiet des Übersinnlichen betreten. Dann habt Ihr jedenfalls auch immer — verzeiht, Herr Kapitän — lebhaft, vielleicht sogar sehnsüchtig an Lady Blodwen und an das Kind gedacht. Drittens kommen nun die arabischen Fabeln in Betracht, welche über dieses Gewässer verbreitet sind, weshalb es gleich das tote Wasser heißt...«
»Ihr sprecht ganz vergebens«, fiel Jansen dem anderen ins Wort, aber ohne seine vorige Heftigkeit, »ich weiß ganz, ganz bestimmt, dass ich etwas Reelles mit greifbarer Deutlichkeit gesehen habe.«
Da konnte Kienock nur die Schultern zucken. Und Jansen erhob sich.
»Mein Entschluss steht fest.«
»Was wollt Ihr tun, Kapitän?«
»Ich werde noch einmal hinabtauchen, in der Hoffnung, dass sich das Gespenst abermals zeigt, und dann werde ich nicht wieder die Flucht ergreifen.«
»Ich kann Euch nur beistimmen, Kapitän, würde aber vorschlagen, dass Ihr noch einen anderen Mann mitnehmt.«
Jansen zögerte, und das verriet schon, dass er jetzt wohl an Geister zu glauben geneigt war, aber auch nichts von Furcht wusste.
»Nun gut«, entschied er dann, »zwei Augenpaare werden wohl nicht gleichzeitig dieselbe Vision haben. Wollt Ihr mich begleiten, Kienock?«
Dieser erklärte sich mit Freuden dazu bereit. Der zweite Maschinist war derjenige, welcher in letzter Zeit das Tauchen bei jeder Gelegenheit am meisten geübt hatte.
So hüllte sich auch Kienock in einen Taucheranzug, diesmal wurden an den Gürteln noch Schiefertäfelchen mit Griffeln befestigt, damit man sich unter Wasser verständigen könnte, beide stiegen hinab.
Nach wenigen Sekunden hatten sie den Grund erreicht. Schlammig oder mit Muscheln bedeckt, wie Jansen geschildert hatte. Dass es die Eisenplatten eines Schiffes waren, auf denen sie standen, konnte nur ein Sachkenner beurteilen, der es aber auch schon vorher hätte wissen müssen.
Kienock stand da, blickte sich nach allen Seiten um, so weit das Licht der Laterne reichte.
Dass er von vornherein unter dem Banne einer gewissen Gespensterfurcht stand, hat er dann später selbst zugegeben — dieser Mann, welcher sonst gewiss nicht an Geister und dergleichen glaubte, der sonst auch ganz ruhig auf einem Kirchhof schlafen konnte.
Da ward von hinten sein Arm berührt — furchtbar erschrocken zuckte Kienock zusammen, obgleich es nur Jansen gewesen, der ihn am Arme ergriffen — aber was Kienock dann zu sehen bekam, das genügte, um auch ihm die klare Besinnung zu rauben.
Jansen hatte den Arm ausgestreckt, Kienock sah es schon selbst — dieselbe Gestalt, welche der Kapitän ihm geschildert.

Es war ein Weib, welches am Ende der Lichtstrahlen sich wie weißleuchtend von dem dunklen Hintergrunde abhob, auf dem linken Arme ein Kind, während es mit dem rechten, erhobenem Arme winkte, sich überhaupt bewegte, etwas hin und her und auf und nieder schwebte, wie auch das goldgelbe Haar hin und her wogte... Blodwen, wie sie leibte und lebte!
Während Kienock noch wie erstarrt dastand, seinen Sinnen nicht trauend, stürzte Jansen vorwärts, so schnell es die Bewegung eines Tauchers im Wasser erlaubt, mit ausgestreckten Armen — da aber wich die Gestalt vor ihm zurück, war plötzlich verschwunden, um nicht wiederzukehren.
Die beiden befanden sich wieder an Deck. Diesmal war es Kienock, der seinen Helm abreißen wollte, er war außer sich, während der Kapitän dann ein ganz ruhiges, nur finsteres Gesicht zeigte.
»Nun, Kienock, wollt Ihr jetzt immer noch von einer Vision oder Halluzination sprechen?«
»Nein, nein!!«, schrie jener. »Bei Gott, die Gespenstermärchen werden zur Wirklichkeit...«
»Glaubt Ihr, dass es Blodwen war?«
»Ja, ja, es waren ihre Züge, es war ihre Gestalt, und sie winkte, winkte wirklich...«
Jansen, der sich schnell des Taucheranzugs entledigt hatte, ließ ihn stehen, begab sich in die Kajüte und ward lange nicht mehr gesehen.
So hatten jetzt die übrigen Zeit, Kienocks Erzählungen zu lauschen.
Nun wolle man sich in die Lage der ganzen Mannschaft versetzen. Dass Matrosen und überhaupt Seeleute sehr zum Aberglauben neigen, wurde vorhin und schon wiederholt gesagt, sie glauben an Seegespenster und dergleichen.
Aber das galt doch nicht von der gesamten Mannschaft der ›Sturmbraut‹. Ausnahmen bestätigen ja nur die Regel. Auch unter ihr gab es einige, wenn es auch nur zwei waren, welche an nichts anderes glaubten, als was sie mit Fäusten packen konnten. Ganz besonders gehörte zu diesen der zweite Steuermann Martin.
Nun nehme man also an, man sähe wirklich einmal einen Geist, der sich mit allen Gründen der Vernunft nicht hinwegleugnen lässt. Oder eine Person, der man unbedingtes Vertrauen schenken darf, kann von einer Geistererscheinung berichten, die sie soeben erst gehabt. Der Vater, der Bruder kommt zu einem und berichtet, wie er soeben den Geist der verstorbenen Schwester mit handgreiflicher Deutlichkeit gesehen hat. Und man geht selbst hin an den Ort und sieht selbst den Geist, er lässt sich nicht wegleugnen. Kurz und gut, man wird mit einem Male gezwungen, unbedingt an das bisher für unmöglich Gehaltene zu glauben, nämlich, dass sich die Seelen von Verstorbenen den noch lebenden Menschen zeigen können.
Ja, was soll man dann von der ganzen Welt noch halten? Soll man da nicht an allem verzweifeln? Ist das nicht ein Grund, um gleich wahnsinnig zu werden? Soll man Selbstmord begehen oder den Rest seines Lebens hinter Klostermauern unter schweren Bußübungen verbringen?
Der Leser wird verstehen, was hiermit gemeint ist. Der definitive Beweis, den der einzelne Mensch erhält, dass es wirklich Geister und Gespenster gibt, dass die Seele des Verstorbenen noch auf Erden wandeln muss, würde ihm jede Lebensfreude rauben. Die schrecklichen Folgen wären überhaupt gar nicht auszudenken. Was uns darin der Spiritismus bringt und zeigt, selbst Materialisationen, also scheinbar wirkliche Geistererscheinungen und dergleichen, das ist dagegen ja eine lächerliche Kleinigkeit, die nur einen Schwachkopf in Verwirrung bringen kann. Das lässt sich schließlich immer noch durch Taschenspielerei erklären. Aber bei einer echten Geistererscheinung, für die es keine natürliche Erklärung mehr gibt, da... muss der normale Geist des Menschen ganz einfach überschnappen.
Und in dieser Lage befand sich jetzt die Besatzung der ›Sturmbraut‹.
Einige der Matrosen hatten doch schon früher etwas von Spiritismus gehört — sie hatten gewusst, wie ihr Kapitän mit seinen Offizieren damals in New York eine spiritistische Sitzung an Bord arrangiert hatte — sie hatten erfahren, was sich dabei Rätselhaftes zugetragen, was durchaus nicht alles auf natürliche Weise erklärt werden konnte, so hatten sie noch mehr über solche Sachen gesprochen... Mumpitz, alles Mumpitz!
Und wenn es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt, so ist sehr interessant, solche unerklärliche Erscheinungen künstlich hervorzurufen, sie zu beobachten, zu studieren, nach Erklärungen zu suchen.
So denkt jeder vernünftige Mensch, der Herz und Hirn am richtigen Platz hat — so muss er denken, sonst ist er ein Phantast, ein Schwächling, ein Waschlappen.
Aber nun hier, hier!!
Der Kapitän hatte Blodwens Geist mit dem Kinde gesehen, der zweite Maschinist hatte die Erscheinung gleichfalls erblickt.
Wollte man etwa glauben, dass diese beiden Männer nur Visionen gehabt hätten? Oder dass sie der ganzen Besatzung verabredetermaßen nur ein Märchen aufbinden wollten?
Gänzlich ausgeschlossen!
Ja, was dann?
Freundlich lachte am azurblauen Himmel die Sonne, aber über der ›Sturmbraut‹ lag es wie das finstere Schweigen einer Todesnacht, und so finster blickten auch alle die wetterharten Gesellen mit den bronzenen Gesichtern in das schwarze Wasser hinab.
»Also hier unten hin kommen wir, wenn wir einmal tot sind«, brach endlich einer der Matrosen das drückende Schweigen.
»Ja, aber nur, wenn wir im Meere versupen«, wurde er belehrt. »Und wenn wir nicht ertrinken, wohin kommen wir da?«
»Anderswohin.«
»Dann spuken wir auf dem Kirchhof, in Kellern und in Speisekammern, wat?«
»Ja, ja, so wird's wohl sein.«
»Und was machen wir denn da unten?«
»Wir werden's schon selber noch erfahren.«
»Mit den Fischen herumspielen, wat?«
Es lag ein furchtbarer Hohn in dieser Unterhaltung der beiden schlichten Matrosen, die jetzt an ein spukhaftes Weiterleben der Seele glauben mussten — sie drückte die Empfindung der anderen aus, der ganzen Menschheit... wenn die ganze Menschheit je in die Lage kommen würde, an so etwas glauben zu müssen.
»Himmelgottver...«
Karlemann war der erste, der seinen Gefühlen in einem fürchterlichen Fluche Luft machen musste. Er verdammte sich und die ganze Welt und Gott bis in alle Ewigkeit, und dabei stampfte er wütend mit dem Fuße auf.
»Und es ist nicht wahr, und ich glaub's nicht, es ist eine verdammte Lüge!«, setzte er dann noch hinzu.
Es war der furchtbare Trotz des Prometheus, der bei dem selbstständigen Jungen hervorbrach.
Der Kapitän trat wieder aus der Kajüte. Er schien plötzlich ein ganz mageres Gesicht bekommen zu haben, in dem die tiefliegenden Augen glühten, was ihm aber nur ein um so energischeres Aussehen gab. Niedergeschmettert hatte ihn also diese Geistererscheinung sicher nicht.
Ohne die Leute zu beachten, ging er nach dem Heck, blieb dort mit über der Brust gekreuzten Armen stehen, lange Zeit, unentwegt in das finstere Wasser blickend. Auch hörte man ihn wiederholt etwas murmeln, ohne es verstehen zu können.
Dann wandte er sich jäh um.
»Den Taucherapparat klar — meinen!«
Während die Matrosen diesem Befehle sofort nachkamen, wieder in finsterem Schweigen, trat Kienock auf den Kapitän zu.
»Ihr wollt nochmals hinab, Kapitän?«
»Selbstverständlich«, war die unfreundlich gegebene Antwort.
»Was dachtet denn Ihr?«
»Wir beide haben keine Vision gehabt.«
»Nein. Und?«
»Ihr gingt doch auf die Gestalt zu.«
»Ich konnte nicht recht sehen, was daraus wurde. Die Gestalt schien zu verschwinden.«
»Das tat sie auch.«
»Sie wich zurück?«
»Sie verschwand wie ein Schatten, zerschmolz in ein Nichts.«
»Kapitän, da wollte ich Euch bitten.«
»Um was? Nun sprecht endlich, was Ihr eigentlich wollt! Ich habe keine Zeit mehr auf dieser Erde zu überflüssigen Gesprächen.«
»Ich wollte Euch bitten, von einem nochmaligen Versuche abzustehen. Wir beide sind überzeugt worden, dass es ein regelrechter Geist war — ob die Lady oder eine andere Erscheinung — Ihr habt sie nicht greifen können, und so hat es auch keinen Zweck mehr, weitere Nachforschungen anzustellen, wir müssen es eben als eine Tatsache hinnehmen, dass...«
Ein heiseres Lachen unterbrach den Sprecher.
»Und Ihr glaubt, Kienock, dass ich diesem Gespenste weiche?!«, stieß Jansen mit einem furchtbaren Grimme hervor. »Dem Menschen gehört die Erde! Dem lebendigen Menschen!!! Und zur Erde gehört auch das Meer! Und ich fühlte mich bisher als freier König des Meeres! Auch dieses Gewässer hier betrachte ich als mein Eigentum! Und ein Gespenst will es mir streitig machen? Hahahaha!!! Und ob nun Blodwen oder ein anderes Gespenst, ich rücke ihm zu Leibe — und ich folge ihm, bis ich es habe — ich will mit ihm ringen — und hat Jakob den Jehovah im Ringkampfe besiegt, so werde ich wohl auch mit diesem Gespenst fertig werden!! Blodwen oder ich — folgen mag ich ihr nicht, sie mag winken, wie sie will — Blodwen oder ich — nur einem kann Erde und Meer gehören — — etwas anderes gibt es nicht für mich!!!«
Staunend blickte die ganze Mannschaft auf ihren Kapitän. Worüber sie staunten, das wussten sie selber nicht. Sie hatten im Menschen den Herrn der Erde sprechen hören, der noch nie einen anderen Herrscher neben sich geduldet, der selbst den Blitz gebändigt hat — sie hatten sich selbst sprechen hören, wofür ihnen nur bisher die Worte gefehlt hatten.
Karlemann erfasste wohl zuerst den Sinn dieser Worte.
»Ja, diesen Geist müssen wir haschen, so was dürfte die Polizei ja gar nicht erlauben. Ist denn an Bord nicht noch ein anderes Taucherkostüm, das für mich passt?«
Es war ein vergeblicher Wunsch. Taucherkostüme für Kinder gibt es in den Spielwarengeschäften noch nicht.
Als sich Jansen schon das seine anlegte, trat ein Matrose vor.
»Kapitän, ich kann ja auch tauchen — nehmt mich mit.«
Jansen hielt mit seiner Beschäftigung inne, sah den Sprecher groß an.
»Weshalb?«
»Weil — weil — weil...«
Der Mann wusste nicht gleich eine Antwort, wurde verlegen.
»Denkst du, ich fürchte mich, noch einmal allein hinabzugehen?«
»O nein, Käpt'n, Furcht gibts bei uns überhaupt nicht — aber seht, Käpt'n — das ist es eben — ich möchte das Gespenst auch einmal sehen.«
»Ich auch, ich auch, ich auch!«, erklang es im Chor, und dann fiel etwas wie von ›sich nicht gefallen lassen‹, ohne dass dies näher erklärt wurde.
Sie alle wollten eben diesem Gespenste, das ihnen den Rang streitig machte, zu Leibe rücken, ob die spukende Erscheinung nun die Lady war oder sonst wer. Aber Jansen wehrte ab, er tauchte allein.
Diesmal blieb er lange unten, wenigstens eine halbe Stunde. An Deck herrschte große Sorge. Doch dass er lebte, erkannte man an den Bewegungen des Seiles, noch mehr an den mit der Regelmäßigkeit des Atmens aufsteigenden Luftbläschen.
Jansen bewegte sich hin und her, ging unter dem Schiff weg, soweit dies das verbindende Seil erlaubte, entfernte sich ziemlich weit, bis er endlich wieder emportauchte.
»Ich habe nichts mehr gesehen.«
Er begab sich in die Kajüte, schloss sich in seine Kabine ein. Die Sonne sank, die Nacht brach an. An Schlaf dachte keiner. Immer hinab in das finstere Wasser geblickt, die Erscheinung Blodwens erwartend.
Mehrmals kam der Kapitän aus der Kajüte, stand lange an der Bordwand, in das Wasser blickend, unverständliche Worte murmelnd.
Bei Sonnenaufgang gab er Befehl, die Anker zu lichten. Die ›Sturmbraut‹ verließ die Inselgruppe. Noch einmal getaucht hätte Jansen nicht, schien aber auch die Untersuchung des Wracks vergessen oder aus irgendwelchem Grunde aufgegeben zu haben. Doch aus Furcht vor dem Seegespenst sicher nicht, das hatte er ja bewiesen.
Der arabische Lotse ward im Boot nach seiner Stadt gebracht, die ›Sturmbraut‹ fuhr wieder nach Norden hinauf, dann nach Westen, der Straße von Gibraltar zu, welche sie abermals ohne Hindernis passierte.
Drei Wochen waren seit diesem Ereignis vergangen.
Die ›Sturmbraut‹ durchfurchte mit geschwellten Segeln wieder den Atlantischen Ozean, und wenn die Matrosen sich nicht nach den zurückgelegten Knoten und nach dem Kompass ungefähr berechnen konnten, wo sie sich befanden, von den Offizieren, welche mehrmals am Tage eine geografische Ortsbestimmung machten, erfuhren sie nichts, und diesen wiederum gab der Kapitän kein Ziel an.
Auch sonst ging alles das alte Gleis. Es wurde gearbeitet, geturnt und gelesen — aber die Stimmung war eine ganz andere geworden. Die alte Fröhlichkeit fehlte, etwas wie Melancholie hatte sich über das ganze Schiff gebreitet.
»Wenn wir tot sind, dann müssen wir als Geister herumspuken, wenn nicht auf dem Meeresboden, dann in Kellergewölben oder sonst wo.«
Das war es, womit sich die Gedanken eines jeden beschäftigten, nicht nur Matrosenhirne, und das um so mehr, weil niemand über jenen Vorfall sprach, es nicht wagte.
Hatte Kapitän Jansen jene Stelle deshalb so schnell und ohne Untersuchung des Wracks verlassen, um solche Gedanken von sich und seinen Leuten zu bannen? Es war vergeblich gewesen. Das Seegespenst begleitete Schiff und Mannschaft — und das sollte nicht nur bildlich zu verstehen sein.
Wieder war eines Morgens eine Ortsbestimmung nach der Sonne gemacht worden, der Kapitän selbst kontrollierte die Berechnung, maß dann auf der Seekarte.
»Was liegt an?«
Der Kurs wurde ein wenig geändert, und eine halbe Stunde später musste aller fünf Minuten eine geografische Ortsbestimmung gemacht werden, wie auch ein Segel nach dem anderen gerefft wurde. Gerade, als ob man sich einem Ziele nähere.
Aber welchem? Ringsherum der unermessliche Ozean, kein Segel zu erblicken, ein solches auch gar nicht zu erwarten. Denn selbst die vom Wind ganz abhängigen Segelschiffe haben ihre gewissen Linien, wenn diese auch nicht mit denen der Dampfer zu vergleichen sind. Aber sie haben ihre Segelkarten, welche sagen: da und dorthin geht nicht, da habt ihr niemals günstigen Wind — und so gibt es auf jedem Ozean ungeheuere Gebiete, die vielleicht noch niemals von dem Kiel eines Schiffes gefurcht worden sind.
Es wurde ununterbrochen gelotet. Der Matrose, welcher das Lot auswarf, erkannte zu seinem Schrecken, dass das Wasser immer seichter ward, zuletzt waren es nur noch sechs Meter Tiefe, und dieser Schrecken teilte sich der ganzen Mannschaft mit.
Denn ein Schrecken muss jeden Seemann packen, wenn er mitten im offenen Wasser, mitten im Ozean plötzlich eine Sandbank findet, von der die Welt bisher noch gar nichts gewusst hat.
Der eine Anker fiel und fasste, der Kapitän, welcher bis zuletzt den Stand der Sonne berechnet hatte, ließ das Schiff sich noch etwas drehen, dann fiel auch der Buganker und nagelte die ›Sturmbraut‹ gewissermaßen im Wasser fest.
Jetzt mussten sich beide Steuerleute mit ihren Sextanten bewaffnen, auch der Chronometer aus der Kajüte wurde an Deck gebracht, ferner wurde wieder der Tauchapparat bereitgesetzt, und da wusste die ganze Mannschaft, um was es sich handelte.
Wohl sollte getaucht werden, aber sicher nicht nach einem Schatze, sondern wahrscheinlich nach einer Kanonenkugel, die einstmals nach genauem Chronometer und genauer geografischer Berechnung hier auf dieser Sandbank im offenen Meere an ganz bestimmter Stelle versenkt worden war, um zu prüfen, ob die beiden Chronometer genau gingen.
Jansen hatte schon zu Blodwen einmal darüber gesprochen, wie aller drei Jahre ein englisches Kriegsschiff eine Reise um die Erde macht, und wie es kurz nach der Abfahrt irgendwo im Meere, nur an einer nicht allzu tiefen Stelle, eine Kanonenkugel versenkt, welche dann bei der Rückkehr nach drei Jahren mittels eines Magneten wieder heraufgezogen wird. Das geschieht noch heute, obgleich es mehr eine Spielerei ist. Das Richtiggehen der Chronometer wird jetzt auf eine andere Weise geprüft.
Noch immer ist dieses Verfahren aber das einzige Mittel, dies zu tun, für solche Schiffe, welche keine Gelegenheit haben, einen Hafen anzulaufen, in dem sie sich mit der Sternwarte von Greenwich telegrafisch in Verbindung setzen können. Wie z. B. bei Kriegsschiffen, wenn sie vor feindlichen Häfen liegen.
So lange man genau weiß, dass der Chronometer noch richtig geht, wird eine Kanonenkugel im Meere versenkt und ihre Lage bis zum Bruchteil einer Sekunde der geografischen Breite und Länge berechnet. Nach diesem im Wasser festgenagelten Punkte kann man dann immer wieder die Uhr justieren — auf eine für den mathematisch gebildeten Seemann ganz einfache, für den Laien freilich schwer zu erklärende Weise.
»Nun, Franz, hülle dich ein in den Panzer, du bist ja immer so erpicht aufs Tauchen«, sagte Jansen, der guter Laune zu sein schien, zu seinem Matrosen. »Hier in der Drehe herum wirst du auf dem kiesigen Gründe eine große Kanonenkugel finden. Aber nicht aufheben, nicht anrühren! Sondern gleich daneben pflanzest du möglichst senkrecht diese lange Stange ein, dass sie noch über die Wasserfläche emporragt.«
Der Matrose traf seine Vorbereitungen, kletterte das Fallreep hinab, die Stange ward ihm gereicht, er verschwand.
Er konnte den Grund kaum erreicht haben, als heftig an der Signalleine gerissen wurde, der Taucher kam auch gleich selbst mit seinem Helm wieder zum Vorschein.
Es lässt sich denken, dass sich alle sofort an jene Situation erinnerten, wie dort im toten Wasser ihr Kapitän so hastig an der Signalleine gerissen und dann den ersten Bericht von dem Seegespenst gebracht hatte.
Und richtig, so war es auch wieder hier!
Mit einer furchtbaren Hast kletterte der Taucher an Deck, konnte nicht erwarten, bis man ihm den Helm abgeschraubt hatte, wonach man ihn erst sprechen hören konnte, und schon jetzt war durch das starke Fenster sein vor Entsetzen entstelltes Gesicht zu sehen.
»Die Lady, ich habe sie gesehen!!«, war dann sein erstes Wort. So sehr man auch darauf vorbereitet gewesen war, wollte es ihm jetzt doch niemand glauben.
»Das bildest du dir nur ein«, sagte der Kapitän.
»Nein, nein, ich habe das Seegespenst gesehen!«
»Du standest unter dem Einflusse unserer Schilderung.«
»Ich habe sie gesehen!«, konnte der Matrose nur immer wieder hervorstoßen.
»Wie sah sie denn aus?«
»Grün — sie hatte ein grünes Kleid an — und ein Kind auf dem Arme — sie erhob sich dicht vor mir vom Boden.«
»Und was tat sie dann?«
»Sie winkte mir — winkte mit dem erhobenen Arme in einem fort.«
»Franz, du bist gewiss nur...«
»Jesus Christus — alle guten Geister — da — da ist sie!«, erklang der Ruf.
Einige Matrosen hatten noch hinabgeblickt, wo ihr Kamerad getaucht war, und...
Ja, da war sie wirklich, viel leicht noch einen Meter unter der glatten Wasserfläche, eingrüngekleidetes Weib, dem gelbe Haare nachschwebten, auf dem linken Arme ein Kind und mit dem anderen winkend.
Durch die Brechung des Wassers zwar etwas verschwommene Konturen, aber alles doch deutlich zu unterscheiden, selbst die starren Augen, welche zu der Mannschaft hinaufblickten.
»Die Lady, sie ist es!«, wurde in einer Weise geflüstert, die man nicht beschreiben kann.
»Und sie winkt uns, wir sollen zu ihr hinabkommen!«
Jansen rieb sich seine Stirn, als er da hinabstarrte.
»Himmel und Hölle!«, murmelte er. »Bei hellem Sonnenschein — verlisch, du Sonne — oder bin ich denn wahnsinnig? Ist dies alles nicht nur ein böser Traum, dass die ganze Welt aus dem Gefüge gegangen ist?«
Wieder war es Karlemann, der zuerst einen praktischen Vorschlag machte.
»Ein Gewehr her! Meine große Elefantenbüchse! Oder soll ich ihr spanischen Pfeffer in die Augen pusten? Dann können wir sie vielleicht lebendig haschen.«
Da ein heiserer Wutschrei, aus des Kapitäns Munde kommend, dem die Schreckensrufe der Matrosen folgten.
Jansen war mit einem Hechtsprung über die Bordwand gesetzt, mit den ausgestreckten Händen gerade auf die weibliche Gestalt zu, verschwand unter dem Wasser, und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn es eben nicht ein wesenloser Geist war, musste er die Gestalt auch gepackt haben.
Zu unterscheiden war in den nächsten Augenblicken nichts, das aufgeregte Wasser hatte sich getrübt, schon allein durch die erzeugten Luftblasen.
Dann klärte es sich wieder, es kam herauf, Jansens Kopf, seine Brust, seine Arme... und in diesen hielt er die Gestalt mit dem Kinde.

Und gleichzeitig erscholl auch sein Lachen, grimmig und furchtbar höhnisch und wirklich herzlich zugleich:
»Eine Galionsfigur, das ist der ganze Teufelsspuk — hahahaha — eine Galionsfigur, die an einem Seil am Kiel unseres Schiffes hängt und uns immer nachschwabbelt, hahahaha!!«
Ja, das Rätsel war gelöst, der ruhelose Geist erlöst. Da lag die vermeintliche Blodwen mit ihrem Kinde an Deck.
Eine sogenannte Galionsfigur, wie wohl fast jedes Schiff eine solche am Bug führt, unterhalb des Bugspriets, möglichst den Schiffsnamen charakterisierend.
Die lebensgroße, aus Holz geschnitzte Figur, stellte jedenfalls die Madonna mit dem Kinde vor. Irgendein Schiff hatte sie verloren, es war ein Tau daran befestigt gewesen, dieses hatte sich mit dem Ende an dem mit Kupfer beschlagenen Kiel der ›Sturmbraut‹ festgeklemmt. Wo das geschehen war, wusste man nicht, war auch ganz gleichgültig. Vielleicht auf der Fahrt durch das Mittelmeer, und so war die Figur auch mit in das ›tote Wasser‹ gekommen.
Wie die spätere Untersuchung ergab, wie man sich aber auch gleich so erklären konnte, hatte das sich voll Wasser gesogene Holz fast genau dasselbe spezifische Gewicht wie das Meerwasser. Also die Figur sank nicht unter, trieb nicht in die Höhe. Unter normalen Verhältnissen lag die Figur flach am Boden. Aber es bedurfte nur der geringsten Strömung im Wasser, wie schon ein Taucher sie in einiger Entfernung erzeugt, so richtete sich der um ein geringes leichtere Oberkörper auf, die Figur stand. Der rechte Arm war abgebrochen, hing aber doch noch an einigen Holzfasern — daher immer die winkenden Bewegungen.
Die früher buntangemalte Figur war von Seepflanzen grün umsponnen worden, nur im Nacken hatte sich eine große Syphusmuschel angesiedelt, die dort ihre langen, goldgelben Fäden spielen ließ.
Das war die ganze Erklärung des Spukes.
Und auf der ›Sturmbraut‹ erscholl ein einziger Freudenschrei — ein Freudenrausch erfasste alle. Etwas noch ganz anderes als wie nur ein zentnerschwerer Alp war von allen plötzlich gewichen, und der aufgeräumteste war vielleicht Kapitän Jansen.
Nachdem die nautischen Instrumente justiert waren und die ›Sturmbraut‹ wieder in Fahrt gebracht, wurde ein Fest gefeiert, bei welchem es viel übermütiger zuging, als die Planken dieses Schiffes es sonst gesehen hatten.
Bevor wir schildern, was für ungeahnte, böse Folgen dieses Zechgelage haben sollte, wollen wir jener Gespensteraffäre noch ein Schlusswort hinzufügen.
Es hatte sich alles auf natürliche Weise erklärt.
Gesetzt aber nun den Fall, die an einem Tau festgeklemmte Galionsfigur hätte sich wieder abgelöst, vielleicht erst, nachdem das winkende Weib von der ganzen Mannschaft mit eigenen Augen erblickt worden war, was dann?
Dann hätten vierzig Menschen mit redlichem Gewissen beschwören können, in Wahrhaftigkeit ein Seegespenst erblickt zu haben! Denn wer wäre auf die Idee gekommen, dass es sich nur um eine Galionsfigur handle, die sich am Kiel zufällig festgeklemmt? Hatte sie sich nicht bewegt, ihren Arm, ganz selbstständig? Wer denkt daran, dass der hölzerne Arm gerade nur so an ein paar Spänen hängt?
Dieses Beispiel zeigt, auf welche Weise manche Gespenstergeschichte entstanden sein mag, erlebt und erzählt von klardenkenden Männern, in deren Glaubwürdigkeit sonst gar kein Zweifel zu setzen ist!
Der Schreiber dieses kann etwas ganz Ähnliches erzählen. Der Passagierdampfer, auf dem er sich befand, sichtete im Atlantischen Ozean die berühmte Seeschlange, ein furchtbares Ungeheuer, wenigstens hundert Meter lang, meterdick, der bemähnte Kopf mit tellergroßen Augen, der immer auf- und zuklappende Rachen mit schrecklichen Reißzähnen ausgestattet.
Es half alles nichts, das mit der Seeschlange war eben doch kein Märchen, da sahen wir sie in voller Lebenskraft raubgierig sich über das Meer schlängeln.
Was für eine Panik da auf dem Passagierdampfer ausbrach, was für Hypothesen da Gelehrte gleich aufstellten, das lässt sich gar nicht schildern.
Beim Näherkommen freilich zerrann die Illusion.
Die vermeintliche Seeschlange war aus Schiffsmatratzen zusammengenäht, wie sie Auswanderer mit an Bord bekommen, die Mähne bestand aus Werg, und in dem Rachen steckte eine Spiralfeder, das Auf- und Zuklappen kam durch die Bewegung der Wellen. Die Mannschaft eines Auswandererdampfers hatte sich den Jux gemacht, diese Seeschlange in die Welt zu setzen.
Gesetzt nun den Fall, jener Auswandererdampfer wäre mit Mann und Maus untergegangen, und die Schlangenpuppe hätte sich vollgesogen und wäre gesunken, noch ehe unser Dampfer so nahe heran war, um die Wahrheit unterscheiden zu können, was dann?
Dann hätten mehr denn 600 Menschen nach bestem Gewissen beschwören können, tatsächlich eine Seeschlange gesehen zu haben.
Eine Dampfjacht von mehr als 600 Tonnen steuerte über den Atlantischen Ozean dem Osten zu. Die Matrosen, welche gerade das Deck scheuerten, befanden sich sämtlich schon in gesetztem Alter, rohe, brutale Gesichter fehlten darunter ganz, allen war die sittsame Ruhe und Manierlichkeit gleich in den Zügen zu lesen, und noch mehr galt das von dem auf und ab gehenden Steuermann, der einen wahren Heiligenblick besaß, obgleich die breitschultrige Gestalt mit dem verwitterten Gesicht den Seemann comme il faut verriet.
»Schiff ahoi!!«
Der, welcher die am Horizont auftauchenden Mastspitzen zufällig zuerst
erblickt, hatte es ›ausgesungen‹.
»Rufe den Kapitän, Ned!«, sagte der Steuermann zu einem Matrosen.
»Der Kapitän schläft!«
»Du bist allerdings erst im letzten Hafen, den wir angelaufen haben, ange
mustert worden«, sagte der Steuermann in mildem Tone, wie man es zwar selten, aber doch manchmal auf einem Schiffe zu hören bekommt, »aber es ist dir erklärt worden, und du könntest es nun auch schon durch Erfahrung wissen, dass Kapitän Oliver jedes in Sicht kommende Schiff selbst sehen will. Und wenn er in einer Nacht neunundneunzigmal aus dem Schlafe gestört worden ist, und die Wache sichtet ein Feuer, so wird er zum hundertsten Male geweckt. Geh, Ned, wecke den Kapitän!«
Der zurechtgewiesene Matrose brauchte sich nicht so zu beeilen, der
Steuermann hatte auch Zeit zu seiner wohlgesetzten Rede gehabt — vorläufig sah man immer nur drei Mastspitzen.
Aber schon änderte der Steuermann eigenmächtig den Kurs, um auf diese
Mastspitzen zuzuhalten.
Aus dem Kajüteneingange kam ein blutjunger, sehr blasser Mensch.
Wie? Sollte das der Kapitän sein?! Da stellt man sich doch einen ganz
anderen Mann vor! Allerdings war es ja eine Lustjacht, aber auch die Jachtsportsmen sind immer ganz andere Kerls, umsonst verbringt man sein Leben nicht auf dem Wasser; schon diese Neigung zum seemännischen Berufe oder überhaupt zum Meere setzt eine außergewöhnliche Konstitution voraus.
Vor zwei Jahren war dieser schmächtige, blutjunge, blasse Mensch mit den melancholischen Augen in Boston aufgetaucht und hatte sich eine Jacht gekauft, diese hier.
Warum nicht? Das kann jeder, der Geld hat.
Anders aber war es, als verlautete, dass dieser blutjunge, blasse Mensch, ein Jüngling von 20 Jahren, diese seine Jacht selbst führen wollte, als Kapitän.
Das kann nicht jeder! Ja, jeder Jachtbesitzer kann sich wohl Kapitän schimpfen lassen — ebenso wie es einen Generalagenten gibt, einen Feuerwehrhauptmann, einen Leutnant von der Heilsarmee. Aber um ein richtiger Kapitän zu sein, der ein Schiff über das Meer führen darf, dem sich Menschenleben anvertrauen, dazu muss man vom Schiffsjungen anfangen, mindestens 2 Jahre als Vollmatrose gefahren sein, das Steuermannsexamen gemacht haben, dann nach einigen Fahrten als Steuermann das Kapitänsexamen.
Nun, dieser blutjunge, blasse Mensch, der sich Thomas Oliver nannte, meldete sich beim Bostoner Seeamt zum Kapitänsexamen und bestand es glänzend.
Um zugelassen zu werden, hatte er vorher allerdings erst Papiere über seine frühere praktische Tätigkeit als Seemann vorlegen müssen. Darüber erfuhr die Öffentlichkeit nichts. Man machte mit dem jungen Menschen, der so feine Fingerchen hatte, behördlicherseits überhaupt ein Geheimnis.
Sachkenner ahnten ja, wer hinter diesem jungen Menschen stecken könne, das heißt, aus welcher Gesellschaftsklasse er im allgemeinen stamme, dass er sofort sein Kapitänspatent erhielt. Doch wir wollen es vorläufig nicht verraten.
Nachdem der blutjunge, blasse Kapitän sein Schiff hatte, sah er sich nach Mannschaft dafür um. Die ersten Leute, Matrosen wie Heizer, holte er sich aus der Kirche, diese besorgten andere, natürlich ebenso geartet wie die Erwählten selbst — lauter Betbrüder.
Nun, um diese Wahl zu treffen, dazu hätte der junge Mensch kein so blasses Gesicht und so melancholische Augen zu haben brauchen. Da hatte er gar nicht so dumm gewählt.
Nirgendwo sieht man so sehr, was für einen mächtigen Einfluss die echte Frömmigkeit auf den Menschen ausübt, wie im Seemannsberufe. Das ›echt‹ muss betont werden; leeres Geplärre tut's freilich nicht. Man soll nur sehen, was so ein Matrose, der jeden Morgen sein Gebet verrichtet, vor dem Essen die Hände faltet, in seiner Freizeit in der Bibel liest und sich nach der Abmusterung von seinen Kameraden absondert, um in die Kirche oder in die Missionshäuser zu gehen — was für ein tüchtiger Kerl so einer auch in der Takelage ist! Ohne Ausnahme! Denn auf den Knien rutschende Betbrüder gibt es an Bord natürlich nicht. Die würden beim Aufentern doch gleich totgetreten werden.
Das wissen auch die Kapitäne. Jeder Kapitän möchte am liebsten lauter solche ›heilige Matrosen‹ an Bord bekommen. Wenn sie nur nicht so dünn gesät wären! Solch ein heiliger Matrose ist immer der nüchternste, pflichttreueste, tüchtigste Mann. Und wenn alles reißt und bricht, der ist immer der erste oben auf der Rahe, alle anderen anfeuernd! Er weiß ja, wo seine Seele bleibt.
Ganz merkwürdig auch, was für einen kolossalen Einfluss so ein einzelner gottesfürchtiger Matrose schnell auf seine anderen Schiffskameraden gewinnt! Die Natur der Sache bringt mit sich, dass dies am Lande, so im allgemeinen Geschäftsleben ganz anders ist. Etwa in einem großen Büro, wenn da ein Kommis als ›Mucker‹ erkannt wird — man hänselt ihn. Was soll er auch anfangen? Etwa Predigten halten? Seine Bücher soll er gut führen, dafür wird er bezahlt — und das tut ein anderer ebenso gut, vielleicht noch besser, der den Abend in lustiger Gesellschaft verbringt und Sonntags zum Kegelschieben geht.
Der Unterschied dürfte sich vielleicht erst später, nach vielen Jahren zeigen. Der Gottesfürchtige bringt sein Leben ganz, ganz bestimmt noch zu einem guten Abschluss. Denn so wahr das Christentum noch jeden Feind überwunden hat, so wahr selbst der orthodoxeste Jude die Herrschaft Christi anerkennen muss, nämlich wenn er einen Wechsel ausstellt oder einen Brief schreibt, indem er das Datum nicht vergessen darf — am 24. Dezember 1907 nach Christi Geburt, sonst ist seine Unterschrift ungültig — ebenso wahr ist noch kein einziger Mensch im Unglück zugrunde gegangen, der nach Gottes Wort gelebt hat! Selbst die Märtyrer sind mit glücklichem Lächeln am Kreuze gestorben.
Wie so ganz anders an Bord des Schiffes, das eine kleine Welt für sich bedeutet! Auch hier wird der ›heilige Matrose‹ zuerst gehänselt. Aber das ändert sich gar schnell. Der Kapitän hat bald heraus, wen er an Bord hat, er stellt diesen Mann immer an die Stelle, wo eben ein ganzer Mann gebraucht wird, er bevorzugt ihn in jeder Weise, freilich nicht mit Leckerbissen, und dann kommt wohl für jedes Schiff einmal eine Stunde, da der Schreiber dieses, der auf See auch so manche Leidenszeit durchgemacht hat, noch jeden Gottesleugner hat zusammenbrechen sehen. In solchen Stunden erkennt man, was für eine Bewandtnis es mit dem sogenannten Atheismus und Freidenkertum und dergleichen hat. Einmal eine Woche lang mit zerfetzten Händen die Pumpenkurbel drehen, wenn die eiskalten Wogen immer über dem Kopfe zusammenschlagen, an den Kleidern Eiszapfen zurücklassend — ei, so eine Zeit kuriert von allem Atheismus! Ach, da wird man mit einem Male so fromm, da erkennt man mit einem Male so deutlich, dass es doch etwas über uns gibt, wovon man in guten Zeiten nur nichts wissen will.
Und da ist es immer dieser ›heilige Matrose‹, der in seinem Gottvertrauen kraftvoll und furchtlos dasteht, als leuchtendes Beispiel für alle anderen, nicht zu verzweifeln, auch nicht auf den Knien zu rutschen, sondern bis zum letzten Atemzuge mutig für Schiff und Leben zu kämpfen — da allerdings hat er Gelegenheit, im ›Weinberge des Herrn‹ zu arbeiten. Der Schreiber dieses hat es durchgemacht.
Es wird so viel über Missionshelden geschrieben, die etwa in Afrika für ihren Glauben gelitten und ihren Tod gefunden haben. O, wenn man an Land wüsste, wie viele solcher Missionshelden es auf See gibt, arme Matrosen, deren Namen die Welt nie erfährt! Dicke Bücher könnte man über sie schreiben. Und deshalb durften wohl hier einige Zeilen über sie gesagt werden.
Übrigens findet man ja fast dasselbe beim Militär, im Soldatenberuf. Ein gottesfürchtiger Soldat ist auch immer ein tüchtiger. Das war schon bei den alten Landsknechten der Fall — siehe die Landsknechtslieder — so ist es auch noch heute. So einen alten, wackeren Haudegen, ob nun General oder Korporal, kann man sich ohne wahre Gottesfurcht gar nicht vorstellen. Die gibt das feste Rückgrat. Dabei ist von einem Muckertum gar keine Rede. — — —
Als der blasse Kapitän seine Leute zusammen hatte, gab er seinem Schiffe einen Namen. Er nannte es ›Repentance‹. Das ist Buße, Sühne.
Hatte der blutjunge, blasse Kapitän etwas begangen, was er abbüßen wollte? Ja, so sah er aus. Und die geeignete Mannschaft für ein Büßerschiff hatte er auch.
Aber die Zuschauer, welche die schmucke Jacht den Hafen von Boston verlassen sahen, irrten, wenn sie glaubten, dass es nun ein Kirchenschiff gebe, auf dem Bibel und Gesangbuch herrschen, auf dem gepredigt und gefastet würde. Übrigens nicht einmal etwas Neues, alles schon da gewesen.
Doch von der ›Repentance‹ galt das nicht. Der junge, blasse Kapitän dachte gar nicht daran, seinen Leuten Predigten zu halten. Er war der unnahbare Kapitän, und wer von den Matrosen und Heizern seinen Schnaps trinken wollte — Gottesfurcht schließt ja keinen Schnaps aus — der bekam seinen täglichen Schnaps. Möge dieses etwas drastische Beispiel zeigen, dass die ›Repentance‹ durchaus kein Kirchenschiff war. Es ging genau so zu wie auf jedem anderen Schiffe, nur dass das Fluchen fehlte.
Mit dem jungen, blassen Kapitän freilich war ein Rätsel verknüpft. Dass er ein tüchtiger Seemann war, der schon manches Schiff geführt haben musste, hatte er mehrmals bewiesen, wenn er das Kommando selbst übernahm. Sonst aber kümmerte er sich um das ganze Schiff nicht, saß immer in seiner Kajüte, selten lesend, mehr schwermütig vor sich hinblickend. Er kam manchmal tagelang nicht an Deck. Deshalb wollte ihn auch seine blasse Farbe nicht verlassen.
Was hier vorlag, war leicht begreiflich. Der junge Mensch hatte der Welt entsagt. Wer heutzutage der Welt entsagen will — wirklich entsagen! — der geht nicht mehr wie früher in die Wüste, sondern er schließt sich in seine Stube ein. Dazu aber gehört schon etwas Kapital, oder man muss Hausarbeiten verrichten, Strümpfe stricken oder, wie Spinoza, Gläser schleifen. Oder er geht in die Fremde, verschwindet. Denn lässt man die Fremde immer Fremde bleiben, so ist man doch immer allein. Ist er mit sogenannten ›Glücksgütern‹ gesegnet, so kauft er sich ein Rittergut. Eine Gartenvilla mit einer hohen Mauer drum genügt auch schon, dann vielleicht noch ein paar große Hunde und ein Plakat — ›Zutritt verboten, hier sind Fußangeln gelegt, Selbstschüsse!‹ — oder er geht auf Reisen. Und hat der menschenscheue Weltentsager sehr viel Geld und Geschmack am Seeleben, dann kauft er sich eine Jacht.
Da kann er leben wie Johannes in der Wüste, ohne Heuschrecken essen zu müssen.
Ja, kommt nur hinaus in die Welt, was für eine Unmenge von seltsamen Käuzen es doch gibt! Aber offene Augen muss man haben, um sie zu sehen!
Es gäbe heutzutage viel weniger Originalität denn früher? Nein, nur kurzsichtiger ist man geworden!
Man braucht deshalb gar nicht in die Welt zu gehen. Vielleicht wohnt dicht neben dir ein Nachbar, an dem du wohl einige Eigentümlichkeiten in seiner Lebensweise wahrnimmst, aber du ahnst nicht, dass er sich nur wenig von dem Simeon Stylites unterscheidet, welcher vierzig Jahre lang auf einer sechsunddreißig Ellen hohen Säule lebte, zu Ehren Gottes, oder auch aus dem ganz egoistischen Grunde, um dem Himmel schon auf Erden näher zu sein.
Auch der junge, weltentsagende Kapitän hatte noch seine besondere Schrulle. Jedes auftauchende Schiff musste ihm gemeldet werden, nur dann kam er aus seiner Kajüte, griff zum Fernrohr, betrachtete es, schüttelte den Kopf und ging wieder in die Kajüte, um weiterzuträumen.
Bei Tage ließ man sich das noch gefallen, anders wurde es bei Nacht, wenn ein Feuer gesichtet wurde. Dieses musste dann von der Jacht verfolgt werden, bis man bei Morgengrauen die Konturen des betreffenden Schiffes erkennen konnte. Aber auch dann stets nur ein Seufzen und Kopfschütteln.
Was für ein Schiff suchte der junge Kapitän auf dem Atlantischen Ozean?
Nun, das hatten die Matrosen bald heraus. Eine Erklärung muss der Mensch doch für alles haben und er weiß sie daher auch immer zu finden.
Es war ein deutscher Matrose, der zuerst des Rätsels Lösung fand und es einem deutschen Kameraden mitteilte.
»Sien Brut is ein wegloopen — oder Fru — auch sie hat eine Jacht, er kennt sie, und nun sucht er die.«
Vielleicht kam man der Wahrheit auch sehr nahe. Einmal hatte der als Steward dienende Matrose ihn in der Kajüte überrascht, wie er seufzend eine Fotografie betrachtete, die er beim Bemerken des Matrosen hastig verbarg, und das Bild hatte ein junges Weib dargestellt.
Also er suchte ein Schiff, von dem er nicht mehr wusste, als dass es sich auf dem Atlantischen Ozean befand. Denn auf diesem blieb auch die ›Repentance‹, immer hin und her segelnd oder dampfend, nur einen Hafen anlaufend, wenn der Proviant ergänzt werden musste, in Frankreich oder Spanien oder Afrika oder Amerika. Zuletzt hatte man Proviant, Trinkwasser und Kohlen in Trujillo eingenommen, dem größten Hafen von Honduras, Zentralamerika, und nun ging es wieder nach der anderen Seite des Ozeans hinüber, immer nach Schiffen ausspähend, immer wieder seufzend das Fernrohr zusammenschiebend.
Na, ganz richtig war es mit diesem jungen, blassen Kapitän ja nicht! Bei dem war etwas im Kopfe locker. Aber mit nur um so respektvollerer Teilnahme blickten alle diese trotz ihrer Frömmigkeit verwitterten und verwetterten Matrosen zu ihrem Kapitän empor.
»Schiff ahoi!!«
Wieder schraubte der junge Kapitän das Fernrohr. Dabei konnte man die Beobachtung machen, dass diese weißen, feinen, schlanken Hände doch eigentlich recht kräftig waren, wie man sich in der schmächtigen Gestalt wohl überhaupt recht täuschen konnte. Das verriet schon, wie er das doch ziemlich schwere Fernrohr hielt, nach minutenlangem Halten noch nicht das geringste Zittern des Armes, und die ganze Gestalt stand wie ein Eichbaum festgewurzelt in den Deckplanken des ziemlich tanzenden Schiffes.
Auch das blaue Auge in dem bartlosen, knabenhaften Gesicht, das sonst so schwermütig und umflort blickte, leuchtete jetzt wie ein zweischneidiger Stahl auf, den man aus der Scheide zückt.
»Ein Dreimaster, der könnte es sein!«, erklang es murmelnd. Die nächststehenden Matrosen hatten es gehört. Sie wunderten sich nicht. Nur dreimastige Schiffe wussten ihres Kapitäns Interesse zu fesseln. ›Sien Brut, dee em wegloopen,‹ hatte eben eine dreimastige Jacht.
Die ›Repentance‹ hielt also bereits darauf zu. Seit dem Morgen herrschte vollkommene Windstille, doch war die See vom letzten Sturme noch ziemlich aufgewühlt.
Die Masten wuchsen aus dem Wasser, auch der Rumpf kam zum Vorschein.
»Das ist ja merkwürdig«, meinte der Steuermann, der ebenfalls das Fernrohr benutzte.
»Was ist merkwürdig?«
»Der hat ja alle Segel stehen.«
Das war in der Tat sehr merkwürdig. Bei Windstille werden die Segel stets festgemacht. Außerdem ist, wie immer falsch berichtet wird, eine Windstille für den Matrosen durchaus keine Erholungszeit. Da wird in der Takelage alles repariert, was zu reparieren ist, Segel werden ab- und angeschlagen, Arbeit gibt es da jedenfalls immer, die während der Fahrt nicht zu machen ist. Wenn die Windstille sehr lange anhält, dann ist es etwas anderes.
»Und kein einziger Mann in der Takelage!«, konnte jetzt beim Näherkommen der Steuermann konstatieren.
»Das Schiff ist ruderlos«, sagte der Kapitän.
Es gehörte ein Falkenblick dazu, um das von hier aus mit bloßen Augen erkennen zu können. Denn mit Hilfe des Fernrohres wäre das nicht zu unterscheiden gewesen, davon kann man sich nur durch den Gesamtanblick des ganzen Schiffes, wie es hin und her schwankt, überzeugen.
Der Steuermann und die Matrosen konnten dies erst viel später bestätigen. Ein ruderloses Schiff, welches alle Leinwand schlaff herabhängen hat, ein willenloses Spiel der Wogen — man muss wohl ein Seemann sein, um das Unheimliche zu begreifen. Das ist auch so etwas Gespenstisches.
»Das ist es wieder nicht!«, seufzte der Kapitän wie immer, als er das Fernrohr zusammenschob.
Aber diesmal entfernte er sich nicht wie sonst, wenn er sich in einem Schiffe betreffs dessen, was sein Geheimnis war, getäuscht sah. Dieses rätselhafte Schiff musste doch näher untersucht werden, das war sogar die Pflicht eines jeden Seemannes.
Die Jacht kam von hinten auf, und bald konnte man am Heck den Namen lesen: ›Colombina Napoli‹.
Das Schiffsregister wurde nicht erst befragt, sondern nach Menschen gespäht. Es war eigentlich überflüssig. Wäre dort noch ein Mensch an Bord gewesen, so hätte er doch vor allen Dingen das Steuerrad festgehalten. Selbst eine Landratte von Passagier hätte schließlich auf diesen Gedanken kommen müssen.
Jetzt war man nahe genug, um das hochbordige Deck übersehen zu können, wenn man einen der beiden Masten erstieg.
Das besorgte der Kapitän als erster selbst, das war doch kein gewöhnlicher Fall, und der junge, blasse Mensch stieg die Wante empor, langsam zwar, aber mit einer Gewandtheit, die noch mehr als den hierin geübten Seemann verriet. Die eine Hand hatte er dabei in der Hosentasche, mit der anderen berührte er nur einmal so spielend die Wante, in deren Sprossen er emporstieg, so wie man einmal zwecklos das Treppengeländer anfasst, und bei diesem hüpfenden Schiffe hätte das auch der geübteste Turner nicht fertig gebracht, die Sicherheit hätte ihm gefehlt.
Vom Mars aus, früher Mastkorb genannt, konnte er das Deck überschauen.
Und er sah lang ausgestreckt zwei Männer liegen, in Arbeitskleidung.
Er ließ die Jacht noch weiter vorwärtsgehen, bis er auch das Steuerrad erblicken konnte, und da sah er neben diesem den Matrosen, dem das Rad anvertraut gewesen, zusammengekauert dasitzen, den Kopf tief auf der Brust.
Der Kapitän stieg wieder herab.
»Das sieht bös aus — alles tot!«
»Tot?!«, stieß der Steuermann entsetzt hervor.
»Drei Mann liegen bewegungslos da, auch der Mann am Ruder, und man kann doch nicht annehmen, dass sie schlafen.«
»Die sind erst vor kurzem an einer ansteckenden Krankheit gestorben!«
Ja, das ist es eben! Mit der Pest geht's schnell. Die Cholera lässt in acht Tagen einen ganzen Passagierdampfer aussterben. Aber auch die Dysenterie genügt schon. Und auch die ist ansteckend.
Was nützt es da, wenn das ganze Schiff mit Gold befrachtet ist, und man bringt's nicht lebendig an Land?
»Leute, es ist ein ausgestorbenes Schiff, von einer Krankheit verseucht. Aber es könnte doch noch jemand am Leben sein. Ich muss hinüber. Wer begleitet mich? Freiwillige vor!«
So viele Matrosen an Deck waren, so viele meldeten sich. Dieser Opfermut hatte nichts mit Gottesfurcht zu tun. Diese wollen wir hier lieber aus dem Spiele lassen. Das wäre eine Herabsetzung jener anderen Sorte von Menschen. Und man darf überhaupt nicht missverstehen. Es gibt so manchen Matrosen, der keine zwei zusammenhängende Worte sprechen kann, ohne sich und alle Welt verdammen zu müssen, und unter der Teerjacke schlägt dennoch das allerwackerste Herz.
»Ihr könnt euch auf dem verpesteten Schiffe den Tod holen.«
»Macht nix.«
Weitere Worte wurden nicht verloren, Kapitän Oliver wählte sich vier Mann aus, und während ein Boot ausgesetzt wurde, begab er sich noch einmal in die Kajüte und kehrte mit einer großen Flasche und einer Art Blumenspritze zurück, tränkte sich und die Auserwählten mit Karbol.
Dann gingen sie ins Boot, tanzten hinüber. Eine lange Hakenstange und eine Strickleiter waren nicht vergessen worden, die letztere wurde an der hohen Bordwand eingehakt, der Kapitän hieß seine Leute warten, stieg zunächst allein hinauf.
Nach fünf Minuten erschien sein blasses Gesicht wieder über der Bordwand.
»Bill, Ned, kommt mit herauf — ihr könnt ganz ruhig sein, hier ist niemand an einer ansteckenden Krankheit gestorben.«
Die Matrosen sahen sich verwundert an.
»Was, niemand gestorben? Das mag der Deibel fressen, ich kann's nicht«, sagte der eine, welcher das ganze Evangelium Matthäi auswendig konnte.
»Die sind wohl alle besoffen?«, scherzte ein anderer, der es mehr mit dem Evangelium Marci hielt.
Der freundliche Leser versteht wohl, was hiermit angedeutet werden möchte. Er soll sich nicht etwa von solchen ›heiligen Matrosen‹ eine falsche Vorstellung machen. Und der Schreiber lässt die von ihm geschilderten Menschen immer genau so sprechen, wie sie im Leben wirklich sprechen.
Die beiden karbolduftenden Matrosen kletterten hinauf.
Ja, da lagen zwei Tote. Aber sie schnarchten.
Ned und Bill blickten sich an, blickten wieder auf die beiden Schläfer, blickten nach dem am Steuerrad zusammengesunkenen, doch sicherlich ebenfalls schlafenden Mann, und sie machten Bewegungen, als wollten sie sich die Augen reiben, weil sie fürchteten, selbst zu schlafen und nur zu träumen.
»Die Mistkäfer stinken ja nach Schnaps, nach Rum«, meinte dann der Evangelist Matthäus.
»Die Schweinehunde sind ja besoffen!«, setzte Evangelist Marcus hinzu.
Und dann beide Evangelisten aus gleichem Munde:
»So was lebt ja gar nicht!!«
»Ja, schlafen tun sie, aber dass sich die ganze Mannschaft so sinnlos bezecht hat, das ist doch wohl ausgeschlossen«, sagte hierauf der blasse Kapitän, welcher trotz aller Weltentsagung keine Predigten hielt, auch niemals fastete, vielmehr auf einen reichlich besetzten Tisch und auf einen guten Tropfen hielt.
Er sprach aus, worauf jetzt auch die beiden Matrosen kamen. Es mag ja manchmal auf einem Schiffe, auf dem die Disziplin gelockert ist, tüchtig gebügelt werden — aber dass sich der letzte Mann dermaßen betrinkt, dass er das Steuerrad nicht mehr halten kann — — nein, so etwas ist in der Weltgeschichte wohl niemals vorgekommen. Nicht in den Zeiten der alten Seeräuber und auch heute sogar noch nicht auf einem russischen Meutererschiffe.
Solch eine Vorstellung ist für einen Seemann einfach unmöglich. Ein Landbewohner mag sich eine illuminierte Pulverfabrik vorstellen.
Der Kapitän beugte sich herab, rüttelte diesen, rüttelte jenen — ganz erfolglos. Die Schläfer sägten weiter, einen Duft von Rum ausatmend, und dasselbe galt von dem Manne neben dem sich drehenden Steuerrade.
»Betrunken sind sie, aber... nein, das ist ja ganz unmöglich!!«
»Wisst, Käpt'n, ich weiß, was hier passiert ist«, nahm da der eine Matrose mit geheimnisvoller Miene das Wort.
»Nun?«, horchte der Kapitän hoch auf.
»Hier liegt ein großes Rätsel vor.«
»Ja, aber was für ein Rätsel?«
»Nu, eben ein großes Rätsel.«
Der junge Kapitän belächelte diese Weisheit des Matrosen nicht, auch sagte er ihm kein zürnendes Wort, sondern er wandte sich zur weiteren Untersuchung des Schiffes, um selbst die Lösung dieses Rätsels zu finden.
Eine offene Luke führte ins Zwischendeck hinab. Auf der Treppe lag wiederum ein Schläfer und machte bö — bö — bö. Er blies Suppe, eine besondere Art des Schnarchens.
Dann befanden sich die drei im Zwischendeck. Was sie hier erblickten, das war nun freilich für den Charakter der Mannschaft sehr belastend.
In dem sonst leeren Zwischendeck war eine lange Tafel aufgeschlagen, zwischen den Leisten standen noch Schüsseln, zum Teil noch Schiffskost enthaltend, ferner viele Flaschen und Gläser, eine riesige Punschbowle — und unter dem Tische und den Bänken lagen die, welche hier gezecht und geschmaust hatten, alle sinnlos betrunken, keines anderen Lautes fähig, als des Schnarchens, keiner anderen Bewegung, als die das schlingernde Schiff mit ihren willenlosen Leibern erzeugte.
»Die müssen ja haaahnebüchen gesoffen haben!«
»Und wie viele das sind!«
»Ja, Ned, sind wir denn hier wirklich an Bord eines Schiffes auf hoher See?!«
»Und was ist denn das?! Die Hälfte davon sind doch kleine... Jungen? Kinder?«
Die beiden starrten auf die kleinen Gestalten, welche da schlafend und zum Teil schnarchend umherlagen, und immer mehr veränderten sich ihre Gesichtszüge, nahmen den Ausdruck der größten Spannung an, wenn nicht des Schreckens.
»Bill, ahnst du etwas?«, brachte der eine endlich hervor.
»Das ist — am Ende — die ›Sturmbraut‹!«
Aus dem Munde des jungen Kapitäns kam ein heiserer Laut. Auch er hatte die halbwüchsigen Jungen angestarrt, dann wandelten seine Blicke umher, bis sie auf der riesenhaften Gestalt eines Mannes haften blieben, der etwas im Hintergrunde des Raumes lag, durch seine Kleidung nur wenig von den anderen verschieden.
Und da drohten die Augen des jungen Kapitäns die Höhlen zu verlassen, er wurde noch blasser.
»Die ›Sturmbraut‹ — Kapitän Jansen — er ist es, den ich seit zwei Jahren suche!«, flüsterten die schneeweißen Lippen, während aus den Augen plötzlich der Schein eines furchtbaren Triumphes hervorbrach.
In diesem Augenblicke machte der riesenhafte Mann — oder nennen wir ihn gleich Kapitän Jansen — eine Bewegung, stöhnte, richtete sich langsam mit halbgeöffneten Augen auf, stand mit einem Ruck auf den Füßen, griff sich an die Stirn, stöhnte noch schauerlicher, taumelte einige Schritte vorwärts und schlug mit schwerem Sturze seines hünenhaften Körpers abermals zu Boden.
»Auf ihn, bindet ihn!!«, zischte Oliver, und doch klang es wie ein Brüllen, damit stürzte er sich auf den jetzt mit dem Gesicht auf dem Boden Liegenden.
Die beiden Matrosen waren sofort zur Stelle, doch brauchte keine Gewalt angewendet zu werden, Jansen schlief schon wieder.
Schnell war er an Händen und Füßen mit Lederriemen gefesselt.
»Der Tiger von Honduras — wir haben diesen Bluthund!«, sagte der eine Matrose in einem Tone, als ob er selbst nicht daran glauben könnte, und auch für den Leser wird bei diesen Worten etwas Rätselhaftes sein.
»Schnell, schnell«, drängte Kapitän Oliver, »sie alle müssen gebunden sein, ehe sie aus ihrer Betäubung erwachen! Hinauf, Ned, drei Viertel der ganzen Mannschaft soll herüberkommen, gleich genügend Stricke mitbringen, fertig geschnitten!«
Eine Viertelstunde später war die ganze Mannschaft der ›Sturmbraut‹ gebunden, auch die Heizer, welche man unten vor den Kesseln gefunden, unter denen sie eben Feuer hatten machen wollen, um mitten in dieser Arbeit mit unverkennbarer Plötzlichkeit einzuschlafen. Der eine hatte noch das mit Petroleum getränkte Werg in der Hand, ja, wie sich später herausstellte, hatte ein Matrose oben den ganzen Mund voll Fleisch.
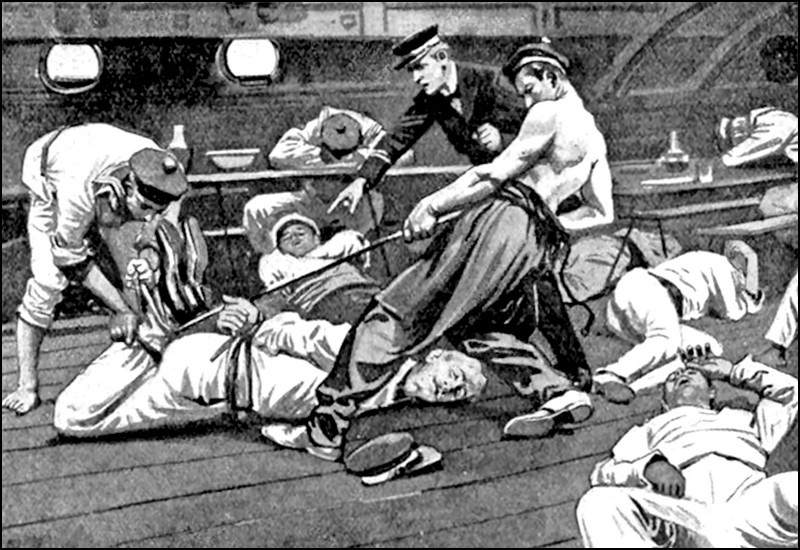
Tot war keiner, aber auch erwachen wollte niemand. Nur Kapitän Jansen bewegte sich noch einmal, Worte kamen über seine Lippen.
»Verflucht, verflucht«, stöhnte er, »der Rum ist vergiftet — das ist Laudanum!«
Dann schlief er weiter. Kapitän Oliver ließ ihn aufheben und in der Kajüte aufs Sofa legen, suchte und fand die Schiffsapotheke, flößte ihm Zitronensaft und andere Medizin gegen Opiumvergiftung ein, rieb ihn, war um ihn beschäftigt.
Aber nun in welcher Weise, der Ausdruck dabei in diesem blassen Gesicht, besonders wenn er einmal so still neben dem Schläfer saß und ihn betrachtete.
Es gibt eine Erzählung — leider weiß der Schreiber nicht genau, von wem die großartige Charakterschilderung ist, wahrscheinlich von Gerstäcker, in seinen ›Regulatoren‹. Ein einsamer Indianerhäuptling findet im Walde einen schwerverwundeten weißen Mann, oder er entreißt ihn erst den Händen seiner Feinde. Er trägt ihn in seine Hütte, verbindet die Wunden, wacht Tag und Nacht an seinem Lager, pflegt ihn liebevoll wie die Mutter ihr Kind. Und wie der Kranke endlich genesen ist, da... röstet der Indianer ihn langsam zu Tode. Das Blassgesicht hat seine Frau ermordet.
Und nun diese Schilderung, wie der finstere Indianer Tag und Nacht neben dem phantasierenden Kranken sitzt und ihn so liebreich pflegt, wie der Leser irregeführt wird!
Das hier war der erste Teil. Der zweite Teil würde wohl noch kommen, das sah man gleich diesem blassen Gesichte an.
Endlich schlug Jansen die Augen auf, starrte verständnislos den vor ihn Sitzenden an, schloss wieder die Augen, öffnete sie nochmals.
»Die haben in New York höllisches Laudanum in den Rum getan, den ich kaufte«, murmelte er, »wir fielen plötzlich alle um wie die Fliegen, auch ich — und — und — ich träume noch jetzt.«
Er schloss nochmals die Augen.
»Nein, Kapitän Richard Jansen, Ihr träumt nicht!!!«
Bei diesen scharf gesprochenen Worten riss Jansen seine Augen mit Vehemenz ganz weit auf, um den vor ihm Sitzenden anzustarren.
Jetzt riss er an seinen Banden, versuchte die Füße zu bewegen, und es war ihm gleich anzusehen, dass ihm schnell die Besinnung zurückkehrte.
»Teufel!! Gebunden? Hm. Verdammt!«
Er betrachtete das blasse Gesicht mit ziemlicher Gemütsruhe.
»Wer seid Ihr?«
»Kennt Ihr mich nicht?«
»Nein. Ganz fremdes Gesicht. Aber die Hauptsache ist jetzt wohl, dass Ihr mein Schiff überrascht habt. Seid Ihr Kapitän?«
»Ja.«
»Seid mit Eurem Schiff hier?«
»Ja.«
»Habt meine ›Sturmbraut‹ wohl ruderlos vor dem Winde treiben sehen?«
»Es herrscht Windstille!«
»Alles an Bord schläft?«
»Alles!«
»Ist kein Mann tot?«
»Keiner!«
»Gott sei Dank, dann ist es noch gut abgegangen mit dem Laudanum!«, erklang es mit einem Seufzer der Erleichterung.
Das also war Jansens erste Sorge gewesen: dass er und sein Schiff nun gefangen waren, das schien er vorläufig noch sehr leicht zu nehmen.
Wieder betrachtete er aufmerksam den vor ihm Sitzenden.
»Sagtet Ihr nicht vorhin, dass Ihr Kapitän wäret?«
»Ja.«
»Ihr seid aber noch verdammt jung.«
»Ja.«
»Was für ein Schiff fahrt Ihr?«
»Die ›Repentance‹.«
»›Repentance‹ — die Buße, Sühne — hm, ein merkwürdiger Name! Wohl eine Jacht?«
»Ja.«
»Ihr seid Jachtsportsman?«
»Ja.«
»Ich dachte es mir gleich.«
»Ja.«
Jansen begann über dieses ewige Ja doch zu stutzen. Auch dieser unbeschreibliche Ausdruck des starren, blassen Gesichts fiel ihm erst jetzt auf.
»Ja, Mann, wer seid Ihr eigentlich? Was habt Ihr nun mit uns vor?«
»Wer ich bin? Wer ich war, müsst Ihr fragen«, wurde der andere gesprächiger.
Aber es war begreiflich, dass Jansen diese Worte nur noch merkwürdiger fand als die frühere Einsilbigkeit.
»Kennt Ihr mich wirklich nicht?«, wiederholte der junge, blasse Kapitän seine vorige Frage.
Lange blickte Jansen ihn an, offenbar sein Hirn zermarternd. Er stand schon unter dem Einflusse eines geheimnisvollen Rätsels.
»Nein.«
»Wirklich nicht?«
Wieder eine lange Pause des Anblickens.
»Nein.«
»So will ich Euch erzählen, wer ich war, und... wer ich jetzt bin.«
Der junge Mann mit dem todblassen Gesicht neigte sich etwas vor. Er erzählte. Nun aber lässt sich leider nicht schriftlich wiedergeben, wie er erzählte. Er sprach in einem leisen, eigentümlich singenden Tone, der aber wie ein scharfes Messer in jedes Herz dringen musste.
»Einst war ich ein glücklicher Mensch. — — Ich nahm eine hohe Stellung ein, durch meine Geburt, wie durch meine Taten. — — Ich hatte schon viel geleistet. — — Ich durfte stolz sein. — — Und mein Vaterland war stolz auf mich. — — Und ich hatte ein Mädchen, das mich liebte. — — Es war meine Braut. — — So lag vor mir das Leben in goldenem Sonnenscheine. — — Den Tod fürchtete ich nicht. — — Denn ihn zu suchen, war mein Beruf. — — Ich war Offizier.«
Jetzt eine noch längere Pause, nur durch einen Seufzer unterbrochen.
»Und da kam das Schicksal. — — Es nahte sich mir in der Gestalt eines Mannes, den ich zum ersten Male sah. — — Man brachte mich in meine Heimat zurück. — — Zwei Matrosendivisionen und fünf Regimenter traten an. — — Und die Trommeljungen mussten vor die Front. — — Und ich musste vor die Front. — — Da riss man mir die Epauletten ab — — und zerbrach meinen Degen. — — Und ich ward ausgetrommelt...«
Es war die Schilderung, wie in England ein Soldat, Offizier oder Gemeiner, wegen eines ehrenrührigen Vergehens unter Trommelwirbel degradiert und ausgestoßen wird.
Wenn man das einmal gesehen hat, das vergisst man nicht! Es ist eine schreckliche Szene. Da muss das Spießrutenlaufen, welches mit dem Tode endet, noch eine Kleinigkeit gewesen sein.
Und wie nun dieser junge Mann sein Schicksal erzählte!! Mit wahrhaft entsetzten Augen starrte Jansen ihn an, und er wusste doch selbst nicht, wovor er sich so entsetzte. Es lag eben im Tone, in der ganzen Vortragsweise.
»Ausgetrommelt seid Ihr worden?«, brachte er endlich hervor.
»Ja. Mit Schimpf und Schande vor der ganzen Front ausgetrommelt!«
»Ja, Mann, weswegen denn?«
»Euretwegen.«
Es war nicht anders, als wenn auf Jansen der Blitz niedergefahren wäre.
»Was? Meinetwegen?!«, schrie er.
»Ja.«
»Ich?! Ich?!«
»Ja.«
»Mann, ich kenne Euch ja gar nicht?!«, schrie Jansen, immer mehr außer sich geratend.
»Nicht? Ich bin Lord Oliver von Leicester.«
»Lord Oliver von Leicester?«, wiederholte Jansen traumverloren, immer das blasse Gesicht anstarrend, »kenne ich nicht, habe diesen Namen noch nie gehört.«
»Ich war damals Kapitän zur See und erster Wachoffizier.«
»Auf welchem Schiffe?«
»Auf dem ›Prince Albert‹, den man den Stolz von England nannte.«
Wieder zuckte Jansen wie von einer Natter gestochen zusammen.
»Mein Gott — ja — jetzt erkenne ich Euch wieder — so furchtbar Ihr Euch auch verändert habt! Ihr wart der junge, schöne Offizier, der auf jener Felseninsel an der westafrikanischen Küste damals die englische Flagge aufpflanzen wollte, um dadurch von dieser Insel für England Besitz zu ergreifen.«
»Ich war es.«
»Ich ließ es nicht zu.«
»Ihr warft die englische Flagge ins Wasser.«
»Und dann Euch selbst.«
»Ihr tatet es.«
»Es geschah gar nicht mit Absicht, und es tat mir hinterher leid, sehr, sehr leid, ich habe oft daran gedacht, bereue es noch heute mit einer Art von Schamgefühl. Ja, weshalb aber hat man Euch da mit Schimpf und Schande ausgetrommelt?«
»Weil Ihr die englische Flagge ins Wasser warft.«
»Ich verstehe nicht.«
»Weil ich es nicht hinderte.«
»Ich verstehe immer noch nicht.«
»Weil ich Euch nicht sofort niederstach.«
Jansen schloss die Augen, blieb eine lange Zeit so liegen, und er ward in seinem Nachdenken nicht gestört.
Dann schlug er die Augen wieder auf.
»Ich jetzt glaube ich Euch zu verstehen. Euch muss doch ein regelrechter Prozess gemacht worden sein, nicht wahr?«
»So geschah es.«
»Die Anklage des militärischen Ehrengerichtes lautete darauf, Ihr hättet zugelassen, dass ich die englische Flagge beleidigte.«
»Ja, das war die Anklage.«
»Und es wurde Euch nun vorgeworfen, dass Ihr mich nicht sofort niedergestochen habt. Das wäre Euere Pflicht gewesen.«
»So sagte man.«
»Und weil Ihr das nicht getan habt, deshalb hat man Euch mit Schimpf und Schande ausgestoßen?«
»Ja.«
Da brach Jansen plötzlich in ein Lachen aus, welches fast herzlich klang.
»Na, da seid Ihr eben zum Sündenbock gemacht worden! Weil ich den Stolz Englands in den Grund schoss, brauchte man einen Sündenbock, der das alles auszubaden hatte, und weil Ihr mir gerade die Flagge gebracht hattet, deshalb musstet Ihr es sein.«
»So ist es.«
»Das seht Ihr wirklich ein?«
»Ja.«
»Dann ist es ja gut. Aber dann wundert mich nur, dass Ihr Euch das noch so zu Herzen nehmt, hat man Euere Güter konfisziert?«
»Das konnte man nicht.«
»Euch nur aus dem Heere gestoßen?«
»Und aus dem Adel.«
»Ist Euch denn daran so viel gelegen?«
»Nein.«
»Dann begreife ich gar nicht, weshalb Ihr da noch...«
Jansen brach ab. Er wusste selbst, dass er, der so ganz anders über Geld, Ehrenstellen und dergleichen dachte, so etwas niemals verstehen würde.
»Und Euere Braut?«
Dass er jetzt zunächst an diese dachte, das war auch so ganz einem Richard Jansen entsprechend, das war für ihn die Hauptsache.
»Lady Maxwell, die Tochter des Herzogs von Wellington.«
»Lady hin, Lady her — Weib ist Weib, Braut ist Braut! Hat auch sie Euch von sich gestoßen?«
»Nein.«
»Na, was wollt Ihr denn da noch mehr?!«
»Sie nahm Gift.«
Ein Blick nach dem Sprecher — ein unbeschreiblicher Blick — und der gebundene Mann drehte sich herum und vergrub stöhnend das Gesicht in den Polstern.
Das war etwas gewesen, was einen Richard Jansen ins Herz getroffen hatte!
Erst nach langer Zeit wandte er sich wieder um. Jetzt hatte die Farbe auch sein Gesicht verlassen.
»Also meinetwegen«, brachte er mühsam hervor. »Ich weiß schon, eigentlich bin ich ja ganz unschuldig — aber ich weiß schon — die Welt ist doch etwas anders, als wie ich Phantast sie mir vorstelle — ich lebe in meiner eigenen Welt — aber nach jener anderen Welt bin ich der schuldige Teil, wenn auch ganz indirekt. Nun, was wollt Ihr jetzt mit mir machen?«
»Hört, mich erst an!«
»Sprecht!«
»Ich war ruiniert. Wo in der Welt sollte ich mich mit meiner Schmach verbergen? Selbstmord? Ich habe meine Ansichten. Es gab auch noch etwas anderes. Man kann alles sühnen. Auf Eurem Kopfe stand ein hoher Preis. Er kann mich nicht reizen. Aber Euch lebendig an England ausliefern, das wäre eine Sühne gewesen, dann wäre ich sicher in Ehren wieder aufgenommen worden. Hinwiederum — ich denke gerecht. Ich bin von einem Vater und noch mehr von einer Mutter dazu erzogen worden. Was Ihr vorhin sagtet, das sah ich selbst ein. Ja, ich war nur ein Sündenbock. Aber es musste sein. Einer hatte die Folgen zu tragen — das Schicksal hatte mich dazu bestimmt. Ich konnte Euch noch entschuldigen.
Was hattet Ihr denn getan? Eine Insel, welche Ihr als Euer Eigentum betrachtetet, habt Ihr verteidigt. Ihr habt auf ein englisches Kriegsschiff, welches Euch bedrohte, geschossen, es gleich in den Grund versenkt...«
»Bei Gott, es ist nicht meine Absicht gewesen!«
»Ich glaube Euch. Noch andere glauben es. Aber es darf nicht geglaubt werden. Kapitän Jansen, ich habe Euch bewundert.«
»Aus welchem Grunde?«
»Fragt nicht so. Ihr hattet noch andere Bewunderer genug, und nicht nur sensationslüsterne Frauen. Ihr wart trotz alledem immer noch ein edler Mann.«
Jansen blieb die Antwort schuldig, musste es wohl. Aber es war ja selbstverständlich — er selbst hielt sich ja durchaus für keinen verworfenen Menschen.
»Mein Entschluss war gefasst«, fuhr Lord Oliver fort. »Ich musste Euch persönlich sprechen. Aber wie Euch, der Ihr rastlos in der Welt umhersegelt, eine Nachricht zukommen lassen? Ich annoncierte wiederholt im ›Lloyd‹, Euch um eine Zusammenkunft bittend...«
»Habt Ihr?«
»Wenigstens in zehn Nummern.«
Er nannte diese mit dem Datum. Sie hatte Jansen gerade nicht in seine Hände bekommen. Der vogelfreie Kapitän hatte sich ja nicht mehr um die seebehördlichen Vorschriften zu kümmern brauchen.
»Ich habe nur Barnums Adressen an mich gelesen. Wusstet Ihr davon nichts, dass ich auf offener See mit Barnums Passagieren eine Zusammenkunft hatte?«
»Damals hatte ich schon meine Jacht, befand mich seit langer Zeit auf See, erfuhr erst später davon.«
»Dann hielt ich mich fast eine Woche in New York auf.«
»Auch das erfuhr ich erst hinterher.«
»Ja, was hättet Ihr dann von mir gewünscht?«
Es war ein böses Zeichen, dieses Sprechen im Imperfekt, in der Form der Vergangenheit. Jetzt war ja diese Zusammenkunft erfolgt — nur freilich in ganz anderer Weise!
»Hättet Ihr Euch zu einer Unterredung eingefunden?«, fragte Lord Oliver erst noch.
»Ganz gewiss, und um so mehr, wenn ich gewusst, wer der Bittsteller sei, und was für ein schreckliches Schicksal er durch mich erlitten.«
»Ich dachte mir, dass Ihr gekommen wäret.«
»Und was hättet Ihr mir dann eröffnet?«, fragte Jansen nochmals.
»Ich hätte Euch zum Zweikampf auf Leben und Tod herausgefordert.«
»Aha! Ich dachte es mir fast.«
»Ihr wäret darauf eingegangen?«
»Ich bin zwar kein Freund vom Zweikampf, aber unter diesen Umständen hätte ich ihn sicher angenommen.«
»Wäre ich gefallen, so hätte sich die Sache überhaupt erledigt. Für Eueren Todesfall hättet Ihr in Bedingungen willigen müssen.«
»In welche?«
»Besitzt Ihr noch den sogenannten Aschantischatz?«
»Er ist gar nicht mein Eigentum, ich kann über ihn nicht verfügen.«
»Aber Ihr habt oder wisst andere Schätze.«
»Ja.«
»Eine Perlenbank im chinesischen Meer.«
»Ja.«
»Wiegt sie den Verlust des ›Prince Albert‹ auf?«
»Wie viel hat der gekostet?«
»Mit ihm sind fast zwei Millionen Pfund Sterling auf dem Meeresboden verloren gegangen.«
»Das wäre eine Kleinigkeit gegen jene Perlenbank. Sie ist groß und ungeheuer ausgiebig und unerschöpflich.«
»Wäret Ihr darauf eingegangen, dass Ihr mir dieses Euer Geheimnis verrietet, wenn ich Euch im Zweikampfe besiegte? Im Falle Eueres Todes konntet Ihr das ja vorher schriftlich niederlegen.«
»Sicher wäre ich darauf eingegangen.«
Und dass ein Kapitän Jansen das nicht nur jetzt sagte, weil er gebunden war, das musste auch für den anderen selbstverständlich sein.
»Das ist nun alles vorbei.«
»Das glaube ich wohl. Die Zusammenkunft hat in ganz anderer Weise stattgefunden. Das ließt Ihr Euch wohl auch nicht träumen, dass Ihr die ›Sturmbraut‹ steuerlos finden würdet, die ganze Mannschaft durch Opium oder gar Laudanum betäubt?«
In bitterstem Tone hatte Jansen es gesagt, und da plötzlich fuhr der andere empor.
»Ihr meint?!«
»Nun ja, jetzt habt Ihr es doch billiger. Ihr liefert mich und die ganze Mannschaft einfach an England aus; in meinem Schiffe findet Ihr schon genug, um den ›Prince Albert‹ und jenes Kanonenboot ersetzen zu können, und Ihr werdet Epauletten und Degen und alles wiederbekommen, werdet auch eine andere Braut wiederfinden.«
Der junge Kapitän war aufgestanden, trat zurück, streckte wie abwehrend beide Hände aus.
»O, Kapitän Jansen, wie habt Ihr alle Welt so furchtbar enttäuscht!«, erklang es in wahrhaft schmerzlichem Tone.
»Ich enttäuscht? Wieso?«
»Nicht nur ich, es gab noch tausend andere Männer, und nicht die schlechtesten, die Euch trotz alledem für einen Ehrenmann hielten, Euch mindestens als einen Ritter ohne Furcht und Tadel bewunderten.«
»Ja, was habe ich denn getan, dass sich dies geändert hat?«
»Ihr könnt auch noch fragen?! Ja, jetzt liefere ich allerdings Euch und Euere ganze Mannschaft dem Henker aus, denn ich mag meine Hände gar nicht mit Euerem Blute besudeln, an einen ritterlichen Zweikampf erst recht nicht zu denken.«
Wieder einmal blickte Jansen den Sprecher verständnislos an.
»Ja, was habe ich denn nur getan, dass Ihr jetzt so verändert zu mir sprecht?«
»Ihr könnt auch noch fragen?!«
»Nun lasst doch nur diese Andeutungen, sprecht frei heraus.«
»Der Tiger von Honduras!«
»Was soll das sein? Gebt Ihr diesen Namen etwa mir?«
»Ja, so werdet Ihr jetzt in der ganzen Welt genannt — der Tiger von Honduras. O, Kapitän Jansen, dass Ihr so ein Bluthund, so ein gemeiner Bösewicht wäret, das hätte ich Euch nimmer zugetraut!«
Jetzt war Jansens verständnisloses Gesicht erst recht begreiflich.
»Mir scheint, ich habe das Laudanum getrunken, und Ihr seid davon wahnsinnig geworden. Ich soll der Tiger von Honduras heißen? Die Republik Honduras in Zentralamerika? Ich bin ja noch gar nicht in Honduras gewesen.«
Der junge Kapitän schüttelte langsam den Kopf.
»Mich wundert nur, dass Ihr es jetzt auch noch zu leugnen versucht, anstatt mit Euerer Bluttat zu prahlen.«
»Mit was für einer Bluttat nur?«
»Ihr wollt es auch noch hören?«
»Jawohl, gewiss will ich's hören!«
»Ihr habt eine blühende Kolonie überfallen, geplündert und niedergebrannt...«
Jansen reckte seinen Kopf weit vor.
»Ich?!«
»Ihr habt gehaust, wie nur je ein Mordbrenner gewütet hat...«
»Ich?!«, rief Jansen mit immer länger werdendem Halse.
»Was sich von den Bewohnern nicht durch Flucht retten konnte, das habt Ihr niedergeschlachtet...«
»Ich?!«
»Ihr habt wehrlose Frauen geschändet...«
»Ich?!«
»Die Kinder ins Feuer geworfen und auf dem Straßenpflaster zerschmettert...«
»Ich?! Ich soll das getan haben?! Nun ist's aber genug! Wann soll denn das passiert sein?«
»Es sind noch keine drei Wochen her, ich komme soeben von jener Trümmerstätte.«
»Und was für eine Ansiedlung war das?«
»Caballos, ein Hafenstädtchen an der Küste von Honduras.«
»Vor drei Wochen? Da soll ich Caballos geplündert haben?«
»Wollt Ihr es etwa leugnen? Ich verstehe Euch nicht.«
»Da soll ich mit meiner ›Sturmbraut‹ in Caballos gewesen sein? Mit meiner ›Sturmbraut‹?«
»Gewiss, mit Euerem Schiffe habt Ihr das wehrlose Städtchen überfallen, habt es bombardiert.«
Jansens furchtbare Erregung lässt sich denken, und doch kam dabei etwas wie Lustigkeit hervor. Diese Anschuldigungen waren ja auch gar zu ungeheuerlich.
»Vor drei Wochen? Da lag ich ja mit meiner ›Sturmbraut‹ an der Küste von Tunis!«
»Erzählt doch keine Märchen! Ich verstehe überhaupt nicht...«
»Bei Gott, Mylord! Euch aber hat man ein Märchen aufgebunden! Fragt doch alle meine Leute, mit denen ich mich jetzt ja nicht mehr verständigen kann, woher wir kommen, wo wir vor drei Wochen gewesen sind. Da habe ich mit meiner ›Sturmbraut‹ vor Sfaks gelegen, einem tunesischen Hafennest. Wir wollen zurück nach Sfaks, Ihr sollt fragen.«
Es hatte den Anschein, als ob der Lord von Anfang an in Bezug auf seine Behauptungen etwas unsicher gewesen wäre.
»Wer hat Euch denn nur dieses Märchen aufgebunden, dass ich mit meiner ›Sturmbraut‹ in Honduras gewesen und dort geplündert haben soll?!«
»Es ist kein Märchen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugt, alle meine Leute haben die noch rauchenden Ruinen gesehen, haben die letzten Einwohner von Caballos jammern und erzählen hören.«
»Ja, wer hat denn das aber getan?!«
»Ihr wart es wirklich nicht?«
»Na, Mylord, nun macht Euch doch nicht lächerlich — doch nein, da ist nichts Lächerliches dabei, hier liegt vielmehr offenbar ein ungeheuerlicher Missbrauch meines Namens vor...«
Jansen richtete sich auf, die Hände auf dem Rücken gebunden.
»Bei dem Angedenken meines Weibes, welches ich liebte«, erklang es feierlich, »bei der Seligkeit meines armen Kindes — ich habe nichts mit dieser Gräueltat in Honduras zu tun!«
Da ging es wie ein Sonnenschein über das blasse Gesicht des jungen Kapitäns.
»Habe ich es doch fast nie glauben können, so sehr man mich auch überzeugen wollte. Nein, ein Kapitän Richard Jansen ist solch einer Tat nimmer fähig.«
Er griff hinter sich, brachte ein Dolchmesser zum Vorschein und durchschnitt dem noch Aufrechtsitzenden die Fesseln an den Händen und dann an den Füßen.
Mit grenzenlosem Staunen blickte Jansen ihn an.
»Ihr gebt mich frei?!«
»Die Unterredung ist jetzt so zustande gekommen, wie ich sie mir gewünscht hatte. So ganz frei gebe ich Euch nicht. Doch jetzt seid Ihr für mich wieder der frühere Kapitän Jansen, den ich bewundere, was ich durch ihn auch erlitten haben mag. Aber das ist vorläufig Nebensache, hier muss erst jener Fall aufgeklärt werden.«
Ja, das war jetzt die Hauptsache. Der Lord erzählte, was er erfahren, wovon er dann noch das Resultat zu sehen bekommen hatte.
Caballos ist ein Hafenstädtchen mit zweitausend Einwohnern an der Küste von Honduras, führt außer den einheimischen Produkten — davon bemerkenswert Kakao, Vanille und Sarsaparille — besonders viel Holz aus, auch teure Farbhölzer — es ist der Stapelplatz des im Gebirge gewonnenen Silbers, der Fluss Ulua, an dem es liegt, ist sehr goldhaltig, die Hälfte der Einwohner beschäftigt sich mit der Goldwäscherei.
Daraus aber zu schließen, Caballos wäre eine reiche Stadt oder gar ganz Honduras ein reiches Land, das wäre ganz verkehrt. Ja, von Natur sind diese Länder ja alle überreich gesegnet, in den Händen eines energischen Volkes könnten sie auch noch etwas werden, aber gegenwärtig ist Honduras ein ganz armseliges Land.
Was für eine Bewandtnis es mit dem Finden von Gold hat, darüber hat sich schon Jansen mit eigenen Worten ausgesprochen. Gold wird ja überall gefunden, selbst im Meerwasser ist Gold vorhanden, und zwar, hat man sich ausgerechnet, für dreißig Billionen Mark — Billionen, das sind Million mal Million, was sich der menschliche Verstand überhaupt nicht vorstellen kann — aber dieses Gold da herauszubekommen, das ist die Sache!
Und so ähnlich ist es auch mit dem Golde, das man aus der Erde kratzt und aus den Flüssen wäscht. Die Goldaktiengesellschaft, die zehn Prozent Dividende verteilen kann, ist schon sehr zufrieden. Goldfunde wie in Kalifornien, Australien und Klondyke bedeuten das große Los in der Lotterie der Goldgräberei.
So ist es auch dort unten. Der auf eigene Rechnung waschende Arbeiter, der wöchentlich auf zehn Mark kommt, gilt schon für einen Glückspilz.
Immerhin, es waren in Caballos ziemliche Mengen von Silber und Gold vorhanden gewesen. Was für Schulden auf den Barren lasten, das sieht man ihnen ja nicht an.
Da war in den Hafen von Caballos ein großer Dreimaster gekommen.
»›Sturmbraut‹, Kapitän Jansen«, hatte er signalisiert.
Auch bis hierher war die Kunde von diesem Seeräuberschiffe — wie es nun einmal genannt wurde — gedrungen, und der Schreck war furchtbar.
»Die Stadtbehörde an Bord!«, hatte das Schiff weiter kommandiert.
Der Magistrat hatte gehorcht, sich zitternd an Bord begeben. Was für Verhandlungen da stattgefunden, wusste man nicht.
Jedenfalls gar keine, die Magistratspersonen waren als Geiseln behalten, wenn nicht getötet worden.
Auch sonst ließ sich der Kapitän gar nicht auf Verhandlungen ein, plötzlich donnerten die Bordgeschütze, zunächst die Hauptgebäude in Trümmern legend, dann mit Kugeln und Granaten die ganze Stadt verwüstend, und gleichzeitig begaben sich die Matrosen an Land, um zu plündern und zu morden.
Hatte die spanische Bevölkerung vielleicht an einen Widerstand gedacht, so war dieser bei Beginn der Kanonade doch sofort gebrochen. Alles floh den nahen Wäldern zu, und was sich nicht rechtzeitig flüchten konnte, das wurde niedergemacht.
»Wie die Vandalen haben sie gehaust. Eben wie Seeräuber, wie die Flibustier, die ja auch oft genug diese Gegenden heimgesucht haben. Sie waren nicht zufrieden mit dem, was sie an Silber und Gold und sonst in den Häusern fanden. Auch auf Lebensmittel und Spirituosen hatten sie es besonders abgesehen. Die Gefangenen, die sie machten, wurden auf scheußliche Weise gefoltert, um von ihnen zu erfahren, wo man das Gewünschte fände. Sie wurden geröstet, mit Messern zerfleischt. Das artete immer mehr in wollüstige Mordgier aus. Wie man da gegen die Weiber verfahren ist, ist ganz selbstverständlich. Und man begnügte sich nicht mit der Schändung, es wurde ein allgemeiner Lustmord daraus. Selbst an den Martern der kleinsten Kinder hatte der ausbrechende Wahnsinn seine Freude. Als es nichts mehr zu morden und zu brennen gab, kehrten die Matrosen auf ihr Schiff zurück, segelten davon.«
Der Erzähler schwieg. Jansen war eisern geworden.
»Ihr wart selbst dort?«
»Ja. Ich befand mich gerade in Trujillo, als die Kunde von dem scheußlichen Vorgange dorthin kam. Ich dampfte sofort hin. Ein spanisches Kriegsschiff war auch schon dort, welches die Untersuchung leitete.«
»Nun, und?«
»Ich habe meinem Bericht kaum noch etwas hinzuzusetzen.«
»Also ich gelte für den Urheber?«
»Ja, man ist fest davon überzeugt.«
»Hat sich der Kapitän auch noch später für mich ausgegeben?«
»Nein. Nur dadurch, dass er ›Sturmbraut, Kapitän Jansen‹ signalisierte. Er selbst führte die Mörder an, es war ein wahrer Riese, und auch sonst trifft seine Beschreibung ganz auf Euch zu.«
Es war nur ein ganz flüchtiger Gedanke, dass Jansen einmal an seinen Doppelgänger aus dem Mormonenland dachte. Wenn er eines Lächelns fähig gewesen, so hätte er ihn gleich belächelt.
»Wie viele Matrosen waren es?«
»Die sich an der Plünderung beteiligten, schätzt man allein auf mindestens fünfzig Mann.«
»So viele habe ich gar nicht an Bord.«
»Man nimmt an, dass Ihr, nachdem Ihr den wahren Seeräuberberuf ergriffen, noch mehr Desperados um Euch versammelt habt. Dann war das Schiff noch immer stark besetzt.«
»Weiß man nicht, dass ich viele halbwüchsige Jungen an Bord habe?«
»Man weiß es, aber weil man diese nicht sah, konnte man ja nicht schließen, dass Ihr es nicht wäret. Dann stellt Euch doch nur die ganze Situation vor.«
»Was für ein Schiff war es?«
»Ein Dreimaster, Vollrigger, vielleicht tausend Tonnen. Konnte sehr gut für die Sturmbraut gehalten werden. Dass Ihr Euer Schiff ständig maskiert, ist ja bekannt.«
»Und die Geschütze?«
»Einige sprachen von drei Kanonen, andere von zwanzig und noch mehr. Diese Berichte stammen von solchen, welche in wildester Flucht nach dem Walde geflohen waren. Also durchaus nicht maßgebend.«
»Hatte das Schiff besondere Kennzeichen, welche auch den bestürzten Einwohnern auffielen?«
»Es war maskiert, hatte aus Brettern einen hohen Aufbau, also auch darin hatte man Euch nachzuahmen versucht, aber es war so plump gemacht, dass man es gleich bemerkte.«
»Haben sich denn die Einwohner gar nicht zur Wehr gesetzt? Ist ihnen kein Gefangener in die Hände gefallen, hat man denn keinen Verwundeten gefunden?«
»Nur einen Toten, der von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden. Nach dem Schnitt seines strohblonden Haares muss es ein Skandinavier gewesen sein. Sonst fand man nichts Auffälliges an ihm.«
»Weiß man, wohin sich das Schiff gewendet haben mag?«
»Gar nichts wusste man damals, als ich nach Caballos kam, zwei Tage nach dem Überfall. Das spanische Kriegsschiff hat sich ganz planlos auf die Jagd gemacht; es wird überall alarmieren, soweit dies nicht schon geschehen ist. Der Telegraf wird wohl bereits die ganze Welt benachrichtigt haben.«
»Dass es die ›Sturmbraut‹, dass dieser Unhold Kapitän Richard Jansen gewesen ist?«
Eine kleine Pause der Verlegenheit, bis der Lord diese überwunden hatte.
»Man konnte ja nichts anderes glauben. Der Schiffsführer hatte seinen Namen genannt, und... es war besonders die riesige Gestalt des Kapitäns, welche die Täuschung vervollständigen musste.«
»Also auch Ihr wart überzeugt, dass ich es wirklich gewesen bin?«
»Kapitän, macht mir keine Vorwürfe. Wie ich Euch bisher beurteilte, habe ich schon gesagt. Aber man hat Euch wie ein Wild gejagt, und Ihr wart ein vogelfreier Desperado...«
»Schon gut, schon gut!«, fiel Jansen dem anderen ins Wort. »Ihr habt Euch ja gar nicht zu entschuldigen. Wolltet Ihr Euch aber nicht ebenfalls an der Jagd auf den blutigen Unhold beteiligen?«
»Gewiss, jetzt brannte ich erst recht auf eine Wiederbegegnung mit Euch.«
»Wusstet Ihr denn, wohin sich der Seeräuber gewendet haben mochte?«
»Ich hatte davon so wenig Ahnung wie ein anderer.«
»Ja, wie kommt es da, dass Ihr Euch nach Osten gewendet habt?«
Wieder wurde der Lord etwas verlegen.
»Zum ersten Male in meinem Leben bin ich abergläubisch geworden, ließ mich durch einen Traum beeinflussen«, sagte er dann. »Glaubt Ihr, dass es Wahrträume gibt, prophetische Träume?«
»Nein, für gewöhnlich nicht; doch ich will nicht abstreiten, dass es solche gibt. Gerade ich hätte Grund, an sie zu glauben. Aber ich selbst habe, so weit ich es beurteilen kann, noch keinen gehabt.«
»Nun, ich selbst habe einen gehabt; er hat mich belogen, und dennoch hat er mich auf die richtige Fährte geführt, Euch nämlich finden lassen. Meine Absicht war, längs der Küste Zentralamerikas entlang zu segeln, in der Erwartung, dass der Freibeuter noch mehreren dieser südamerikanischen Städte, die schon so viel unter den Flibustiern zu leiden gehabt haben, seinen Besuch abstatten würde, und es war wohl ganz richtig, wenn ich die nördliche Richtung einschlug, wo sich blühendere Kolonien finden als im Süden.
Aber es sollte anders kommen. In der Nacht, bevor ich diese Fahrt angetreten, hatte ich einen Traum. Ich bin in Algier gewesen, und dorthin wurde ich im Traume versetzt. Und dort fand ich Euere ›Sturmbraut‹, war an Bord und sprach mit Euch. Was, weiß ich nicht, der Traum wurde undeutlich, ich erwachte.
Das Eigentümliche aber war nun, wie mir eine innere Stimme zuflüsterte, diesen Traum als einen prophetischen aufzufassen, ihm zu folgen, mich nach Algier zu begeben, dort würde ich Euch finden. Wie gesagt, ich habe noch nie etwas auf Träume gegeben, habe noch nie beglaubigt bekommen, dass ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Hier aber war es ein ganz undefinierbares Gefühl, welches mich förmlich zwang, gegen meine Vernunft zu handeln. Denn solltet Ihr Euch wirklich nach Algier gewendet haben? Was wollte denn dieser Freibeuter unter den Kanonen Algiers? Ihr habt wohl in New York mit Euerem Schiffe liegen können...«
»Ich bin überhaupt gar nicht in Algier gewesen«, bemerkte Jansen zunächst einmal.
»Ihr habt es nicht auf Euerer Mittelmeerfahrt angelaufen?«
»Nein, ich bin überhaupt nie in Algier gewesen.«
»Hattet Ihr auch nicht die Absicht, Euch dorthin zu begeben?«
»Ich habe mit keinem Gedanken daran gedacht.«
»Da sieht man, was auf Träume zu geben ist. Und doch, bin ich nicht richtig geführt worden? Indem ich die Richtung nach Gibraltar einschlug, bin ich Euch hier begegnet, musste Euch und Euer ganzes Schiff in einem hilflosen, ohnmächtigen Zustande finden. Es ist wunderbar! Und es wird immer wunderbarer, je länger man sich alles überlegt. Ich wäre doch gar nicht imstande gewesen, es mit Euch aufzunehmen. Als ich meine ›Repentance‹ ausrüstete, wollte ich mich ja hauptsächlich von der Welt zurückziehen, eine Wiederbegegnung mit Euch dem Zufall überlassend. Um an Bord möglichste Ruhe zu haben, wählte ich als Besatzung sogenannte ›heilige‹ Matrosen aus. Kennt Ihr diese Bezeichnung?«
Jansen bejahte mit flüchtigem Lächeln.
»Dann wisst Ihr auch, dass es sonst gar tüchtige Matrosen sind.
Jeder ist ein ganzer Mann, auch für den Fall, dass es zum Kampfe mit einem Seeräuber kommen sollte. Aber hätte ich die Absicht von vornherein gehabt, auf Euch als auf einen Piraten Jagd zu machen, so hätte ich mir doch ein ganz anderes Schiff angeschafft, als Matrosen besonders Novascotiamen gewählt. Doch, wie gesagt, an so etwas dachte ich ursprünglich ja gar nicht. Ich hielt euch für alles andere, als für einen Seeräuber. Ich hoffte auf einen Zufall, um mit Euch eine vernünftige Unterredung zu haben — allerdings einen Zweikampf betreffend. So habe ich außer den üblichen Handwaffen auch nur zwei Böllerkanonen an Bord.
Da musste sich mein Urteil über Euch auf eine so furchtbare Weise ändern. Wenn ich Euch jetzt traf, dann musste es zum Kampfe kommen. Aber was wollte ich denn mit meinem schwachen Schiffchen gegen das Euere?
Kurz, ich schalt mich einen Narren, als ich einem Traume gehorchte, um Euch in Algier zu suchen. Und da muss ich Euch hier in einem ganz unbefahrenen Wasser treffen! Muss Euer ganzes Schiff in einem ohnmächtigen Zustande finden! Und da gebt Ihr mir die Überzeugung, dass Ihr gar nicht jener Wüterich von Honduras seid, also findet unsere Unterredung auch so statt, wie ich sie ursprünglich geplant hatte. Ihr seid für mich noch immer ein satisfaktionsfähiger Ehrenmann O, es ist wunderbar!«
»Ja«, entgegnete Jansen, »Shakespeares Wort bleibt bestehen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Geträumt habt Ihr allerdings, aber Erfolg habt Ihr nur dadurch gehabt, dass Ihr Euerer Vernunft nicht gehorchtet. Ich selbst könnte solche Sachen genug erzählen. Dann sind auch in Euerer Geschichte für mich noch Rätsel genug vorhanden. Vor vier Wochen ist jener Überfall geschehen?«
»Gestern waren es vier Wochen.«
»Ihr habt doch eine Dampfjacht?«
Jansen konnte sie durch ein Bullauge liegen sehen.
»Ja, und ich verstehe gleich, was Ihr meint. Weshalb ich nicht schon in Algier bin, wie ich überhaupt hier in dieses unbefahrene Wasser westlich von der Fucusbank komme. Mir gebricht es nicht etwa an Kohlen, wohl aber habe ich einen Maschinendefekt gehabt. Ich brach gleich am anderen Tage von Caballos wieder auf, durchquerte sechs Tage später die Fucusbank mit der vierten Straße, genannt die Straße von Flores, kam drei Tage später wieder heraus, hätte also in zehn Tagen in Algier liegen können. Da versagte die Maschine, der Defekt konnte nicht gefunden werden. Wir hatten hier immer steifen Wind aus Südosten, gegen den ich vierzehn Tage lang angekreuzt habe, ohne viel von der Stelle zu kommen. Gestern war der Maschinendefekt repariert, ich nahm den Kurs nach Gibraltar wieder auf, war aber unterdessen hoch nach Norden verschlagen worden — da muss ich heute Euerer ›Sturmbraut‹ begegnen! Und dabei stieg mir nicht die geringste Vermutung auf, dass das führerlose Schiff die von mir gesuchte ›Sturmbraut‹ sein könne. O, es ist wunderbar!«
Jansen war aufgestanden, dehnte die gefesselt gewesenen Glieder.
»Die Hauptsache ist, dass Ihr Euer Ziel erreicht habt. Und wenn Ihr auch meine Fesseln gelöst habt, so betrachte ich mich doch als Euren Gefangenen.«
»Ihr sollt frei sein.«
»Aber ich stehe zu Eurer Verfügung.«
»Eben deswegen müsst Ihr frei sein.«
»Ist es Euch noch immer ernst mit einem Zweikampf auf Tod und Leben?«
»Ja.«
»Mylord«, begann Jansen in anderem Tone. »Ich dächte doch, wir hätten uns nun schon ausgesprochen. Es wäre wirklich besser, wenn sich zwei Männer wie wir die Hand zur Versöhnung reichten, um...«
Jansen hatte seine Rechte schon ausgestreckt, aber jener wandte sich mit finsterem Gesicht ab.
»Ihr wollt meine Hand nicht nehmen?«, fragte Jansen in schmerzlichem Tone.
»Ich darf nicht«, erklang es murmelnd zurück.
»Ihr könnt mir nicht verzeihen?«
»Doch, ich habe Euch ja gar nichts zu verzeihen, wie ich schon gesagt, aber... o, hätte ich damals doch den Schwur nicht abgelegt!«
»Was für einen Schwur? Doch lasst, das geht mich nichts an. Ihr müsst unbedingt einen Zweikampf mit mir bestehen?«
»Es ist meine heilige Pflicht.«
»Auf Leben und Tod?«
»Einer von uns muss bleiben.«
»Das ist gar nicht so leicht zu machen, mit welchen Waffen wir uns auch schlagen.«
»Bis einer kampfunfähig ist.«
»Dann braucht er noch nicht tot zu sein.«
»Wenn er von seiner Verwundung wiederhergestellt ist, dass er die Waffe wieder halten kann, so ist er verpflichtet, den Zweikampf fortzusetzen, und vergeht darüber auch ein ganzes Jahr. Seid Ihr damit einverstanden?«
»Wenn Ihr darauf besteht, so bleibt mir nichts anderes übrig, so leid es mir auch tut.«
»Dann bestimmt die Waffen.«
»Das möchte ich lieber Euch überlassen.«
»Nein, Ihr sollt sie bestimmen, auch das gehört zu meinem festen Entschluss.«
»Aber ich weigere mich.«
»So soll das Los entscheiden.«
»Einverstanden!«
Der Lord griff mit englischer Bündigkeit in die Westentasche und brachte ein Geldstück zum Vorschein.
»Pistole oder Säbel, ist Euch das recht?«
»Ja.«
»Kopf ist Pistole, Wappen ist Säbel.«
»Werft!«
»Tut Ihr es!«
Jansen nahm die Silbermünze ohne weiteres, warf sie in die Luft, fing und zeigte sie. Es war der Kopf zu sehen.
»Also auf Pistolen!«, sagte der Lord.
Jansen nickte vergnügt. Auch mit dem Säbel wusste er recht gut Bescheid, besser als mit dem Stoßdegen — aber mit der Pistole war er, wie wir wissen, seiner Sache erst recht sicher.
»Ist Euch gleichzeitiges Schießen auf Kommando recht?«
»Einverstanden!«, entgegnete Jansen.
»Zwanzig Schritt sind wohl eine normale Distanz.«
»Ganz, wie Ihr wünscht.«
»Denkt nicht etwa, dass ich Euch schonen werde.«
»Das wäre wohl auch sehr merkwürdig, nachdem Ihr mich zwei Jahre lang auf dem Wasser gesucht habt. Habt Ihr es denn aber gar so eilig, mich ins Jenseits zu befördern?«
»Eure vorige Bemerkung beantwortet diese Frage von selbst. Natürlich werde ich Euch Zeit lassen, dass Ihr Euch von den Folgen des Betäubungsmittels erholen könnt.«
»Das wäre das Wenigste, ich habe schon jetzt eine ganz ruhige Hand. Aber ich möchte Euch auch sonst noch um einige Frist bitten.«
»Wozu?«, fragte der Lord mit einigem Stutzen.
»Ich habe vor meinem eventuellen Tode noch etwas zu ordnen.«
»Das hätte ich bei Euch, einem vogelfreien Desperado, nicht erwartet.«
»Nicht? Früher war dies allerdings nicht der Fall, jetzt ist aber doch noch etwas hinzugekommen. Ist nicht begreiflich, dass ich nicht gern von hinnen fahren möchte, ehe ich bewiesen, dass ich nichts mit jener Mordbrennerei in Caballos zu tun habe? Selbst ein Pirat, wie ich einer sein soll, hält auf eine gewisse Ehre, die er, wenn sie ihm geraubt wird, wiederherstellen möchte.«
Der Lord bekämpfte ein unmutiges Gefühl.
»Ich werde Eure Unschuld bezeugen.«
»Wenn Ihr es könnt. Auch Ihr könntet vorher Euren Tod finden, durch Schiffbruch oder sonst wie.
Aber abgesehen davon — ist mir denn zu verargen, wenn ich jenen Herrn, meinen Doppelgänger, der meinen Namen missbraucht hat, vorher erst noch einmal sprechen möchte?«
»Auch Sie wollen sich an der Jagd auf jenen Seeräuber beteiligen?«, fragte der Lord düster.
»Wenn er unterdessen noch nicht gefangen ist, ja.«
»Und wie wollen Sie das anfangen, ihn auf dem endlosen Meere zu finden, wenn er sich jeder Verfolgung zu entziehen weiß?«
»Ah, Mylord, Sie fürchten, ich könnte so schlau sein, wie jener Mann in alten Zeiten, der wegen eines Verbrechens sein Leben verwirkt hatte: als letzte Gunst gewährt man ihm, dass er sich selbst die Art seines Todes wählt, und da zieht er sich den Tod aus Altersschwäche vor. Nein, Mylord, solche Hintergedanken habe ich nicht. Ich bitte nur um eine Frist von... drei Monaten. Ist bis dahin die Auseinandersetzung mit meinem Doppelgänger nicht erfolgt, so stehe ich dennoch zu Ihrer Verfügung.«
»Gut, diese Frist sei Ihnen gewährt!«
»Ich danke Ihnen. Über alles andere können wir ja dann noch später sprechen.«
Die Matrosen der ›Repentance‹ bekamen den Befehl, die Gebundenen wieder zu befreien. Von diesen war noch kein einziger wieder zu sich gekommen; Jansens eiserne Natur hatte den Betäubungstrank am schnellsten überwunden, bei ihm zeigten sich nicht einmal üble Nachwirkungen.
Besonders durch Behandlung mit kaltem Wasser erwachten auch die anderen nach und nach aus ihrem todähnlichen Schlafe, da aber wusste noch kein einziger, was eigentlich passiert war, bei vielen hielt der fürchterliche Katzenjammer mehrere Tage an.
Dies konnte nicht die Folge eines bloßen Zechgelages gewesen sein. Ja, ein solches hatte gestern Abend allerdings stattgefunden, es wurde auch schon erwähnt, dass es dabei ganz ausnahmsweise lustig an Bord der ›Sturmbraut‹ zugegangen war, die Mannschaft hatte eben die Erlösung von einem Geisterbanne gefeiert, aber dass sich alle so sinnlos betrunken hätten, das war bei Kapitän Jansens Manneszucht ja ganz ausgeschlossen.
Es war überhaupt mehr eine Schmauserei gewesen, bei der natürlich auch das Trinken nicht hatte fehlen dürfen. Da gerade nichts zu tun gewesen, hatte auch die Wache im Zwischendeck daran teilnehmen dürfen, und dass Kapitän Jansen auch dieser ein übermäßiges Trinken erlaubt hätte, das war wieder ganz ausgeschlossen, das hatten auch die Matrosen der ›Repentance‹ gar nicht glauben können.
Und völlig ausgeschlossen waren überhaupt der wachegehende Steuermann, der Mann am Ruder und der auf dem Ausguck gewesen. (Der eine an Deck liegende Mann war nämlich kein Matrose gewesen, sondern der zweite Steuermann Martin.)
Nur als dann der an Bord obligate Grog gebraut worden war, hatten auch diese davon ein Glas nach oben bekommen, nur ein einziges, das aber hatte genügt.
Jansen hatte dazu ein frisches Fässchen Rum öffnen lassen, welches er mit vielem anderen Proviant in New York eingenommen. Ahnungslos hatte er den Grog gebraut, ihn gekostet und für gut befunden.
Der Gedanke lag doch eigentlich sehr nahe, dass man in New York versuchen konnte, die Mannschaft des ›Pulverschiffes‹ durch Gift aus dem Wege zu räumen, wenn der Kapitän so leichtsinnig war, sich in der feindlichen Stadt, wenn man sich so ausdrücken darf, mit Proviant und Getränken zu versehen.
Ja, dieser Gedanke musste doch eigentlich sehr nahe gelegen haben — konnte man hinterher sagen! Von der ganzen Mannschaft der ›Sturmbraut‹ hatte kein einziger an so etwas gedacht! Es ist ja überhaupt merkwürdig, dass Räubernaturen, selbst wirkliche Verbrecher, gewöhnlich nicht nur einen leichtsinnigen Charakter haben, sondern in gewissem Sinne geradezu naiv und harmlos sind. Doch möchte man da das Wörtchen ›echt‹ vorsetzen, nämlich ›echte‹ Räuber und dergleichen ›Mordbuben‹ — das heißt, alle die, welche, wenn sie in ihrem blutigen oder spitzbübischen Fache Außerordentliches geleistet haben, dann später als Helden verherrlicht werden, wenn auch nur vom oder für das breite Volk. Ja, dem alten Verse von dem Manne, der kein braver ist, wenn er niemals einen Rausch gehabt, liegt sogar ein gar tiefer Sinn oder richtiger eine gar tiefe Erkenntnis des menschlichen Charakters zugrunde. Ein wirklicher Schuft, der so gefährlich ist, dass man seinen immer saubergewaschnen Händen womöglich auch noch Ehrenämter anvertraut, wird sich tatsächlich niemals betrinken, aus Furcht, da könne sich sein wahrer Charakter einmal offenbaren.
Jeder hatte sein Glas Grog getrunken, zwei Glas, als ihnen allen fast gleichzeitig die Besinnung schwand.
Innerhalb fünf Minuten lagen sie alle wie die Fliegen da.
Als Steuermann Martin gemerkt hatte, wie sich bei ihm plötzlich alles drehte, war ihm gerade noch gelungen, von der Kommandobrücke herunterzukommen, da war er neben dem Matrosen, welcher schon schlief, ebenfalls zusammengebrochen.
Auch Jansens Natur hatte diesem Betäubungstrank unterliegen müssen. Er hatte den heißen Grog schon vorher mit einigen großen Zügen gekostet, so gehörte er mit zu den ersten, welche schlafend niederfielen.
»Das ist Laudanum!«, war sein letzter klarer Gedanke gewesen. Laudanum nennt man die weingeistige Lösung des Opiums. Es scheint, dass sich das Opium hierdurch verändert, d. h. andere Eigenschaft annimmt, obgleich das chemisch nicht nachzuweisen ist.
Aber es ist ein großer Unterschied, ob man Opium direkt zu einem Schlaftrunk verwendet, also nicht wie in diesem Falle es dem Rum zusetzt, oder ob man erst eine weingeistige Lösung des Opiums herstellt und diese dann nach einiger Zeit einem Getränk beimischt.
In Rum kann man Opium gar nicht herausschmecken. Aber in ersterem Falle, wenn man direkt Opium beimischt, wird man die nach und nach eintretende Schläfrigkeit noch rechtzeitig bemerken, um Gegenmittel anwenden zu können, mindestens um nicht weiter zu trinken.
Ganz anders beim Laudanum. Dieses scheint zuerst gar nicht zu wirken, man merkt gar nichts von Schläfrigkeit — bis es mit einem Male ist, als ob man einen Schlag auf den Kopf bekommt. Seine Wirkung ist urplötzlich. Merkwürdig ist auch, dass Laudanum trotz seiner viel intensiveren Wirkung doch eigentlich nicht so gefährlich ist wie direktes Opium, man kann viel mehr davon einnehmen, ohne, wie beim Opium, gleich in den Tod hinüberzuschlummern. Hingegen macht der Genuss des Laudanums den Menschen noch viel schneller zum Idioten als das Opium.
Dieses Laudanum hat besonders in Amerika bei der Ausrottung der Indianer eine traurige Rolle gespielt. Durch Gift direkt töten wollte man sie nicht, das ging gegen das ›Gewissen‹ jener Herren, die im Parlament saßen und die Ausrottung der Söhne des großen Geistes sogar von der Kanzel herab predigten, weil es ›Heiden‹ seien, aber ihnen durch Laudanum die gesunde Vernunft rauben, dass sie willenlos auf jeden Vertrag eingingen, das beschwerte nicht ihr Gewissen.
Die Leute der ›Sturmbraut‹ waren durch kaltes Wasser und andere Mittel wohl einmal zur Besinnung gebracht worden, aber arbeitsfähig waren sie noch lange nicht, sie schliefen gleich wieder ein und sollten noch einige Tage brauchen, ehe sie sich vollständig erholt, das Gift wieder aus dem Körper geschwitzt hatten.
Nur für Kapitän Jansens stählerne Natur hatte der nachfolgende, freilich mehr denn zwölfstündige Schlaf genügt, um alle schädlichen Einflüsse des narkotischen Giftes zu überwinden. Wenn er noch Kopfschmerzen hatte, so merkte man ihm doch davon nichts an.
So war er jetzt, wie die Matrosen der ›Repentance‹, zunächst um seine Leute beschäftigt, die nach dem ersten Erwecken, was bei allen gar nicht einmal gelang, gleich wieder in Schlaf oder doch in einen lethargischen Zustand verfielen.
Diese fremden Matrosen mussten aller Voraussicht noch längere Zeit die ›Sturmbraut‹ bedienen, und ohne im Innern weitere Umschau zu halten, bekamen sie doch gleich recht Merkwürdiges von diesem Zigeunerschiff zu sehen.
Zuerst hatten sie alle Schläfer finden wollen, nur daraufhin hatten sie das ganze Schiff durchstöbert, so auch die vor den Kesseln schlafenden Heizer entdeckt, im Maschinenraum den zweiten Ingenieur und den Schmierer, von denen dasselbe galt wie von der unbedingt nötigen Wache an Deck.
Aber da hatten sie auch, als sie nach der Foxel gegangen waren, unter der Back auf einer festgelaschten Kleiderkiste eine seltsame, fremde und allen Seeleuten doch so wohlbekannte Gestalt sitzen sehen...
»Der Klabautermann!!!«, war der entsetzte Ruf erschallt. Gottesfurcht oder Frömmigkeit schützt nicht vor Aberglauben, nicht vor den Glauben an Gespenster. Gerade die kernfrommen Naturen haben nie an einem persönlichen Teufel gezweifelt. Das beste Beispiel dafür ist Luther, in neuerer Zeit der Engländer Spurgeon, wohl der einflussreichste Prediger der Welt, die ganze Heilsarmee könnte dafür ins Feld geführt werden.
Also auch diese ›heiligen Matrosen‹ glaubten wie alle anderen an den fliegenden Holländer, an böse und gute Seegespenster, zu welch letzteren auch der Klabautermann gehört.
Das Gerücht war schon immer zirkuliert, dass die ›Sturmbraut‹ einen guten Geist an Bord habe, einfach den Klabautermann; daher auch das Glück dieses Piratenschiffes, welches unversehrt aus jeder Gefahr hervorging, daher auch die Schätze des Kapitäns, manchmal seine scheinbare Allwissenheit, seine Unverwundbarkeit, — denn dass damals der Kaperkapitän dicht vor Jansens Augen seine Pistole abgebrannt hatte, das und anderes mehr war schnell genug bekannt geworden — kurzum, Kapitän Jansen musste mit Geistern in Verbindung stehen.
Aber es ging hierbei, wie es immer geht: so sagte man, aber man glaubte es nicht; oder auch gerade umgekehrt: je weniger man im Innern an der Existenz solcher Geister, wie des Klabautermannes zweifelte, desto mehr leugnete man es mit Worten des überlegenen Spottes.
Und da sahen diese Matrosen ihn plötzlich sitzen, den Klabautermann, so wie schon die Großväter ihn beschrieben hatten, die ihn mit eigenen Augen geschaut, wie alle Literatur der Seeleute ihn schildert, die Stereotypbilder ihn wiedergeben: in dem altholländischen Kostüm mit Pumphosen, Schnallenschuhen und großen Glasknöpfen, mit den runden Eulenaugen, auf seiner Kleiderkiste sitzend, im zahnlosen Munde die lange Kalkpfeife...
Der Schreck der fremden Matrosen lässt sich denken. Da half alle Gottesfurcht nichts. Und nur noch misstrauischer konnte man deshalb werden, dass des Piratenkapitäns erste Aufmerksamkeit diesem zu Fleisch und Blut gewordenen Spukgespenst der See galt.
Dass die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ ihren Klabautermann damals nicht auf der Fucusinsel zu Tischkoffs Gesellschaft zurückgelassen hatte, war so selbstverständlich, dass wir es gar nicht besonders erwähnt haben. Die ›Sturmbraut‹ wäre ohne den Klabautermann ebenso wenig wie ohne Kapitän Richard Jansen die echte ›Sturmbraut‹ gewesen.
Sonst hatte sich an dem Klabautermann nichts geändert. Wenn er nicht in einer Koje der Foxel schlief, saß er rauchend auf seiner Kleiderkiste, stumpfsinnig vor sich hinblickend, hilflos wie ein kleines Kind, das gefüttert werden muss. Wie Tischkoff ihn seinerzeit manchmal zu einem lebendigen, vernünftig sprechenden Menschen ›galvanisiert‹ hatte, das war und blieb allen ein Rätsel, von selber wiederholte sich dieser Vorgang auch nicht.
Der Klabautermann war der einzige, dem das Laudanum nichts geschadet hatte — einfach aus dem Grunde nicht, weil er nichts von dem vergifteten Grog getrunken; er verschmähte alle SpirituosenGetränke, schluckte sie nicht, ließ sie, ohne auszuspucken, wieder aus dem Munde laufen, wenn man sie ihm einflößte.
So hatte der arme Kerl länger denn zwölf Stunden unentwegt auf seiner Kleiderkiste gesessen, ohne Nahrung. Daran also dachte Jansen zuerst, und dass sich das alte Kind wirklich nicht allein zu helfen gewusst, das zeigte, wie gierig es das gereichte Wasser trank, aus dem Löffel die schnell bereitete Speise schluckte.
Selbst Lord Leicester unterlag dem allgemeinen Eindruck, mochte er auch sonst nicht an den Klabautermann geglaubt haben.
»Wer ist das?«, flüsterte er mit scheuen Augen.
»Das kann ich Ihnen selber nicht sagen. Der einzige lebende Mensch, den wir einmal auf einem sonst verlassenen Wrack fanden.«
Jansen erzählte diese Geschichte genauer, ohne speziell auf den altholländischen Charakter jenes Wracks einzugehen, noch weniger erwähnte er dabei etwas von Tischkoff und dessen Experimenten mit dem Klabautermann.
Er versuchte trotzdem dem Ganzen eine natürliche Erklärung zu geben, musste aber auch gestehen, dass seine Leute diesen unbekannten Mann als ihren Schutzgeist, eben als den Klabautermann betrachteten.
Die fremden Matrosen hatten diese Erklärung gehört. Ihr Kapitän hatte ihnen bereits erzählt, dass ein anderer unter der Maske Jansens und seines Schiffes jene Gräueltat verübt habe. Ist die erste Signatur eines jeden echten Christen überhaupt, dass er seinem Feinde verzeiht, nichts von Rache wissen will, so hatten diese Seeleute schon an sich Grund, mitleidvoll auf diesen Mann zu blicken, dem das Schicksal so übel mitgespielt hatte — eben weil sie Seeleute waren, verstanden sie gleich den Kern der ganzen Sache, wie leicht es doch für das Verhängnis ist, aus einem braven Kapitän einen vogelfreien Desperado zu machen, wenn er, ein Michael Kohlhaas zur See, aus gerechtfertigtem Trotz sich den feindlichen Mächten nicht fügen will.
Aber diesem Mitleid mischte sich auch scheues Misstrauen bei. Wer es mit Gespenstern hält, auch wenn diese Fleisch und Blut angenommen haben, der kann kein wahrhaft redlicher Mann mit tadellosem Gewissen sein. Und zu solchem Misstrauen, einem gottesfürchtigen Herzen entspringend, fand man in diesem Schiffer immer mehr Grund.
Diese kleinen Matrosen, Kinder noch, die schon so alte Gesichter hatten — was für eine Bewandtnis hatte es mit diesen? Geheimnis! Aber Geheimnis und Zauberei sind verwandte Begriffe.
Und in der Kajüte auf einem Sofa hatte man eine lebensgroße Figur aus Holz liegen sehen, eine Frau mit einem Kinde auf dem Arm darstellend — die Seeleute erkannten auf den ersten Blick, dass es wohl eine abgebrochene Galionsfigur sei — aber was hatte die in der Kajüte auf dem Sofa zu tun?
Jansen versäumte, hierfür eine Erklärung zu geben — leider. Oder auch nicht leider. Hätte man seine Erklärung geglaubt? Oder wäre dadurch nicht alles nur noch viel rätselhafter geworden?
So war das Urteil schnell fertig.
»Du sollst Gott deinem Herrn allein dienen. — Und jener, ja, die ganze Mannschaft treibt mit einer aus dem Meere gefischten Galionsfigur Abgötterei!«
Kein einziger Mund wagte das auszusprechen. Es war gar zu ungeheuerlich. Aber jeder dachte es sich. Auch Blicke können reden.
Und nun war da noch ein drittes oder viertes großes Geheimnis vorhanden, abgesehen von den zahllosen kleineren, die dieses Schiff barg, welches aller Erklärung spottete.
An Deck, zwischen Kombüse und Kommandobrücke, befand sich ein hölzerner Aufbau, aus lauter kleinen Käfigen bestehend, welche Möwen enthielten.
Nicht nur die an sich doch ungebildeten Matrosen hätten hierin ein Geheimnis gewittert. Wer befasst sich mit Möwen? Wer fängt die zwar treuen, aber doch ganz unnützen Begleiter eines jeden Schiffes, um sie in Käfige zu sperren?
Nun ja, Naturforscher, welche Tiere fangen und ausstopfen, sie an Naturaliensammlungen verkaufen. Aber mit Möwen ist da ein schlechtes Geschäft zu machen. Möwen sind billig. Schon die Sandbänke an der Elbemündung liefern genug, um alle Naturalienkabinette der Welt mit Bälgen zu versorgen. Ja, wenn es seltene Arten gewesen wären! Aber das hier waren ausschließlich ganz gemeine Möwen, die man überall mit der Angel fangen kann.
Und zu diesen Käfigen war Kapitän Jansens zweiter Gang. Niedergeschlagen saßen die Tiere hinter den Gittern, wie jede gefangene Möwe. Aber was war das? Was für ein Leben kam da plötzlich zwischen die Vögel, als sich ihnen die riesenhafte Mannesgestalt näherte? Jansen zerhackte Fleisch, und... gierig rissen es ihm die Raubvögel aus den Fingern!
Schon das war ein Wunder. Hat man schon einmal eine Möwe im Käfig, in einem Vogelbauer gesehen? Wohl schwerlich. Im zoologischen Garten wird sie dadurch am Leben erhalten, dass man ihr die Flügel verschneidet und ihr so möglichste Freiheit gibt, sie am besten auf den offenen Ententeich hinaus lässt. Von da kehrt sie, wenn der Hunger sich meldet, nach dem gewohnten Futterplatze zurück. Aber in einem Verschlage würde sie niemals etwas fressen, aus der Hand nun gleich gar nicht, sie stirbt am zweiten Tage des Hungertodes.
Und hier geschah auch etwas ganz anderes! Als Jansen die Trinknäpfe füllte, öffnete er sorglos die Türen; ein und die andere Möwe flatterte heraus, beschrieb einen weiten Kreis, um sich dann auf des Kapitäns Schulter niederzusetzen, um sich streicheln zu lassen, wie sie selbst ihren krummen Schnabel an seine Wange schmiegte, an sein Ohr, als wenn sie etwas hineinflüstere.
Den Matrosen begann zu grauen. Es war nicht nur, dass sie das Zähmen einer Möwe nach allgemeiner Ansicht für unmöglich hielten. Seeleute betrachten Möwen überhaupt mit besonderen Augen. Sie sehen nicht gern, wenn ein Passagier oder ihr freidenkender Kapitän eine der treuen Begleiterinnen des Schiffes mit der Angel fängt, geschweige denn schießt. Es existiert darüber nicht gerade ein Verbot — es ist dabei immer die alte Geschichte, dass man fürchtet, sich durch Aberglauben lächerlich zu machen — doch zahllos sind die Geschichten über die, welche eine Möwe aus frevelndem Übermute getötet haben, wie die dann vom Unglück verfolgt worden sind.
Und dieser Kapitän Jansen nun, schon an sich ein von Geheimnissen aller Art umsponnener Mann, hatte Möwen gezähmt! Einfach übernatürlich — noch einfacher Hexerei!
Die Matrosen sollten noch ganz anderes zu sehen bekommen, obgleich nicht einmal alles, und das war gut!
»Sie haben die Möwen gezähmt?«, fragte zunächst der junge Lord, fast mit nicht minder scheuen Augen.
Jansen bejahte lakonisch.
»Nur aus Liebhaberei?«
»Nein.«
»Wozu sonst?«
»Mylord! Das hier ist ein Zigeunerschiff. Ja, wir sind von jeher Zigeuner gewesen — Seezigeuner! Und Zigeuner sind nun einmal ein eigentümliches Volk, sie haben ihre Geheimnisse, welche sie nicht verraten dürfen. Verzeiht mir meine Offenheit!«
Ja, Zigeuner! Denkt man beim Hören dieses Wortes nicht immer gleich an Wahrsagerei und dergleichen geheimnisvolle Künste?
So hatten die fremden Matrosen erst recht allen Grund, diesen Mann mit scheuen Augen anzublicken.
Und gut also, dass sie nicht erfuhren, was der Kapitän dann tat. Jansen begab sich in seine Arbeitskabine, nahm einen Bogen sehr dünnes, aber festes Papier, begann mit einer ganz kleinen, sogenannten Zeichenfeder winzige Buchstaben darauf zu kritzeln.
Er schrieb an Tischkoff, berichtete ihm im kürzesten Telegrafenstile über die noch gut abgelaufene Vergiftung mit Laudanum, etwas ausführlicher dann, was er über seinen Doppelgänger in Honduras erfahren, um im Briefstile zu schließen:
Und nun beschwöre ich Sie, mir zu sagen, wo ich dieses Schiff zu suchen habe!
Sie können es! Ich zweifle nicht mehr, dass Sie eine Sehergabe besitzen. Zum ers
ten Male bitte ich Sie, davon in meinem Interesse willkürlich Gebrauch zu ma
chen.
So, das genügte! Auch eine Unterschrift war nicht nötig. Jansen schnitt alles überflüssige Papier weg, faltete den Brief ganz klein zusammen, nahm aus dem Schreibtisch ein Knäuel Seidengarn, begab sich wieder an Deck.
Und abermals fürchteten sich die fremden Matrosen mehr, als dass sie darüber staunten, wie Jansen eine Möwe aus dem Verschlage nahm, ihr ein Papier an den Leib band und sie dann mit einem Schwunge in die Luft warf.
Sofort schoss die Möwe mit der Schnelligkeit eines Pfeiles dem Südwesten zu, war im Nu den Augen verschwunden.
Was war das gewesen? Zauberei! Nur einer wusste eine Erklärung, die ihm dann freilich erst recht über seine Begriffe ging.
»Wie? Sie haben diese Möwen wie die Tauben zur Beförderung von Briefschaften abgerichtet?!«, rief der Lord in grenzenlosem Staunen.
»Ja.«
Wohin die Möwe bestimmt war, das wagte der junge Lord gar nicht mehr zu fragen, auch er war ganz kopfscheu geworden.
Zwei Stunden verbrachte Jansen untätig neben dem Vogelkäfig, höchstens einmal auf und ab gehend, sonst unausgesetzt nach Südwesten spähend, wo die abgesandte Möwe verschwunden war.
Da kam es von dorther wie ein weißer Streifen wieder herangesaust, und plötzlich saß in ihrem engen Verschlage wieder die Möwe, sich das weiße Gefieder putzend.
Jansen nahm sie — ja, sie hatte unter den Brustfedern ein Zettelchen, aber ein anderes, und auf diesem stand mit Tischkoffs steiler Hand geschrieben:
Durchqueren Sie die Fucusbank in der Straße von Corvo.
Nichts weiter! Es genügte für Jansen. Er traute der Sehergabe seines Kommodore, wusste bestimmt, dass er der falschen ›Sturmbraut‹ in diesem Fahrwasser begegnen würde.
Am anderen Tage konnte die ganze Mannschaft der ›Sturmbraut‹ wieder ihrer Arbeit nachgehen, wenn auch noch mit schwerem Kopfe.
Nach einer kurzen Unterredung mit dem Lord war dieser mit seinen Matrosen wieder auf die ›Repentance‹ hinübergegangen; diese folgte der ›Sturmbraut‹ im Kielwasser.
Das nächste war, dass aller Proviant, den man in New York eingenommen, ohne Prüfung über Bord geworfen wurde, selbst die zugelöteten Konservebüchsen. Man hatte ja schon von allem gegessen, ohne üble Folgen zu spüren, aber unter den vielen Zentnern von Hülsenfrüchten brauchte ja nur eine einzige Erbse zu sein, die etwas ausgehöhlt und mit Zyankali gefüllt war, sie hätte vielleicht genügt, um die ganze Mannschaft der ›Sturmbraut‹ ins Jenseits zu befördern. Nur dem in New York eingenommenen Trinkwasser durfte man trauen, das lässt sich ja nicht so portionsweise vergiften.
Sonst hatte man seine Lektion bekommen. Wie die ›Sturmbraut‹ fernerhin zu verproviantieren sei, das war ein Problem, welches erst noch gelöst sein wollte. Da konnte man wieder an den Vergleich mit den Schmetterlingen und den Seeblumen denken.
Nun, für zwei Wochen war doch noch genug Proviant vorhanden, von dem alten noch, und bis dahin würde schon Rat geschafft worden sein.
Am dritten Tage steuerte man in die Straße von Corvo ein. Über die Eigenschaften der ganzen Fucusbank hat schon Kapitän Jansen seine eigenen Mitteilungen gemacht. Diese ungeheuere, schwimmende Graswiese wird ja von zahlreichen Schiffen durchkreuzt, auch von Seglern, unter Zuhilfenahme von freien Wasserstraßen, welche die Natur selbst geschaffen hat.
Dabei darf man aber nicht an schmale Straßen denken. Es gibt deren fünf, die man genauer kennt, und jede ist viele, viele Meilen breit, da sieht man hüben und drüben nichts von dem grünen Fucus, da kann jedes Segelschiff einen Sturm überstehen, und kommt es der grünen Grenze zu nahe, so kann es auch noch durch den Seetang segeln, ohne befürchten zu müssen, von den grünen Armen des wuchernden Todes umschlossen zu werden; denn hier ist das noch meilenbreit nur treibender, nicht festgewachsener Fucus.
So ist diese Fucusbank für die Schiffe überhaupt gar nicht so sehr gefährlich. Sonst würde man ja auch viel mehr davon hören. Nur vor den festgewachsenen Teilen, die allerdings gewissermaßen ganze Kontinente bilden, müssen sich die Schiffe hüten, aber die kann man eben auch als festes Land betrachten, deren Grenze das Schiff ebenso meidet, wie jede andere Küste.
Vier Tage lang durchdampfte die ›Sturmbraut‹ diese sogenannte Straße von Corvo, immer gefolgt von der ›Repentance‹, ohne ein anderes Schiff zu erblicken.
Gewiss, es waren sicher noch mehr Schiffe in dieser Straße, welche als Verbindungslinie zwischen dem Mittelmeer und Südamerika ja ziemlich befahren ist — schon die von Portugal kommenden Schiffe benutzen eine nördliche Straße — aber sie ist eben so breit, dass ein oder einige Dutzend Schiffe nebeneinander fahren können, ohne sich gegenseitig in Sicht zu bekommen.
Morgen würde man auf der anderen Seite das offene Meer gewinnen. Durfte man dann noch hoffen, jenem Piratenschiff zu begegnen? Durfte man denn überhaupt etwas auf Tischkoffs Prophezeiung geben? War in dieser Vertrauensseligkeit nicht etwas wie heller Wahnsinn?
Jansen sprach nicht. Unentwegt stand er auf der Kommandobrücke, ab und zu das Fernrohr vors Auge führend.
Und dasselbe galt von der gesamten Besatzung. Über der ganzen ›Sturmbraut‹ lag ein unheimliches Schweigen.
Jansen hatte der versammelten Mannschaft mit kurzen, dürren Worten geschildert, wie furchtbar ein anderes Schiffsvolk den Namen der ›Sturmbraut‹ missbraucht hatte — das hatte unterdrückte Wutschreie, Racheschwüre und geballte Hände erzeugt — dann hatte Jansen gesagt, dass er an Tischkoff eine Möwenpost gesendet, was für eine Antwort er erhalten — weiter nichts, dann war das unheimliche Schweigen eingetreten, welches aber mehr sagte als Worte.
Ja, ein jeder hoffte noch immer felsenfest, dass jener rätselhafte Mann, der jetzt als Gefangenaufseher dort im Norden auf der einsamen Fucusinsel hauste, sie nicht umsonst durch diese Straßen von Corvo geschickt habe.
»Wir haben ja noch Zeit bis morgen.«
Das war das einzige, was darüber heute einmal gesprochen wurde.
Kurz vor Sonnenuntergang stieg ein dichter Nebel auf. Die ›Repentance‹ war aus irgendeinem Grunde gerade zurückgeblieben, war bis außer Rufweite gekommen, nicht einmal die Dampfpfeife erreichte sie mehr, und dann war sie schnell im Nebel verschwunden.
Das war fatal. Aber auch die ›Sturmbraut‹ musste ihre Fahrt aufgeben. Es wäre selbst für einen echten Seeräuber unverantwortlich gewesen, in diesem undurchdringlichen Nebel, in dem man von der Kommandobrücke aus nicht einmal mehr den Fockmast erkennen konnte, noch vorwärts zu fahren, was übrigens nur mit Hilfe der Maschine geschehen konnte. Man befand sich doch immer in einer begrenzten Wasserstraße, die Möglichkeit war vorhanden, ein anderes Schiff zu rammen, und das wäre ja der eigene Schaden gewesen.
So ließ man die ›Sturmbraut‹ mit der schwachen Strömung nach Westen treiben. Das Heulen der Nebelhörner genügte als Warnung. Ab und zu ein Signal aus der Dampfpfeife war für die ›Repentance‹ bestimmt, von der man aber nichts zu hören bekam.
Als die Sonne eines neuen Tages aufging, trieb der einsetzende Westwind schnell den Nebel davon. Von der ›Repentance‹ war nichts zu sehen, dagegen stand da in einer Entfernung von einer Seemeile ein stattlicher Dreimaster.
Wie ein elektrischer Strom ging es plötzlich durch die ganze Mannschaft der ›Sturmbraut‹.
»Da ist er, das ist dieser Bluthund, der sich für uns ausgegeben hat!!!«
Nichts, auch gar nichts berechtigte zu dieser Annahme. Dieses Schiff hatte eine ganz andere Form als die ›Sturmbraut‹, und wenn man auch an eine Maskierung dachte — — es konnte doch ebenso gut ein anderer Segler sein, sodass der richtige noch immer zu erwarten war, wenn man nun einmal an Tischkoffs Prophetengeist durchaus nicht zweifeln wollte.
Aber es war eben die bestimmte Ahnung, die jedes Herz erfüllte, und von dieser musste wohl am sichersten Kapitän Jansen überzeugt sein, sodass er sofort Vorbereitungen zum Kampfe traf.
»Möglichst das Leben schonen, es wird nur mit dem Gummiknüppel gearbeitet!!«
Solche wurden alsbald verteilt, unauffällig, denn man war schon in Sehweite, dass man mit bloßen Augen ziemlich deutlich unterscheiden konnte.
Erwähnenswert ist dabei, dass diesmal niemand an eine Wiederverwendung der Heißwasserpumpe dachte, obgleich solch ein heißes Bad bei diesen Bluthunden doch recht angebracht gewesen wäre. Aber da hätte einer und der andere tödlich verbrüht werden können, und lebendig wollte man sie alle haben!
Und man sollte sich denn auch in seiner Ahnung nicht getäuscht haben!
Auf dem anderen Schiffe hatte der plötzliche Anblick von der ›Sturmbraut‹ einen ebensolchen starken Eindruck gemacht.
In höchster Eile wurden die letzten Segel gesetzt und die Rahen gerichtet; die in der Takelage beschäftigt gewesenen Matrosen glitten herab, traten offenbar zu einer Beratung zusammen, und da gingen auch schon Flaggen hoch.
»Hier ›Sturmbraut‹, Kapitän Richard Jansen. Streicht die Segel!«
Auf unserer ›Sturmbraut‹ ein Augenblick des lähmenden Staunens, und dann ein allgemeiner Wutschrei, den kein Mund hatte vorsichtig unterdrücken können, und es war auch nicht nötig gewesen, Jansen hatte seinen Entschluss schon gefasst gehabt.
Er hatte auf der Kommandobrücke bereits die riesenhafte Gestalt eines Mannes gesehen, der die Manöver leitete, doch offenbar den Kapitän, seinen Doppelgänger, und dessen Anblick raubte ihm ganz die Besinnung, obgleich er nach seiner Weise ganz ruhig blieb oder vielmehr dadurch erst recht eiskalt wurde.
»Hoch unser Signalement, ganz genau dasselbe, auch ganz genau derselbe Befehl!!!«
Und so gingen auf seinem Schiffe genau dieselben Flaggen hoch.
»Hier ›Sturmbraut‹, Kapitän Richard Jansen. Streicht die Segel!«
Ja, das machte allerdings Eindruck! Jetzt trat auch dort drüben eine plötzliche Lähmung jeglicher Bewegung ein, und nicht nur für einen Augenblick, sie währte viel länger — und nicht wie vorhin hier aus Wut, aus Entrüstung, sondern aus ehrlichem Schreck.
Die dort hatten unter dem Namen der ›Sturmbraut‹ ein Schiff plündern wollen, unter der wohl ganz richtigen Annahme, dass schon die Angabe dieses gefürchteten Namens genügen würde, um jeden Widerstand zu beseitigen — und nun war dies die echte ›Sturmbraut‹! Denn ein anderes Schiff wäre wohl nicht so leicht auf die Idee gekommen, ebenfalls solch einen Missbrauch zu treiben — oder jetzt hatten auch jene ihre Ahnung!
Doch dann kam wieder Leben in die Erstarrten, und wenn man auch die Kommandos nicht verstand, so war trotzdem sofort zu erkennen, dass sich jene nicht ohne Widerstand ergeben wollten.
Ein Hin- und Herlaufen, Kanonen wurden abgedeckt, aus den aufgeklappten Stückpforten kamen die Mündungen anderer zum Vorschein.
Nur einer dachte an die Ungleichheit des Kampfes, wie Jansen ihn einleiten zu wollen schien — Mahlsdorf.
»Kapitän, unsere Geschütze sind noch nicht klar!«
»Kein einziger Schuss darf fallen«, lautete die Antwort, als Kommando gegeben. »Nur der Gummischlauch wird gehandhabt! Und nicht gar zu kräftig, Jungens, dass nicht gar zu viele Köpfe in Trümmer gehen! Lebendig wollen wir sie haben! Volldampf voraus!«
Und der Zweikampf zwischen den beiden Schiffen begann.
In fünf Minuten musste die ›Sturmbraut‹ mit ihren zwölf Knoten Fahrt die eine Seemeile gemacht haben.
In diesen fünf Minuten hatte das feindliche Schiff nur zweimal Zeit, seine Geschütze abzufeuern. Es mussten mindestens zehn Kanonen sein, welche gegen die ›Sturmbraut‹ böllerten.
Bei der ersten Salve krachte und prasselte es in der Takelage der ›Sturmbraut‹, donnernd stürzten ganze Rahen an Deck, dann folgte ein Regen von Holzsplittern.
Niemand kümmerte sich darum. Vorwärts, vorwärts!!
Hierauf kam als Einleitung für die zweite Kanonade eine Salve von Gewehrkugeln.
Diese konnte den Matrosen der ›Sturmbraut‹ nichts anhaben, sie lagen, wie so oftmals eingeübt, wohlgeborgen hinter der hohen Bordwand, klar zum Sprung, zum Entern.
Nur ein Opfer war schon gefordert worden — der Mann am Ruder. Denn bisher hatte man noch nicht daran gedacht, diese Stelle auf der Kommandobrücke mit einer Panzerung zu umgeben, nicht einmal für ständig mit einer Holzplanke, welche ja auch höchstens gegen Gewehrkugeln schützt.
Mit der Panzerung der Kommandobrücke unserer heutigen Kriegsschiffe ist es ja überhaupt eine eigentümliche Sache. Den freien Blick hindert die Schutzwehr unter allen Umständen, da helfen keine ›Gucklöcher‹, und einer Granate widersteht solch eine Stahlwand niemals, mag sie auch noch so stark sein, sie bricht einfach um.
Und hat man denn etwa früher, als die Schiffe hundert und mehr Kanonen führten, eine Panzerung gekannt? Oder wie ist es denn heute in der offenen Feldschlacht?
Was fällt, das fällt eben, ein anderer muss einspringen, und so ist es schließlich auch noch heute für den Mann am Ruder.
Auch hier lagen noch drei Matrosen zur Reserve in Deckung am Boden. Zunächst aber sprang Jansen, als der Matrose, wahrscheinlich von einer Gewehrkugel getroffen, zusammengebrochen war, selbst an das Steuerrad, um es nicht wieder aus den Händen zu lassen, wobei er dennoch zugleich durch das Sprachrohr die Maschine beherrschen konnte.
Dann krachte die zweite Breitseite. Diesmal wurde bei der großen Nähe der Rumpf der ›Sturmbraut‹ getroffen, das ganze Schiff erzitterte, bäumte sich förmlich auf.
Was tat's, ob es leck geschossen war für immer? Die Hauptsache war, dass kein Unterwasserschuss dabei gewesen, oder richtiger, dass die ›Sturmbraut‹ überhaupt noch die Fahrt fortsetzen, das feindliche Schiff noch erreichen konnte.
Und das sollte auch gelingen.
»Klar zum Entern!!! Entert über!!!«
Vier Enterhaken fielen, und dann waren die Matrosen der ›Sturmbraut‹ drüben, auch genug von den halbwüchsigen Jungen, die hier ebenfalls ihren ganzen Mann stellten.
Es war ein völlig ungleicher Kampf.
Höchstens dreißig Gummischläuche waren es, die von mehr als fünfzig Revolvern, Messern und Entersäbeln empfangen wurden.
Aber es war das wütende Anlaufen der Berserker, welche die zur Schildkröte gepanzerten römischen Legionen stets durchbrochen haben — allerdings um stets auch bis zum letzten Manne ihren Tod zu finden.
Hier gilt das Gleichnis nur für den ersten Teil, der zweite Fall sollte nicht eintreten.
Das Hervorspringen der von Jansen zu Athleten ausgebildeten Matrosen geschah mit zu großer Plötzlichkeit, ihr Ansturm war gar zu furchtbar.
Wie eine sich entladende Donnerwolke stürzte man sich plötzlich auf den Feind.
Dieser bekam gar nichts zu sehen, kein einziger konnte aus seinem Revolver mehr als einen Schuss abfeuern, an einen Gebrauch des Messers oder des Entersäbels war erst recht nicht zu denken.
Da waren die zur fürchterlichen Wut gereizten Rächer schon über ihnen, die ihren Namen missbraucht hatten, die Gummiknüppel hieben zu, es war wie ein einziger Schlag — und noch einmal — und noch einmal! — es klang manchmal, als ob irdene Töpfe zersprängen — aber es waren keine Töpfe, sondern Köpfe — und dann half wohl auch noch die Faust nach.
Jansen selbst hatte in dem Augenblick, da sich die beiden Bordwände berührten, das Steuerrad fahren lassen, setzte mit drei mächtigen Sprüngen die Kommandobrücke entlang, mit gleichen Füßen über das Geländer hinweg, und dann hatte er auf der anderen Brücke seinen Doppelgänger gepackt.
Doch man konnte ihn gar nicht seinen Doppelgänger nennen. Das Gesicht war ein ganz anderes, die Gestalt mochte ein wenig kleiner sein als die Jansens, dafür aber hatte sie ein paar ungeheuere Schultern, einen wahren Stiernacken, während Jansen sonst ganz normal gebaut, eher etwas zu schlank zu nennen war.
Jedenfalls musste dieser Mann, der sich den Namen unseres Helden angemaßt hatte, ein wahrer Herkules sein.
Aber hier zeigte sich einmal, dass es doch nicht allein auf Muskeln, Knochen und überhaupt auf Körperkraft ankommt, auch die Gewandtheit allein tut's nicht — es muss noch etwas anderes dabei sein, was zum Siege hilft, was man aber nicht genauer definieren kann. Die einen sprechen gleich von einem Siege der gerechten Sache, andere meinen, dass schon die unbedingte Siegeszuversicht die ganze Sache entscheidet.
Kurz, Jansen hatte seinen gewaltigen Gegner gepackt — da er keinen Gummischlauch mitgenommen, hätte er wenigstens einen seiner unwiderstehlichen Faustschläge anwenden können, der bekanntlich auch einem Bären den Garaus machte — aber Jansen verschmähte auch seine Faust, er sorgte nur dafür, dass sein Gegner nicht zum Gebrauch des Revolvers oder Messers kam — es wurde ein Ringkampf, und für Jansen sah es einige Sekunden ganz bedenklich aus — da hob er seinen Gegner hoch empor, stampfte ihn mehrmals mit furchtbarer Wucht gegen den Boden — ein heiseres Gebrüll, man hatte Knochen brechen hören — dann schmetterte er ihn nochmals gegen die hölzerne Wand, dass diese einbrach — dann warf er ihn zu Boden und hatte ihm im Nu um die Hände eine Schlinge gelegt.
Bei vollem Bewusstsein hatte er seinen riesenhaften, noch stärkeren Gegner gebunden. Nur an den Händen. Für die Füße war es nicht nötig. Dem Manne waren beide Schenkelknochen gebrochen.
Und unten war es inzwischen ebenfalls still geworden. Alles niedergeschlagen, gebunden. Karlemann war es, der sich den letzten ausersehen hatte.
Er lief einen ungeschlachten Matrosen an, dieser schwang auf den Wicht den krummen Entersäbel, Karlemann wich dem Hiebe, der ihm den Kopf gespalten hätte, mit affenartiger Behändigkeit aus, bückte sich blitzschnell, ein Griff nach den Füßen — Karlemanns bekannter Griff — und der Mann lag platt auf dem Rücken, die Beine gen Himmel reckend, und ehe er sie wieder herunter bekam, hatte er schon seinen Schlag mit dem Gummiknüppel weg, der ihn bewusstlos machte.
Hierauf löste Karlemann die um seine Hüften gewundenen Lederriemen, aber bevor er ans Binden ging, spuckte er erst seinen Kautabak aus und biss von einer Platte gemütlich ein neues Stück ab. — — —
Die ›Repentance‹ hatte die ›Sturmbraut‹ wiedergefunden, neben einem anderen Dreimaster liegend.
Ein ebenso seltsamer wie schrecklicher Anblick bot sich beim Näherkommen der Mannschaft dar.
Auf dem anderen Schiffe hingen an den untersten Rahen aller drei Masten wie riesenhafte Gurken Menschen, achtundvierzig Stück konnte man zählen.
Diese ›heiligen Matrosen‹ waren dennoch echte Seeleute, die weit in der Welt herumgekommen waren, sie wussten sofort, was hier geschehen war, hatten sie doch auch den Kanonendonner vernommen.
»Er hat das Piratenschiff von Honduras wirklich noch in dieser Straße gefunden! Und er hat es geentert! Hat es genommen! Und er hat die Piraten bereits aufgeknüpft!!«
Die ›Repentance‹ dampfte heran, legte bei, der Lord begab sich hinüber.
Der junge, blasse Mann hielt sich nicht lange mit näherer Betrachtung auf, er suchte nur nach Kapitän Jansen, fand diesen in seiner Kabine, wo er sich soeben das pulvergeschwärzte Gesicht wusch.
»Einen Augenblick! Bitte, nehmen Sie einstweilen Platz«, erklang es ebenso höflich wie gemütlich.
Dann war er zur Stelle, noch das Handtuch benutzend.
»Sie haben einen Kampf gehabt?«
Jansen erzählte mit kurzen Worten. Er selbst fand durchaus nichts Besonderes dabei.
»Es waren siebenundfünfzig, bei neunen haben diese Himmelhunde mit dem Gummiknüttel zu derb zugehauen, so konnte ich nur achtundvierzig aufknüpfen.«
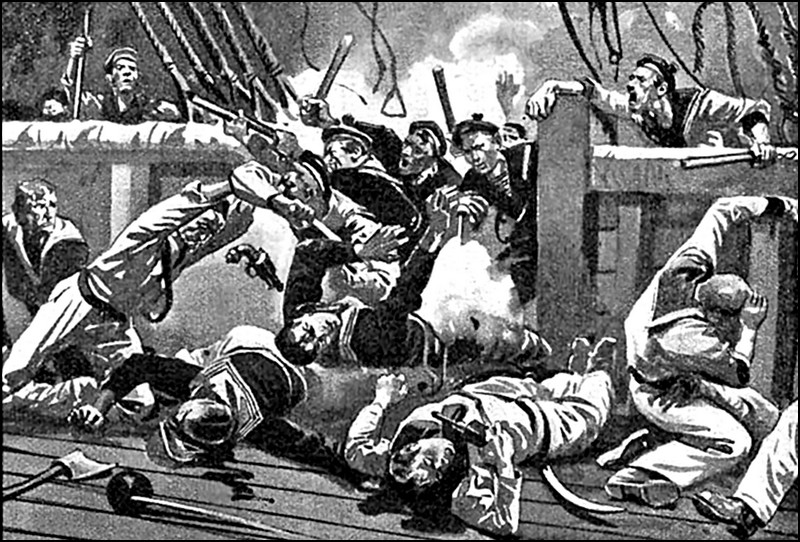
Der Lord war doch erschüttert, er brauchte immer lange Zeit zu seinen Fragen, und fragen musste er, freiwillig schien Kapitän Jansen nichts erzählen zu wollen, oder er fand eben alles selbstverständlich.
»Haben Sie die Piraten nicht zuvor ins Gebet genommen?«
»Natürlich habe ich.«
»Nun?«
»Es ist ein nordamerikanisches Schiff — in Philadelphia beheimatet — mit dem schönen und friedlichen Namen ›Noahs Taube‹ — ging vor drei Monaten mit Stückgut nach Buenos Aires. Außer der Mannschaft waren noch eine Masse Arbeiter an Bord, fast hundert, Schlosser und dergleichen, die in Argentinien die mitgenommenen Maschinen montieren sollten. Unterwegs meuterte die Mannschaft gegen den Kapitän, der auch ein Rüpel gewesen zu sein scheint. Der erste Steuermann selbst führte die Meuterer an. Das ist mein Doppelgänger, der dort oben am Kreuzmast ziemlich in der Mitte hängt. Sein Genick wollte gar nicht brechen, es musste eine Schlinge an seine schon gebrochenen Beine gelegt werden. Ja, und da war das Piratenschiff eben fertig. Wer von den Arbeitern nicht mitmachen wollte, wurde den Haifischen ausgeliefert. Aber es machten doch genug mit. Es waren die richtigen Brüder, die sich da zusammengefunden. Meistenteils Novascotiamen. Die machten jetzt einmal Ernst, ließen das alte Freibeutertum wieder aufleben, und dass sie unter meiner Flagge segelten, war ja gar kein so dummer Einfall von ihnen.«
»Haben sie schon viele Schiffe überfallen und geplündert?«
»Kein einziges. Die Plünderung von Caballos war ihr erster Streich.«
»Und dann?«
»Es war ihr erstes und letztes Unheil, das sie anrichteten. Diese blutige Piraterei war doch nicht so ganz nach ihrem Geschmack, nach jenem Mordtaumel kam eine furchtbare Ernüchterung.«
»Was hatten sie sonst vor?«
»Sie befanden sich auf der Fahrt nach der afrikanischen Küste.«
»Was wollten sie da?«
»Solide Sklavenhändler werden, das war mehr nach ihrem Geschmacke. Eigentlich hatten sie in Caballos ja nur plündern wollen, sie hatten Proviant gebraucht, aber sie waren eben ins Morden hineingekommen.«
»Wie gab sich das Piratenschiff hier zu erkennen?«
»Wiederum als ›Sturmbraut‹, der Kapitän nannte wiederum meinen Namen. Er hatte schon wieder Mangel an Proviant, deshalb musste er es doch noch einmal als Seeräuber versuchen.«
Wieder machte der Lord in seinem Fragen eine lange Pause, während sich Jansen noch immer die Hände abtrocknete.

»Ihre ›Sturmbraut‹ hat viel Havarie erlitten?«
»Es geht. Der Großmast ist ziemlich beschädigt, ich kann aber alles selbst reparieren.«
»Ich sah zwei böse Schusslöcher.«
»Ja, einige haben wir abbekommen. Aber keinen Unterwasserschuss. Ich muss einmal ins Dock.«
»Wohin begeben Sie sich da?«
»Mylord, das muss mein Geheimnis bleiben.«
Wieder eine lange Pause.
»Haben Sie sie sämtlich gleich aufgehängt?«, fragte der Lord dann weiter.
»Natürlich. Meine aufgebrachten Jungen wollten sie erst nach alter Seeräubermanier als Zielscheiben benutzen, aber ich ließ es nicht zu.«
»Keinen einzigen haben Sie am Leben gelassen?«
»Nein. Wozu?«
»Um als Entlastungszeugen für Sie aufzutreten.«
Erst zuckte Jansen die Schultern.
»Die ganze Mannschaft Ihres Schiffes kann ja für mich zeugen.«
»Wir können Schiffbruch erleiden.«
»Never mind, ich habe unterdessen meine Ansicht geändert.
Mag die Welt von mir denken, was sie will — ich habe Rache ausgeübt, oder doch bestraft — das genügt für mich.«
»Sie hätten wenigstens nach Caballos fahren und die Halunken dort aufknüpfen sollen.«
»Nein — wie gesagt — darüber hat sich meine Ansicht vollständig geändert. Auch ich hätte ja bei diesem Renkontre meinen Tod finden können, wir alle zusammen — was hätte uns da solch eine Rechtfertigung genutzt? Und auf den Nachruf gebe ich nichts.«
»Ja, Kapitän, habt Ihr selbst denn keine Tote, keine Verwundeten?«
Mit dem Abtrocknen seiner Hände war Jansen fertig, jetzt betrachtete er angelegentlich seine Fingernägel, bis es endlich langsam und finster herauskam:
»Ja, fünf Tote — fünf meiner Matrosen sind nicht mehr — wieder fünf dahin — darunter zwei der Jungen — brave Kerls — ja, fünf Männer hat die ›Sturmbraut‹ weniger — und acht ernstlich Verwundete — davon werden wohl zwei abgehen — und einige werden Krüppel bleiben — auch mein Mahlsdorf — mein erster Steuermann — soeben hat ihm Goliath den linken Arm abgesägt — oben an der Schulter — ja, es hat mit der Piraterie doch etwas auf sich.«
In einer unbeschreiblichen Weise hatte Jansen das hervorgebracht, durchaus nicht in schmerzlichem Tone, nur finster — aber besonders in der häufigen Wiederholung hatte es gelegen!
Dann blickte er schnell mit gleichmütigem Gesicht auf.
»Ja, Mylord Kapitän, jetzt stehe ich zu Ihrer Verfügung. Pistole auf zwanzig Schritt, nicht wahr?«
Der ehemalige englische Offizier hatte schon viel Pulver gerochen, viel Blut fließen sehen — aber er stand doch ganz unter dem Eindrucke jener so merkwürdig hervorgebrachten Worte.
Er war es jetzt, der in Gesichtsausdruck und Bewegungen den tiefsten Schmerz zeigte, als er, wie abwehrend, beide Hände vorstreckte.
»O, Kapitän — wenn Ihr wüsstet, wie ich Euch verstehe, wie ich Euch bemitleide — o, wenn mich doch kein Schwur bände...«
Da näherten sich murmelnde Stimmen, die Kajütentür ward aufgerissen, Matrosen stürzten herein, einige außer sich, andere mit fahlen Gesichtern.
»Kapitän, unsere ›Sturmbraut‹ ist hin!!!«
Es war ganz wunderbar, dass Jansen nicht aufschnellte, aber auch nicht wie versteinert sitzen blieb. Musste doch schon dieses Eindringen der Matrosen ihn auf etwas Furchtbares vorbereiten.«
»Unsere ›Sturmbraut‹ hin?«, fragte er ganz ruhig., »Was soll das heißen?«
»Ist dem Untergange geweiht! Wir haben ihn gefunden!!«
»Wen gefunden?«
»Unseren Klabautermann, den wir vermissten.«
»Ach so! Nun?«
»Unter den Trümmern der großen Rahe haben wir ihn gefunden — zerschmettert — tot — nun ist auch unser Schiff dem Untergange geweiht!«
Da erst stand Jansen auf, und plötzlich brach er in ein höhnisches Lachen aus.
»Recht so, recht so!! Tot ist unser Klabautermann? Recht so, recht so!! Nun mag alles zum Teufel fahren!!«
Und dann wandte er sich an den Lord.
»Noch fünf Minuten, Mylord, dann stehe ich zur Verfügung, ich möchte nur noch einmal mit meinen Leuten allein sprechen, und ich bitte Sie, bis dahin hier in der Kajüte zu bleiben.«
Er begab sich hinaus, gefolgt von seinen Matrosen.
Ja, das Unglück war geschehen. Man hatte beim Anblick des Piratenschiffes den Klabautermann vergessen, ihn auf seiner Kleiderkiste am Eingange der Back sitzen lassen — eine herabstürzende Rahe hatte ihn erschlagen.
»Unser Klabautermann, nun ist es auch mit unserem Schiffe, mit uns selbst vorbei!«, erklang es nach wie vor im Chore.
Jansen gab sich keine Mühe, seine Leute von ihrem Aberglauben zu befreien, machte sie nicht darauf aufmerksam, dass ein echtes Seegespenst doch eigentlich unsterblich sein müsse — er ging vielmehr auf die Idee seiner Leute ein.
»Well, so ist es eben auch mit unserer Herrlichkeit vorbei. Aber sagt, Leute, wollen wir jetzt etwa Selbstmord begehen?«
Nein, daran dachte niemand.
»Leben wollen wir schon noch, der Wille hat nur wenig Zweck, jetzt sind wir geliefert, so oder so.«
»Also wir wollen dieses christliche Zigeunerleben weiterführen?«
»So lange es geht, ja.«
»Und habt ihr schon einmal daran gedacht, dass auch ich nur ein sterblicher Mensch bin? Was fangt ihr nun an, wenn ich euch einst verlassen muss?«
Es war fast, als hätte Jansen etwas für diese Matrosen völlig Unverständliches gesagt.
»Ach, Käpt'n, Euch kann doch niemand etwas anhaben«, wurde dann gemeint.
»Nanu! Bin ich denn etwa gegen eine Kugel gefeit?«
»Jawohl, das seid Ihr!«
Und das war allerdings die felsenfeste Überzeugung der ganzen Mannschaft. Denn Jansen hatte schon viel, viel mehr Proben von seiner scheinbaren Unverwundbarkeit gegeben, als er selbst bisher erwähnt.
»Doch, ich bin ein sterblicher Mensch, einmal wird mich dieses seltsame Glück doch verlassen, und... nun hört mich an, meine braven Jungen.«
Jansen begann der versammelten Mannschaft von dem Kapitän der ›Repentance‹ zu erzählen, dass das jener Adjutant sei, in dessen Hand er damals die englische Flagge so beleidigt habe, er schilderte mit zu Herzen gehenden Worten dessen ganzes Unglück — und nun habe dieser ihn zum Zweikampf auf Leben und Tod gefordert, nicht mehr aus Rache, sondern durch einen Schwur sei er dazu verpflichtet, und er, Jansen, wolle darauf eingehen, eben weil jener ein so wackerer Mann sei, der seine ganze Sympathie besitze.
Und diese einfachen Matrosen verstanden alles, auch das, was ihr Kapitän sonst nicht mit Worten ausdrücken konnte, wie man zum Beispiel mit einem Manne auf Leben und Tod kämpfen kann, für den man eigentlich die größte Freundschaft hegt.
»Na, da schießt den Kerl doch tot«, ließ sich nur eine einzige Stimme vernehmen, während alle anderen schweigend dastanden. »Euer Revolver ist ja unfehlbar!«
Es war Karlemann gewesen, und seinem Charakter war das auch ganz entsprechend. Schließlich musste man ihm ja recht geben.
In Jansens Gesicht zuckte es, als er sich dem Jungen zuwandte.
»Wir werden gleichzeitig auf Kommando schießen«, sagte er aber nur, ganz ruhig.
»Ist das schon bestimmt ausgemacht?«
»Mit beiderseitiger Übereinstimmung.«
»Hm, das ist fatal. Viel besser wäre doch gewesen, wenn gelost wurde, etwa gewürfelt, wer den ersten Schuss hat.«
»Und wenn der Lord nun doch den ersten Schuss bekommt?«
Man wird gleich merken, dass hinter dieser Frage eine Falle steckte, und Karlemann ging richtig hinein.
»Na, das wollte ich wohl arrangieren, dass Ihr den ersten Schuss bekämt.«
Diesmal war es Jansens Faust, welche zuckte. Aber er beherrschte sich. Es war eben Karlemann, der diesen Vorschlag machte, und dieser deutsche Zigeunerknabe hatte im Kopfe etwas zu viel und im Herzen etwas zu wenig, er war ein geborener Halunke, dem man aber so etwas gar nicht übel nehmen konnte. Für solche Charaktere, die für nichts verantwortlich zu machen sind oder sein sollen, hat man heutzutage das Wort ›Übermensch‹ erfunden — ein ganz gefährliches Wort.
Dann plötzlich richtete sich Jansen mit einem förmlichen Ruck empor.
»Denkt nicht etwa, dass ich ihn schonen werde — er ist verpflichtet, mir nach dem Leben zu trachten, so werde auch ich mein Möglichstes tun, ihn wenigstens mit mir in den Tod zu nehmen!!«
Mit rauer Stimme hatte er es hervorgestoßen — eigentlich doch ganz ohne Grund. Aber die Situation war danach angetan, dass es nicht besonders auffiel.
»Ja, meine Jungen«, fragte er dann mit veränderter Stimme, »was fangt ihr nun an, wenn ihr mich nicht mehr habt?«
Nur gedrücktes Schweigen antwortete, bis ein Matrose eine Entgegnung wusste, nach Matrosenweise.
»Dann sind auch wir futsch.«
»Nicht so. Doch dann könnt ihr machen, was ihr wollt, darüber habe ich nicht mehr zu bestimmen. Ich würde euch nur vorschlagen, erst einmal nach der Fucusinsel zu fahren, schon die ›Sturmbraut‹ bedarf der Reparatur, und dann könnt ihr Tischkoff um Rat fragen, was weiter geschehen soll. Der wird es schon wissen. Und nun, meine Jungen — falls das Unglück es doch will — lebt wohl!«
Hatten all diese Männer eine Ahnung, was ihr Kapitän beabsichtigte? Wohl schwerlich. Und dennoch, es wurde eine regelrechte Abschiedsszene, im Grunde genommen ja ganz angebracht — und doch wieder nicht.
»Leb wohl, Jochen, leb wohl, Wilm, leb auch du wohl, mein braver Oskar...«
So schritt er die Front ab, jedem Einzelnen die Hand schüttelnd. Und »lebt wohl, Kapitän, lebt wohl, Käpt'n«, erklang es immer zurück, und niemand fand an diesem letzten Abschiedsgruß, der nur auf einen eventuellen Tod berechnet war, etwas Humoristisches, vielmehr fuhr manche losgelassene Hand schnell nach den Augen, viele hatten plötzlich das Bedürfnis, sich die Nase zu putzen, und da meistenteils Mangel an Taschentüchern war, so wurden dazu die Zipfel der Flausröcke benutzt oder noch einfacher die Finger.
Und da kam ja noch so manche Szene vor. Am unglücklichsten war Madam Hullogan.
»Will sich armer Käpt'n noch nicht sterben«, jammerte sie in einem fort, »soll sich unser Käpt'n noch leben hunderttausend Millionen Jahre!«
Und ihren Gatten, den Bootsmann Enoch, griff die ganze Sache so an, dass seine Beine immer krümmer wurden, bis er nicht mehr auf ihnen stehen konnte, sondern sich setzen musste.
»Ach, das ist ja alles Mumpitz!«, schrie dann wieder einmal Karlemann dazwischen. »Stecken Sie diesem verrückten Engländer doch eine Schrotpatrone in den...«
Dann begab sich Jansen zu den Verwundeten, ihnen gleichfalls ein ›Lebewohl‹ wünschend, ebenso wie dem einarmig gewordenen, in Bandagen liegenden Mahlsdorf.
Bei diesem Abschied kamen in seine Augen Tränen — schnell wandte er sich, um auch die im Zwischendeck aufgebahrten Toten noch einmal zu sehen.
Hierauf noch eine Besprechung mit Martin, dem zweiten Steuermann, dem er auch etwas von jener chinesischen Perlenbank erzählte, dann begab er sich in die Kajüte zurück.
»Ich bin bereit, Mylord.«
Er setzte sich schnell noch einmal an den Schreibtisch, schrieb etwas auf einen Zettel, steckte ihn in ein Kuvert, versiegelte dieses.
»Hier ist die genaue geografische Angabe, wo sich im chinesischen Meere die Perlmuschelbank befindet.«
»O, das ist ja nicht so...«
»Stecken Sie ein!«
»Und wenn ich nun meinen Tod finde?«
»Dann wird Ihnen dieses Kuvert wieder abgenommen, wenn nicht von mir, dann von einem anderen, mein zweiter Steuermann ist darüber schon instruiert. Einverstanden?«
»Gewiss, ebenso habe auch ich es mir gedacht. Wenn Sie mich töten, dann soll Gott entschieden haben, dann habe ich auch sonst nichts mehr von Ihnen zu beanspruchen.«
Der Lord hatte das Kuvert in seiner Brusttasche geborgen.
»Wie ist's mit den Pistolen?«, fragte Jansen.
»Ich dachte, dass jeder seinen eigenen Revolver benutzt.«
»Wie Sie bestimmen. Nur muss ich da erst sagen, dass ich keinen Revolver habe, mit dem ich nicht schon geschossen.«
»Und ich muss gestehen, dass ich mich mit einem besonderen Revolver eingeschossen habe.«
»Recht so, dann werde ich den wählen, bei dem ich mich am sichersten fühle. Also auf Kommando?«
»Ich dachte, dass ein anderer sekundenweise bis drei zählt, schon vorher ist in Front Stellung genommen und visiert, bei drei wird gefeuert.«
»Gut. Wer soll zählen?«
»Bestimmen Sie!«
»Weiß einer Ihrer Leute davon, etwa Ihr Steuermann, der auf mich einen sehr sympathischen Eindruck macht?«
»Ich habe ihm unterdessen berichtet, wer ich bin, um was es sich handelt — ein ganz vernünftiger Mann, er will nichts verurteilen — aber als Sekundant bei einem Zweikampfe dienen, das würde er niemals.«
»So schlage ich meinen zweiten Steuermann vor.«
»Sehr recht.«
»Dann sind wir wohl fertig.«
»Ich muss nur noch meine Waffe holen, sonst habe ich die Rechnung mit dieser Welt abgeschlossen.«
Der Lord entfernte sich, um sich noch einmal an Bord seines Schiffes zu begeben, Jansen ging an den Waffenschrank und nahm den größten Revolver, den man gewöhnlich in seiner Hand sah, wenn es einen besonderen Schuss galt, öffnete nur einmal die Trommel, blickte hinein — sie enthielt sechs Patronen.
Als er sich an Deck begab, war der Lord schon wieder da, soeben untersuchte Karlemann dessen mitgebrachten Revolver, ebenfalls eine ansehnliche, langläufige Waffe, untersuchte jede Patrone einzeln, was allein schon beleidigend wirken musste, denn es war geradezu, als ob Karlemann dächte, jener könne etwa gar Explosiv- oder Schrotpatronen benutzen.
Jansen machte dieser Szene schnell ein Ende, auch sonst waren die Vorbereitungen bald getroffen.
Martin zählte die zwanzig Schritte ab, die beiden Duellanten nahmen Stellung, so, dass keiner von der Sonne geblendet wurde.
»Fertig?«
»All right.«
Die beiden erhoben die Revolver, drückten das linke Auge zu, visierten. Es war unverkennbar, dass der Lord auf die Brust, Jansen auf den Kopf des Gegners hielt.
Die ganze Mannschaft der ›Sturmbraut‹ bildete Spalier, auch die meisten der ›Repentance‹ hatten sich eingefunden, es herrschte eine atemlose Spannung.
»Eins«, begann Martin sekundenweise zu zählen, »zwei — drei...«
Zwei Feuerströme aus entgegengesetzter Richtung mit einem einzigen Knall — Jansen blieb stehen, wie er gestanden hatte, besonders scharfsichtige Augen, wie es solche gibt, hatten ganz deutlich gesehen, wie die Kugel dicht an seiner linken Achsel vorbeigepfiffen war — der junge Lord dagegen ließ den Revolver aus der erhobenen Hand fallen, dann warf er beide Arme hoch und schlug rückwärts zu Boden.
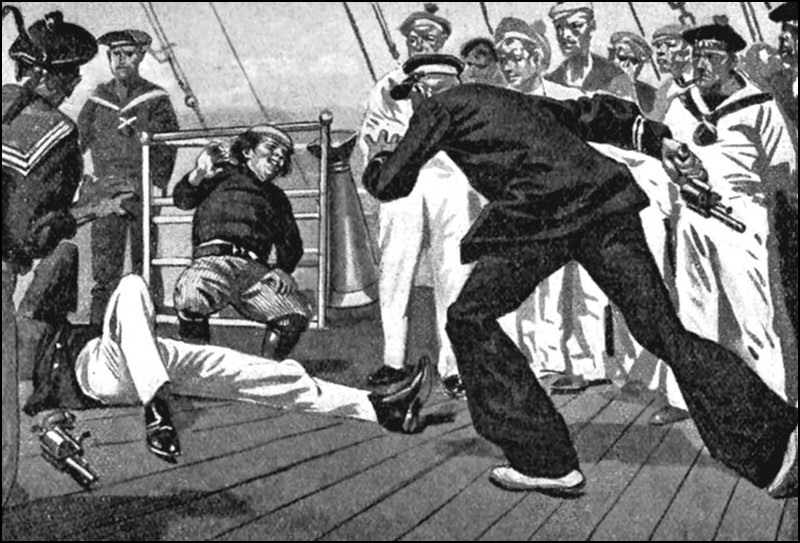
»Getroffen, getroffen!!«, jubelte Karlemann und sprang hin zu dem Gestürzten. »Mitten durch die Stirn, mitten zwischen die Augen!!«
Da aber passierte auf der anderen Seite eine seltsame Szene. Regungslos stand Jansen da, den noch rauchenden Revolver in der erhobenen Hand, sekundenlang — endlich senkte er ihn langsam — und dann neigte er langsam den Oberkörper vor — und so schlich er langsam auf den gestürzten Gegner zu — immer langsamer, immer zögernder — und immer stierer ward der Ausdruck seiner Augen.
Und so erreichte er endlich den regungslos Daliegenden.
Und Jansen beugte sich noch weiter vor, um das hässliche Loch zu betrachten, aus dem einige Tropfen Blut hervorsickerten, mitten zwischen den Augen, etwas über der Nasenwurzel.
»Das war ein Kapitalschuss, mitten zwischen die Augen!«, musste Karlemann noch einmal sagen.
Jansen hörte es, er musste es doch selbst sehen — und dennoch wollte er es nicht glauben.
»Es ist nicht wahr«, murmelte er, aber es klang wie ein Röcheln.
»Was ist nicht wahr?«, fragte der ganz glückliche Karlemann.
»Der ist mausetot.«
»Es ist nicht wahr — und es ist nicht wahr!! Ich träume nur!«
»Na, nun machen Sie doch keine Geschichten, Jansen!«
»Es ist nicht möglich — es ist nicht wahr — ich habe nur über seinen Kopf hinweggeschossen!«
»Wollten Sie? Aber Sie haben ihn mitten zwischen die Augen getroffen.«
Da richtete sich Jansen langsam wieder auf, hob den Revolver, untersuchte die Kammer, die abgeschossene Patrone — und plötzlich begannen seine Hände so zu zittern, dass sie die Waffe nicht mehr halten konnten, und dann schlug er laut aufstöhnend wie ein verwundeter Büffel diese zitternden Hände vor das Gesicht.
»Zum Mörder geworden — wiederum ohne meine Absicht!!!«
Dann aber plötzlich ein wildes Lachen, schnell bückte er sich...
»Mein erster Fehlschuss, es soll auch mein letzter gewesen sein!!«
Blitzschnell hatte er den Revolver wieder aufgerafft, die Mündung gegen seine Schläfe gesetzt...
»Um Gott, Kapitän, was tut Ihr!!!«
Von allen Seiten waren sie auf ihn zugesprungen, wuchtige Fäuste schlugen auf seinen Arm — aber sie waren zu spät gekommen, es hatte schon geknackt, einmal, zweimal.
Nur geknackt, nicht geknallt!
Und da machte der Kapitän ein solches Gesicht, dass sie von ihm ließen, er senkte ja auch schon den Revolver, betrachtete ihn, öffnete die Kammer — zweimal hatte der Hahn auf je eine Patrone geschlagen, alle beide hatten versagt — Jansen drehte die Trommel zurück, hob den Revolver, schoss zweimal in die Luft — und diesmal versagten dieselben Patronen nicht, alle beide gingen sofort los — und da brach Jansen abermals in ein schallendes Gelächter aus, bis er zuletzt mit dem Fuße aufstampfte.
»Bei Gott und bei allen Teufeln!«, rief er. »Wohlan denn, wenn mich der Tod durchaus nicht haben will, da mag es denn so weitergehen!!!«
Acht Tage später näherte sich die ›Sturmbraut‹, mit der Messervorrichtung die grünen Schlingpflanzen durchschneidend, wieder einmal, der Fucusinsel.
An Bord ging alles in demselben Gleise. Dieselben Gesichter, gewöhnlich
gleichmütig, manchmal finster, manchmal heiter — schon konnte man auch hin und wieder Scherze hören, selbst vom Kapitän.
Was war denn auch weiter passiert? Es fehlten sechs Mann. Dafür waren
es Seeleute gewesen. Sie hätten hübsch zu Hause bleiben sollen, wenn sie in ihren Betten hatten sterben wollen. Die anderen Verwundeten würden bald wiederhergestellt sein, einer, nur mit einem Beine, konnte schon noch zu leichter Arbeit verwendet werden, und dass der erste Steuermann nach einigen Wochen mit nur einem Arme auf der Kommandobrücke stehen würde, hatte auch nicht viel zu sagen. Der Riesendampfer, auch die kleineren Fahrzeuge waren schon deutlich zu erkennen.
»Das sieht recht merkwürdig aus«, brummte Jansen, der jetzt mit Steuer
mannsdienste versah.
»Ja, recht einsam«, bestätigte Martin. »Und hatte Mr. Tischkoff nicht alle
die kleineren Fahrzeuge vernichten wollen, um den internierten Soldaten eine Flucht unmöglich zu machen?«
»Das hatte er allerdings tun wollen. Das heißt, von einem Vernichten der
Fahrzeuge wie der Galeerenjacht hat er damals nicht gerade gesprochen, sondern nur, dass er den Gefangenen eben jede Gelegenheit zur Flucht nehmen würde.«
»Wie wollte er das aber anders erreichen, als durch Versenken oder sonsti
ge Vernichtung dieser Boote?«
»Ja, mein lieber Martin, da müssen Sie diesen Geheimniskrämer wohl
selbst fragen«, lachte Jansen.
Martin war wohl derjenige, welcher unseren Helden am besten verstanden
hat. Dieser zweite Steuermann wusste immer ganz genau, wann er den Kapitän nach allem Beliebigen fragen durfte, ohne eine barsche Zurückweisung befürchten zu müssen.
Jetzt fanden auch die Matrosen die Sache auffällig. Es musste doch eine Wache da sein, welche die Ankunft eines Schiffes meldete, das hätte doch einige Aufregung hervorrufen müssen.
Statt dessen war kein Mensch zu erblicken, keine Flagge, kein anderes Signal.
Die ›Sturmbraut‹ kam in den freien Wasserstreifen, legte neben dem Riesendampfer bei, Jansen erstieg die noch herabhängende Treppe, deren Messinggeländer schon längst nicht mehr geputzt worden war.
Wohl hatte Jansen während seiner langen Abwesenheit mit der Fucusinsel immer durch Briefmöwen in Verbindung gestanden, aber nur, um diese in Übung zu erhalten. Das heißt, ab und zu hatte man eine Möwe fliegen lassen, mit einem kurzen Bericht über die letzten Geschehnisse, meistenteils aber nur mit Angabe des Ortes und der Zeit des Ausfluges, und die immer zurückkehrende Möwe hatte niemals etwas anderes mitgebracht als wiederum die Zeitangabe ihres Eintreffens auf der Insel.
In dieser Hinsicht also war Tischkoff immer auf seinem Posten gewesen, aber sonst hatte er nichts von sich oder über die gefangenen Soldaten hören lassen. Die Worte jener letzten, prophetischen Mitteilung waren seine einzigen gewesen.
An Deck kein Mensch. Es sah überhaupt alles so verlassen aus. Besonders auch an Land. Gleich am Strande war ein großer Gemüsegarten gewesen — alles verwildert, selbst die Wege schon mit Unkraut bewachsen.
»Das sieht doch gerade aus, als ob die Insel verlassen worden wäre«, wandte sich Jansen an Karlemann, der ihm gefolgt war.
»Hm, gearbeitet ist hier wenigstens nicht viel worden. Die scheinen ihren Wohnsitz ins Gebirge verlegt zu haben, vor vierzehn Tagen wenigstens muss doch noch jemand an der Möwenstation gewesen sein.«
»Es war Tischkoffs eigene Schrift.«
»Na, dann muss doch Tischkoff noch hier sein, wenn er in diesen vierzehn Tagen nicht gestorben ist.«
»So wollen wir uns nach der Möwenstation begeben.«
»Um zu erfahren, ob er dort ist? Das können wir einfacher haben.«
»Wie das?«
»Indem wir eine Möwe mit einer Anfrage abschicken.«
Ja, das war einfach genug, und es geschah alsbald.
»Wir liegen an dieser Insel. Sind Sie auf der Möwenstation?«, lautete die Frage, welche eine Möwe um den Hals bekam, und sofort schoss sie auf den Inselberg zu, um nach fünf Minuten zurückzukehren.
»Ja, und ich erwarte Sie hier, wenn Sie mir nicht andere Nachricht zukommen lassen.«
In einer halben Stunde hatte Jansen den Berggipfel erreicht, begleitet von Karlemann, den zurückzuweisen er keinen Grund hatte.
Der Berggipfel hatte einen ziemlichen Umfang, war wild zerklüftet, besonders auch hatte die vulkanische Kraft, welche den ganzen Berg geschaffen, hier oben zahlreiche große Höhlen gebildet.
In einer solchen befanden sich die Verschläge für die gezähmten Möwen, in der daneben war alles untergebracht, was zu ihrer Fütterung und sonstigen Pflege gebraucht wurde, durch einen Zugeimer konnte man aus der etwas tiefer liegenden Quelle Wasser heraufbefördern, und auf der anderen Seite befand sich eine dritte, sehr geräumige Höhle, in der früher Handwerkszeug untergebracht gewesen war.
Das war alles ausgeräumt worden, diese Höhle diente jetzt als Aufenthalt eines modernen Robinsons, der sich hier als Gelehrter, als Bücherwurm etabliert hatte. Das heißt, ihre Wände waren ganz mit Büchern bedeckt, die auf Stellagen ruhten, am meisten fielen die dicken Schweinslederbände auf, welche einst Tischkoffs Kabine in der ›Sturmbraut‹ fast völlig ausgefüllt hatten — dann noch ein Tisch und Stuhl, freilich von dem Robinson nicht selbst gezimmert, sondern von der ›Indianarwa‹ stammend, das Lager nur aus einem etwas schrägliegenden Brette mit einigen Decken bestehend, und neben dem Eingange verrieten Spuren, dass dieser Höhlenbewohner auch sonst alles verschmähte, was ihm der noch immer reich ausgestattete Passagierdampfer bieten konnte, dass er nämlich sein Essen ganz primitiv zwischen zwei Steinen kochte.
Tischkoff saß vor dem Tische und schrieb, ganz so, wie man ihn früher in seiner Kabine immer gesehen hatte, in einen Talar aus schwarzem Samt gehüllt, das weiße Haar mit einem Samtbarett bedeckt.
Ein ganz seltsamer Anblick, dieser Schreiber in altertümlicher Gelehrtentracht — die z. B. auch der romantische Richard Wagner bevorzugte — hier auf dieser einsamen Fucusinsel, in dieser Höhle, umschwirrt von weißgefiederten Möwen.
Tischkoff musste die auf dem Stein schallenden Schritte hören, aber zunächst wandte er gar nicht den Kopf, schrieb ruhig weiter.
»Einen Augenblick, ich bin gleich fertig... so, nun stehe ich zu Diensten.«
Er war aufgestanden, noch ganz derselbe, das von zahllosen Fältchen durchfurchte Gesicht von so ruhiger Heiterkeit wie immer. Geradezu auffallend war auch, dass an dem schwarzen Samtkostüm kein Stäubchen haftete, auf sein Äußeres hielt er also wie immer.
Ein Händedruck, ein freundliches Lächeln — sonst weiter nichts vonseiten Tischkoffs.
»Wo sind die englischen Soldaten?«, musste natürlich Jansens erste Frage sein.
»Alle tot.«
»Tot?!«
»An den Pocken gestorben. Sie brachen aus, zuerst bei einem — alle anderen wurden angesteckt, sind sämtlich gestorben. Kaum vier Wochen nach Ihrer Abreise. Ich habe mein Möglichstes getan, konnte sie aber nicht retten.«
Jansen betrachtete den Sprecher mit scharfem Blick. Sein gewöhnliches Lächeln hatte ihn einmal verlassen, er war bei dieser Mitteilung sehr ernst geworden.
Nein, schnell hatte Jansen den Gedanken wieder verworfen, dass dieser Mann solch eines Massenmordes fähig sei, um sich unliebsamer Gesellschafter zu entledigen. Und schließlich wäre unser Held gar nicht mehr so sehr entsetzt darüber gewesen, er hatte schon gar zu viel durchgemacht.
»Und Sie selbst sind davon verschont geblieben?«
»Ich?«
Mit einem schmerzlichen Seufzer wandte sich Tischkoff etwas zur Seite, und Jansen hatte im letzten Augenblick ein ganz altes, eingefallenes Gesicht gesehen, das mit dem sonstigen gar keine Ähnlichkeit mehr hatte.
Wollte er damit sagen, dass ihm keine Pocken und keine andere Krankheit etwas anhaben könnten, da er sich ja einmal mit dem ewigen Juden verglichen hatte, der den ersehnten Tod nicht finden kann?
Als Tischkoff nach einer Sekunde jenem sein Gesicht wieder zudrehte, war es ganz das frühere, nur eben in der Erinnerung an das Erlebte sehr ernst.
»Ja, ich blieb verschont. Alte Leute, wenn sie sonst noch kernfest sind, werden überhaupt viel weniger leicht von derartigem Seuchengift infiziert.«
Jansen wollte diese Erklärung gelten lassen, musste es wohl.
»Weshalb hausen Sie hier oben?«, war seine nächste Frage.
»Ja, das geht doch nicht anders.«
»Wieso nicht?«
»Wegen der Möwen, die ich ja stündlich erwarten kann.«
»O, das tut mir leid!«, sagte Jansen mit aufrichtigem Bedauern.
»Never mind. Ich habe viel über das Problem nachgegrübelt, wie ich eine ankommende Möwe von hier aus sofort nach jener Kabine dirigieren könne, in der ich mich auf der ›Indianarwa‹ häuslich eingerichtet hatte, dass sie etwa durch das Bullauge geflogen kommt, um mir ihren Zettel abzugeben, vermochte dieses Problem aber nicht zu lösen. Mr. Algots, können Sie das nicht?«
Karlemann rieb sich erst lange seine schmutzige Nase, um dann zu entgegnen.
»Nee, sogleich nicht, die Geschichte ist auch gar nicht so einfach.«
»Dann muss ich wohl hier oben bleiben. Und was führt Sie nun hierher?«
Jansen begann von seinen letzten Erlebnissen zu erzählen, zwar so kurz wie möglich, aber doch nichts vergessend.
Karlemann fand das bald langweilig, erst kümmerte er sich um die Möwen, dann spazierte er weiter davon.
Darauf schien Jansen nur gewartet zu haben, jetzt machte er es noch kürzer, aber noch immer nichts übergehend, bis er den Kampf mit der falschen ›Sturmbraut‹ und das Duell mit Lord Leicester schilderte.
Tischkoff war ein aufmerksamer Zuhörer, aber durch nichts zu erschüttern.
Und Jansen verriet nur noch durch ein leises Zittern der Stimme, was damals in ihm vorgegangen war.
»Ja, es war meine feste Absicht gewesen, mich von ihm töten zu lassen — und ich hatte doch so sorgsam gezielt — mindestens einen Zoll hoch musste meine Kugel über seinen Kopf hinweggehen — und ich war doch gerade mit diesem Revolver so sicher — da muss ich meinen ersten Fehlschuss tun, ihn mitten zwischen die Augen treffen. O Gott, o Gott!!«
Tischkoff hatte zunächst nur ein bedauerndes Achselzucken.
»Es war das Verhängnis des jungen Mannes«, meinte er dann.
»Und das meine.«
»Ja, auch das Ihre.«
»Sie glauben an ein Verhängnis?«
»Ja. Was wurde denn nun aus der ›Repentance‹, wie fassten die das auf?«
»Der erste Steuermann trug alles protokollarisch ins Logbuch ein, er glaubte meiner Versicherung, dass ich gar nicht beabsichtigt hatte, den Lord zu töten, obgleich ich mir gar keine besondere Mühe gab, ihn davon zu überzeugen — er wollte sich zunächst in den Heimathafen des Schiffes, nach Boston, begeben. Doch das ist ja jetzt alles Nebensache. Sie glauben an ein Verhängnis?«
»Ja, wie ich schon sagte. Was geschah nun mit dem Seeräuberschiffe...«
»Bitte, weichen Sie mir doch nicht aus. Das versenkten wir. Sie glauben, dass jedem Menschen schon sein Schicksal bestimmt ist?«
»Ja, und zwar bis ins kleinste Detail hinein, bis zu dem Haar, das ihm vom Kopfe fällt — und dennoch ist jeder Mensch freier Herr über seinen Willen, kann tun und lassen, was er will.«
»Wie ist denn das zu vereinen?«
»Das... kann ich Ihnen nicht erklären. Das kann nur durch eine geistige Offenbarung begriffen werden.«
»Ich verstehe — indem ich erkläre, es nicht begreifen zu können. Aber ich glaube, dass die Vorherbestimmung des Schicksals und eine vollkommene Willensfreiheit zu vereinen sind. Kennen Sie den Boëtius?«
»Ja, dieser Philosoph hat eine Erklärung für die Zusammenreimung dieser Widersprüche versucht, und ich glaube, dass es ihm ziemlich gut gelungen ist.«
»Ich aber muss gestehen, dass ich auch den Boëtius nicht verstanden habe. Übrigens habe ich einen viel einfacheren Beweis, dass jeder Mensch wirklich sein Schicksal erfüllen muss, das ihm im voraus bestimmt worden ist — obgleich er immer freier Herr seines Willens bleibt.«
»Nun?«
»Einfach, weil es Menschen gibt, welche die Sehergabe besitzen, welche also den Schleier der Zukunft lüften können.«
»Woher wollen Sie denn wissen, dass es solche Menschen gibt?«, tat Tischkoff ganz erstaunt.
»Sie fragen auch noch? Sie selbst sind doch ein Seher, wie ich Ihnen auch damals geschrieben habe, und schon oft habe ich ja davon eine Probe bekommen, doch erst neulich wieder, als Sie mich durch die Straße von Corvo schickten...«
Da machte Tischkoff wieder seine eigentümlich abwehrende Bewegung, die keinen Widerspruch duldete.
»Sprechen Sie nicht davon«, sagte er finster, »ich weiß nichts davon, will nichts davon wissen!«
Und mit einem Ausbruch von furchtbarem Seelenschmerze setzte er mit ganz veränderter, fast verzweifelnder Stimme hinzu:
»Ach, wenn Sie wüssten, wie unglücklich mich das macht, wie tief, tief unglücklich!!«
Ja, das ist es! Dieser Russe hatte es ausgesprochen.
Dass der Schreiber dieses selbst an eine Medienschaft und dergleichen glaubt, hat der Leser wohl schon gemerkt. Er ist durch unleugbare Tatsachen, besonders in Indien, davon fest überzeugt worden. Aber er hat auch ein sicheres Mittel, um zu unterscheiden, ob die Personen, welche übersinnliche Phänomene zustande bringen, Betrüger sind oder nicht, woraus dann natürlich auch auf das geschlossen werden kann, was sie erzeugen oder sonst leisten, ob sie also wirkliche Medien oder nur betrügerische Taschenspieler sind.
Mit kurzen Worten lässt es sich sagen: Alle diese Medien, Fakire und Derwische, welche durch Geburt zu übernatürlichen Fähigkeiten veranlagt sind oder sich durch künstliche Mittel darin ausgebildet haben, sind unglückliche Menschen! Sie brauchen keine Melancholiker zu sein, keine Kopfhänger, sie können für gewöhnlich ganz heiter erscheinen — aber sobald man vertrauter wird, da erfährt man, wie tief, tief unglücklich sie sind. Weswegen, das wissen sie gewöhnlich selbst nicht zu sagen. Das ist mit Worten eben gar nicht zu definieren. Sie fühlen, dass sie keine natürlichen Menschen mehr sind. Oder aber, um ein sehr treffendes Gleichnis zu wählen, einen Menschen deshalb glücklich zu nennen, weil er etwa die Gabe des zweiten Gesichtes besitzt, in die Zukunft zu blicken vermag, das wäre genau so, als wolle man einen Zwitter beneiden, weil dieser niemals die Sehnsucht der Liebe mit ihren stets nachfolgenden Schmerzen, beim Manne wie beim Weibe, kennen lernt.
Ja, hier soll es einmal gesagt werden: alle diese Medien sind Zwitter, d. h. geistige, seelische, nämlich zwischen dem Menschen, für den die Erde geschaffen ist, und zwischen jener anderen Region, von der wir noch so gut wie gar nichts wissen, und über die wir wohl auch niemals etwas Positives erfahren werden, in der wir aber schon ganz sicher manchmal während des Schlafes verweilen — — und merkwürdig ist es, dass diese Medien sehr oft, wenn auch durchaus nicht immer, zugleich körperlich Zwitter sind.
Es ist ganz zweifellos, dass man durch fortgesetztes Nachtwachen, Fasten und gewisse Übungen in sich übernatürliche Fähigkeiten entwickeln kann. Aber man darf niemand raten, es zu versuchen. Es ist nicht nur über, sondern auch durchaus unnatürlich. Mit dem Erfolge wird auch alle Lebensfreudigkeit verloren, eine drohende Stimme der Natur hält den Betreffenden warnend davon ab, diese Fähigkeiten zu benutzen, am wenigsten gegen Geld; nun aber lassen sich Medien doch durch den Glanz des Goldes blenden, durch öffentliche Ausübung ihrer phänomenalen Gaben verlieren sie diese wieder — jetzt werden sie zu Betrügern, wenn sie nicht schon vorher körperlich und seelisch gebrochen im Irrenhause enden.
»Lassen Sie mich!«, rief Tischkoff nochmals mit abwehrender Handbewegung.
Aber diesmal ließ sich Jansen nicht zurückweisen.
»Nein, nur dieses eine Mal noch möchte ich Ihre Sehergabe in Anspruch nehmen.«
Tischkoff schien doch etwas darauf eingehen zu wollen.
»Worüber?«
»Über mich selbst — über die Art meines zukünftigen Todes.«
Da hob Tischkoff warnend die Hand.
»Kein Mensch wage, den Schleier der Zukunft zu lüften!!«
»Haben Sie mir nicht auch gesagt, wo ich jenem Piratenschiff begegnen würde?«
»Das war etwas ganz anderes — und niemals tue ich es wieder!«
»Wenn Sie wüssten, was ich vorhabe, ließen Sie sich vielleicht doch erweichen.«
»Was haben Sie vor?«
»Hören Sie mich an!«
Jansen setzte sich auf eine der herumstehenden Kisten, in denen Tischkoff wohl seine Bücher heraufgetragen hatte.
»Vor einigen Tagen habe ich einen Selbstmordversuch begangen«, begann er.
Das war allerdings etwas, was Tischkoff nicht zu hören erwartet hatte, hoch blickte er auf.
»Einen Selbstmordversuch?«
»Ja.«
Und Jansen erzählte, wie er damals, als er den Lord versehentlich erschossen, die Waffe gegen sich selbst erhoben und zweimal losgedrückt habe.
»Zweimal versagte der Revolver. Mir unbegreiflich. Zum ersten Male bei diesem Revolver passiert, bei diesen Patronen. Dann, als ich in die Luft feuerte, waren sie ganz intakt. Es ist eben mein Schicksal, an das auch ich jetzt glaube, dass ich auf andere Weise enden soll. Doch das nur jetzt nebenbei. Es war mein fester Wille, mich von dem Lord töten zu lassen. Ich war an seinem ganzen Unglück schuld, durch meinen Tod konnte er sich rehabilitieren — kurz, er sollte mich töten. Ich wollte immer vorbeischießen, einmal würde er mich doch tödlich treffen. Und noch etwas anderes trieb mich zu diesem Entschlusse, nicht nur, um dem jungen Manne gefällig zu sein. Sagt, Tischkoff, führen wir nicht ein elendes Leben?«
»Jeder muss den Wert seines Lebens selbst einschätzen«, entgegnete er ausweichend.
»Es ist ein elendes Leben«, fuhr Jansen mit leiser, schwermütiger Stimme fort. »Wie die wilden Tiere, wie die Haifische werden wir gejagt. Wir gelten als Seeräuber, jeder Hundsfott würde als Held bewundert werden, der uns den Garaus macht, auch durch die schurkischste Hinterlist. Haben wir denn dieses Los verdient? Wodurch? Doch es ist nutzlos, darüber nachzugrübeln, uns verteidigen zu wollen. Es ist so, wie es ist. Wir sind vogelfreie Desperados, die nirgends mehr Proviant einnehmen dürfen, ohne Gift fürchten zu müssen. Und mehr noch: jeder Schuft kann sich für mich ausgeben, sein Schiff für meine ›Sturmbraut‹, er kann unter meinem Namen Verbrechen begehen und... es wird ihm geglaubt!
»Seht, Tischkoff, diese furchtbare Erkenntnis war es, die mich überwältigte, mir das Leben verleidete. Deshalb sollte mich der Lord im Zweikampfe töten. Und als ich nun an seiner Leiche stand, das hässliche Loch in seiner Stirn sah, wo ich ihn doch hatte schonen wollen, da empfand ich erst recht, welch grausames Spiel doch das Schicksal mit mir treibt, und in furchtbarster Verzweiflung richtete ich die Waffe gegen mich selbst.
»Sie versagte. Zweimal. Da packte mich ein wilder Trotz gegen dieses grausame Schicksal. Ja, nun wollte ich denn auch leben bleiben, meinetwegen ein regelrechter Seeräuber werden.
»Aber diese Stimmung hielt nicht lange an. Ach, Tischkoff, ich habe während der Fahrt bis hierher gar viel durchgemacht, als ich mich tagelang in meiner Kabine eingeschlossen hielt. Ich verglich mein früheres Schicksal, da ich ein so glücklicher Mensch gewesen, mit jetzt, und immer größer ward meine Verzweiflung, wie ich sie noch nie gekannt.
»Und da plötzlich kam es wie der heilige Geist über mich, der mir den Weg zur Erlösung aus dieser Trübsal zeigte...«
Mit leuchtenden Augen sprang Jansen jäh von seinem Sitze empor.
»Tischkoff, ich weiß, was ich zu tun habe — wie ich wieder ein ehrlicher Mann werden kann!!«
»Nun?«, fragte Tischkoff ziemlich gelassen.
»Ich — stelle — mich — den Gerichten!!«
»Welchem Gericht?«
»Dem englischen; denn England habe ich doch den größten Schaden zugefügt, von England geht alles aus, besonders die auf meinen Kopf gesetzte Prämie — England kann mich auch wieder zum anerkannten Handelskapitän machen.«
»Hm. Ich beabsichtigte schon einmal, Ihnen ganz denselben Vorschlag zu machen. Er ist Ihnen also von selbst gekommen. Wie denken Sie sich nun die ganze Sache?«
Jansen hatte sich wieder gesetzt, war wieder ruhig geworden.
»Was habe ich getan?«, fuhr er fort. »Zwei englische Kriegsschiffe vernichtet. Alles andere kommt gar nicht in Betracht. Auch mein Aufenthalt in New York war doch nur ein verwegener Streich, nichts weiter. Ich habe es nur mit England zu tun. So will ich mich nach England begeben und mich aburteilen lassen. Allerdings mit Vorbehalt, es ist eine Art von Bestechung dabei. Ich erbiete mich, die beiden von mir vernichteten Schiffe zu ersetzen. Oder noch mehr: ich biete das Geheimnis der Perlenbank an.«
»Ja, wofür wollen Sie denn das eigentlich anbieten?«
»Nun, natürlich für meine und meiner Leute vollkommene Amnestie, dass wir wieder als ehrliche Seeleute gelten.«
»Hm, das nennt man aber eigentlich nicht, sich einem gerechten Richterspruch unterwerfen.«
»Nein, allerdings nicht. Ich sprach ja auch schon von einer gewissen Bestechung. Doch eine solche liegt im Grunde genommen gar nicht vor. Ich will nur den von mir angerichteten Schaden wieder gutmachen, so weit ein Mensch das kann. Hängen lassen will ich mich freilich nicht, auch nicht lebenslänglich ins Zuchthaus sperren, kein halbes Jahr — das ertrüge ich nicht. Lieber den Tod. Ja, lieber den Tod! Also ich unterwerfe mich dem englischen Richterspruche. Genügt die von mir angebotene Sühne, dann ist alles gut, dann bin ich rehabilitiert, mit mir alle meine Jungen — verwirft man mein Angebot, verurteilt man mich, zum Galgen, zu Gefängnis, gleichviel auf wie lange, dann... werde ich mich freiwillig töten. Immer wird der Revolver doch nicht versagen, wenn ich ihn gegen meine Schläfe setze. Verstehen Sie nun, was ich will?«
»Ja, ich verstehe«, entgegnete Tischkoff kalt. »Und was sagen Ihre Leute dazu?«
»O, da muss ich Ihnen etwas Herrliches erzählen! Wie gesagt, dieser Vorsatz kam mir in der Einsamkeit meiner Kabine. Als mein Plan fix und fertig war — vorgestern erst ist es gewesen — ließ ich meine Jungen antreten, erklärte ihnen, was ich beabsichtige. Es handelte sich nur noch darum, auf welche Weise ich mich nach London begeben sollte, wo unterdessen die ›Sturmbraut‹ blieb, was aus meinen Jungen würde, wenn ich ihnen einen abschlägigen Bescheid zukommen lassen müsste, der zugleich meinem Leben ein freiwilliges Ende setzen würde, sodass die ›Sturmbraut‹ keinen Kapitän mehr hätte.
»Der Schreck meiner Leute ob dieser Offenbarung war groß. Dann erbaten sie sich Bedenkzeit, traten zur Beratung zusammen. Und das Resultat derselben? Sie alle wollen mit ihrem Kapitän leben... oder sterben!«
»Dieses Resultat hatten Sie doch auch erwartet?«
»Ja, ich gestehe es«, entgegnete Jansen mit seiner gewöhnlichen Offenheit. »Und dennoch, es war eine herrliche, überwältigende Szene. Ich habe dann geweint wie ein Kind.«
»Was wollen Sie nun tun?«
»Zunächst setze ich eine Denkschrift auf, alles das enthaltend, was ich Ihnen vorhin mitgeteilt habe, meine Bedingungen usw. Diese schicke ich an das Londoner Seemannsamt, welches sie weitergeben mag. Entweder laufe ich wegen ihrer Beförderung vorher doch einen Hafen an, oder ich halte einen Postdampfer auf, der nach London geht.
Dann begebe ich mich mit der ›Sturmbraut‹ langsam nach England. Direkt in einen Londoner Hafen gehe ich natürlich nicht hinein. Auf diese Weise stelle ich mich nicht. Ich bin überhaupt kein schuldbewusster Verbrecher, sondern ich betrachte mich mehr als Englands Feind, mit dem England Krieg geführt hat, der jetzt freiwillig aus besserer Einsicht kapitulieren will.
»Wahrscheinlich werde ich nach Dover gehen, welches mit London in kürzester Eisenbahnverbindung steht. Dort lege ich mich mit der ›Sturmbraut‹ weit draußen vor Anker. Unterdessen hat man Zeit gehabt, meine Denkschrift zu prüfen. Wer mit mir unterhandeln will, muss zu mir an Bord...«
»Die werden sich schön hüten«, unterbrach Tischkoff mit einem kurzen Lachen, das allerdings nicht beleidigen konnte.
»O, das lassen Sie nur meine Sache sein! Sie wissen doch, wie ich es mit den beiden südamerikanischen Republiken gemacht habe, die mir ebenfalls vollkommen Amnestie erteilten. Leicht möglich, dass ich auch hier mir vorher einige Geiseln besorge, Respektspersonen, damit man meine ›Sturmbraut‹ nicht vom Lande aus in den Grund schießt. Nur nicht so wie in New York will ich handeln, das heißt, mich nicht direkt in einen Hafen zwischen andere Schiffe legen; denn werde ich verurteilt, dann muss auch meine ›Sturmbraut‹ in die Luft fliegen, und noch mehr Schaden anrichten, dass auch Unschuldige unter unserer Vernichtung leiden, das will ich nicht!«
»Also wenn Sie kein Gehör finden, wollen Sie sich in die Luft sprengen?«
»Ja.«
»Und alle Ihre Leute sind damit einverstanden?«
»Von diesen geht der Vorschlag zuerst aus. Entweder als freie Männer leben dürfen... oder sterben!«
»Sehr anerkennenswert! Ich wenigstens finde etwas Heldenhaftes dabei. Kein einziger hat sich davon ausgeschlossen?«
»Nur einer.«
»Wer?«
»Karlemann — Algots.«
»Das dachte ich mir.«
Und auch Jansen hatte es leichthin gesagt.
»Karlemann nennt mich natürlich einen Narren. Mag er! Ich kenne seinen Charakter zur Genüge, deshalb kann ich ihm auch nicht verübeln, wenn er anders denkt. Er hatte mir übrigens schon früher einmal gesagt, dass er durchaus keine Lust habe, freiwillig in die Luft zu fliegen.«
»Was hat er sonst vor?«
»Das weiß er selbst noch nicht, würde es mir wohl auch kaum verraten. Zunächst wird er eine Gelegenheit suchen, mich verlassen zu können. Und seinen Aschantischatz nimmt er natürlich mit.«
»Und Sie?«
»Ich verproviantiere mich hier, nehme Trinkwasser und Kohlen ein, dann geht es sofort nach England.«
»So wünsche ich Ihnen und Ihren Leuten viel Glück!«
Einige Zeit blickte Jansen den alten Mann, der ihm nie ein Freund geworden, gespannt an.
»Wollen Sie mir nicht meine Bitte erfüllen? Es dürfte die letzte sein.«
»Welche Bitte?«
»Mir meine Zukunft zu enthüllen.«
»Nein!«, entgegnete Tischkoff schroff.
Dann aber wandte er sich wieder dem Bittenden zu.
»Ja, ich könnte es. Wenn ich Ihnen aber nun sagte, dass man Sie zu London aufhängen wird — dann würden Sie wohl gar nicht erst nach England gehen?«
Jansen ward blass bis an die Lippen, dann aber fuhr er jäh empor.
»Herr, wofür halten Sie mich?! Mein Entschluss ist gefasst!«
»Ja, aber wozu wollen Sie da überhaupt erst Ihr zukünftiges Schicksal erfahren, zumal, da auch Sie daran glauben, dass kein Mensch seinem Verhängnis entgeht?«
»Sie haben recht, aber — aber...«
»Schon gut, schon gut!«, kam Tischkoff dem Stockenden mit seinem freundlichen Lächeln zu Hilfe. »Sie sind ein Mensch, und das sagt genug. Nun denn: Ja, ich kenne Ihre Zukunft, habe mich darum gekümmert, habe es tun müssen — Sie werden im hohen Alter eines natürlichen Todes sterben.«
Da leuchteten Jansens Augen auf, um gleich noch einmal einen zweifelnden Ausdruck anzunehmen.
»Im Zuchthaus?«
»Als freier Mann. Doch nun genug, es war mein letztes Wort.«
»Und was werde ich in London... ?«
»Hören Sie nicht?! Es war mein letztes Wort!«
Und Jansen konnte auch zufrieden sein.
Eine Woche verging. Die ›Sturmbraut‹ war an der Seite des Riesendampfers, wie schon einmal, etwas aus dem Wasser emporgewunden worden, die Heizer, alles gelernte Schlosser, vernieteten unter Aufsicht der Ingenieure die Schusslöcher, während die Matrosen die Takelage wieder in Ordnung brachten, dann wurde eine große Jagd auf die verwilderten Rinder und anderen Tiere abgehalten, ihr Fleisch gesalzen, die Kohlenbunker wie die Wassertanks wieder gefüllt.
Nichts war davon zu merken, dass die Matrosen sich auf eine Fahrt vorbereiteten, welche wahrscheinlich mit ihrem Tode endete. Wahrscheinlich, nicht nur vielleicht! Denn wenn man heimliche Gespräche belauschte, so konnte man hören, dass sich die meisten Matrosen durchaus keiner großen Hoffnung hingaben, die englische Regierung würde auf die Vorschläge eingehen.
Aber deshalb war nicht die geringste Niedergeschlagenheit vorhanden.
»Na, dann fliegen wir eben in die Luft — Hauptsache ist, dass wir nach dem Tode nicht auf dem Meeresgrunde und auch nicht in Kellern und Speisekammern herumzuspuken brauchen.«
So wurde überall während der Arbeit und in der Freizeit gesprochen. Alle diese Männer, von denen kein einziger auch nur die geringste verbrecherische Anlage hatte, waren eben dieses Desperadolebens überdrüssig, nun freuten sie sich, dass darin eine Wendung eintreten sollte, mochte diese auch ausfallen, wie sie wolle.
Nur bei einigen ward diese Stimmung umgeändert, was aber dem Ganzen wenig Abbruch tat.
Karlemann wollte da also nicht mitmachen, sondern die ›Sturmbraut‹ bei der ersten sich bietenden Gelegenheit verlassen, um seine eigenen Wege zu gehen.
Er hatte nicht erwartet, hier noch dieselben größeren und kleineren Fahrzeuge wiederzusehen, welche man früher nach und nach hierher gebracht hatte, so z. B. das einem Kaper abgenommene Kornschiff, ferner auch das gedeckte Segelboot, mit einer Hilfsmaschine ausgerüstet, mit dem sich damals Jansen und Karlemann von Aspinwall nach der Fucusinsel begeben hatten.
Dieses Boot war noch vollkommen instand, und sofort war Karlemanns Entschluss gefasst, es zu benutzen, um sich von hier zu entfernen, ohne länger die ›Sturmbraut‹ in Anspruch nehmen zu müssen.
Aber dazu brauchte er noch einen Begleiter, mindestens. Er begnügte sich damit nicht, sondern wählte deren drei aus.
Von Karlemanns altem Schlage, den er damals in Monrovia geworben, lebten nur noch zwei, Bolle und Klingelmann. Dass Karlemann sie leicht beredete, mit ihm zu kommen, war begreiflich, und niemand nahm es ihnen übel. Das waren eben Karlemanns ursprüngliche Leute. Ferner war da auch noch der Indianerjunge, den wir nicht wieder erwähnt haben, weil er sich niemals hervorgetan hat, obgleich er sonst ein ganz tüchtiger Matrose geworden war. Auch dieser sollte Karlemann begleiten, und diese drei halbwüchsigen Jungen nahmen in dem kleinen Boote noch nicht so viel Platz weg, brauchten weniger Proviant, als der baumlange Jansen mit seinem unersättlichen Magen damals beansprucht hatte.
Karlemann machte es kurz, wie immer. Die ersten mit frischem Salzfleisch gefüllten Fässer nahm er für sich in Beschlag, rüstete sein Boot mit allem sonstigen aus, was er brauchte — vorher aber noch schaffte er von der ›Sturmbraut‹ den ganzen Aschantischatz herüber, ihn wie Ballast verstauend. Die Schmucksachen und die Goldbarren füllten wohl einige Kisten, das Boot sah auch nur klein aus, aber im Grunde genommen hatte dieser viele Zentner schwere Schatz für dieses gedeckte Segelboot gar nichts zu bedeuten. Mit dem Kubikinhalt hat es eben eine eigentümliche Bewandtnis, das bezieht sich auch auf die Tragkraft eines Fahrzeuges, da kann sich ein Laie ganz gewaltig täuschen, selbst wenn er in der Stereometrie ziemlich bewandert ist.
Die zentnerschweren Eisenkisten wurden von der kleinen Luke wie die Pillen verschluckt, und an der Wasserlinie war nichts zu merken, dass das Segelboot um etwas gesunken wäre.
»Sie nehmen den ganzen Schatz mit?«, fragte der zusehende Jansen.
»Selbstverständlich.«
»Wenn Sie nun Schiffbruch erleiden?«
»Na, was dann?«
»Freilich, Sie haben recht — aber es ist doch leichtsinnig, gleich alles auf einmal aufs Spiel zu setzen.«
»Leichtsinnig? Das sagen Sie mir? Sie? Sie? Hahahaha!«
Jansen fühlte sich nicht beleidigt. Karlemann hatte hierin noch viel mehr recht, dass er seinen großen Freund ob dieser Bemerkung auslachte.
»Na, da adjüs.«
»Was? Sie wollen wohl schon absegeln?«
»Sicher, ich bin fertig. Also ich wünsche angenehmes IndieLuftfliegen, und sorgen Sie nur dafür, dass Sie, wenn Sie vom Himmel wieder herunterkommen, nicht mehr lebendig sind, sonst könnte es Ihnen dreckig gehen. Sagen Sie den anderen Adjüs von mir. Klar bei den Brassen!!«
Und Karlemann segelte davon, ohne für die anderen noch ein Wort zu haben. Wenn der Seemann, wie schon häufig erwähnt, überhaupt wenig vom Abschiednehmen weiß, wie auch ein Lokomotivführer und das andere Zugpersonal nicht bei jeder Abfahrt tränenerstickten Abschied von der Familie nimmt, so Karlemann erst recht nicht.
Wir wollen sein Boot einige Tage begleiten, auch noch eine besondere Episode schildern, ohne diese zum Abschluss zu bringen, obgleich dann der Leser von Karlemann Abschied nehmen muss.
Das Boot arbeitete sich mit der Messervorrichtung durch die Fucusbank, nur mit Hilfe des Westwindes, ohne die Dampfkraft gebrauchen zu müssen.
Dann war ein Sturm oder vielmehr eine hohe See zu überstehen, wobei die vier kleinen Männer im Innern des Bootes unter dem geschlossenen Deck wie die Heringe eingepresst lagen und sich rollen ließen, dann ging es bei besserem Wetter weiter, immer dem Osten zu.
Es war am neunten Tage nach der Abreise, als Karlemann fortwährend geografische Ortsbestimmungen machte, und als er den Anker fallen ließ, fand dieser Grund.
Seine Jungen wussten sofort, was ihr kleiner Kapitän vorhatte: seinen Schatz versenken, wenigstens einen Teil davon.
Wo sie sich befanden, wusste von den anderen dreien keiner, Karlemann hatte die geografischen Bestimmungen immer allein gemacht, und ein lautes Rechnen oder Sprechen war dieses verschlossenen Jungen Sache überhaupt nicht.
Nachdem der Anker gefallen war, begab sich Karlemann unter Deck, holte aus der Instrumentenkiste, die er stets unter Verschluss hielt, einen zweiten Sextanten hervor, schraubte daran etwas herum, kroch wieder an Deck.
»Nun wollen wir zusammen eine ganz genaue Bestimmung machen, bis auf Zehntelsekunden.«
Dass Karlemann seine ersten Leute hierin ausgebildet hatte, wissen wir.
Also der eine Junge machte mit dem ihm gereichten Instrumente eine Sonnenaufnahme, der andere schrieb die ihm diktierten Zahlen auf, rechnete das Resultat aus, immer laut sprechend. »Stimmt — stimmt!«, sagte Karlemann immer; auch er hatte die Sonne mit seinem eigenen Sextanten aufgenommen, machte gleichfalls eine Berechnung.
Aber wenn man die beiden Rechnungen verglichen hätte, so würde man gesehen haben, dass sie durchaus nicht übereinstimmten.
Karlemanns Resultat ergab einen Ort, der gute zehn Meilen weiter südlich lag.
Der Leser wird wohl verstehen. Dieser deutsche Zigeunerknabe traute auch seinem besten Freunde nicht, überhaupt keinem anderen Menschen. Er hatte einfach den anderen Sextanten verschraubt, sodass er ein ganz falsches Resultat ergab.
Jetzt wurden die Kisten versenkt, nicht nur eine, sondern gleich alle, der ganze Aschantischatz, und gesetzt nun den Fall, einer der Begleiter wäre treulos gewesen, er hätte sich diese geografische Bestimmung gemerkt oder heimlich aufgeschrieben, um den Schatz später einmal für sich selbst aufzufischen — da hätte er lange suchen können, der lag ganz woanders!
Es war ein recht einfaches Mittel, um einen Treulosen irrezuführen, und dennoch so raffiniert, dass der ehrliche Jansen niemals auf so etwas gekommen wäre.
Die Fahrt wurde fortgesetzt. Es waren schon zwei Schiffe gesichtet worden, aber Karlemann war ihnen aus dem Wege gegangen, was auch leicht zu machen war, da ein großes Schiff ja schon gemustert werden konnte, ehe von ihm aus das schließlich doch nur kleine Segelboot zu erblicken war.
Wieder drei Tage später tauchte abermals ein ›Segel‹ auf. Das heißt, drei Mastspitzen, die obersten Segel kamen stets viel später, weil die Erde rund ist und am gleichmäßigsten auf dem Wasser.
Karlemann ging zwar jedem Schiffe aus dem Wege, beobachtete es aber doch stets angelegentlich durchs Fernrohr, ehe er wieder ans Verschwinden dachte.
So tat er auch hier, ließ das Schiff mehr hochkommen, hielt selbst etwas darauf zu, dabei immer das Fernrohr vorm Auge.
»Hm, das ist ja ein verdammt kleines Schiff — schon an der Takelage zu erkennen — oder täusche ich mich denn so in der Entfernung? Nein, das ist Wirklichkeit. Gerade wie — wie...«
Plötzlich ließ Karlemann das Fernrohr sinken, sein Gesicht strahlte vor Freude.
»Der Knipperdolling, es ist mein Knipperdolling!!«, jubelte er laut, dabei wie sehnsüchtig die Arme nach jener Richtung ausbreitend,
Karlemann hatte seinen ›Knipperdolling‹, den er damals in dem Hafen seiner Felseninsel hatte zurücklassen müssen, nie vergessen können. Jedenfalls hatte er viele Anstrengungen gemacht, nur um zu erfahren, wo dieses Miniaturschiffchen geblieben war; seine diesbezüglichen Annoncen hatte man wiederholt im ›Lloyd‹ lesen können, aber alle seine Bemühungen waren vergeblich gewesen. Dabei ist zu bedenken, dass auch Karlemann schon allen Grund gehabt hatte, möglichst wenig mit englischen und anderen Behörden zu tun zu bekommen, er hatte dabei eben immer vorsichtig sein müssen.
Und nun lief ihm hier sein geliebter ›Knipperdolling‹ über den Weg!
Nach einer Viertelstunde, während welcher Karlemann ganz außer sich gewesen, befand man sich in genügender Nähe, um signalisieren zu können.
Das Miniaturschiffchen sah schmucker denn je aus, alles blitzte in der Sonne. An Deck befanden sich vier Mann, welche das noch kleinere Segelboot natürlich mit nicht minder großem Interesse betrachteten, und jetzt zeigten sie Flaggen.
»›Delfin‹, Norfolk, Kapitän James Burton«, besagten diese, und am Heck wurde das Sternenbanner gezeigt.
»›Delfin‹, was für ein phantasieloser Name!«, meinte Karlemann geringschätzend. »Also in amerikanischen Händen. Burton? Nun, der Mann wird wohl mit sich handeln lassen, sonst...«
Er beendete seine Rede nicht, sondern dachte nur daran, seinen ›Knipperdolling‹ möglichst schnell zu erreichen.
Dann signalisierte auch er den Namen seines Bootes: ›Gazelle‹, beheimatet in San Francisco, wo er es gekauft, und was alles noch am Heck stand, aber statt seines Namens gab er, wie es ihm gerade einfiel, den deutschen Namen Müller an.
»Bitte an Bord kommen zu dürfen«, signalisierte er dann weiter.
»Sehr angenehm.«
Die Miniaturjacht ward außer Fahrt gebracht, zehn Minuten später legte das Boot bei, Karlemann sprang an Deck, stand vor einem jungen Manne, der ihn mit großen Augen betrachtete, zuerst ganz sprachlos vor Staunen.
»Kapitän Burton?«
»Ja — und Sie — Sie — sind Sie nicht der kleine Karlemann — — der kleine Kapitän Algots, wollte ich sagen?«
»Woher kennen Sie mich denn?«
»O, ich habe doch schon so viel von Ihnen gehört — außerdem habe ich Sie selbst auf dem Zirkusschiff gesehen...«
»Und wissen Sie, dass diese Jacht hier einst mein Eigentum war?«
»Ich weiß es.«
»Wie sind Sie in ihren Besitz gekommen?«
»Durch Kauf.«
»Wem haben Sie sie denn abgekauft?«
Karlemann stellte die Fragen in seiner brüsken Manier; der junge Kapitän schien unmutig werden zu wollen, doch er beherrschte sich, zeigte sich jetzt und später als Gentleman.
»Aber, bitte — darf ich Sie zunächst nicht einladen, in der Kajüte mein Gast zu sein? Ich schätze mich doch überglücklich, den weltberühmten kleinen Kapitän Karl Algots als meinen Gast bewirten zu dürfen.«
Karlemann folgte ihm in die winzige Kajüte, schon auf dem Wege dahin scharfe Umschau haltend — mit sehr gemischten Empfindungen.
Alles war vielleicht noch reicher ausgestattet als damals, da Karlemann die Miniaturjacht von der mexikanischen Tänzerin übernommen hatte, dabei aber viel seemännischer, und dennoch zugleich viel reizender, indem in allem und jedem auf die Zierlichkeit der Jacht Bezug genommen worden war.
So sei nur erwähnt, dass der als Steward dienende Matrose den Champagner in ganz kleinen Flaschen brachte, Viertelliterflaschen, wie man sie ab und zu in Frankreich bekommt, z. B. auf den Bahnhöfen zur Mitnahme. Es war ja nur eine Spielerei, dass es auch hier solche gab, und dennoch, es verriet den Geschmack des Kapitäns, wie er sein Schiffchen liebte, dass er auch an solche Kleinigkeiten gedacht. Denn bei jener Tänzerin hatte es so etwas nicht gegeben, auch Karlemann hatte nicht daran gedacht, wegen der Kleinheit seines Schiffchens sich nun auch mit solchen zierlichen Fläschchen zu verproviantieren.
Das war nur ein einziges Beispiel, diese Übereinstimmung war eben in allem und jedem durchgeführt, ohne dass darunter die Bequemlichkeit litt.
Und Karlemann war gerade die Natur, um dies alles gleich herauszufinden, eben weil er dieses sein ehemaliges Schiffchen mit ganz besonderen Augen betrachtete, und... es war ganz einfach eine böse Eifersucht, die immer mehr in ihm aufstieg.
»Ja, Herr Kapitän, wie kommen Sie in dem winzigen Boote eigentlich hierher? Wieder auf neue Unternehmungen aus?«
Das, was ihn selbst anbetraf, hatte Karlemann schnell erledigt, sein ganzes Herz trieb ihn nur einem einzigen Ziele zu.
»Wie sind Sie in den Besitz dieser Jacht gelangt?«
Kapitän Burton erzählte. Es war einfach genug. Die reizende Jacht war damals nach England gekommen, James Burton, ein enragierter Jachtsportsman, hatte sie gesehen, in der Auktion alle anderen überboten.
»Was haben Sie dafür gezahlt?«
»Zweiundvierzigtausend Pfund Sterling.«
»Das ist billig genug.«
»Billig genug?«, wiederholte Mr. Burton mit umdüsterter Stirn.
»Ja, für alles das, was da drin steckte.«
»Gewiss, sie war reich ausgestattet, aber zweiundvierzigtausend Pfund Sterling...«
»Da steckte noch etwas ganz anderes drin als nur Gold und dergleichen.«
»Was denn sonst noch? Ich habe wirklich kein Geheimfach gefunden...«
»Das glaube ich schon — aber meine Liebe steckte in dem Schiffchen drin.«
Kapitän Burton schien schon mehrmals etwas verlegen geworden zu sein, nur der brüske Ton des Jungen hatte dies immer schnell wieder verscheucht.
Jetzt blickte er den Jungen mit dem alten, schon faltigen Gesichte, der sich mit einem Male so poetisch ausdrücken konnte, mit ganz anderen Augen an.
»Sie haben wohl recht an Ihrem Schiffchen gehangen?«, sagte er leise.
»Na und ob. Ich biete Ihnen fünfzigtausend Pfund dafür. Topp?«
Es lag schon in Karlemanns Tone, dass der andere, der sicher ein gutes Herz besaß, jede weichere Regung gleich wieder schwinden ließ.
»Nein, mein ›Delfin‹ ist mir nicht feil, sagte er jetzt kalt.
»Sechzigtausend Pfund.«
»Nein.«
»Fünfundsiebzigtausend Pfund!«
»Geben Sie sich keine Mühe.«
»Hunderttausend Pfund.«
Der andere antwortete nicht mehr, er nippte an seinem Champagnerkelch.
»Sie wollen nicht?«
»Nein, mein ›Delfin‹ ist mir nicht feil.«
»Na, wissen Sie denn eigentlich, wie viel das ist, hunderttausend Pfund Sterling?!«, fuhr Karlemann ihn in seiner Weise an.
Der junge Mann machte eine höchst unwillige Bewegung, aber er beherrschte sich wiederum.
»Und wissen Sie, wer ich bin?«, fragte er entgegen.
»Nee!«
»Mein Vater, dessen einziger Sohn ich bin, ist der Getreidehändler Elias Burton.«
Ja, dann allerdings kannte Karlemann diesen sonst sehr gewöhnlichen Namen Burton. Elias Burton war einer der ersten Milliardäre, die das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gezeugt hat.
Aber Karlemann musste immer wieder einen Hieb anbringen.
»Getreidehändler? Getreidespekulant, meinen Sie wohl. Morgen kann Ihr Vater vielleicht keinen Dollar mehr haben. Ich rate Ihnen, die hunderttausend Pfund lieber anzunehmen, die haben Sie sich dann wenigstens ehrlich verdient.«
Wieder musste der andere alle Anstrengung machen, um sich beherrschen zu können.
»Der ›Delfin‹ ist mir nicht feil.«
»Mit welchem Rechte haben Sie ihn denn überhaupt gekauft?«, fing jetzt Karlemann immer noch aus einem anderen Tone an. »Der ›Knipperdolling‹ war doch mein rechtmäßiges Eigentum.«
Da wollte den jungen Mann denn doch etwas die Beherrschung verlassen.
»Mein lieber Knabe«, sagte er spöttisch, »suchen Sie sich gefälligst den Richter, der Ihnen da Recht spricht!«
Karlemann sah schnell genug ein, dass er auf diese Weise nicht weit kommen würde, und plötzlich nahm der geborene Schauspieler die kläglichste Miene an, und ebenso ward sein Ton.
»Ach, wenn Sie wüssten, wie sehr, sehr ich dieses Schiffchen geliebt habe!«
Und faktisch, es machte auf das weiche Herz des anderen einen tiefen Eindruck.
»Ich wollte ja schon vorhin davon beginnen. Sie ließen mich nur nicht zu Worte kommen — ich bin gern erbötig, Ihnen noch etwas herauszuzahlen. Wie viel fordern Sie?«
»Als ob mir damit gedient wäre!«, winselte Karlemann weiter. Wenn dieses ›Winseln‹ auch nicht gar zu wörtlich zu nehmen ist, jedenfalls aber machte er seine Sache ausgezeichnet.
»Ach, mein liebes, liebes Schiffchen!«
»Sind Sie mit zehntausend Pfund zufrieden?«
»Nein, ich bin es, der Ihnen hundertundfünfzigtausend Pfund bietet.«
»Nein, ich bin es, der Ihnen noch zwanzigtausend Pfund geben will.«
Und so ging dieser seltsame Handel, wie er wohl selten vorgekommen ist, noch eine ganze Weile weiter.
»Haben Sie schon von dem Aschantischatze gehört?«, fing Karlemann zuletzt an.
»Ja, gewiss!«
»Ich habe ihn, ich biete Ihnen...«
»Nein, nein, nein, mein ›Delfin‹ ist mir nicht feil!«
»Aber wenn Sie den Aschantischatz sehen würden!«
»Und wenn Sie mir alle Schätze der Welt zu Füßen legen würden — da kann ich einmal hart sein!«
»Kaufen Sie sich doch gleich ein anderes Schiff, wenn Sie so viel Geld haben, oder ich will es Ihnen dazu geben.«
»Kaufen Sie sich doch ein anderes!«
»Das ist aber doch nicht mein ›Knipperdolling‹ — kaufen Sie sich ein anderes Schiff, ich will es bezahlen.«
»So lassen Sie sich einen zweiten ›Knipperdolling‹ ganz in demselben Stile bauen.«
»Das schlage ich Ihnen vor, lassen Sie sich einen anderen ›Delfin‹ bauen. Das, was mir mein ›Knipperdolling‹ wert war, alle die Erinnerungen, die können doch auf der Werft nicht eingebaut werden.«
»Das alles gilt aber von mir, auch an meinen ›Delfin‹ knüpfen sich liebe Erinnerungen. Es tut mir wirklich leid...«
»Zweimalhunderttausend Pfund. Wissen Sie, wie viel das ist?«
»Na, nun lassen wir das aber endlich sein!«, musste der junge Burton doch lachen. »Und ich hoffe, dass wir trotzdem als gute Freunde scheiden!«
Indem er so sprach, bückte er sich, um ein neues Fläschchen Champagner aus dem am Boden stehenden Kübel zu nehmen.
Und in diesem Moment, da jener sich bückte, leuchtete es in Karlemanns Augen gar listig und zugleich auch böse auf.
»Vielleicht werden wir aber doch noch einig«, fing er dann immer wieder an, als jener die Kelche wieder füllte.
»Einig sind wir ja hoffentlich schon.«
»Dass Sie mir das Schiffchen doch noch ablassen.«
»Niemals! So leid es mir tut!«
»Wenn ich Ihnen aber nun etwas zeige!«
»Was denn? In dieser Hinsicht kann mich nichts reizen, das sage ich Ihnen gleich.«
»Ich habe etwas in meinem Boote.«
»Bitte, Mister Algots, lassen Sie es doch endlich, es wird nichts daraus.«
»Ich werde es holen. In drei Sekunden bin ich zurück.«
Karlemann verließ schnell die Kajüte, begab sich auf sein Boot.
»So oder so, meinen ›Knipperdolling‹ muss ich doch wiederhaben«, murmelte er, als er unter Deck kroch.
Nach einer Minute betrat er wieder die Kajüte, öffnete eine Kassette, brachte daraus ein juwelenschimmerndes Gehänge zum Vorschein.
»Was sagen Sie hierzu?«
»In der Tat, herrlich! Ist das ein Halsband von so einem Aschantihäuptling?«
»Das hat der Aschantikönig um seinen Bauch getragen.«
»Um den Bauch? So?«, lächelte Burton.
»Nun, sehen Sie an. Ich will Ihnen diese Kajüte bis dorthin...«
Karlemann hatte die Hand ausgestreckt, ganz unwillkürlich folgte Burton der Richtung, wobei er sich etwas umwendete.
In diesem Augenblick zog Karlemann ein Fläschchen aus der Tasche, hatte es im Nu entkorkt, schüttete den Inhalt in das noch halbgefüllte Champagnerglas des anderen, ließ blitzschnell das Fläschchen wieder in der Tasche verschwinden.
»Bis an jenen Strich will ich die Kajüte...«
Da wandte sich Mister Burton ihm jäh zu.
»Junge, was hast du soeben in meinen Champagner gegossen?!!«
Er musste es im Spiegel gesehen haben, den Karlemann vergessen hatte — und nun suchte Karlemann auch nach keiner Entschuldigung, sondern er bückte sich blitzschnell, sein bekannter Griff, und Mr. Burton lag auf dem Rücken.
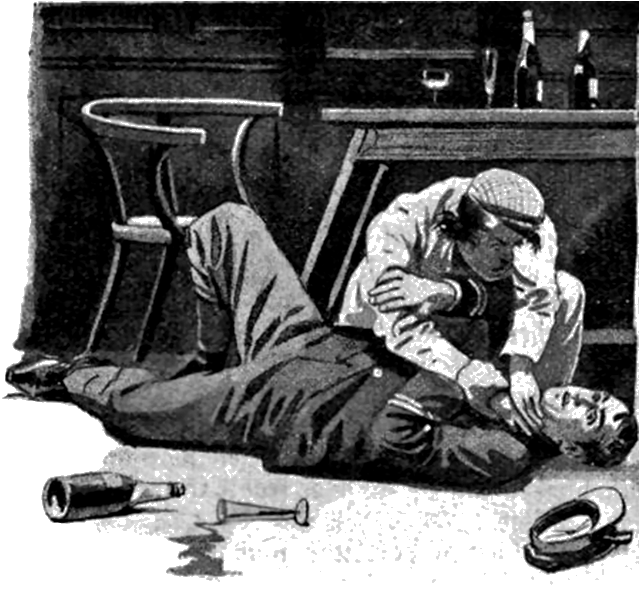
»So, dann komme ich auf diese Weise wieder zu meinem ›Knipperdolling‹, und mit den drei anderen werde ich auch noch fertig!«, zischte er, als er seine Finger wie Eisenklammern um den Hals seines Opfers legte, dass es keinen Laut hervorzubringen vermochte.
Weiter aber wollen wir diese Szene, wie Karlemann tatsächlich zum Seeräuber geworden ist, nicht schildern, wir werden ihr Ende bald aus anderem Munde erzählen hören — wir kehren zu der Fucusinsel zurück.
Die ›Sturmbraut‹ war fertig zur Abreise
»Und Sie, Mister Tischkoff?«
»Mich wollen Sie, bitte, freigeben.«
»Freigeben?«, fragte Jansen verwundert.
»Ja, dass ich diese Insel verlassen darf, Sie auch nicht begleite.«
»Ja, sind Sie denn nicht Ihr freier Herr?«
»Nein. Ich fühle mich Ihnen verpflichtet. Verstehen Sie nicht, weshalb? Gut, Sie brauchen es auch nicht zu verstehen. So wollen wir Abschied voneinander nehmen.«
»Aber was haben Sie denn nur vor?!«, fragte Jansen immer erstaunter.
Doch da erinnerte er sich, dass dieser Mann ja immer ein Rätsel für ihn gewesen war und es wohl auch bleiben würde, und er fragte in dieser Beziehung nichts weiter.
»Sie bleiben vorläufig noch hier?«
»Ja.«
»Aber wenn ich einmal wieder hierher komme, ich würde Sie nicht mehr vorfinden?«
»Nein, leben Sie wohl!«
Es war ein sehr kurzer Abschied, und dann segelte die ›Sturmbraut‹ nach Osten.
Sie war kaum aus der Fucusbank heraus, als man einen großen Postdampfer gewahrte, der beim Anblick des Seglers, wie die Reederei vorschreibt, alsbald seinen Namen nannte. Es war ein englischer Postdampfer, der nach London fuhr.
Für Jansen, der seine Denkschrift fertig hatte, kam er wie gerufen. Es fragte sich nur, wie den Brief hinüberbefördern. Jansen hatte keine Lust, sein Schiff, das wieder maskiert war, noch einmal als ›Sturmbraut‹ zu verraten, und es war auch sehr die Frage, ob er diesem großen Postdampfer nur durch Nennung seines Namens so imponieren konnte, dass er sofort stoppte. Jedenfalls wollte er, wenn irgend möglich, alles vermeiden, was an ein Gewaltmittel erinnerte.
Noch war der Dampfer weitab, aber er musste an der ›Sturmbraut‹ ziemlich dicht vorüberkommen.
Jansen gab für sein Schiff einen fingierten Namen an, erwiderte den Gruß und fragte an, ob der Postdampfer einen Brief mitnehmen könne.
Dass es ein höchst wichtiger Brief sei, brauchte er nicht hinzuzusetzen. Die Anfrage ging vom Kapitän aus, und dieser weiß doch, was es heißt, einen Postdampfer in der Fahrt aufzuhalten.
Ja, wenn er an Bord gebracht wird; wir wollen dazu stoppen, lautete die Antwort. Der englische Kapitän musste ausnahmsweise ein sehr freundlicher Mann sein.
Gut, dann konnte es gemacht werden. Englische Briefmarken besaß Jansen, der dicke Brief wurde frankiert, für die abnehmenden Hände ein in Papier gewickeltes Mundstück als Trinkgeld dazugelegt, das Ganze in Gummituch gehüllt — sonst brauchte Enoch, der den Brief im Boot hinüberbringen sollte, keine weitere Instruktion.
Geworfen musste der Brief werden, und für den Fall, dass er das Deck nicht gleich erreichte, wurde das Paket an einer dünnen Schnur befestigt.
Also Enoch ging mit sechs Mann ins Boot, vorwärts gerudert, nach einer Richtung, dass ein Laie von Landratte nimmermehr vermutet hätte, dieses Boot hätte es auf jenen Dampfer abgesehen — aber Enoch wusste schon, wie er steuerte, der Dampfer trieb mit stoppender Schraube direkt an dem Boote vorbei, der erste Wurf gelang, die Schnur wurde abgeschnitten, und ehe das Boot in das aufgewühlte Kielwasser gelangte, strebte es schon wieder mit mächtigen Ruderschlägen seinem Schiffe zu, das dankend mehrmals seine fingierte Nationalflagge, klugerweise eine englische, auf- und nieder zog.
Tief atmete Jansen auf, als er dem Postdampfer nachsah.
So, da ging er hin, mit ihm der Brief, der sein und seiner Leute Schicksal barg.
Wohin nun? Auch das Ziel der ›Sturmbraut‹ war ja London, oder doch dessen Nähe, aber man wollte doch zwei Wochen der Seebehörde und den anderen Gerichten, die sich mit der Sache befassen würden, Zeit geben.
Es würde eine schreckliche Zeit der Ungeduld werden, auch wenn man die zwei Wochen auf eine verkürzte.
Es ging bei dem ganz schwachen Westwinde nordwärts. Erst als der Wind direkt nach Süden umsprang, wurde mit halber Kraft gedampft. Kreuzen wollte man doch nicht erst.
So verstrichen einige Tage, ohne Zwischenfall, wenn man auch einige Schiffe in Sicht bekam, mit denen die maskierte ›Sturmbraut‹ Grüße wechselte.
Nach auf der Kommandobrücke durchwachter Nacht, da Mahlsdorf noch immer zum Dienst unfähig war, lag Jansen eines Morgens schlafend in seiner Koje.
Da wurde er geweckt.
»Kapitän, der ›Knipperdolling‹ ist in Sicht — wahrhaftig, 's ist Karlemanns ›Knipperdolling‹!!«
Mit gleichen Füßen aus der Koje und an Deck geeilt. Ja, diese zierliche Jacht konnte nur Karlemanns ehemaliger ›Knipperdolling‹ sein.
Ach, es waren gar wehmütige Erinnerungen, die in Jansen aufstiegen, als er das zierliche Schiffchen betrachtete, das jetzt einen anderen Besitzer hatte.
Damals, als er die Bekanntschaft des deutschen Zigeunerknaben machte, wie dieser dann von der mexikanischen Tänzerin das reizende Spielzeug erworben, was für Pläne da unser Held gehabt, wie da die Welt im rosigsten Sonnenlichte vor ihm gelegen hatte... und nun heute!!
»Ach, Blodwen, Blodwen, hätte ich dich doch niemals gesehen!! Ja, ich möchte, dass ich dir bald folgen könnte!«
So erklang es mit leisem Schluchzen aus der Brust dieses eisernen Mannes.
Da zeigte die kleine Jacht, die aber ganz anders getakelt war, nämlich wie ein großer Dreimaster, Flaggen, sie meldete ihr Signalement.
»›Delfin‹, Norfolk, Kapitän James Burton.«
In Jansens Kopfe entstand ein plötzlicher Plan.
»Die Freude kann ich ihm noch machen — dieser Junge, ein Liebling der Götter, wird nicht unser Schicksal teilen, der ist viel zu schlau — ja, seinen ›Knipperdolling‹ werde ich ihm wieder verschaffen können!«
Und er ließ zurücksignalisieren.
»›Fingal‹, Bremerhaven, Kapitän Denhardt. Bitte um Unterredung.«
»Bitte, Burton«, wurde drüben geantwortet, mit der gewöhnlichen, überaus großen Höflichkeit, deren man sich bei der Flaggensprache befleißigt, so kompliziert sie doch eigentlich auch ist.
»Kapitän Denhardt bittet an Bord des ›Delfins‹ kommen zu dürfen.«
»Bitte sehr.«
Ein Boot auszusetzen war nicht nötig, die ruhige See erlaubte ein Ansegeln — oder eigentlich ein Andampfen, was es aber in der Seemannssprache nicht gibt — kurz, die mit halber Kraft gehende ›Sturmbraut‹ änderte den Kurs, hielt auf die Jacht zu, hatte sie in fünf Minuten erreicht, und das große Schiff übte auf sie eine Anziehungskraft aus wie ein größeres Stück Holz auf einen Papierspan, das kleine Schiff ward förmlich angezogen.
Jansen sprang herab auf das Deck.
Einen Blick auf die riesenhafte Gestalt, und der junge Kapitän prallte schreckensbleich zurück.
»Kapitän Richard Jansen!!!«
»Ja, ich bin es, aber habt keine Angst, ich komme nicht als Seeräuber«, sagte unser Held mit einem gutmütigen Lächeln, dem aber auch etwas unsäglich Schmerzliches innewohnte.
»Ist diese Jacht verkäuflich?«
Burton musste etwas nach Fassung ringen. Es war ihm doch gar zu überraschend gekommen.
»Nein«, brachte er dann hervor. »Wissen Sie, wem diese Jacht früher gehört hat?«
»Meinem kleinen Freunde — Karlemann — Kapitän Algots, wollte ich sagen.«
»Er ist tot.«
Jansen glaubte natürlich seinen Ohren nicht trauen zu dürfen.
»Ich habe ihn erschossen.«
»Erschossen?!!«
»In der Notwehr.«
Und Burton erzählte. Was wir schon wissen, braucht nicht wiederholt zu werden.
»... Da brachte er mich durch Wegziehen der Füße zum Sturz, warf sich auf mich, entwickelte eine Kraft, die ich dieser kleinen Gestalt nimmermehr zugetraut hatte, umschnürte mit seinen Händen meinen Hals, dass ich keinen Laut mehr von mir geben konnte, und dann schlug er auch auf mich ein, jedenfalls doch, um mich vollends zu betäuben.
Ich war dem Erstickungstode nahe. Es gelang mir noch, den Revolver aus der Tasche zu ziehen. Ich schoss blindlings drauflos. Was tut man nicht in der Todesangst! Und überhaupt, ich musste mich doch wehren, und wenn ich mich recht entsinne, so sagte er triumphierend, während er mir noch die Luft abdrückte, dass er dann auf diese Weise zu seinem Ziele kommen wolle, und mit den drei anderen, also mit meinen Matrosen, würde er auch noch fertig.
Also ich schoss. Da rollte er zur Seite. Ein Schuss durch die Lunge. Er hat furchtbar gelitten. Zwei Stunden lang hat er mit dem Tode gerungen. Sprechen konnte er nicht. Der Erstickungstod machte seinen Qualen ein Ende.«
Jansen war wie gelähmt. Er stierte den Erzähler nur immer an. Dann hob er langsam die Hände, als wolle er sie sich vors Gesicht schlagen, aber er tat es nicht, sondern wandte sich und blickte nach der hohen Bordwand seines Schiffes hinauf, wo die Köpfe fast der gesamten Mannschaft zu sehen waren.
»Habt Ihr's gehört? Karlemann ist tot, unser Karlemann ist tot!!«
Einen größeren Jammer hätte er nicht in seine Stimme legen können.
Ja, sie alle hatten die ganze Erzählung mit angehört.
Er hatte den Tod verdient, er war als Räuber aufgetreten, er war nicht zu bemitleiden, ja — aber...
»Unser Karlemann ist tot!«, erklang es oben im Chor in ganz demselben Tone, und dann setzte noch einer hinzu:
»Der Klabautermann tot — Karlemann tot — jetzt kommt einer nach dem anderen an die Reihe!«
Der Matrose sprach die Gedanken aller anderen aus. Merkwürdig war, dass beim Tode der anderen Kameraden gar nicht solche Gedanken entstanden waren, wo Karlemann doch eigentlich gar nicht zur ›Sturmbraut‹ gehörte. Er war aber eben der stärkste Vertreter dieses Seezigeunertums gewesen.
»Und die drei anderen sind mit dem kleinen Boote davongefahren?«, wandte sich Jansen dann wieder an Burton.
»Nein, es sollte anders kommen. Zunächst versicherte ich mich der Knaben, denn wenn sie auch furchtbar erschüttert waren und mir ihre Unschuld versicherten — ich durfte ihnen doch nicht sogleich trauen. Ich machte Platz in der Segelkammer, sperrte sie ein. Das Boot nahm ich ins Schlepptau. In der Nacht überlegte ich mir die Sache. Was sollte ich mit den Jungen anfangen? Dem kleinen Kapitän hatte ich ein christliches Seemannsbegräbnis gegeben, und das Einfachste war wohl, wenn ich seine kleine Mannschaft wieder in ihr Boot setzte und sie davonsegeln ließ. Gesetzt den Fall, dass sie damit einverstanden waren. Anderntags wollte ich sie deshalb fragen. Es war eine sehr stürmische Nacht. Das Schleppseil musste verlängert werden, dass uns das Boot nicht rammte. Da meldete mir der Wachhabende, dass das Seil gerissen sei. Da war nichts zu machen, ein Suchen nach dem Boote in der finsteren Nacht ganz ausgeschlossen. Jetzt erst dachte ich daran, die Jungen zu fragen, was sie eigentlich in dem Boote Besonderes gehabt hätten. Als ich an der Tür der Segelkammer vorbeiging, war es mir, als ob ich Stimmen hörte, oder überhaupt, es kam mir vor, als ob die Jungen nicht schliefen. Die Segelkammer hat noch einen Nebenraum mit einer Öffnung in der Wand, nur lose mit Segeln verdeckt. Eine Ahnung gab mir ein, doch einmal zu lauschen, was die mitten in der Nacht zu sprechen hatten. Ich benutzte jene Nebenkammer. Und da musste ich hören, wie die drei Knirpse ganz sachgemäß besprachen, auf welche Weise sie Herren dieser Jacht werden könnten, wobei es ihnen auf unsere Ermordung gar nicht ankam.«
Jansen blieb ungerührt. Was konnte man denn auch von solchen Jungen, welche bei Karlemann in die Schule gegangen waren, anderes verlangen?
»Und was taten Sie da?«
»Ich machte mich Ihnen bemerkbar und klar, dass es so etwas bei mir nicht gäbe, nun könnte ich sie aber auch nicht in Freiheit setzen, sondern sie würden hier in der Segelkammer als Gefangene bleiben, bis ich sie dem ersten mir begegnenden Kriegsschiffe ausliefern wolle, wo sie natürlich als Seeräuber sofort aufgeknüpft würden.«
»Und Sie haben sie einem Kriegsschiffe ausgeliefert?«, fragte Jansen jetzt doch mit einigem Schreck.
»Nein, obgleich ich ein holländisches Kriegsschiff sichtete, dann auch noch ein französisches. Es ging doch etwas gegen mein Gewissen. Es sind schließlich ja noch Kinder. Ach, ich habe in diesen Tagen mein Gehirn fortwährend zermartert, was ich nun eigentlich mit diesen kleinen Bösewichtern anfangen solle...«
»Ja, wo sind sie denn jetzt?«
»Immer noch unten in der Segelkammer eingesperrt.«
»Ah so! Würden Sie die Kerls mir übergeben?«
»Herzlich gern, dann bin ich diese Last los!«
»Bei mir dürfen sie solch böse Streiche nicht machen.«
»O, Herr Kapitän, ich weiß sehr wohl, dass Sie gar kein solcher Seeräuber sind, als welchen man sie verschreit.«
Aufmerksam blickte Jansen den Sprecher an.
»Seit wann sind Sie auf hoher See?«
»Seit fast acht Wochen.«
»Und seit wann ohne Nachricht vom Lande?«
»Ebenso lange. Ich gehe manchmal in See, um keine Briefe und Zeitungen lesen, anderen Klatsch hören zu müssen.«
»So haben Sie auch noch nichts von einem Tiger von Honduras gehört?«
»Tiger von Honduras?«, wiederholte der junge Mann verwundert.
»Ist Ihnen etwas von einem sogenannten Aschantischatz bekannt?«
Jansen hatte sehr geschickt operiert. Durch diese letzte Frage lenkte er jenen von der Erklärung der vorigen ab.
»Jawohl, das ist das Gold und das Geschmeide, welches Kapitän Algots den Aschantihäuptlingen abgenommen hat.«
»Wissen Sie nicht, ob sich dieser Schatz an Bord des Bootes befand?«
»Allerdings. Kapitän Algots bot ihn mir sogar zum Tausche gegen meine Jacht an. Ich ging aber nicht auf den Vorschlag ein.«
»Also ich bitte Sie, mir diese Gefangenen auszuliefern.«
»Herzlich gern.«
Sie wurden sofort heraufgebracht, kamen gleich an Bord der ›Sturmbraut‹, und Kapitän Burton verabschiedete sich, ohne sich weiter für den Aschantischatz zu interessieren, fuhr mit geschwellten Segeln davon.
Wollte er das Boot jetzt vielleicht noch suchen? Doch er hatte es ja schon vor einigen Tagen verloren, und hätte er so etwas vorgehabt, so hätte er sich doch wenigstens noch mit einem Worte danach erkundigt, ob das Boot auch wirklich den Aschantischatz enthalten habe.
Jansen nahm die drei Jungen vor, die sich sehr niedergeschlagen zeigten, aber doch froh waren, aus ihrer Gefangenschaft wieder zu den Kameraden gekommen zu sein. Sie hatten sich ja schon aufgeknüpft gesehen.
Von dem Ende ihres kleinen Kapitäns wussten sie gar nichts zu erzählen, und Jansen glaubte ihrer Versicherung, dass sie durchaus nichts von seinem Vorhaben, selbst durch Gewalt wieder in den Besitz seines ›Knipperdollings‹ zu kommen, gewusst hätten.
Dagegen schilderten sie ausführlich, wie sie den Schatz versenkt hatten, und nun stellte sich heraus, dass die Jungen recht wohl wussten, wie ihr Kapitän sie zu täuschen gesucht hatte. Klingelmann hatte nämlich gemerkt, dass der Sextant verschraubt gewesen war, hatte dies dann später seinen Kameraden mitgeteilt.
Aber die richtige Berechnung wussten sie nun freilich auch nicht, die hatte Karlemann jedenfalls mit sich in den Tod genommen, und Jansen dachte auch gar nicht daran, deshalb weitere Nachforschungen zu halten.
Die Fahrt nach Norden wurde fortgesetzt.
Es war die Zeit der regelmäßigen Herbststürme, unter denen die ›Sturmbraut‹ viel zu leiden hatte. Am schlimmsten aber war, dass sich eine Woche lang an dem grauen Himmel weder Sonne noch Sterne zeigen wollten, und dann hört jede geografische Bestimmung auf; nur nach dem Kompass und nach der gemachten Knotenzahl kann man ungefähr noch mutmaßen, wo man sich befindet, wobei man aber durch Strömungen sehr getäuscht werden kann.
Doch das sind Lagen, in die jedes Schiff ab und zu kommen kann.
Jedenfalls befand sich die ›Sturmbraut‹ noch auf hoher See, ungefähr auf der Höhe der Kanarischen Inseln, aber so weit entfernt von ihnen, dass ihre Küsten durchaus nicht zu fürchten waren.
Es war der 14. Oktober. Der sonst immer währende Sturm hatte einmal nachgelassen, ein heftiger Regenguss die haushohe See schnell niedergeschlagen, dafür aber senkte sich am Abend ein undurchdringlicher Nebel herab.
Die ›Sturmbraut‹ verfolgte ihren Kurs mit halber Dampfkraft. Keine Vorsicht wurde außer acht gelassen. Beide Wachen mussten an Deck sein, ununterbrochen heulten die Nebelhörner, beständig wurde gelotet, obgleich Jansen überzeugt war, sich auf hoher See in ganz freiem Wasser zu befinden.
So kam Mitternacht heran.
»Zehn Faden frei — zehn Faden frei!«, sangen abwechselnd die beiden Matrosen, welche das Lot handhabten.
Da plötzlich war dem Kapitän, als ob er in weiter Ferne ein ihm so wohlbekanntes Geräusch höre — ein Geräusch, welches noch jedem Seemanne das Blut aus den Wangen gejagt hat, wenn es nur zu hören, seine Ursache nicht zu sehen ist.
Und da vernahmen auch alle anderen das eigentümliche Brausen.
»Die Brandung!!«, erklang es entsetzt.
Jansen gab noch kein Kommando, er lauschte noch immer, dabei ganz kopfscheu werdend.
»Martin, wo ist die Brandung?«
»Im Westen, Kapitän, im Westen!«
»Eine Brandung im Westen? Was für eine Küste können wir im Westen haben?!«
Ja, das war es, was auch alle die anderen sonst so eisenfesten Seeleute ganz außer Fassung brachte. Aber man muss wohl selbst Seemann sein, um verstehen zu können, was es heißt, aus einer Richtung eine Brandung zu vernehmen, wo man nimmermehr eine vermutet hat.
Und immer deutlicher ward das Brausen und Donnern.
»Stopp!«, kommandierte Jansen durch das Sprachrohr.
Die Maschine auch gleich rückwärts gehen zu lassen, daran brauchte er noch nicht zu denken.
Das Zittern der Schiffsplanken hörte auf — und in diesem Augenblick, als die ›Sturmbraut‹ noch mit vier Knoten vorwärts ging, von unten ein furchtbarer Ruck, der alles in die Höhe warf, dann noch ein knirschendes Geräusch, das sich durch die Schiffsplanken bis auf den menschlichen Körper übertrug und auch durch das Ohr wahrgenommen ward, und...
»Wir sinken!!!«
Es war nicht nur ein Ruf des Schreckens, sondern auch Jansen hatte die Tatsache sofort erkannt. Woraus, das lässt sich nicht erklären.
Jedenfalls aber war die ›Sturmbraut‹ doch aufgerannt, und saß sie fest, so konnte sie sich doch eben nicht mehr bewegen, was nicht der Fall war, sie schlingerte noch heftig von einer Seite auf die andere, und das Auflaufen war so heftig gewesen, dass unbedingt ein großes Leck entstanden sein musste.
»Klar bei den Booten!!«, donnerte Jansens Kommandostimme, und dann durch das Sprachrohr hinab: »Alles an Deck, wir sinken!!«
Fast schon der nächste Augenblick zeigte, dass es wirklich so war. War auch noch nicht zu bemerken, dass sich die Bordwand der Wasserfläche näherte, so verrieten doch gleich die veränderten Schwankungen, wie sich das Schiff schnell mit Wasser füllte.
Mit einem Satze war Jansen die Brückentreppe hinab, stürzte nach dem Kajüteneingange, prallte hier mit dem zweiten Ingenieur zusammen, der den Weg aus dem Maschinenraum durch die Kajüte genommen hatte.
»Kapitän, wir sinken, das Wasser schießt in Strömen in den Maschinenraum!!«, schrie er.
Jansen schleuderte ihn zur Seite, in die Kajüte, nach seiner Kabine — da quoll ihm von hinten ein schäumender Wasserstrahl entgegen.
Ein Moment lähmenden Entsetzens, dann ein heiserer Schrei, und Jansen stürzte zurück, sonst würde er hier in der Kajüte ertrinken.
Nicht ein Augenblick war mehr zu verlieren. Jetzt ging es mit Vehemenz hinab.
Ein Glück, dass auf der ›Sturmbraut‹ eine Disziplin herrschte, wie auf dem geschultesten Kriegsschiff, dass bei dem Kommando ›klar bei den Booten‹ jeder Mann wusste, wohin er seine Hand zu legen, was für Griffe er zu tun hatte. Sonst wäre bei diesem Nebel die ganze Mannschaft verloren gewesen, nur die kleinste Unordnung hätte zu entstehen brauchen.
Ausgeschwungen waren die sämtlichen Boote überhaupt schon gewesen, jetzt schossen sie mit der Rudermannschaft hinab, die anderen, wie die Heizer und jene, welche man als Passagiere betrachten konnte, wie z. B. der Schiffsmaler und Madam Hullogan, Hals über Kopf hinein, und dann abgesetzt, wobei man schon die Bordwand des sinkenden Schiffes zu fühlen bekam.
»Pult, Jungens, pullt aus, dass wir aus dem Strudel kommen!!«, heulte durch den Nebel eine Stimme, die wohl dem Bootsmanne gehörte.
»Belegt, belegt, stopp, sonst rammen wir uns gegenseitig!!!«, donnerte dagegen Jansens Stimme.
Es war eine furchtbare Situation. Undurchdringlicher Nebel, dass kein Boot das andere erblicken konnte, beim kräftigen Anrudern konnten sie sich gegenseitig in den Grund rammen, sich glatt durchschneiden, und in dichter Nähe war jeden Augenblick der Strudel zu erwarten, der alles in der Nähe Befindliche mit in die Tiefe zog.
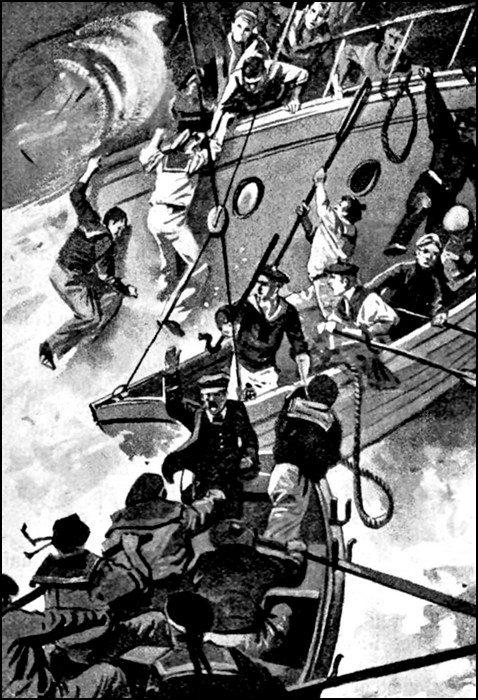
Jansen schien das letztere vorziehen zu wollen. Und da kam allen eins zum Bewusstsein.
Hatte man nicht ausgemacht, dass der Untergang der ›Sturmbraut‹ auch die ganze Mannschaft vernichten solle?
War darüber gesprochen worden? Oder nicht? Es war für diese Seedesperados immer ganz selbstverständlich gewesen, und mit der ›Sturmbraut‹ in die Luft zu fliegen, etwa unter Zuhilfenahme des Nitroglyzerins, darüber war ja auch oft genug wirklich gesprochen worden.
Dieser Entschluss war bei jedem felsenfest gefasst gewesen. Es war anders gekommen. Es gibt Verschiedenes, was man sich gar nicht vornehmen dürfte. Ja, ehe sie einem Feinde lebendig in die Hände fielen, einen Schuss in den Sprengstoff zu feuern, das hätte jeder mit klarem Bewusstsein fertig gebracht — aber hier war eben kein menschlicher Feind gekommen, hier hatte sich Gott direkt eingemischt, da war die klare Besinnung verlorengegangen, denn der Trieb der Selbsterhaltung ist bei jedem lebenden Wesen eben der stärkste.
Kurz, sie befanden sich schon in den Booten, und nun war es zu spät, um noch mit der ›Sturmbraut‹ auf den Grund hinabzugehen.
Oder beabsichtigte oder hoffte Jansen es nachträglich doch noch? Hatte er nur deshalb den Befehl gegeben, nicht zu den Rudern zu greifen, um noch von dem Strudel hinabgezogen zu werden?
Hatte er dies wirklich beabsichtigt, so sollte er auch hierin getäuscht werden.
Kein brausender Strudel wollte entstehen.
»Das Schiff kann gar nicht tief gesunken sein«, hieß es.
»Oder wir werden von einer Strömung fortgetrieben«, lautete eine andere Ansicht.
Es muss schrecklich sein, solch eine Ungewissheit, erzeugt durch undurchdringlichen Nebel!
»Die Boote sollen sich melden!«, kommandierte Jansen.
Vier Bootssteuerer gehorchten dieser Aufforderung der Reihe nach, dann zählten sich auch die Insassen eines jeden ab, und danach waren es zweiundvierzig Mann, Madam Hullogan mit eingeschlossen, und danach wieder fehlte kein einziger.
Mit vieler Mühe wurden die fünf Boote unter Jansens Anleitung zusammengebracht, Bord an Bord, und so lagen sie die ganze Nacht. Sie konnten ja gar nichts tun. Entweder hätten sie sich beim Rudern gerammt, oder sie hätten sich verloren. Wohl befanden sich in jedem Boote einige Petroleumlaternen, alles war in tadelloser Ordnung, aber bei diesem Nebel versagte doch alles.
Und nun nicht wissend, wo sie sich befanden, schon nicht mehr die Lage des gesunkenen Schiffes erraten könnend!
Doch, eins konnten sie wissen: nämlich dass sie sich in einer Strömung befanden, fortgetrieben wurden. Denn das Geräusch einer Brandung verminderte sich immer mehr, bis gar nichts mehr davon zu hören war.
So lagen die fünf Boote länger denn sechs Stunden zusammen, bis der Morgen anbrach, ohne Nebel, aber doch grau wie Blei.
Was die Schiffbrüchigen während dieser sechs Stunden alles in Gedanken erwogen hatten — gesprochen war fast gar nicht worden — können wir nicht schildern, und der helle Tag zeigte ihnen erst die Trostlosigkeit ihrer Lage.
Land war nicht zu sehen. Nichts als das graue, eintönig rollende Meer.
Unter gewöhnlichen Verhältnissen wäre die Lage dieser Schiffbrüchigen gar nicht so hoffnungslos gewesen. Die vorzüglichen Boote waren mit allem ausgerüstet, dass man sich zwei Wochen am Leben erhalten konnte. Einmal musste sich der Himmel doch aufklären, dann konnte man bestimmen, wo man sich befand. Und ganz sicher war, dass man höchstens drei Tage zu rudern brauchte, so musste man die Westküste Nordafrikas erreichen, und hielt man mehr nördlicher, musste man an die Küste von Spanien oder Portugal gelangen, und die See hätte noch viel höher gehen können.
Bekleidet waren alle zwar nur sehr dürftig, aber es war auch noch gar nicht so kalt.
Also für gewöhnlich hätte keine schiffbrüchige Mannschaft unter solchen Verhältnissen den Mut sinken lassen, frisch hätte man zu den Riemen gegriffen. Aber nun hier die Mannschaft der ›Sturmbraut‹.
»Unsere ›Sturmbraut‹ gesunken!«
Erst jetzt kam es ihnen voll und ganz zum Bewusstsein. Und dass es so gekommen, alles ganz gegen ihre Vorsätze, das war es eben, was diese sonst so eisernen Männer völlig aus dem Konzept brachte.
Endlich öffnete Jansen die bisher fest zusammengepressten Lippen.
»Noch leben wir — noch sind wir alle beisammen — vorwärts, nach Osten — pullt an!!«
Sie ruderten los, stumm.
Da tauchte im Süden ein Rauchwölkchen auf, ihm folgten drei Mastspitzen.
Was halfen alle Erwägungen? Das Schiff kam schnell herauf.
»Das ist ein Kriegsschiff!«
Sie ruderten weiter.
Unsichtbar machen konnten sich diese fünf Boote nicht.
Da hisste das Schiff zum Zeichen, dass es die offenen Boote gesehen, die Flagge — die englische Kriegsflagge.
So, nun war es gut!
»Jungens, was wollen wir tun?«
Ja, was tun?
Dass jedes Boot mit Waffen ausgestattet sein soll, darüber schreibt die Seebehörde nichts vor, auch auf Kriegsschiffen ist das nicht der Fall, und ebenso wenig hatte man auf der ›Sturmbraut‹ einmal solch eine Möglichkeit erwogen.
Vielleicht war es Leichtsinn, aber es war nun einmal so.
Zur Zeit der Katastrophe hatte auch Jansen seinen Revolver nicht einstecken gehabt — wozu sollte er auch — und so bestand die ganze Bewaffnung der Schiffbrüchigen nur aus ihren Messern.
Sollte man sich mit diesen zur Wehr setzen? Sich an Bord des Kriegsschiffes bringen lassen, um dann mit den Messern über die Besatzung herzufallen, die sicher aus einem halben tausend Mann bestand?
Es wäre Wahnsinn gewesen! Ja, und waren sie denn überhaupt je Seeräuber gewesen? Und wollten sie jetzt noch nachträglich zu Mördern werden?
Nur eins gab es: sich dieses Messer selbst ins Herz zu stoßen. Ihr Entschluss war ja immer gewesen, niemals lebendig in eine Gefangenschaft zu kommen, mit diesem Vorsatze hatten sie sich ja auch auf die Fahrt nach England begeben.
Es ist aber leicht einzusehen, dass sich durch diesen Schiffbruch alles total verändert haben musste. Sie hatten doch erst versuchen wollen, ob sie nicht vielleicht von England in Gnaden wieder aufgenommen würden.
Jansen erhob sich am Steuer.
»Jungens! Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Es ist alles anders gekommen, als wir geplant hatten. An Widerstand ist hier nicht zu denken, auch nicht an eine Selbstvernichtung, an Selbstmord, denn dadurch würden wir eine Schuld gestehen, die wir gar nicht begangen haben. Anders kann ich mich jetzt nicht ausdrücken. Für uns bleibt nur eins übrig: uns auf Gnade und Ungnade diesem englischen Kriegsschiffe zu ergeben. Es wird uns nach England bringen, dort hat man bereits meine Denkschrift geprüft, und geht man nicht auf meine Vorschläge ein, spricht man uns schuldig, dann können wir noch immer sehen, wie wir uns aus dieser Klemme helfen, und gelingt es nicht, dann lassen wir uns eben aufknüpfen, unschuldig. Es sind noch ganz andere Kerls unschuldig eines viel schmachvolleren Todes gestorben. Einverstanden?«
»Ja, Kapitän!«, erklang es einstimmig aus den sämtlichen fünf Booten, kein einziger Mund hatte sich ausgeschlossen.
Das Kriegsschiff, eine Korvette, deren Namen man noch nicht lesen konnte, war in Rufweite herangekommen.
»Habt Ihr Euer Schiff verloren?«, rief der an seiner Uniform erkenntliche Kapitän, ohne das Sprachrohr benutzen zu müssen.
»Ja, die ›Patria‹ von NewOrleans, Kapitän Sylvester«, entgegnete Jansen, der schon längst nicht mehr auf der Ducht, d. h. auf der Bootsbank, sondern am Boden des Fahrzeuges saß.
Und nun wird der Leser auch etwas merken. Dass Jansen und die ganze Mannschaft nicht etwa das einzige Mittel vergessen hatten, welches es noch gab, um doch vielleicht aus dieser Kalamität zu kommen, durch eigene Kraft eine Küste zu erreichen, um sich dann weiter fortzuhelfen.
Sie verweigerten einfach, sich an Bord des Kriegsschiffes aufnehmen zu lassen.
Dieser Versuch war so selbstverständlich, dass wir vorher gar nicht erst darauf vorbereitet haben.
Es kommt ja hin und wieder vor, dass Schiffbrüchige im offenen Boote verweigern, sich von einem Schiffe aufnehmen zu lassen: wenn es nicht mehr gar zu weit entfernt von einer Küste ist, Lebensmittel noch genug vorhanden sind, überhaupt die Mannschaft noch in der Lage ist, die Küste aus eigener Kraft zu erreichen, mag es sich auch noch um einige Tage angestrengten Ruderns handeln, und dann muss auch der Kapitän dabei sein, der den Matrosen eine gehörige Prämie verspricht.
Denn wie schon häufig erwähnt, auf der See gibt es nichts umsonst. Auch die Aufnahme der Schiffbrüchigen muss die betreffende Reederei bezahlen, nicht nur dann die Verpflegung, sondern schon die dabei geleistete Arbeit, das kostet sogar schweres Geld — und abgesehen davon, dass der schiffbrüchige Kapitän dies seiner Reederei ersparen will, geht es dabei auch um die Ehre. Ein Kapitän, der sein möglichstes getan hat, ohne fremde Hilfe bis zuletzt fertig zu werden, wenn er das Wrack nicht mehr auf den Strand setzen kann, dann wenigstens noch die Besatzung, steht in hohem Ansehen, dann kann ihm sein vorhergegangenes Unglück noch verziehen werden.
Freilich hat alles seine Grenzen, auch das Verweigern, sich von einem Schiffe retten zu lassen. Da kann sehr leicht Misstrauen entstehen.
Wenn auf hoher See, vielleicht Tausende von Meilen vom Lande entfernt, ein Boot gesichtet wird, und die Mannschaft weigert sich, sich von dem Schiffe aufnehmen zu lassen, liegt da nicht der Verdacht sehr nahe, dass hier etwas nicht in Ordnung ist? Vielleicht sind es Meuterer, die gerade die Flagge zu fürchten haben, welche das seine Hilfe anbietende Schiff führt. Oder sonst irgendein verdächtiger Grund.
»Seid Ihr selbst der Kapitän?«, wurde vom Kriegsschiff, welches mit stoppender Schraube immer näher trieb, weiter gefragt.
»Ja.«
»Wann habt Ihr es verloren?«
»Erst in dieser Nacht.«
»Wo?«
»Ich konnte seit acht Tagen keine Bestimmung mehr machen, wir müssen uns in der Nähe der Kanarischen Inseln befunden haben, als wir aufrannten.«
»In der Nähe der Kanarischen Inseln? Unsinn, von denen seid Ihr zweihundert Meilen westlich entfernt. Das können nur die OmaloRiffe gewesen sein.«
O weh! Und so kann man sich irren, wenn längere Zeit keine geografische Bestimmung zu machen ist!
»Ihr wollt doch aufgenommen werden?«
»Nein, das wollen wir nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Wir wollen dann die Kanarischen Inseln zu erreichen suchen.«
»Noch heute tritt wieder starker Sturm ein.«
»Es wird uns schon gelingen.«
»Ist die ganze Mannschaft damit einverstanden?«
»Very well«, erklang es einstimmig, und schon atmete alles erleichtert auf.
Wenn nur das Kriegsschiff nicht unterdessen so unheimlich nahe gekommen wäre, jetzt musste man schon jeden Gesichtszug erkennen können!
»Wie Ihr wollt. Kann ich Euch mit etwas aushelfen?«
»Besten Dank, wir sind mit allem ver...«
»By Jove!!«, erklang da auf dem Kriegsschiffe eine Stimme in höchstem Staunen. »Das ist doch der Wilm, der zuletzt auf der ›Sturmbraut‹ war?«
»Jawohl«, rief eine andere Stimme in demselben Tone, »ich hab's schon immer gesehen, es nur nicht glauben wollen — das ist die ganze Mannschaft der ›Sturmbraut‹, ich habe sie doch in New York gesehen!«
»Und das ist der Kapitän Richard Jansen, wie er leibt und lebt!!«
»Der Tiger von Honduras, wir haben ihn!!!«
Die Aufregung, die an Bord des Kriegsschiffes entstand, lässt sich gar nicht beschreiben.
Doch nur wenige Augenblicke, in diesen drängte sich eben die Aufregung einer viel längeren Zeit zusammen, dann wiederholten die Bootsmannspfeifen das gegebene Kommando, und im Nu waren die Matrosen auf ihren Stationen mit Handwaffen angetreten. Denn dass es auf einem englischen Kriegsschiff sonst nicht an Disziplin fehlt, darf man wohl glauben — und die es nicht glauben, sind eben in einem schweren Irrtum befangen, der noch einmal sehr verhängnisvoll werden kann.
»Ihr seid der Kapitän Richard Jansen von der ›Sturmbraut‹?«
Missglückt und verloren!! Und Jansen erhob sich zu seiner ganzen riesenhaften Höhe und verschränkte die Arme über der Brust.
»Ich bin es!«
»Die ›Sturmbraut‹ ist gescheitert?«
»Ja.«
»Das ist die Mannschaft?«
»Ja.«
»Ergebt Euch!!«
»Wir ergeben uns.«
»Denkt an keinen Widerstand!«
»Wir ergeben uns.«
»Bei der geringsten verdächtigen Bewegung lasse ich feuern.«
»Wir ergeben uns«, wiederholte Jansen zum dritten Male.
»So kommt an Bord!«
Das Fallreep ward herabgelassen.
»Lass fallen die Riemen, streich Backbord«, kommandierte Jansen, um sein Boot als erstes dort hinzudirigieren.
»O, Kapitän, Kapitän!!«, stöhnte es einmal in tiefster Seelenqual.
»Ruhe, Jungens, ich kann euch die Versicherung geben, dass alles gut ablaufen wird«, tröstete Jansen.
Dachte er an Tischkoffs Prophezeiung? Die bezog sich nur auf ihn. Und bis zu seinem hohen Alter war noch eine gar lange Zeit.
Er erstieg als erster das Fallreep, betrat durch die geöffnete Bordwand das Deck — sofort wurden von hinten seine Hände ergriffen und in Eisen gelegt.
Ruhig hatte Jansen es sich gefallen lassen, er blickte sich um, las den Namen der Korvette — ›Duke of Westmoreland‹ — blickte den vor ihm stehenden Mann in Kapitänsuniform an, den Kommandanten — und diese Züge konnten nicht lügen, Jansen war in die Hände eines edlen, gerecht denkenden Mannes gefallen.
»Ich bitte um anständige Behandlung.«
»Ich tue meine Pflicht, ich muss Sie fesseln.«
»Ich bin nicht der Seeräuber, für den ich gelte.«
»Das wird das Gericht entscheiden.«
Daraus hatte Jansen schon viel gehört. Ein Kriegsschiff hat das Recht, jeden Seeräuber sofort aufzuknüpfen. Allerdings nur, wenn er auf frischer Tat ertappt wird, welcher Grund ja aber zu umgehen ist.
»Es wurde vorhin gerufen, ich sei der Tiger von Honduras.«
»So werden Sie genannt, weil Sie als Mordbrenner die Hafenstadt Caballos überfallen haben.«
»Es wird bald bewiesen werden, dass ich das gar nicht gewesen bin. Ein anderes Schiff hat den Namen meiner ›Sturmbraut‹ missbraucht.«
»Wahrhaftig?!«, rief der Kommandant in größter Überraschung.
Doch schnell hatte er sich wieder beherrscht.
»Hierüber habe nicht ich, sondern das Gericht zu urteilen.«
Ja, auch diese Unparteilichkeit gehört mit zu einem gerechten Manne, und Jansen konnte damit nur zufrieden sein.
»Ich bitte um eine anständige Behandlung«, wiederholte Jansen.
»Ich werde Sie behandeln als einen Untersuchungsgefangenen, dessen Schuld erst bewiesen werden muss.«
»Dafür sage ich Ihnen meinen Dank.«
»Führt ihn ab!«
»Halt! Ich möchte dabei sein, wenn auch meine Leute gefesselt und abgeführt werden. Nur dann kann ich eine Garantie für ihr Verhalten übernehmen.«
Die Richtigkeit dieses Vorschlages ward gleich eingesehen, so blieb Jansen dabei, wie einer seiner Leute nach dem anderen heraufstieg, sofort gefesselt und abgeführt wurde.
Wohin, das zu fragen, hatte er kein Recht, oder es wäre von ihm anmaßend gewesen.
Als drittletzter kam ein Matrose, dem beide Füße amputiert worden waren. Er musste mit einer Schlinge hochgehievt werden, desgleichen Mahlsdorf, und als letzte erschien Madam Hullogan an Deck.
Sie war die einzige, die mit allem nicht einverstanden war und ihrem Unmut laut Luft machen musste, sonst wäre sie wahrscheinlich erstickt.
»Ist sich eine Gemeinheit...«, fing sie an, und so ging es weiter, bis sie gefesselt war und ihr Schimpfen nach und nach verklang.
»Herr Kapitän Jansen, folgen Sie mir«, sagte Kapitän Webb und begleitete den Gefangenen selbst.
Die Sensation in England war ungeheuer. Nicht etwa darüber, dass die schiffbrüchige Mannschaft der ›Sturmbraut‹ gefangengenommen war. Davon war noch gar nichts bekannt.
Nein, vorläufig nur über Jansens Denkschrift, die unterdessen in England eingetroffen und in der Öffentlichkeit bekannt geworden war.
Und der Inhalt dieser Denk- oder Verteidigungsschrift genügte schon, um ganz England in Atem zu halten. Die Zeitungen sprachen kaum noch von etwas anderem, und schade nur, dass die Wirtshäuser in England um eins schließen müssen. Dann aber ging die Disputation auf der Straße weiter.
Also Richard Jansen, der Seeräuber, wie er nun einmal hieß, hatte in der Denkschrift so ziemlich seinen ganzen Lebenslauf erzählt, alle seine Vergehen darin angeführt, und glaubte, hiermit bewiesen zu haben, dass er kein Seeräuber sei, überhaupt kein Verbrechen begangen habe, und was für Schaden er sonst angerichtet, das könne doch alles mit Geld gutgemacht werden.
Man müsse sich nur auf den Standpunkt stellen, keinen Privatmann, keinen Handelskapitän vor sich zu haben, sondern man müsse ihn als anerkannt gewesenen Feind Englands betrachten, mit dem man im offenen Kampfe gelegen, dann könne ihm gegen eine gewisse Entschädigung auch alles verziehen werden.
So erbot sich Jansen, die beiden von ihm vernichteten englischen Kriegsschiffe — durch Zufall vernichtet, wie er genügend bewies — voll und ganz zu ersetzen. Ebenso wolle er alle Hinterlassenen der dabei getöteten Mannschaften zufrieden stellen. Oder viel einfacher wäre, wenn er gleich sein Geheimnis preisgäbe. Es sei doch bekannt, dass er im Chinesischen Meere eine höchst ertragreiche Perlenbank wisse. Er wolle also deren Lage angeben, mit China würde sich England wohl leicht darüber verständigen können, und wenn seine Angaben auf Wahrheit beruhten, so verlange er für sich und seine ganze Mannschaft vollkommene Amnestie. Außerdem hoffe er, dann mit seiner Mannschaft in englische Dienste treten zu können...
Ach, wenn Jansen geahnt hätte, wie gut die Sache für ihn stand! Damals!
»Na, selbstverständlich, das ist der tüchtigste Kerl, der je unter der englischen Flagge gefahren ist, der muss das Kommando über ein Kriegsschiff bekommen!«
Das war die Stimme des großen Volkes, und die wenigen, welche anders dachten, bekamen Prügel.
Merkwürdig war dabei, dass man allgemein annahm, Jansen habe es auf einen Dienst in der Kriegsmarine abgesehen. Hier hatte er sich offenbar nicht deutlich genug ausgedrückt.
Die Zeitungen waren in ihrem Urteil etwas gespaltener. Diejenigen, welche für die Regierung arbeiteten und in den höheren Kreisen gelesen wurden, verlangten eine ganz unparteiische Untersuchung und Aburteilung, während die vom Volke gelesenen, und das waren die meisten, natürlich auch die Stimmung des breiten Volkes teilen mussten.
Diese letzteren Zeitungen bedienten sich überdies eines eigentümlichen Mittels, um noch mehr für den jetzigen Seeräuber und zukünftigen Kriegsschiffskommandanten Propaganda zu machen. Die ›Daily Chronicle‹ war es, die zuerst darauf hinwies, dass dieser Kapitän Richard Jansen doch eigentlich ein Engländer sei. Das wurde mit unglaublichem Raffinement nachgewiesen, indem Jansens Ahnenreihe bis hinauf fast zum Affen — oder sagen wir Adam — verfolgt wurde, und es war ja auch möglich, dass Jansens Ururururururur... ururgroßmutter aus England stammte — und danach war nach englischen Ansichten dieser Ururururur... urururenkel selbst ein Engländer.
»Und dieser Engländer muss uns als der tüchtigste Seemann, der je die Meere befahren hat, welche sämtlich England gehören, unbedingt erhalten bleiben!«
Auch im Parlament ward der Fall eifrigst besprochen. Hier waren die Ansichten allerdings noch geteilter.
»Recht muss unbedingt Recht bleiben«, lautete dann die allgemein angenommene Resolution. »Kapitän Jansen muss vor ein unparteiisches Gericht, muss unparteiisch abgeurteilt werden, wie Old England es von je gehalten hat. Von dem Angebot mit der Perlenbank dürfen wir uns auf keinen Fall beeinflussen lassen, wie Old England noch nie, nie einer Bestechung zugänglich gewesen ist. Ist er des Todes schuldig, dann muss er hängen; kann er seine Taten schon mit Zuchthaus sühnen, dann kommt er in die Tretmühle; wird er schuldlos gesprochen, dann ist er eben schuldlos. Aber von der Perlenbank dürfen wir uns nimmermehr beeinflussen lassen, so etwas hat Old England noch nie getan. Hip hip hip hurra für Old England. God save the Queen!«
Der Leser versteht. Es war eben Old England, welches im Parlament solch kernige Worte sprach, jenes England, welches aus Schwarz nicht nur Weiß, sondern nach Belieben Blau, Grün, Rot, Ultraviolett und alle anderen Farben des Regenbogens zu machen verstanden hat.
Jedenfalls standen Jansens Aktien famos. Hausse, Hausse, und immer Hausse! Ach, wenn er es nur geahnt hätte!
Doch die Hauptsache nun, die schon bei den Nürnbergern galt, war, dass der Seeräuber auch wirklich kam, um sich zum Verhör zu stellen.
»Hat Kapitän Richard Jansen schon jemals sein Wort gebrochen?«, wurde stolz gefragt.
Es hatte eigentlich niemand eine Berechtigung, durch Tatsachen verbürgt, so auf Jansens Wort zu bauen, aber... es war nun einmal so.
»Nur der Tod kann ihn abhalten, hierher zu kommen — oder lebenslängliche Gefangenschaft bei marokkanischen Piraten.«
»Was können denn marokkanische Piraten einem Richard Jansen anhaben?«, wurde dem gegenüber geringschätzend geantwortet.
»Aber er kann den Tod gefunden haben.«
»Nein, auch der kann ihm nichts anhaben, er hat ja den Klabautermann an Bord.«
»Na, dann muss er auch kommen.«
Und man wartete. Wenn man nur gewusst hätte, welchen englischen Hafen er mit der ›Sturmbraut‹ anlaufen würde. Jansen hatte ganz allgemein von England gesprochen, also auch nichts von Dover, das er im Auge gehabt, erwähnt.
Aber sicher würde er doch London bevorzugen.
Also man wartete ganz besonders in London mit geradezu fieberhafter Ungeduld.
So vergingen vierzehn Tage, und keine andere Sensation, wie sie das große London noch mehr haben muss, als jede andere Großstadt, konnte diese fieberhafte Spannung auf das Erscheinen der ›Sturmbraut‹ vermindern.
Da lief auf dem Telegrafendrahte der Blitz durch ganz England.
»Die ›Sturmbraut‹ ist gescheitert. Kapitän Jansen mit seiner ganzen Mannschaft von dem ›Duke of Westmoreland‹ aufgefischt, welcher schon in Portsmouth mit den Gefangenen eingetroffen ist.«
Erst wollte man es gar nicht glauben. Und dann war mit einem Male die Stimmung für den schon zum Volkshelden gewordenen Seeräuber völlig umgeschlagen.
Die Gründe hierfür sind schwer zu definieren. Sie können nur angedeutet werden.
Einmal hätte sich ein Kapitän Richard Jansen mit seiner ganzen Mannschaft überhaupt nicht fangen lassen dürfen. Das setzte ihn in der Volksgunst sofort herab.
Und dann ist es eben ein großer Unterschied — in jedem Falle! — ob jemand sich freiwillig einem richterlichen Verhöre stellt, oder ob er dazu in Ketten herbeigeschleppt wird.
Aber nachlassen konnte die Sensation deshalb nicht. Von London mussten nach Portsmouth Extrazüge abgehen, und dann stand das Volk am Kai und konnte die mitten im Hafen liegende Korvette, deren Planken die zweiundvierzig Seeräuber bargen, anstarren.
Der Prozess begann, und das englische Volk erlebte auch hierbei etwas Außerordentliches.
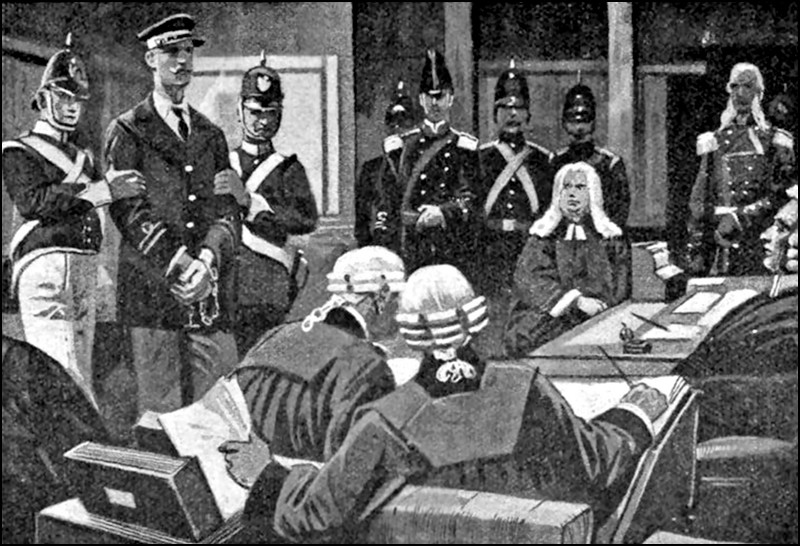
Ob dieser Prozess gegen die gefangenen Seeräuber in London oder hier in Portsmouth, das mit allen richterlichen Machtmitteln ausgestattet ist, zu führen sei, hätte erst entschieden werden müssen. Aber nicht einmal zu dieser Wahl sollte es kommen.
Wie schon erwähnt, kann jedes Kriegsschiff auf frischer Tat erwischte Seeräuber sofort aufhängen. Nur um ein abschreckendes Beispiel zu demonstrieren, werden sie gewöhnlich erst nach dem nächsten Hafen gebracht, und dort werden für sie Galgen erbaut.
Ein englisches Kriegsschiff hingegen dürfte dies letztere eigentlich nicht tun. Denn nach einem uralten englischen Gesetz sollen Seeräuber gar nicht wieder das Land betreten, nach einer frommen Ansicht, Gottes schöner Erdboden würde von ihren Füßen besudelt; wenn nach dem Hafen gebracht, so sollen sie doch auf dem Schiffe selbst vom Leben zum Tode befördert werden, auch eine Gerichtssitzung soll, wenn eine solche nötig, auf dem Schiffe selbst stattfinden, und zwar soll der Kapitän, der die Seeräuber gefangen, der Vorsitzende der Verhandlung sein.
Dieses alte Gesetz war hervorgekramt worden, man wollte es einmal zur Anwendung bringen. Oder fürchtete man sich, die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ hinter Kerkermauern zu bringen, wozu doch erst ein kurzer Transport nötig war? Glaubte man an Helfershelfer? Hielt man diese rabiaten Burschen an Bord eines Kriegsschiffes für am sichersten aufgehoben?
Wie dem auch sei, — die Gerichtsverhandlungen fanden an Bord der ›Westmoreland‹ statt, und um nun auch alles zu erfüllen, musste Kapitän Webb sogar den Vorsitzenden spielen, obgleich er gar nichts davon verstand, hatte ja auch allerdings wenig hineinzureden.
Die Voruntersuchungen begannen. Die nach altenglischem Brauch mit weißgepuderten Perücken geschmückten Richter begaben sich mit ihrem ganzen Stabe in Booten hinüber nach dem Kriegsschiff. Die Kajüte diente als Gerichtssaal.
Öffentlich mussten die Sitzungen unbedingt sein, aber viel Publikum konnte die Kajüte doch nicht fassen. So fanden nur wenige ›Geladene‹ Platz, darunter vor allen Dingen die Berichterstatter von Zeitungen, und die sorgten dafür, dass das englische Volk schnellstens alles erfuhr, was hier vor sich ging, was die Untersuchungsgefangenen aussagten, und da wurde kein Mienenspiel und keine Geste unberücksichtigt gelassen.
Kapitän Jansen und seine Mannschaft wurden vorgeführt, einer nach dem anderen, immer mit gefesselten Händen und unter militärischer Bewachung.
Wir wollen gleich sagen, dass diese Gerichtsverhandlungen länger denn ein Vierteljahr dauerten, und da kann man nicht verlangen, dass sie alle geschildert werden; keine einzige davon wollen wir herausgreifen.
Jansen hatte also nicht erfahren, was für eine Sympathie er anfänglich für sich gehabt; jetzt erkannte er nur, wie faul die Sache für ihn stand.
Er glaubte, in seiner Denk- oder Verteidigungsschrift ganz ausführlich gewesen zu sein, und, ach, was hatte er nicht alles vergessen! Was wurde da nicht alles noch ausgepackt!
»Kennen Sie einen Mister Ephraim Jonas?«
Nach längerem Überlegen verneinte Jansen.
»Entsinnen Sie sich nur, den Direktor der Antimonbergwerksgesellschaft zu Bantang auf Borneo?«
»Ach so, den — ja, den kenne ich!«
»Gestehen Sie, diesen Mann gefoltert zu haben?«
»Gefoltert nicht, sondern nur...«
»Sie haben ihm von einer Kuh die Fußsohlen lecken lassen.«
»Ja, das habe ich getan.«
»Ihm auf diese Weise ein Geständnis erpresst?«
»Ja.«
»Ist das eine Qual?«
»Ja.«
»Eine fürchterliche?«
»Gewiss, und der Mann hat es verdient, er war ein Schuft!«
»Eins nach dem anderen. Inwiefern ist das eine fürchterliche Qual?«
»Die Empfindung des Kitzelns.«
»Woher wissen Sie das?«
»Weil ich das an meinem eigenen Leibe probiert habe.«
»Bei welcher Gelegenheit?«
Nun musste Jansen, wollte er sich nicht in Ausflüchte verwickeln, erst sein ganzes Abenteuer auf Borneo zum besten geben.
Dann wurde von Land eine Kuh besorgt, die Prozedur des Fußleckens wurde an verschiedenen Personen vorgenommen, selbst Richter legten sich hin, und sie alle wollten unter Lachen sterben. Dies nahm schon viele Tage in Anspruch; wenn irgend etwas nicht zur Stelle war, wurde die Sitzung wieder auf einen anderen Tag verschoben, durchaus nicht gleich auf den nächsten, da kann man sich vorstellen, wie langsam das ging, und nachdem endlich die Kuh ihre Pflicht getan, alles zu Protokoll genommen worden war, wurde die Frage wiederholt.
»Gestehen Sie, diesen Mister Ephraim Jonas auf solch eine Weise gefoltert zu haben?«
»Ja.«
»Und hinterher haben Sie ihn auch noch furchtbar schlagen lassen?«
Es war gar nicht zu verwundern, wenn Jansen seine Richter auch noch reizte, indem er auf diese Frage erwiderte:
»Nicht mehr, als er verdiente.«
»Weshalb soll er die Prügel verdient haben?«
Ach, nun musste Jansen erst wieder hiervon anfangen, und alle seine Leute wurden zunächst einzeln verhört!
Wie sollte denn das nur noch enden?
Die Hauptsache aber war hierbei, dass er sich tatsächlich an einem englischen Untertanen vergriffen, ihn im Verfahren der Selbstjustiz sogar gefoltert hatte, und das brachte natürlich eine neue Anklage gegen ihn.
Während der Verhandlungen wusste der Untersuchungsrichter wiederholt auch geschickt die Frage nach jener Perlenbank einzuflechten.
»Gebt mich und meine Leute frei, und ich nenne euch ihre Lage!«
Davon konnte jetzt natürlich keine Rede mehr sein. Es war eben Jansens Verhängnis gewesen, dass er als Gefangener hergekommen war. Jetzt gab es keinen Vergleich, jetzt musste der Gerechtigkeit freier Lauf gelassen werden, oder vielmehr, der Schein der unparteiischen Gerechtigkeit musste nun unter allen Umständen gewahrt werden.
Nun aber hauptsächlich doch all das, was mit Jansens eigentlichem Seeräuberberuf zusammenhing! Und hier war wieder die Hauptsache der bewaffnete Widerstand gegen England auf jener afrikanischen Felseninsel, der mit der Vernichtung der beiden englischen Kriegsschiffe geendet hatte.
Und was nun sonst noch alles hinzukam! Die Geschichte auf den Südseeinseln, in dem hohlen Felsenberge, wo er doch ebenfalls ein englisches Kriegsschiff mit Beschießung bedroht hatte, usw. usw.
Diese Verhandlung würde ja gar kein Ende nehmen!
Und dann schließlich kam auch noch der Fall von Caballos hinzu, wo Jansen direkt zum Seeräuber geworden sein sollte.
Ging dieser Fall England auch direkt nichts an, so konnte hier doch ein überzeugender Indizienbeweis geführt werden, dass Jansen und seine Mannschaft wirklich offenkundige Seeräuberei betrieben hatten.
Hier aber zeigte sich etwas Merkwürdiges.
Jansen wies diesen Verdacht natürlich von sich, erzählte seine Begegnung mit Lord Leicester, wie er von diesem erst die Kunde von der Mordbrennerei bekommen, wie er dann dem Seeräuberschiffe, das seinen Namen missbraucht, den Garaus gemacht hatte.
Natürlich berief er sich hierbei auf die Mannschaft der ›Repentance‹ als Zeuge, musste dabei allerdings auch den so unglücklich verlaufenen Zweikampf angeben.
Wo aber war die ›Repentance‹?
»Die ist untergegangen.«
»Untergegangen?!«, rief Jansen in grenzenloser Bestürzung.
»In der Nähe der Balearen hat man Trümmer von ihr gefunden, sie ist zweifellos mit Mann und Maus untergegangen.«
Jansen zeigte für gewöhnlich eine große Fassung, hochaufgerichtet stand er mit gefesselten Händen vor den Richtern, beantwortete alle Fragen ruhig und sachgemäß.
Nur manchmal brach bei ihm der ganze verhaltene Jammer hervor, und so auch diesmal, als er den Untergang der ›Repentance‹ erfuhr.
»Untergegangen, auch dieses Schiff untergegangen!«, rief er verzweifelt. »Hat sich denn nur alles gegen mich verschworen?!!«
In diesem Falle aber irrte sich Jansen.
Das große Publikum war sofort der Überzeugung, dass ein Richard Jansen niemals zum gemeinen Mordbrenner geworden sein könne, dies drückten im Namen des Volkes alle Zeitungen aus.
Hiervon erfuhr Jansen allerdings nichts, da er ja nie eine Zeitung in die Hand bekam, dies konnte also keinen direkten Vorteil für ihn bedeuten.
Aber auch die Richter glaubten ihm auf sein Wort hin, dass er mit jenem Mordbrenner nicht identisch gewesen sei.
Doch was nützte ihm solches Vertrauen in einem einzigen Falle? Da waren noch hundert andere zu erledigen, wo alles gegen ihn sprach.
So war schon ein Vierteljahr vergangen, und das Ende dieses Prozesses war noch gar nicht abzusehen. Ein neues Jahr war angebrochen, und zwar mit einer bitteren Kälte, wie England sie sonst nur selten zu empfinden bekommt. Denn im nördlichen Amerika, das so schon immer unter Winterkälte zu leiden hat, war sie diesmal strenger denn je aufgetreten, und der Westwind brachte eine Kältewelle nach der anderen bis nach England, alles unter Schnee und Eis vergrabend.
Der Kriegshafen von Portsmouth selbst war noch eisfrei geblieben, während sich draußen an den Molen schon die Eisschollen auftürmten. Das bringt die warme Strömung mit sich, die ganze geschützte Lage.
Damals hatte Portsmouth noch eine andere Bedeutung als nur für die englische Kriegsflotte.
Noch heute vermittelt die Linie Dover und Calais nicht etwa den größten Passagierverkehr zwischen England und dem europäischen Kontinent. Das ist ein weitverbreiteter Irrtum. Die kürzeste Linie ist sie allerdings, führt die luxuriösesten Dampfer, aber benutzt werden andere Linien viel mehr, teils wegen der Billigkeit, teils ist die Eisenbahnverbindung dann eine bessere.
So kommen für Deutschland und Holland vor allen Dingen die Linien Vlissingen—Queensborough und Hoek van Holland—Harwich in Betracht, für Frankreich heutzutage Dieppe—Newhaven.
Dieppe war schon damals der Ausgangspunkt der von Frankreich nach England reisenden Passagiere, Newhaven hatte noch gar keine Eisenbahnverbindung mit London, dafür spielte das naheliegende Portsmouth die Rolle.
So zeigte Portsmouth damals auch noch ein ganz anderes, viel lebendigeres Bild als später. Denn der Passagier- und Expressgutverkehr zwischen Frankreich und England ist doch ein ganz beträchtlicher, mehrere Linien ließen ihre Schiffe täglich hin und her laufen.
Dies alles konnte Jansen aus seiner Untersuchungszelle beobachten. Man hatte ihm als solche eine sehr bequeme Kabine angewiesen, welche ganz vorn im Schiff lag, und deren Bullaugen nach drei verschiedenen Richtungen gingen.
Freilich mochte er wenig Zerstreuung durch Beobachten der ein- und auslaufenden Kriegs- und Passagierschiffe und was sonst solch ein Hafen alles bietet, finden, allein es war schon genug, dass er drei offene Fenster hatte, die frische Seeluft einatmen konnte, denn in einer regelrechten Gefängniszelle hätte ein Richard Jansen es wohl schwerlich drei Monate aushalten können, da wäre er schon längst ein gebrochener Mann gewesen.
Auch sonst durfte sich Jansen als Untersuchungsgefangener über nichts beklagen. Die Kabine war komfortabel ausgestattet, Dampfheizung, das Essen kam aus der Kajüte.
Diese Fürsorglichkeit war sicher nur dem Umstande zu verdanken, dass der Kommandant des Schiffes zugleich der Vorsitzende des ganzen Verfahrens war, der über alles zu bestimmen hatte, und dass dieser Kapitän Webb eben ein so vortrefflicher Mensch war, der für den Seeräuberkapitän geradezu Sympathie zu hegen schien. Direkt sprach er dies freilich nicht aus, dagegen ließ er es durch Handlungen um so deutlicher merken, und was sind Worte gegen Taten!
Mit auf dem Rücken geschlossenen Händen war Jansen hier eingeliefert worden — als er die erste Mahlzeit erhielt, waren sie ihm vorn zusammengekettet worden, so hatte er essen müssen.
Gleich darauf war der Kommandant zu ihm eingetreten, von zwei bewaffneten Matrosen begleitet.
»Schmeckt es Ihnen?«
»Ich danke.«
»Können Sie so mit gebundenen Händen essen?«
»Es muss gehen.«
»Wenn Sie sich irgendwie obstinat zeigen, werden Sie noch völlig an die Wand geschlossen, müssen auch so schlafen.«
In strengstem Tone mit strengster Miene hatte der Mann es gesagt, den wir eben einen so vortrefflichen Menschen genannt haben.
Aber man kann doch auch nicht erwarten, dass solch ein Kapitän ein freundlich lächelnder Süßholzraspler ist, zumal einem ihm anvertrauten Mordbrenner gegenüber.
Und Jansen war Menschenkenner genug, um diesen Mann nicht nach seinen Worten zu beurteilen, die ihm die Pflicht gebot. Jansen selbst war ja genau solch ein Charakter.
»Ich denke nicht an Widerstand.«
»Nicht? Dann kann ich Ihnen auch die Hände freigeben.«
Jansen konnte nur mit einem dankenden Blicke antworten.
Aber so schnell ging das doch nicht, es sollte ein Haken dabei sein.
»Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie keinen Fluchtversuch unternehmen wollen?«
Da verwandelte sich der dankende Blick in einen schmerzlichen. Doch zunächst hatte Jansen noch einen anderen Gedanken.
»Sie würden meinem Ehrenworte trauen?«
»Ja.«
»Mir, dem blutigen Piraten und Mordbrenner?«
»Sie sind nur dessen angeklagt, Ihre Schuld muss erst noch bewiesen werden.«
»Sie halten mich für schuldlos?«
»Das gehört nicht hierher. Ich frage Sie, ob Sie mir Ihr Ehrenwort geben wollen, keinen Fluchtversuch zu machen.«
»Nein, daraufhin gebe ich mein Ehrenwort nicht.«
»Sie planen eine Flucht?«
»Selbstverständlich.«
»Auch über Menschenleben hinweg?«
»Wenn es sein muss — ja.«
»Nach dieser offenen Erklärung halte ich mich für berechtigt, Ihnen dennoch die Fesseln abzunehmen. So spricht kein hinterlistiger Schurke.«
Sprach's und löste Jansen die Hände.
Ja, hier standen sich zwei wirkliche Männer gegenüber!
»Lassen Sie Ihre Fluchtgedanken lieber sein«, sagte Kapitän Webb noch, ehe er die Kabine verließ. »Eine Befreiung von Ihrer oder anderer Seite aus ist unmöglich gemacht, wird niemals gelingen.«
So war Jansen wenigstens fessellos. Nur wenn er vor die Richter geführt wurde, mussten sie ihm wieder angelegt werden. Er war eben der verwegene Seeräuber, dem man alles zutraute.
Kapitän Webb kam täglich zu ihm, untersuchte die Kabine auf's genaueste, selbst die Taschen des Gefangenen, einmal musste sich Jansen, weil man vermutete, dass Steuermann Martin aus seiner Zelle ein Zettelchen an den Kapitän herausgeschmuggelt habe, sogar nackt ausziehen und sich den Mund ausspülen, ebenso versagte ihm der Kommandant Zeitungen und Bücher, weil diese zu gute Mittel sind, um Briefschaften zu befördern, und Jansen zweifelte nicht, dass Webb in einem solchen Falle mit aller Strenge gegen ihn vorgegangen sein würde, während er sich doch andererseits wahrhaft freundschaftlich gegen ihn benahm.
Manche Stunde verbrachte er bei ihm, erzählte ihm, was das Publikum über diesen Prozess sage, beruhigte ihn über den Verbleib seiner mitgefangenen Leute, die ebenso gut behandelt würden, beantwortete alle Fragen — aber nur so weit, wie es dem Untersuchungsgefangenen gegenüber zulässig war.
Kurz, zwischen den beiden entwickelte sich eine Freundschaft, und dennoch blieb das strenge, unnahbare Verhältnis zwischen einem pflichtgetreuen Aufseher und einem Untersuchungsgefangenen immer bestehen.
Die über jeden Zweifel erhabene Lauterkeit dieses Mannes ward auch noch in anderer Weise sichtbar.
Außer von dem eigentlichen Aufseher, der ihm das Essen brachte, die Kabine reinigte usw., stets unter dem Schutze zweier bewaffneter Matrosen, empfing Jansen noch regelmäßigen Besuch von seinem Verteidiger und einem Geistlichen.
Dass diese beiden freundlich gegen den Untersuchungsgefangenen waren, ist begreiflich. Der Rechtsanwalt hoffte einen glänzenden Sieg davonzutragen, wenn er nur die voraussichtliche Todesstrafe in lebenslängliches Zuchthaus umwandelte, und der Geistliche wollte durch Retten einer sündigen Seele seiner himmlischen Krone eine neue Perle einverleiben.
Aber die beiden waren manchmal doch gar zu freundlich, und Jansen hatte gar bald heraus, was sie wollten: ihm das Geheimnis seiner Perlenbank entlocken!
Der Advokat versprach ihm dafür, wenn nicht völlige Freiheit, so doch die größten Milderungsgründe, der Schwarzrock bot ihm dafür die ewige Seligkeit mit einem reservierten Sitz im Himmel an, und auch sonst verschmähten die beiden kein Mittel, um den Perlenbankwisser gesprächig zu machen.
Nur zu Prügel und zu sinnverwirrenden Mitteln, wozu ja auch der Alkohol zu rechnen ist, den man durch gewisse Mittel noch wirksamer machen kann, hatten sie sich noch nicht verstiegen, dafür sorgte eben Kapitän Webb, welcher selbst die Perlenbank mit keinem einzigen Worte berührte, und das eben war es, was Jansen so hoch anerkannte.
»Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen«, sagte Kapitän Webb eines Tages, nachdem er die Zellenuntersuchung beendet hatte. »Ob sie Ihnen aber Freude bereiten wird, weiß ich nicht.«
»So unterlassen Sie sie lieber ganz.«
»Wollen Sie nichts über Ihre ›Sturmbraut‹ hören?«
»Meine ›Sturmbraut‹?!«, schnellte Jansen wie von einer Tarantel gestochen empor. »Sie ist doch nicht etwa... als Wrack gefunden, wieder gehoben worden?!«
Schon das verriet, wie recht Kapitän Webb gehabt, zu vermuten, dass Jansen nämlich seine ›Sturmbraut‹ lieber als für die Welt verschollen betrachtet hätte.
»So ist es. Ich kann es Ihnen gar nicht verschweigen, denn Sie werden wahrscheinlich Ihr Schiff selbst betreten, es mindestens hier sehen müssen, denn es wird hierher geschleppt.«
»Hierher geschleppt?«, wiederholte Jansen außer sich. »Meine ›Sturmbraut‹?«
Es griff ihn so an, dass er das Gesicht in den Händen barg. Doch nach einigen Sekunden hatte er sich wieder beherrscht.
»Wie kam das? Bitte, erzählen Sie!«
»Es ist schon zwei Monate her, da sichtete ein französischer Dampfer in der Nähe der OmaloRiffe die Toppen eines gesunkenen Dreimasters. Kapitän Mercier, der sein eigenes Schiff fährt, besitzt die Mittel, um das Wrack auf eigene Kosten untersuchen und, als es sich noch brauchbar erwies, heben zu lassen.
Sofort wurde erkannt, dass es die gesunkene ›Sturmbraut‹ sei. Ich selbst hatte ja schon gesagt, dass Sie wohl nur bei den OmaloRiffen gescheitert sein könnten.
Nun beging Kapitän Mercier eine Ungehörigkeit, für die er zur Verantwortung gezogen wird, wenn er sich nicht besser zu entschuldigen weiß, als er bisher getan.
Er hätte das Seeräuberschiff, wie es nun einmal hieß, an die Seebehörde ausliefern, mindestens den Fund doch sofort anzeigen müssen. Statt dessen bestach der sehr vermögende Mann seine Besatzung und die des Taucherschiffes, verpflichtete sie zur Verschwiegenheit. Er wollte dieses Schiff eben für sich behalten, vielleicht nur als Rarität. Es war eine Dummheit von dem Manne, schließlich hätte ihm das Schiff als herrenloses Gut ja doch zugesprochen werden müssen, nachdem es in den Bereich Ihres Prozesses gezogen worden war, dort seine Pflicht getan hatte.
Das tat Mercier eben nicht, er unterschlug dieses Corpus Delicti, schleppte das Wrack nach Nantes, ließ es dort im Dock reparieren.
Aber die Sache wurde doch bald ruchbar, England hat Ihr Schiff requiriert, jetzt befindet es sich auf dem Transporte nach — — da, da ist es ja schon!!«
Ja, da kam sie, die ›Sturmbraut‹, stolz wie immer, nicht als hilfloses Wrack geschleppt werdend, sondern unter eigenem Dampf, steuerte direkt in den Hafen ein.
Jansen hatte innerhalb seiner Kabine noch nie einen Gefühlsausbruch gezeigt, den ganzen Tag schritt er auf und ab, und auch in der Nacht hätte ihn jemand beobachten können, er würde nur einen friedlichen Schläfer gesehen haben.
Beim Anblick seines stolzen Schiffes aber brach mit einem Male alles hervor, was er bisher zurückgedrängt hatte.
»Meine ›Sturmbraut‹, ach, meine ›Sturmbraut‹, meine ›Sturmbraut‹!!«, jammerte er mit hervorstürzenden Tränen, sehnsüchtig die Arme nach jener Richtung ausbreitend, und immer wieder hatte er nichts als diese zwei Worte, bis der riesenhafte Mann sich auf die Knie warf und sein Gesicht weinend und schluchzend in den Polstern des Diwans vergrub.
Kapitän Webb hatte die Kabine schon längst verlassen — er konnte diesen hünenhaften Mann nicht wie ein kleines Kind weinen sehen, er selbst weinte blutige Tränen.
Zuletzt war es doch schneller gegangen, als man geglaubt. Richard Jansen und die achtzehn Mann, die unter ihm gedient, waren der Piraterie in wiederholtem Falle für schuldig und zum Tode verurteilt worden.
Es handelte sich also nur um jene, welche damals in London für die ›Sturmbraut‹ gemustert hatten, wozu dann als einziger noch der Steuermann Martin gekommen war.
Das Verfahren gegen Karlemanns halbwüchsige Gesellen schwebte noch, diese würden wahrscheinlich, wenn Deutschland ihre Wiederaufnahme verweigerte, in eine Zwangserziehungsanstalt kommen, ferner kamen noch der Maler van Zyl und Madam Hullogan in Betracht, deren Anteilnahme an der Piraterie erst noch näher bewiesen werden musste. Jedenfalls wurden diese erst später abgeurteilt und würden natürlich viel glimpflicher wegkommen.
Morgen würde die Hinrichtung stattfinden. Auch hierbei sollte jenes alte Gesetz oder Brauch wirksam bleiben. Nicht an Land, sondern ebenfalls an Bord dieses Kriegsschiffes wurden die neunzehn Delinquenten gleichzeitig an den Rahen emporgezogen, die Schlinge um den Hals. Also auch ein den Tod erleichterndes Fallbrett gab es für die Piraten nicht. Doch so etwas kennt ja auch kein Selbstmörder, und der Tod des Hängens soll überhaupt kein schmerzvoller sein.
Als der Richtspruch verkündet wurde, hatte sich die ganze Mannschaft der ›Sturmbraut‹ zum ersten Male wieder zusammen gesehen. Auch die anderen, Karlemanns Jungen, hatten diesem feierlichen Akt beiwohnen müssen, wie wahrscheinlich auch morgen der Hinrichtung. Denn mit Seeräubern hat man von jeher eine Ausnahme gemacht, noch immer sind sie öffentlich gehenkt worden, und so sollte es auch morgen sein, wieder würden morgen oder schon während der ganzen Nacht aus allen Teilen Englands Extrazüge eintreffen, schaulustiges Publikum bringend, ebenso aber würden vom europäischen Kontinent herüber Extrafahrten per Dampfer veranstaltet.
Die Plötzlichkeit des Urteils war jedenfalls mit Absicht geschehen, eben um den übermäßigen Andrang des Publikums zu vermeiden. Nur das gegenüberliegende Frankreich, Holland und Belgien konnten noch Zeit haben, rechtzeitig Passagiere dazu herüberzubefördern.
Also die neunzehn Todeskandidaten hatten ihr Urteil mit der größten Gleichgültigkeit hingenommen. Sie sahen alle etwas mager und bleich aus, aber das machte nur die lange Gefangenschaft im engen Raume. Sie hatten an solch ein Schicksal schon früher zu oft gedacht, als dass es für diese Männer, welche dem Tode schon in jeglicher Gestalt ins Auge geschaut, jetzt noch etwas Schreckhaftes gehabt hätte.
Sie nickten nach der langen Trennung einander freundlich oder bedeutungsvoll zu, nichts weiter. Dass die ›Sturmbraut‹ wieder gehoben worden war und hier im Hafen lag, hatten sie alle erfahren. Aber auf sie gekommen, wie ein Verbrecher gewöhnlich noch einmal an den Ort seiner Tat geführt wird, war keiner.
Nur Madame Hullogan fing nach Verkündung des Urteils wieder in unglaublicher Weise zu schimpfen an und musste deshalb abgeführt werden, nachdem ihr drei Tage bei Wasser und Brot zudiktiert worden, wohl nicht zum ersten Male während ihrer Untersuchungshaft.
Dann wurden auch die Verurteilten zurückgeführt in ihre Einzelhaft, um die letzte Nacht zu verbringen.
»Na, da adjüs, morgen zum letzten Male auf ein Wiedersehen!«, konnten sie beim Weggange noch einige Worte wechseln.
»Hauptsache ist, dass wir nicht auf dem Meeresgrunde und auch nicht in Kellern und Speisekammern zu spuken brauchen.«
»Morgen früh?«, fragte Enoch noch einmal seinen zufälligen Nachbar.
»Ja, morgen in aller Frühe segeln wir hinüber.«
»Un morgen givvt's grad Erven und Swiensfleesch, wat ick so gern fräten dau.«
»O, Jungens, heute Abend werden wir erst noch nach unserem letzten Wunsch gefragt.«
»Und der wird erfüllt?«
»Ganz sicher!«
»Dann wünsch ick mir ein Leben von hundert Jahr und en Großvaterstuhl un en lange Piep«, meinte ein Schlauer.
»Nein, so was gibt's nicht!«, wurde ganz sorglos gelacht. »Nur was für eine Nacht.«
»Dann möcht ick nochmal an Land und tanzen.«
»Wir werden nur gefragt, was wir gern essen und trinken wollen.«
»Na, denn frät ick hüt noch mal Erven mit Swiensfleesch, avver ne ganz bannige Portion«, ließ sich Enoch wieder vernehmen.
»Ich glaube, du kannst die Nacht auch noch mit deiner Frau verbringen.«
»Mit deee? Nee, dann segle ick läver glicks in de Höll!«
Dann waren sie getrennt.
Die Nacht brach an, eine fürchterliche Nacht! Das Wasser in dem so überaus geschützt liegenden Hafen von Portsmouth blieb ziemlich ruhig, aber das Donnern des Meeres hörte man trotz der ziemlichen Entfernung deutlich. Und in der Luft ein unausgesetztes Heulen und Pfeifen.
Jansen hatte Licht bekommen, dann erschien der Geistliche, fragend, ob er noch einen besonderen Wunsch habe... nämlich für seine Henkersmahlzeit.
Jansen wollte von nichts wissen. Aber der Schwarzrock ließ sich nicht so schnell abweisen, erzählte von Beefsteaks und Koteletts und anderen Gerichten, führte Delikatessen im Einzelnen an.
Es war eine ganz schlaue Berechnung, dass der Geistliche den aufwartenden Kellner selbst machte. Anderenfalls wäre er sicher gekommen, wenn der Todeskandidat gerade beim Essen saß. Denn bei oder nach einer guten Mahlzeit ist der Mensch eben ein ganz anderer, selbst noch kurz vor seinem Tode, da lässt sich eine Seele viel leichter retten... und auch von ihr herausbekommen, wo sie eine Perlenbank weiß, und an darauf bezüglichen Anspielungen ließ es der Schwarzrock denn auch nicht fehlen.
Aber Jansen wies ihn kurzerhand ab.
»Lassen Sie mich zufrieden, von mir erfahren Sie nichts. Und auch wegen meiner Seligkeit brauchen Sie sich keine Mühe zu geben, das kann ich alles allein machen; denn wenn ich gewollt hätte, so wäre ich jetzt schon selbst Pastor.«
Ob solcher Gottlosigkeit schlug der Schwarzrock die Hände über dem Kopfe zusammen — und ging.
So erhielt Jansen nur ein einfaches Nachtessen, nach dem er wie gewöhnlich noch eine Stunde in der engen Kabine auf und ab schritt, manchmal stehen bleibend, um dem Heulen des Sturmes zu lauschen.
»Das ist ja ein fürchterliches Unwetter!«
Was gehen einen Menschen, den nur zehn Stunden von seinem Tode trennen, noch die irdischen Elemente an?
Aber auch noch andere leise Worte fand der Todeskandidat.
»Wo bleibt Tischkoff, um seine Prophezeiung wahr zu machen, dass ich in einem hohen Alter eines friedlichen Todes sterben soll? Ach, ich habe gar keine Sehnsucht danach, es ist mir lieber, dass es morgen mit mir zu Ende geht, und den Würmern ist es gleich, ob man mich hängt oder wie ich sonst meinen Tod finde! Mit meinen Jungen zusammen sterben zu können, das ist auch etwas wert!«
Nach diesen Worten darf man glauben, dass sich Jansen ruhig zur Koje legte und bald einschlief. Auf den nochmaligen Besuch seines gestrengen Freundes, des Kommandanten, hatte er vergebens gehofft.
Doch was sollte der auch noch? Er konnte ihm ja doch nicht helfen, und Jansen hatte beobachtet, wie furchtbar diesen ihm doch eigentlich ganz fremden Mann seine Verurteilung zum Tode angriff. — — —
Es war erst zehn Uhr. Jansen war sehr früh schlafen gegangen.
In der kleineren Kajüte, die zum Gerichtsbüro eingerichtet worden, saß Kapitän Webb und blätterte im Scheine der Lampe in dicken Akten, dabei aber fast aller Minuten nach der Uhr sehend, oftmals hastig aufspringend und einen Gang durch den Raum machend.
Sollte sich Jansen nicht geirrt haben, wenn er glaubte, sein Todesurteil hätte diesen Mann furchtbar ergriffen?
Kein anderer Mensch hatte etwas davon bemerkt. Auch dass er so oft den Untersuchungsgefangenen besucht, manche Stunde bei ihm verbracht, immer freundlich mit ihm gesprochen hatte, war für die anwesenden Matrosen ganz selbstverständlich gewesen.
Kapitän Webb war das Ideal eines Offiziers. Von unnachsichtlicher Strenge, wusste er doch jeden seiner Untergebenen ohne Ausnahme an sich zu fesseln, sodass sogar der, den er wegen eines Vergehens hart bestraft hatte, für ihn jederzeit durchs Feuer gegangen wäre. Worin dieses Geheimnis lag, lässt sich nicht definieren. Aber vielleicht hat mancher, der Soldat gewesen ist, einen ebensolchen Vorgesetzten gehabt, zu dem er trotz aller Strenge in fast abgöttischer Verehrung aufgeblickt hat.
Gerechtigkeit ist vor allen Dingen das Zaubermittel, Strenge, wenn sie angebracht ist, und dann wieder Leutseligkeit und Milde, Kameradschaftlichkeit auch gegen den geringsten Soldaten, ohne sich etwas zu vergeben, und dann hauptsächlich muss man sehen, dass der Vorgesetzte diese unnachsichtliche Strenge auch gegen sich selbst übt.
Kapitän Webb war ein eiserner Charakter. Über alles die Pflicht! Als das Todesurteil über Jansen und seine Leute gesprochen worden war, hatte er mit keiner Wimper gezuckt. Warum auch? Es waren gerechte Geschworene und Richter gewesen, die es gesprochen.
Wie wäre nun jeder erstaunt gewesen, wenn er beobachtet hätte, dass dieser eiserne Mann, sonst erhaben über jede Regung, hier in der einsamen Kajüte offenbar die größte Nervosität zeigte!
Immer wieder nach der Uhr gesehen, immer wieder aufgesprungen und hin und her gewandert.
»Schon zehn Uhr! Jetzt müssten sie bereits hier sein. O Gott, o Gott, was ich aufs Spiel setze — meine Frau — meinen Sohn — und wenn es missglückt!!«
Da schrak dieser eiserne Mann zusammen, sein Fuß ward an die Stelle gebannt, er lauschte.
An Deck rannten Matrosen, offenbar war ein Boot gekommen. Taktmäßige Schritte — »Gewehr bei Fuß!!« — eine Frage nach dem Kommandanten Kapitän zur See Webb, und in die Kajüte herein trat ein Offizier, ein Colonel der königlichen Leibgarde, was auch noch am Mantel zu erkennen war, über dem er noch die Schärpe eines Adjutanten trug.
Erstaunt betrachtete Kapitän Webb den im Range höheren Offizier, einen noch ziemlich jungen Mann, an dessen Schnurrbarte Eiszapfen hingen, die aber in dem warmen Raume schnell wegtauten.
»Kapitän zur See Edgar Webb?«
»Ich bin es.«
»Kommandant des ›Duke of Westmoreland‹?«
»Ja.«
»Sir Fitzley, Colonel im ersten Leibgarderegiment zu Fuß, Adjutant Ihrer Majestät der Königin. Zufolge geheimer Kabinettsorder habe ich den Kapitän Richard Jansen abzuholen.«
Jetzt war des Schiffskommandanten Überraschung erst recht angebracht.
»Sie wollen den Kapitän Richard Jansen abholen?!«
»Ja.«
»Wohin denn?«
»Ihn sofort nach Windsor bringen.«
»Zu Ihrer Majestät doch nicht? Wozu denn?«
»Herr Kamerad, bitte, stellen Sie nicht solche Fragen! Ich habe nur zu gehorchen. Hier meine Order, auch für Sie geltend.«
Der Colonel brachte ein Papier zum Vorschein, an dem ein großes Siegel hing, Webb nahm und las es, schüttelte immer mehr den Kopf.
»Dieser Jansen ist zum Tode verurteilt.«
»Das ist bekannt.«
»Morgen früh findet die Hinrichtung statt.«
»Sie wird wohl eben nicht stattfinden.«
»Und wie soll ich Ihnen diesen Jansen ausliefern?«
»Wie hier befohlen ist.«
»Das kann ich ja gar nicht so ohne Weiteres!«
»Warum denn nicht?«
»Ich bin Vorsitzender in...«
»Sie sind vor allen Dingen Offizier, Soldat, Ihr höchster Vorgesetzter ist Ihre Majestät.«
Der Colonel hatte recht. Eine richterliche Person hätte sich selbst dem Befehle der Königin widersetzen können, aber ein Offizier hatte einfach zu gehorchen, und nun hatte Kapitän Webb als Vorsitzender des hier stationierten Gerichtshofes gleichzeitig auch noch die höchste juristische Macht, er konnte den schon zum Tode Verurteilten sofort ausliefern, ohne erst einen anderen zu Rate zu ziehen, und als Offizier war er eben jetzt dazu gezwungen.
»Ja, die Order stimmt. Sofort?«
»Sofort, am Kai hält schon unser Wagen.«
»Bitte, folgen Sie mir!«
Durch eine Nebentür der Kajüte traten sie in einen Korridor, durchschritten ihn bis ans Ende, wo zwei Matrosen mit gezogenen Entersäbeln Wache hielten.
Der eine schloss auf, der andere nahm eine Laterne, alle vier betraten Jansens Kabine.
Jansen schlief erst seit einer Stunde, das Licht der Laterne weckte ihn. Er sah außer den bekannten Gestalten einen fremden Offizier.
»Kommt man schon, um mich zu holen?«, fragte er erst in schläfrigem Tone.
Dann hatte er sich schnell ermuntert, sprang mit gleichen Füßen aus der Koje.
»Well, ich bin bereit.«
Der fremde Offizier war vor dem so schnell aus der Koje Springenden etwas erschrocken zurückgefahren. Es war eben der Seeräuberkapitän Richard Jansen.
»Der ist ja gar nicht gefesselt!!«
»Nein, nicht in seiner Zelle, er wird sofort wieder gefesselt. Jansen, Sie werden abgeholt.«
»Ich — abgeholt?«, wiederholte Jansen ungläubig. »Wohin?«
»Das werden Sie erfahren. Kleiden Sie sich an!«
Jansen gehorchte, ohne eine weitere Frage zu stellen, und während er sich anzog, entfernte sich der Colonel noch einmal und kehrte mit vier Soldaten zurück, in Mäntel gehüllt, ebenfalls reichlich mit Eiszapfen behangen, an den Gewehren die Bajonette aufgepflanzt.
Darauf wurde Jansen wieder gefesselt, ihm ein Mantel umgehängt, der Colonel unterzeichnete einen von Kapitän Webb ausgestellten Schein, dass er den Gefangenen richtig erhalten habe, es ging an Deck und ins Boot, welches, von vier Matrosen gerudert und einem fünften Manne gesteuert, dem nahen Kai zustrebte.
Auf diesem stand schon ein zweispänniger Wagen. Ob es ein Mietwagen war oder ob er irgendein Abzeichen trug, konnte Jansen in der Finsternis, welche nur durch einige weit auseinanderstehende Gaslaternen erhellt wurde, die zudem in dem herrschenden Sturm jeden Augenblick zu verlöschen drohten, nicht erkennen.
Jansen musste einsteigen, neben ihn setzte sich je ein Soldat, das Gewehr zwischen den Knien, ihm gegenüber nahm der Colonel Platz, die Pferde zogen an.
Da die anderen beiden Soldaten doch wohl nicht zurückblieben, waren sie wahrscheinlich zum Kutscher auf den Bock gestiegen.
Das Innere des Wagens war durch eine besonders angebrachte Lampe etwas erleuchtet.
Jansen fragte nicht mehr. Er hatte schon vorhin eine barsche Antwort erhalten; diese Frage nach dem Wohin hatte er auch nur in der Schlaftrunkenheit gestellt, denn er selbst war ja gerade der Mann, der solche zwecklose Fragen immer lächerlich gefunden hatte.
Aber in welcher Spannung er sich befand, lässt sich denken. Was konnte das sein, dass er, der in wenigen Stunden gehenkt werden sollte, von einem hohen Infanterieoffizier abgeholt wurde?
»Herr Kapitän Richard Jansen«, hub da der Colonel an.
Diese Höflichkeit und Freundlichkeit der Anrede war es, die Jansen hoch aufhorchen ließ, fast schon von einer Ahnung erfüllt.
»Herr?«
»Ich habe gehört, dass Sie jede Kette zersprengen können.«
»Jede doch nicht, auch diese hier, die meine Hände zusammenhält, wohl schwerlich.«
»Versuchen Sie keine Selbstbefreiung.«
»Ich denke nicht daran — nur was man mit mir jetzt vorhat, wohin ich gebracht werde, möchte ich gern wissen.«
Die freundliche Ansprache berechtigte, ihn jetzt zu dieser Frage. Der Colonel wies sie nicht wieder barsch wie vorhin zurück, ging aber auch nicht darauf ein.
»Es würde Ihr eigener Schaden sein.«
»Das glaube ich.«
»Nicht etwa, dass diese Soldaten auf Sie schießen würden.«
»Nicht?!«, fuhr Jansen wiederum überrascht empor.
Es hatte schon im Tone gelegen, und wie Jansen seitwärts nach den Soldaten blickte, sah er in Gegenwart eines hohen Vorgesetzten ganz unmilitärisch lächelnde Gesichter.
Und da schon wurde bei Jansen die vorhin gehabte Ahnung zur Gewissheit!
»Sie wollen mich... befreien?«
»Sie sagen es.«
Das war zu viel für jeden, der sich schon im Geiste an einer Rahe hängen sieht, er konnte noch eine andere Natur besitzen als Jansen. Er musste sich zurücklehnen, schloss die Augen.
Nach einer Weile, als der Colonel nicht von selbst fortfuhr, öffnete er sie wieder.
»Wer sind Sie?«
»Das werden Sie nie erfahren.«
»Wer schickt Sie?«
»Ihr Freund.«
»Tischkoff?«
»Wer ist das?«
»Sie kennen keinen Mann namens Tischkoff?«
»Nein. Sie haben noch andere Freunde, welche nicht wollen, dass Sie morgen gehenkt werden.«
Wieder fuhr Jansen, von einem Gedanken erfasst, empor.
»Kapitän Webb!«
»Sie meinen den Kommandanten des ›Duke of Westmoreland‹?«
»Ja.«
Der andere ließ ein kurzes Lachen hören.
»Wie kommen Sie denn auf diese Idee?«
»Weil er immer so... nein, nicht eigentlich freundlich... ich glaubte es.«
»Wenn Sie glauben, Kapitän Webb, dieses personifizierte Pflichtgefühl, wäre dessen fähig, dann kennen Sie diesen Mann durchaus nicht. Sie denken, ich bin Offizier?«
»Nicht?!«
»Ich trage nur die Uniform eines Colonels, diese Soldaten sind maskiert, wir haben uns gleich die Uniform der königlichen Leibgarde gewählt, haben einen königlichen Befehl gefälscht. O, was meinen Sie wohl, was wir alles ins Werk setzen mussten, um Sie herauszubekommen!«
Jansens immer größer werdendes Staunen lässt sich begreifen.
»Und wem verdanke ich dies alles?«, rief er mit überströmendem Herzen.
In diesem Augenblick hielt der Wagen.
»Wir sind am Ziele und haben keine Sekunde zu verlieren. Lassen Sie sich die Augen verbinden.«
»Wozu das?«
»Damit Sie nicht wissen, wohin wir Sie bringen.«
»Aber wenn ich...«
»Lassen Sie sich die Augen verbinden!«, wiederholte der falsche Offizier ungeduldig. »Nicht nur Sie, der Sie noch längst nicht in Sicherheit sind, sondern auch wir befinden uns auf der Flucht, und für uns steht gar zu viel auf dem Spiele.«
Jansen ließ sich die Augen mit einem schwarzen Tuche verbinden, er ward aus dem Wagen geleitet, dieser fuhr schnell davon. An einer Hand geführt, machte er gegen fünfzig Schritte, eine Tür knarrte, einen Korridor entlang, einige Stufen hinauf, viel, viel mehr hinab, dann rasselte es in einem Schlosse, Jansen ward noch einige Schritte vorwärts geschoben.
»Hier bleiben Sie, bis ich wiederkomme.«
Eine Tür ward zugeworfen, es rasselte abermals im Schloss. Jansen zögerte nicht lange, sich von der Binde zu befreien. Das konnte er aber, wohlbemerkt, nicht mit den Händen bewerkstelligen, denn diese waren ihm noch immer auf dem Rücken gefesselt, und er fand recht sonderbar, dass man ihn nicht wenigstens jetzt befreit hatte.
Vorsichtig nach jener Richtung schreitend, woher er gekommen, erreichte er die Tür, fand, mit dem ganzen Leibe tastend, richtig eine Klinke — bei längerem Suchen hätte er sich eben umgedreht und hinten mit den Händen getastet — und mit Hilfe dieser hervorstehenden Klinke war es ihm ein leichtes, sich die Binde über den Kopf zu schieben.
Es war ein Kellergewölbe, von einer an der feuchten Wand hängenden Küchenlampe spärlich erhellt. Dass er in einen Keller geführt worden, hatte er ja gleich am Abstieg gemerkt.
Außer der Haupttür war noch eine zweite vorhanden, ebenfalls sehr stark und mit einem Vorhängeschloss versehen, dann oben an der jenseitigen Wand ein vergittertes Fenster.
Jansen begann, auf und ab zu wandern. Eine Kirchturmuhr hörte er nicht schlagen, ihm deuchte, dass er recht lange warten müsse, eine Stunde war doch mindestens schon vergangen — und wenn man so in Gedanken versunken ist, wie Jansen es war, geht jegliches Zeitmaß verloren, da kann man sich gleich um viele Stunden irren.
Endlich rasselte es wieder im Schlosse der Haupttür, die drei Männer, die ihn begleitet hatten, traten ein, jetzt aber in Zivil, ihnen folgte noch ein vierter, ein schon älterer Mann.
»Ich bitte tausendmal um Entschuldigung«, sagte der falsche Colonel. »Ich hatte nur an drei Minuten gedacht, die Sie hier verbringen sollten, es ist etwas dazwischengekommen, und so sind daraus vier Stunden geworden.«
»Wie lange bin ich schon hier?«
»Es ist gleich drei Uhr.«
»Donnerwetter! Das hätte ich mir nicht träumen lassen!«
»Ja, kommen wir nun schnellstens zur Sache! Also wir offerieren Ihnen die Freiheit!«
»Diese Offerte nehme ich dankbarst an. Und meine Leute?«
»Was für Leute?«
»Die anderen achtzehn, die in einigen Stunden aufgeknüpft werden sollen?«
»Sie meinen, ob wir nicht auch die befreien können? Das ist ganz ausgeschlossen, gar keine Möglichkeit dazu vorhanden. Seien Sie doch froh, dass Sie selbst mit dem Leben wegkommen. Aber wir stellen Bedingungen!«
»Welche?«
»Sie wissen im Chinesischen Meere eine Perlenbank.«
»Aha! Ja, die weiß ich.«
»Geben Sie uns deren Lage an, dann sind Sie wirklich frei.«
»Sofort?«, fragte Jansen, hierdurch beweisend, wie ihm die Augen aufgingen, wie er gleich alles durchschaute.
»Nein, sofort allerdings nicht. Sie können uns ja absichtlich eine falsche Angabe machen.«
»Hm«, brummte Jansen und er musste mit gesenkten Lidern nach unten blicken, um das Aufflammen seiner Augen nicht merken zu lassen. »Wie wollen Sie das sonst machen?«
»Wir müssen erst untersuchen, ob Sie uns wirklich die Wahrheit gesagt haben.«
»Das heißt, Sie wollen sich erst nach China begeben?«
»Ich nicht...«
»Na, dann eben ein anderer. Darüber kann ein Jahr vergehen.«
»Höchstens.«
»Mindestens, wollen wir lieber sagen. Und so lange wollen Sie mich gefangen halten?«
»Das müssen wir allerdings.«
»Hier in diesem nassen Keller?«
»O nein, Sie werden ein höchst komfortables Gefängnis erhalten — von einem Gefängnis ist überhaupt gar keine Rede.«
»Nun gut, ich bin damit einverstanden. Aber auch ich habe meine Bedingungen.«
»Nennen Sie diese, obgleich Sie eigentlich nur zwischen Tod und Leben zu wählen haben.«
»Befreien Sie erst meine achtzehn Jungen, sie sollen dann die Gefangenschaft mit mir teilen, und ich hoffe, dass man uns nicht finden wird.«
»Ich sagte Ihnen schon, dass es ganz und gar ausgeschlossen ist...«
Da bekam der Sprecher, der vorhin den Colonel gespielt, von einem der ehemaligen Soldaten von hinten einen Puff. Es sollte ein heimlicher sein, aber Jansen hatte es wohl bemerkt.
Und der Colonel, wie wir ihn noch nennen wollen, verstand diesen heimlichen Puff auch sofort.
»Hm — nun, vielleicht ließe es sich doch noch machen...«
»O nein, bitte, geben Sie sich keine Mühe mehr — Sie haben ja soeben gesagt, dass es ganz und gar ausgeschlossen ist.«
»Aber vielleicht — wenn wir...«
»Nein, nein, ich habe den Köder gewittert und schnappe nicht zu.«
»Den Köder gewittert?«, ließ sich da zum ersten Male der ältere Mann vernehmen. »Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, dass ich das Geheimnis der Perlenbank nur verrate, wenn ich mich nebst allen denen, die heute früh gehenkt werden sollen, in Freiheit sehe — und zwar in vollkommener Freiheit — ich ziehe diese auch dem komfortabelsten Boudoir vor.«
Ein böser Blick nach dem spöttisch Sprechenden, und dann wandte sich der Alte zunächst an seine jüngeren Begleiter.
»Sehen Sie, meine Herren, ich sagte Ihnen doch gleich, dass ich diesen Kapitän Jansen viel besser kenne als Sie. Geben Sie sich keine Mühe, von ihm auf diese Weise sein Geheimnis zu erfahren. Ich aber nannte Ihnen schon das Mittel, dem ich noch keinen Menschen habe widerstehen sehen, so sehr sie vorher auch prahlten. Ein Jahr lang warten, alle seine Angaben prüfen — weiter fehlte nichts. Vorwärts, auf den Bock mit ihm, die Knute wird ihn sofort zum Sprechen bringen.«
Jansen stand und lauschte nur, während jener schon ein Schlüsselbund aus der Tasche gezogen hatte und die Nebentür aufschloss.
»Packt ihn — aber festhalten, der Kerl hat Bärenkräfte — hier herein mit ihm.«
Gehorsam griffen drei Paar Hände zu, um Jansen festzuhalten.
»Da kann er aber doch noch immer falsche Angaben machen«, meinte der eine, der beide Arme von hinten um Jansens Leib gelegt hatte.
»I wo, das kenne ich besser, ich bin nicht umsonst in Russland gewesen, da lernt man, was die Knute zu bedeuten hat. Wenn das Blut aus den aufspringenden Schwielen spritzt, denkt man gar nicht mehr an solche Simulationen.«
Die Tür war auf, Jansen ließ sich willig vorwärtsschieben.
In dem Nebenraume, ebenfalls durch eine Lampe erhellt, hatte der Sachkundige, der die Wirkung der russischen Knute doch sicher am eigenen Leibe kennen gelernt hatte, in Voraussicht dessen, was kommen würde, schon seine Vorbereitungen getroffen.
In der Mitte stand ein Bock mit breiter Oberfläche, daneben lagen eine Lederknute und einige Stricke.
Leben brauchte in Jansen nicht erst zu kommen, er ließ sich ja vorwärtsschieben, bewegte selbstständig seine Füße — aber beim Anblick dieser Marterinstrumente schien ihm erst die richtige Erkenntnis aufzugehen, seinen Ohren mochte er vorhin noch nicht getraut haben.
»Peitschen wollt ihr mich?!«
»Jawohl, und nun keine weitere Einleitung, nicht erst im Guten fragen — vorwärts, hier auf den Bock mit ihm, die Hände können auf dem Rücken bleiben, nur die Füße müssen ihm noch gebunden werden.«
Da richtete sich Jansen etwas empor.
»Peitschen wollt ihr mich?! Ach, ihr jämmerlichen Wichte, ihr armseligen Menschlein, die ihr einen Richard Jansen so gut kennen wollt...«
Die ihn Haltenden fühlten, wie er seine Armmuskeln anspannte, sie packten mit aller Kraft zu — da aber flogen sie schon zur Seite, es hatte geknackt, wie Glas war die starke Kette gesprungen, Jansens Hände waren frei, und der erste, der wieder nach ihm griff, bekam eine Maulschelle, dass es ein Wunder war, wenn nicht gleich der ganze Kopf abflog, und weil der zweite schnell in die Tasche griff, erhielt er einen Fußtritt, der ihn zu Boden warf.
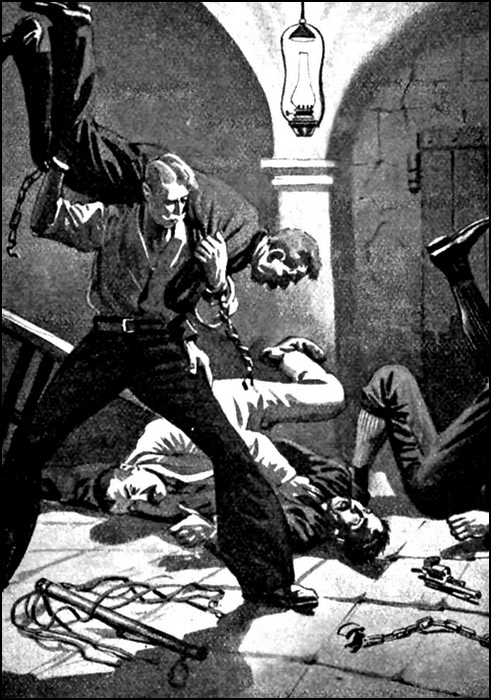
Der Alte hatte einen Revolver gezogen, aber er kam nicht zum Schießen, Jansen hatte schon den dritten gepackt und ihn mit furchtbarer Wucht auf jenen geschleudert.
Vier Menschen lagen röchelnd am Boden — wenn sie überhaupt noch röcheln konnten!
Jansen kümmerte sich nicht um sie, er reckte die lahmgewordenen Arme, ging nach der Ausgangstür, ebenfalls mit einer Klinke versehen, er rüttelte daran, beim ersten Griff brach sie ab — da stemmte er seine Schultern gegen die Tür, es sah aus, als riebe er sich nur etwas daran — krachend sprang die massive Tür auf, das aus dem Gewölbe dringende Licht zeigte noch in einiger Entfernung eine Treppe, Jansen hin und hinauf — jene Männer hatten sonst, diesen Richard Jansen eben durchaus verkennend, gar keine Vorsichtsmaßregeln getroffen, die Haustür war unverschlossen...
Jansen befand sich draußen in der finsteren Nacht, wurde vom Schneesturm umtobt.
»Frei, frei!!«, jauchzte er diesem Sturme entgegen. »Und den möchte ich sehen, der mich wieder lebendig fängt!!«
Er verschwand in der Nacht.
Es war früh um sechs Uhr, noch immer herrschte finstere Nacht, nur der Sturm hatte sich völlig gelegt, dafür war eine noch eisigere Kälte eingetreten, und auf der Reede hörte man die Eisschollen zusammendonnern.
Auf sieben Uhr war die Hinrichtung festgesetzt worden, da an dem Januarmorgen erst ein ganz schwaches Dämmerlicht herrschte.
Denn wohl sollte es eine öffentliche Hinrichtung sein, aber wie die Behörde es oftmals so gern tut, auch die deutsche, wurde dem Publikum ein Schabernack gespielt.
Auf dem Kai drängte sich Kopf an Kopf, aller Kälte trotzend. Solch eine öffentliche Hinrichtung bekam man ja wohl niemals wieder zu sehen. Wie viele erfrorene Gliedmaßen es da geben würde, abgesehen von Ohren und Nasen, das war noch gar nicht zu erdenken. Und dabei standen die meisten Tausend noch dazu in den Straßen festgekeilt, wo sie überhaupt gar nicht das Schiff sehen konnten, nichts vom Hafen, und auch die vordersten Tausend, die fast das eiserne Geländer durchbrachen, würden schwerlich mehr als einige Konturen in der Dämmerung zu sehen bekommen.
Aber auch noch aus einem anderen Grunde waren viele Menschen aus allen Teilen Englands nach Portsmouth gekommen, solche, die nach Frankreich wollten, oder Verwandte und Bekannte von einem aus Dieppe kommenden Schiffe abzuholen hatten.
Damit war es heute nun freilich nichts. Gestern Abend war der aus Dieppe erwartete Dampfer noch angekommen, mit zweistündiger Verspätung, hatte nur unter furchtbaren Schwierigkeiten den sicheren Hafen gewinnen können, beim Anlaufen ständig in Gefahr, an den den Seegang abhaltenden Molen zu zerschellen, die Passagiere, von den zitternden Abholenden wie vom Tode Auferstandene empfangen, hatten von dieser Seereise erzählen können, und aus Portsmouth war schon gestern kein Dampfer mehr abgegangen.
Heute war es zwar windstill, aber das Meer nur noch schrecklicher. Das nach Frankreich gelegte Kabel war gerissen, so war man ohne Verbindung mit Dieppe, aber dass gestern Abend die ›Frankia‹, welche heute früh hier in Portsmouth eintreffen sollte, bei diesem Unwetter abgegangen sei, das war ganz ausgeschlossen. Die sich lauter oder stummer Verzweiflung Hingebenden, welche meist Familienmitglieder hatten abholen wollen, konnten wohl ob dieser Ungewissheit bemitleidet werden, von Seeleuten und allen Sachverständigen aber ebenso deshalb, dass sie glauben konnten, die ›Frankia‹ hätte bei solch einem fürchterlichen Unwetter die Ausfahrt angetreten.
Also es war noch eine Stunde vor der zur Hinrichtung festgesetzten Zeit, als sich der ganze Gerichtshof, die Hälfte davon mit Perücken versehen, in mehreren Booten an Bord der ›Duke of Westmoreland‹ bringen ließ. Es war ein Zufall, dass kein einziger gleich an Bord logierte, wegen Unterbringung der vielen Gefangenen war dort auch großer Platzmangel, sehr viele Gerichtsherren wohnten überhaupt in Portsmouth, die anderen fuhren entweder jeden Abend, wenn Gerichtssitzung gewesen, nach London zurück und kamen früh wieder, oder sie logierten in Hotels oder genossen bei Bekannten Gastfreundschaft.
Wir wollen es nur mit dem High Sheriff zu tun haben, dem ersten Staatsanwalt, der sich durch eine ganz besonders schöne Allongeperücke auszeichnete.
Mit Mühe hatten sie sich durch die Menschenmassen Bahn gebrochen, und während der Bootsfahrt waren sie trotz deren Kürze schon halb erfroren, mussten sich in der warmen Kajüte erst auf- und die überall herabhängenden Eiszapfen, vom Nebel entstanden, abtauen lassen.
»Solch ein Gerichtsverfahren an Bord eines Schiffes darf niemals wieder vorkommen!«, wurde allgemein gejammert.
»Und gerade heute so ein Wetter!«, setzte der High Sheriff noch hinzu. »Wissen Sie schon, Kapitän, dass das Kabel nach Dieppe gerissen ist?«
Gewiss war das Kapitän Webb bekannt.
»Und ich erwarte mit der ›Frankia‹ meine Frau und Kinder!«, jammerte der High Sheriff weiter.
»Und ich meinen Freund«, sagte ein anderer mit einer Perücke.
»Ach was, Freund — ich meine Frau und meine vier Kinder! Dass die auch gerade im Winter nach Paris müssen!«
»Und ich erwarte meine Frau«, erlaubte sich ein Gerichtsschreiber zu bemerken.
»Mit den Kindern?«, fragte der High Sheriff.
»Nein, nur meine Frau.«
»Na dann — aber meine Frau hat die vier Kinder bei sich.«
Es waren noch mehrere, welche Familienangehörige mit der ›Frankia‹ zu erwarten hatten. In Paris war etwas los gewesen, sie hatten die Rückreise wohl alle gleichzeitig angetreten. Und dann würde die ›Frankia‹ wohl auch noch von schaulustigen Franzosen benutzt worden sein, welche der Hinrichtung beiwohnen wollten.
Aber zunächst zählte jeder auf, wen er von seinen Angehörigen heute zu erwarten hatte.
»War denn Ihr Sohn bei der Einweihung nicht auch in Paris?«, wurde Kapitän Webb gefragt.
In seiner wortkargen Weise bejahte dieser.
»Sie haben nur den einzigen, nicht wahr?«
»Ja, das einzige Kind.«
»Will er denn auch die ›Frankia‹ zur Überfahrt benutzen?«
»Er schrieb so.«
»Schrecklich, schrecklich!!«, erklang es im Chor, wobei aber wohl jeder nur an sich selbst dachte.
»Aber, meine Herren«, nahm da der als seemännischer Sachverständiger Fungierende das Wort, »es ist ja ganz ausgeschlossen, dass die ›Frankia‹ bei diesem Unwetter in See gegangen ist.«
»Ja, das sagen Sie! Können Sie uns Gewissheit geben?«
»Kapitän Oxley ist wegen seiner Vorsicht bekannt — wegen seiner übertriebenen Vorsicht — er hat deshalb von seiner Reederei schon manchen Rüffel bekommen. Nicht wahr, Herr Kapitän Webb?«
»Ja, leider«, sagte dieser trocken.
Eine Erklärung für dieses doch eigentlich merkwürdige ›leider‹ gab er nicht, sondern fuhr gleich fort:
»Meine Herren — wie Gott will — ich habe Ihnen zuerst eine wichtige Mitteilung zu machen: wissen Sie etwas davon, dass Kapitän Jansen abgeholt worden ist?«
»Was?!«, wurde im Chore gestaunt.
»Er wurde gestern Nacht um zehn Uhr von einem Adjutanten Ihrer Majestät abgeholt.«
»Was?!!«, wurden die Gesichter immer ungläubiger.
»Um nach Windsor gebracht zu werden.«
»Was?!!«
»Hier ist die Bestätigung.«
Der High Sheriff nahm das vom Colonel unterzeichnete Papier. Dieses noch unbekannte Geschehnis verscheuchte zunächst alle privaten Interessen, bannte die Sorge um die Angehörigen.
»Das ist ja kaum glaublich! Colonel Sir Fitzley? Kennt den einer der Herren?«
»Jawohl, vom ersten Leibgrenadierregiment. Er ist erst aus Indien gekommen.«
»Und er ist Adjutant Ihrer Majestät?«
»Davon ist mir nichts bekannt.«
»Doch, er sollte es werden.«
So wurden die Meinungen ausgetauscht.
»Kapitän Webb, kennen Sie ihn persönlich?«
»Nein.«
»Nach Windsor sollte der Gefangene gebracht werden, der heute baumeln soll?«
»So sagte der Adjutant.«
»Ja, wozu denn nach Windsor?«
»Das weiß ich nicht.«
»Fragten Sie ihn denn nicht?«
»Doch, aber der Colonel wusste es selbst nicht.«
»Doch nicht zu Ihrer Majestät?«
»Weiß ich nicht. Meine Herren, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es ein Viertel vor sieben ist.«
»Ja, aber was nun?«
Wieder ein Durcheinander von Stimmen.
»Warum haben Sie mich nicht gleich benachrichtigt?«, fragte der High Sheriff wieder.
»Ich habe nach Windsor telegrafiert, um eine Anfrage zu halten. Aber die Telegrafenleitung zwischen London und Windsor ist durch den Sturm zerstört.«
»Auch das noch! Haben Sie da nicht gleich nach London telegrafiert?«
»An wen?«
»Nun, natürlich an den Justizminister.«
»Tut mir leid«, entgegnete Kapitän Webb, »ich bin Seemann und kein Kriminalbeamter, wusste nicht, wie ich mich da zu verhalten hatte. Man hätte mir in dieser Sache nicht die höchste Verantwortung geben sollen. Indem ich nach Windsor telegrafierte, an die Stadtverwaltung, glaubte ich, meine Pflicht völlig getan zu haben.«
»Was wurde Ihnen denn aus London erwidert?«
»Von dem Hauptpostamt? Man würde meine Depesche weiterbefördern.«
»An wen?«
»Sagte man mir nicht.«
»Vielleicht nach Windsor durch einen reitenden Boten?«
»Vielleicht. Weiß nicht.«
»Haben Sie keine Nachricht erhalten?«
»Nein. Meine Herren, es ist acht Minuten vor sieben, und es sind noch Vorbereitungen zu treffen.«
Wieder ein Durcheinander von Stimmen, bis der High Sheriff endlich folgende Resolution fasste:
»Wer da ist und um sieben baumeln soll, muss auch baumeln, und wer nicht da ist, kann nicht baumeln. Vorwärts!«
Schnell wurden noch die letzten Vorbereitungen an Deck getroffen. Eigentlich fehlten nur noch die Delinquenten.
Als Henkersknechte dienten Matrosen von demselben Schiffe, von denen sich nur wenige freiwillig dazu gemeldet hatten, Speichellecker, die anderen hatten zu diesem Dienste kommandiert werden müssen.
Und die achtzehn Todeskandidaten marschierten an Deck, gefolgt von ihren kleinen Kameraden, welche nur zuzusehen brauchten, alle gefesselt.
Im Scheine der noch nötigen Laternen sahen sie, wie an den vielen, lang herabhängenden Seilen von geschickten Matrosenhänden Schlingen geschlagen wurden. Es machte auf sie nicht den geringsten Eindruck.
»Hurrjeh, ist dat hüt bannig kalt!«
»Wenn man uns nur wenigstens die Fesseln abnehmen wollte, dass man sich einmal um den Leib kloppen kann.«
»Die könnten uns auch Mäntel geben, dass man da oben warm hängt.«
»Dass sie mir nur nicht einen zu dünnen Strick geben«, meinte der dicke Smutje, der noch nichts von seinem Schmerbauch eingebüßt hatte, ängstlich.
»Was hast du denn gestern noch gegessen, Moritz?«
»Beefsteak, aber das war schrecklich zach — ich habe jetzt noch die Hälfte davon zwischen den Zähnen hängen.«
»Und ich hatte mir saure Rindkaldaunen mit Schlagsahne bestellt...«
»Was? Mit Schlagsahne?!«
»Ja, eben weil ich schon so viel von Schlagsahne gehört, aber noch nie in meinem Leben welche gegessen habe, wollte ich sie doch noch einmal schmecken. Aber diese Engländer wussten ja nicht einmal, was saure Rindkaldaunen sind.«
»Und die Schlagsahne?«
»Die sollte mir Petrus oder der Teufel schlagen, meinte der, und da habe ich mich noch einmal recht satt an sauren Gurken gegessen. Aber die Cholerine habe ich davon bekommen — Herrgott, Herrgott! Wenn's nur nicht da oben noch einmal losgeht, da geniere ich mich ja.«
»Ja, wo ist denn der Käpt'n?«
Noch ehe diese Frage beantwortet werden konnte, wurde energisch Ruhe geboten, der High Sheriff verlas nochmals das Todesurteil, und eben verscheuchte ein heller Schimmer des jungen Tages die finstere Nacht, als sich achtzehn Schlingen um ebenso viele Menschennacken legten.
Es ging alles schneller, als jemand geglaubt hätte. »Fertig! Hievt...«
»Haltet ein!!!«, donnerte da eine Stimme, noch ehe das ›up‹ gekommen war, und diese englischen Kriegsschiffsmatrosen waren zu gut eingedrillt, als dass einer schon vorher Hand über Hand gezogen hätte.
Ein Mann hatte das ›Haltet ein!‹ gerufen, der von dort, wo die Boote anlegten, über Deck gestürzt kam, ein riesenhafter Mann.
»Haltet ein, ich mag nicht allein leben, ich will mit meinen Jungen zusammen gehenkt werden!«
»Bei allem was lebt, Kapitän Jansen!«
Er war es, mit Reif und Eiszapfen bedeckt, an beiden Händen noch die Eisenringe mit klirrenden Ketten, auch sonst einen ganz verwilderten Eindruck machend.
Das war denn doch ein Fall, welcher die Hinrichtung zum Aufschub brachte.
Der freiwillig Zurückgekehrte ward in der Kajüte von den Gerichtspersonen vernommen.
Mit fliegenden Worten erzählte Jansen, ganz der Wahrheit gemäß, dabei immer den Kapitän Webb anblickend.
»Was? Das Geheimnis Ihrer Perlenbank wollten sie von Ihnen wissen?!«, rief dieser, ganz außer sich, als Jansen so weit war.
»Ja, nur deshalb hatten sie mich von hier entführt.«
»Und selbst martern wollten sie Euch?!«
»Wenigstens knuten.«
»O, diese hinterlistigen Halunken!«
Mit diesem unvorsichtigen Ausrufe hatte sich Kapitän Webb verraten. Jansen hatte es ja auch schon gewusst oder doch geahnt. Nämlich, dass Kapitän Webb selbst hierbei seine Hand im Spiele gehabt, dass der ganze Befreiungsversuch erst von ihm ausging. Aber die von ihm Geworbenen oder mit ihm Verbündeten hatten anders gehandelt, als er gewollt. Sie hatten Jansen nur zur Freiheit verhelfen sollen. Statt dessen hatten sie versucht, durch Versprechungen oder durch Gewalt in den Besitz seines Geheimnisses zu kommen.
Es sei gleich hier erwähnt, dass diese Entführungsgeschichte nie aufgeklärt wurde. Wohl wurde eine Untersuchung eingeleitet, aber sie ward von Anfang an ganz nachlässig betrieben. Fürchtete man vielleicht, dass unter diesen Militärmasken Personen gesteckt hatten, durch deren Entlarvung die ganze englische Regierung kompromittiert wurde? Denn es hatte sich eben nicht um eine Befreiung des Delinquenten gehandelt, sondern darum, ihm ein wertvolles Geheimnis zu entreißen, von dem die englische Regierung den größten Vorteil gehabt hätte, und auch die Fälschung der königlichen Order deutete auf ganz hochstehende Personen hin.
Und dann später geschah noch etwas, wonach man überhaupt mit allem nichts mehr zu tun haben wollte, was an diese Geschichte, da man den Kapitän Richard Jansen als Seeräuber hatte henken wollen, erinnerte.
Auf Kapitän Webb, der als Admiral starb, war jedenfalls nie ein Verdacht gefallen.
Und die Gedanken dieser Herren hier waren jetzt mit etwas ganz anderem beschäftigt, dass sie aus jenem Rufe gar nichts Besonderes herausgehört hatten, ihnen gegen Kapitän Webb nicht der geringste Argwohn aufstieg.
»Erzählen Sie kurz, erzählen Sie kurz!«, drängte der Sheriff fortwährend.
»Ich war frei. Ja, aber wie! Ein verlassener Mann. Und in wenigen Stunden sollten meine Jungen gehenkt werden. Ohne mich. Diese ganzen Stunden bin ich in den Straßen umhergeirrt. Ich kam an den Hafen. Da sah ich sie an Deck geführt werden. Und da war mein Entschluss gefasst. Ich sprang in ein Boot — hier bin ich.«
»Na ja, das ist ja alles recht schön und gut«, sagte der Sheriff in seiner hastigen Weise. »Aber wenn Sie nun einmal hier sind, müssen Sie auch baumeln. So leid mir's tut.«
»Deshalb komme ich ja eben. Ich will mit meinen Jungen zusammen leben oder sterben!«
»Von leben ist keine Rede mehr — baumeln, baumeln, baumeln! Nu machen Sie aber fix, wir haben...«, der Sheriff brachte unter dem Talar seine Taschenuhr zum Vorschein, »wir haben durch Sie schon sechs Minuten Verspätung. Sie könnten wenigstens schon seit fünf Minuten eine Leiche sein.«
»Ich bin bereit.«
»Na, da machen Sie sich fertig.«
»Er ist doch fertig«, meinte ein anderer Richter. »Oder soll er eine andere Hose anziehen, weil die an den Knien aufgeplatzt ist?«
»Ach was, Hose! Zum Baumeln braucht man überhaupt keine Hose anzuhaben. Aber gefesselt muss er sein, Handschellen muss er anhaben! So steht's in der Vorschrift. Und nun fix, fix, dass wir die verlorene Zeit wieder einholen!«
Gut, Jansen bekam neue Fesseln, er ward als neunzehnter an Deck geführt.
»Da kommt er, der Käpt'n!«, sagten die Matrosen, die sich alles andere nicht erklären konnten.
Die unterdessen abgenommenen Schlingen wurden ihnen wieder umgelegt, jetzt neunzehn Stück, und jetzt bekam auch das frierende Publikum etwas zu sehen, soweit es nicht totgedrückt oder erfroren war; denn inzwischen war es hell geworden. Nur draußen auf dem Meere lag noch eine scharf abgegrenzte, undurchsichtige Nebelwand.
Der Richtspruch ward nicht noch einmal vorgelesen.
»Fertig! Hievt...«
Wieder konnte der Urteilsvollstrecker das ›up‹ nicht aussprechen. Diesmal hatte ein gellender Schrei ihn unterbrochen, ein fürchterlicher Schrei, gleichzeitig aus vielen tausend Kehlen kommend.
»Die ›Frankia‹, da kommt sie!!«
Wir wollen gleich sagen, dass niemand mehr an die Hinrichtung dachte. Die Delinquenten hätten die Schlinge vom Halse nehmen und davonlaufen können, niemand hätte etwas gemerkt. Aber auch sie starrten wie gelähmt mit weitaufgerissenen Augen nach dem offenen Meere.
Denn der Anblick, der sich ihnen bot, war ein gar zu fürchterlicher.
Zwar war es nur ein Schiff, ein stattlicher Raddampfer von mindestens 5000 Tonnen, der soeben aus der Nebelwand aufgetaucht war, aber wie sich dieser Dampfer nun gebärdete, das lässt sich gar nicht beschreiben, und auch auf dem besten Bilde kann man ja immer nur einen Moment wiedergeben.
Von hier aus sah man wohl, dass das Meer außerordentlich aufgewühlt sein musste, aber den richtigen Eindruck bekam man doch erst durch ein Schiff, mit dem diese häuserhohen Wogen spielten.
Wie der große Dampfer manchmal kerzengerade in der Luft stand, dann in einem Wassertale völlig verschwand, im nächsten Moment wieder hoch oben schwebte, und nun immer diese seitlichen Schwankungen, wie die mächtigen Schaufelräder dabei stets in der Luft peitschten, und dann wieder, als wolle das ganze Schiff einen Salto mortale schlagen — das ist der Versuch einer Beschreibung, die aber nicht im entferntesten wiedergibt, was die Zuschauer erblickten, denen sich vor Entsetzen das Haar auf dem Kopfe sträubte.
»Die ›Frankia‹ ist wirklich abgefahren!«, war man endlich auch zu Worten fähig.
»Der Kapitän muss ja wahnsinnig gewesen sein, dass er ausgelaufen ist!«
»Dann kann es auch nicht Kapitän Oxley sein!«
»Aber wenigstens meine Frau wird nicht mitgefahren sein!«
Dieser eine sprach für hundert andere, welche heute ihre Angehörigen erwarten konnten, aber das war nun etwas, worauf niemand hoffen durfte.
An Deck war niemand zu sehen, selbstverständlich nicht, da konnte sich nichts Lebendiges drauf halten. Wer weiß, wie die auf der Kommandobrücke sich festgeschnürt hatten, aber die Kajüten waren sicher voll von Passagieren.
Denn wohl sehr, sehr selten kommt es einmal vor, dass jemand die beabsichtigte Fahrt mit dem Schiffe aufgibt, weil draußen zu schlechtes Wetter herrscht. Da hört man vor allen Dingen auf den Kapitän und seine Offiziere, und die werden doch keine Passagiere abschrecken, die werden ihr Schiff doch auch nicht in unnötige Gefahr bringen — außerdem gewinnt man vom Hafen aus ja noch nie den rechten Eindruck, den das Meer draußen macht — und schließlich ist solch ein Zurückbleiben überhaupt Torheit; denn nach einer stürmischen Ausfahrt hat man vielleicht das schönste Wetter für die ganze übrige Fahrt, während man umgekehrt bei ganz ruhiger See ausfährt, und das Schiff erreicht doch niemals sein Ziel.
Kurz, wer einmal ein Schiff schon zur Reise gewählt hat, er braucht noch gar nicht das Billett gelöst zu haben, der fährt auch ganz sicher mit.
»Sie darf wenigstens nicht einfahren!«
Alle Seeleute, und nicht nur die, konnten über solch eine Zumutung nur lächeln — wenn jemand noch eines Lächelns fähig gewesen wäre. Einmal so weit, suchte der Dampfer nun natürlich auch noch den ruhigen Hafen zu gewinnen, und es war auch nichts weiter als die beiden Molen zu fürchten, die zum Schutze des Hafens dienen und die dennoch gerade den Schiffen so gefährlich werden können.
Der Dampfer kam in seinem wahnsinnigen Tanze heran, die Dampfpfeife heulte mehrmals, aber es waren keine Notsignale, sondern die vorschriftsmäßigen, welche die Einfahrt melden, und jetzt wurden hinter dem Sturmschutz auf der Kommandobrücke Menschenköpfe sichtbar, durch das Fernrohr konnte man schon deutlich die Gesichtszüge erkennen.
»Wahrhaftig, es ist Kapitän Oxley! Ist denn der plötzlich wahnsinnig geworden, dass er die Ausfahrt gewagt hat, dieser sonst so überaus vorsichtige Kapitän?!«
Nein, wahnsinnig war er nicht geworden, aber er hatte endlich die ewigen Vorwürfe seiner Reederei, dass er durch seine Vorsicht so viele Fahrten versäume und dadurch natürlich die Dividende der Aktiengesellschaft schmälere, überdrüssig bekommen, er hatte einmal zeigen wollen, dass er dasselbe leisten könne, was andere Kapitäne wagten, und mit fast fünfhundert Passagieren an Bord hatte er die Fahrt trotz allen Unwetters angetreten.
Und immer näher kam der Dampfer in seinem wahnsinnigen Tanze.
Was sich nun ereignete, war das Werk weniger Augenblicke; ohne jede Einleitung war die entsetzliche Katastrophe geschehen.
Schon durften alle die Tausende von Zuschauern, ob sie nun Angehörige an Bord hatten oder nicht, erleichtert aufatmen; denn, aus der Perspektive gesehen, schienen nur wenige Meter die ›Frankia‹ von dem ruhigen Wasser des Hafens zu trennen, welche Grenze von der äußersten Spitze der Mole fast ganz scharf gezogen war, als der Dampfer von einer der ungeheueren Wogen, in deren Bereiche er sich vorläufig noch immer befand, ganz nach Backbord geschleudert wurde, wie ein Ball flog er förmlich durch die Lüfte, und... da war es schon geschehen!
Ein vieltausendstimmiger Schrei des Entsetzens, noch ehe man den donnernden Krach gehört hatte — die ›Frankia‹ war auf die Spitze der Mole gerannt! Einen Augenblick war nichts weiter als ein kochender Wasserstrudel zu sehen, alles verschwinden lassend. Niemand glaubte, den Dampfer daraus wieder auftauchen zu sehen — und doch, da war er wieder, aber nur die Hälfte, der hintere Teil, ganz schräg stehend.
Es war ganz offenbar, dass sich die Spitze der Mole in das Innere des Dampfers förmlich hineingebohrt hatte, nur auf diese Weise noch den Rest des Schiffes über Wasser haltend.
Aber ein Glück war das nicht zu nennen. Die vor Entsetzen gelähmten Zuschauer sollten noch immer Furchtbareres zu sehen bekommen.
Die etwas vorn angebrachte Kommandobrücke war mit dem ganzen Vorderteile überhaupt verschwunden, und was sich hier befunden hatte, rang jetzt schon in den riesigen Wellen mit dem Tode, war bereits zerschmettert, also auch der Kapitän und seine Offiziere, die sich doch sicher alle auf der Kommandobrücke befunden hatten.
Und jetzt ergoss sich aus einer Tür des erhöhten Hinterteiles, also aus dem Eingange zu den Kajüten, welche nach der Bauart der ›Frankia‹ sämtliche fünfhundert Passagiere getragen haben mussten, ein Menschenstrom. Das in die Kajüten und in die verschiedenen Salons eindringende Wasser hatte die Passagiere daraus vertrieben, sie suchten ihre Rettung an Deck, und hier oben wurden sie nun erst recht von den wütenden Wogen in Empfang genommen, die sie zu Dutzenden, zu Hunderten mit sich herabrissen.
»Meine Frau, meine Kinder!!«
»O Gott, o Gott, mach es doch kurz mit ihnen!!«
So wurde gebetet, nicht mehr gejammert. Eines Jammers waren all diese Zuschauer ja gar nicht mehr fähig. Sie hofften nur noch, dass eine mitleidige Woge gleich noch den Rest des Wracks verschwinden lasse, auf dass dieses entsetzliche Schauspiel endlich vorüber sei.
Und dass keine Woge so mitleidig sein wollte, das eben war das Allerfürchterlichste dabei!
Die Spitze der Mole hielt ihre Beute fest, und schon mit bloßen Augen konnte man deutlich alles unterscheiden, jede einzelne Bewegung, wie die sich am letzten Maste festklammernden Menschen losgerissen und über Bord gespült wurden, einzeln und gleich reihenweise, Dutzende davon engumschlungen, und das Schlimmste dabei war nun vielleicht, dass es dennoch Stellen an Deck gab, wo sie vor den Wogen einigen Schutz fanden — einigen, nicht vollständigen! — Ab und zu fand eine allgewaltige Woge ihren Weg nach solch einer geschützten Stelle und riss einige der Festgeklammerten mit sich fort, und wie nun trotzdem um diese etwas gesicherten Stellen gekämpft wurde, mit welcher Verzweiflung, mit welcher Bestialität sie einander die Kleider vom Leibe rissen...
Doch nein, wir wollen hier nicht von Bestialität sprechen. Es waren Menschen, die um ihr Leben kämpften, das man nur einmal zu verlieren hat, und das Fernrohr zeigte auch hochherzige Szenen genug, wie einer den anderen zu halten suchte — das Fernrohr zeigte aber leider auch, wie Väter und Mütter gegen Rücksichtslose um ihre Kinder kämpften; es zeigte sogar ganz deutlich die von Todesangst verzerrten Gesichtszüge, und gar mancher Zuschauer erkannte in ihnen die eines Familienangehörigen, des Gatten, der Gattin, der Kinder, und der Wind trug das Zetergeschrei der Unglücklichen bis hierher!
»O Gott, o Gott, der du der Allbarmherzige sein willst, mach es doch nur wenigstens kurz mit ihnen!!«
Nein, diesmal war der allmächtige Gott eben nicht barmherzig! Er, der nach seiner Verheißung alltäglich seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte, der ganz Sodom verschonen wollte, wenn sich in dieser Stadt nur zehn Gerechte befänden — diese Stelle, wie Abraham für das Schicksal Sodoms fleht, ist eine der herrlichsten im ganzen alten Testamente — dieser Gott des alten Testamentes mochte zu sehr ergrimmt sein über die Hunderte, welche aus fluchwürdiger Sensationslust nach Portsmouth gekommen waren, um die neunzehn Seeräuber henken zu sehen, und ihretwegen mussten auch die Unschuldigen leiden.
Der Pier hielt sein Opfer mit eisernen Klammern fest, auf dass Schuldige wie Unschuldige den ganzen Schrecken von Gottes Grimm durchkosten sollten, und auf dass viele Tausende von Menschen dazu verurteilt waren, ganz untätig zuschauen zu müssen.
Ja, ganz untätig!
»Wer wagt es?! Wer rettet die noch Lebenden?! Hundert Pfund Sterling, tausend Pfund...«
So klang der Ruf.
Aber das waren Worte, keine Taten.
Und wenn man dem Retter alle Schätze der Welt versprochen, was hätte es genützt! Und was fragt der brave Mann auch nach so etwas!
Gerade die besten Seeleute waren es, die gleich offen sagten, dass hier jede Rettung unmöglich sei.
»Meine Frau, meine Kinder, ich kann sie noch sehen, retten Sie sie, retten Sie sie!!«, wimmerte der High Sheriff zu Füßen des Kapitäns Webb.
»Habe ich nicht meinen eigenen Sohn drüben?«, entgegnete dieser in fragendem Tone, und mehr brauchte er nicht zu sagen.
Und dennoch, es fanden sich brave Männer. Der Befehl ihres Herzens war stärker, als die Erwägung ihrer Vernunft.
Es gingen Boote ab, es gingen kleine Dampfer ab — sie alle erreichten nur die Grenze, wo die Herrschaft des wahnsinnig gewordenen Meeres begann, dann hatten sie genug mit sich selbst zu tun, um sich wieder in Sicherheit zu bringen, und die Zurückgekehrten konnten nur sagen:
»Es geht nicht, gegen Gott können wir nicht ankämpfen!«
Zwei Boote aber kehrten überhaupt nicht wieder zurück. Es waren nur noch vierzehn wackere Männer mehr zu bejammern, und von den übrigen Bootsbesatzungen, die bis zu einer Stunde mit den wütenden Wogen gerungen, hatten gar viele die Gliedmaßen erfroren, würden Krüppel für immer sein, und das alles ganz zwecklos; denn es war gar nicht daran zu denken gewesen, auch nur in Wurfnähe des Wracks zu kommen.
»Wo ist Bob Snyder? Der alte Bob muss kommen!«, erklang da der Ruf, und alle die Tausende stimmten mit ein: »Der alte Bob muss mit seiner Mannschaft kommen!!«
Bob Snyder war Wärter des Leuchtturmes von Southampton und wurde dann Bootsmeister der ersten, speziell in England gegründeten Rettungsstation.
Wenn der alte Mann für jedes aus Seenot gerettete Menschenleben eine Medaille bekommen hätte, er würde auf seiner Brust schon längst keinen Platz mehr gehabt haben. —
Da möchte zunächst über das Bootsrudern oder vielmehr Bootssteuern durch Brandung und auf hoher See im allgemeinen etwas gesagt werden.
Dass es auch beim Segelwesen unter den Kapitänen und Seeleuten Genies gibt, welche etwas leisten, was selbst Talente nie erlernen können, wurde schon einmal gesagt. Noch vielmehr aber gilt das beim Steuern des Ruderbootes durch die brandende See.
Wie es da manchem ganz einfachen Manne gelingt, das von ihm gesteuerte Boot so dicht an ein um sich schlagendes Wrack und durch die Brandung zurück wieder glücklich an Land zu bringen, das ist oftmals ein Rätsel, welches selbst der tüchtigste Kapitän nicht begreift. Wohl muss auch der ein Boot durch die Brandung steuern können, aber solche Kunststückchen, wie so ein armseliger Fischerknecht, bringt er nicht fertig, da kann er nur staunen.
Und merkwürdig ist dabei, dass es fast nur auf den Steuerer ankommt, viel weniger auf die Rudermannschaft. Oder das ist auch nicht so merkwürdig. Denn so ist es ja überall in der Welt, wo etwas geleistet werden muss, das gilt auch bei der Aktiengesellschaft vom Direktor — die anderen, welche die Maschinen bedienen und die Schreiberei machen, sind haufenweise zu bekommen — und nur vom kommandierenden General, vom Schlachtenlenker hängt der Sieg ab! Dass dieser tapfere, gutdisziplinierte Truppen haben muss, ist ganz selbstverständlich, und hat er sie zur Zeit nicht zur Verfügung, so darf er die Schlacht eben nicht annehmen.
Ein noch besseres Beispiel, wie die Hand, welche die rohe Kraft führt und bändigt, den Sieg entscheidet, hat man beim Pferderennen. Jeder, der etwas davon versteht, wird nicht auf das bisher schnellste, siegreichste Pferd, sondern auf den besten Jockei wetten. Denn das ist gewiss, dass ein minderwertiges Pferd unter einem guten Jockei mehr leistet, als ein schnelleres Pferd unter einem Stümper. Was es aber nun ist, was so ein gottbegnadeter Jockei, wie jetzt der Amerikaner Dehare, der in England jährlich 420 000 Mark bekommt, eigentlich in seiner Hand und in seinen Schenkeln hat, dass er jedes von ihm ›gesteuerte‹ Pferd zur größtmöglichen Schnelligkeit bringt, das hat bisher noch kein Mensch ergründen können. Das ist eben ein Genie.
Und solch ein Genie war Bob Snyder im Bootssteuern. Natürlich war schon längst bekannt gewesen, wie viele Schiffbrüchige der alte Leuchtturmwärter von Southampton bereits gerettet — aber doch erst später war er als solch ein genialer Bootssteurer entdeckt worden. Man hatte ihm die Organisierung der ersten englischen Rettungsstation übertragen, und da ist es eben so selbstverständlich, dass er sich nun auch für seine Boote die tüchtigsten Leute aussuchte und sie für seine Zwecke ausbildete. —
»Wo ist Bob Snyder? — Der alte Bob muss mit seinen Unsterblichen kommen!!«
Es wurde nach Southampton telegrafiert, nach zwei Stunden traf der alte Bob mit den zehn Ruderern seines ersten Rettungsbootes ein, genannt die ›Immortals‹, d. h. die Unsterblichen, weil ihre Anzahl immer wieder ergänzt wurde. Denn selten einmal ging eine Fahrt nach einem Wrack ab, ohne dass es wenigstens einige abgequetschte Finger gab, und die Krüppel wurden dann durch die anderen eingeschulten BootsMannschaften ersetzt.
In den zwei Stunden hatte sich nichts geändert. Nur der Überlebenden waren noch weniger geworden, immer noch sah man ab und zu einen der sich Festklammernden von den Wogen fortgespült werden, hörte durch den Wogendonner sein Hilfegeschrei, wenn er dazu noch fähig war.
Schließlich soll sich der Mensch ja an alles gewöhnen, sogar an anhaltende Schmerzen. Aber die Zuschauer hatten sich in diesen zwei Stunden noch nicht an den Anblick des Schreckens gewöhnt. Der Eindruck war noch genau derselbe wie in der ersten Viertelstunde. Noch immer ein allgemeines Entsetzen und Jammern und Beten und Rufen nach Rettern.
Die Anzahl der sich noch an Deck Haltenden durfte man auf mindestens noch fünfzig schätzen. Und ihre Lage war schrecklicher denn je. Die See wütete nach wie vor, Woge nach Woge übergoss das halbe Schiff, welches durchaus nicht brechen wollte, um allen Qualen ein schnelles Ende zu machen, und was die an Kälte leiden mussten, konnten schon die am Lande beurteilen. Aus Westen her brachte der wieder aufkommende Wind eine immer grimmigere Kälte, immer länger wurden die Eiszapfen, mit denen der Dampfer schon bei der Einfahrt ganz behangen gewesen war, und bald würde das Wrack von einem ganzen Eisberge eingeschlossen sein.
Da endlich kam der alte Bob Snyder mit seinen zehn Unsterblichen an. Rettungsboote standen ihm in Portsmouth genug zur Verfügung. Aber er wies auch das beste zurück.
»Nein, da können wir nicht hin, da ist jede Rettung ausgeschlossen.«
Und dabei blieb der sachverständigste, beste und unerschrockenste Bootssteuerer der ganzen Welt!
Unterdessen waren von London und von dort, wo gegenwärtig der englische Hof residierte, auch Prinzen und andere aus königlichem Geschlecht eingetroffen. Sie konnten nichts weiter als Orden und dergleichen anbieten, aber da war ja schon mit barem Gelde viel mehr versucht worden, und wenn sich Bob Snyder nicht einmal dadurch, dass man seine Knie umklammerte, bewegen ließ, ins Boot zu gehen, wie wollte man ihm da mit Geld und Anhängseln beikommen!
Da richtete sich aus der Menschenmasse eine lange, hagere, schwarze Gestalt empor, eine dürre Faust ward geschüttelt.
»Das ist der Fluch, das ist die Vergeltung Gottes!!«, zeterte eine quäkende Männerstimme. »Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet — und ihr habt den Richard Jansen und seine Leute...«
Die Methodistenstimme kam nicht weiter. Die letzten Worte wurden aufgegriffen und aus Tausenden von Kehlen wiederholt: »Richard Jansen und seine Leute!!«, Und es hatte wie ein Jubel der Erlösung durchgeklungen.
Richard Jansen befand sich schon längst wieder in seiner ihm als Zelle dienenden Kabine.
Wie und wann er hinabgebracht, wusste er nicht. Er hatte die Katastrophe selbst mit erblickt, konnte alles Weitere von den Fensterchen aus beobachten, und was kümmerte es ihn da, dass er und seine Leute von einem Vorsichtigen doch nicht vergessen, auch wieder gefesselt abgeführt worden waren.
Jansen selbst hielt eine Rettung für ausgeschlossen. Sonst hätte er wohl, darf man glauben, seine Dienste sofort angeboten, als einmal der Ruf nach dem braven Manne erschollen war und sich zuerst niemand melden wollte.
Als sich aber dann doch genug gefunden hatten, die Rettung zu versuchen, war gerade Jansen es gewesen, der zu einem der Fensterchen hinausgebrüllt hatte, von dem wahnwitzigen Versuche abzustehen.
Seine warnende Stimme war in dem allgemeinen Tumult verloren gegangen.
So hatte Jansen in seiner engen Kabine genau dasselbe durchgemacht, wie draußen das Publikum. Er hatte getobt, gejammert, war entsetzt, ganz außer sich gewesen. Und dann immer dazwischen einmal:
»Und doch, es muss, es muss gelingen! Ich biete mich an! Nein, nein, es geht nicht, sie sind verloren!«
Dann war der Ruf nach Bob Snyder erklungen, den auch Jansen recht wohl kannte, und da mit einem Male war Jansen wie erstarrt, hatte sich wohl vor die Stirn schlagen wollen, wurde aber durch seine Fesseln daran gehindert.
»Ach, ich Narr, ich Narr!!«, erklang es in verzweifelndstem Tone. »Warum konnte ich nicht meine Dienste anbieten — auch wenn keine Aussicht auf Rettung ist — so wäre ich mit meinen Jungen doch wenigstens eines ehrlichen Todes gestorben!«
Er hatte recht, wenn er das Versäumte jetzt nicht mehr nachzuholen suchte. Jetzt hätte man ihn wohl sicher abgewiesen; denn jetzt wartete man eben auf Bob Snyder, der mit seinen Unsterblichen noch immer die Elemente besiegt hatte.
Bob Snyder kam und... lehnte den Rettungsversuch als eine Unmöglichkeit ab.
Da erklang die Stimme des Methodisten, die mit einem vieltausendstimmigen Rufe nach Kapitän Richard Jansen und seinen Leuten endete.
Und wie elektrisiert war Jansen, der es gehört, emporgefahren, auch über ihn kam es wie der heilige Geist, der ihm den Weg der Erlösung zeigte.
»Gott, ich danke dir!«, rief er mit nach oben gerichtetem Blick. »So lass mich und meine braven Jungen als ehrliche Männer sterben!!«
Schon näherte sich seiner Tür ein Stimmengewirr, und noch ehe er sie erreicht, ward sie schon aufgerissen.
Vor der Tür stand eine Menschenschar, an der Spitze Kapitän Webb, und an diesem vorbei drängte sich der High Sheriff, noch die Perücke auf dem Kopfe, warf sich gleich zu Jansens Füßen und umklammerte seine Knie.
»Retten Sie meine Frau und Kinder, welche ich noch an Deck sehe, o, retten Sie meine Frau und die armen Kinder — Sie können es, nur Sie können es, ich weiß es, alle Welt weiß es!«
So erklang es in jammerndem Tone.
Es war ein Blick der unsäglichsten Bitterkeit, mit dem Jansen auf den vor ihm Knienden herabsah. Denn gerade bei diesem High Sheriff, als seinem obersten Richter, hatte Jansen die ganze Parteilichkeit furchtbar empfinden müssen, den ganzen Hass, den die englische Regierung gegen ihn hatte, zumal da er das Geheimnis seiner Perlenbank nicht verraten wollte.
Er war kein gerechter Richter gegen ihn gewesen. Aber das ließ sich nur empfinden, niemals beweisen. Denn scheinbar hatte der High Sheriff den ganzen Prozess mit strengster Gewissenhaftigkeit geleitet. Wir haben den Charakter dieses Mannes vorhin durch einige leichtfertige Redensarten anzudeuten versucht, Jansen hatte solche nie von ihm zu hören bekommen — aber er hatte diesen Charakter eben sofort und immer empfunden.
Doch es war eben nur ein Blick der bitteren Verachtung gewesen, im nächsten Moment war es schon ein ganz anderer.
»Ja, ich will es versuchen!«
»Halten Sie wirklich für möglich, mit einem Boote an das Wrack zu kommen?!«, rief Kapitän Webb in zweifelndem Tone.
»Wenn Gott es will, ja — ihm ist nichts unmöglich.«
»Dann vorwärts, vorwärts, verlieren Sie keine Zeit!«, jammerte der High Sheriff, immer in seiner egoistischen Art, und noch manch anderer mit ihm.
»Entledigt mich erst meiner Fesseln!«
Es war ein Ruf der furchtbarsten Ironie — wenn auch von Jansen ganz unbeabsichtigt getan.
Der Schlüssel war in der allgemeinen Verwirrung nicht gleich zur Stelle, da spannte Jansen seine Muskeln und zerriss die Kette mit einem Ruck, heute zum zweiten Male.
Sie war dicht an der rechten Handschelle gebrochen, von der linken hing sie lang herab, und da ihn dies hinderte, packte er sie, stemmte diese Hand dabei gegen die Wand, noch ein Ruck mit seiner unwiderstehlichen, alles aus den Fugen reißenden Titanenkraft, und auch diese hindernde Kette war abgerissen.
Nur die breiten Ringe blieben noch um seine Handgelenke, und auf diese eisernen Manschetten durfte der in der letzten Not angerufene Mann wahrhaftig stolz sein!
Dass ihm jetzt nichts mehr versagt wurde, ist ganz selbstverständlich — und ebenso, dass jetzt auch niemand etwas von einer Belohnung und dergleichen sprach. Jansen verlangte nach seinen Leuten, und nicht nur die achtzehn Matrosen und Heizer, darunter auch die Offiziere wie Koch und Steward, die vor drei Stunden den Strick um den Hals gehabt, erschienen augenblicklich an Deck, fessellos, sondern auch Karlemanns halbwüchsige Jungen wurden sofort herbeigeschoben, sogar den Maler und Madame Hullogan hatte man nicht vergessen.
»Meine eigenen Boote, die von der ›Sturmbraut‹, die haben wir am besten in der Gewalt!!«, kommandierte Jansen.
Die waren damals von dem ›Duke of Westermoreland‹ mitgenommen worden, lagen unter Siegel am Kai.
Ja, es war ein königliches Siegel, durch welches man diese Boote, in denen man blutige Seeräuber gefangen, unantastbar gemacht hatte!
Aber wer kümmerte sich jetzt um diese Unverletzlichkeit! Die Siegel brachen von ganz allein, und die fünf begehrten Boote lagen neben dem englischen Kriegsschiff.
»Leute«, rief Jansen, »wir sind aufgefordert worden, die noch auf dem Wrack Lebenden zu holen. Seid ihr bereit dazu?«
Mit einem eigentümlich starren Blick hatte Jansen diese seine Worte begleitet.
Von diesen zweiundvierzig Mann war kein einziger, der nicht sofort erkannt hätte, dass hier jede Rettung ausgeschlossen war, wir brauchen Madam Hullogan gar nicht auszunehmen — und sie blickten nach dem Wrack, und sie blickten auf ihren Kapitän, der sie so starr ansah — und sie wussten alles, alles!
»Ja, Käpt'n, wir wollen!«, erklang es einstimmig.
Sie hätten gleich sagen können: ›Ja, Käpt'n, wir wollen mit Euch eines ehrlichen Todes sterben, wonach wir sogar noch bewundert werden.‹
Aber ihre Antwort hatte auch schon genügt — es waren ihre aufleuchtenden Augen, welche sprachen.
Jansen teilte die ganze Mannschaft ab. Es waren dieselben Bootsbesatzungen, wie sie damals aufgefischt worden waren. Und schon damals waren sie nach Rettungsdivisionen abgeteilt gewesen, oder zum Rettungsmanöver, wonach das beste Boot zuerst abgeht, dann, wenn dieses vernichtet ist oder Unterstützung braucht, geht das zweitbeste ab, und so fort.
So wurde das erste Boot von Jansen selbst gesteuert, das zweite von Goliath, das dritte von Enoch, das vierte von Martin, das fünfte von Mahlsdorf, und diese Reihenfolge rührte nicht daher, dass der erste Steuermann jetzt nur noch über einen Arm verfügte. Als Bootssteuerer hatte dieser schon immer zwei Matrosen nachstehen müssen, die aber unterdessen beide ihren Tod gefunden.
Bei der Verteilung der Ruderer hingegen kam es gerade darauf an, die Boote möglichst gleichstark zu machen. So waren vor allen Dingen Jansens große und Karlemanns kleine Matrosen durcheinandergemischt, dann kamen die Heizer und das sonstige Maschinenpersonal hinzu, die zwar ebenso wie Koch und Steward im Rudern tüchtig ausgebildet waren, aber doch nicht mit regelrechten Matrosen verglichen werden konnten.
Sonst sei nur noch erwähnt, dass Madam Hullogan, die im ›Pullen‹ einen ganzen Mann stand, ins dritte Boot kam, von ihrem eigenen Ehegespons gesteuert, während der Schiffsmaler früher zum fünften Boote gehört hatte, und selbst er hatte bei den oft zur Übung abgehaltenen Manövern pullen müssen, dass ihm auch am vereisten Kap Hoorn kein trockener Faden am Leibe geblieben war, und er hatte es auch immer mit dem größten Vergnügen getan.
»Ihr bleibt zurück, van Zyl.«
»Weshalb?«
»Es geht in den Tod.«
»Ich weiß es.«
»Und Ihr wollt mit?«
»Ganz bestimmt!«
»Well. Fertig!«
Und fort ging es, ein Boot hinter dem anderen, mit allem ausgerüstet, was man zu solch einer Rettung nötig hatte, vor allen Dingen mit langen Leinen und Haken.
Sorgliche Personen hatten den Wackeren wohl auch Pelze angeboten, aber keine Seeleute. Nur so dünn wie möglich angezogen, dass keine Bewegung gehemmt wird, und ist der Pelz durch und durch nass, wird er wohl nicht viel gegen Kälte helfen.
Wie sich Jansen die Rettung, d. h. das Abholen der Schiffbrüchigen von dem Wrack dachte, hatte er nicht gesagt, wusste es wahrscheinlich selbst noch nicht.
Er hielt ja auch die Rettung für ausgeschlossen.
Dort an dem Wrack oder an der Mole würde eines der fünf Boote nach dem anderen zerschellen. Das wussten auch alle anderen, und dennoch wollte keiner zurückbleiben. So war dieser ganze Rettungsversuch mehr ein versteckter Massenselbstmord.
Dass aber dennoch jeder sein möglichstes tat, um doch vielleicht einen oder den anderen vom Wrack und lebendig an Land zu bringen, war ebenso selbstverständlich. Nur war das Erfüllen dieser Hoffnung in unabsehbare Ferne gerückt.
Also vorwärts ging es!
Beschrieben kann solch eine Bootsfahrt nicht werden. Da hört auch jede Phantasie auf.
Das muss man einmal selbst gesehen haben, um so etwas glauben zu können.
In wenigen Minuten waren alle Ruderer mit Eis bedeckt, und besonders an den ziemlich regungslosen Beinen, aber sogar auch an den Händen bildeten sich lange und immer länger werdende Eiszapfen. Das salzige Seewasser gefriert erst bei vier Grad Celsius, kann überhaupt nicht gefrieren, bevor sich nicht das Salz ausscheidet, was wiederum nicht eintreten kann, solange es in tüchtiger Bewegung ist. Findet aber ein Tropfen des flüssigen Wassers einen Ruhepunkt, so scheidet er im Augenblick die drei bis vier Prozent Salz aus und erstarrt sofort zu Eis.
Was es nun heißt, in solches Eiswasser getaucht zu sein, lässt sich denken. Ohren und Nasen hatten sie wohl schon alle erfroren, dann würden Hände und Füße darankommen. Dennoch war sehr unwahrscheinlich, dass einer fror. Trotz ihrer Eisschicht dampften sie alle, wie ihre Gesichter glühten, und wer von Natur aus eine genügende Blutzirkulation besaß, der konnte durch diese innere Wärme auch vor dem Erfrieren der unbeweglichen Gliedmaßen bewahrt werden.
Am meisten hatten unter dieser Kälte doch eigentlich die ziemlich unbeweglich sitzenden Bootssteuerer leiden müssen. Aber gerade diese dampften und glühten am allermeisten. Vor seelischer Anstrengung!
Denn gerade bei solchen Gelegenheiten sieht man, dass Seele oder Geist, wenn sie all ihre Kräfte entwickeln, noch viel mehr Nervensubstanz verbrauchen als bei rein körperlichen Leistungen.
Und weiter ging es in dem wahnsinnigen Tanze. Eine andere Bezeichnung für diese Art von Fahrt kann eben nicht gefunden werden.
Jansen hatte seine Selbstvernichtungsgedanken schon längst aufgegeben.
Denn jetzt glaubte er selbst, dass es ihm gelingen würde. Er hatte sich von dem beeinflussen lassen, was er vorhin erblickt, wie nämlich jene braven Männer die Rettung, nur die Bootsfahrt, versucht und wieder davon hatten absehen müssen, wenn es ihnen noch möglich gewesen.
Gewiss, auch die, die so etwas unternommen, waren Seeleute comme il faut gewesen, geschulte Bootsruderer, die sich schon in so mancher Brandung bewährt — — hier aber zeigte sich einmal, was es zu bedeuten gehabt, dass Jansen seine Leute, allerdings zum größten Teil erst nach Karlemanns Ideen, in allen körperlichen Künsten der Seemannschaft zu wahren Athleten ausgebildet hatte.
Was sie im Kampfe mit den wütenden Wogen leisteten, kann hier nicht geschildert werden. Aber an Land von den die Boote beobachtenden Seeleuten wurde es erkannt und anerkannt, durch zahllose Rufe der Bewunderung und mehr noch des grenzenlosesten Staunens.
»Das sind keine Menschen, das sind ja Teufel!!«, lautete die höchste Anerkennung, die nicht mehr übertroffen werden konnte.
Dann aber musste Jansen seine Ansicht wiederum ändern, musste erkennen, dass eine Rettung doch nicht möglich sei.
Ja, sein Boot als erstes war so weit an das Wrack gekommen, dass die Leine geworfen werden konnte. Aber was für einen Zweck hatte das?
Dass ein Boot hätte an dem Wrack anlegen können, dass war gänzlich ausgeschlossen. Es musste eine Verbindung zwischen Wrack und Booten durch eine Leine hergestellt werden, an der sich dann jeder einzelne durchs Wasser Hand über Hand herüberangelte.
Aber was Jansen da zu sehen bekam, wenn sein Boot so hoch oben auf einem Wellenberge schwebte, dass er das ganze Deck überblicken konnte, das spottet jeder Beschreibung.
Wer keinen Halt an dem letzten oder an dem stehengebliebenen Schornstein gefunden, dort sich zwischen Tauwerk und Ketten verstrickend, der hatte sich an die Kajütenwand gedrängt, wohl immer noch gegen fünfzig Menschen, Männer und Frauen und Kinder, zum großen Teil fast ganz nackt, weil sie sich im Kampfe um das Leben die Kleider vom Leibe gerissen hatten, noch jetzt sich gegenseitig umklammernd, was vielleicht nicht einmal mehr nötig gewesen, denn — — hier wie dort waren sie alle zusammengefroren, bildeten alle zusammen einen einzigen Eisklumpen. Und von diesem riesigen Eisklumpen brach dennoch jede Woge, welche diese Menschenmasse einmal erreichte, immer wieder ein Stück ab, es mit sich über Bord nehmend — und stets waren auch wieder einige Menschen weniger geworden!
Nein, dass diese Eingefrorenen fähig wären, noch die zugeworfene Leine zu fangen, sich an dieser durchs Wasser zu ziehen, daran war ebenfalls gar nicht zu denken. Einige schrien wohl, winkten, eine Frau, die kaum noch einige Fetzen eines Hemdes anhatte, hielt ihr nacktes Kind hoch — aber die meisten waren doch schon ganz sicher tot, wurden nur noch durch das Eis aufrecht gehalten, und auch die sich noch Regenden waren nicht der geringsten Anstrengung mehr fähig.
Und hinüber auf das Wrack, die Unglücklichen anseilen und so in die Boote ziehen?
Ach, das sind alles solche Mittel, die man sich so leicht ausklügeln kann, wenn man noch kein in der Brandung festsitzendes Wrack gesehen hat!
»Herr, du gnädiger Gott, erspare mir diesen nochmaligen Anblick!«, ächzte Jansen, als er wieder einmal mit seinem Boote von einem himmelhohen Wasserberge herunterrutschte.
Und dabei musste er sich sehr vorsehen, dass er nach der richtigen Seite herunterrutschte, nach der von dem Wrack abgekehrten, denn auf der anderen Seite, wohin das Boot auch immer mit aller Macht wollte, wäre es sofort zerschmettert worden.
Schon längst hatten die sämtlichen Boote gewendet, sodass also die Ruderer jetzt nach dem Wrack blickten. Zuerst hatten sie die furchtbarste Mühe gehabt, an dieses heranzukommen, und jetzt war es nicht anders, als ob die hölzernen Boote plötzlich von Eisen seien und der halbe Dampfer ein ungeheuerer Magnet, mit solch schier unwiderstehlicher Kraft wurden die Boote nach dort gezogen.
Das ist es ja eben, was die Annäherung an ein Wrack bei hoher See so gefährlich macht, das erfordert eine geschulte Rudermannschaft mit stählernen Muskeln und einen Steuermann, der Boot und Wogenprall kennt wie der Jockey sein Pferd.
Alle fünf Boote durften nicht nur stoppen, sondern mussten unausgesetzt mit Aufgebot aller Kraft abrudern, um eben nicht an das Wrack geschleudert zu werden, und dann bei der Rückkehr das Boot auch wirklich wieder zu entfernen, das bewirkte dann allein die Kunst des Steuerers, der die kommenden und gehenden Wogen zu berechnen verstand, und verstand er das nicht, dann...
»Pult, Jungens, pullt für euer Leben!!!«, brüllte da Jansen auf, nicht seiner Rudermannschaft zu, sondern der des zweiten Bootes, welches von Goliath gesteuert wurde.
Dieser hatte die Herrschaft über sein Boot verloren, nicht durch eigene Schuld, sondern einer der Ruderer hatte aufgegeben, wohl auch nicht freiwillig, nicht aus Mutlosigkeit — er war hintenüber geschlagen, wahrscheinlich von der Kälte überwältigt, vielleicht schon tot.
Es ist nicht unbedingt nötig, dass an jeder Seite des Bootes gleichviel Riemen sein, müssen. Man sieht oft genug Seeboote, in denen auf der einen Seite drei, auf der anderen nur zwei Mann rudern. Dadurch beschreibt das Boot nicht etwa einen Kreis, die Kraft der zwei Männer braucht auch nicht der der drei anderen zu entsprechen, sondern das muss der Bootsmann durch eine Idee von Schrägstellung des Steuers ausgleichen, und das Rudern auf bewegter See ist ja überhaupt so ganz anders als auf glattem Wasser.
Aber wieder anders hier! Das Versagen des einen Ruderers hatte genügt, um die anderen fünf Mann einmal aus den Takt zu bringen, nur für einen Augenblick — aber schon der wieder hatte genügt, um das Boot eine seitliche Drehung machen zu lassen — und da half alle Kunst Goliaths, den Jansen für den besten Steuerer hielt, nichts mehr — da ging das Boot schon hin wie ein Spielball, auf das Wrack zu, ein schmetternder Krach, und es war nicht mehr.
Alle anderen hatten es gesehen, aber die hatten nicht einmal Zeit, einen Schrei auszustoßen. Pullen, immer pullen!! — sonst konnte ihrer im nächsten Augenblick dasselbe Schicksal warten.
»Wieder sieben brave Jungens von der ›Sturmbraut‹ weniger!«, flüsterte Jansen, und dann gab er gleich wieder seine gewöhnlichen Ruderkommandos.
Abermals hob sich sein Boot hoch empor, doch diesmal blickte Jansen nicht nach dem Wrack, sondern nach dem Hafen, und er erkannte unter den vielen Schiffen auch seine ›Sturmbraut‹, aus deren Schornstein noch immer ein leichter Rauch emporwirbelte.
»Ich hab's, ich hab's!!«, jauchzte da plötzlich Jansen auf. »Und ich hole sie dennoch von dem Wrack!!!«
Da kam etwas Dunkles auf sein Boot zugetrieben. Schwimmende Leichen gab es hier genug. Aber wer so etwas schon einmal gesehen hat, der weiß, dass man bei solch hohem Seegange im Wasser gar nichts deutlich unterscheiden kann. Wie Phantome werden die Leichen oder die lebendigen Schwimmer oder sonstige Gegenstände hin und her geschleudert, man kann durchaus nicht unterscheiden, ob das dort ein Mensch oder ein Stück Holz ist — und kommt man in die Nähe, so fliegt eine Möwe auf.
Aber dieser dunkle Gegenstand trieb direkt auf Jansens Boot zu, zwei schwarze Hände klammerten sich am Rande fest, und dann tauchte etwas auf aus der weißen Gischt, auch etwas Schwarzes, das man ebenso gut für etwas anderes als für ein menschliches Gesicht halten konnte, so furchtbar waren Kinnlade und alles zerschmettert.
»Massa!«, röchelte es aus diesem unförmlichen Klumpen.
»Goliath, mein Goliath!«, jammerte Jansen, und er packte ihn hinten beim Rockkragen, hob ihn mit Riesenkraft empor — es war nur ein menschlicher Rumpf, ohne Beine.
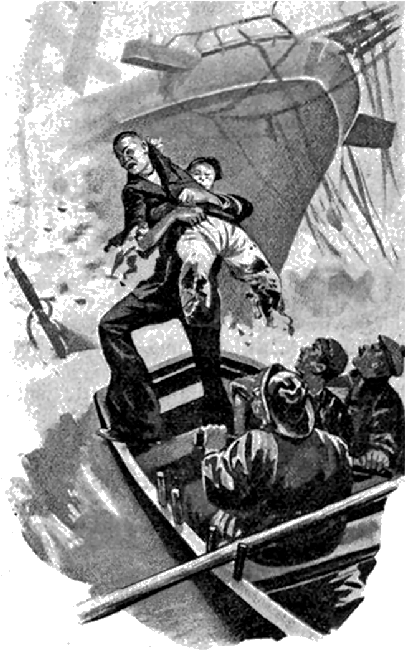
Und da schleuderte Jansen ihn, ohne noch ein Wort zu haben, nicht in sein Boot, sondern ins Meer zurück, und der Rumpf ward nicht mehr gesehen!
Ja, Jansen hatte recht getan — besser so! Das war Goliaths Ende gewesen, Jansen sollte noch später erfahren, wer dieser rätselhafte Neger, der ihm freiwillig als Sklave gedient, obwohl er mit seinen Kenntnissen doch eine ganz andere Rolle hätte spielen können, eigentlich gewesen war.
»Zurück nach dem Hafen!!«
»Nach dem Hafen?«
»Zurück! Pullt an!«
»Kapitän, wir wollen sterben wie Goliath und die anderen!«
»Ich kann die vom Wrack dennoch retten!«
»Wir wollen es nicht, wir wollen sterben.«
»Gehorcht, ihr Himmelhunde! Zurück nach dem Hafen!«
Und sie gehorchten.
An Land hatte man alles beobachten können, ohne ein Fernrohr gebrauchen zu müssen.
An dem ungeheuerlichen Wechsel der Situation, wie die zum Tode verurteilten Seeräuber, die eigentlich schon seit drei Stunden dort oben an den Rahen hätten hängen sollen, jetzt plötzlich als die letzten Retter in der Not betrachtet wurden, hatte niemand etwas Auffälliges gefunden.
Können diese braven Männer die Schiffbrüchigen retten oder nicht — das war das einzige, wovon jetzt alles beherrscht wurde.
Nur als Karlemanns zwerghafte Gesellen in die Boote gesprungen waren und sich gleich so wuchtig ins Zeug gelegt hatten, in Handhabung des schweren Riemens sich nicht vom herkulischsten Matrosen überbieten lassend, da war einem das Humoristische der Sache einmal zum Bewusstsein gekommen.
»Und die will man in eine Zwangserziehungsanstalt stecken? Hahahaha!!!«
Doch dann war keine Zeit mehr zum Lachen. Die vielen tausend Zuschauer sahen, wie wacker sich die fünf Boote durchkämpften — und als der alte Bob Snyder sagte, das brächte er nicht fertig, das könnten ja auch keine Menschen, sondern das müssten Teufel sein, da war auch der bigotteste bereit, diese Teufel anzubeten — und dann, als die Boote an das Wrack herangekommen, wurde gejauchzt und gejubelt, gar nicht an dem Jammer Beteiligte fielen einander in die Arme — und dann wieder furchtbare Niedergeschlagenheit, als man erkannte, wie der riesenhafte Seeräuberkapitän viele Dutzend Male die Leine vergeblich schleuderte, neue Verzweiflung, als die Sachverständigen erklärten, dass die auf dem Wrack ja gar nicht mehr imstande seien, die Rettungsleine zu benutzen, nur zu fassen — und dann ein einstimmiger Schrei des Entsetzens, als das eine Boot gegen das Wrack geschleudert wurde und auf Nimmerwiedersehen verschwand — — und dann wieder die furchtbarste Niedergeschlagenheit, als die vier übriggebliebenen Boote den Rückweg antraten.
»Auch diese Seeräuber, die sich dem Teufel verschrieben, haben es nicht fertiggebracht!«
Jetzt brach bei einigen satirischen Philosophen, die einen kalten Kopf behalten, doch der menschenverachtende Hohn hervor.
»Ja, da kommen sie, die Seeräuber — nun könnt ihr sie doch noch henken und euch daran weiden!«
Sie kamen, von Eiszapfen starrend. Bis zur Grenze der wütenden See hatten sie noch wacker gerudert, dann, wie sie das ruhige Wasser erreichten, wurden sie schlapp, und es war nicht zu verwundern.
Da sprang im ersten Boote der riesenhafte Kapitän auf.
»Pullt, ihr Himmelhunde, pullt!!!«, hörte man ihn wütend brüllen, und dann zur Pier hinüberwinkend: »Mut, Mut, ich hole sie dennoch! Meine ›Sturmbraut‹ klar, meine ›Sturmbraut‹ klar! Dampf auf. Dampf auf!!! Pullt, Jungens, lustig, Jungens, singt, Jungens: Wenn ick am Nordpol frieren tu, dann denk ick an dee Höll...«
In stumpfsinnigem Schweigen hatten die vielen tausend Zuschauer den zurückkehrenden vier Booten entgegengeblickt.
Wie den Ruderern die Arme, so waren denen plötzlich die Herzen wie gelähmt.
Da also war Jansen aufgesprungen, hatte ihnen jene Worte zugerufen — sie hatten nur einige wenige davon gehört oder verstanden: Mut, Mut, ich hole sie dennoch!!
Und wie plötzlich die erstarrten Bootsmannschaften unter Absingen eines gotteslästerlichen Ruderliedes die Riemen mit neuer Macht durchholten, als hätten sie nicht schon länger denn eine Stunde unter den fürchterlichsten Anstrengungen gerudert, so ging es durch die ganzen am Ufer stehenden Menschenmassen wie ein Blitz.
»Er will sie doch noch holen! Habt ihr's gehört? Er will sie dennoch retten!! Was sagte er von seiner ›Sturmbraut‹?«
Die Boote schossen heran, legten mit einer Schneidigkeit bei, als wären die Ruderer eben erst durch ein gutes Frühstück zum Landungsmanöver vor den Augen des Höchstkommandierenden vorbereitet worden.
Dann freilich war es mit den meisten vorbei. Die Eiskruste konnte sie doch nicht aufrecht halten, so fielen sie einfach von den Duchten und blieben liegen, wie sie lagen.
Nur wenige waren noch imstande, an Land zu kriechen, während Jansen, obgleich die Bootssteuerer sonst derselben Erschöpfung unterlagen, mit gleichen Füßen hinaufsprang.
»Auf, auf, ihr Himmelhunde, wir haben noch mehr zu tun! Ist meine › Sturmbraut‹ klar? Dampf auf! Dampf auf!!!«
Und während Jansen das mehr brüllte als schrie, lachte er im ganzen Gesicht.
Schnell war er von Hafenbeamten und anderen Seeleuten umringt, die hier zu entscheiden hatten — mit fliegenden Worten gab Jansen Aufklärung, was er beabsichtigte.
»Mit meiner ›Sturmbraut‹ hindampfen und das Wrack wegschlagen!«
»Wegschlagen?«, wurde verständnislos wiederholt.
»Na ja, ich schlage das ganze Wrack mit dem Steven oder mit dem Bug fort.«
Es war ein Glück, dass unter den Zuhörern einige waren, welche schon mehr Prophetengeist als besonderen Scharfsinn besaßen, sodass sie Jansen sofort verstanden.
Denn es war auch noch etwas viel Ungeheuerlicheres, als die Bootsfahrt nach dem Wrack, was Jansen jetzt zur Rettung der noch Lebenden versuchen wollte.
Ei wollte also mit seiner ›Sturmbraut‹ unter Dampf hinfahren und sie so dirigieren, dass sie, von einer Woge erfasst, dass ganze Wrack in Trümmer schlug, wonach die im Wasser Schwimmenden aufgefischt werden konnten.
Ganz hübsch ausgedacht, nicht wahr? Ja, in der Theorie war es auch ganz einfach.
»Mann, was Ihr da vorhabt, das ist ja ganz und gar unmöglich!!«
Der das rief, war ein früherer Kapitän und jetziger königlicher Hafenbeamter, der im ganzen Seewesen als Kapazität galt, nachdem er schon früher genug Proben seines außerordentlichen, an Tollkühnheit grenzenden Mutes gegeben hatte.
Aber weswegen das nun so ganz und gar unmöglich sein sollte, das freilich können wir dem Leser, der nicht selbst Seemann ist, nicht erklären. Da muss er einfach diesem kompetenten Sachverständigen glauben.
Oder man bedenke nur, wie mangelhaft es damals noch mit den Dampfern bestellt war. Schraubendampfer waren damals, wie schon mehrfach erwähnt, als unbrauchbar verworfen, diejenigen, welche die Meere befuhren, galten als Ausnahmen, bei denen man nur immer darauf wartete, dass sie doch noch ihre Unbrauchbarkeit bewiesen, und trat nun einmal dieser Fall ein, dann hieß es: Na ja, eben ein Schraubendampfer, wir haben es ja gleich gesagt!
»Es geht, es geht, ich weiß, was ich mit meiner ›Sturmbraut‹ leisten kann!!«, rief aber Jansen, merkwürdigerweise immer mit lachendem Munde.
Und dieser lachende Mund war es, der den Ausschlag gab. Das Lachen allein tat es freilich nicht. Es war das ganze glückstrahlende Siegesbewusstsein, das von dem riesenhaften Manne ausging, welches jedem solch eine Möglichkeit dennoch glaubhaft machte.
Und sollte man denn überhaupt ihm, der die Schiffbrüchigen retten wollte, irgendwelchen Widerstand entgegensetzen? Das war hier ein anderer Fall als damals, da Kolumbus versicherte, auch auf einer westlichen Fahrt nach Indien gelangen zu können — damals oder später, einmal wäre Amerika ja doch entdeckt worden, wenn nicht von Kolumbus, dann von einem anderen — hier aber forderte jede das Deck überspülende Woge neue Todesopfer, da war keine Minute zu verlieren.
Also dann vorwärts!
Und das sagten sich auch die ermattet zusammengebrochenen Bootsmannschaften, denen Jansen schon unterwegs mitgeteilt hatte, was er vorhabe.
Das allgemeine Zusammenbrechen war nur eine momentane Krise gewesen, so wie jeder in dem Augenblick die größte Müdigkeit empfindet, wenn er den Gipfel eines Berges erklommen hat; dieser braucht gar nicht so hoch zu sein.
Der Gedanke, noch einmal die Planken ihrer geliebten ›Sturmbraut‹ betreten zu können — als freie Männer! — brachte sie schnell genug wieder auf die Beine, und vorwärts in geschlossenem Zuge ging's nach der ›Sturmbraut‹, Madam Hullogan mit den großen Seestiefeln voran.
Es war gesagt worden, dass wohl alle Ohren und Nase erfroren hatten, viele jedenfalls auch Hände und Füße. Ja, dem war auch so. Aber wer schon einmal ein Ohr erfroren hat, der weiß, dass die Geschichte ganz anders ist, als derjenige denkt, welcher noch kein Ohr erfroren hat. Das kommt alles erst später zum Ausbruch, zunächst merkt man gar nichts davon, und ein erfrorenes Ohr bricht auch gar nicht so leicht ab — ach, wie viele ohrenlose Menschen liefen sonst herum! — und einer erfrorenen Hand oder einem erfrorenen Fuße fällt es erst recht nicht ein, gleich abzubrechen. Dass sie später sehr oft amputiert werden müssen, das ist wieder eine andere Sache.
Kurz, die ganze oder übriggebliebene Mannschaft der ›Sturmbraut‹ marschierte unter Anführung von Madam Hullogans Seestiefeln im Geschwindschritt nach ihrem Schiffe, als ginge es zum fröhlichen Tanze. Und einen Tanz sollte es ja auch noch geben.
Jansen hatte unterdessen erfahren, wie es mit der ›Sturmbraut‹ stand. Sie war, wie der moderne Ausdruck lautet, ›desarmiert‹ worden. Darunter versteht man aber nicht, dass nur die Kanonen entfernt werden, sondern alles muss heraus, alles, selbst das, was man sonst unter niet- und nagelfest versteht, wie z. B. die an Bord festgeschraubten Möbel, vor allen Dingen zuerst auch die Kompasse, dann Proviant, Trinkwasser und Kohlen — überhaupt alles, bis nur noch der nackte Rumpf übrig bleibt, wozu aber als Ausnahme Ruder und Steuerrad gehören. Oder auch nicht als Ausnahme, denn die müssen ja schon beim Stapellauf vorhanden sein, ebenso wie die volle Takelage, während Segel, Kompass, Chronometer und dergleichen noch fehlen.
Bis auf die Kohlen war man bei der ›Sturmbraut‹ schon gekommen. Sonst war schon alles entfernt, auch das Trinkwasser war bereits aus den Tanks gepumpt. Gestern war man mit der Entleerung der Kohlen, welche die ›Sturmbraut‹ bekanntlich mit Vorliebe als Ballast mitnahm, beschäftigt gewesen, bei Anbruch der Nacht hatten sich in dem einen Bunker nur noch wenige Tonnen befunden.
Um nun gleich die bequemste Arbeitskraft zur Hand zu haben, hatte man noch immer den Kessel gefeuert, um die Winden benützen zu können. Erst dann wären auch die Feuer ausgeblasen worden.
Heute war an eine Weiterarbeit natürlich nicht gedacht worden. Bei Tagesanbruch war ja jene Katastrophe erfolgt, und die Hinrichtung der Seeräuber brachte wohl überhaupt einen Feiertag mit sich.
So genau orientierte sich Jansen allerdings nicht über die Desarmierung seiner ›Sturmbraut‹. Ihm genügte, zu hören, dass sie noch dampffähig war, dass sich das Kesselwasser von gestern Abend noch unter hoher Dampfspannung befinden musste, und dass auch noch genügend Kohlen vorhanden waren, um den geplanten Rettungsversuch wagen zu können.
Im Übrigen muss betont werden, dass keine Minute Zeit zu verlieren war.
Als Jansen hinaufgeklettert war und das Deck seiner ›Sturmbraut‹ betrat, die wie ein hohles Ei dicht am Kai auf dem Wasser schwamm, glitt er auf dem Glatteis aus, wäre rückwärts zu Boden geschlagen, wenn hinter ihm nicht die Bordwand gewesen wäre — so fiel er vorwärts auf die Nase, und zwar ganz tüchtig.
Aber mit fröhlichem Lachen sprang er wieder auf.
»Hei, das war ein Kuss des Wiedersehens mit der geliebten Braut! Nun vorwärts, vorwärts, auf die Stationen!!«
Die Nachgekommenen kletterten herauf, sie wussten ja schon alles, was ihr Kapitän beabsichtigte, im Nu verschwanden Heizer und Maschinisten unter Deck, und während die Ventile geöffnet wurden, welche das Seewasser als Ballast in die Kohlenbunkers einließen, stieß der Schornstein schon mächtige Rauchwolken zum Himmel empor.
Zu alledem war ja viel, viel weniger Zeit gebraucht worden, als zu unserer Schilderung dieser Vorgänge. Seit Jansen den Hafenbeamten seine Absicht auseinandergesetzt, waren kaum fünf Minuten vergangen, als die ›Sturmbraut‹ schon bis zur normalen Wasserlinie gesunken war.
»Klar zur halben Kraft«, meldete gleichzeitig der Maschinist durch das Sprachrohr.
»Leinen, Leinen!«, rief Jansen. »Enoch, hast du genug Tauenden?«
»Es ist nix mehr da, Käpt'n.«
Nur einen Blick nach der Takelage.
»Schon gut. Los die Trossen! Viertelkraft voraus! Stopp! Rückwärts...«
Und die Verbindung mit dem Lande war gelöst, schon dampfte die › Sturmbraut‹ mit halber Kraft durch den Hafen.
Noch während dieser ruhigen Fahrt ließ Jansen alle entbehrlichen Taue in der Takelage abschneiden, wovon es beim laufenden Gut ja genug gibt — es seien nur die Fußpferde erwähnt, auf denen der Matrose beim Segelreffen steht — denn Jansen brauchte Taue, längere Seile, zu welchem Zwecke, werden wir gleich sehen, und er wollte nicht warten, bis man ihm solche von anderen Schiffen oder aus den Magazinen lieferte.
Nur fort, fort! — Denn dort draußen arbeiteten die eisigen Wogen nach wie vor an dem Wrack, auf welchem einige Dutzend Unglückliche noch immer verzweifelt auf ihre Rettung harrten.
Als die ›Sturmbraut‹ das ruhige Wasser hinter sich hatte, konnte voller Dampf gegeben werden — mit solchem ging es hinaus in die wütende See — und nun bekamen die Zuschauer etwas zu sehen! — denn das Schiff, welches für jeden echten Seemann nicht nur ein Gestell aus Holz oder Eisen ist, sondern ein mit einer Seele begabtes Wesen, erkannte die Hand seines Herrn und gehorchte ihm wie immer!
Noch viel war zu tun, während die stolze Jacht den wütenden Wogen bewies, dass sie die Braut dessen sei, nämlich des Sturmes, der jene erst so aufgeregt hatte.
Vor allen Dingen ließ Jansen die vorderen Tanks wieder etwas auspumpen, dagegen die hinteren etwas mehr füllen. Dadurch kam das Schwergewicht mehr nach hinten, wodurch die Fahrt zwar sehr beeinträchtigt wurde, die Schraube aber nicht so oft aus dem Wasser schlug, er daher das ganze Schiff mehr beherrschen konnte.
Und so erreichte man das Wrack, umfuhr es, lief von vorn wieder dagegen an.
Die nachfolgenden Manöver, die mindestens noch eine halbe Stunde in Anspruch nahmen, ehe das Wagnis glückte oder überhaupt nur auszuführen war, können wir hier nicht schildern.
Jedenfalls war es furchtbar, und vielleicht noch schrecklicher sah es vom Lande aus, wie das große Schiff immer so dicht neben dem Wrack und neben der steinernen Mole in der Brandung operierte, immer vorwärts und wieder zurück, in jeder Sekunde manchmal dreimal bedroht, im nächsten Moment in lauter kleine Eisensplitter zu zerbersten.
Aber die ›Sturmbraut‹ wusste eben, wer ihre Zügel führte, wer am Sprachrohr kommandierte. Doch seien auch die wirklichen Lebewesen nicht vergessen, zumal nicht die Maschinisten, ohne deren Disziplin und Kaltblütigkeit, wie sie dem leisesten Ruf gehorchten, wie sie die Ventile handhabten, überhaupt nichts zu erreichen gewesen wäre.
Und dann endlich hatte Jansen seine ›Sturmbraut‹ so weit, wie er sie haben wollte — dort die sich heranwälzende Woge musste die letzte Arbeit verrichten — freilich das durch Berechnung herausfinden, das war es! — und die ungeheuere Woge kam und fasste die ›Sturmbraut‹ und schleuderte sie seitwärts — und zwar so, dass sie gerade mit ihrem vordersten Teile das Wrack rammte.
Ein schmetternder Krach, und auch die letzte Hälfte der ›Frankia‹ war verschwunden.
Und nun noch ein schrecklicher Kampf mit der Brandung, welche das rettende, allen irdischen und himmlischen Mächten trotzende Schiff durchaus auf die Mole haben wollte — aber sein Steuerer hatte keinen Moment verpasst, sein Kommando war keinen Moment zu spät gekommen — die rückwärts wirbelnde Schraube fasste, die ›Sturmbraut‹ ging zurück, war gerettet.
Doch das war nur die letzte Arbeit des ersten Teiles gewesen. Auf dem Wrack hatten sich noch immer einige Dutzend zusammengefrorene Menschen befunden.
O, diese Augen, welche nach dem für ihre Rettung kämpfenden Schiffe geblickt hatten!
Und diese Menschen lagen jetzt alle im Wasser, wurden von den Wogen zwischen Trümmern aller Art hin und her geschleudert, wurden an der Mole durch die Wucht des Anpralls zermalmt.
Also im nächsten Augenblick, da Jansen das Schiff wieder in seiner Gewalt hatte, nochmals vorwärts, so nahe wie möglich an die schaumbedeckte Mole heran — und da sprangen gegen ein Dutzend Matrosen, große wie kleine, an langen Seilen befestigt kopfüber von Bord, sich dabei als Ziel alles wählend, was mit einem Menschenkörper Ähnlichkeit hatte.
Das war es, was Jansen geplant, wie er sich die letzte Bergung der im Wasser Schwimmenden gedacht! Hätte er von diesem seinen Plane zu jenen Sachverständigen am Lande gesprochen, man hätte ihn trotz allen Ernstes der Situation ausgelacht — oder ihn für wahnsinnig gehalten.
Doch das tollkühnste Wagnis des lächerlichen Wahnsinns sollte gelingen!
Also die an Leinen befestigten Helden waren gesprungen, und es waren meist lebendige Menschen, die sie mit sicherem Griffe packten.
Dann wurden sie wieder heraufgezogen. Freilich ist das leichter gesagt als getan, ganz abgesehen davon, dass jeder dabei noch eine menschliche Last in den Armen hatte. Heraufgerissen mussten sie werden, ehe sie am eisernen Rumpfe der ›Sturmbraut‹ zerschellten.
Aber dem Kühnen soll ja viel gelingen. Es gelang auch diesen, den großen wie den kleinen Helden. Kein Finger wurde gequetscht. Und wer eine Leiche erwischt hatte, der sprang gleich noch einmal, und auch andere taten es, die schon einen Lebenden herausgebracht.
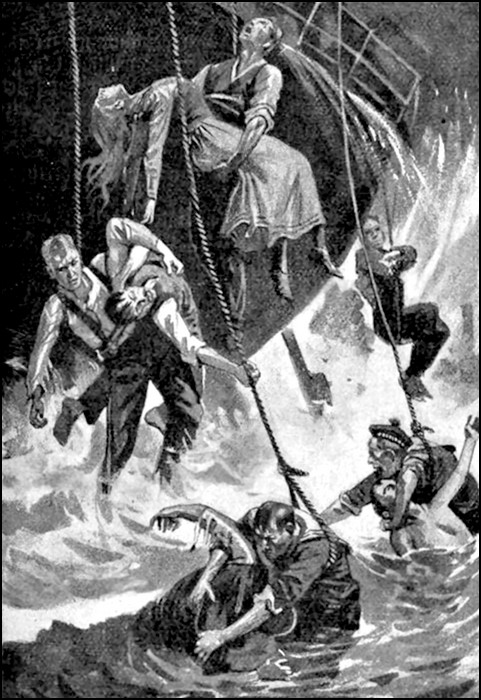
Jansen konnte dabei nicht den gemütlichen Zuschauer spielen. Er hatte das sich bäumende Schiff zu halten, das sich durchaus auf die Spitze der Mole stürzen wollte.
Und nach zehn Minuten hatte es wohl auch keinen Zweck mehr, noch nach Lebenden zu spähen.
»Wie viele?«, fragte Jansen.
Es klang wie ein Röcheln.
Enoch zählte schnell die irgendwo Untergebrachten, wo sie zunächst auftauen mussten.
»Achtundzwanzig.«
»Lebende?«
»Nur lebendige, vorläufig wenigstens — die toten habe ich nicht gezählt.«
»Kapitän, was ist Euch?!«, rief der neben Jansen stehende Martin.
Jener wurde plötzlich blass wie der Tod. Ach, er hatte, wenn auch nur am Ruder und am Sprachrohr stehend, in diesen wenigen Minuten vielleicht mehr geleistet als alle die anderen zusammen.
»Achtund — zwanzig, es — ist — genug«, brachte Jansen mühsam hervor, und dann wieder mit voller Lunge durch das Sprachrohr gedonnert:
»Volldampf rückwärts!!«
Die ›Sturmbraut‹ gehorchte, war bald außer jeder Gefahr.
»Martin — übernehmt das — Steuer — ich — kann nicht — mehr — nur fünf Minuten...«
Wankenden Schrittes ging Jansen nach der Treppe und... stürzte kopfüber die ganze Treppe hinab.
Welche Magistratsperson den Befehl gegeben, dass in Portsmouth alle Kirchenglocken geläutet wurden, wusste später niemand mehr zu sagen.
Ein ganz und gar von Aberglauben durchseuchter Mensch behauptete dann steif und fest, sie hätten, als dies ›Seeräuberschiff‹ zurückgekommen sei, von allein zu läuten begonnen.
Übrigens hatte das Glockenläuten gar keinen Zweck, denn es wurde gar nicht gehört, dermaßen johlte das tobende Volk.
Das ›Seeräuberschiff‹ hatte wieder am Kai beigelegt und lieferte ab, was es lebendig aufgefischt hatte oder, um einen beliebten Seemannsausdruck zu gebrauchen: dem blanken Hans aus den Zähnen gerückt.
Achtundzwanzig lebende Menschen. Von fünfhundert Passagieren und sechzig Mann Besatzung nicht eben viel — aber doch besser als nichts. Wie viele davon Männer oder Frauen oder Kinder waren, tut nichts zur Sache, und es ist auch ganz gleichgültig, ob die Gattin und die Kinder des High Sheriffs dabei waren, oder ob die Decke, die jetzt um eine nackte Gestalt geschlagen wurde, nur einen armen Kohlenzieher von der ›Frankia‹ verhüllte. Sie kamen alle wie aus dem Mutterleibe.
Jansen sollte solche Einzelheiten auch gar nicht erfahren. Er stand schon wieder auf der Kommandobrücke. Der Sturz von der Treppe hatte seinem harten Schädel nichts geschadet. Und er lachte auch schon wieder im ganzen Gesicht. Aber es war kein irdisches Lachen. Und solche Gesichter zeigten auch alle anderen. Gerade, als ob sie den Himmel offen gesehen hätten. Sogar der krummbeinige Enoch, wie er seine schnauzbärtige Hullogan anblickte.
Der letzte, in herbeigebrachte Decken gehüllte Körper war von sorgsamen Händen an Land getragen worden.
»Kapitän, Kapitäään!!«, flüsterte da der einarmige Mahlsdorf, auch mit so einem verklärten Engelsangesicht, nur dass seine Pausbacken von hineingestopftem Kautabak herrührten.
»Ruhig, Mahlsdorf, ich weiß schon«, lächelte Jansen mit außergewöhnlicher Freundlichkeit bei solchen Gelegenheiten, und rief dann im Kommandotone zum Teil durch das Sprachrohr: »Los die Trossen!! Viertelkraft vorwärts! Stopp!! Die Korkfänder mehr nach achtern, ihr blutigen Himmelhunde! Viertelkraft rückwärts...«
Die ›Sturmbraut‹ löste sich ab vom Kai, steuerte durch den Hafen und ging mit voller Dampfkraft wieder in das wilde Meer hinaus.
Zuerst hatte man nur beobachtet.
Der Dampfer wollte wohl seine Lage verändern.
Weshalb denn das?
Schade! Gerade hatten die ersten an Deck stürmen wollen, um die ›Seeräuber‹, die eigentlich schon seit fünf Stunden hätten dort oben baumeln müssen, zu umarmen, zu küssen und Gott weiß was sonst noch.
Ein Glück nur, dass sie noch lebten!
Na, da musste man eben warten, bis die ›Sturmbraut‹ anderswo beilegte.
»Die will doch nicht etwa mitten im Hafen verankern?«
»Sie haben ja gar keine Anker mehr.«
»Ja, wohin wollen die denn sonst?«
»Die gehen doch wieder aufs offene Meer hinaus?!«
»Die wollen wohl noch mehr Schiffbrüchige zu retten suchen?«
»Gibt's ja gar nicht.«
»Oder die denken doch nicht etwa, wir wollen sie noch...«
Die Unruhe wurde zum Tumult, dieser, als man erkannte, dass die ›Sturmbraut‹ tatsächlich auf die hohe See hinausging, verwandelte sich in lähmendes Staunen, und dann brach der Aufruhr erst recht los.
»Es ist ja gar nicht möglich, die brauchen doch keine Angst mehr zu haben!!«
Solche und ähnliche Ausrufe, zum Teil sehr naive, fielen noch mehr.
Ein blaublütiger Gentleman, der als Augenzeuge vom königlichen Hofe gekommen war, sprang vor, winkte und schrie, als könne er von der fast schon verschwindenden ›Sturmbraut‹ noch gesehen und gehört werden.
»Kapitän Jansen, Kapitän Jansen, was tun Sie denn? So kommen Sie doch nur!!!«
Dabei steckte er die andere Hand gewohnheitsmäßig, wie Engländer es nun einmal lieben, in die Hosentasche. Oder vielleicht hielt er darin auch schon ein paar Orden bereit, die man ihm gleich mitgegeben.
Aber da half kein Locken mehr — — Kapitän Jansen war mit seiner ›Sturmbraut‹ seewärts ahoi gegangen!
Richard Jansen hat in seinem später angelegten Tagebuche viele, viele Seiten damit verschwendet, um zu erklären, was ihn damals zu seiner fluchtähnlichen Ausfahrt aus Portsmouth bewog.
Er hat es nicht mit Worten erklären können.
Sollen wir es versuchen? Nein, das können wir nicht.
Aber etwas anderes fällt uns bei dieser Gelegenheit ein.
Wie hieß denn eigentlich der barmherzige Samariter? Oder hat der etwa den von Räubern Geschlagenen, dessen Wunden er mit Öl und Wein wusch, nach Namen und Adresse gefragt, um ihm dann die Rechnung präsentieren zu können?
Es ist dies durchaus kein passendes Gleichnis für Jansens Tat. Und dennoch!
Aber Jansen gibt selbst, nachdem er die Unmöglichkeit einer wirklichen Erklärung für sein rätselhaftes Verhalten eingesehen hat, ein anderes Gleichnis, ein Selbsterlebnis aus seiner Jugendzeit, was wir hier auch mit seinen eigenen Worten wiedergeben wollen:
»Ich war noch ein Kind, da war es nicht nur für uns junges Volk, sondern für das ganze Nest ein Ereignis, dass ein Zigeuner beim Betteln festgenommen und ins Spritzenhaus gesteckt wurde, von wo die Gendarmerie ihn am nächsten Morgen nach Danzig bringen sollte. Der noch ziemlich junge, zerlumpte Mann, dem wir bei seiner Abführung nachliefen, war eigentlich gar kein Zigeuner, vielmehr sicher ein guter Deutscher, aber damals wurde alles ›Zigeuner‹ genannt, was sich bettelnd auf der Landstraße herumtrieb, und auf diesen verwahrlosten Mann hier mit den langen Haaren, von der Sonne verbrannt, dass auch die Winterkälte ihn nicht wieder bleichen konnte, passte diese Bezeichnung ja auch so ziemlich, mehr noch seinem Charakter nach, den er bald offenbaren sollte, wie auf all dieses fahrende Volk, welches mit den Zigeunern die Arbeitsscheu und Rastlosigkeit teilt.
Der Mann konnte von Glück sagen, dass er am Abend in unser gutes Spritzenhaus kam. Es war eine bitterkalte Nacht, und der Tagedieb war dermaßen verwahrlost und unsauber, dass ihm auch das mitleidvollste Weib kein Nachtquartier gewährt hätte, er hätte höchstens in einem offenen Schuppen schlafen müssen, wo er höchstwahrscheinlich erfroren wäre, während man ihm im Spritzenhaus genügend Decken geben musste, nachdem er auch eine warme Suppe und reichlich Brot erhalten hatte.
In der Nacht brach der Strolch aus. Er hatte die wohlverschlossene Tür mit der Geschicklichkeit eines Zigeuners zu öffnen verstanden. Merkwürdig war, nicht ganz einem Zigeuner entsprechend, dass er keine Decke mitgenommen hatte, gar nichts.
Wie sich später herausstellte, erfolgte seine Flucht in der zehnten Stunde, für den Winter schon vollkommene Nacht. Der größte Taugenichts im ganzen Dorfe war, meine Wenigkeit ausgenommen, der Sohn des Bürgermeisters, welchen Ehrentitel der Vorsteher des ansehnlichen Ortes erhalten hatte. Ludwig war wieder einmal heimlich aus dem Fenster gestiegen, um im Mühlenteiche Karpfen zu fischen, unter dem Eise, aus dem für die im Winterschlafe liegenden Fische offengelassenen Luftloche heraus. Dabei war mein Ludwig selbst in dieses Loch gefallen, gleich so erstarrt gewesen, dass er sich nicht allein heraushelfen konnte; seine schwachen Hilferufe verhallten in der einsamen Gegend, er war des Todes.
Nur einer vernahm die Hilferufe — der vorbeischleichende Zigeuner. Er befreite den Jungen unter den größten Anstrengungen aus dem Eisloche, fragte ihn, wer er sei, nämlich um zu erfahren, ob er von diesem Dorfe sei, sonst hätte er ihn wahrscheinlich zurückgebracht — der kirre gewordene Ludwig gestand, wer er sei, gleichzeitig himmelhoch bittend, ihn nicht zu verraten — der Zigeuner setzte seinen Weg fort, Ludwig schmuggelte sich in sein Bett zurück.
Am anderen Morgen entdeckte man die Flucht des Zigeuners, aber auch Ludwigs Abenteuer ward ruchbar, wie der Zigeuner ihn gerettet habe.
Patrouillen wurden nach allen Richtungen ausgeschickt, um den Flüchtling zu suchen, aber nicht, um ihn ins Spritzenhaus zurückzubringen, um ihn der Gendarmerie auszuliefern, und es wäre ja auch gar nicht nötig gewesen, dass gerade unser Bürgermeister das Herz auf dem rechten Flecke gehabt.
Endlich fand man den Zigeuner denn auch mittels eines Spürhundes. Er musste in der Nacht noch ungefähr vier Stunden gelaufen sein, dann hatte er sich ermüdet ins Gebüsch gelegt, auf den hartgefrorenen Schnee. So fand man ihn schlafend — im Todesschlafe. Er war erfroren.
Warum, frage ich nun, hat dieser Zigeuner den geretteten Jungen nicht zu seinen Eltern gebracht? Solch ein weltbewanderter Mann weiß doch ganz genau, was für eine Belohnung da seiner wartet. Und der Strolch hatte Papiere gehabt, er war nur immer wegen Bettelns bestraft worden. Weshalb hatte er da auf alles verzichtet, weshalb hatte er seine Flucht fortgesetzt? Eben weil er ein echter Zigeuner war, der nichts weiter haben will, als seine Freiheit.
Oftmals noch habe ich an diesen germanischen Zigeuner gedacht, am stärksten jetzt wieder, da ich für mein damaliges Verhalten eine Erklärung suche, und eine andere als dieses Beispiel kann ich als Gleichnis auch nicht geben.« — —
Ja, es war heller Wahnsinn gewesen, dass Jansen nach jener rettenden Tat, als sich ihm schon alle Hände zum überströmenden Danke entgegenstreckten, einfach Reißaus genommen hatte.
Merkwürdig nur, dass auch alle die anderen fünfunddreißig Menschen, welche sich auf der ›Sturmbraut‹ befanden, von genau demselben Wahnsinn angesteckt worden waren. Denn keinem einzigen war eingefallen, dem Kapitän auf die Sinnlosigkeit seines Vorgehens aufmerksam zu machen, was doch wenigstens die Offiziere bei solch einer Gelegenheit hätten tun können — im Gegenteil, Mahlsdorf selbst hatte den Kapitän, als er ihn so geheimnisvoll anflüsterte, erst dazu bestimmen wollen, jetzt schleunigst mit Volldampf davonzufahren, und wir wollen gleich sagen, dass er im Sinne aller anderen gesprochen hätte. Sie alle fanden diese Flucht eben ganz selbstverständlich, dachten auch gar nicht hinterher an eine Rückkehr.
Und für so dumm, dass jemand glaubte, man könne ihn noch nachträglich hängen oder ihn auch nur für eine Stunde noch einsperren, wird man wohl auch nicht den beschränktesten Kopf halten, der sich an Bord der ›Sturmbraut‹ befand.
Nein, sie alle wussten recht gut, was sie getan, was sie jetzt zu erwarten gehabt, und... sie befanden sich alle in einer Art Freudentaumel.
Was hatten sie getan?
Etwas, was der Prediger Salomo nicht mit aufführt unter all den vielen Dingen und Tätigkeiten, welche alle ihre Zeit haben.
O, es ist wunderbar, dieses dritte Kapitel des Predigers Salomo. Man wird es kennen, oder man schlage es einmal auf.
Da wird am Anfange dieses Kapitels umständlich aufgezählt, was alles seine Zeit hat. Mit geboren werden und sterben fängt das lange Register an, mit Streit und Friede hört es auf. Dazwischen sind ganz sonderbare Dinge angeführt, und da das ›hat seine Zeit‹ hinter einem langen Striche steht, so hat man das auch immer dazuzusetzen. Pflanzen hat seine Zeit — ausrotten, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; Steine sammeln hat seine Zeit — Steine zerstreuen hat seine Zeit.
Was soll das bedeuten? Das ist einfach Unsinn, leeres Gewäsch. So denkt man noch nicht als Kind. Da denkt man sich beim Lesen dieses Kapitels überhaupt noch gar nichts.
Man wird älter, man liest dieses Kapitel noch einmal — wahrscheinlich nur zufällig — und da kommt man eben zu jener Ansicht.
Zerreißen hat seine Zeit — zunähen hat seine Zeit — das ist ja leeres Gewäsch!!
Und bei dieser Ansicht bleiben wohl, leider, die meisten Menschen, so ungefähr neunhundertneunundneunzig von tausend, bis sie die zweite Nummer des aufgestellten Programms erfüllen, bis sie ins Grab fahren.
Aber dem Tausendsten, der nicht etwa ein Gelehrter zu sein braucht, gewöhnlich sogar ist er das Gegenteil davon, vielleicht ein armer Tagelöhner, der kaum seinen Namen schreiben kann — — dem geht plötzlich, in der Nacht, eine Ahnung und dann die Gewissheit auf, dass er da etwas von einer Weisheit gelesen hat, welche nur Gott selbst einem Menschen offenbaren konnte!
Ja, glaubt man denn etwa, dass König Salomo, als er sagte, dass zerreißen und zunähen seine Zeit habe, dabei an seine zerrissenen Hosen gedacht hat?
Und doch, es muss gesagt werden, denn solche naive Menschen gibt es wirklich genug, und das sind dann gerade die, die sich sehr klug dünken.
Steine sammeln hat seine Zeit, und Steine zerstreuen hat seine Zeit.
Wo ist denn jetzt der kolossale Turm von Babel? Mit dem, was davon noch vorhanden, könnte man ihn nicht wieder aufbauen, das gäbe ein sehr kleines Türmchen. Die herumwohnenden Araber bauen sich von den Steinen ihre Häuser, backen sich zwischen den Steinen ihre Durrafladen, und die übrigen werden zerstreut in alle Welt, kommen ins britische und in andere Museen, und jeder die Trümmerstätte besuchende Reisende klopft sich ein Stückchen ab und nimmt es als Andenken mit.
Das ist das Schicksal des Turmes, welcher alle Völker für die Ewigkeit zusammenhalten sollte!
Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit.
Es gab einst ein Deutschland unter Karl dem Großen, unter Karl dem Fünften und noch unter anderen Kaisern. Immer wieder wurde es einmal zerrissen, und immer wieder wurde es zusammengenäht. Der letzte, der die einzelnen Fetzen wieder einmal zusammenflickte, war Bismarck.
Aber wird das so weitergehen? Nein, auch das hat seine Zeit! Du allmächtiges Perserreich, wo bist du denn geblieben? Und du, großer Alexander, und du, Cäsar, die ihr die ganze damals bekannte Welt erobertet, wo sind denn die Früchte eurer Siege? Es hat alles seine Zeit, und... es ist alles, alles ganz eitel!
Ja, es ist alles, alles ganz eitel! Das, was damals als die größten Taten bewundert wurde, von Geschichtsforschern und vielen anderen Menschen noch heute bewundert wird, das hat alles absolut keinen Zweck gehabt! Es wird gesagt, dass durch solche Eroberungszüge die Kultur nach entfernteren Ländern getragen wurde, dass wir sonst noch gar nicht so weit wären, wie wir heute sind, dass zum Beispiel auch die Kreuzzüge uns viel Nützliches aus dem Orient gebracht hätten.
Aber das ist eine leere Sophisterei, welche sofort widerlegt werden könnte, wozu aber hier nicht der Ort ist. Wer sich dafür interessiert, mag den Thomas Carlyle lesen.
Ach, wir selbst haben es ja in unseren Tagen erlebt! Als der alte ExPräsident Paul Krüger am Ende seiner Laufbahn das Werk seines ganzen Lebens, welches er doch gewiss für gut und segensreich gehalten hat, zusammenbrechen sah, ob da nicht auch dieser so fromme, bibelfeste Mann aus tiefster Überzeugung gesagt hat: Es war alles, alles ganz eitel!
Ja, gibt es denn keine ewige Gerechtigkeit? Gewiss gibt es die! Aber nicht für so etwas. Wer soll denn auf der Stelle hierfür bestraft werden, wenn einmal so ein ganzes Reich zertreten wird? Das macht im Weltall, das von der ewigen Gerechtigkeit regiert wird, auch nicht den geringsten Unterschied aus. Nach wie vor geht die Sonne alltäglich auf über Gerechte und Ungerechte, deshalb verändert kein Stern nur um den millionsten Teil einer Linie seine Bahn.
Eine furchtbare Revolution, die ein ganzes Reich vernichtet und ein anderes wieder auferstehen lässt, oder mit einem Ruck einen Stein umwälzen, wodurch ein Käferlein zerdrückt wird — es ist genau dasselbe!
Wir kleinen Menschlein lassen uns nur immer durch die für uns scheinbar so großen Dimensionunterschiede blenden.
Alles vergeht und ist eitel. Ja, gibt es denn gar nichts, was festen Bestand hat und nicht eitel ist? Gewiss gibt es das.
An einem Winterabend ging ein Mann durch die Straßen, in seinem dünnen Kittel frierend, kaum noch Sohlen unter den Füßen. Er war jung und stark und arbeitswillig, aber er hatte schon seit längerer Zeit keine Arbeit gefunden. Er musste betteln, so furchtbar schwer ihm das auch fiel. Nur wenn er schon dem Hungertode nahe war, konnte er jemanden um eine Gabe ansprechen. Soeben hatte er von einer mitleidigen Seele ein Stück Brot und einen Groschen extra geschenkt erhalten. Oder vielmehr ein Penny ist es gewesen. Das Brot wurde sofort gegessen, und mit dem Penny in der Tasche wanderte der junge Mann nun einem Orte zu, wo er wusste, für diesen Penny eine warme Lagerstätte zu bekommen. Freilich nicht zwischen Eiderdaunen. Immerhin, er brauchte diese kalte Nacht nicht wie gewöhnlich in einer unverschlossenen Hausflur oder gar auf einer Parkbank zu verbringen.
Da hörte er aus einer Mauernische ein Winseln. Ein Weib, welches die Vorübergehenden um eine Gabe anflehte, das heißt, anflehen wollte, es aber kaum wagte. Ebenfalls noch ziemlich jung, aber ganz anders als der junge Mann, der seine roten Backen noch nicht verloren. Bleich und elend, ganz gebrochen. Wahrscheinlich im Leichtsinn von zu Hause weggelaufen. Doch das ist ja ganz gleichgültig, ob verschuldet oder unverschuldet — eben fremd in der großen Stadt, nicht betteln könnend, vor Kälte und Hunger dem Tode nahe. Das zu sehen, genügte für jenen Mann, schnell griff er in die Tasche und gab ihr seinen Penny, brachte sie hin, wo sie dafür eine Brotsuppe und eine Decke bekam. Dann ging er weiter, um sich eine offene Haustür zu suchen. Aber er brauchte sie nicht, er hätte doch nicht schlafen können. Die ganze Nacht ist er durch die Straßen gewandert. Gefroren hat er nicht mehr. Es war ihm mit einem Male so warm ums Herz geworden, ach, so wunderschön warm, und diese Wärme ging ihm durch den ganzen Körper, und die über ihm funkelnden Sterne sahen mit einem Male ganz anders aus, das war kein kaltes Gefunkel mehr, sondern sie lächelten plötzlich so warm auf ihn herab — und der Mann blickte noch über diese Sterne, er sah mit verzückten Augen den ganzen Himmel offen — und da sah er, wie in das Buch der ewigen Gerechtigkeit etwas eingetragen ward, was nicht eitel ist, sondern ewigen Bestand hat!
Geneigter Leser, du weißt, was hiermit gesagt werden soll. Der erste Brief von Paulus an die Korinther ist eigentlich recht fade. Es ist sein schwächstes Schreiben. Immer Vorwürfe und sich fortgesetzt wiederholende Ermahnungen — es sieht aus, als hätte Paulus nur den einmal angefangenen Briefbogen voll machen wollen.
Und da plötzlich bricht zwischen diesen dürren Worten eine ganz andere Stimme hervor, wie aus einer anderen Welt, wie Sphärenmusik mit Begleitung von schmetternden Engelsposaunen erklingt plötzlich das dreizehnte Kapitel: Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete, und ich hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts als ein tönend Erz. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse, und wenn ich Berge versetzen könnte, und ich hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und ich hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze.
O, ist das herrlich, herrlich!
Suche die ganze menschliche Literatur durch von den indischen Veden an bis herauf zu den modernsten Philosophen, ob du irgendwo solche furchtbar packende Worte über die Liebe findest.
Wie ist Paulus eigentlich dazu gekommen, in seinem sonst so trockenen Briefe plötzlich solch himmlische Worte anzustimmen? Denn mit dem anderen Inhalte des ganzen Briefes steht dieses dreizehnte Kapitel ja in absolut keinem Zusammenhange.
Da ist Paulus gewiss beim Briefschreiben einmal unterbrochen worden, und er hat inzwischen eine gute Tat getan.
Ja, das ist es! Die Liebe — und die aus dieser Liebe entspringenden Taten!
Alles, alles andere ist eitel.
Freilich hat der Prediger gesagt, dass auch Lieben seine Zeit habe. Aber indem er als Gegenteil gleich das Hassen hinzusetzt, wird gezeigt, dass hiermit jene Liebe gemeint ist, welche wir mit allen Tieren teilen.
Paulus aber meint eine ganz andere Liebe. Auch schon die Liebe der Mutter, der Gattin und der Braut gehört hierher — denn beim Weibe findet man sie viel häufiger, als beim Manne — jene Liebe, von welcher der in andere Regionen versetzte und verzückte Paulus sagt: sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles.
Kann man denn nur etwas Herrlicheres finden, um zu schildern, wessen ein edles Weib in seiner Liebe zum erwählten Manne fähig ist? Sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles, alles, alles!!
Und doch gibt es immer noch eine andere Liebe, welche mit dieser Welt gar nichts zu tun hat, welche wahrhaft göttlich ist. Ach, dass unsere Sprache doch so arm ist! Sie ist eben Menschenwerk.
Jene Liebe, von der Paulus sagt, dass sie nimmer aufhöret, so doch die Weissagungen und die Sprachen aufhören werden — mit anderen Worten: so doch die ganze Welt in Trümmern gehen wird, ein Weltkörper nach dem anderen, denn auch das sind Steine, die einmal aufgebaut und dann wieder zerstreut werden. Die Liebe aber höret nimmer auf, sie allein ist das ewig Beständige.
Wer diese Liebe einmal gefühlt und ausgeübt hat, der weiß, was wahrhaftes Glück ist. Alles, alles andere ist ganz eitel.
Freilich haben diese Liebe und die daraus entspringende Seligkeit auch ihre Steigerungen. Es fängt damit an, dass man etwa ein beleidigendes Wort verzeiht, nicht aus kluger Vernunft — das ist eitel, der Lohn ist dahin — sondern aus einem plötzlich überströmenden Herzen, eben in der plötzlichen Erkenntnis, dass eine solche verzeihende Liebe in dieser Welt das einzigste Reelle ist; eine weit höhere Stufe mag sein, dass man mit Hintansetzung von Leben und Gesundheit und allen anderen Folgen einen Menschen vom Tode errettet, das Allerhöchste aber ist wohl, wenn jemand seiner ganzen Lebenshoffnung entsagt, um dadurch einen anderen Menschen glücklich machen zu können.
Wer so etwas getan, für den öffnet sich der Himmel. Wer so etwas noch nicht gefühlt, der weiß nicht, was Glück ist, er weiß noch nicht einmal, was leben ist.
Die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ wusste recht wohl, was sie getan.
Ein Werk, das nicht eitel war und nicht nur für kurze Zeit bestehen würde, sondern bis in alle Ewigkeit hinein, wenn dieses Werk auch unsichtbar für Menschenaugen war.
Und auch die Früchte dieses Werkes genossen sie mit ganzer, himmlischer Wollust.
Sie, die schon juckend den Brand einziehen fühlten, der ihnen Hände und Füße abfaulen lassen würde, wenn diese nicht rechtzeitig amputiert wurden — sie befanden sich in einem Wonnetaumel, waren wirklich wie berauscht.
Wer solch ein unbeschreibliches Glücksempfinden hat, sucht es auf irgendeine Weise auszudrücken. Am leichtesten hat es wohl, wer musikalisch ist, das Reich der Töne beherrscht. Auf dem Klavier etwa mag man solch ein inneres Glücksempfinden ausdrücken können — ungefähr.
Die hier, von denen wir sprechen, waren der Hauptsache nach Matrosen. Ihr Glücksempfinden war genau dasselbe, dessen nach solch einer Tat ein Mann fähig gewesen, der alle Kenntnisse dieser Erde besaß. Darin ist kein Unterschied. Aber im Ausdruck ihres Glücksempfindens waren es Matrosen. Sie benahmen sich wie Matrosen im Rausche, sie lachten und jauchzten wie Matrosen und mussten ihrem unbändigen Glück in Matrosenwitzen Luft machen, sich dabei wie Matrosen betragend.
Da stand einer gebückt an der Bordwand, ein anderer sah es, schlich sich leise hin, spuckte in seine gespreizte Bärenpfote, und dann knallte er dem Freunde eins hinten drauf, dass ein anderer Sterblicher gleich in die Brüche gegangen wäre, und wie der Getroffene nur ein wenig überrascht herumfuhr, da blickte er mit lachendem Gesicht in ein anderes lachendes Gesicht, und nun die Hände in die Hosentaschen gesteckt und mit breitem Behagen gesagt:
»Na, Hein, mien Jung, wat seggst!«
Das war für diesen Matrosen dasselbe, als wenn ein anderer in seliger Verzückung den Saiten seine eigene Sinfonie entlockt. »Kinder, nun seid endlich vernünftig«, sagte Jansen lachend. Wohl seit drei Stunden hatte er von der Kommandobrücke aus zugesehen, wie Madam Hullogan Irish Jig tanzte und ihrem Partner, ihrem Manne, immer mit den Seestiefeln gegen die geschweiften Schienbeine treten wollte, was ihr aber nicht gelang, denn Enoch tanzte nicht wie damals mit sauertöpfischem Gesicht, sondern er schlenkerte wacker seine Türkenbeine, grölte und juchzte, wie es sich eben für einen irischen Jig gehört.
»Kinder, nun seid endlich vernünftig«, lachte also Jansen, wie er schon seit drei Stunden gelacht hatte, und brachte sie auseinander.
Doch seine Ermahnung galt für alle anderen, welche sich nicht minder ausgelassen betrugen.
Was sich an Deck befand, mit Ausnahme der beiden auf der Kommandobrücke stehenden Offiziere und des Mannes am Ruder, sammelte sich alles um den Kapitän.
»Kinder, was fangen wir nun an?«
»Erst einmal etwas essen. Ich habe einen ganz bannigen Hunger.«
»Vorher aber noch einen Grog, den haben wir uns wohl verdient!«
Es waren Matrosen, welche dies zu ihrem Kapitän sagten. Eigentlich etwas ganz Ungeheuerliches, während des Dienstes an Deck. Aber so ehern die Schranke an Bord auch sein mag, es können doch Gelegenheiten kommen, da sie durchbrochen wird. Von einer Undisziplin braucht ja deshalb keine Rede zu sein.
»Ja, essen und Grog trinken«, lachte Jansen nach wie vor, »hat sich was! Die ›Sturmbraut‹ ist desarmiert worden.«
Es war kein Matrose darunter, der die Bedeutung dieses Wortes nicht gekannt hätte, und sie machten doch etwas erschrockene Gesichter.
»Vollständig desarmiert?!«
»Ausgenommen und ausgeweidet wie ein Huhn, und noch viel schlimmer. Bei einem ausgenommenen Huhn hat man doch noch die Hauptsache, aber die Planken der ›Sturmbraut‹ dürften schwer verdaulich sein.«
»Ja, ich habe schon gemerkt, dass die ganze Kombüse ausgeräumt ist«, meinte Smutje, »ich dachte, die Töpfe wären anderswo untergebracht worden.«
»Gib dir keine Mühe, sie zu suchen. Du findest an Bord kein Stück irgendwelcher Art.«
Auch die anderen hatten wohl schon gemerkt, dass ihre Foxel vollständig ausgeräumt, die Bibliothek und alles verschwunden war, in ihrem Seligkeitstaumel aber gar nicht weiter darauf geachtet.
»Das ist ja eine nette Geschichte! Wo sind wir denn eigentlich?«
»Was weiß ich? Hier gibt's keinen Sextanten mehr.«
»Wie lange sind wir denn schon gedampft?«
»Hat jemand noch eine Uhr?«
Wer eine besessen, dem war sie in der Untersuchungshaft abgenommen worden.
Der immer lachende Jansen hatte hiermit ja auch nur sagen wollen, dass ihnen alles und jedes fehle.
»Kapitän«, rief da Mahlsdorf auf der Kommandobrücke, »aus dem Heizraum wird gemeldet, dass soeben der letzte Korb Kohlen angeschleift wird.«
Da erschrak auch Jansen etwas.
»Was?! Ich denke, Kohlen sind noch genug da!«
»Der letzte Korb, in zehn Minuten ist er verbraucht.«
»Sapperlot! Dann löscht lieber die Feuer.«
Mit einem Male aber fing er wieder zu lachen an.
»So, Jungens, jetzt können wir Robinsons spielen. Wir sind auf einem jungfräulichen Eiland, nur dass es schwimmt. Nun strenge jeder seine Geisteskräfte an, wie wir uns am Leben erhalten und unsere Lage immer verbessern, also geradeso wie Robinson Crusoe es gemacht hat.«
Es war Tatsache. Sie befanden sich in keiner anderen Lage als Schiffbrüchige auf einer nackten Felseninsel, auf der keine Möwe nistet, auf der sich nicht einmal Regenwasser ansammelt.
Denn sie hatten ja gar keine Möglichkeit, solches aufzufangen, konnten nur auf einen Schneefall hoffen. Vier Schaufeln und zwei Karren unten im Heizraum, ihre Anzüge und schließlich die Messer, die sie sich hatten geben lassen, schon als sie die Bootsfahrt angetreten, das war alles, was sie besaßen, nicht einmal Boote mehr.
Doch diese eigentümlichen Schiffbrüchigen, die sich sonst auf einem noch ganz soliden Schiffe befanden, fassten ihre Lage durchaus nicht tragisch auf, im Gegenteil, der erste Schreck machte schnell wieder einer ungeheueren Heiterkeit Platz.
»Recht so, recht so, nun sind wir erst die richtigen Seezigeuner!!«, erklang es jubelnd im Chore.
Denn sie wollten sich nun einmal lieber mit Zigeunern vergleichen, als mit Robinsons, und wenn man sich Zigeuner nicht anders vorstellen kann als ein zerlumptes, bettelndes Volk, dann hatten sie auch wirklich recht.
Noch immer hatte niemand die Frage gestellt, weshalb ihr Kapitän eigentlich den Hafen von Portsmouth verlassen hatte, und was Jansen dann zu ihnen sagte, wäre gar nicht nötig gewesen; denn er äußerte nichts weiter, als was jeder einzelne in seinem eigenen Herzen dachte.
»Ja, meine lieben Jungens, es war eine große Dummheit von mir, dass ich vorhin gleich absegelte. Weshalb ich das getan habe, kann ich selber nicht sagen — weil — weil — weil — es drängte mich aber etwas dazu — ich konnte gar nicht anders handeln...
»All right, Käpt'n, all right, wir wissen schon«, erklang es im Chore, immer im Jubel, der schließlich ebenso schwer zu erklären gewesen wäre. Aber wir haben deshalb ja schon Worte genug verschwendet.
»Also, da hilft es nichts, nun müssen wir Robinsons spielen.«
»Seezigeuner, Seezigeuner!!«
»Meinetwegen Seezigeuner, wenn wir die auch schon immer gewesen sind.«
»Nun fängt's aber erst richtig an«, wurde nach wie vor gelacht. »Wir mögen drei Stunden gedampft sein, immer mit voller Kraft, immer westlich. Das ist das einzige, was ich bestimmt weiß.«
»Ein Robinson darf überhaupt nicht wissen, wo er sich befindet«, ließ sich lachend Martin von der Kommandobrücke vernehmen.
»So befinden wir uns etwa dreißig Meilen von Portsmouth entfernt und haben keine Möglichkeit, nach dort zurückzukehren.«
»Fällt uns ja auch gar nicht ein!!!«, erklang es im Chore. »Dann müssen wir einen anderen Hafen anlaufen.«
»Wozu denn nur?«
»Wir brauchen doch Proviant.«
»Wir rufen das erste Schiff an, das uns in Sicht kommt.«
»Und lassen uns ins Schlepptau nehmen?«
»Niemals, niemals! Wir betteln uns so durch, bis wir imstande sind, nach unserer Fucusinsel zu kommen, wo wir uns wieder verproviantieren und aus der ›Indianarwa‹ uns auch sonst vollständig ausrüsten können.«
Genau so dachte Jansen. Er hatte nur einmal die Meinung seiner Leute hören wollen. Also sich ganz durch eigene Kraft forthelfen! Wirklich, es macht Spaß — besonders, wenn man solch einen Zigeunercharakter hat.
Man hatte während der dreistündigen Fahrt einige Segel zu sehen bekommen, anfangs ziemlich viel, sie wurden immer spärlicher, jetzt war kein einziges in Sicht, obgleich der Ärmelkanal doch das befahrenste Gewässer der Erde sein soll.
Das stimmt ja auch, aber doch nur zwischen der Linie Dover und Calais, wo sich die Küsten auf wenige Meilen nähern, kann man gleich ganze Trupps von Schiffen sehen, zumal sich diese doch immer so in der Mitte halten.
Hier aber, wo man schon Cherbourg hinter sich hatte, war der Kanal etwa vierzig geografische Meilen breit, im Quadrat hätte das eine Fläche gegeben größer als ganz Belgien, und wenn sich auf dieser zurzeit dreihundert Schiffe befanden, so war es nur ein Zufall, wenn eines das andere erblickte.
In dieser Hinsicht befand sich die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ doch in einer höchst üblen Lage. Es war später Nachmittag, seit ihrer Henkersmahlzeit gestern Abend hatten sie noch keinen Bissen genossen, sie wurden schon seit längerer Zeit von wirklichem Hunger geplagt, den sie nur während der unerhörten Anstrengungen vergessen hatten, dann auch während ihres Freudentaumels. Jetzt aber kam er zum Durchbruch.
Der einzige Trost war, dass jeder eine gute Portion Kautabak bei sich hatte. Denn dieses Labsal aller Seeleute war den Untersuchungsgefangenen nicht verweigert worden, die letzte Ration hatten sie erst vorgestern gefasst. Hierbei sei erwähnt, dass da mit den Piraten nicht etwa eine Ausnahme gemacht worden war. In England erhalten alle Strafgefangenen Kautabak, zum Teil ja auch in deutschen Anstalten — in Amerika gibt es sogar wöchentlich eine Unze = ¹/16 Pfund Rauchtabak.
Auch mit Wasser waren sie vorläufig versehen. Der Kessel war im Hafen mit Frischwasser gespeist worden.
»Ein Segel!«, erklang da der Ruf, noch ehe man weiter zu beraten brauchte, was in dieser Kalamität zu geschehen habe.
Es war nicht eigentlich ein Segel, sondern eine Rauchwolke, welche am westlichen Horizonte auftauchte, bald konnte man auch drei Masten unterscheiden, denen der ganze Rumpf eines großen Schiffes nachfolgte.
»Ein Kriegsschiff!«
»Es führt die englische Flagge!«, konnte der, der die schärfsten Augen besaß, alsbald hinzufügen.
Die Aufregung war groß, und die verschiedensten Fragen wurden aufgeworfen.
»Ob die aber auch schon wissen, was unterdessen geschehen ist?«
»Wenn es aus einem englischen Hafen kommt, sicher, denn das ist doch schon überallhin telegrafiert worden.«
»Wenn es aber nun von einer weiten Reise kommt? Oder wenn es nur acht Stunden schon auf See ist?«
»Na, wir werden uns verständigen können.«
Darüber also machten sie sich nicht die geringste Sorge. Sie waren sich eben bewusst, was sie getan, und hielten es mit Recht für ganz selbstverständlich, dass sich jedes Schiff zur höchsten Ehre anrechnen würde, der ›Sturmbraut‹ aushelfen zu dürfen, und war dem Kapitän noch nichts von der ganzen Katastrophe bekannt, so bedurfte es doch nur einiger aufklärenden Worte.
Schnell wurde beraten, was man als das Notwendigste gebrauchte. Vor allen Dingen Proviant soviel wie möglich, dann Segel, welche jedes Schiff zur Reserve führt, vielleicht auch Kohlen. Dann aber war noch an vieles, vieles andere zu denken, und man musste alles, was man zu erbitten hätte, im Kopfe behalten.
Da alles so ganz, ganz anders kommen sollte, brauchen wir auch diese Vorbereitungen und Erwägungen nicht näher zu schildern.
Hauptsache war, dass die Möglichkeit vorhanden, mit dem Schiffe Bord an Bord zu kommen. Hier draußen war die See nämlich viel weniger aufgeregt, sie tobte ihre letzte Kraft nur noch an den Küsten aus. Für ein geschultes Kriegsschiff war es eine Kleinigkeit, ein anderes anzusegeln und mit Enterhaken eine feste Verbindung herzustellen. Die ›Sturmbraut‹ musste sich dabei ja fast ganz passiv verhalten.
Das englische Kriegsschiff, eine gedeckte Korvette, war fast schon in Rufweite gekommen, als sie endlich Flaggen zeigte.
»Was für ein Schiff ist das?«, lautete die Frage.
Jansen stand schon am Ende der Kommandobrücke, semaphorierte mit den Armen, und es war noch hell genug, um jede seiner Bewegungen deutlich erkennen zu können, schon mit bloßen Augen, so wie er ja selbst kein Fernrohr auf die Flaggen hatte richten können.
»Hier ›Sturmbraut‹, Kapitän Jansen«, war schnell semaphoriert. Drüben eine ungeheuere Aufregung, die begreiflich war, ob die nun schon von der Katastrophe und der Rettungstat wussten oder nicht.
Es wurden Kommandos gegeben, die aber noch nicht zu verstehen waren, die Matrosen liefen durcheinander, verteilten sich.
»›Sturmbraut‹ von Portsmouth?«, wurde dann durch Flaggen gefragt.
»Ja«, semaphorierte Jansen zurück.
Da drüben keine neuen Flaggen hochgingen, wollte er gleich seine Wünsche anbringen.
»Wir sind...«
Weiter kam er in seinen Armbewegungen nicht.
»Hallo, was ist denn das?!«, schrie er bestürzt.
Drüben waren längs der Bordwand weiße Rauchwölkchen aufgewirbelt, wohl ein Dutzend, und die Matrosen kannten deren Bedeutung recht gut; im ersten Augenblick waren sie wie gelähmt, und zu weiteren Äußerungen sollten sie auch nicht kommen.
Gleichzeitig mit den Schallwellen, welche das Donnern der Geschütze
herüberbrachte, waren auch schon die Granaten da, und sie hatten gut gezielt, die ›Sturmbraut‹ bäumte sich wie ein zu Tode getroffener Widder, während andere Geschosse das ganze Deck rasierten, verschwunden war die Kombüse, ein Mast brach zusammen...
»Die Hunde beschießen uns!«, konnte Jansen nur noch stöhnen. Da krepierte eine Granate am Fuße des Schornsteins, gellende Schmerzensschreie, ein letztes Röcheln — der erstarrte Jansen sah noch seine Getreuen sich an Deck wälzen, sah Gliedmaßen durch die Luft fliegen, sah, wie die Hullogan in zwei Stücke gerissen wurde — da brach unter einem Kanonendonner die Kommandobrücke zusammen, und mit Jansen als letztem Mann war die ganze ›Sturmbraut‹ verschwunden, diesmal für immer!
Durch die finstere Nacht fuhr pfeilschnell eine Illumination. Solch eine Illumination, wenn man sich so ausdrücken darf, ist bei Nachtzeit wohl jedes Schiff, wenn alle Räume erleuchtet sind, besonders beim Passagierdampfer alle Kabinen. Die kleinen, runden Bullaugen, wenn sie so rot erglühen, machen ganz den Eindruck einer festlichen Illumination.
Es konnte nur ein kleiner Dampfer sein, musste aber eine für damalige Zeiten außerordentlich starke Maschine haben, dass er so schnell die Wellen durchschnitt.
Am vordersten Top führte er das vorschriftsmäßige weiße Licht, das bei Nacht den Dampfer charakterisiert, außerdem aber noch daneben je ein rotes Licht, und jedes Kauffahrteischiff, jeder Fischer, der dieses Feuersignal sah, kannte dessen Bedeutung, und unter den verschiedensten Gefühlen ward immer dieselbe Frage laut:
»Ein englischer Aviso — was für eine Order mag er haben?!«
Denn was für den Offizier die Adjutantenschärpe ist, das ist für das Kriegsschiff bei Tage der besondere Wimpel, bei Nacht das dreifarbige Toplicht, für England rotweißrot.
Aber es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob ein einzelner Mann mit Vollmacht betraut ist, oder ob ein Man of War, ein ganzes Kriegsschiff, mit geheimer Order durch die Meere jagt. Was für eine Order kann das sein?
Tiefster Frieden liegt über Europa. Da fällt dem russischen Zaren ein, den englischen Gesandten nicht zu empfangen, weist ihm mit einem beleidigenden Worte die Tür — ein doppelter Depeschenwechsel hin und her, der Krieg ist erklärt, in einer Stunde weiß es ganz England und Russland, so weit es durch Telegraf erreichbar ist, schon rüstet sich alles zum Kampfe, morgen weiß es schon die ganze Welt.
Aber die Schiffe wissen es nicht, welche sich auf dem Meere befinden. Und da gehen die Avisos ab, so viele nur aufzubringen sind. Gerade hier im Kanal ist die schnellste Benachrichtigung von höchster Wichtigkeit, kann vielleicht den ganzen Krieg entscheiden. Denn der Kanal dient ja auch der russischen Kriegs- und Handelsflotte als Passage nach dem offenen Ozean. Da also können noch viele ahnungslose russische Kriegsschiffe vernichtet und Kauffahrer gekapert werden.
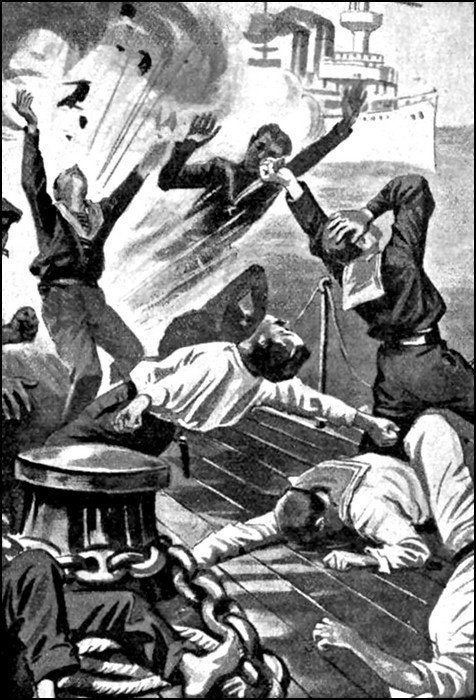
Das ist nur ein Beispiel. Jedes Schiff und Fahrzeug bekam schnell genug zu wissen, weshalb dieser englische Aviso durch den Kanal hin und her kreuzte.
Nachdem er sich den Namen eines gesichteten Schiffes durch Feuersignale hatte melden lassen, stellte er stets die Frage, ob es die ›Sturmbraut‹ gesehen habe.
Die ›Sturmbraut‹ war ja schon zu bekannt, als dass man nicht immer gleich gewusst hätte, um welches Schiff es sich gehandelt habe, die meisten wussten ja auch, dass das Seeräuberschiff jetzt unter Siegel in Portsmouth lag, von da war es jedenfalls durch diese verwegene Bande unter Kapitän Jansen wieder entführt worden — aber jedes Schiff konnte diese Frage nur verneinen.
Auch Kriegsschiffe wurden von dem Aviso befragt, englische wie andere; mit diesen, welche besser zur farbigen Lichtersprache eingerichtet, konnte man sich besser unterhalten; aber der Aviso erhielt auf seine Frage nur immer eine Verneinung. Die ›Sturmbraut‹ war von keinem gesichtet worden.
Da wieder die Toplaterne eines Dampfers. Er konnte kaum das rotweißrote Signalement des Avisos erkannt haben, als er sich schnell als englisches Kriegsschiff meldete — ›H. M. S. Victoria‹.
Am Fockmast des Avisos begannen die farbigen Lichter zu spielen.
»Ist Kapitän Jansens ›Sturmbraut‹ gesehen worden?«
Drüben ließ die Antwort nicht lange auf sich warten.
»Heute kurz vor fünf von mir in den Grund geschossen worden, Lord Frankmore.«
Der Kommandant auf dem Aviso brauchte nicht neben sich den Steuermannsmaaten mit dem Signalbuch zu haben, er hatte alle diese Zeichen im Kopfe, und nachdem er die Bedeutung der einzelnen Lichtsignale buchstabiert, starrte er die aus der Nacht auftauchenden bunten Feuer wie eine Erscheinung aus dem Jenseits an.
»Was — was sagen die da?!«, wandte er sich jetzt doch an den Signalgast.
»Heute kurz vor fünf von mir in den Grund geschossen worden, Lord Frankmore«, konnte dieser nur wiederholen.
»Die ›Sturmbraut‹ in den Grund geschossen?! Die ›Victoria‹ ist doch erst heute Mittag von Plymouth abgegangen.«
»Die Herren Offiziere sprachen davon.«
»Das ist wohl ein Irrtum! Lord Frankmore meint etwas ganz anderes!«
Aber der Kommandant des Avisos ließ sich nicht erst in ein weiteres Gespräch durch Signalfeuer ein, gab nur noch den Befehl, dass die ›Victoria‹ stoppe und ihn im Boot erwarte, ließ dieses aussetzen, konnte kaum erwarten, hinein- und hinüberzukommen.
Die ›Victoria‹ war ein Schlachtschiff erster Klasse, ihr Kommandant ein Kapitän zur See, also im Range eines Obersten, und Lord Archim Frankmore war aus königlichem Geblüt, ein Liebling der Königin, ein Liebling der Götter, die ihn mit allem gesegnet, was ein ehrgeiziger Mensch nur begehren kann; er stand kurz vor seiner Ernennung zum Admiral, er galt anerkanntermaßen als zukünftiger Chefadmiral der ganzen englischen Kriegsflotte — der Kommandant des Avisos hieß einfach Fred Müller und war nur Kapitänleutnant, jetzt aber war er eben ein Adjutant Ihrer Majestät und mehr noch, und als solcher wurde er beim Betreten des Decks mit jenen Ehrenbezeugungen empfangen, die sonst nur der Königin gebührten.
Lord Frankmore kam ihm entgegen.
»Sie haben die ›Sturmbraut‹ gesichtet?«
»Ja, und sie in den Grund geschossen.«
Wie sich der Kapitän weit vorbeugte, so drohten seine Augen die Höhlen zu verlassen.
»In den... Grund geschossen?!«
»Wie die Order lautete.«
»Eine Order? Welche Order?«
Der Irrtum klärte sich bald auf.
Es war wieder einmal ein verstümmeltes Telegramm gewesen, welches der ›Sturmbraut‹ den Untergang bereitet hatte.
Ach, was für Unheil haben solche Telegramme schon angerichtet!
Im sudanesischen Feldzuge ging Scherlan vor, anstatt zurück, wie ein Telegramm es befohlen, und seine Truppen wurden infolgedessen bis auf den letzten Mann vernichtet.
Die Belagerung der arabischen Hafenstadt Aberltor sollte aufgegeben werden — durch ein einziges falsch wiedergegebenes Depeschenwort ward sie in den Grund geschossen.
Das sind nur zwei Beispiele aus dem englischen Telegrafenreich.
Die Katastrophe der ›Frankia‹ war natürlich sofort telegrafisch nach London berichtet worden, nach dort ging Depesche nach Depesche ab, erst von London aus konnten sie über ganz England verbreitet werden, so also auch nach Plymouth.
Da hatte es denn auch geheißen:
»Die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ geht in die Boote, um die Schiffbrüchigen zu retten.«
Während der nachfolgenden Szenen, wie die ›Seeräuber‹ mit den Wogen und mit dem Wrack gerungen, hatte aber auch der pflichtgetreueste und der zeilengierigste Reporter nicht daran gedacht, seiner Zeitung über den weiteren Verlauf der Rettungsarbeit zu berichten, die Spannung war eben eine gar zu lähmende gewesen, und als dann die Boote erfolglos zurückgekehrt, war die heldenmütige Mannschaft doch gleich wieder mit ihrer ›Sturmbraut‹ davongefahren, um die Rettung auf eine andere Weise zu versuchen.
Diese war gelungen. Achtundzwanzig gerettete Menschen brachte sie zurück, um gleich wieder davonzufahren. Und nun erst kam Leben in die Erstarrten, unter den Zeitungsberichterstattern begann ein Wettlauf nach der Telegrafenstation.
So kurz wie möglich. Und der, dessen Telegramm dann nach Plymouth gelangte, mochte vergessen haben, dass er schon vorher immer das Telegrafieren vergessen hatte. Außerdem war jetzt das das Sensationellste, dass sich die ›Sturmbraut‹ so plötzlich wieder entfernt hatte, ohne den Dank abzuwarten.
Kurz, nach Plymouth gelangte über London ein Telegramm, aus dem man fast entnehmen konnte, Kapitän Jansen hätte sich mit seinen Leuten in die Boote begeben, scheinbar um den Schiffbrüchigen Hilfe zu bringen, in Wirklichkeit um sich durch List und Gewalt wieder in den Besitz seiner ›Sturmbraut‹ zu bringen, was ihm auch gelungen war, und dann war er eben in die See gegangen, war glücklich entkommen.
In diesem Sinne wurde dann auch die Depesche von der ersten Zeitung, an die sie gerichtet, aufgefasst, die Geschichte in diesem Sinne gleich noch weiter ausgesponnen.
Die Seeräuber, die schon den Strick um den Hals gehabt, hatten sich als echte Halunken benommen. Durch jene Katastrophe wurde ihre Hinrichtung verschoben, Kapitän Jansen erbot sich, mit seinen Leuten die Schiffbrüchigen zu retten, natürlich unter der Bedingung, dass er und seine Leute Amnestie erhielten, man traute ihm und seiner verwegenen Bande, man gab ihnen alles, was sie forderten, auch ihre noch unter Dampf liegende ›Sturmbraut‹ — aber anstatt dem Wrack zu Hilfe zu kommen, waren die freigegebenen Verbrecher und Todeskandidaten mit ihrem Schiffe heidi! in die offene See gegangen.
So lautete der erste Bericht, der durch Extrablatt in Plymouth verbreitet wurde.
Ist solch eine Entstellung etwa eine noch nie da gewesene Ungeheuerlichkeit? Ach, wenn man alle Beispiele heranziehen wollte, was in dieser Hinsicht schon geleistet worden ist! Es würde eine Geschichte der Blamagen unseres ganzen Zeitungswesens sein.
Und dann lief in Plymouth auch eine behördliche Depesche ein, welche ebenfalls nicht auf die Errettung der Schiffbrüchigen Bezug nahm, sondern nur auf die so ganz undefinierbare Entweichung der Helden mit ihrer ›Sturmbraut‹, und hier nun hatte sich ein direkter Fehler eingeschlichen, oder die Depesche war verstümmelt worden, wahrscheinlich erst in Plymouth, wo man eben ganz sicher annahm, dass Kapitän Jansen mit seinen Leuten sich durch einen heimtückischen Halunkenstreich befreit hätte.
Es war natürlich eine englisch abgefasste Depesche gewesen, und wir können, hier diesen vielleicht durch einen Gleichklang zweier Worte entstandenen Irrtum nicht näher angeben. So wollen wir es in deutscher Sprache versuchen.
Die Hauptsache war, dass die verschwundene ›Sturmbraut‹ aufgesucht werden sollte und... »sie ist sofort zu berichten.«
Daraus hatte man gemacht: »Die ›Sturmbraut‹ ist sofort zu vernichten.«
So ungefähr kann man den Irrtum im Deutschen wiedergeben. Die in Plymouth liegende ›Victoria‹ hatte sich eben zur Fahrt nach Portsmouth anschicken wollen. Der Kommandant hatte das Extrablatt gelesen, hatte auch noch die Order bekommen, nicht schriftlich, sondern mündlich von seiner vorgesetzten Behörde: Wo die ›Sturmbraut‹ angetroffen wird, ist sie sofort in Grund zu schießen!
So war die ›Victoria‹ abgegangen. Der Zufall hatte gewollt, dass gerade sie zuerst das Schiff gesichtet, das sich mit beispielloser und dennoch bei ihm schon bekannter Ungeniertheit gleich als ›Sturmbraut‹ zu erkennen gab, und... Lord Frankmore hatte seiner Order gehorcht.
Er hatte das entwichene Seeräuberschiff beschossen.
Einige Unterwasserschüsse hatten es sofort zum Sinken gebracht, nachdem einige Granaten auch an Deck Verwüstung angerichtet.
Ein Auffischen der im Wasser Schwimmenden hatte der Kommandant wohl angeordnet, doch war es von vornherein ganz zwecklos gewesen.
Man befand sich gerade in einer starken Strömung, welche alles mit fortriss, was nicht schon durch den Strudel mit in die Tiefe hinabgezogen worden war, außerdem brach soeben die Dunkelheit an — eben wegen dieser Strömung hatten sich die Boote gar nicht weit von dem Kriegsschiffe entfernen dürfen, sie kehrten zurück, ohne irgend etwas von der ›Sturmbraut‹ aufgefischt zu haben. — — —
Was die beiden Offiziere hier voneinander erfuhren, dazu waren weit weniger Worte notwendig.
Wer von den beiden ob des Gehörten furchtbarer bestürzt war, das war schwer zu entscheiden.
Jetzt war es Lord Frankmore, der sich weit vorbeugte, und dessen Augen die Höhlen zu verlassen drohten.
»Es — ist — nicht — möglich!!«, konnte er nur immer wieder stöhnen, nachdem auch er schon den wirklichen Sachverhalt erfahren, wie die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ dennoch die Rettung bewirkt.
»O, furchtbarer Irrtum!!«, konnte wiederum der Kommandant des Avisos immer nur ächzen.
»Nur gesucht sollte sie werden?«
»Um sie nach Portsmouth zurückzubringen, um sie unter dem Geläute der Kirchenglocken zu empfangen, um diesen Helden vollkommene Amnestie zu erteilen!«
»Vollkommene Amnestie?«
»Sie können noch daran zweifeln?! Hier, hier...«
Der von ehrlichem Schmerze überwältigte Kapitänleutnant konnte nicht weitersprechen. Er hatte schon zuvor aus seiner Brusttasche einen großen Brief gezogen gehabt, ihn immer in der Hand gehalten, jetzt drehte er ihn um — Lord Frankmore sah das königliche Siegel — und er las die Aufschrift:
»An den Honorable Sir Richard Jansen.«
Und als ob dem Lord, der bisher alles so geistesabwesend wiederholt hatte, erst beim Lesen dieses Titels die ganze, furchtbare Wahrheit aufginge, so wandte er sich plötzlich und schritt seiner Kajüte zu.
»Sic transit gloria mundi! So gehet unter der Ruhm der Welt.«
Es waren die letzten Worte, die man von ihm gehört.
Dann knallte ein Schuss. Lord Frankmore hatte sich eine Kugel durch den Kopf gejagt.
War dieser Selbstmord auch durch nichts gerechtfertigt, so war es doch auch keine Tat der Feigheit gewesen. Vielleicht eher eine Tat der Klugheit.
Jene Worte vom untergehenden Ruhme der Welt hatte Lord Frankmore jedenfalls auf sich selbst bezogen. Denn wir haben schon vorhin erwähnt, welch ein Liebling der Götter dieser noch junge Edelmann war, welche Aussichten ihm winkten.
Hatte er etwa schon geahnt, was für einen Empfang man ihm, wenn er in Portsmouth lebendig angekommen wäre, bereitet hätte?
Gewiss, man hätte ihm verziehen. Man hätte ihm ja überhaupt gar keine Vorwürfe machen können. Er hatte nichts als seine Pflicht getan, für den ganzen Irrtum konnte er doch nichts.
Aber... es ist eben ein eigentümliches Ding um die Volksgunst. Und hier umfasst der Begriff ›Volk‹ alle Schichten, auch die allerobersten.
Schon durch die Ernennung des Seeräuberkapitäns zum englischen Baronet, war seitens der Königin dieser allgemeinen Stimmung Ausdruck gegeben worden.
Orden und dergleichen Auszeichnungen müssen, wenn die Gelegenheit dazu ist, schnellstens ausgeteilt werden, womöglich gleich an Ort und Stelle, dadurch gewinnen sie an Wert, bei der Festtafel sowohl wie auf dem Schlachtfelde. Oder, wie ein geistreicher Kopf die Orden so fein klassifiziert hat: die erdienten Orden sowohl wie die erdienerten und die erdinierten.
Die Königin war natürlich sofort benachrichtigt worden, wie es dem Kapitän Richard Jansen mit seiner heldenmütigen Mannschaft doch noch gelungen war, achtundzwanzig Menschenleben von dem Wrack zu retten, wie sie ständig mit Portsmouth in telegrafischer Verbindung gewesen war, sich immer alles berichten lassend, und da war nichts vergessen worden.
Was nun tun? Wie diese braven Männer ehren?
Aber schnell, sofort musste es geschehen!
Eine Amnestie, eine vollständige Begnadigung der schon zum Tode Verurteilten konnte auch die Königin nicht gewähren, nicht so ohne weiteres, das musste alles seinen formellen Weg nehmen.
Dass diese Braven nun begnadigt waren — und wie! — das war ja ganz selbstverständlich, aber jetzt handelte es sich um eine Anerkennung, um eine schnelle Anerkennung!
Und einen Mann zum englischen Ritter ernennen, das kann die Königin augenblicklich!
Also das Dokument aufgesetzt und mit dem Eilboten hin nach Portsmouth gesandt!
Da war die ›Sturmbraut‹ schon wieder in See gegangen. Man wartete noch immer auf ihre Rückkehr, weil man ihre fluchtähnliche Abfahrt sich so gar nicht erklären konnte.
Dann kamen andere Befehle.
»Avisos hinausgeschickt, die ›Sturmbraut‹ gesucht!«
Und der erste Aviso, der Volldampf gehabt, hatte das königliche Dokument mitbekommen.
Als Lord Frankmore die Adresse gelesen, die den von ihm vernichteten Seeräuber zum Baronet ernannte, da war er gegangen, um sich eine Kugel vor den Kopf zu schießen.
Er wusste, dass er etwas getan, was nicht wieder gutzumachen war. Ein grausames Verhängnis hatte eine ungeheuere Schuld auf ihn gewälzt, deren Last er noch immer fühlen würde, auch nachdem sie ihm abgenommen worden wäre.
Da war er lieber abgetreten von der Bühne, auf der er noch eine so große Rolle hätte spielen sollen.
Sic transit, gloria mundi!
Der Liebling Englands und der Götter hatte es gewiss auf sich bezogen — das Wort konnte aber ebenso gut für Jansen gelten.
Ja, es war gut, dass Lord Frankmore Portsmouth nicht lebendig erreichte. Man hätte ihm einen Empfang bereitet, den er nie vergessen, nie verschmerzt hätte.
Die Volksgunst ist launisch. Im Augenblick war ein Richard Jansen der Liebling des Volkes, der vergötterte Held — man hätte für diesen jenen geopfert.
Doch was nützten nun alle Vorwürfe, die man auch noch dem Toten machte? Es war ebenso unedel, als da man die ganz unschuldigen Matrosen der ›Victoria‹ mit Steinen bewarf.
Dies alles konnte keinen einzigen jener braven Männer wieder lebendig machen, so wenig wie Dankgottesdienste und verherrlichende Nachrufe in den Zeitungen. Ihren Baronstitel konnte sich die Königin, wie sich der Volksmund derb ausdrückte, nun an den Hut stecken.
Mit der ›Sturmbraut‹ und ihren Seezigeunern war es nun vorbei! Einmal hatte es ja doch kommen müssen, das ist der Lauf der Welt. Es entstand darüber in England eine ganze Literatur — bis auch diese wieder etwas Neuerem weichen musste.
Im Laufe der Tage und der Wochen wurden Körperteile, ganze Leichen an die Küste getrieben und von Fischern aufgefangen, aus den Messern, Kriegsschiffsmatrosen gehörend, erkannte man hauptsächlich, dass sie zur Besatzung der ›Sturmbraut‹ gehört hatten.
Sie wurden neben dem Massengrabe beigesetzt, welches die Opfer der ›Frankia‹ bekommen hatten, soweit sie nicht von Verwandten rekognosziert worden waren — wiederum Festgottesdienste mit schönen Reden — sie erhielten einen schönen Denkstein, und dann... wurden sie vergessen.
Sic transit gloria mundi!
Den adlig gewordenen Leichnam des zum Tode verurteilten Seeräuberkapitäns hatte man nicht aufgefischt. Natürlich nicht, sonst hätte er in spätem Alter nicht noch seine Tagebücher schreiben können.
Jansen hatte fast an ein Phantom geglaubt, als um ihn plötzlich die Granaten pfiffen und krepierten und er die Leichen seiner Getreuen sah.
Dann brach unter ihm die Kommandobrücke zusammen, und dann ging es hinab in die eisige Flut.
»Die Hunde haben meine ›Sturmbraut‹ bombardiert!«, erklang es jammernd.
Er hatte es schon einmal gerufen, das erstemal nur ganz unbewusst, jetzt war ihm die Erkenntnis der Wirklichkeit gekommen.
Er fühlte, dass ihn eine gewaltige Strömung fortriss, der auch die sonst noch hochgehende See hier ihre ziemliche Ruhe zu verdanken hatte.
Unwillkürlich machte er Schwimmbewegungen. Von seinen Leidensgenossen bemerkte er keinen. Außerdem senkte sich jetzt schnell die Dunkelheit herab.
Da fühlte er sich mit einem anderen menschlichen Körper in Berührung kommen, griff zu, packte wohl einen Menschen, gewahrte aber sofort, dass es eine Leiche war, der auch noch der Kopf fehlte.
Da erfasste ihn noch einmal der ganze Jammer.
»Meine ›Sturmbraut‹ hin! Meine braven Jungen von englischen Granaten zerrissen! Wie Schlachtvieh hingemetzelt! Das ist der Dank dieser Welt!!«
Noch einmal richtete er sich hoch aus dem Wasser empor. Das englische Kriegsschiff sah er nur noch in schwachen Umrissen schon in weiter, weiter Ferne. Und wäre es ihm noch so nahe gewesen, er hätte es nicht angerufen.
Dann zog er das von einem Kriegsschiffsmatrosen geliehene Messer aus der Scheide.
»Wenn ich einmal über Bord gehe und keine Hoffnung mehr habe, dann schneide ich mir lieber die Pulsadern auf, ehe ich mich stundenlang herumquäle.«
So hatte er einmal gesagt, und solch einem Selbstmörder wird man wohl keine Vorwürfe machen.
Einst wäre unser Held schon in dieser Lage gewesen. Damals in der Südsee, als er mit der ganzen Bussole über Bord gegangen war. Und damals hatte er gar nicht an solch einen Selbstmord gedacht, im Gegenteil, da hatte er sich mit einem wahren Vergnügen dem Kampfe mit den phosphoreszierenden Wogen hingegeben.
Ja, das war aber auch etwas ganz anderes gewesen! Hier schnitt ihm das eiskalte Wasser wie mit Messern in den Leib, versetzte ihm den Atem — hier half es nichts, dass man tüchtig Arme und Beine regte, der kalte Tod kroch langsam bis ans Herz heran.
Nein, besser so, als durch Erstarrung nach und nach unfähig werden, um dieses schnöde Leben noch weiter zu ringen.
Und nun die ›Sturmbraut‹ hin, alles, alles hin!!
»Blodwen, erwarte mich!«
Er setzte die Schneide des Messers an sein Handgelenk.
»Hilfe, Hilfe!!«, erklang es da, ziemlich in seiner Nähe.
Das war dennoch angetan, jeden Selbstmordgedanken gleich aufzugeben.
»Das war Martins Stimme! Martin, Martin!!«
»Kapitän, ich...«
Ein Gurgeln erstickte die Stimme.
O, welch ein Gefühl das sein mag, wenn sich zwei Überlebende in solcher Lage noch an ihren Stimmen erkennen, sich mit ihren Namen rufen!
Laut jauchzte Jansen auf, steckte das Messer zurück, strebte mit mächtigen Stößen der Richtung zu, aus welcher der Hilferuf gekommen.
Unterdessen war es finstere Nacht geworden, durch keinen Stern erhellt. So war es nur ein Zufall, oder nennen wir es lieber Gottes Hand, welche Jansen gerade einen menschlichen Körper greifen ließ.
»Martin, mein Martin!!«
Keine Antwort. Aber eine Leiche war es nicht, der Mann strampelte vielmehr noch ganz tüchtig, und jetzt begann er auch wieder zu gurgeln.
Noch ehe Jansen auf den Gedanken kam, einen Verstümmelten vor sich zu haben, der nicht mehr schwimmen konnte — am nächsten lag das Fehlen der Arme, weil keine Hände den Retter verzweifelt packten — kam Jansen durch Tasten zur Überzeugung, dass bei diesem Manne, ob nun Martin oder ein anderer, etwas am Oberkörper nicht in Ordnung sein könne, er fühlte Arme und Hände, aber diese waren wie festgeschnürt, und es war wirklich eine höhere Erleuchtung, dass Jansen gleich die wahre Ursache erkannte.
Dem Manne war die Jacke hinten auf dem Rücken heruntergerutscht, oder wahrscheinlicher hatte er sie ausziehen wollen und war nicht ganz damit fertig geworden, nun waren ihm die Arme hinten wie festgeschnürt.
Jansen hielt sich nicht lange damit auf, ihm die Jacke vollends auszuziehen, der Mann schien ganz verstrickt zu sein — wieder zog er sein Messer, mit einem Schnitt hatte er die ganze Jacke aufgeschlitzt, und sofort klammerten sich ihm denn auch zwei Arme mit der Kraft der Todesangst um den Hals.
»Los, los!«, begann jetzt auch Jansen zu gurgeln, und zwischen den beiden entspann sich ein wilder Kampf um Tod und Leben, und da hätte auch Jansens Riesenkraft nichts genützt, wenn er nicht zugleich so ein vorzüglicher Schwimmer gewesen wäre, der schon manchen Ertrinkenden gerettet hatte, daher auch alle Griffe und Kniffeverstand.
So blieb er Sieger in dem furchtbaren Kampfe, das heißt, er konnte sich noch rechtzeitig aus der eisernen Umklammerung der Todesangst befreien, und zwar ohne betäubende Faustschläge anwenden zu müssen.
Als der andere merkte, wie tatkräftig er unterstützt wurde, dass sein Kopf über Wasser blieb, kehrte ihm die Besinnung zurück, er machte nun wieder Schwimmbewegungen.
»Kapitän, unsere ›Sturmbraut‹!«, war dann sein erstes Wort.
Ja, es war Martin, der zweite Steuermann, und auch in seinem Todeskampfe konnte er sich nur immer mit der letzten Katastrophe beschäftigt haben.
»Es war ein englisches Schiff, und es hat uns in den Grund geschossen!«, fuhr er jammernd fort, so weit man, wenn man von solchen Wogen umhergeschleudert wird, in jammerndem Tone sprechen kann.
»Es war ein Irrtum, verlasst Euch darauf!«, tröstete Jansen, der von jeher von allen Menschen immer nur das Beste gedacht hatte.
»Unsere ›Sturmbraut‹ ist hin!«
»Wir beide aber leben noch.«
»Auch wir sind des Todes!«
»Mut, Steuermann, nur Mut, wir werden schon durchkommen!«
So sprach derselbe Jansen, der sich vor einer halben Minute noch die Pulsadern hatte öffnen wollen. Von der eisigen Kälte spürte er plötzlich nichts mehr, der Ringkampf um Tod und Leben hatte ihm das Blut warm zum Herzen gedrängt, und da er nun einen neuen Leidensgenossen gefunden, war er bereit, auch für sein eigenes Leben mit aller Tatkraft zu kämpfen, dachte gar nicht mehr an einen freiwilligen Tod, fand solch einen Gedanken jetzt von einem anderen feige. So ist der Mensch.
Sie schwammen nebeneinander her, dafür sorgend, dass sie sich so oft wie möglich mit Händen und Füßen berührten, sonst hätten sie sich in der Finsternis verloren.
»Kapitän, das ist eine lange Todesqual«, begann da Martin wieder zu gurgeln; denn ein Gurgeln und Spucken war es immer.
»Wir werden uns retten!«
»Wie lange soll das dauern?«
»Bis uns dieser Strom ans Ufer treibt; denn jeder Meeresstrom trifft einmal eine Küste.«
Stumm schwammen sie wieder nebeneinander, wie lange, da fehlte jede Zeitberechnung.
»Mut, Steuermann«, rief da Jansen abermals, sich im Wasser emporrichtend, »ein Feuer, ein Feuer!!«
Ja, das war allerdings die Toplaterne eines Dampfers, der dort vor ihnen in weiter, weiter Ferne leuchtete, aber wenn Jansen den Gefährten nicht nur aufmuntern wollte, sondern selbst durch diese Toplaterne Hoffnung bekam, dann freilich war das der höhere Optimismus.
Martin ging denn auch gar nicht darauf ein, dazu hatte er als Seemann viel zu viel Erfahrung.
»Ich fühle, wie sich der eisige Tod mir bis in die Knochen schleicht«, klagte er.
»Mut, Steuermann, diesen Dampfer müssen wir erreichen!«
»Ach, Kapitän, wenn es vom Willen des Menschen abhinge!«
»Ich werde nicht hier im Meere meinen Tod finden, ich weiß es.«
»Ja, Ihr — ich — kann nicht mehr!«
Jansen hatte auch schon längst gemerkt, wie die Bewegungen seines Gefährten schwächer und schwächer wurden.
»Hängt Euch auf meinen Rücken!«
»O, Kapitän...«
»Schweigt, gehorcht! Hängt Euch auf meinen Rücken, umschlingt meinen Hals, nur nicht zu fest. Konnte ich schon als halbwüchsiger Junge schwimmend einen Mann tragen, so werde ich's auch jetzt fertig bringen.«
Martin tat, wie ihm geheißen, legte sich flach auf Jansens Rücken und die Arme um dessen Hals.
So schwamm Jansen mit ungeschwächter Kraft weiter, jenem Lichtchen zu.
Und wahrhaftig, unter tausend Zufällen war der günstigste ihm gewogen!
Das Lichtchen ward immer deutlicher, jetzt tauchte auch das rote Backbordlicht auf, und dann erglühte eine lange Reihe von Bullaugen, wonach es ein außerordentlich großer Dampfer sein musste, sicher ein Passagierschiff.
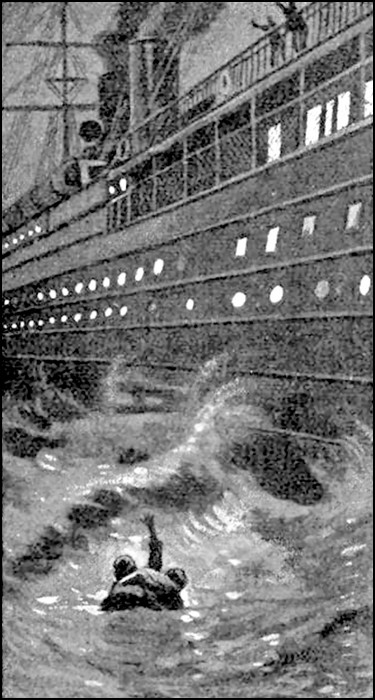
Unterdessen aber, seitdem er Martin auf dem Rücken hatte, war mindestens eine Stunde vergangen. Schon längst drohte Jansens Brust unter den gewaltigen Anstrengungen zu zerspringen, er glaubte förmlich in dem Eiswasser zu schwitzen, und immer mehr fühlte er, dass auch er nur ein Mensch war, dessen Kräfte beschränkt sind, er fühlte sie merklich schwinden.
»Mut, Mut, Steuermann, der Dampfer hält direkt auf uns zu, er muss an uns vorüber, wir werden uns rechtzeitig bemerkbar machen können.«
Keine Antwort. Jansen achtete nicht darauf. Martin lag noch genau so auf ihm, seinen Kopf auf Jansens Schulter, die Arme möglichst lose um seinen Hals.
Und da kam es herangerauscht, das funkensprühende Ungetüm mit zahllos feurigen Augen.
»Mann in See, Mann in See!!«, schrie Jansen mit dem Aufgebot seiner letzten Lungenkraft.
»Benzei, benzei!!«, erklang es sofort aus vielen Kehlen zurück. Noch immer war Jansen fähig, verwundert aufzuhorchen. Was für ein fremder Ruf war das gewesen? Und fast noch fremder kam ihm vor, dass der Dampfer, ganz ausnahmsweise trotz seiner Größe von einer Propellerschraube getrieben, bereits stoppte, die Schraube ging rückwärts. Gerade, als wenn man es auf diese Stelle abgesehen hätte, nur auf einen Schwimmer wartend, der Hilfe brauchte.
Lange hielt sich Jansen mit solchen Gedanken freilich nicht auf.
»Fang das Seil, Käpt'n, fang das Seil!«
Es kam schon geflogen, Jansen fühlte, dass es eine Schlinge war, die sich ihm um die Brust legte, er griff nur nach, ob sich auch Martin innerhalb der Schlinge befände, dann packte er das Seil, wollte sich daran hochziehen — da mit einem Male fühlte er, dass er nur noch der Schwimmbewegungen fähig gewesen war, was er geleistet hatte — gerade bis hierher hatte seine Kraft gereicht, nicht weiter — die Besinnung verließ ihn. — —
Schon während der letzten Stadien eines traumlosen Schlafes fühlte er eine behagliche Wärme durch seinen ganzen Körper gehen, und das blieb auch, als er die Augen aufschlug.
Es war ein heller Tag, der durch zwei Bullaugen drang, und er lag in einem offenen Bett, welches, auf Kugellagern ruhend, die heftigen Schwankungen des Schiffes nicht mitmachte.
Sonst glich der Raum wenig einer Kabine, wie Jansen sie gewöhnt war, die Wände mit Teppichen behangen, auf dem Boden Teppiche und viele Kissen und niedrige Polster, das Bett war wohl das einzige Möbel, und in einer Ecke kauerte auf solch einem Polster eine Gestalt, welche Jansen recht gut schon kannte.
»Thogluk!«, rief er in hellem Staunen. »Bei allem, was lebt, Thogluk, der Fakir!!«
Ja, es war das indische Knochengerippe mit dem Totenkopf, der jetzt bestätigend nickte, nichts weiter.
»Ja, bin ich denn hier auf der ›Indianarwa‹?!«
»Du sagst es.«
Aber nicht der Totenkopf hatte dies gesagt, sondern eine andere Gestalt, welche jetzt an das Bett trat, und Jansen glaubte erst, Tischkoff vor sich zu haben, weil der Mann auch so einen schwarzen Samttalar mit Barett trug.
Doch schnell sah er seinen Irrtum ein, und dennoch war ihm dieser Mann wohlbekannt.
»Graf Axel, der Sterndeuter!«
Die letzte Bezeichnung war ihm nur so herausgefahren.
»Ich bin es«, entgegnete der schwedische Okkultist, der sich schon früher, als er noch der Welt angehört, als solcher bekannt gemacht hatte, also als Mystiker, Alchimist und dergleichen.
»Ja, ich kann aber doch nicht auf der ›Indianarwa‹ sein!«
»Du bist es.«
»Auf der, welche an der Fucusinsel lag?«
»Nein, das nicht. Das hier ist ein viel kleinerer Dampfer, den wir nur ebenso genannt haben — die ›Freiheit von Indien‹.«
Da erst entsann sich Jansen, wie er überhaupt hierher gekommen war, und das verdrängte alle anderen Gedanken.
»Wie befindet sich Martin?«
»Der Mann, den du auf dem Rücken trugst?«
»Ja.«
»Es war dein zweiter Steuermann, den du erst später annahmst?«
»Ja.«
»Er ist tot.«
Entsetzt fuhr Jansen empor.
»Tot?«
»Er war erfroren.«
»Er lebte noch, als ich den Dampfer erreichte!«
»Nein, da war er bereits erfroren.«
»Er hielt noch seine Arme um meinen Hals geschlungen.«
»Er war an dich festgefroren. Du trugst bereits eine Leiche.«
Von einem Schauer gepackt, sank Jansen in die Kissen zurück. »An mich festgefroren«, ächzte er, »eine Leiche habe ich getragen — auch Martin tot, mein treuer Martin — er war der letzte...«
»Du sagst es.«
Wieder fuhr Jansen empor.
»Was sagte ich?«
»Er war der letzte von der ›Sturmbraut‹ — außer dir.«
»Kein anderer ist mit dem Leben davongekommen?«
»Nein.«
»Woher wissen Sie denn das?«
»Ich habe es in den Sternen gelesen.«
Wenn Jansen nicht an die Sterne glauben wollte, so hatte er doch an Tischkoff schon zuviel erlebt, um an etwas anderes glauben zu müssen. Und jetzt befand er sich gerade in der richtigen Stimmung dazu.
»Kein anderer gerettet?«
»Alle tot.«
»Ertrunken?«
»Von den Granaten getötet, zermalmt, ertrunken, erfroren.«
»Sie wissen, was uns geschehen?«
»Alles.«
Jansen fragte nicht mehr, woher das jenem bekannt sein konnte. Er hatte deswegen ja schon mit Tischkoff Erfahrungen gemacht.
Aber zu einer anderen Frage wurde er doch durch eine gewisse Neugier gedrängt.
»Sie wussten, dass Sie mich hier finden würden?«
»Ja.«
»Gerade an dieser Stelle?«
»Gerade hier.«
»Deshalb kamen Sie hierher?«
»Ja.«
»Ach«, rief da Jansen schmerzlich, »wenn Sie das alles so genau in den Sternen gelesen haben, warum konnten Sie mich da nicht eine Stunde eher finden!«
»Wozu das?«
»Weil Sie dann auch meinen treuen Martin lebend angetroffen hätten.«
»Sein Tod war schon im Buche des Schicksals verzeichnet.«
Dem wagte Jansen gar nicht mehr zu widersprechen — ja, er glaubte schon selbst an so etwas, war förmlich dazu gezwungen worden.
»Ach, es ist grausam, dieses Schicksal!«, klagte er.
»Es ist nicht grausam, die ewige Vorsehung ist vielmehr allgütig.«
»Warum musste ich da meinen treuen Martin erst finden?«
»Weil Sie dadurch von einem Selbstmord abhalten wurden.«
Jansen starrte dem Sprecher in das kalte, leidenschaftslose Gesicht.
»Auch das ist Ihnen bekannt?«
»Alles!«
»Wie wollte ich mich töten?«
»Sie zogen das Messer und setzten es schon an Ihr Handgelenk, als Sie Hilferufe vernahmen.«
»Sie sind allwissend!«
»Nein, ich weiß nur alles, was Ihre Person anbetrifft.«
»Nur meine Person?«
»Ja.«
»Weshalb?«
»Weil Ihre Person eng mit meinem eigenen Schicksale verbunden ist.«
»Inwiefern?«
»Wenn Sie das noch nicht gemerkt haben, so werden Sie es noch erfahren.«
»Nun gut — weshalb musste ich da erst den Ertrinkenden retten, ihn so lange tragen, wenn ja doch bestimmt war, dass er sterben sollte?«
»Kapitän, Sie fragen frevelhaft! Und doch, Ihnen will ich einmal eine Antwort geben, die ich jedem anderen Menschen, verweigern würde. Ihretwegen war dies alles nötig.«
»Meinetwegen?«
»Ja. Sie mussten die Hilferufe des Ertrinkenden vernehmen, damit Sie nicht Selbstmord begingen. Dann mussten Sie sich mit dem Schwächeren abmühen, damit durch die Anstrengungen Ihr eigenes Blut in Wallung geriet, auf dass Sie nicht selbst den Tod des Erfrierens erlitten. Dazu war dieses ganze Zwischenspiel nötig. Erkennen Sie nun das Walten des Schicksals, wie es sein Ziel immer zu erreichen weiß?«
Ja, als hätte Jansen einen Einblick erhalten in den geheimnisvollen Mechanismus des Schicksals, durch welchen es das ganze Weltgetriebe im Schwunge hält, sowohl die Bewegungen des Wurmes wie die Taten der Götter lenkt — einen Einblick, den sonst kein sterblicher Mensch ungestraft haben darf — so schloss Jansen schaudernd die Augen.
Im Grunde genommen freilich gehörte zu alledem, was der schwedische Mystiker da sagte, nicht einmal der Scharfsinn einer Kartenlegerin, das konnte sich auch der naivste Mensch so zusammenreimen, wenn er nun einmal an ein Verhängnis glaubte und immer nach einer Erklärung suchte.
Aber dieser Schwede hatte ja auch schon in anderer Weise Proben von seinen übersinnlichen Fähigkeiten gegeben, und der geschwächte Jansen befand sich nun gerade in der Stimmung, dass dies alles einen außerordentlichen Eindruck auf ihn machen musste.
»Und es ist dennoch grausam, dieses Schicksal«, fuhr er dann in demselben klagenden Tone fort.
»Ich war lebensmüde — ach, so lebensmüde! — Warum konnte der Tod nicht auch mich nehmen?«
»Wissen Sie denn, wozu das Schicksal Sie noch bestimmt hat?«
»Ich war lebensmüde und bin es noch«, wiederholte Jansen nur.
»Meinetwegen brauchte niemand zu sterben.«
»Das Schicksal ist dennoch allgütig. Wissen Sie denn, was aller Ihrer Leute noch gewartet hätte, wenn dieses allgütige Schicksal sie nicht rechtzeitig abgerufen?«
»Ist es Ihnen bekannt?«
»Sie fragen viel, und doch...«
Und die Stimme des alten Mannes nahm einen eigentümlich singenden Ton an, während sein Auge starr in die Ferne gerichtet war, als er fortfuhr:
»Zwei Spalten hat jede Seite im Buche des Schicksals. Die eine ist weiß und mit schwarzer Schrift bedeckt, die andere schwarz und weiß beschrieben. Die schwarze Schrift auf der weißen Seite verkündet das Schicksal des Menschen, so wie es gekommen ist, nachdem es geschehen ist; die schwarze Seite erzählt, wie es gekommen wäre, wenn das Schicksal ihn auf einen anderen Weg gedrängt hätte.«
»Ich verstehe, ich verstehe«, murmelte Jansen, und dann musste wohl auch er schon von einer Art Prophetengeist erfüllt sein.
Der Leser aber sei nur an die Sage erinnert, wie Herkules am Scheidewege steht — und dieser Fall tritt wohl für jeden Menschen des öfteren ein.
»Die weiße Seite blendet mich oft«, fuhr der Alte in seinem merkwürdig singenden Tone fort, »dann aber kann ich die weiße Schrift auf der schwarzen Seite nur um so deutlicher entziffern, während sie sonst vor meinen Augen verschwimmt.«
»Ich verstehe, ich verstehe«, wiederholte der plötzlich von einem anderen Geiste erfüllte Jansen.
»Die schwarze Schrift, welche das Schicksal deiner Leute erzählt, hört plötzlich auf, weiß wie die Unschuld leuchten die Seiten.«
»Sie sind tot.«
»Du sagst es. Aber die weiße Schrift auf schwarzem Grunde leuchtet fort.«
»Sie erzählt das Schicksal meiner Leute, wenn sie nicht ihren Tod gefunden hätten?«
»Du sagst es.«
»Und was erzählen diese schwarzen Seiten?«
Die Augen des Alten wurden noch starrer.
»Ich sehe ein Schiff«, begann er zu flüstern. »Es ist deine ›Sturmbraut‹. Du bist mit allen deinen Leuten darauf. Nur wenige fehlen, deren schwarze Schrift schon früher aufgehört hat. Aber, o, wie sehen all diese sonst so kraftstrotzenden Männer aus? Sie müssen wohl schon seit langer Zeit Hunger leiden. Sie sind zu Gerippen abgemagert. Und nicht nur das — sie alle können sich nicht mehr auf den Füßen halten — und nicht nur vor Hunger — sie sind mit Aussatz und mit Schwären bedeckt — und ich sehe dich — sie zeigen dir ihre offenen Füße und Hände — aus den brandigen Wunden fließt eine stinkende Flüssigkeit — und einem nach dem anderen sägst du Füße und Hände ab — ganze Arme und Beine — und es nützt doch nichts — der Brand frisst immer weiter...«
»Höre auf, höre auf!«, schrie Jansen, dessen Augen sich vor Entsetzen immer weiter geöffnet hatten, und mit diesen Augen konnte auch er jetzt den Schleier der Zukunft durchdringen. »Du willst doch nicht damit sagen, dass alle meine Leute ihre Gliedmaßen erfroren hätten und dann jämmerlich zugrunde gegangen wären?«
Der Alte fuhr sich über die Augen, und der starre Seherblick verließ ihn.
»Du sagst es. Oder bist du fähig, den Brand fernzuhalten? Kannst du erfrorene Gliedmaßen behandeln?«
»Mit Zwiebelsaft einreiben.«
»Mit Zwiebelsaft einreiben, hahaha!! Ist das deine ganze ärztliche Kunst? Damit willst du erfrorenen Gliedern, die nur noch scheinbar mit dem Körper zusammenhängen, das Leben wiedergeben? Und wenn du nun keine Zwiebeln hast? Auch jene Menschen, welche du von dem Wrack gerettet hast, haben fast sämtlich erfrorene Gliedmaßen, aber die werden mit Eiskompressen behandelt, auch sonst sind sie in der Behandlung geschulter Ärzte, deren Kunst heute schon so weit ist, den Brand zu verhindern — dein Schiff aber sah ich von allen Mitteln entblößt, und du selbst weißt wohl, was du von der ärztlichen Kunst verstehst — ich sah dich die Säge handhaben, als ob du einen Baumstamm vor dir habest — und ich sah dein Herz dabei sich verbluten...«
»Genug, genug!«, ächzte Jansen. »Wohl ihnen dann, dass es so gekommen ist, dass ihnen solch ein langsames Absterben bei lebendigem Leibe erspart blieb! Wartet aber meiner nicht dasselbe Los?«
»Nein. Du hast nichts erfroren, wir haben dich bereits untersucht.«
»Wie kommt das?«
»Du hast eben eine andere Natur.«
»So ist meine weiße Seite noch beschrieben?«
»Noch viele, viele Seiten.«
»Und was liest du?«
»Kein Mensch begehre sein Schicksal zu wissen!«
»Doch, ich will es wissen!«
»Aber ich verkünde es dir nicht — wenn ich überhaupt auf deinen Seiten lesen könnte. Sie blenden mich.«
Der Alte wandte sich der Tür zu, drehte sich dort noch einmal um.
»Nun denn — weshalb dich das Schicksal für uns bestimmt hat, das wenigstens kann ich dir sagen — du sollst Geister, die sich nach irdischem Leben sehnen, zu Menschen machen. Genug!«
»Was soll ich?!«, rief Jansen erstaunt und diesmal ganz verständnislos. »Aus Geistern soll ich Menschen machen?«
Graf Axel aber war schon hinaus, und auch der Fakir war von seinem Kissen verschwunden.
Dafür traten bald indische Diener ein, die ihm europäische Kleider nach seinem Maße brachten, und dann fragten sie nicht erst lange nach seinen Wünschen, sondern luden ihn zum Betreten der benachbarten Kabine ein, wo eine Mahlzeit angerichtet war, und zwar nicht nur aus Reis bestehend.
Beim Anblick der dampfenden Schüsseln erinnerte sich unser Held, dass er ein noch gesunder Mann in seinen besten Jahren war, der seit Gott weiß wie lange seinem Magen nichts mehr hatte anbieten können, und... er langte zu.
Der gottbegnadete Volksprediger Zschokke hat als Novellist, als er noch weniger fromm war, die köstliche Szene geschildert, wie ein junger Mann, der durch ein Ereignis bis zum Tode betrübt ist, dabei aber nach langer Reise von einem Wolfshunger geplagt wird, weinend und schluchzend eine ganze gebratene Kalbskeule verspeist, und als er damit fertig ist, da merkt er, dass jedes Ding zwei Seiten hat, dass er doch eigentlich gar nicht so traurig zu sein braucht.
Und Thomas Alva Edison, der immer mindestens achtundvierzig Stunden hintereinander arbeitet, dabei ebenso viele Zigarren rauchend, ehe er sich an den Esstisch setzt, um dann eben solch eine übermenschliche Arbeit zu leisten — der sagt, dass er gerade während des Essens immer die schwierigsten Probleme löst, da kämen ihm wie göttliche Offenbarungen für seine Erfindungen die genialsten Gedanken. (Dann, sei hier über diesen merkwürdigen Mann gleich noch erwähnt, schläft er ein paar Stunden auf dem Stuhle, auf dem er gerade sitzt — so etwas wie ein Bett kennt Edison überhaupt nicht — immer die Zigarre im Munde, und an ein Wechseln der Wäsche und der Strümpfe wird er erst erinnert, wenn seine Stiefelsohlen durchgelaufen sind.)
Mögen diese beiden Beispiele als Ersatz für eine ausführliche Schilderung dienen, was in unserem Helden vorging, für seinen Stimmungswechsel, als er den Hunger stillte, den er lange Zeit für unbezähmbar hielt.
Er sah plötzlich alles mit ganz anderen Augen an. Auch die Unterredung mit dem schwedischen Mystiker mochte ja viel mit beitragen.
Wenn es so war, dass jedem Menschen sein Schicksal bestimmt ist, was konnte er dann daran ändern?
Sonnen wallen auf und nieder, Wolken gehen und kommen wieder, Und kein Mensch kann's wenden!
Ja, so ist es! Lasset die Toten ihre Toten begraben. Nur dem Lebenden gehört diese Erde, und das Schicksal, welches sie regiert, soll ja ein allgütiges sein, wenn wir blinden Menschlein das auch sehr oft oder meistenteils nicht einsehen wollen. Nur darf dieser lebende Mensch nicht krank und nicht hungrig sein.
So weit war Jansen in seiner Stimmung gekommen, als Graf Axel wieder eintrat, ein Paket unter dem Arme.
»Hat es Ihnen geschmeckt?«
»Ausgezeichnet.«
»Sind Sie wiederhergestellt?«
»Körperlich und geistig.«
»Das freut mich — besonders die geistige Wiederherstellung.
Keine Selbstmordgedanken mehr?«
»Ich denke nicht mehr daran.«
»So lassen Sie uns weitersprechen.«
Der Graf legte das Paket auf den Tisch und setzte sich.
»Wissen Sie, was dieses Paket enthält?«
»Nein.«
»Ihr Eigentum.«
»Meine alten Sachen?«
»Die haben Sie doch nicht selbst gemacht, und nur was der Mensch von Grund auf selbst schafft, darf er als sein Eigentum betrachten. Nur das Papier hier haben Sie allerdings nicht selbst gemacht.«
»Das Papier hier? Herr, Sie sprechen in Rätseln.«
»Ihr Tagebuch und Ihre anderen Aufzeichnungen.«
Der Graf packte aus, es waren eine ganze Masse Bücher, Hefte und andere Schriftstücke, auch nur lose Briefe, mit den verschiedensten Handschriften bedeckt, und zu seinem grenzenlosen Staunen erkannte Jansen darunter sein eigenes Tagebuch, welches er auf den Wunsch Tischkoffs geführt hatte — der Leser entsinnt sich, Tischkoff hatte ihm die von Blodwen gekaufte ›Sturmbraut‹ und alles andere unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, oder um keinen Dank haben zu wollen, dass Jansen fernerhin alle seine Erlebnisse aufzeichne und diese Manuskripte Tischkoff vermache — und durch Anlegen dieses Tagebuches war Jansen nun einmal ins Schreiben hineingekommen, er hatte aus seinen Aufzeichnungen ganze Erzählungen gemacht, was er früher nie gekannt, und all diese Manuskripte sah er nun vor sich liegen.
»Ja, wie kommen Sie denn zu diesen meinen Papieren?!«
»Die hat man auf der ›Sturmbraut‹ in Ihrem Pulte gefunden.«
»Das glaube ich wohl, aber dadurch vergrößert sich für mich nur das Rätsel, wie Sie die plötzlich hier haben können.«
»Wir kommen direkt von London.«
»Direkt? Ich wurde beim Schwimmen nach Westen getrieben, Ihr Schiff kam mir entgegen.«
»Nicht doch. Wohl kamen wir von Westen, aber wir sind unterdessen in London gewesen.«
»Unterdessen? Wie soll ich das verstehen?«
»Sie haben einen Tag und eine Nacht geschlafen, oder zusammen fast sechsunddreißig Stunden, und unterdessen sind wir in London gewesen, wir befinden uns im Kanal, haben erst Southampton hinter uns.«
Jetzt begann Jansen zu verstehen, wodurch aber nur sein Staunen wuchs.
»Nun gut denn! Und man hat Ihnen meine Papiere so ohne Weiteres ausgeliefert?«
»Der Maharadscha bat um Ihre und Ihrer Leute schriftliche Hinterlassenschaften. Und Sie wissen wohl, wie sehr England dem Maharadscha Ghasma Dschalip Subktadscha verpflichtet ist. Kurz, er brauchte nur zu bitten, und alle Papiere sind ihm sofort ausgeliefert worden. Allerdings hatte man sie schon zuvor durchgelesen und leider bemerkt, dass Sie darin die Lage jener Perlenbank nicht verzeichnet haben, ebenso wenig einer Ihrer Leute.«
Nein, das hatte Jansen allerdings nicht, denn er hatte immer damit gerechnet, dass diese seine vorläufigen Aufzeichnungen doch einmal in andere Hände kommen könnten, und dass keiner seiner tagebuchführenden Matrosen solch einen schriftlichen Leichtsinn begangen, der einmal zum Verrat führen konnte, war ganz selbstverständlich.
Über diese ›tagebuchführenden Matrosen‹ muss noch etwas Besonderes gesagt werden.
Im Allgemeinen sind Matrosen keine Literaten. Aber es braucht nur einmal ein einziger in der Foxel zu sein, der ein Tagebuch führt, dann dauert es gar nicht lange, so fängt ein zweiter an, dann ein dritter, und schließlich schreiben sie alle, wenigstens während dieser einen Reise. Auf der nächsten denken sie nicht mehr daran, oder es will eben keiner zuerst anfangen, ein gewisses Schamgefühl hält sie davon ab, als ›Skribifax‹ zu gelten, irgendeine starke Persönlichkeit muss immer erst den Anfang machen.
Ist die aber erst einmal da, dann wird während der Freizeit stets geschrieben. Es ist wirklich ganz merkwürdig. Das findet man bei keiner anderen Arbeiterklasse. Merkwürdig ist auch, was sie schreiben. Keine Tagebücher im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Denn was so ein Matrose wirklich erlebt, das ist doch sehr wenig. Dabei sind solche von Segelschiffen gemeint, oder auch von Dampfern, nur nicht von Passagierschiffen, die wissen sich immer zu amüsieren.
Ach, wenn man ahnte, wenn man solche echte Teerjacken besoffen durch die Straßen torkeln sieht, was für einen ganz, ganz anderen Charakter sie im Grunde genommen doch haben! Im Mannschaftslogis, in der Foxel muss man sie belauschen! Was sie da alles, wenn sie erst einmal angefangen haben, in das Reich ihrer Gespräche ziehen, die ganze Erde und den ganzen Himmel, sie urteilen über Gut und Böse, philosophieren über Probleme, an die sich geschulte Fachleute gar nicht heranwagen!
Es ist dies die Folge des Berufs, der ganzen Lebensweise eines Matrosen. Er kommt ja herum in der Welt, sein Gesichtskreis wird immer weiter, dabei sieht er alles mit ganz naiven, durch keine Schulbrille getrübten Augen — — und dann wieder die langen Reisen, die einsamen Nachtwachen auf dem träumenden oder wild schäumenden und sich bäumenden Meere, da fängt er an zu grübeln — — ganz ohne seinen Willen und ohne jede Schulung wird jeder Matrose etwas von einem Philosophen. Der Schreiber dieses, der sich selbst lange genug als Matrose alle Winde um die Nase hat pfeifen lassen, bildet keine Ausnahme, und das wird dem Leser Erklärung für seine manchmal wohl etwas eigentümliche Schreibweise, die sich auch gern mit Reflexionen befasst, geben. —
So hatte auch die Mannschaft der ›Sturmbraut‹ genug Papier vollgeschmiert.
»Der Maharadscha dachte, Ihnen eine Freude zu bereiten«, sagte Graf Axel.
Hastig griff Jansen nach den Manuskripten.
»Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen — ja, ein wertvolleres Andenken an meine braven Offiziere und Jungen kann ich nicht besitzen. Aber«, setzte er zögernd hinzu, »eigentlich gehören diese Manuskripte gar nicht mir, am allerwenigsten die, welche von mir selbst stammen.«
»Wem denn sonst?«
»Kennen Sie einen Mann namens Tischkoff?«
»Ja.«
Schon im Tone hatte die Aufforderung gelegen, dass Jansen über das Verhältnis Tischkoffs zu dieser indischen Gesellschaft nicht weiter forschen sollte.
»Mister Tischkoff hat Anspruch auf diese meine Tagebücher und Berichte.«
»Ich weiß es. Erzählen Sie nicht erst, wieso. Ich weiß alles. Mister Tischkoff stellt Ihnen die Manuskripte als Ihr Eigentum wieder zurück.«
»Dann danke ich ihm und Ihnen.«
Jansen blätterte zwischen den Papieren, meist mit Krakelzügen bedeckt, von Matrosenfäusten herrührend, manchmal heiter, manchmal trübe lächelnd, bis er wieder aufblickte.
»Ihr Aufenthalt in London war da ein recht kurzer.«
»Nur wenige Stunden.«
»Dann sind Ihnen diese Papiere sehr schnell ausgeliefert worden.«
»Es war ja alles in Ordnung, und man musste auf den Zustand des Maharadschas Rücksicht nehmen, der überhaupt keine Landluft mehr vertragen kann.«
»Ist er krank?«
»Sehr.«
»Was fehlt ihm?«
»Es ist Altersschwäche.«
»Ich habe ihn nur zweimal gesehen, das ist doch kaum zwei Jahre her, und da habe ich ihn gar nicht für so alt geschätzt.«
»Dann haben Sie sich geirrt. Er ist schon über siebzig.«
»Nicht möglich! Doch wenn Sie es sagen. Ja, als ich ihn so in seiner Majestät dasitzen sah — ich hätte ihn fast für einen unsterblichen Gott gehalten.«
»Er ist ein sterblicher Mensch, der seine Wiedergeburten durchzumachen hat, bis er sich erlöst hat.«
Mit einem brahmanischen oder buddhistischen Inder darf man nicht über die Wiedergeburt streiten, er kann keinen Menschen begreifen, der nicht daran glaubt — oder es braucht auch kein brauner Inder zu sein.
Graf Axel selbst fing schnell mit der Schilderung an, was für einen Eindruck das Rettungswerk der ›Seeräuber‹ und dann die durch einen Irrtum entstandene Vernichtung der ›Sturmbraut‹ und all dieser braven Männer in ganz England gemacht habe.
Jansen hatte sich nur nach dem Ergehen der von ihm geretteten Menschen erkundigt, dann hörte er teilnahmslos zu, und das empfand auch der Erzähler, er brach plötzlich ab.
»Sie interessieren sich wohl gar nicht dafür?«
»Offen gestanden, nein. Ich habe mit der ganzen Welt abgeschlossen, möchte gar nichts mehr davon wissen.«
»Dann war es wohl auch recht von mir, dass ich Sie während unseres Aufenthaltes in London habe schlafen lassen.«
»Weshalb hätte ich geweckt werden sollen?«
»Nun, Grund genug war doch dazu vorhanden.«
»Um etwa Dank entgegenzunehmen?«
»Ja.«
Jansen machte eine abwehrende Bewegung.
»O, wenn Sie wüssten, wie schrecklich mir das gewesen wäre — vielleicht gar noch Festlichkeiten!«
»Ich dachte es mir, eben deshalb habe ich Sie schlafen lassen.
Und war es auch recht von mir, dass ich überhaupt gar nicht sagte, wie Sie sich lebend bei uns an Bord befinden?«
»Das haben Sie nicht gesagt?!«, fuhr Jansen freudig empor.
»Nein.«
»Und Ihre Leute?«
»Die zählen in dieser Hinsicht überhaupt nicht mit. Sie gelten für tot — wenn man die Möglichkeit ausschließt, dass Sie von einem Schiffe aufgefischt worden sind.«
»Ich danke Ihnen.«
Eine Pause trat ein.
»Ja, was aber soll nun aus mir einsamen Menschen werden?«, nahm dann Jansen wieder trübe das Wort.
»Wir sind noch in Ihrer Schuld.«
»Wieso?«
»Sie haben noch 10 000 Pfund zu bekommen, die jährliche Leibrente, welche wir Ihnen...«
»O, sprechen Sie doch nicht so! Was soll ich denn mit diesem Gelde?«
»Wir stellen Ihnen alles zur Verfügung.«
»Wozu?«
»Dass Sie sich ein neues Schiff kaufen können.«
»Eine neue ›Sturmbraut?«, fragte Jansen bitter.
»Sie können sich ein Schiff nach ganz demselben Typ bauen lassen.«
»Mit einer neuen Mannschaft?«
»Auch die werden Sie bekommen.«
»Ich glaube, Herr Graf, Sie scherzen nur. Oder Sie wollen gar meiner spotten. Wissen Sie nicht, ahnen Sie nicht, was dieses Schiff mir gewesen ist? Von meiner Mannschaft gar nicht zu sprechen.«
Ja, der Schwede musste es wohl wissen, das bewies sein langes Schweigen.
»Was haben Sie sonst vor?«, fragte er dann.
»Wie ich schon sagte: von dieser Erde verschwinden.«
»Aber doch am Leben bleiben.«
»Ja. Ich möchte fernerhin ganz meinen Erinnerungen leben. Sie sind schön genug, selbst die schmerzlichsten. Denn auch im bittersten Schmerz kann man eine süße Befriedigung finden. Ja, ich hätte eine Bitte.«
»Sprechen Sie.«
»Bringen Sie mich nach jener Fucusinsel. Ist Ihnen bekannt, ob sich Mister Tischkoff noch dort befindet?«
»Nein, er hat sie bereits verlassen.«
»So möchte ich dort mein Leben beschließen, wo die Gefahr am geringsten ist, einmal als Robinson gefunden zu werden.«
»Sie können aber auf dieser Insel nicht Ihr Leben fristen.«
»Nicht? Ich verstehe nicht. Oder ist Ihre alte ›Indianarwa‹ und sind die vielen Rinder...«
»Ehe Tischkoff sie verließ, hat er Vorkehrungen getroffen, dass die Quelle versiegt, Sie würden dort kein Wasser finden.«
»O, auf solch einem großen Terrain fällt immer genug Regen.«
»Trotzdem — ich will Ihnen einen anderen Vorschlag machen.«
»Nun?«
»Sie wollen eine einsame Insel haben?«
»Ja.«
»Die Erde ist verteilt, und wenn es auch noch unerforschte und selbst unbekannte Inseln gibt, so können sie doch einmal von einer Macht besetzt werden, und dann ist es mit der Idylle vorbei.«
»Deshalb eben dachte ich an die Fucusinsel, von deren Existenz die Welt noch nichts weiß.«
»Aber auch sie könnte einmal entdeckt werden, und wenn auch eben deshalb die Wasserquelle vernichtet wurde, damit sich dort nicht viele Menschen festsetzen können, so ändert das doch daran nichts, dass Sie dort nicht gestört werden könnten.«
»Nun, wo wäre ich sonst vor jeder Störung geschützt?«
»Würden Sie zum Brahmanismus übertreten?«
Jansens erstes Staunen war begreiflich. Doch nur wenig zögerte er, dann bejahte er.
»Es gibt nur einen Gott, und es ist gleichgültig, unter welchem Namen ich ihn anbete.«
»Könnten Sie sich unter Toten wohlfühlen?«, war des Grafen nächste Frage.
»Unter Toten?«
»Zwischen Gräbern. Es handelt sich um die heilige Toteninsel in der Nähe von Kalkutta, wo schon seit uralten Zeiten die Gebeine der königlichen Brahmanen beigesetzt werden. Auf dieser Insel wohnt als Wächter nur ein einziger Mann, ein Brahmane. Würden Sie diese Stellung annehmen?«
»Ja, das wäre gerade etwas für mich«, sagte Jansen erfreut, soweit man bei so etwas Freude äußern kann. »Aber ich bin kein Brahmane, der doch aus einer besonderen Kaste sein muss, und ich möchte keinen anderen von einem ihm liebgewordenen Platze verdrängen...«
»Das ist nicht der Fall, und wäre irgendein Hindernis vorhanden, so würde ich Ihnen doch nicht erst diesen Vorschlag machen. Das lassen Sie nur alles meine Sorge sein, und über die Einzelheiten sprechen wir noch. Also Sie begleiten uns zunächst nach Indien.«
»Ich bin bereit.«
»So begrüße ich Sie als Gast des Maharadschas, der Sie auch selbst sehen will. Das ganze Schiff steht zu Ihrer Verfügung. Die Verhältnisse kennen Sie ja noch von unserer alten ›Indianarwa‹ her, alles ist hier so wie dort, nur um vieles kleiner, wie wir unsere Leute reduzieren mussten.«
Jansen hatte für seinen eigenen Bedarf drei luxuriös eingerichtete Kabinen und an die zwei Dutzend Diener zur Verfügung bekommen. Ein einziger hätte genügt, der ihm das Essen brachte und seine Kabine reinigte, welch letzteres er schließlich auch selbst gemacht hätte, wenn es eben nicht Inder gewesen wären, die immer nur auf einen einzigen Handgriff dressiert sind.
Es war ein Dampfer von sechstausend Tonnen, für damalige Zeiten ein außerordentlich großes Passagierschiff, mit allen Erzeugnissen der modernsten Technik, Kunst und Bequemlichkeit ausgestattet, dann nur mehr für indischen Geschmack umgemodelt, besetzt mit fast siebenhundert Menschen, welche auch genügend Platz fanden, zumal die meisten indische Diener waren, welche sich am wohlsten fühlen, wenn sie während ihrer Freizeit wie die Heringe zusammengequetscht sind.
Die seemännische Besatzung auf und unter Deck bestand ausschließlich aus Japanern, Kapitän und Offiziere, alles Japaner, und zwar die tüchtigsten Seeleute, wie Jansen bald merkte, und zwar ebenfalls in überreichlicher Zahl vorhanden, aber auch diese durften gar keine Ansprüche machen oder hatten von selbst keine, ein kleiner Raum genügte, um gegen achtzig Matrosen und Heizer aufzunehmen, je drei Offiziere begnügten sich wie der Dachs in seinem Loche, dabei ebenso wie ein Dachs auf peinliche Sauberkeit haltend, immer scheuernd und putzend.
So war für die vornehmeren Inder und deren Frauen und Kinder überreichlich Platz vorhanden. Sie besaßen ganze Fluchten von Kabinen, jede einzelne Familie ihren eigenen Salon, ihre eigenen Bäder. Selbst ein mit warmem Wasser gespeistes, ziemlich umfangreiches Schwimmbassin war hier wiederum vorhanden, freilich nur bei ruhiger See zu benutzen.
Wie auf der alten ›Indianarwa‹, so ging auch hier alles aus dem großen Topfe. An allem und jedem war Überfluss vorhanden. Jeder Passagierdampfer ist ja auch zur Mitnahme von Fracht eingerichtet, er muss sie haben, sonst bedarf er des Ballastes. Hier bestand dieser, abgesehen von Kohlen und Trinkwasser, nur aus Proviant. Selbst frisches Fleisch gab es täglich, in einem Kühlraum mit eigener Eismaschine aufbewahrt, das Allermodernste.
Aber wie Jansen bald merkte, begnügten sich auch hier die indischen Diener und die japanischen Seeleute, selbst Kapitän und Offiziere, fast ausschließlich mit Reis, sie wollten gar nichts anderes haben, und so waren die besseren Sachen, die feinsten Delikatessen, alle in Hülle und Fülle vorhanden, nur für die wenigen vornehmen Inder da.
Kurz, das ganze indische Kastenwesen kam hier zum Ausdruck, wie es ja auch schon auf der alten ›Indianarwa‹ gewesen war. Dies alles bemerkte Jansen nach und nach nur so zufällig. Er selbst kümmerte sich um nichts, stellte keine einzige Frage. Jetzt war er es, welcher Tischkoffs Leben zu führen begann. Den ganzen Tag schrieb er in seiner Kabine, hatte eine große, englische Bibliothek entdeckt, welche er erst zum Nachschlagen, dann aber auch zur Weiterbildung benutzte; er kannte einige Stunden, an denen das Deck wie ausgestorben war, da promenierte er in der frischen Luft auf und ab, nahm sein Bad, seine Mahlzeiten, und dann ging es wieder an das Niederschreiben seiner Erinnerungen, und so verlief ein Tag wie der andere, ohne dass er mit irgendeinem Menschen in Berührung kam, wie er selbst auch von keinem anderen mit nur einem Blicke belästigt wurde.
Nicht eigentlich, dass diese Lebensweise eine Folge der letzten Zeit war, der furchtbaren Schicksalsschläge, die er durchgemacht, dass er dadurch also etwa zu einem menschenscheuen Sonderling geworden wäre.
Nein, sondern Jansen hatte plötzlich entdeckt, dass es ein Leben gibt, welches auf dieser Erde vielleicht einzig und allein ein dauerndes Glück oder doch zufriedene Behaglichkeit gewährt — ein glückliches Leben, welches sich so viele Menschen leisten könnten, sie brauchen gar keine Rentiers zu sein, und sie wissen nichts davon, wollen nichts davon wissen, plagen sich statt dessen lieber mit tausend Nichtigkeiten herum, immer unzufrieden, immer von eingebildeten Krankheiten gequält, bis sie schließlich wirklich krank werden, und dann ist das Lamento erst recht groß.
Es ist dies ein Leben mit einer gleichförmigen Arbeit, welche man ständig unter seinen Händen wachsen steht — ein Leben, in dem jede Tagesstunde geregelt ist, ohne jede Abwechslung, vor allen Dingen ohne jedes sogenannte Vergnügen.
Wer nicht glaubt, dass solch eine eintönige Arbeit das höchste, dauernde Glück ist, welches diese Erde gewähren kann, muss es nur einmal probieren. Es ist gar nicht nötig, dass man dabei an einem Werke schreibt oder etwas Künstlerisches schafft. Selbst die Arbeit am Webstuhl oder an der Strickmaschine kann solch einen dauernd glücklichen Zustand herbeiführen, nur muss dabei alle Sehnsucht nach Gesellschaft oder Vergnügen irgendwelcher Art beseitigt sein. Erst wenn man solch eine Periode hinter sich hat, wieder vom Strudel des Lebens fortgeschwemmt worden ist, wird man dies leider erkennen, und dann wird man sich nach diesem eintönigen Leben zurücksehnen wie nach dem verlornen Paradiese, und wenn es auch nur eine armselige Dachstube mit wenig mehr als trocken Brot gewesen ist.
Besser freilich ist daran, noch mehr empfindet dieses anspruchslose Glück, wer sich mit höheren Dingen befasst, vor allen dabei seinen Geist ausbildet.
Durch das Wiedererhalten seiner schon verloren geglaubten Manuskripte war Jansen in diese Lebensweise hineingekommen. Er hatte sich aus dem Verlust gar nichts gemacht, gar nicht daran gedacht. Sie hatten eigentlich ja auch nicht ihm gehört. Jansen war überhaupt nie schreibselig gewesen.
Jetzt erst, als er sein Tagebuch und seine anderen Manuskripte wieder durchlas, merkte er, was ihm alles gefehlt hatte, wenn er sie nicht besessen. Denn es ist doch ein unsicheres Ding, sich nur auf sein Gedächtnis verlassen zu wollen. Er las auch das, was seine Offiziere und gewöhnlichen Matrosen niedergeschrieben hatten, und abgesehen davon, wie oft ihn dabei die Rührung überwältigte, während er ein andermal laut hinauslachen musste, manch schönen Gedanken fand, merkte er auch, wie sehr diese anderen Aufzeichnungen seine eigenen ergänzten.
Das musste weitergeführt, womöglich vollendet werden! So kam er ins Schreiben. Und durch Benutzung der großen Bibliothek, alle Gebiete umfassend, hauptsächlich aber sich auf indische Religion erstreckend, kam er auch ins Lesen, er begann regelrecht zu studieren, zunächst die indische Umgangssprache, das Hindustanisch.
Und wie die Tage vergingen, so gewann er dieses einförmige Leben immer lieber. Fürwahr, Tischkoff hatte damals doch das beste Leben erwählt! Jansen dachte oftmals daran, wie sehr doch sein Leben dem Tischkoffs glich. Nicht ausgestoßen von der Welt, sondern in seiner eigenen Welt lebend. Er war jetzt auch immer so in Gedanken versunken. Manchmal, wenn er zufällig in den Spiegel blickte, staunte er darüber, dass er so gar so still und sinnig vor sich hinlächelte. Genau wie Tischkoff.
Ein solches Leben ist aber auch fast nur an Bord eines großen Schiffes möglich. Man kann sich auch in einem Landhause, mitten in der größten Stadt in der Einsamkeit begraben, aber... es wird eben bald zum Grab. Das empfindet man sehr schnell. Draußen rauscht die Welt, und man selbst fühlt sich so allein, ach, so allein! Und geht man auf der Straße, dann empfindet man wieder so unangenehm die Blicke der fremden Menschen, so neugierig, weil sie förmlich instinktartig den Sonderling wittern, der nicht zu ihnen gehört.
Wie ganz anders auf einem Schiffe! Das ganze Schiff mit seinen zitternden Planken selbst ist Leben. Mit jeder Sekunde verändert es seinen Ort. Man sieht die Welt.
Die Bordroutine gestattet keine Annäherung, wenn man sie nicht wünscht. So hatte Jansen gar bald den Plan aufgegeben, sich auf jener Toteninsel als Grabwächter niederzulassen. Dort hätte er doch manches vermisst, und er war gar nicht so erpicht darauf, sich Bohnen und anderes Gemüse selbst zu bauen. Hier fehlte ihm absolut nichts. Er hatte keine Sehnsucht nach irgend etwas anderem. Die Zeit war ihm zur Ewigkeit geworden.
In der dritten Woche kam die ›Indianarwa‹ ziemlich dicht an einer kleinen Insel vorbei, mit einer reizvollen Vegetation, mit Palmen, stark bestanden.
Jansen wunderte sich, dass man schon so weit im Süden war — noch mehr aber wunderte er sich über sich selbst, so gar kein Bedürfnis zu empfinden, zu fragen, wo man sich befände, was für eine Insel das eigentlich sei.
Er hörte zufällig nicht ihren Namen, er ergötzte sich an ihrem Anblick, und dann ging er wieder unter Deck an seine Arbeit.
Eine Woche später lief die ›Indianarwa‹ einen großen Hafen an, nahm Kohlen ein. Jansen empfand das nur als eine Störung, kam während drei Tage nicht an Deck. Seine vielen Diener störten ihn nicht, das waren nur Automaten, von denen erfuhr er also nichts, und so einen Barbier, der einem beim Rasieren alle Tagesneuigkeiten erzählt, ob man sie hören will oder nicht, bis man zuletzt grob werden muss — so etwas gibt es an Bord überhaupt nicht.
Die ›Indianarwa‹ dampfte wieder ab, und Jansen wusste gar nicht, was für ein Hafen das gewesen war, zu welchem Erdteil er gehört hatte.
Eben genau wie Tischkoff, welcher bekanntlich auch manchmal nach dem Verlassen eines Hafens, wenn er wieder an Deck erschien, gefragt hatte, was für eine Stadt das gewesen sei, aber auch nur, wenn er dazu einen besonderen Grund gehabt.
Durch nichts und niemanden ward Jansen in dieser glücklichen Arbeitsruhe gestört. Der Maharadscha hatte ihn noch nicht zu sehen gewünscht, niemand sprach ihn an, auch Graf Axel nicht, falls er diesen überhaupt einmal zu sehen bekam, und Jansen selbst hatte noch nicht daran gedacht, ihm von seinem geänderten Entschlusse Kenntnis zu geben.
Er glaubte, das müsse immer so weitergehen, bis... die ›Indianarwa‹ als ein Werk von Menschenhänden einmal ihren Untergang fände, und dann machte aber auch Jansen mit. Genau wie Tischkoff.
Aber er sollte doch in seiner glücklichen Ruhe, die keine Zeit mehr kannte, gestört werden.
Eines Tages, als ganz ruhige See war, begab er sich nach dem Schwimmbade, zu der gewöhnlichen Stunde, da er wusste, dass es von keinem anderen benutzt wurde. Aber sonst war bei solch einem Wetter immer alles bereit für einen Schwimmbedürftigen. Vielleicht auch reservierte man diese Stunde, die er immer pünktlich innehielt, nur für ihn, ebenso wie man doch auch an Bord der ›Sturmbraut‹ sich genau nach Tischkoffs Gewohnheiten gerichtet hatte, ohne dass er deshalb jemals ein Wort zu hören bekommen, also etwa so, wie man einen fürstlichen Gast bewirtet.
Ganz in Gedanken versunken, über den Sinn eines indischen Spruches grübelnd, betrat er die prächtige Schwimmhalle, ging nach seinem gewöhnlichen Platze, wo er sich entkleidete — und fuhr erschrocken aus seinem Träumen empor, als er fast über ein Weib gestolpert wäre, das da am Boden kauerte und sich eben die Füße abtrocknete.
Und das war nicht die einzige anwesende Person, die ganze Halle war voll Frauen und Kinder, die soeben aus dem Wasser kamen, noch mit Ankleiden und auch erst mit Abtrocknen beschäftigt, und dabei ging es durchaus nicht still zu. Aber der in eine andere Welt entrückte Mann hatte von alledem nichts gemerkt.
Ein erstaunter Blick auf das vor ihm liegende Weib, ein erstauntes Umsichschauen — dann zeigte Jansen, dass er noch immer der alte war.
Von jäher Röte übergossen, wandte er sich zur Flucht, auch gleich gewohnheitsmäßig ein ›pardon‹ murmelnd. Aber der Weg bis zum Ausgang war noch ein weiter, und er sollte auch nur einen Schritt tun können, da wurde ihm schon der Weg vertreten, von einem jungen, schönen Weibe, das um die braune Gliederpracht einen nur dünnen Bademantel geschlagen hatte.
»Wovor fliehst du, Faringi?«, redete sie ihn in reinstem Englisch an.
»O, verzeihen Sie, ich wusste nicht...«
»Warum entziehst du dich immer unserer Gesellschaft? Sind wir nicht deine Frauen?«
Es lässt sich denken, wie betroffen Jansen war. Aber es sei gleich bemerkt, dass er durchaus nicht an jene Szene erinnert wurde, da sich in der Mormonenstadt die Frauen mit ihren Kindern um ihn gedrängt hatten, um ihn als Gatten und Vater zu begrüßen.
Diese hier verhielten sich ganz anders, nur einige wenige traten langsam näher, zum Teil Kinder auf dem Arm, die meisten blieben mit indischer Teilnahmslosigkeit wo sie waren, höchstens ihre großen, dunklen Augen auf den Fremdling richtend.
»Ihr — meine — meine...«, konnte Jansen nur stammeln.
»Deine Frauen«, ergänzte jene. »Ja, wir sind deine Frauen.«
»Sie scherzen. Ich weiß gar nicht...«
»Ist das nicht dein Kind?«
Sie hatte einem anderen Weibe ein elfenbeinfarbenes Knäblein vom Arme genommen, hielt es ihm hin.
Ganz geistesabwesend starrte Jansen auf den vielleicht einjährigen Jungen, der ihm zappelnd und jauchzend die Ärmchen entgegenstreckte und jetzt richtig mit ›Papapapapa‹ anfing.
»Mein — mein Kind?!«, staunte Jansen nun immer mehr.
»Es ist der Lawaharadscha.«
»Der Lawaharadscha. Heißt das nicht soviel wie... der Kronprinz?«
»So ist es. Du gabst seinem in Iklahana irrenden Geiste wieder Fleisch und Blut.«
So weit war Jansen in die indische Religionslehre nun unterdessen eingedrungen, um zu wissen, was das hieß. Auch Graf Axel hatte schon einmal ähnliches gesagt: aus Geistern Menschen machen. Es ist einfach das Erzeugen von Kindern. Die Hindus glauben doch an eine Wiedergeburt, die Seele ist unsterblich, nach dem Tode wird sie in Iklahana, so eine Art Fegefeuer, geläutert, dann irrt sie als geisterhaftes Wesen umher, den Moment abpassend, da sie wieder in einen Mutterleib schlüpfen kann. Sie wählt sich ihre Eltern sogar aus, allerdings frei von allen egoistischen Zwecken, nur nach Gelegenheit zur geistigen Vervollkommnung strebend oder sich selbst strafend, was auch zum Vorteil ist, sodass es nicht immer menschliche Eltern zu sein brauchen. Oder man kann es eine Art von seelischer Anziehungskraft nennen. Wer im vorigen Leben wie ein Tier gelebt hat, wird auch zum Tiere, weniger zur Strafe als zur Besserung, als solches kann er nicht sündigen, muss aber alle Leiden eines Tieres durchmachen, was er dann in Iklahana erkennt.
Deshalb auch ist die Ehe bei den brahmanischen und buddhistischen Hindus ein noch viel heiligeres Sakrament, als bei uns Christen, aber nicht nur die Ehe, sondern auch die Zeugung, die gar nicht zu einer gemeinen Handlung entwürdigt werden kann, so wenig wie beim Tiere. Ein Geist sucht sich zu inkarnieren, wieder zu verfleischlichen. Daher auch das freie Geschlechtsleben bei aller, uns ganz unverständlicher Unschuld.
Und in Jansen ging schon eine Ahnung auf — er sollte ja hier aus Geistern Menschen machen — er wollte es nur gar nicht glauben.
»Es ist der Sohn der Eloha«, fuhr das Weib in seiner Erklärung fort.
»Der Eloha?«
»Der Maharadschina.«
»Ist das nicht der Titel des Lieblingsweibes des Maharadschas — der Großfürstin, wollte ich sagen?«
»Ja, das ist Eloha.«
»Und das ist ihr Kind?«
»Und du bist sein Vater.«
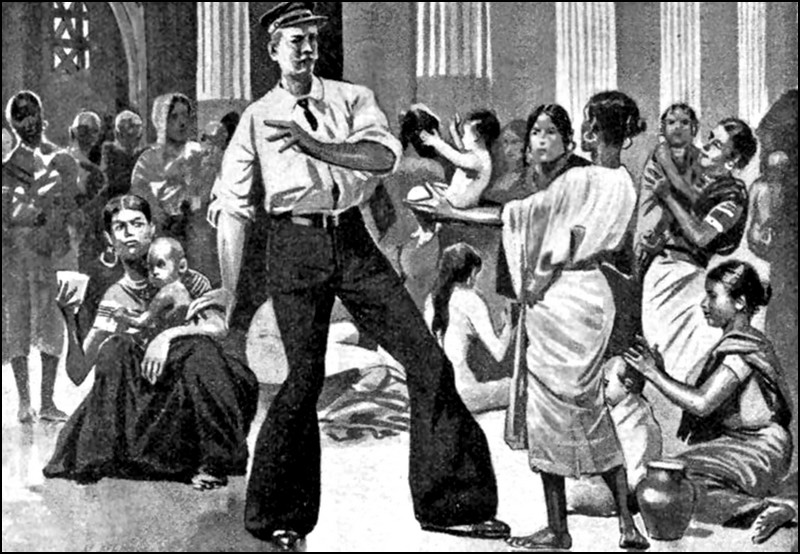
Da überkam Jansen abermals eine Ahnung — noch eine andere als vorher — und da sah er es selbst stehen, das braune, junonische Weib, die brennenden Augen auf ihn geheftet — und Jansen floh davon, wie Joseph vor Potiphars Weib geflohen sein mag. Nur, dass er seinen ganzen Anzug mitnahm.
In halber Betäubung erreichte er seine Kabine.
Ja, er hatte daran gedacht, als er sich auf diesem Schiffe heimisch zu fühlen begann, an jene Jugendsünde.
Es waren unterdessen kaum zwei Jahre vergangen, aber Jansen hatte sich ganz besonders in letzter Zeit so geändert, dass er da wohl von einer Jugendsünde sprechen konnte.
Etwas wie Beschämung war manchmal über ihn gekommen. Er hatte immer die Minute gefürchtet, da er vor den Maharadscha treten sollte, der gewiss doch wieder zwischen seinen beiden Lieblingsfrauen saß. Aber schließlich hatte er sich an diesen Gedanken gewöhnt. Es waren ja auch indische Verhältnisse, das merkte er besonders bei seinen jetzigen Studien.
Aber dass jene Geschichte solche Folgen haben könnte, daran hatte er denn doch nicht gedacht! Nun wurden alle seine moralischen Bedenken wieder aufgewärmt.
Und was hatte das Weib gesagt? Das alles wären seine Frauen? Was hatte Graf Axel gesprochen, von wegen Geistern, aus denen er...
Sein Gedankengang, der schon ziemlich lange gewährt hatte, während er aufgeregt hin und her gegangen war, wurde durch Graf Axels Eintritt unterbrochen.
»Wir sind am Ziele.«
Jetzt erst merkte Jansen, dass das Zittern der Schiffsplanken aufgehört hatte.
»An welchem Ziele.«
»An der heiligen Toteninsel.«
»Und wo soll diese sein?«
»Etwa vier Meilen von Kalkutta entfernt.«
»Ja, wie kommen wir denn dahin?«, staunte Jansen, zunächst alles andere vergessend.
»Wie meinen Sie? Worüber wundern Sie sich?«
»Wir sollen um ganz Afrika herumgefahren sein?!«
»Nein, wir sind um Kap Hoorn gegangen.«
Auch davon hatte Jansen nichts gewusst.
»Ja, und da sollen wir schon an der Ostküste Indiens sein?!«
»Nun, ich denke, in acht Wochen lässt sich das schon erreichen.«
»Was? Acht Wochen?!«, rief Jansen, in immer größeres Staunen geratend.
»Acht Wochen sind wir unterwegs gewesen.«
»Und ich dachte, es wären acht Tage — meinetwegen vierzehn Tage!«, murmelte Jansen kopfschüttelnd.
Dann erwachte er aus seinen Träumen, die Hauptsache war ihm wieder eingefallen.
»Ja, Herr Graf, dann kann ich wohl von Bord gehen?«
In den wenigen Minuten hatte sich also sein Entschluss total geändert.
»Deshalb komme ich eben«, entgegnete der Graf. »Wollen Sie mich nicht an Deck begleiten, dass wir das andere angesichts der Insel besprechen?«
»Einen Augenblick noch. Ich habe soeben eine mir unangenehme Begegnung gehabt...«
»Ich weiß davon bereits. Aber wieso unangenehm? Sie befanden sich auf der ›Freiheit von Indien‹.«
»Doch, es war mir unangenehm. Und nun sagte da eine Frau, das seien...«
»Auch das weiß ich schon. Die Frauen haben zufällig etwas gehört, es nicht verstanden und haben nun zu Ihnen gleich davon nach Weiberart geschwatzt.«
»Was haben Sie zufällig zu hören bekommen?«
»O, nichts von Bedeutung.«
»Aber für mich dürfte es von großer Bedeutung sein«, sagte Jansen mit Betonung. »Herr Graf, ich bitte Sie, mir hierüber reinen Wein einzuschenken. Sie erwähnten schon einmal, gleich bei unserer ersten Unterredung hier an Bord, dass Ihr oder wohl dieses ganzen Schiffes und seiner Besatzung Schicksal mit dem meinen verknüpft sei...«
»Ist dies bisher nicht auch schon mehrmals der Fall gewesen?«
»Bitte, lassen Sie mich aussprechen. Gleichzeitig sagten Sie etwas davon, dass es meine Bestimmung sei, aus Geistern Menschen zu machen — ein Ausdruck, den ich damals gar nicht verstand, über dessen Bedeutung ich auch nicht weiter nachgrübelte. Und jetzt sollen die Frauen des Maharadschas die meinen sein? Da müssen Sie doch etwas zu hören bekommen haben, wenn Sie mir das so offen ins Gesicht sagen können. Da muss ich wirklich um Aufklärung bitten.«
»Nun gut«, entgegnete der Graf nach kurzem Zögern, das aber nichts mit einer Verlegenheit gemein hatte. »Ja denn, es liegt dem auch etwas Reelles zugrunde. Aber es ist alles anders gekommen, als ich ursprünglich gedacht. Sie hatten doch während Ihres ersten Aufenthaltes auf unserer alten ›Indianarwa‹ ein Liebesverhältnis mit Eloha, der ersten Lieblingsfrau des Maharadschas. Nicht wahr?«
Jetzt war es Jansen, welcher gegen seine sonstige Gewohnheit in solchen Sachen nichts von Verlegenheit wusste. Er blieb ganz sachgemäß.
»Ich gebe es zu, wenn ich dabei auch ganz unschuldig war.«
»Ich weiß alles. Das ganze Schiff erfuhr es bald. Es war Bestimmung, dass gerade Eloha es sein musste, in deren Schlafkabine Sie damals drangen.«
»Ganz ohne meine Absicht.«
»Tut nichts zur Sache. Es war Bestimmung und — Sie haben ja nun doch wohl schon die indischen Verhältnisse kennen gelernt.«
»Das Verhalten des Maharadschas, der an meinem Lager sein Gebet verrichtete und mir dann einen guten Morgen wünschte, sagte mir schon genug«, entgegnete Jansen, aber nicht etwa auch nur an ein Lächeln denkend.
»Nun sehen Sie! Und diese Nacht ist nicht ohne Folgen geblieben. Das heißt, so drücken wir Abendländer uns aus. Hier wird darüber als von einem höchst freudigen Ereignis gesprochen.«
»Das heißt, der Lawaharadscha soll mein Sohn sein.«
»So ist es.«
»Das müsste aber erst bewiesen werden«, setzte sich Jansen jetzt doch auf die Hinterbeine.«
»Sie glauben es nicht?«
»Erlauben Sie wenigstens, dass ich es bezweifle.«
»Wer soll sonst sein Vater sein?«
»Was weiß ich? Doch jedenfalls der Gatte der Maharadschina,«
»Der Maharadscha selbst?«
»Und warum soll der nicht der Vater sein?«
»Weil es bei dem nicht mehr möglich war.«
Jansen hatte schon die Bemerkung auf der Zunge, dass dann doch noch immer ein anderer der Vater des Kronprinzen sein könnte, eben weil hier solche polnische oder vielmehr indische Verhältnisse herrschten, aber... eine derartige Verteidigung war ihm immer verächtlich vorgekommen, und ein Glück nur, dass sich Richard Jansen deshalb noch niemals hatte zu verteidigen brauchen.
»Die Maharadschina selbst behauptet, dass ich der Vater dieses ihres Kindes sei?«, fragte er statt dessen.
»Sie behauptet es.«
»Na, dann ist es ja gut, die muss es doch am besten wissen.«
Hiermit war dieser Streit beigelegt, Jansen hatte seine Vaterschaft anerkannt.
»Für diese ganze indische Gemeinschaft, welche ein Reich, eine Welt für sich bildet«, fuhr der Graf hierauf fort, »war selbstverständlich, dass der Vater des Kronprinzen nach dem Tode des Maharadschas nun auch die Oberleitung dieses Gemeinwesens übernehmen würde...«
»Ich?!«, unterbrach Jansen den Sprecher doch wieder etwas bestürzt.
»Jawohl, Sie, und das um so mehr, da unser Reich ja ein Schiff ist und Sie der tüchtigste Kapitän sind. Bitte, lassen Sie mich nur aussprechen. Damals allerdings, das heißt, bei der Geburt des Prinzen oder schon einige Zeit vorher, dachte man noch nicht an den Tod des Maharadschas, wenn wir Wissenden auch schon davon in den Sternen gelesen hatten. Da aber kam es, was wir also schon vorausgesehen, der Maharadscha wurde sterbenskrank, und kaum hatten wir die Zeichen seiner baldigen Auflösung aus Altersschwäche erkannt, als auch Sie schon von uns aus dem Meere als Schiffbrüchiger aufgefischt wurden.«
»Hm, allerdings ein merkwürdiges Zusammentreffen der Umstände«, brummte Jansen.
»Bestimmung. Und Sie können sich denken, wie nun das ganze Schiff erst recht glaubte, dass Sie von den Göttern — oder nennen Sie es Schicksal — zum Nachfolger des Maharadschas bestimmt seien.«
»Auch Sie waren davon überzeugt?«
»Gewiss, und ich habe mich mit denen, welche hier etwas mit in die Regierungsgeschäfte einzureden haben, darüber unterhalten — und zur Erbschaft eines verstorbenen indischen Fürsten gehören auch alle seine Weiber und Kinder — die Frauen haben etwas von diesem unseren Gespräch erlauscht und... so ist das eben alles gekommen, dass es Ihnen die Weiber, die daraus keine Heimlichkeit machen zu müssen glaubten, vorhin gleich direkt gesagt haben.«
»Hm. Aber, geehrter Herr Graf, ich bin durchaus nicht geneigt, die Führung dieses Schiffes zu übernehmen, noch weniger die vielen Frauen und Kinder des Maharadschas dereinst als die meinen, selbst wenn es in den Sternen geschrieben steht. Da wage ich den Sternen zu trotzen.«
»Ja, habe ich Ihnen denn etwa schon solch einen Vorschlag gemacht?«
»Nein, das allerdings nicht, aber...«
»Bin ich nicht vielmehr voll und ganz auf Ihren Wunsch eingegangen, sich auf eine einsame Insel zurückziehen zu wollen? Habe ich Ihnen da nicht einen guten Vorschlag gemacht?«
»Ich muss es zugeben. Ich verstehe nur nicht recht...«
»Wie sich eine Bestimmung des Schicksals mit der unbeschränkten Willensfreiheit des Menschen zusammenreimen lässt, darüber haben Sie, wie ich vernommen, ja schon oft genug mit jenem Manne gesprochen, den Sie Tischkoff nennen. Ja, der Mensch ist frei, und ferne von mir sei es, Ihren Entschluss ändern zu wollen. Wenn Ihnen diese Toteninsel nicht gefällt, so können Sie sich ja eine andere aussuchen. Wollen Sie dieselbe also nun in Augenschein nehmen?«
Noch gar nicht recht wissend, was er von dieser ganzen Unterhaltung halten sollte, folgte Jansen dem Vorausgehenden an Deck.
Da sah er auf Backbordseite allerdings ein liebliches Eiland, von dem die ›Indianarwa‹ in einer Entfernung von kaum einem halben Kilometer ankerte, bedeckt von einer üppigen Vegetation, bei der nicht einmal das besonders ausgewählte Laub der Bäume, wie wir für so etwas Zypressen bevorzugen, an den trüben Zweck der Insel erinnerte — mehr aber sah Jansen von dieser auch nicht; denn vor allen Dingen ward seine Aufmerksamkeit von dem gefesselt, was man da an Deck vornahm.
In der Mitte desselben, zwischen Schornsteinmantel und Großmast, wurden soeben von indischen Dienern Balken und Bretter, die sich in genügender Menge an Bord befunden haben mochten, hoch aufgetürmt, sehr kunstvoll in gewisser Anordnung, dass dazwischen immer freie Räume blieben, und das ganze, schon eine beträchtliche Höhe erreicht habende Stapel machte einen Eindruck, dass man gar nicht auf einen anderen Gedanken kommen konnte, als auf den, den auch Jansen sofort fasste.
»Was? Das soll wohl ein Scheiterhaufen werden?!«, fragte er überrascht
»Sie sagen es.«
»Aber auf ihm soll doch nicht etwa jemand verbrannt werden?«
»Gewiss, nach indischer Weise.«
»Ist denn jemand gestorben?«
»Der Maharadscha.«
»Der... Maharadscha?!«, konnte Jansen nur langsam wiederholen.
»Er ist tot.«
»Tot?! Seit wann denn?«
»Schon seit vierzehn Tagen.«
»Schon seit... vierzehn Tagen?! Und ich habe gar nichts davon erfahren?!«
»Sie haben sich ja niemals um etwas gekümmert, nie eine Frage gestellt.«
Da kam es Jansen zum Bewusstsein, wie teilnahmslos er doch während der acht Wochen für seine Umgebung gelebt hatte; eine gewisse Beschämung beschlich ihn, doch diese ward sofort durch den Grafen selbst wieder beseitigt.
»Außerdem«, setzte dieser noch hinzu, »ist deswegen hier auch wirklich gar kein Aufhebens gemacht worden. Wohl nur durch die Frage, ob Sie den Maharadscha einmal sprechen könnten, oder warum dieser, wie er beabsichtigt, Sie nicht zu sprechen begehre, hätten Sie davon erfahren können. Sonst wurde deshalb kein Wort verloren, so groß der Schmerz auch sein mag. Oder schließlich doch kein Schmerz. Der Marahadscha war ein Brahmane, der die letzte Wiedergeburt durchgemacht hatte, jetzt ist er sofort in Nirwana eingegangen.«
»Er hat mich nicht mehr sehen wollen?«, fragte Jansen leise; denn er war doch sehr erschüttert über diese plötzliche Kunde.
»In letzter Zeit war er gar nicht mehr fähig dazu, er erkannte niemanden mehr.«
»Ein leichter Tod?«
»Ein köstlicher Tod, wie ich ihn jedem wünschen möchte.«
»Er ist wohl mumifiziert worden?«
»Jawohl. Seine Leiche können Sie noch unverändert sehen.«
»Und er wird hier auf diesem Schiffe verbrannt?«
»Auf diesem Scheiterhaufen.«
»Die Asche kommt dann ebenfalls auf jene Insel?«
»Nein. Der Maharadscha hat bestimmt, dass sie auf dem Meeresgrunde ruhen soll — und schließlich dennoch auf der Insel. Man kann sich doch vorstellen, dass sich diese wie jede andere noch auf dem Meeresboden fortsetzt.«
»Das wird aber eine gefährliche Geschichte«, meinte Jansen, den immer höher sich auftürmenden Holzstoß betrachtend.
»Was soll gefährlich werden?«
»Das wird eine tüchtige Glut geben, da passen Sie nur auf, dass nicht das ganze Deck und das ganze Schiff in Gefahr... ja, was machen denn die?!«, unterbrach er sich bestürzt.
Einige Inder hatten große Kannen herbeigeschleppt, deren flüssigen Inhalt sie zwischen die Balken schütteten, so reichlich, dass es von allen Seiten wieder heraus und über das Deck lief, und der Geruch sagte sofort, dass es Petroleum war.
»Die tränken den Scheiterhaufen mit Petroleum«, bestätigte Graf Axel.
»Aber so unvorsichtig! Das ganze Deck wird ja überschwemmt! Ich kann schon gar nicht begreifen, wie man den Scheiterhaufen so einfach an Deck aufbaut, das gibt ja ein mörderisch großes Brandloch, und Sie bringen doch das ganze Schiff in Gefahr!«
»In was für eine Gefahr?«, fragte der Graf mit erkünsteltem oder wirklichem Gleichmut wie zuvor.
»Na, dass das ganze Schiff in Flammen aufgeht, so weit es nur brennbar ist!«
»Ja, wissen Sie denn nicht, was wir vorhaben?«
»Was vorhaben?«
»Nun, das wenigstens muss Ihnen doch bekannt sein, dass beim Tode eines vornehmen Inders auch dessen Frau verbrannt wird, und hat er deren mehrere, so werden eben alle verbrannt.«
Ja, das wusste Jansen schon von der Schule her, oder doch aus Jugendschriften — aber jetzt hatte er noch gar nicht daran gedacht, und wenn man so einen Fall wirklich erleben soll, dann ist das noch etwas ganz anderes, als wenn man es in Form einer Erzählung liest.
»Was? Alle Frauen sollen mitverbrannt werden?!«, rief Jansen erschrocken.
»Sämtliche!«
»Wie viele hat denn der Maharadscha gehabt?«
»Es sind achtunddreißig, welche auf diesem Scheiterhaufen neben der Leiche ihres Gebieters stehen und lebendig verbrannt werden, und nicht nur das, sondern dieses ganze Schiff wird ein feuerspeiender Begräbnisherd sein, in dem fast siebenhundert Menschen ihren Tod finden sollen.«
Jansen war entsetzt. Lange Zeit wollte er es gar nicht glauben.
»Also das ganze Schiff soll in Flammen aufgehen?«
»Das ganze Schiff, mit allem, was sich auf ihm befindet. Und dieser Hitze werden wohl auch die äußeren Eisenplanken nicht widerstehen, sie werden zerschmelzend in den Fluten des Meeres verschwinden. ›Die Freiheit von Indien‹ ist nicht mehr — mit dem letzten freien Fürsten von Indien soll auch sein auf dem Wasser geschaffenes Reich zugrunde gehen. So hat Maharadscha Ghasma Dschalip Subktadscha bestimmt.«
»Aber das darf ja gar nicht sein!!«, rief Jansen, immer mehr außer sich geratend.
»Wollen Sie dem etwa mit Hilfe von Polizei wehren?«, lächelte Graf Axel.
»Und sind denn die Frauen mit so etwas einverstanden?«
»Die kennen es doch gar nicht anders.«
»Und die ganze Besatzung?«
»Der ist der letzte Wille des Fürsten heilig.«
»Auch die Japaner?«
»Die gehören mit zur Besatzung — vielmehr zu unserem Reiche.«
»Die Frauen wissen es und können noch so heiter sein?«
»Das brauchte Sie doch nicht zu wundern; diese Inderinnen kennen es nicht anders, als dass sie mit der Leiche ihres Gatten verbrannt werden, aber... sie wissen es noch gar nicht.«
»Was wissen sie noch nicht?«, stutzte Jansen.
»Dass sie verbrannt werden. Ja, warum stutzen Sie da so? Die Sache ist ja ganz einfach. Diese Frauen, wie eigentlich wir alle — ich vielleicht ausgeschlossen — waren doch fest überzeugt, dass weder Sie noch überhaupt ein Mensch die Ehre, der Nachfolger des Maharadschas mit allen Rechten zu werden, ausschlagen könnte. Nur ich habe von vornherein daran gezweifelt. Und so ist es denn auch geschehen. Oder sind Sie doch vielleicht bereit, der Nachfolger des Maharadschas zu werden?«
Mit immer starreren Augen hatte Jansen den ruhigen Sprecher betrachtet, und da mit einem Male kam ihm die Erkenntnis, was für ein schlauer Diplomat dieser Mann doch war, was für eine Falle der ihm gestellt oder doch eine Alternative.
»Haaa, jetzt erst witterte ich Lunte! Weshalb haben Sie mir das nicht schon früher gesagt?«
»Was gesagt?«
»Dass ich vom Schicksal oder vielmehr von Ihnen und Ihren Genossen zum Nachfolger des Maharadschas bestimmt bin!«
»Ich glaube, darüber haben wir doch schon zur Genüge gesprochen. Ich hätte es selbstverständlich getan, wenn Sie nicht gleich bei unserer ersten Unterredung von Ihrer Sehnsucht nach einer einsamen Insel gesprochen hätten. Ich machte Ihnen schon den Vorschlag, dass Sie sich ein neues Schiff anschaffen sollten. Oder tat ich das nicht?«
»Das taten Sie allerdings.«
»Nun also. Da aber erkannte ich gleich, dass Sie sich nicht zum längeren Aufenthalt auf diesem Schiffe und noch weniger als Nachfolger des von allem Prunke umgebenen Maharadschas eigneten.«
»Lassen wir das einmal sein, bleiben wir bei der Hauptsache. Also, wenn ich auf diese mir angebotene Erbschaft verzichte, wenn ich an Land gehe, so werden die achtunddreißig Weiber verbrannt. Nicht wahr?«
»Jawohl, nebst ihren Kindern, soweit sie diese noch auf dem Arme halten können, und dann, wenn diese Feierlichkeit vorüber ist, kommt das ganze Schiff daran, mit allem, was sich auf ihm befindet.«
»Und wenn ich nun die Erbschaft annehme?«
»Dann bleibt alles beim alten.«
»Inwiefern beim alten? Wollen Sie mir das nicht etwas genauer detaillieren?«
»Nun, dann sind Sie eben der Maharadscha.«
»Ich bin aber doch kein Brahmane, bin überhaupt zu dieser Religion noch gar nicht übergetreten.«
»Gut, dann nennen Sie sich lieber den Kapitän oder noch richtiger den Herrn dieses Schiffes.«
»Der auch über das Ziel dieses Schiffes und über alles zu bestimmen hat?«
»Gewiss, das hat der Maharadscha immer gekonnt, dessen Stelle Sie voll und ganz vertreten sollen, auch wenn Sie kein Inder und kein Brahmane sind.«
»Kann denn da kein anderer für mich einspringen? Muss denn gerade ich es sein, der die hinterlassenen Frauen heiraten und dadurch das ganze Schiff mit allen Menschenleben erhalten soll?«
»Ja, das müssen gerade Sie sein.«
»Weshalb gerade ich?«
»Weil es so in den Sternen geschrieben steht.«
»Sie mit Ihren verfluchten Sternen!«, rief Jansen in hervorbrechendem Unmut. »Aber nein, geehrter Herr, Sie haben sich in mir geirrt, ich lasse mich durch Ihre überschlaue Diplomatie nicht fangen, und auch Ihre Sterne können mir gar nicht imponieren — Sie haben ganz einfach einen tüchtigen Kapitän an Bord haben wollen, oder überhaupt mich, der in Ihren Händen dasselbe werden sollte, was jedenfalls der Maharadscha gewesen ist — eine willenlose Puppe...«
»Sie irren vollkommen, Herr Kapitän«, wurde der aufgebrachte Jansen kühl unterbrochen. »Ich weiß überhaupt gar nicht, was Sie wollen — ich habe Ihnen die Offerte durchaus nicht gemacht — und ich selbst werde auch nicht den Verbrennungstod mit erleiden.«
»Nicht?!«, stutzte Jansen doch wieder.
»Nein. Ich werde auch nicht länger hier an Bord bleiben, selbst wenn Sie das Erbe des Maharadschas antreten und so das ganze Schiff erhalten.«
»Was wollen Sie tun?«
»Ich begebe mich mit auf jene Toteninsel und warte, bis das Boot kommt, welches allmonatlich den einsamen Totenwächter mit allem versorgt, was er braucht.«
»Von wo kommt dieses Boot?«
»Von Kalkutta.«
»Wie weit ist dieses entfernt von hier?«
»Kaum zehn Seemeilen.«
»Weshalb begeben Sie sich nach Kalkutta?«
»Um dort an einer gewissen Stelle, die ich Ihnen vorläufig aber noch verschweigen möchte, Bericht über alles Geschehene zu erstatten. Dieses Boot nimmt auch den Brahmanen mit zurück, der vorläufig noch auf der Toteninsel haust, und an jener Stelle werde ich auch gleich dafür sorgen, dass Sie als neuer Totenwächter bestätigt werden. Doch Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich mich vor diesem Massentode fürchte, ihm auf diese Weise aus dem Wege gehen will. So steht es eben in den Sternen geschrieben, die Sie vorhin verfluchten. Schließlich gehöre ich auch gar nicht so sehr zu diesem Volke der ›Indianarwa‹.«
»Wann ist dieses Boot zu erwarten?«
»Regelmäßig bei Vollmond, also in vierzehn Tagen.«
»Und so lange müsste auch ich auf dieser Insel ausharren?«
»Das geht wohl nicht anders zu machen.«
»O doch! Geben Sie mir nur ein Boot, dann will ich die Küste des Festlandes schon erreichen.«
»Außer mir darf niemand mehr dieses Schiff verlassen, und seine Verbrennung findet baldigst statt.«
»Ich brauche keine Ruderer, ich will schon allein hinüberkommen.«
»Auch das Boot muss ich Ihnen leider versagen, es muss alles und jedes mit verbrennen, es ist Bestimmung des Verstorbenen, welche heilig gehalten werden muss.«
Jansen biss sich auf die Lippen.
»Nun wohl denn, so werde ich mich zunächst nach dieser Insel begeben, wenn ich auch keine Lust mehr habe, mich dauernd auf ihr niederzulassen. Aber der Verbrennung möchte ich doch wirklich zusehen.«
»Wie Sie wünschen. Was wollen Sie mitnehmen?«
»Ich denke, es darf überhaupt nichts mehr herunter von dem der Verbrennung geweihten Schiffe?«, fragte Jansen spöttisch.
»Ganz so ist das ja nicht gemeint. Es handelt sich doch auch nur um Decken, Bücher und dergleichen.«
»Nur meine Manuskripte und einige Wäsche werde ich mitnehmen.«
Jansen begab sich wieder in seine Kabine zurück, um seine und die anderen Manuskripte in eine kleine, wasserdicht schließende Blechkiste zu verpacken, welche er früher einmal hier gefunden hatte.
Sein Gemüt war von einem Gemisch der verschiedensten Empfindungen erfüllt, die er nicht näher definieren konnte. Im allgemeinen aber waren es bittere.
Ja, er durchschaute den ganzen Plan, und es war nichts anderes als eine hinterlistige Falle, die man ihm gestellt. Dieser Graf Axel war von vornherein überzeugt gewesen, dass der unglückliche Mann, der durch den Verlust seiner ›Sturmbraut‹ und seiner Freunde alles verloren hatte, was ihn noch an diese Welt fesselte, niemals das Kommando über dieses üppige Schiff übernehmen würde. Da hatte er ihn vor eine Alternative gestellt: Entweder du wirst der Nachfolger des Maharadschas oder das ganze Schiff mit allen den siebenhundert Menschenleben geht in Flammen auf — und dann also bist nur du an ihrem Tode schuld, du hast sie auf deinem Gewissen.
Aber Jansen dachte nicht daran, sich auf diese Weise zwingen zu lassen. Das heißt, er glaubte auch noch nicht, dass es mit der Verbrennung des ganzen Schiffes wirklich Ernst werden könnte. Das alles war nur ein hinterlistiges Scheinspiel.
Dann packte er in einem größeren Koffer noch die Kleidungsstücke zusammen, die man ihm zur Verfügung gestellt, und begab sich wieder an Deck, bereit, das Schiff zu verlassen.
Auch Graf Axel war schon fertig, wartete auf ihn neben einem größeren Stapel von Kisten und Koffern, welche alsbald von japanischen Matrosen in ein Boot getragen wurden.
Ehe Jansen nachfolgte, blickte er noch einmal nach dem Holzstoße zurück. Dieser war immer höher gebaut worden, und soeben brachte man einen großen, glockenförmigen Gegenstand herbei, oder überhaupt eine riesige Glocke aus silberweißem Metall, genau eine solche, wie sie damals Tischkoff aus einem Steinhaufen auf einer einsamen Insel an der Küste Patagoniens zum Vorschein gebracht, die dann auch auf sein Geheiß auf der Fucusinsel zurückgelassen worden war, ohne dass man noch erfahren hätte, wozu dieser merkwürdige Gegenstand dienen sollte.
»Was für eine Glocke ist das?«, wurde jetzt Jansens Neugier doch rege.
»Kennen Sie das nicht? Das ist ein indischer Sarg, in dem die Leichen der Fürsten verbrannt, in dem dann ihre Asche beigesetzt wird. Es ist ein feuerfestes Metall. Die Asche des Maharadschas Ghasma wird in diesem Sarge nur nicht in der Erde, sondern auf dem Meeresgrunde ruhen.«
Die Erklärung war gegeben. Also auch jener geheimnisvolle Mann, der sich Tischkoff genannt, bevorzugte solch einen Verbrennungstod und hatte seinen glockenähnlichen Metallsarg immer bei sich gehabt.
»Auch die Frauen kommen in solche Särge?«, fragte Jansen nur noch.
»Nein, die sind nur für Fürsten bestimmt, und alle die anderen werden doch überhaupt lebendig verbrannt.«
Jansen kümmerte sich um nichts mehr, wollte es nicht — er folgte dem Grafen in das Boot nach, welches bald die Insel erreicht hatte.
Die beiden stiegen an Land, das Gepäck wurde von den Japanern nachbefördert, einige Worte zwischen diesen und dem Grafen, die Jansen nicht verstand.
»Herr Kapitän«, wandte sich dann der Graf an diesen, »bis zu der Hütte des Brahmanen sind noch zehn Minuten, aber die Matrosen müssen zurück, die Feierlichkeit auf dem Schiffe nimmt sofort ihren Anfang — ich meine, wir werden unser Gepäck wohl selbst nach der Hütte tragen müssen...«
»Nehmen Sie doch keine Rücksicht auf mich!«, entgegnete Jansen finster.
Die Japaner gingen wieder ins Boot und ruderten zurück, die beiden Abgesetzten standen neben ihren Sachen.
»Ja, da wollen wir einmal selbst Hand anlegen«, sagte der Graf, sich nach zwei seiner Koffer bückend, »in einer halben Stunde geht die Sonne unter, und es wird eine stockfinstere Nacht.«
Aber Jansen rührte sich nicht. Mit fest zusammengepressten Lippen sah er dem Boote nach, beobachtete, wie dieses an der ›Indianarwa‹ beilegte und gleich gehievt wurde, beobachtete weiter, wie man an Deck noch immer mit dem Bauen des Scheiterhaufens beschäftigt war, und man konnte in dieser Entfernung noch immer jede einzelne Person mit den bloßen Augen deutlich erkennen.
Da fuhr Jansen hastig zu seinem Begleiter herum.
»Herr Graf!«
»Bitte?«
»Ich hoffe, Sie scherzen doch nur.«
»Womit denn?«
»Dass dieses ganze Schiff mit all den siebenhundert Menschenleben meinetwegen verbrannt werden soll.«
Das ›meinetwegen‹ war ihm nur so herausgefahren.
»Ihretwegen?«, wiederholte denn auch der Graf erstaunt. »Wer sagt denn das?«
»Verstellen Sie sich nicht!«, schrie Jansen ihn da plötzlich wütend an. Doch der alte, ausgetrocknete Schwede ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Nun ja, in gewisser Hinsicht haben Sie ja recht. Nur an Ihnen liegt es, diese siebenhundert Menschen dem Leben zu erhalten.«
»Und es ist nicht wahr, und es ist nicht wahr!!«, schrie Jansen, immer mehr außer sich geratend.
»Was soll nicht wahr sein?«
»Die Frauen wie das ganze Schiff werden nicht verbrannt, nur weil ich nicht auf ihm bleiben will!«
»Sie werden es ja sehen.«
»Und es ist nicht wahr!! Die werden irgend einen Vorwand finden, um wieder die Anker zu lichten und davonzufahren.«
»Nein, die ›Indianarwa‹ wird nicht die Anker lichten, sondern an jener Stelle dort in Flammen aufgehen, sobald es finster geworden ist.«
»Dann macht man mir mit bengalischem Feuer und dergleichen nur ein Trugbild vor!«
»O, Sie werden sich schon überzeugen können, wie reell diese Verbrennung ist.«
Da plötzlich packte Jansen den Schweden mit eisernem Griff und setzte ihm gleichzeitig sein Dolchmesser auf die Brust.
»Dann soll das auch dein Tod sein, Halunke!!«, zischte er.
Dieser Schwede stand nicht so fest in den Boden gewurzelt, wie Tischkoff einmal unter Jansens Faust bewiesen hatte, aber sein Gesichtsausdruck blieb ruhig.
»Dann wäre mein Verhängnis, durch Ihre Hand meinen Tod zu finden. Aber Sie tun mir unrecht, Herr Kapitän. Ich habe mit dieser Sache absolut nichts zu schaffen gehabt. Der Maharadscha hatte bestimmt, dass Sie sein Nachfolger werden sollen, und sobald Sie zugesagt, hätten Sie auch diesen seinen letzten Willen schriftlich zu lesen bekommen. Und wenn Sie diese Erbschaft nicht antreten, so soll das ganze Schiff mit allem, was auf ihm ist, verbrannt werden. Das ist überhaupt eine indische Sitte, und was finden Sie denn so Besonderes dabei? Auch ich bin ein Germane, als Skandinavier vielleicht mehr als Sie. Und haben wir Germanen in unserer Vorzeit nicht dasselbe gehabt? Mit dem Herzog mussten auch seine Rosse und Gefolgsleute sterben, auf seinem Grabhügel gaben sich oft Tausende seiner Getreuen den freiwilligen Tod, um seinen Einzug in Walhalla verherrlichen zu helfen. Genau so ist es hier. Herr Kapitän, geben Sie sich doch keinen schwermütigen Gedanken hin. All diese Inder und Japaner, Männer wie Weiber, nehmen Ihnen durchaus nicht übel, dass Sie eine Absage gegeben haben, dass sie nun in den Tod gehen müssen. Der Tod ist diesen Indern kein Schrecken. Sie werden sie ja nachher singen und jauchzen hören, auch wenn die Flammengluten sie schon umspielen.«
Noch ein wilder Blick, der immer erstarrter wurde, und Jansen gab sein Opfer frei.

Ja, sie machten Ernst!
Überall waren an Deck Pfannen mit Teer und Werg aufgestellt, welche ein fast taghelles, freilich sehr rotes und qualmendes Licht verbreiteten, und im Scheine dieser Fackeln vollzog sich die heilige Zeremonie.
In dichten Reihen umstand die ganze Besatzung des Schiffes, an die siebenhundert Menschen, Männer, Frauen und Kinder, den ungeheueren Holzstoß, auf dessen Gipfel schon die große Glocke mit des Maharadschas irdischen Resten thronte.
Sie alle hatten sich festlich geschmückt; noch bunter herausstaffiert und zugleich mit herrlichem Geschmeide behangen waren die Bajaderen, welche jetzt singend in langer Reihe herankamen, um den Holzstoß zu umringen, zu umtanzen, wozu der alte Toghluk den Takt angab.
Auch die Umstehenden stimmten mit ein in den heiligen Gesang, in dem die Namen Brahma, Wischnu und Siwa die Hauptrolle spielten.
Und lebhafter ward der Tanz der Bajaderen und rauschender der allgemeine Sang, als, von allen anderen Frauen des Maharadschas geführt, Eloha erschien, ein Knäblein auf dem Arme, den Kronprinzen, dessen Herrlichkeit nicht länger als ein Jahr hatte währen sollen.
Doch das ist für die Hindus ja ganz gleichgültig, das ist nur ein kurzes Untertauchen in die Schatten des Todes, und der, der einmal zum Herrschen auf dieser Erde bestimmt war, würde in einer ganz anderen Herrlichkeit wiederkehren, so wie alle anderen dem Tode Geweihten zu einem neuen Leben, in dem sie ihre Bestimmungen zu erfüllen hatten.
Graf Axel hatte gesagt, alle Frauen des Maharadschas würden mit ihren Kindern den Scheiterhaufen besteigen, um gleichzeitig zu sterben.
Dem war aber nicht so. Ganz allein bestieg das braune, junonische Weib, welches früher zur Rechten des Fürsten gesessen, auf dazu vorgerichteten Stufen den Scheiterhaufen, bis sie neben dem glockenähnlichen Sarge stand, ihr Kind im Arm, und nichts war ihr anzusehen, dass sie etwas wie Grausen oder Todesfurcht empfände.
Hochaufgerichtet stand sie in ihrer ganzen exotischen Schönheit da, in schillernde Seide gehüllt, überladen mit dem kostbarsten Geschmeide aller Art, und wie sie zum Feste gekleidet war, so lag auch nichts anderes als ein glückliches Lächeln auf ihren schönen Zügen.
»Brahma, Vishnu, Shiwa!«, erklang es noch einmal im Chor, diesmal mit einem gellenden Jauchzen, und da sprang der ausgetrocknete Fakir auf, ergriff eine der brennenden Pfannen und schleuderte sie gegen den Holzstoß.
Im Nu stand dieser in hellen Flammen und... Graf Axel hatte doch recht gehabt!
Ringsum war das ganze Deck dermaßen mit Petroleum getränkt, dass auch die ganze Umgebung plötzlich hoch aufloderte, und jedenfalls waren Vorkehrungen getroffen, dass gleichzeitig das ganze Schiff an allen Enden Feuer fing.
Wohl waren die zunächst Stehenden instinktmäßig vor den ihnen entgegenschlagenden, aus dem Boden kommenden Flammen zurückgewichen, dann aber stürzten sie sich unter einem jauchzenden Singen geradezu hinein, und so würden dennoch alle zugleich ihren Tod finden, nicht nur die übrigen Frauen des Maharadschas gleichzeitig mit der Favoritin.
Aber zu solch einer Katastrophe sollte es nicht kommen.
Noch war es ein erstes Aufflammen des Petroleums gewesen, noch hatte das Holz selbst nicht Feuer fangen können, als plötzlich in der Menge die riesenhafte Gestalt eines Mannes auftauchte, triefend, wie aus dem Wasser gezogen, jedenfalls auch erst aus diesem kommend.
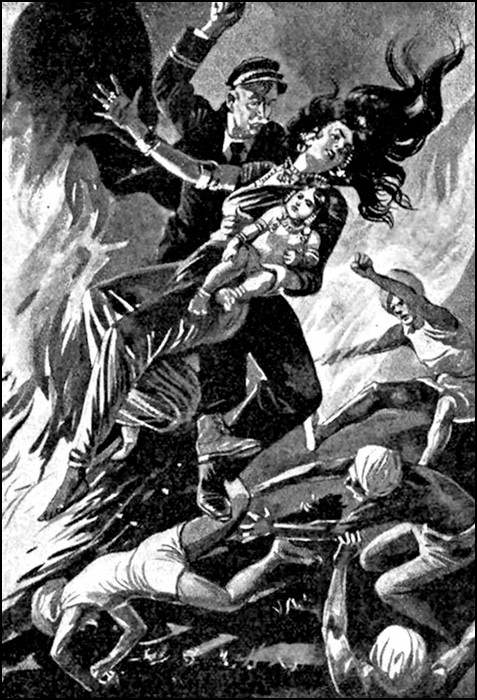
»Nicht meinetwegen, nicht meinetwegen!!!«, überklang die Stimme dieses Mannes all das ohrenbetäubende Singen und Jauchzen, mit drei riesigen Sätzen war er den Scheiterhaufen hinauf, in den Flammen verschwunden... da aber tauchte er an der anderen Seite schon wieder auf, nicht allein, sondern das junonische Weib samt dem Kinde im Arm und war mit einem Sprunge auch schon wieder herab.
Und dann donnerte Jansens mächtige Stimme Kommandos, um des mit furchtbarer Geschwindigkeit um sich greifenden Feuers Herr zu werden, und die fanatische Menge suchte keinen freiwilligen Tod in den Flammen mehr, sondern man gehorchte diesen Kommandos, und das war ein ganz anderes Jauchzen, welches jetzt auf dem brennenden Schiffe erscholl.
Wieder müssen wir uns mit einem anderen Schiffe beschäftigen. Es ist eine große Dampfjacht, welche mit Ausschluss der Maschine unter vollen Segeln auf offenem Meere treibt, westlich von Chile, aber weit, weit entfernt von der Küste.
Von den an Deck herumlungernden Matrosen, die bei diesem Winde nichts zu tun haben, ist nichts weiter zu sagen, als dass sie alle mehr oder weniger zerfetzte Gesichter besitzen. Jedenfalls Novascotiamen.
Versetzen wir uns in die Kajüte, mit jenem Luxus ausgestattet, den wohl jeder aufwendet, wenn er sich nun einmal solch ein ganzes Schiff nur zu seinem Vergnügen leisten kann.
In dieser befinden sich fünf Herren. Der eine, der schon sehr gläserne Augen hat, trinkt Brandy mit Zucker; ein zweiter, klein und sehr dick und mit einer mächtigen, blauangehauchten Gesichtsgurke, flickt einen Riss in einer ganz merkwürdig aussehenden Weste, welche er zu diesem Zwecke erst ausgezogen hat, und dabei zeigt sich, dass er kein Hemd trägt, sondern nur ein Vorhemdchen, noch dazu ein sehr kurzes; ein dritter, dem Aussehen nach ein Franzose, dreht und raucht eine Zigarette nach der anderen, wobei er zum Drehen immer so lange Zeit braucht, bis die angebrannte alle ist; ein vierter, der nur ein Ohr hat, ist damit beschäftigt, mit seinem Bowiemesser von dem kostbaren Mahagonitische lange Späne abzuschneiden; der fünfte endlich schießt durch ein riesiges Blaserohr mit gefiederten Pfeilen nach den geschnitzten Engelsköpfen an der Holzwand der Kajüte.
Der Leser hat sie natürlich bereits erkannt — die fünf Seezigeuner, welche einmal Inselzigeuner hatten werden wollen.
Damals, als Barnum das Interview mit der ›Sturmbraut‹ arrangiert, hatten sie sich von Jansen getrennt — als echte Seezigeuner selbstverständlich ohne jeden Abschied.
Sie hatten sich in New York wieder Schiffe besorgen wollen, jeder sein eigenes, hatten es auch wirklich getan, aber als sie so weit gewesen, hatten sie gemerkt, dass sie sich eigentlich doch schon recht aneinander gewöhnt.
Nein, lieber nicht! Also die einzelnen Schiffe wurden wieder verkauft oder einfach im Stiche gelassen, sie hatten sich eine größere Jacht zusammen angeschafft, hier die ›Zingalia‹.
Sehr gut gewählt war dieser Name ja. Zingalo heißen die Zigeuner in Spanien, sie selbst nennen sich gewöhnlich so, denn in Spanien sind die Zigeuner heutzutage ja eigentlich zu Hause, noch viel mehr als in Ungarn.
Zingalia — also ein Zigeunerstaat, auf ein Schiff übertragen. Aber gerade zu diesem Schiffe wollte der Name doch nicht recht passen, es wurde nichts mit einer lustigen Zigeunerwirtschaft.
Sie waren genau wieder in dasselbe Leben geraten, welches sie schon früher geführt hatten, diese Sportsmen, welche sich immer auf See aufhalten mussten, weil sie einfach an Land unmöglich waren: sie langweilten sich.
Nur durch Jansen und vielleicht mehr noch durch Karlemann war in dieses ihnen unsäglich langweilige Leben Abwechslung gekommen, sie hatten es sogar lebenswert gefunden. Da hatten sie unisono den Streich begangen, die ›Sturmbraut‹ zu verlassen.
Nun, das konnte ja wieder gutgemacht werden. Aber vergebens hatten sie mit ihrer ›Zingalia‹ die ›Sturmbraut‹ in allen Erd- oder vielmehr Meeresgegenden gesucht. Eine Heimat hatte dieses echte Zigeunerschiff nicht, gab niemals eine Adresse auf, und wo es einmal gewesen war, da kamen sie stets zu spät hin, ihre Annoncen im ›Lloyd‹ blieben unbeantwortet — kurz, sie hatten den Anschluss nicht wieder finden können.
Und dann hatten sie jene Katastrophe erfahren, welche Jansens Zigeunerherrlichkeit ein Ende machte.
Dass diese fünf Jagdsportsmen alles aufgeboten hätten, um ihre Freunde zu befreien, mit List oder mit Gewalt, wobei es ihnen auf gar nichts angekommen wäre, das braucht wohl nicht erst versichert zu werden. Aber die ganze Untersuchung hatte doch nur drei bis vier Monate gedauert, und gerade so lange war die ›Zingalia‹ auf der anderen Seite der Erdkugel auf hoher See gewesen.
Kurz, sie erfuhren nur, wie ihre Freunde von der ›Sturmbraut‹ den Heldentod gefunden hatten — dann konnten sie ihnen einige Tränen nachweinen, wenn diese nervenlosen Männer noch einer Träne fähig gewesen, lieber veranstalteten sie zu Ehren der heldenhaften Freunde ein solennes Zechgelage... es war eben vorbei.
Was nun? Nun konnten die fünf genau wieder so wie früher leben. Nur dass sie sich jetzt gemeinschaftlich langweilten. Denn man glaube doch ja nicht, dass den beiden ersten dieser Sportsmen, die wir kennen gelernt, dem Puppenkleiderfabrikanten und dem Haarwasseronkel, ihre damalige Duelliererei auf Kanonen und ganze Schiffe ein besonderes Vergnügen bereitet habe! O nein, nur um die Langeweile totzuschlagen, nichts weiter.
Jetzt hatte der Puppenkleiderfabrikant, Mr. Fairfax, ein Vergnügen daran gefunden, alle Tische mit seinem Bowiemesser zu Spänen zu zerschneiden, schon seit längerer Zeit tat er nichts weiter, hatte schon etliche Tische in Fidibusse verwandelt — und seitdem die ›Zingalia‹ etwas den Amazonenstrom hinaufgefahren war, wobei man eine Begegnung mit echten Botokuden gehabt — aber so etwas wie ein interessantes Abenteuer gab es für diese abgestumpften Menschen ja gar nicht mehr — seitdem schoss Mr. Brown mit einem echt botokudischen Pusterohr, pustete schon seit sechs Monaten nach den Engelsköpfen oder nach sonst etwas. Manchmal pustete er auch einem Matrosen ins Hinterteil, schoss einen spitzen, gefiederten Pfeil hinein. Aber machte das etwa besonderen Spaß? Der Matrose zog einfach den Pfeil heraus und hielt grinsend die offene Hand hin, um sie sich mit Gold füllen zu lassen. Dann waren die Novascotiamen schon so weit, wie bei uns die Treiber, die sich ja auch zu gern anschießen lassen, womöglich so empfindlich, dass dabei gleich eine Leibrente herausspringt.
Auch Lord Seymour hatte seine Beschäftigung gefunden. Seit einiger Zeit unterlag Admiral Nelsons siegreiche Hose doch dem Zahne der Zeit, sie wurde mit einem Male an allen Ecken und Kanten morsch, bei jedem Bücken des fetten Lords entstand irgendwo ein Riss — und als ob dies auf ein gemeinschaftliches Signal geschehe, so zeigte auch plötzlich das Fell des alten Menschenfressers, zur Weste verarbeitet, das Bestreben, in die Brüche zu gehen, und da half kein Einschmieren und nichts, immer entstand einmal ein Riss in der Menschenhaut.
Nun war aber doch ganz ausgeschlossen, dass Lord Seymour an diese seine Heiligtümer eine andere Hand gelassen hätte. Also flickte er die Risse immer selbst. Da er aber nun bekanntlicherweise kein Unterzeug trug, aus irgendeinem Grunde nicht einmal ein Hemd — wahrscheinlich wollte er eben die Weste aus Menschenhaut auf bloßem Leibe haben, es war doch wohl etwas Aberglaube dabei — und da der edle Lord überhaupt keine anderen Kleidungsstücke mehr kannte, so paradierte er entweder immer ohne Hosen oder ohne Weste, d. h. entweder mit nackten Beinen oder mit nacktem Oberkörper.
Nur Mr. Rug und Monsieur Chevalier waren sich in ihren Lebensaufgaben treu geblieben. Der erstere trank nach wie vor Brandy mit Zucker, bis er umfiel, der letztere rauchte nach wie vor Zigaretten, die er sich erst selber machte — Arbeit genug, um den ganzen Tag auszufüllen. — — —
Seit zwei Stunden war in dieser hochedlen Gesellschaft kein einziges Wort gefallen.
Da eröffnete Mr. Rug die Unterhaltung damit, dass er polternd vom Stuhle fiel. Der Australier hatte für heute sein Tagewerk verrichtet.
»Jonny — Brandy — mit...«, lallte er noch, und dann fing er an zu schnarchen.
Kein Klingelzeichen war nötig, um Matrosen hereinzurufen, das mächtige Poltern war auch an Deck gehört worden, vier Matrosen erschienen sofort, gleich eine Art Bahre mitbringend, trugen Mr. Rug hinaus, der jetzt von seinem eigenen Arzte behandelt wurde, und das ging alles so geschäftsmäßig vor sich, als passiere das... täglich dreimal. Aber es kam täglich nur zweimal vor, dass der Australier sich betrank, wieder nüchtern wurde und abermals umfiel.
Hierauf gähnte Mr. Brown laut hörbar, wobei er natürlich einmal mit dem Pusten aussetzen musste, sodass auch das Klatschen der Pfeile gegen die Wand aufhörte, und das wieder veranlasste den einohrigen Fairfax, nach seinem Freunde zu blicken, welcher noch immer mit weitgeöffnetem Rachen dasaß.
»Mr. Brown«, nahm der Puppenkleiderfabrikant endlich auch das Wort, nachdem er lange genug den anderen mit aufgerissenem Munde betrachtet hatte.
»Was gibt's denn?«, fragte der Angeredete, nachdem er seinen Rachen mit einem hörbaren Krach zugemacht hatte.
»Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass Sie vergessen hatten, Ihren Mund wieder zu schließen.«
»Ich gähnte, war nur noch nicht fertig.«
»Dann bitte ich um Entschuldigung, Sie gestört zu haben.«
Also Mr. Brown gähnte weiter, und hier wirkte dieser Krampf des Unterkiefers ganz besonders ansteckend, alle anderen unterstützten ihn dabei.
»Es ist nicht zum Aushalten«, sagte Lord Seymour, als er sich genügend ausgegähnt hatte, und griff sich an sein Hinterteil. »Keine Bewegung kann man mehr machen — kaum schließe ich den Mund, da platzt mir wieder hinten die Hose. Haben Sie gehört, wie's krachte?«
»Sie haben eine zu kurze Haut«, meinte Monsieur Chevalier.
»Nein, nicht die Haut, nur die Hose ist ihm hinten geplatzt,« nahm Fairfax für den Lord Partei.
»Das wäre schlimm, wenn wirklich seine Haut zu kurz wäre. Dann könnten wir noch etwas ganz anderes zu hören bekommen als nur ein Reißen seiner Hose, wenn er gähnt und den Mund wieder zumacht.«
Aber beide oder alle drei hatten das mit den gelangweiltesten Mienen hervorgebracht.
»Wo befinden wir uns eigentlich?«, fuhr nun, da das Gespräch einmal in Gang gekommen, Mr. Fairfax fort, dabei aber nicht vergessend, wieder lange Späne von dem Tische zu hobeln.
»Vorgestern haben wir das Kap passiert«, entgegnete Mr. Brown während seines Pustens.
»Welches Kap?«
»Das Kap der guten Hoffnung.«
»Was?!«, sagte Monsieur Chevalier, aber ohne jedes Staunen.
»Da können wir doch nicht schon im roten Meere sein.«
»Nein, wir sind auch nicht um das Kap der guten Hoffnung gefahren, sondern wir haben vorgestern Kap Hoorn passiert.«
Um der Streitigkeit ein Ende zu machen, wurde der Steuermann gerufen.
Dieser erklärte, dass der letzte Sprecher, Lord Seymour, mit seiner Behauptung recht habe. Kap Hoorn war es gewesen, das man vorgestern passiert hatte.
Also diesen fünf Herren ging es genau so, wie damals Jansen, nur die Ursache dieser Teilnahmslosigkeit war eine etwas andere.
»Ja, wohin segeln wir eigentlich?«
»Es war doch die Osterinsel bestimmt«, meinte der eine.
»Bestimmt? Nicht, dass ich wüsste«, entgegneten gleichzeitig die drei anderen, die noch in der Kajüte vorhanden waren.
»Wir wollten doch nachsehen, was aus den wilden Tieren geworden ist.«
»Ach so — ja — das können wir machen.«
Und dann wieder ein allgemeines Gähnen:
»Ach, ist das langweilig!«
Da kam abermals der wachhabende Steuermann herein.
»Meine Herren, ein großer Dampfer ist in Sicht.«
»Nun und?«
Was hatte denn der, dass er solch eine gleichgültige Meldung brachte?
»Als ich die ›Zingalia‹ signalisierte, zeigte er eine blaue Flagge mit weißem Stier.«
»Wohl die ›Indianarwa‹?«
»Kein anderes Schiff.«
»Will sie etwas von uns?«
»Sie hat uns nur begrüßt.«
»So grüßen wir sie wieder. Gut!«
Der Steuermann rückte ab, etwa wie ein begossener Pudel. Der erst vor kurzem angenommene Offizier, kein echter Novascotiaman, hatte geglaubt, den Herren, die sich immer so langweilten, eine recht überraschende Nachricht bringen zu können. Aber es war nichts damit gewesen, es machte nicht den geringsten Eindruck auf die abgekitzelten Nerven, auch jetzt wandten sie keinen Blick nach einem Bullauge, um das Schiff zu mustern, dessen Name wenigstens doch auch in ihren Schicksalen schon eine Rolle gespielt hatte.
Aber vielleicht waren sie nur zu faul, sich an Deck zu begeben, nur den Kopf zu drehen, denn gesprochen wurde jetzt noch darüber. Das Bewegen der Kinnladen erforderte etwas weniger Anstrengung.
»Der damals von der Fucusinsel verschwundene Maharadscha hat sich ein neues Schiff angeschafft.«
»Weiß schon«, lautete die allgemeine Antwort auf diese Erklärung des einen, der den Mund am wenigsten halten konnte.
»Hat es wiederum ›Indianarwa‹ getauft.«
»Weiß schon. Ist aber nur sechstausend Tonnen groß.«
»Der Maharadscha ist überhaupt tot.«
»Stimmt.«
»Seit wann?«
»Seit einem halben Jahre.«
»Zuletzt ist er doch in London gewesen.«
»Ja, um sich die Papiere der ›Sturmbraut‹ geben zu lassen.«
»Wie kam der dazu?«
»Fragen Sie! Jansen war mit dem doch immer verbündet gewesen.«
»Wozu wollte er die Papiere?«
»Weiß nicht.«
»Er soll ja einen Nachfolger bekommen haben.«
»Woher wissen Sie das?«
»Es stand doch des Langen und Breiten in allen Zeitungen.«
»Lese keine Zeitungen, weder lange noch breite.«
»Wie ist denn das möglich?«
»Was soll nicht möglich sein?«
»Dass der Maharadscha von — von — von welchem Reiche war er Maharadscha?«
»Von Bunterkund.«
»Sie meinen wohl die Provinz Bundelkund?«, wurde verbessert.
»Der Maharadscha von Bunterkund, hahaha, sehr gut das!«, lachten aber die anderen, doch wohl nur, um den Mund einmal auf andere Weise verziehen zu können.
Seitdem aber blieb es bei ›Bunterkund‹, obgleich Maharadscha Ghasma auch gar nichts mit der Provinz Bundelkund zu tun gehabt hatte.
»Und weshalb soll der Maharadscha von Bunterkund keinen Nachfolger haben können?«, wurde dann wieder gefragt.
»Weil kein Sohn da war.«
»Eben deshalb hat er testamentarisch einen anderen zum Nachfolger bestimmt.«
»Kann so ein abgesetzter indischer Fürst denn das?«
»Bei diesem Maharadscha hat England wohl eine Ausnahme machen müssen.«
»Es handelt sich auch nur darum, dass er auf seinem Schiffe als solcher anerkannt wird.«
»Und dann noch mehr darum«, wurde ergänzt, »dass dieser Nachfolger, der den gleichen Titel führt, auch alle die Apanagen und die sonstigen Gelder des Erblassers erhält.«
»Und er bekommt sie?«
»Sicher! Das hat alles jener Graf Axel arrangiert, von dem Jansen uns so viel erzählt hat.«
Eine kleine Pause trat in der Unterhaltung ein, welche Lord Seymour dazu benutzte, seine Hose auszuziehen, um auch deren neue Wunde zu sticken, und da er vergaß, seine Weste vorher anzuziehen, eine Jacke überhaupt nicht trug, so saß der Dickwanst jetzt nur noch in einer Bauchbinde da, deren Länge glücklicherweise genügte, um ein Feigenblatt zu ersetzen. Und das Vorhemdchen nicht zu vergessen!
»Auch diese neue ›Indianarwa‹ soll ja grandios ausgestattet sein«, eröffnete dann einer wieder das Gespräch.
»Na ja, gerade wie auf der alten, wie Jansen uns erzählte. Sie haben ja auch alles mitgenommen.«
»Alles von Silber und Gold.«
»Bah, Silber und Gold!«, erklang es verächtlich. »Alles gespickt mit Edelsteinen.«
»Bah, Edelsteine!«
»An die hundert der schönsten Weiber.«
»Bah, Weiber! Können Sie uns nichts anderes sagen, was da grandios sein soll? Das haben wir doch schon alles von Jansen zu hören bekommen, und der war so vernünftig, diesen ganzen Larifari in einem Atemzuge zusammenzufassen.«
»Welch anderer als Jansen will denn überhaupt darüber berichten, wie es auf der ›Indianarwa‹ aussieht?«, meinte ein anderer. »Und der hat doch auch nur die alte ›Indianarwa‹ unausgeräumt zu sehen bekommen. Als wir auf ihr waren, war ja schon die Hauptsache weg.«
»Nun, auf die neue ›Indianarwa‹ sind doch auch schon welche gekommen, die davon berichten können.«
»Wer denn? Auf dieses indische Schiff kommt kein fremder Mensch.«
»Auch nicht, wenn sie im Hafen liegt?«
»Da erst recht nicht. Ach, was für Mühe haben sich die Zeitungsreporter da schon gegeben!«
»Soll man es nicht auch einmal mit einer Verhaftung versucht haben, vielleicht eben nur deswegen provoziert, um in die Geheimnisse dieses heiligen Schiffes zu dringen?«
»Hat man, in Marseille, als es sich dort einmal verproviantierte. Aber nur eine Depesche nach Paris, und der Präfekt von Marseille bekam ebenfalls telegrafisch eine Nase — so lang. Diesem Maharadscha kann man doch nichts wollen.«
»Aber es sind dennoch Fremde an Bord gekommen.«
»Wer denn?«
»Kennen Sie nicht die beiden Fälle?«
»Nein.«
»Einmal wirkliche Schiffsbrüchige. Ich weiß nicht mehr, von welchem Schiffe. Wohl ein englisches. Die wurden ganz freundlich aufgenommen — aber zu sehen haben die nichts bekommen, bis man sie im nächsten Hafen absetzte.«
»Und der zweite Fall?«
»Da hat sich ein Berichterstatter vom ›New York Herald‹ als Schiffbrüchiger ausgegeben, hat sein Schiff im offenen Boote verlassen, natürlich die Gelegenheit abpassend, dass er auch von der ›Indianarwa‹ erspäht wurde. Es war ein wagehalsiges Stückchen, der Kerl, der sich in Lumpen gekleidet, wurde tatsächlich halbverschmachtet aufgefischt.«
»Von der ›Indianarwa‹?«
»Eben von dem indischen Schiffe, auf das er es abgesehen. Insoweit war es ihm geglückt, viel mehr hat er aber nicht erreicht. Ja, er wurde auch vor den Maharadscha geführt, es soll ein baumlanger Kerl mit langem, schwarzem Vollbart sein, der zwischen zwei Weibern saß...«
»Der Vollbart?«
»Nee, der Maharadscha, der neue. Aber weiter bekam der Reporter auch nichts zu sehen, dann wurde er in eine Kabine gesteckt, durfte sie nicht verlassen, nur zum Spazierengehen an Deck, und dann war dieses wie ausgestorben. Sonst hat er auch nicht das geringste Interessante erspäht, was des Berichtens wert gewesen. Und wissen Sie, wer das gewesen ist?«
»Mr. Sparrow jedenfalls nicht.«
»Eben Tom Sparrow.«
Es war ein welt, oder doch in ganz Amerika durchaus bekannter Name — ein Zeitungsberichterstatter, welcher, um dem Publikum etwas Interessantes berichten zu können, alles riskierte und wirklich auch das fast Menschenunmögliche fertig brachte. Es kam ihm gar nicht darauf an, wenn es ein interessantes Gespräch zu belauschen galt, in einen Kamin zu kriechen, in dem schon Feuer brannte, sich also bei lebendigem Leibe räuchern zu lassen, und ein andermal war er zu demselben Zwecke in ein noch viel unappetitlicheres Rohr gekrochen.«
»Und auch der hat nichts erspähen können?«
»Wie ich sagte. Man hielt ihn bis zur Ankunft im nächsten Hafen wie einen Gefangenen, und da half ihm keine seiner sonstigen Künste und Listen, er vermochte keinen Schritt allein zu tun.«
»Na, das hätte ich an seiner Stelle sein sollen«, meinte Lord Seymour, Admiral Nelsons siegreiche Hose auf den nackten Knien und gegen das Licht mit dem Faden nach dem Nadelöhr stichelnd.
»Sie, Mylord?«, hieß es spöttisch. »Sie wollen sich in dieser Beziehung doch nicht etwa mit Tom Sparrow vergleichen!«
»Ich nicht? Sehe ich denn etwa auch aus wie so ein ausgehungerter Sperling?«
Sparrow heißt nämlich Sperling — und dabei war Seymour aufgestanden, reckte seine Bauchbinde heraus und zupfte das Vorhemdchen zurecht.
Nein, wie ein ausgehungerter Sperling sah das dicke Männchen nun allerdings nicht aus — doch ehe man dazu kam, ihm dies zu versichern, stieß Monsieur Chevalier einen lauten Jauchzer aus, der ebenso freudig wie schmerzlich klang, und dann fing der Franzose zu spucken an.
»Was haben Sie denn, Chevalier?«
»Mir die Zigarette verkehrt in den Mund gesteckt«, entgegnete der Gefragte, nachdem er sich ausgespuckt hatte. »Und trotzdem, ich hab's, ich hab's!! Meine Herren, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schon seit langer, langer Zeit gehe ich mit dem Plane um, diese Erde zu verlassen...«
»Auf welche wollen Sie denn sonst gehen?«
»... 's ist gar zu erbärmlich langweilig hier«, fuhr der Sprecher unbeirrt fort. »Aber es ist ihnen bekannt, meine Herren, dass ich ein guter Christ bin, ich kann an keiner Kirche vorbeigehen, ohne sie zu betreten und zu beten...«
»Seit wie vielen Jahren sind Sie denn an keiner Kirche vorbeigekommen?«
»... und wenn die Kirchtür des Nachts verschlossen ist, dann breche ich sie auf. Also glaube ich auch an einen Himmel und an eine Hölle. Was nun immer meinen Selbstmord verzögerte, das war der Zweifel, ob ich unseren Freund Jansen im Himmel oder in der Hölle zu suchen habe...«
»Ach so, Selbstmord wollen Sie begehen! Nein, da gehe ich nicht mit.«
»Na, da wollen wir doch mal alle zusammen auf die ›Indianarwa‹ gehen!«
Ein plötzliches Stillschweigen, ein Stocken jeder Bewegung, und dann erhoben sich die drei anderen gleich- und ruckmäßig wie die Automaten.
»Wahrhaftig, das ist ein Gedanke, das machen wir!«
»Aber wenn sie uns nicht aufnehmen? Warum sollen sie?«
»Sie müssen, wir sind Schiffbrüchige im offenen Boote — sonst drohen wir mit dem internationalen Seestrafgesetzbuch — Paragraf 248 B dritter Abschnitt.«
»Aber wie einen Schiffbruch plausibel machen?«
»Eine Sprengpatrone in den Kielraum — zum Anschein eine Kesselexplosion.«
»Wir feuern ja seit acht Tagen nicht.«
»Können die denn das wissen? Auch unter den Kessel eine gute Portion Pulver, wir pusten den Qualm durch den Schornstein — ist das nicht plausibel genug?«
»Wird gemacht, wird gemacht!«, jubelte Lord Seymour. »Ist denn aber die ›Indianarwa‹ auch noch da?«
»Da schwimmt sie ja«, sagte Mr. Brown,
steckte schnell sein endlos langes Blaserohr durch eins der runden Fensterchen und pustete einen Pfeil nach dem noch ziemlich nahen Schiffe.
»Dann fix, fix«, schrie der Lord, »Pulver unter den Kessel und ein Loch geschlagen — — halt, halt — noch einen Augenblick — nur noch fünf Minuten — ich muss erst meine Hosen sticken!«
Aber die anderen eilten schon hinaus, den stichelnden Lord zurücklassend.
Jetzt galt es zunächst, die Mannschaft für das Vorhaben gefügig zu machen. Doch das war eine Kleinigkeit. Es waren eben Novascotiamen, deren Charakter wir schon wiederholt geschildert haben, mit allen Teufeln verbrüdert, und sie wussten doch, was für Herrn sie sich zu Brot und Lohn verdingt hatten, sie hatten auf der ›Zingalia‹ ja auch schon haarsträubende Sachen erlebt, und wenn sie dafür bezahlt wurden, so waren sie noch zu etwas ganz anderem bereit, als nur ihr eigenes Schiff zu versenken.
Damit war man also schnell bei ihnen fertig, es handelte sich hauptsächlich nur darum, den Matrosen und Heizern rechtzeitig einzuschärfen, dass sie sich dann, wenn sie als Schiffbrüchige aufgenommen wurden, nicht etwa verplapperten.
»Na, Sir, was denkt Ihr denn von uns? Los denn, klar bei den Booten!«
Lord Seymour stichelte noch immer mit emsiger Hast an seiner unsterblichen Hose herum, und es waren tatsächlich auch noch keine fünf Minuten vergangen, seitdem der tolle Plan ausgeheckt worden oder doch seitdem die anderen hinausgeeilt waren, als es einen gewaltigen Knall gab, der das ganze Schiff erzittern machte, und fast gleichzeitig stürzte Fairfax herein.
»Mmmmmmamamamamamamachen Sie schnell, wir sinken!«, brüllte er, soweit man brüllen kann, wenn man dabei durch die Nase stottern muss, zumal wenn diese Nase eine seitliche Krümmung hat.
Das freilich war dem edlen Lord doch etwas gar zu plötzlich gekommen.
»Was?! Ist denn schon der Kiel durchgeschlagen?«
»Freilich, freilich, das Wasser kommt in Strömen hereingeschossen! Es ist zu gründlich besorgt worden — fix, fix, dass wir ins Boot kommen — ziehen Sie ihre Hohohohose an!«
»Aber ich kann doch nicht die zerrissene Hose anziehen!«, fing der so ziemlich im Adamskostüm dastehende Lord jetzt zu jammern an.
»Dann ziehen Sie wenigstens Ihre Jacke an!«
»Da muss ich doch erst meine Weste anziehen.«
»Na, da ziehen Sie doch Ihre Weweweweste an! Fix, nur fix!«
»Ich kann doch meine Weste nicht anziehen.«
»Na, warum denn nicht?«
»Weil die auch noch einen Riss hat, quer über der Brust, ich kann mich doch nicht den indischen Damen so gut wie nackt präsentieren!«
»Aber Sie haben doch noch eine Bauchbinde und ein Vorhemdchen an!«
»Sitzt denn das Vorhemdchen wenigstens gut?«
»Zeigen Sie her — der Schlips sitzt nicht ordentlich.«
Und Mr. Fairfax zupfte Schlips und Vorhemdchen etwas zurecht.
»So — nun aber naus, naus — in die Boote!!«
Ja, man merkte schon, dass das Schiff sehr schnell sank, es wäre gar nicht nötig gewesen, dass die Matrosen so schrien.
Also Lord Seymour sich Hose und Weste über den Arm gehängt und mit hinaus, nur angetan mit Pantoffeln, Strümpfen, Bauchbinde, Vorhemdchen und Schlips. Seine Jacke ließ er zurück. Aber man darf wohl glauben, dass deren Taschen nichts enthielten, was er später vermisst hätte. Wes er bedurfte, um durch die Welt zu kommen, befand sich jedenfalls in der Hose oder Weste, vielleicht auch in der Bauchbinde. Und dasselbe galt von den anderen Herren. Diese spleenigen Abenteurer waren ja immer auf solch eine Plötzlichkeit gefasst, alles im Stich lassen zu müssen. Aber wes sie unbedingt bedurften, das Wichtigste, hatten sie Tag und Nacht bei sich, vor allen Dingen außer dem Scheckbuch Banknoten und einiges Kleingeld, das ist ja die Hauptsache im Leben, und wer sich nicht als Mensch fühlte, wenn er sich nicht täglich rasieren konnte, der ging eben mit dem Rasiermesser und Seifenpinsel schlafen, so wie Monsieur Chevalier mit einem genügenden Tabaksvorrat und Zigarettenpapier.
Ähnlich geht es ja jedem Matrosen. Wie selten kann aus einem Schiffbruch die Kleiderkiste gerettet werden! Nichts weiter als was man auf dem Leibe trägt. Aber Pip und der ganze Tabaksvorrat, besonders auch Kautabak. Und wie der Schreiber dieses aus Erfahrung weiß, muss der deutsche Matrose — bei anderen hat er das nie beobachten können — unbedingt auch noch die Fotografien mitnehmen, die seine Kleiderkiste enthält, die seiner Angehörigen, seiner Freunde, aber selbst ihm sonst ganz fremder Personen — um sie erst noch herauszubekommen, dafür riskiert er sein Leben. Es sind dies Kleinigkeiten, welche aber zur Unterscheidung des nationalen Charakters mehr erzählen als dicke Bücher.
Sie sprangen in die schon ausgeschwenkten Boote, und es war die höchste Zeit, diese herabzulassen, wenn sie noch von dem Strudel freikommen wollten.
»Halt, halt, wir haben Mr. Rug vergessen!!«
Da kam er schon an — nicht angegangen, sondern er wurde angeschleppt, von seinem Leibarzt und seinem Leibdiener, der am anderen Arm einen großen Korb mit Flaschen hatte. Es wurde eben nichts vergessen.
»Jonny — Whisky — Whisky mit Zucker — mehr Zucker«, lallte der Australier, der unter den Händen seines Arztes schon wieder etwas zur Besinnung gekommen war, mit schwerer Zunge, und dann befand er sich glücklich in einem der vier Boote.
Diese stießen ab und kamen glücklich von dem Strudel ab, der sich über der zuletzt verschwindenden Mastspitze der ›Zingalia‹ bildete. Die Sache war ›geglückt‹.
Jetzt überzählte der Kapitän, ein echter Novascotiaman, zunächst die Häupter seiner Lieben.
»Da fehlt doch einer.«
»Der Jim.«
»Ein Heizer?«
»Ja.«
»Wo steckt denn der?«
»Dort unten«, hieß es, und eine ausgestreckte Hand deutete auf die Stelle, wo die verschwundene Mastspitze auf dem sonst glatten Wasser die letzten Ringe zog.
»Vielleicht kommt er noch.«
»Nee, Käpt'n, nee, der kommt nicht mehr. Der steckte gerade im Rußkanal, hat gar nichts davon erfahren. Mir fiel's zu spät ein.«
»Na, da Mützen ab zum Gebet!«
Sie zogen die Mützen und spuckten über die gefalteten Hände den braunen Tabakssaft.
Als die Mützen wieder aufgesetzt wurden, hatte der Verunglückte sein ehrliches Seemannsbegräbnis bekommen.«
»Pullt an!«
Fort ging es im Rudertakt. In zehn Minuten war die ›Indianarwa‹ erreicht. Diese, welche dampfte, hatte sofort gestoppt, als die Explosion erfolgt war. Ein anderes Schiff war nicht in Sicht, womit diese unternehmenden Abenteurer auch gerechnet hatten.
Dort, wo die Kommandobrücke noch die Bordwand überragte, erschienen einige Männer, Offiziere, lauter kleine, gedrungene Gestalten, unverkennbar Japaner, nicht uniformiert, sondern gekleidet, wie sich eben englische Seeleute von der Handelsflotte kleiden. Es werden ganz einfach die Straßenanzüge abgetragen, statt eines Hutes eine Mütze, aber auch ohne jedes Abzeichen, wozu nur bei schlechtem oder kaltem Wetter die speziellen Seemannskleider, wie Ölanzug, Flausrock, Teerjacke, Südwester usw. kommen. Darin kann man keinen englischen Seemann von einem deutschen oder skandinavischen unterscheiden, hingegen schon von einem Franzosen, der auch bei der Arbeit das Patente, das Auffällige liebt, und mehr noch gilt das vom Italiener, Spanier, Griechen und den anderen aus der Hundetürkei. Da darf vor allen Dingen die Schärpe und anderer Klimbim nicht fehlen. Denn je weniger einer ist, desto mehr will er zu sein scheinen.
»Was ist denn das gewesen?«, wurde von oben herab gefragt.
»Eine Kesselexplosion«, entgegnete der Kapitän, den man erst den Sprecher machen ließ.
»Seid Ihr Kapitän Sherman?«
Dieser bejahte. Mit dem Namen des Schiffes, der vorhin beim Gruße signalisiert wurde, wird doch auch stets der des Kapitäns genannt.
»Eine Kesselexplosion, so! Sah gar nicht danach aus.«
»Was wollt Ihr damit sagen?«, fuhr der Kapitän empor, ward aber gleich von Mr. Brown, welcher von diesen Herren wohl der Vernünftigste war, zurückgezogen.
»Sicher, Herr Kapitän, es war eine Kesselexplosion. Wir haben bis vor einer Stunde gedampft, der Kessel sollte abgeblasen werden...«
»Schon gut, schon gut. Ihr wollt zu uns an Bord, was?«
»Ihr werdet uns doch nicht etwa abweisen?«
»Weil das hier gerade die ›Indianarwa‹ ist, deshalb gingt ihr in die Boote, es kam euch gar nicht darauf an, das ganze Schiff zu vernichten, was?«
»Herr Kapitän, wir haben nicht für einen einzigen Tag Proviant in den Booten.«
»Warum nicht?«
»Weil keiner drinnen war.«
»Was für eine heillose Wirtschaft ist denn das?«
»Ja, dafür wird sich Kapitän Sherman zu verantworten haben.«
»Gehört Ihr mit zur Besatzung? Und der Halbnackte da? Es sind auch noch andere, die mir einen ganz merkwürdigen Eindruck machen.«
»Wir sind die Besitzer der ›Zingalia‹.«
»Wie heißt Ihr denn?«
»Können wir uns nicht lieber an Bord vorstellen?«
»An Bord? Ihr werdet einfach ins Schlepptau genommen.«
Da schrillte eine Klingel, noch hier unten hörbar, worauf sich der japanische Kapitän und die Offiziere schnell entfernten.
Denen in den Booten aber war mit den letzten Worten ein heilloser Schreck in die Glieder gefahren.
Wahrhaftig, daran hatten sie gar nicht gedacht! Es war eben alles viel zu schnell gegangen. Sie hätten doch daran denken können, dass sie von dem indischen Schiffe, wenn dieses durchaus keinen fremden Menschen an Bord haben wollte, einfach ins Schlepptau genommen wurden, die ruhige See ließ das zu, und im Laufe des Tages würde man schon noch ein anderes Schiff sichten, welches weniger Bedenken trug, die ›Schiffbrüchigen‹ gegen angemessene Bezahlung — die bekannten Seepreise! — an Bord zu nehmen.
Nun, gar so heillos war der Schreck nicht. Nur war dann das alles umsonst gewesen.
»Na, Mylord, wie steht's denn nun?«, flüsterte da der Franzose schadenfroh. »Sie wollten doch alle Geheimnisse dieses Schiffes ausspionieren, und jetzt kommen Sie nicht einmal an Bord.«
»Schade, dass wir nicht gewettet haben!«, setzte Mr. Brown brummend noch hinzu.
Da machte der Lord ein ganz jämmerliches Gesicht, rieb sich den dicken Bauch.
»Und ich muss an Bord!«, fing er zu jammern an. »Ich habe mich verkühlt, schrecklich verküüüühlt...«
Und dann gab er seinem Nachbar einen Fußtritt.
»Ich bin krank, sterbenskrank, verstanden?«, flüsterte der Lord.
»Habe die die die Trichinose oder so was Ähnliches.«
Ja, der Plan war ganz gut, und die anderen wollten ihn auch keineswegs durchkreuzen.
»Eine Blinddarmentzündung, das ist besser.«
»Jawohl — mit chronischer Mastdarmfistel.«
Aber es sollte nicht nötig sein, diesen Plan durchzuführen. Merkwürdig war, oder auch dem ganzen Charakter dieses geheimnisvollen Schiffes entsprechend, dass sich über der Bordwand keine neugierigen Matrosengesichter gezeigt hatten, denn das bleibt doch sonst nicht einmal auf einem Kriegsschiffe aus.
Jetzt erschienen Matrosenköpfe, ebenfalls mongolische, aber nur, um ein Fallreep herabzulassen, und da tauchte auch schon wieder der Kapitän auf.
»Bitte, kommen Sie an Bord.«
Eigentlich hatte er auch schon vorher ganz höflich gesprochen, nur etwas spöttisch. Die Japaner sind ja überhaupt sehr höflich und dabei viel natürlicher als die Chinesen.
Die Schiffbrüchigen ließen sich das nicht zweimal heißen, Lord Seymour war auch plötzlich von seiner Blinddarmentzündung und seinen anderen Leiden kuriert.
Es waren siebenunddreißig Mann, welche das Fallreep hinaufkletterten. Besonders die vielen Diener, welche die in gewisser Beziehung so verwöhnten Sportsmen beanspruchten, hatte die Besatzung der Jacht so groß gemacht.
So, nun befanden sie sich wenigstens an Deck des geheimnisvollen Schiffes. Von indischer Pracht war hier freilich nichts zu sehen, auch nichts von indischem Leben. Nur japanische Seeleute — und da auch ein Inder, aber nicht im orientalischen Kostüm mit Turban, Kaftan und roten Schnabelschuhen, sondern in einem modernen Anzuge, und dieser Inder war es auch, der sie jetzt empfing, während der Kapitän auf der Brücke blieb, wie sich überhaupt niemand mehr um sie kümmerte.
»Bitte, wer ist der Herr Kapitän?«, begann dieser Inder in tadellosem Englisch.
»Ich.«
»Nicht wahr, auch der Besitzer der gesunkenen Jacht befindet sich hier?«
»Das sind wir«, wurde von entsprechender Seite geantwortet, wobei sich die Betreffenden immer durch etwas Vortreten bemerkbar machten.
»Gleich vier?«
»Sogar fünf! Die ›Zingalia‹ gehörte uns gemeinschaftlich.«
»Ah, so. Aber wo ist denn der fünfte?«
Auch Mr. Rug wurde vorgeschleift, taumelte — und konnte mit einem Male ganz gerade stehen.
»Ist der Herr krank?«
»Nur besoffen.«
»Ah so«, sagte der Inder mit tiefstem Ernst. »Nun, es scheint ja zu gehen. Bitte, wollen diese fünf Herren mir folgen. Für die anderen wird ebenfalls gesorgt werden.«
So wurde von vornherein eine scharfe Trennung zwischen den Jachtbesitzern und der Besatzung bewerkstelligt, einfach zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und die fünf Sportsmen sollten mit allen anderen auch nicht so bald wieder in Berührung kommen, weder mit dem Kapitän, noch mit dem Arzte, noch mit irgend jemandem, der sonst manchmal mit an ihrer Tafel saß.
Also unsere fünf ›Helden‹ folgten dem vorausschreitenden Inder, Lord Seymour immer Hose und Weste über dem Arm, anstatt mit ihnen seine nackten Gliedmaßen zu bedecken, der Australier taumelnden Ganges, von seinen Freunden unterstützt.
Es ging durch einen verdeckten Eingang zwei Treppen hinab, auf dem Korridor gewahrten sie prächtige Teppichläufer, sonst aber durchaus nichts von indischem Leben, das ganze Schiff, welches doch stark bevölkert sein sollte, schien ausgestorben zu sein, dann befanden sie sich in einer größeren Kabine oder in einem größeren Salon, der an Einrichtung allerdings nichts zu wünschen übrig ließ.
»Ich heiße die Herren im Namen des Maharadschas willkommen«, nahm hier der Inder mit womöglich noch größerer Höflichkeit das Wort.
»Was für ein Maharadscha ist das?«, fragte Mr. Brown, der bei solchen Gelegenheiten immer den Sprecher machte, mit weniger Höflichkeit.
»Es ist der Nachfolger des Maharadschas Ghasma Dschalip Subktadscha, sein Name ist einfach Rakta, was wiederum nur Nachfolger oder Stellvertreter heißt, einen anderen Titel hat er nicht bekommen, ist aber seitens Englands als Maharadscha, d. h., als indischer Großfürst, anerkannt worden. Sollte das den Herren nicht schon bekannt sein?«
»Doch, wir haben davon gehört.«
»In seinem Namen heiße ich Sie also an Bord der ›Indianarwa‹ willkommen.«
»Wir danken sehr.«
»Bitte, wollen mir die Herren nun ihre Namen nennen — oder vielleicht schreiben Sie sich gleich hier ein.«
Er brachte ein Notizbüchlein zum Vorschein; die Sportsmen willfahrten seinem Wunsche.
Dann bat der Inder um Bericht, wie die ›Zingalia‹ so plötzlich gesunken sei, und die Übeltäter blieben bei ihrer Kesselexplosion.
Der Inder machte sich über die verschiedenen Einzelheiten Notizen, verzog dabei keine Miene.
»Ich muss dem Maharadscha darüber Bericht erstatten. Also nur ein Mann hat dabei seinen Tod gefunden?«
»Nur ein einziger.«
»Und was war das Ziel der ›Zingalia‹?«
»Eigentlich hatten wir gar keines.«
Der Inder steckte sein Notizbuch ein.
»Nun, meine Herren, Sie befinden sich hier in einer besonderen Kabinenabteilung, ganz separiert — an Land würde man es Zimmerflucht oder Appartement nennen — es sind sechs zusammenhängende Kabinen, in denen Sie alles finden, was Sie bedürfen, sodass Sie sie gar nicht zu verlassen brauchen, und... ich ersuche Sie, dies auch nicht zu tun.«
»Weshalb denn nicht?«
»Weil... das an Bord dieses Schiffes so üblich ist. Dem Gaste, so herzlich er aufgenommen wird, sind gewisse Grenzen gezogen. Oder ich will doch lieber gleich deutlicher sein: Ihr Bezirk muss auf diese sechs Kabinen beschränkt bleiben. Sie dürfen sie überhaupt gar nicht verlassen.«
»Das heißt, wir werden hier so gut wie gefangengehalten?«
»In gewisser Beziehung, ja.«
»Man schließt uns ein, dreht den Schlüssel draußen um?«, wurde gleich noch deutlicher gefragt.
Oho! An solch eine Behandlung waren gerade diese Sportsmen, welche zwar nicht vogelfrei, aber doch frei wie die Vögel in der Luft waren, am allerwenigsten gewöhnt.
Allerdings hatten sie das schon vorher gewusst, auch die anderen, welche zufällig an Bord dieses geheimnisvollen Schiffes gekommen, waren ja so behandelt worden — aber wenn man es auch als selbstverständlich hinnahm, so musste man sich doch dem Scheine nach gegen solch eine Behandlung sträuben.
»Ja, wozu denn das?«
»Das ist die spezielle Bordroutine dieses Schiffes in bezug auf Gäste. O, Sie dürfen das auch nicht so nehmen. Sie werden nichts vermissen, Sie werden aufs beste verpflegt, haben Bad und alles...«
»Aber wir sind nicht gewöhnt, uns einsperren zu lassen!«
»Bitte, meine Herren, es handelt sich doch nur um wenige Stunden, wir rufen den ersten Dampfer an oder, wenn Sie wollen, das erste uns begegnende Segelschiff, da sind Sie sofort von dem Zwange erlöst. Wir sind ganz dicht bei einer Dampferlinie, welche wir gleich aufsuchen, der Kurs ist schon geändert, da kann diese Freiheitsberaubung ja nicht lange währen.«
Das war natürlich eine kalte Dusche. Deswegen, um nur einige Stunden hier zu verbringen, hatte man doch nicht das wertvolle Schiff geopfert.
Es war eben alles viel zu schnell gegangen, der ersten Idee war nach dem Charakter dieser Leutchen sofort die ganze Tat gefolgt, nun sah man es zu spät ein.
»Wohin begibt sich denn die ›Indianarwa‹?«, wurde kleinlaut gefragt.
»Wir haben überhaupt niemals ein Ziel, wir laufen nur einen Hafen an, wenn Proviant oder sonst etwas ersetzt werden muss, und wir sind noch auf ein Vierteljahr mit allem versorgt.«
»Wenn uns aber das nächste Schiff oder sein Ziel nicht passt, was dann?«
»Nun, dann warten Sie eben auf ein zweites.«
»Und wenn uns auch dieses nicht gefällt?«
»Dann befragen Sie ein drittes, das Sie in Sicht bekommen.«
»Mit Gewalt werden wir nicht von Bord gebracht, nicht zwangsweise abgesetzt?«
»O nein! So etwas wie Gewalt oder Zwang gibt es an Bord der ›Freiheit von Indien‹ überhaupt nicht. Dass wir Ihre Bewegungsfreiheit beschränken, das ist etwas ganz anderes. Sonst pflegen wir gerade die Gastfreundschaft und Gastfreiheit, und zwar die unbeschränkteste, das heißt für den, der sich einmal an Bord unseres Schiffes befindet.«
»Was? Da könnten wir wohl so lange hier bleiben, wie wir wollen?«
»Das können wir Ihnen nicht verwehren, darüber haben wir heilige Gesetze, und selbst wenn uns ein Gast unangenehm wäre, dürften wir ihn dies nicht im entferntesten empfinden lassen.«
»Na, dann ist ja alles gut, dann bleiben wir hier!«, entfuhr es dem einen unbedachtsam, wofür er eins aufs Hühnerauge bekam.
Aber der Inder schien nichts gehört zu haben.
»Haben die Herren sonst noch Wünsche?«
»So dürfen wir gar niemals an Deck?«
»O, gewiss! Sie müssen doch Bewegung im Freien haben. Genügt täglich zweimal eine Stunde, vor- und nachmittags?«
»Ich ziehe vor, an Deck spazieren zu gehen, wenn ich will«, meinte der Haarwasseronkel trocken.
»Das tut mir allerdings leid. Vielleicht früh zwischen acht und neun und nachmittags zwischen vier und fünf?«
Während der Inder nach den Wünschen fragte, machte er doch immer gleich strikte Vorschriften, aber so geschickt, das man das gar nicht empfand.
»Gut denn! Und wie ist es mit Kleidern und Wäsche? Wir haben nichts gerettet, als was wir am Leibe tragen.«
»Gleich im Nebenzimmer finden Sie eine reichhaltige Garderobe. Außerdem ist überall eine Klingel, Sie brauchen nur zu drücken, jedem Wunsche wird Rechnung getragen, der nur an Bord eines Schiffes zu erfüllen ist.«
Eine Verbeugung, und der Inder entfernte sich. Die Zurückbleibenden hörten ganz deutlich, wie er draußen zuschloss.
»Sapristi!«, sagte zunächst der Franzose, sich eine Zigarette drehend.
»Na, was denn?«, wurde ihm von drei Seiten erwidert. »Haben Sie nicht gewusst, was uns hier erwartet?«
»Aber uns so einzusperren!«
»Das ist ja sogar das Schöne dabei — nun, Mylord, beweisen Sie, dass Sie mehr können als Tom Sparrow — nun brechen Sie diese Riegel und schauen Sie sich auf diesem geheimnisvollen Schiffe um, ohne dass Sie daran gehindert werden.«
»Das werde ich allerdings fertig bringen. Erst aber muss ich mich hier nach Nähzeug umsehen, dass ich meine Hose flicken kann, sonst muss ich klingeln.«
Er begann sofort, alle Kästen aufzuziehen.
»Ein Glück nur, dass der Kerl nicht daran gedacht hat, uns ein Ehrenwort abzufordern, dass wir nicht auszubrechen versuchen, überhaupt nicht herumschnüffeln wollen.«
»Das kann aber noch kommen.«
»Nein, sicher nicht«, meinte ein anderer. »Wir sind doch Gastfreunde, und fordert man denen etwa ein diesbezügliches Ehrenwort ab?«
»Gastfreunde sperrt man aber eigentlich nicht so ein.«
»Lassen wir das. Wir sind eben auf der ›Indianarwa‹, von der noch niemand etwas Reelles hat erzählen können. Sehen wir uns lieber in den anderen Kabinen um.«
Bemerkenswertes boten die sechs Räume nicht, wenigstens nicht für diese schwerreichen Sportsleute, die an den höchsten Luxus gewöhnt waren.
»Ja, was wollen wir nun anfangen?«, meinte Fairfax nach dieser Besichtigung, ließ sich auf einem festgeschraubten Fauteuil nieder, zog seinen Nickfänger und begann, von dem vor ihm stehenden Tisch aus feinstem Ebenholz lange Späne abzuschneiden.
Mag dieses Beispiel genügen, weshalb dieser amerikanische Gentleman nicht an Land leben konnte, nur auf seinem eigenen Schiffe, und dasselbe galt für alle die anderen.
»Lasst mich nur erst meine Hose und Weste heil haben«, entgegnete der Lord, der wirklich ein Nähzeug gefunden, »dann will ich hier schon herauskommen.«
»Zu dumm, dass ich mein Blaserohr nicht mitgenommen habe!«, brummte der Haarwasseronkel.
»Klingeln Sie doch, ein Bambusrohr wird es hier schon geben.«
»Aber es muss ein botokudisches sein, und das wird hier wohl nicht vorhanden sein.«
»Hier ist auch ein Klavier. Nun los, Chevalier, spielen Sie uns was vor.«
»Ist es nussbraun?«
»Nein, schwarz.«
»Ich spiele nur auf nussbraunen Klavieren.«
»Verdammt hart!«, knurrte der Späne hobelnde Fairfax. »Ist das Klavier weicher?«
»Nu, 's geht«, meinte Brown, schon mit seinem Taschenmesser in der polierten Platte herumbohrend.
»Ich will aber doch erst...«
Fairfax drückte den Klingelknopf, ein Klingeln hörte man nicht, dafür aber fast sofort eine menschliche Stimme.
»Was befehlen die Herren?«
Die ziemlich weit entfernte Stimme kam aus einem anderen Zimmer.
»Hier herein!«
»Ich bedaure, ich kann nicht kommen. Was wünschen die Herren?«
»Wir wünschen einen Diener und keinen indischen Gentleman.«
»Ich bin auch ein Diener.«
»Na, dann scheren Sie sich doch in drei Teufels Namen hier herein!! Oder sollen wir etwa zu Ihnen hinauskommen?«
»Ich kann aber nicht hineinkommen, die Tür ist zugeschlossen.«
Jetzt wurde man doch stutzig, begab sich ins nächste Gemach, immer noch weiter bis ans Ende der sechs Räumlichkeiten, und da sah man des Rätsels Lösung.
Auch hier war noch eine Seitentür, diese besaß oben eine Öffnung, und in ihr zeigte sich ein braunes Gesicht.
»Nun hört sich aber doch alles auf! Gerade wie im Zuchthause!«
»Was befehlen die Herren?«
»Einen Schleifstein oder Wetzstahl«, sagte Fairfax zunächst. »Sofort, mein Herr!«
Der Kopf verschwand, aber die Klappe blieb offen, durch welche man eine andere Kabine sah, die nichts weiter enthielt, als einen großen Tisch.
Noch ehe man dazu kam, über diese denn doch gar zu streng durchgeführte Gefangenschaft zu sprechen, ging in jenem Nebenzimmer die Korridortür auf, ein Inder trat ein, eine ganz moderne Livree tragend, derselbe, den man vorhin auch hatte verschwinden sehen, legte auf den Tisch sowohl einen Schleifstein wie einen Wetzstahl.
»Bitte, hier, mein Herr.«
»Was soll denn das heißen?«
»Ich weiß nicht.«
»So geben Sie die Dinger doch wenigstens her.«
»Ich darf nicht.«
»Ja, wie sollen wir sie denn sonst bekommen, wenn diese Tür verschlossen ist?«
»Sobald ich wieder hinaus bin, ist die Tür offen.«
»Ah so, das ist ja eine Art Sicherheitskäfig, wie der Tierbändiger ihn benutzt, um in den Raubtierkäfig zu gelangen, was?«
»Ich weiß nicht, Sir.«
»Gut, fort!«
Kaum hatte der Diener das abgeschlossene Gemach durch die Korridortür verlassen, als diese hier auch geöffnet werden konnte.
Und bei dieser Vorsichtsmaßregel blieb es. Als die Herren zu speisen wünschten, wurde ihnen die Mahlzeit erst in dem abgeschlossenen Gemach serviert, sie mussten sich die Schüsseln selbst holen, brauchten es aber auch nicht zu tun, sie konnten sich ja auch einen Diener zum Servieren wünschen. Dann aber nahm dieser seinen Weg ebenfalls erst durch den Sicherheitskäfig und verließ die Gesellschaft auch wieder so.
Diese Sportsmen genierten sich natürlich durchaus nicht, die verschiedensten Experimente anzustellen, brauchten als Gefangene ja auch gar keine Rücksicht zu nehmen.
Zunächst ließ man die Verbindungstür auf, lehnte sie nur ein wenig an. Doch der Diener, welcher auch durch die Außentür blicken konnte, ließ sich nicht täuschen, verlangte erst, dass die Tür wirklich geschlossen würde, ehe er das Gewünschte hereinbringen könne, und dabei war jedenfalls auch ein Mechanismus tätig, welcher anzeigte, ob jene Tür wirklich geschlossen sei oder nicht.
Dann versteckte sich einer in jenem Raume, schmiegte sich dicht an die Tür, sodass er von der Klappe aus gar nicht gesehen werden konnte.
Allein der livrierte Wärter ließ sich nicht irre machen, er wusste sofort, dass sich jemand in diesem Raume befand, der erst zurückgehen musste.
Dieses Rätsel wurde bald aufgeklärt, als man die Decke genauer betrachtete und da oben einige Löcherchen sah. Sie wurden ganz einfach von oben beobachtet, und daher freilich war jede Mühe vergeblich.
Wozu aber nur diese ungeheuere Vorsicht?
»Eben weil wir Gäste sind, die in die Geheimnisse dieses Schiffes keinen Einblick bekommen sollen, und man mag mit Neugierigen schon genug traurige Erfahrungen gemacht haben.«
»Oder die Gäste sollen auf diese Weise hinausgeekelt werden«, meinte ein anderer.
»Auch möglich. Wie aber wollen Sie da unbemerkt hinausgelangen und herumspionieren, Mylord?«
»Das ist meine Sache; ich werde es schon fertig bringen.«
Kurz vor vier Uhr erschien wieder jener erste Inder, wohl ein vornehmer Hindu, der sich dann als Sidi Sabasi vorstellte, und lud die Herren zum Spaziergang an Deck ein.
Bis zur nächsten Treppe hatte man durch den Korridor nur wenige Schritte zu machen, dabei kam man an zwei Türen vorüber, welche nicht zum Appartement der Gäste gehörten; Lord Seymour, sich hinter dem Rücken des Inders haltend, klinkte an beiden, fand sie verschlossen.
An Deck waren einige japanische Matrosen beschäftigt, auf der Kommandobrücke gingen die Offiziere hin und her. Nichts weiter. Man hätte ebenso gut an Bord irgendeines großen, englischen Frachtdampfers sein können.
Auch für die andere Mannschaft der ›Zingalia‹ war für diese Stunde das Deck frei, bald gesellten sich der Kapitän und der Arzt zu den Herren, klagten diesen ihre Not.
Sie waren erst recht wie die wilden Tiere eingesperrt, sogar zusammengepfercht, klagten auch über das Essen, welches nur aus Reisgerichten bestände. Fleisch gäbe es überhaupt nicht — was bei den fünf Sportsmen durchaus nicht zutraf. Diese hatten vielmehr die auserlesensten Gerichte erhalten, sogar frisches Fleisch der verschiedensten Art, sie hätten nach der Speisenkarte bestellen können.
Es dämmerte ihnen gleich eine Ahnung auf, dass man jene erst recht so bald wie möglich von diesem heiligen Schiffe entfernen wollte, aber sie sagten nichts, das besorgte auch der Kapitän von selbst, und der Arzt stimmte ihm immer bei.
»Der Verlust des Schiffes bedeutet Aufhebung des Kontraktes.«
»Selbstverständlich.«
»Sobald ein Schiff in Sicht kommt, verlassen wir diesen verdammten Hungerkasten.«
»Wir halten Sie nicht. Also die ganze Mannschaft will abbezahlt werden?«
Es geschah auf der Stelle, und noch an demselben Tage verließ die ganze Mannschaft der ehemaligen ›Zingalia‹ dieses Schiff, wurde von den japanischen Matrosen auf einen Dampfer gebracht, der sich zur Aufnahme bereit erklärt hatte.
Auch die Diener gingen alle mit, selbst wenn sie seit Jahren einem der Herren treu gedient hatten, sogar Mr. Rug ward von seinem Jonny verlassen.
Ein patriarchalisches Verhältnis konnte ja auch bei diesen Sportsmen niemals zustande kommen, deren Hauptzug im Charakter der Hang zur ungebundensten Freiheit war. Wahrscheinlich hatte zwischen diesen langjährigen Dienern schon seit einiger Zeit eine Art von geheimer, wenn auch unschuldiger Meuterei bestanden, sie waren eben schon längst entschlossen gewesen, gemeinschaftlich diese verrückte Gesellschaft zu verlassen, und wer in dieser Zeit sparsam gewesen, musste es schon zu einem Vermögen gebracht haben.
Doch so weit war es noch nicht. Die Mannschaft war nur ausbezahlt worden, der Kontrakt gelöst, sonst befand sie sich noch an Bord, es musste erst ein Schiff abgewartet werden.
Nach dem Spaziergange, der auch den Australier so ziemlich wieder nüchtern gemacht hatte, waren die fünf in ihr komfortables Gefängnis zurückgeführt worden, hier wurde von neuem besprochen, wie man zum Ziele gelangen könne.
Dabei dachte man an die kleinen Öffnungen in der Decke, es konnte auch noch andere Vorrichtungen geben, um zu beobachten und zu belauschen — die Unterhaltung wurde in möglichst leisem Tone geführt, man saß eng zusammen, dabei mit irgend etwas beschäftigt, dass die absichtliche Heimlichkeit wenig auffiel.
Ja, was wollte man hier eigentlich?
Das intime Leben auf diesem indischen Schiffe kennen lernen. Keiner der fünf Herren hatte die neue ›Indianarwa‹, welche bereits seit zwei Jahren existierte, schon einmal gesehen. Aber sehr viel gelesen hatten sie schon über sie, Zeitungsberichte. Von der Pracht und Herrlichkeit, wie es auf diesem Schiffe, ganz wie an einem indischen Hofe zugehen solle, ein Fest löste das andere ab, Gauklervorstellungen, Bajaderentänze und dergleichen.
Solche Berichte brachten die Zeitungen, vornehmlich englische und amerikanische, immer einmal, besonders wenn das indische Schiff einen Hafen angelaufen hatte, um Proviant und Kohlen einzunehmen. Dabei hielt es sich stets höchstens zwei Tage auf, und dann, wenn es den Hafen wieder verlassen, erschienen jedesmal solch farbensprühende Berichte über das Leben dieses schwimmenden Altindiens aus gewandten Federn in allen Zeitungen des betreffenden Landes, eine druckte sie aus der anderen ab.
Ja, woher wollte denn der Erzähler eigentlich seine Kenntnisse haben? Einige waren sogar so naiv, gleich zu versichern, dass noch kein fremder Fuß dieses Schiff betreten habe.
Diese Berichte waren also einfach Schöpfungen der Phantasie. Jene Schiffbrüchigen, welche wirklich an Bord der ›Indianarwa‹ gewesen, hatten ja erzählt, wie sie von alledem nichts gemerkt, da sie wie Gefangene, wenn auch sonst ausgezeichnet behandelt worden wären, und selbst Tom Sparrow war so ehrlich gewesen, nur den negativen Erfolg seines Besuches zu schildern.
Doch gleichgültig, das Publikum will unterhalten sein. Und irgend etwas Wahres musste ja daran sein. Denn weshalb waren denn sonst die Schiffbrüchigen, wie auch der Reporter, immer eingesperrt gewesen? Und hatten sie nicht häufig Bajaderengesang und dergleichen vernommen?
Dieses indische Schiff hatte eben seine Heimlichkeiten. Es wollte sonst als ein ganz harmloses gelten. Deshalb bekam man auch, wenn es einen Hafen anlief, nichts weiter als einige japanische Matrosen zu sehen, welche die Arbeit verrichteten, gekleidet wie englische Seeleute. Alle anderen hielten sich unter Deck verborgen. Aber dass dies viele Hunderte sein mussten, das erkannte man doch schon an der Unmenge von Proviant, der immer eingenommen wurde, zumal an dem frischen, wie Gemüse, das noch an demselben Tage verbraucht werden musste.
Unsere fünf Freunde waren fest überzeugt, dass an den phantastischen Berichten doch etwas Wahres sei. Sie hatten ja oft genug den Erzählungen Jansens gelauscht. (Hierbei aber sei bemerkt, dass ihnen Jansen sein nächtliches Abenteuer verschwiegen hatte, mit so etwas prahlte er niemals, genierte sich vielmehr, darüber zu sprechen.) Das hatte er auf der alten ›Indianarwa‹ erlebt. Aber sollte der ehemalige Maharadscha die ganze Lebensweise nicht auch auf das neue Schiff übertragen haben? Sollte es nicht auch sein Nachfolger beibehalten haben?
Selbstverständlich. Wozu hatten sich denn diese Inder sonst auf das Meer geflüchtet und ihrer schwimmenden Heimat gerade den Namen ›Freiheit von Indien‹ gegeben? Aber diese ›Freiheit‹ durfte eben von keinem profanen Augen geschaut werden.
»Bei Jansen und seinen Leuten war das etwas anderes, die wurden als Verbündete betrachtet — da — da — horcht!«
Wirklich — ziemlich deutlich, aber wie aus weiter, weiter Ferne kommend, hörte man einen vielstimmigen Gesang, der nur aus Weiberkehlen herrühren konnte.
»Das ist der Gesang der Bajaderen, den sie am KalayaFeste, unserem Ostern entsprechend, zu Ehren Vishnus ertönen lassen«, erklärte der Franzose.
»Waren Sie denn längere Zeit in Indien, dass Sie das so genau wissen?«
»Ich bin sogar in Indien geboren.«
»Ich habe das Licht der Welt zufällig auf Hawaii erblickt«, brummte Lord Seymour; »meine Mutter war auch so eine Seezigeunerin, aber Hawaiisch, oder wie die Sprache dort heißt, kann ich deswegen nicht.«
»Ich aber bin in Indien erzogen, bis zu meinem zwanzigsten Jahre dort gewesen«, entgegnete Monsieur Chevalier.
Die Herren waren nun schon etliche Jahre zusammen, kannten sich noch länger persönlich, aber über ihre früheren Schicksale hatten sie sich nie unterhalten, sie wussten noch nicht einmal ihre Vornamen.
»Also hier gibt's wirklich Bajaderen, die singen und herumhuppen, gerade wie auf der alten ›Indianarwa‹, wie uns Jansen erzählte.«
»Haben Sie je daran gezweifelt?«
»Nein, das nicht, sonst hätte ich doch lieber nicht die ›Zingalia‹ versenkt.«
»Nun also.«
»Ja, wie wollen wir aber hier nun etwas erfahren?«
»Ich weiß, ich habe meinen Plan«, blieb der Lord bei seiner Geheimniskrämerei.
»Nun?«
»Ich breche einfach heute nacht aus.«
»Ausbrechen?«
»Na ja, ich öffne einfach eine Tür.«
»Können Sie denn das?«
»Ich bin doch gelernter Einbrecher — Schlosser, wollte ich sagen.«
»Was Sie sagen! Wo haben Sie denn das gelernt, Mylord?«
»Wissen Sie nicht, dass in den hohen englischen Adelskreisen jeder ein Handwerk gelernt haben muss?«
Ja, jetzt entsannen sich auch die anderen auf diese löbliche Sitte, welche in England uralt, von Wilhelm dem Ersten auch im preußischen Königshause eingeführt ist. Königin Viktoria war eine sehr geschickte Buchbinderin. Friedrich der Zweite hatte das Tischlerhandwerk erlernt, unser jetziger Kaiser ist Drechsler.
»Ich lernte schlossern, und zwar von klein auf, musste von zartesten Kindesbeinen an täglich mindestens zwei Stunden am Schraubstock und sogar vor dem Amboss stehen, musste Schlösser machen und die Schlüssel selbst schmieden, und ich tat es mit der größten Liebe, denn mich hatte eine Räubergeschichte enthusiasmiert, ich wollte später einmal auch so ein heldenhafter Einbrecher werden — und ich lernte etwas — schon mit meinem siebenten Jahre konnte ich mit einem krummen Nagel alle Stubentüren aufmachen — mir hat es nie an Schokolade gefehlt — und im zehnten Jahre konnte ich sogar jedes Geldschrankschloss aufmachen — ich habe immer Taschengeld genug gehabt.«
Der Lord griff in die Tasche seiner unsterblichen Hose und zeigte triumphierend ein sehr dickes Messer, welches als Klingen eine Menge Handwerkszeug enthielt.
»Und dann wollen Sie hinaus?«
»Dann bin ich schon draußen.«
»Ja, was aber dann?«
»Na, dann halte ich mit der Laterne eben Umschau.«
»Sie werden doch natürlich sofort festgenommen.«
»Wissen Sie nicht, wie es Jansen ergangen ist? In der Nacht ist im Schiff alles wie ausgestorben, alles schläft, am Boden, in den Korridoren — da kann man ruhig den Schläfern auf den Hühneraugen herumtreten, das stört hier niemanden — Jansen hat uns doch oft genug erzählt, wie es ihm ergangen ist, als er damals in der Nacht den Weg verfehlte, und nun so im Finstern herumgetappt ist.«
»Ja, das war damals an der Fucusinsel!«
»Hier wird es nicht anders sein. Indien bleibt Indien, da ändert sich wie bei den Chinesen im Laufe der Jahrtausende nichts. Freiheit von Indien — ich nehme mir die Freiheit!«
»Na, ich glaube nicht, dass Ihnen das gelingen wird!«
»Ich mach's!«
»Da wüsste ich doch noch einen anderen Ausweg!«, meinte der Franzose.
»Nun?«
»Erst können wir ja einmal fragen, unter welchen Bedingungen man uns hier alles zeigt.«
»Können wir versuchen. Aber Zweck wird's wenig haben.«
»Wir waren doch Jansens beste Freunde, der mit diesem Indien so vertraut war, wir wissen um das Geheimnis der Fucusinsel.«
Monsieur Chevalier war es gewesen, der dies gesagt, und plötzlich hörten die anderen hoch auf.
»Hört, das ist ein Gedanke!«, wurde mit erhobenem Zeigefinger geflüstert, und hierüber unterhielt man sich noch des längeren, bis man durch ein Klopfen an der Nebentür unterbrochen wurde.
Der nach der gegebenen Erlaubnis Eintretende, welcher den Weg durch den Sicherheitsraum genommen hatte, war Sidi Sabasi.
»Verzeihen Sie, wenn ich störe — ich wollte die Herren benachrichtigen, dass ein Schiff in Sicht ist, ein französischer Passagierdampfer, welcher nach Valparaiso fährt, und er hat sich schon bereit erklärt, Sie aufzunehmen.«
»Wen? Uns?«, ward in brüskem Tone gefragt, den man sich bei längerem Seeleben leider so leicht angewöhnt, und diese vogelfreien Sportsmen kannten da nun erst recht keine Formalitäten. Im Grunde genommen aber ist es auch das Richtige.
»Die Mannschaft der gesunkenen ›Zingalia‹.«
»Gut, so mag diese gehen. Wir haben uns überhaupt bereits verständigt. Wir bleiben hier.«
»Ah, die Herren wollen hier an Bord bleiben, das ist etwas anderes!«
»Ja, wir nehmen die uns angebotene Gastfreundschaft dankbar an.«
»Bitte sehr. Soll da vorläufig kein anderes Schiff mehr angerufen werden?«
»Wenn Sie uns noch einige Zeit hier behalten wollen...«
»Ich sagte bereits, dass die Gastfreundschaft für den, der sich einmal an Bord der ›Indianarwa‹ befindet, unbeschränkt ist.«
»Dann ist es ja gut. Ja, Sir, wenn wir Sie einmal sprechen dürften.«
»Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung.«
»Unsere Unterhaltung dürfte längere Zeit in Anspruch nehmen.«
»Ich bin an nichts gebunden.«
»Sie werden wohl erst oben melden müssen, dass wir den Dampfer nicht benutzen wollen.«
»Sagten Sie nicht, dass Sie das schon Ihrem Kapitän mitgeteilt haben?«
»Das haben wir allerdings getan, er weiß, dass wir hier bleiben.«
»Dann ist auch alles schon in Ordnung. Wenn Sie selbst nicht noch einmal mit Ihren Leuten sprechen wollen?«
»Dazu haben wir keine Veranlassung.«
»Dann stehe ich zu Ihrer Verfügung.«
»Bitte, nehmen Sie Platz.«
Der Inder, ein vollendeter Gentleman mit europäischen Manieren, setzte sich, und diesmal führte Monsieur Chevalier das Wort.
»Ist es nicht möglich, dass wir uns hier auf diesem Schiffe frei bewegen dürfen?«
»Ebenso, wie Sie diese Frage ohne Umschweife stellen, werde ich auch antworten: nein.«
»Weshalb nicht?«
»Es geht gegen unsere Gesetze.«
»Auch eine Besichtigung des ganzen Schiffes ist nicht gestattet?«
»Auch das nicht.«
»Können wir den Maharadscha einmal sprechen?«
»Nur, wenn er es wünscht.«
»Hat er es noch nicht gewünscht?«
»Bisher noch nicht.«
»Wird er es wünschen?«
»Das weiß ich nicht.«
»Aber er weiß, dass wir uns hier befinden?«
»Selbstverständlich.«
»Können Sie uns nicht zu einer Audienz anmelden?«
»Ich kann es, ich werde es tun, aber es ist zwecklos. Der Maharadscha ist — ist —«
»Ich verstehe. Eine unnahbare Person, unnahbarer noch als eine unserer abendländischen Majestäten.«
»So ist es.«
»Aber wird er wenigstens einen Brief annehmen und lesen?«
»Auch das nicht. Übrigens können Sie alles, was Sie dem Maharadscha zu schreiben haben, mir sagen. Ich werde es sowieso erfahren. Denn Sie könnten den Brief noch so sehr versiegeln, ich würde ihn erbrechen und erst lesen, seinen Inhalt im Auszuge dem Maharadscha vortragen.«
»Ah, Sie sind so eine Art Sekretär des Maharadschas!«
»Das bin ich, sein Leibsekretär, und noch mehr — ich bin der Stellvertreter und Bevollmächtigte des Maharadschas, ich spreche und stehe hier in seinem Namen.«
Ohne jeden Stolz hatte der noch junge Inder es gesagt, ganz geschäftsmäßig.
»Dann können wir es ja gleich Ihnen vortragen.«
»Gewiss, es ist dasselbe, als ob Sie mit dem Maharadscha selbst sprächen.«
»Das ist vortrefflich. So werde ich Ihnen eine Eröffnung machen. Wir haben keinen Schiffbruch erlitten.«
»Nicht?«
»Das heißt keine Kesselexplosion, sondern wir haben unser Schiff, die ›Zingalia‹, auf andere Weise zum Sinken gebracht.«
Todesstille herrschte in der Kabine. Fünf Augenpaare hingen erwartungsvoll an den brünetten Zügen des jungen Franzosen, der sich soeben gleichmütig eine neue Zigarette drehte.
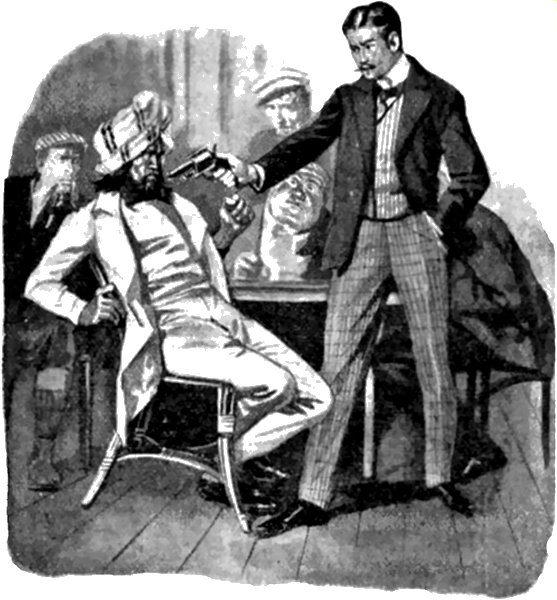
Was hatte der vor? Nun, die anderen wollten ihn gewähren lassen. Monsieur Chevalier sprach am allerwenigsten, wusste aber auch immer am bestimmtesten, was er wollte.
In den unbeweglichen Zügen des Inders war kaum von Staunen etwas zu bemerken.
»Mit Absicht zum Sinken gebracht?«
»Mit Absicht.«
»Und wozu das?«
»Um an Bord dieses Schiffes zu kommen.«
»Ich verstehe. Nun, Sie haben ja auch Ihr Ziel erreicht.«
»Nicht so ganz. Uns ist natürlich die Hauptsache, auch das Leben und Treiben auf diesem Schiffe kennenzulernen.«
»Wenn Sie das beabsichtigten, so haben Sie Ihr Schiff umsonst geopfert.«
»Meinen Sie? Ich nicht. Es handelt sich vor allen Dingen hier um diesen Herrn, um Lord Archibald Seymour. Mir ist sehr wenig daran gelegen, die Verhältnisse auf diesem Schiff kennen zu lernen, hat für mich gar keinen Reiz — aber hier Lord Seymour ist sehr gespannt darauf und... ich habe es mir in den Kopf gesetzt, ihm dazu zu verhelfen. Also, Mister Sabasi, Sie werden die Güte haben, dem Lord alles Sehenswerte auf diesem Schiffe zu zeigen.«
Die vier anderen wussten durchaus nicht, wo hinaus ihr Freund eigentlich wollte, verrückt war er ja schon immer gewesen, nicht mehr und nicht weniger als die anderen — jetzt aber musste er plötzlich vollständig übergeschnappt sein.
Und ebenso dachte wohl der Inder, mit solchen Augen betrachtete er den gelassenen Sprecher.
»Das klingt ja fast, als wollten Sie mich zwingen...«
Er kam nicht weiter. Der Franzose war mit dem Drehen seiner Zigarette fertig, griff in die Tasche, doch jedenfalls nach dem Feuerzeug, und... hielt dem Inder auch wirklich ein Feuerzeug hin, nur keine Streichholzbüchse oder dergleichen, sondern einen Revolver.
»Allerdings werde ich Sie zwingen. Zunächst keine Bewegung, keinen Laut — oder Sie sind ein toter Mann, auf mein Ehrenwort.«
Ganz ruhig hatte Chevalier es gesagt. Aber in seinen Augen lag es.
Das braune Gesicht des Inders ward plötzlich ganz grau, er wagte sich nicht zu rühren, und nicht minder bewegungslos saßen auch die anderen da.
Das war ja toller als toll!
»Chevalier«, war zuerst der Australier eines Wortes fähig, »was tun Sie denn da für...«
»Ruhe!«, ward er von jenem unterbrochen, »Auch für Sie gilt meine Warnung. Sobald Sie mich hindern, einer der Herren, schieße ich den Inder nieder, und dass meine Kugel sein Herz nicht verfehlt, wissen Sie. Ja, ich bin zu allem entschlossen, und ebenso wissen Sie doch auch, dass ich mich schon seit längerer Zeit mit Selbstmordgedanken trage. Glückt die Geschichte nicht, so jage ich einfach mir selbst eine Kugel durch den Kopf, und dass das dann vielleicht auch Ihren Tod bedeutet — — mir ganz gleichgültig.«
Die anderen Herren erkannten, in was für eine Lage sie da geraten waren. Sie selbst waren solche Charaktere, die auf nichts Rücksicht nahmen — nun aber merkten sie, wie gefährlich es werden kann, solch einen gleichgearteten Mann zu seinem Gesellschafter zu haben.
»Mensch«, fing nur der Lord noch einmal an, »was gehen Sie denn meine Geschäfte an? Kümmern Sie sich doch gefälligst um sich selbst!«
»Ruhe, Mylord! Ich tue, was ich will. Mir ganz gleichgültig, was daraus wird. Oder empfinden Sie etwa Gewissensbisse darüber, dass bei dem Versenken unseres Schiffes ein unschuldiger Mann seinen Tod gefunden hat? Well, auch mir ist alles ganz gleichgültig.«
Die Herren schwiegen. Ihr junger Freund hatte ihnen da eine furchtbare Wahrheit gesagt. Und der Franzose saß so, dass es ganz unmöglich war, ihm den Revolver aus der Hand zu schlagen oder nur dessen Richtung abzulenken, und dass Chevalier in diesem Falle sofort auf den Inder geschossen, ihn getötet hätte, daran zweifelten sie nicht im Mindesten.
Außerdem aber war ja so etwas ganz nach ihrem Geschmack, nur im ersten Moment waren sie so sehr bestürzt gewesen, jetzt beobachteten sie mit Interesse, wie sich die Sache noch abwickeln würde — an ihre eigene Person dachten sie dabei gar nicht mehr. Sie waren ja schon viel zu sehr daran gewöhnt, ihr Leben bei jeder Gelegenheit aufs Spiel zu setzen, nur um ihre Nerven anzureizen.
»Bravo!«, sagte denn auch Mister Brown. »Nun mal weiter.«
»Also Sie wissen jetzt, Mister Sabasi«, fuhr der Franzose dann fort, »um was es sich handelt. Sie werden uns oder speziell meinem Freunde, dem Lord Seymour, Gelegenheit geben, dass er das Leben und Treiben auf diesem Schiffe kennen lernt. Antworten Sie. Jetzt erlaube ich Ihnen das Sprechen.«
»Das kann ich nicht«, hauchte der Inder, der seine Fassung angesichts des auf ihn gerichteten Revolvers in einer Weise verloren hatte, die man diesem Orientalen kaum zugetraut hätte.
»Sie müssen es eben ermöglichen. Sinnen Sie nach, wie Sie das machen.«
»Herr, wir werden beobachtet!«
»Von wem?«
»Oben an der Decke sind Löcher, an diesen liegen die Augen von heimlichen Lauschern.«
Es fiel dem Franzosen gar nicht ein, nach oben zu blicken, er kannte diese Gucklöcher ja auch schon.
»Sehr schlimm für Sie. Oder glauben Sie, dadurch ändert sich in meinem Entschlusse etwas? Jetzt mache ich es vielmehr noch kürzer. Ich zähle bis drei, und wenn Sie mir bis dahin nicht zugesichert haben, dass Sie dem Lord dennoch die Gelegenheit geben, alles im Schiffe kennenzulernen, sind Sie ein toter Mann. Eins...«
Die vier anderen sahen die Katastrophe kommen und keine Möglichkeit, sie abzuwenden. Sie kannten doch diesen Franzosen zur Genüge! Ein Eingreifen ihrerseits, nur die leiseste Bewegung dazu, und Chevalier hätte schon vorher abgedrückt.
Und der Inder musste dasselbe wissen, ohne diesen Mann sonst zu kennen — es stand in dessen Augen geschrieben, dass er zu allem fähig war.
»Zwei...«
»Ja.«
»Sie wollen dem Lord behilflich sein?«
»Ich will.«
»Sie können es auch?«
»Ich werde einen Weg dazu finden.«
»Werden Sie auch mit den Beobachtern dort oben fertig werden?«
»Es sind gar keine oben.«
»Wir werden gar nicht beobachtet?«
»Sie wurden bisher immer beobachtet, von mir selbst, aber gegenwärtig ist niemand oben, ich habe die Schlüssel zu diesen Kabinen in meiner Tasche.«
»Ah, das ist vortrefflich! Sind Sie ein Anhänger des Brahmanismus oder des Buddhismus?«
»Ich selbst bin Brahmane.«
»Ah, das wird ja immer vortrefflicher.«
Und Monsieur Chevalier begann zu dem Inder in einer Sprache zu sprechen, welche die anderen nicht verstanden. Aber der eine, welcher etwas Hindustanisch verstand, merkte, dass es auch diese allgemeine Umgangssprache nicht war.
Der Inder musste etwas ihm sehr Unangenehmes zu hören bekommen, wieder verwandelte sich seine braune Gesichtsfarbe in ein Aschgrau, sein Zögern war ersichtlich.
»Entweder Sie beten mir den Schwur nach, oder Sie sind bei drei ein toter Mann«, sagte der Franzose, der den Revolver noch nicht um eine Linie hatte sinken lassen. »Beginnen Sie — eins, zwei...«
Da begann der Inder zu sprechen, Chevalier sagte manchmal etwas vor, was jener nachsprach. Auch hierbei kamen die Namen Brahma, Vishnu und Shiva sehr oft vor, aber auch noch andere Götternamen.
Und dann steckte Monsieur Chevalier den Revolver sorglos ein und erhob sich, um einen Gang durch die Kabine zu machen.
»Sie haben ihn schwören lassen?«, fragte Mister Fairfax.
»Ja.«
»Was?«
»Alles, was ich von ihm verlangte. Wir sind in Sicherheit, er kann uns nicht verraten, ist auf unserer Seite.«
»Erzwungene Schwüre und Eide braucht man nicht halten.«
»Aber das gilt nicht für diese Inder, noch weniger für einen Brahmanen. Genug, wir sind in Sicherheit, jetzt mögen die anderen ruhig ohne uns auf das Schiff hinübergehen. Nun, Mister Sabasi, wie denken Sie sich die Sache?«
Der Inder, sonst die Gelassenheit selbst, befand sich in größter Aufregung, trocknete sich immer den Schweiß von der Stirn.
»Ich habe noch keine Ahnung«, murmelte er.
»Gut, nehmen Sie sich Zeit, so eilig haben wir es ja nicht. Aber bis morgen Abend werde ich einen Plan vorgelegt haben, der auch wirklich zum Ziele führt. Jetzt können Sie gehen.«
Schwerfällig erhob sich der junge, sonst so rüstige Inder — diese Überrumpelung durch den Franzosen, an dem er seinen Meister gefunden, hatte ihn eben ganz perplex gemacht — schritt unsicheren Ganges der Seitentür zu, hier aber wandte er sich, sich auch plötzlich wieder aufrichtend, hastig um.
»In diesem Augenblick blitzt mir ein Gedanke durch den Kopf!«
»Lassen Sie den Blitz vor uns leuchten«, sagte Chevalier gleichmütig.
Sidi Sabasi blickte starr nach dem Lord mit seiner blauen Gesichtsgurke.
»Ein seltsamer Zufall — schon immer habe ich daran gedacht.«
»An was? Halten Sie sich nicht so lange mit der Einleitung auf.«
»Es ginge — allein das, was Sie von mir verlangen, ist unmöglich.«
»Sie haben es mir zugeschworen.«
»So einfach im Schiffe herumführen kann ich Sie nicht.«
»Das glaube ich wohl — suchen Sie eben eine andere Möglichkeit.«
»Es handelt sich nur um den Lord?«
»Nur um diesen. Um was andres brauchen Sie sich gar nicht zu kümmern.«
»Wohlan denn — hier an Bord befindet sich ein indischer Diener, welcher mit dem Lord eine ungemeine Ähnlichkeit hat.«
Wie die anderen Herren gleich aufblickten, das zeigte schon, wie sie sofort verstanden, wo hinaus jener wollte.
»Sprechen Sie Hindustanisch, Mylord?«, wandte sich denn auch Chevalier gleich an diesen.
»Nee«, lautete dessen trockene Antwort, »nur Englisch, ziemlich Französisch und etwas Jiddischdeitsch.«
»Das ist auch gar nicht nötig«, ließ sich der Inder wieder vernehmen. »Könnte der Mann sprechen, wäre es gar nicht möglich, dass der Lord seine Rolle übernimmt.«
»Ah, er ist stumm?«
»Taubstumm.«
»Ah, desto besser! Was für eine Rolle spielt er denn?«
»Nanda Pikuno ist hier der — der — Hansnarr, der Spaßvogel.«
»Ah, ich verstehe! Ist er wahnsinnig?«
»Nicht gerade wahnsinnig, aber doch sehr beschränkt, er gilt als Koptu, kann tun und treiben, was er will.«
Zunächst war es der in alle indischen Verhältnisse eingeweihte Franzose, der seinen Freunden eine kurze Erklärung gab.
Die Inder sind ja heutzutage meistenteils Mohammedaner, der Brahmanismus kann nur noch als eine Sekte gelten, der Buddhismus hingegen hat sich nur im nördlichsten Indien, in Tibet, in China und Japan Eingang verschafft, hier auch unter einem anderen Namen auftretend.
Der am meisten verbreitete Glaube in Indien, durch Feuer und Schwert aufgedrängt, ist also der Mohammedanismus. Nun wird dem geneigten Leser vielleicht bekannt sein, wohl auch aus früheren Erzählungen des Verfassers, wie der Wahnsinnige von dem Mohammedaner für heilig gehalten wird. Nicht nur, dass man ihn bemitleidet, sondern er gilt durch sein Leben in einer eingebildeten Welt direkt als ein Liebling Allahs und des Propheten. In allen türkischen und arabischen Städten sieht man immer einmal einen Irrsinnigen in den Straßen Allotria treiben, und die Passanten lassen sich nicht nur alles von ihm gefallen, sondern räumen ihm auch sorgsam jeden Stein aus dem Wege. Nur wenn er es gar zu toll treibt oder gefährlich wird, sperrt man ihn ein, hegt und pflegt ihn aber noch immer als einen Heiligen.
In Indien wird das freie Herumlaufen der Geistesgestörten vom englischen Regiment nicht geduldet. Und die Hindus haben die Irrsinnigen überhaupt niemals für heilig gehalten. Aber ein besonderes Entgegenkommen haben sie für diese Unglücklichen doch von jeher gehabt. Es ist ja bekannt, welche Liebe die Inder gegen Tiere, besonders gegen misshandelte, wie überhaupt gegen alles Schwache und Hilflose zeigen. Jeder Tempel ist mit einem Tierasyl oder Tierhospital verbunden, wie Europa kein einziges aufzuweisen hat. Jedes kranke oder altersschwache Tier, Pferd oder Hund oder Katze oder Vogel, wird dort frei angenommen, aber... dem Besitzer nicht wieder ausgeliefert. Man verpflegt es bis zum Tode. So ist Indien auch das Paradies aller Krüppel und Bettler. Da darf man glauben, dass geistig anormale Menschen ebenso dort in Anstalten die beste Pflege finden, in Tempeln, ohne deshalb, wie nach mohammedanischer Ansicht, als Heilige vergöttert zu werden.
Zweitens herrscht an indischen Höfen noch heute dieselbe Sitte wie bei uns im Mittelalter: die Fürsten halten sich Hofnarren. Oder bei uns kam dieser Posten vielmehr erst am Anfange der neueren Zeit auf, die ersten Hofnarren tauchten erst Ende des 18. Jahrhunderts auf, der Geschmack daran soll also erst durch die Kreuzzüge aus dem Orient nach Deutschland gekommen sein.
Bei uns freilich hatten die Hofnarren noch einen ganz besonderen Zweck. Wohl dienten sie zur allgemeinen Belustigung, waren grobe Spaßmacher, aber unter den Narrenkappen staken meistenteils gar geistreiche Köpfe, welche mit bitterem Spott die damaligen Unsitten an den Höfen geißelten, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, es waren eben Narren, die man höchstens mit einer Maulschelle bestrafen konnte, und welche trotzdem manchmal mehr Macht hatten als der erste Minister — und auch ein größeres Einkommen. Ein Kunz von der Rosen unter Kaiser Maximilian I., ein Gundling am preußischen Hofe, ein Klaus unter einigen sächsischen Kurfürsten sind wie noch andere mehr zu historischen Berühmtheiten geworden.
Solch eine gefürchtete und selbst politische Rolle hat ein Hofnarr im Orient, soweit bekannt, niemals gespielt, auch nicht in Indien. Da muss es ein wirklicher Dummkopf sein, der eben den Hanswurst spielt, und ein solcher gehört nun einmal zum engeren Gefolge des Fürsten, wie sein Leibbarbier und sein Pfeifenträger.
Einst war Nanda Pikuno ein ganz vernünftiger Mensch gewesen, noch auf der alten ›Indianarwa‹, ein Diener. Infolge eines Schreckens hatte er durch lange Krankheit Sprache und Gehör verloren, auch seinen richtigen Verstand, war etwas albern geworden, wenn auch durchaus nicht irrsinnig.
Als der eigentliche Hofnarr des alten Maharadschas, ein Zwerg, durch den Tod abgegangen war, hatte man Pikuno zu seinem Nachfolger erwählt, der es schon unfreiwillig immer gewesen war.
Sabasi schilderte ausführlich, wie sich jener betrug, was er sich alles erlaubte und erlauben durfte, und der aufmerksamste Zuhörer war Lord Seymour.
»Vortrefflich, vortrefflich!!«, rief er ein übers andere Mal. »Also, ich darf einfach alles machen, was ich will!«
»Was Sie wollen«, lächelte der sonst ernste Inder zum ersten Male. »Nur nicht gefährlich werden. Das entspräche Pikunos harmlosem Charakter nicht.«
»Aber handgreiflich werden darf ich?«
»Wie handgreiflich?«
»Wenn ich nun dem Maharadscha eine herunterhaue?«
»Dann werden Sie einige Tage bei Wasser und Brot eingesperrt.«
»Puh!«, machte der Lord. »Das entspricht nun wieder meinem Charakter nicht. Und Sie glauben, dass ich dieses Narren Rolle durchführen kann?«
»Das kommt ganz auf Sie an.«
»Ich sehe ihm wirklich so ähnlich?«
»Ganz genau dasselbe Gesicht.«
»Ist er als Inder nicht viel brauner?«
»Nicht brauner als Sie.«
»Auch so dick wie ich?«
»Genau dieselbe Gestalt.«
»Auch so eine Glatze?«
»Die Haare fehlen ihm in ganz derselben Weise; auch den Bart trägt er ebenso.«
»Auch so eine Gesichtsgurke?«
»Genau dieselbe Form.«
»Und die Farbe?«
»Alles dasselbe, er ist in jeder Hinsicht Ihr Doppelgänger.«
»Hat er aber nicht eine Zeichensprache gelernt?«, fragte der Franzose.
»Nein, so etwas kennen wir gar nicht, und ich wüsste nicht, dass er sich besondere Zeichen gebildet hätte, um Wünsche auszudrücken. Nun ja, wie es jedes Kind macht, wenn es zum Beispiel hungrig ist. Er ist überhaupt ein vollkommen unentwickeltes Kind, nur dass er schon laufen kann und Zigaretten liebt.«
»Wie soll nun die Vertauschung der Rollen vor sich gehen?«
Der Plan, den Sabasi entwickelte, war einfach genug. Er habe von diesem Nanda Pikuno den Gästen erzählt, diese hätten den Narren einmal zu sehen begehrt. Nicht erst morgen, sondern heute noch, nach dem Abendessen würde er, Sabasi, den Hofnarren also hereinbringen, und dann mussten die Herrn ihn eben überwältigen und bei sich behalten.
»Überwältigen, wie?«, fragte Chevalier. »Ihn binden?«
»Das ist vielleicht gar nicht nötig. Pikuno ist ein großer Freund von spirituösen Getränken, die er durch uns nicht bekommen darf.«
»Gut, dann werden wir das leicht bewerkstelligen können. Lord Seymour wird mit ihm dann die Kleidung wechseln. Und wie soll der Lord hier herauskommen?«
Nur ein kurzes Zögern, dann zeigte der Inder den Mechanismus, welcher jene in Betracht kommende Tür öffnete. So einfach er auch war, hätte ihn doch schwerlich ein Uneingeweihter finden können.
»Es ist ein großer Vertrauensbruch, den ich begehe.«
»Sie sind zum Schwure gezwungen worden, und mehr verlange ich auch nicht von Ihnen.«
»Die anderen Herren werden keinen Gebrauch davon machen, diese Räume nicht verlassen?«
»Das wird sich finden, darüber können wir Ihnen noch kein Versprechen geben. Wir dürfen aber nicht von dort oben beobachtet werden.«
»Selbstverständlich nicht, das wäre ja mein eigener Schaden.«
»Wir werden Sie natürlich nicht verraten; wenn die Sache aber nun herauskommt, der Lord sich erwischen lässt, was wartet Ihrer dann?«
»Der Tod.«
»Sie werden hingerichtet?«
»Ich erhalte den Befehl, mich selbst zu töten.«
»Und dem würden Sie nachkommen?«
»Selbstverständlich!«
»Nun, das finde ich nicht so ganz selbstverständlich. Aber das können Sie ja halten, wie Sie wollen. Und was steht dem Lord bevor, wenn er dabei erwischt wird?«
»Das weiß ich nicht. Jedenfalls wird er bestraft — oder vielmehr: man wird ihm die Möglichkeit nehmen, dass er das weitererzählt, was er auf diesem Schiffe geschaut hat.«
»Auch er wird getötet?
»Leicht möglich.«
»Mylord, Sie haben es gehört, richten Sie sich darnach. Noch haben Sie Zeit, von dem geplanten Abenteuer zurückzutreten.«
»Fällt mir ja gar nicht ein, ich kann mit meinem Leben doch machen, was ich will.«
»So haben wir wohl nichts weiter zu besprechen. Sie bringen den Nanda Pikuno zu uns herein, für alles andere tragen wir selbst Sorge.«
»Und wie lange soll er hier und der Lord ausbleiben?«
»Das wird der Lord wohl selbst noch nicht bestimmen können.«
»Und wie soll es dann mit dem Gefangenen gehalten werden?«
»Er kann wirklich sich gar nicht verständlich machen?«
»Nein. Doch das ist auch das Wenigste. Sie müssen ihn eben in trunkenem Zustande halten, er liegt in einer Koje, wird für den Lord ausgegeben — dann, nach des Lords Rückkehr, bringe ich ihn ungesehen in irgendeinen Winkel, und kommt er dort zu sich, so mag er sich nur verständlich zu machen suchen — er ist eben ein Narr, der nur geträumt hat.«
Es war nichts mehr zu verabreden, Sabasi entfernte sich, und die Herren beobachteten durch das Fensterchen, wie die Mannschaft der ›Zingalia‹ durch japanische Matrosen an Bord eines Schiffes gebracht wurde.
Dann hatten die Herren noch genug zu besprechen, bis das Abendessen serviert wurde, mit genügendem Wein, wozu schon die Petroleumlampen angezündet werden mussten.
Sie saßen noch bei Tisch, ohne einen Diener zugelassen zu haben, als sich wieder Sabasis Stimme anmeldete, dessen Worte von grunzenden Lauten begleitet wurden.«
»Zurück, Pikuno — du darfst nicht mit hierherein — willst du dich gleich fortscheren — na, nun hast du dich doch mit hereingedrängt, nun magst du auch bleiben...«
Diese Worte, wohl auch durch energische Handgriffe unterstützt, da der Angeredete ja taub war, waren natürlich nur eine List, um die draußen Stehenden zu täuschen.
»So, meine Herren, da haben Sie ihn«, sagte der eintretende Sabasi in anderem Tone.
Ihm nach stolperte ein kleiner, korpulenter Mensch, von dem nichts anderes zu sagen ist, als dass er das vollkommene Ebenbild von Lord Seymour war, nur dass er auf indische Weise gekleidet war, in einen blauen Kaftan mit Schnabelschuhen, auf dem Kopfe einen riesigen Turban balancierend.
»Lord Seymour, wie er leibt und lebt!«, erklang es im Chor.
Mr. Brown war gerade einmal aufgestanden, und sofort nahm das Kerlchen, immer jene grunzenden Laute ausstoßend, auf dem freien Stuhle Platz, nur mit untergeschlagenen Beinen, und griff auch gleich mit beiden Händen in die vollen Schüsseln, sich in das weitaufgerissene Maul schiebend, was hineinging, sich dabei das ganze Gesicht vollschmierend, und dann an den noch übervollen Mund die nächste Flasche führend und sie nicht eher absetzend, als bis sie leer war, worauf er wieder mit beiden Händen unter vergnügtem Grunzen in dem gepfefferten Reisbrei herumpatschte.
»Dieses Grunzen ist der einzige Laut, den er hervorbringen kann«, erklärte Sabasi, »es ist ein Zeichen des Behagens. Ich habe ihm nämlich zu verstehen gegeben, dass es hier drin etwas zu essen gibt, und da ließ er sich nicht mehr zurückdrängen.«
Mit ernstestem Interesse betrachteten unsere Freunde das schmatzende Ungeheuerchen.
»Frisst der immer wie so 'n Schwein?«, fragte zunächst Lord Seymour.
»O, Mylord«, ermahnte Chevalier, »Sie wissen doch, dass Orientalen weder Gabel noch Löffel kennen.«
»Pardon — speist der denn immer so mit den Pfoten? wollte ich sagen.«
»Er benimmt sich eben in jeder Weise noch ganz wie ein unbeholfenes Kind«, erklärte Sabasi, »oder meinetwegen auch wie ein Tier, wie ein Affe.«
»Also passen Sie auf, wie's gemacht wird«, ließ sich der Franzose wieder vernehmen, »dass Sie das dann auch alles nachahmen können.«
O, dazu ließ sich der Lord doch nicht zweimal auffordern — er patschte mit beiden Händen in eine Schüssel mit Rosinenhirse, dass der Brei in der ganzen Kabine umherspritzte.
Sabasi entfernte sich bald wieder, alles andere den Herren überlassend.
Diese beobachteten noch eine Weile das Gebaren des Taubstummen, sonst hatten auch sie sich nicht weiter um ihn zu kümmern — das, worauf es ankam, besorgte dieser von ganz allein — er sprach den auf dem Tische stehenden Flaschen so emsig zu, dass er gar bald vom Stuhle fiel.
Der Australier goss ihm noch ein Glas Branntwein in den Schlund, dann wurde er völlig entkleidet, was auch der Lord mit seiner eigenen Person besorgte.
»Was suchen Sie denn?«, fragte der Franzose, als der Lord den indischen Kaftan und noch mehr die Unterkleidung des Taubstummen immer wieder hin und her wendete und besonders die Falten untersuchte.
»Läuse«, lautete der lakonische Bescheid.
»Die wird es an Bord dieses Schiffes wohl schwerlich geben.«
»Hm, schade!«, brummte der edle Lord bedauernd und schlüpfte in das indische Kostüm.
Als er dann auch noch den Turban um seine Glatze drapiert hatte, war er wirklich von dem Taubstummen gar nicht zu unterscheiden.
Dieser ward in eine Koje gepackt, und ohne dass noch etwas besprochen wurde, wann die Rückkehr des Lords zu erwarten sei, traf man gleich Anstalten, den falschen Hofnarren hinauszubugsieren. Denn die Tür selbst öffnen durfte man jetzt nicht, falls draußen sich zufällig jemand aufhielt. Wächter waren sonst nicht auf dem Korridor postiert, das hatte schon Sabasi gesagt.
So wurde die Klingel geläutet, welche den aufwartenden Diener herbeirief, der diese Kabinen, wie immer, durch den Sicherheitsraum betrat.
»Hier, schaffe den Kerl wieder hinaus, der sich vorhin mit dem Sidi hereingeschlichen hat«, sagte der Franzose.
»Ich weiß, Sahib — er hat sich doch nicht lästig betragen?«
»Das nicht gerade, er hat sich nur vollgegessen.«
»Das glaube ich wohl«, lächelte der Diener. »Er hat sich doch nicht betrunken?«
»Dass dies nicht geschah, dafür haben wir gesorgt. Nun hinaus mit ihm!«
Der Diener fasste den falschen Hofnarren am Arm, zunächst ganz sanft, einige ermunternde Worte, ein Zeichen nach der Tür, und Lord Seymour ließ sich denn auch willig hinausführen, unter einem behaglichen Grunzen, und nur in der Tür noch einmal, einen lüsternen Blick nach dem Tische mit den Flaschen zurückwerfend, dann stolperte er unsicheren Ganges weiter.
»Famos gemacht, an dem ist ein Schauspieler verloren gegangen«, erklärte Chevalier, als sie allein waren.
Der Lord befand sich auf dem Korridor, wurde von dem Diener noch einige Schritte vorwärtsgeschoben — »Nun sieh zu, wie du weiterkommst, Pikuno« — und er ließ ihn stehen.
Es war gegen neun Uhr, schon seit zwei Stunden finstere Nacht. Damals, als Jansen auf die alte ›Indianarwa‹ gekommen, war bei Nacht im Schiffe immer alles finster gewesen, Jansen hatte nicht einmal eine Laterne auftreiben können, bis er deren Aufbewahrungsort fand.
Dass aber nicht solche primitive Verhältnisse herrschen konnten, während sich das Schiff in Fahrt befand, war selbstverständlich. Was hätte denn daraus werden sollen, wenn das Schiff einmal in Gefahr kam! So waren überall, besonders an jeder Ecke, brennende Petroleumlampen angebracht.
Sonst hatte der Lord von Sabasi nur noch erfahren, dass hier niemand eine regelrechte Schlafstelle besaß, wenigstens keiner der fünfhundert Diener, jeder legte sich nach indischer oder überhaupt orientalischer Sitte zum Schlafen eben dahin, wo er gerade einen weichen Platz fand, der ihm zugänglich war, und das geht so weit, dass zum Beispiel Bürodiener und selbst unverheiratete Kommis, deren es ja auch eingeborene genug gibt, gleich im Büro schlafen, sich einfach auf den nie fehlenden Teppich legend, und so lungern auch in den orientalischen Häusern in jeder Stube rauchende, schwatzende und schlafende Diener herum, welche, wenn man mit einem Besuch allein sein will, erst durch ein nachdrückliches Gebot hinausgejagt werden müssen. Doch diese orientalischen Diener werden im allgemeinen ja nur wie lebendige Maschinen betrachtet, durch deren Anwesenheit man sich für gewöhnlich in keinem Gespräche und in keiner Handlung stören lässt.
Dass dies also auch hier so war, das hatte sich der Lord durch Tabasi noch sagen lassen. Sonst hatte er von ihm gar nichts mehr wissen wollen, um selbstständig alles ausspionieren zu können, was ihm, seinem Charakter nach, viel mehr Freude machte.
Nachgeholt aber muss werden, dass der Lord nicht nur, wie er zu dem fragenden Chevalier gesagt. Englisch, Französisch und etwas ›Jiddischdeitsch‹ verstand. Da hatte er nicht die Wahrheit gesagt, nur einen Witz gemacht.
Lord Seymour war, wie fast jeder englische Aristokrat, einige Jahre Offizier gewesen, hatte auch in Indien gestanden und beherrschte daher das Hindustanisch vollkommen, wie er auch mit den indischen Verhältnissen Bescheid wusste. Wenn er das verschwieg, so war das jedenfalls klüger gewesen, als wenn er damit geprahlt hätte.
In diesem Korridor hier befand sich niemand, alles wie ausgestorben. Den Gang des Taubstummen, der immer über die große Zehe gestolpert war, nachmachend, auch wenn er sich unbeobachtet glaubte, schritt der Lord vorwärts und prallte, als er um die nächste Ecke bog, mit einem Inder zusammen, der auch wirklich ein indisches Kostüm trug.
»Du hier, Pikuno? Komm, der Maharadscha erwartet dich!«
Weitere Worte verschmähend, da der Taube ihn ja doch nicht verstand, winkte er, ihm zu folgen, zog ihn auch erst etwas an der Brust und schritt dann voraus, aber dabei immer aufpassend, dass der vermeintliche Hofnarr ihm auch wirklich folge.
Also zum Maharadscha! Da sah sich Seymour ja gleich am Ziele seiner Wünsche, brauchte nicht erst lange unter dem Mantel der Narrheit zu suchen.
Auch die anderen Korridore, welche sie durchschritten, waren wie ausgestorben. Dagegen erscholl immer lauter ein Gesang, den Seymour als von Bajaderen herrührend erkannte.
Noch am späten Abend ward eins der täglichen Feste gefeiert — oder der Maharadscha ließ sich einfach von seinen Weibern unterhalten — desto besser, so bekam der falsche Pikuno ja alles gleich zu sehen und konnte vielleicht noch heute nacht sich zurückschmuggeln, um seinen Freunden etwas zu erzählen.
Der Gesang verstummte. Am Ende eines Korridors angekommen, schlug der Führer einen Vorhang zurück, und... der vorgebliche Taubstumme hätte vor Staunen wirklich bald Maul und Nase aufgesperrt, wenn er auch als Lord Seymour sonst über Staunen und dergleichen Gefühlsschwächen erhaben war.
Es war ein für damalige Schiffsverhältnisse riesiger Saal, für den ehemaligen Passagierdampfer wahrscheinlich der Speisesaal, durch Hinzunahme der Nachbarräume noch bedeutend erweitert, in dem sich wohl alle befanden, die nicht zur eigentlichen Mannschaft gehörten, mindestens sechshundert Personen, wobei noch Kinder ausgeschlossen, nur Männer und Weiber.
Sie alle kauerten am Boden, in schillernde Seide gehüllt, die Weiber mit allerlei Tand, aber wohl mit unechtem, behangen, und sie alle blickten nach der im Hintergrunde in Stufen ansteigenden Bühne, auf der die edlen Hindus mit ihren Weibern saßen, noch anders gekleidet, in ganz anderer Farbenpracht, die Weiber mit glitzerndem Geschmeide überdeckt, welches das rote Licht zahlloser Lampen, und Lampions in Tausenden von Farben sprühen ließ.
Zuoberst auf dieser Plattform kauerten wieder gegen fünfzig Weiber, immer noch prächtiger gekleidet und geschmückt, das mussten die Weiber des Maharadschas sein, vielleicht zugleich auch die Bajaderen, denn sie lagen wieder zu Füßen des Maharadschas, welcher noch höher auf einem Throne saß, zwischen seinen beiden Lieblingsfrauen, wenn auch nur die eine, die rechte, die eigentliche Favoritin, die legitime Herrscherin sein mochte.
Der steinreiche Lord Seymour hatte früher selbst ein Haus geführt, in dem er alles zusammengeschleppt, was er auf seinen Weltreisen für kostbar gehalten, soweit es überhaupt zu kaufen gewesen war — aber er hatte diese seine Schätze nicht mit denen vergleichen können, die er während seines Aufenthaltes in Indien an den Höfen der eingeborenen Radschas und Maharadschas gesehen — und was er dort an fabelhaftem Glanze geschaut, an Gold und Elfenbein und Edelsteinen aller Art, das ließ sich wieder nicht im entferntesten vergleichen mit dem, was er hier zu erblicken bekam.
Jansen hatte ihnen davon erzählt, sie hatten es ihm geglaubt — aber was hier der Lord mit eigenen Augen schaute, das hätte er niemandem geglaubt, wenn es ihm so auf diese Weise geschildert worden wäre.
Schon der Schmuck, den diese Weiber trugen, nicht minder aber auch die Männer, an den Händen, an Stirnbändern, wie besonders auch an den Waffen, war einfach unschätzbar.
Mit Ausnahme des ›Volkes‹, wie man die unten Sitzenden bezeichnen konnte, rauchte alles, auch die Weiber, letztere besonders aus meterhohen Wasserpfeifen, und der Luxus, der mit diesen Rauchapparaten getrieben wurde, spottet jeder Beschreibung.
Wo unter einem Körper ein Kissen zum Vorschein kam, da funkelte alles von Gold und Edelsteinen, und so war es in allem und jedem. Der sonst so kaltblütige Lord war im ersten Augenblick wirklich wie geblendet.
»Wenn dieses Schiff einmal untergeht — oder wenn das so ein richtiger Seeräuber wüsste — da möchte man doch gleich selbst Seeräuber werden!«
Das waren seine ersten Gedanken — auch so ganz seinem Charakter entsprechend.
Dann richtete der Lord seine Aufmerksamkeit zunächst auf die oberste Gruppe. Er hatte genau dasselbe Bild, welches einst Jansen geschaut. Links, aber zur rechten Hand, ein braunes, junonisches Weib mit großen, tiefernsten Augen, von welchem der Lord noch nicht wusste, dass es Eloha hieß, rechts oder zur linken Hand der Hauptperson das Gegenteil von jenem, eine mildblickende Fee, deren Leib unter der dünnen Gazeumhüllung wie frischgefallener Schnee leuchtete, und in der Mitte der Herr und Gebieter all dieser Männer und Frauen, der Maharadscha, der anerkannte Nachfolger des Verstorbenen, über dessen sonstige Persönlichkeit noch gar nichts bekannt geworden war.
Über seine Figur konnte man nicht urteilen, da er mit untergeschlagenen Füßen kauerte, und auch der Oberkörper verschwand unter kostbaren, von Diamanten und anderen Edelsteinen strotzenden Gewändern. Jedenfalls aber war es ein groß und stark gebauter Mann mittleren Alters, das edle, tiefbraune Antlitz von einem langen, schwarzen Barte umrahmt, der ihm bis weit auf die Brust fiel.
Regungslos wie eine Statue saß er da, den Blick auf die Kommenden gerichtet, nur ab und zu automatisch seinen funkelnden Tschibuk zum Munde führend und ihm Rauchwölkchen entlockend.
»Der Kerl hat doch trotz seines schwarzen Bartes blaue Augen?!«, war des Lords nächster Gedanke. »Und und und — wenn ich mir den Bart wegdenke — Himmelherrgott, wo habe ich den Kerl denn nur schon einmal gesehen? Ach so, zu Delhi, am königlichen Hofe, da war ein indischer Prinz, der auch so trotz aller Rassemerkmale blaue Augen hatte. Natürlich, das ist er, das ist er — wenn ich auch nicht weiß, was für eine Rolle der Kerl damals gespielt hat. Jetzt ist der also hier Großfürst zur See.«
Hiermit war der Lord demnach schnell fertig, die Entdeckung einer Ähnlichkeit mit einer ihm bekannten Person beunruhigte ihn nicht mehr.
Jetzt erst aber merkte er, dass er unterdessen immer vorwärtsgeschoben worden war, bis er dicht vor der untersten Stufe stand, mit vornehmen Weibern besetzt, auch gar nicht mehr weit entfernt von dem Hauptthron, und da gewahrte er ebenfalls erst jetzt noch eine andere Person, die er bisher übersehen.
Dicht zu den Füßen des Maharadschas kauerte ein Haufen schwarzer Lumpen, aus denen zur Seite ein Paar brauner Knochenhände hervorsah, ohne jedes Fleisch, und obendrauf saß ein brauner Totenschädel, in dem die funkelnden Augen das einzige Lebende waren, und daraus musste man schließen, dass diese Lumpen ein ganzes solches Menschenskelett bargen.
Nun, der Lord hatte die Erzählungen Jansens noch zu gut im Kopfe, um noch zu wissen, dass dies Toghluk, der Fakir, war, nach Graf Axels Abgange die rechte Hand des neuen Maharadschas, wenn er nicht auch schon beim alten die Hauptperson gewesen war.
»Hier ist er«, sagte der Inder, der den Narren bis hierher mehr geschoben als geleitet hatte, aber wieder ein anderer, als der, der dem Lord auf dem Korridor begegnet war.
Seymour war sich immer bewusst gewesen, welche Rolle er zu spielen hatte, war immer über die große Zehe gestolpert, und so tat er auch jetzt zuletzt noch einen tüchtigen Stolprich und fiel direkt einer der braunen Schönen in den Schoß, die auf der untersten Stufe ihr Nargileh rauchte und dabei ab und zu aus einer Schale überzuckerte Rosenblätter naschte.
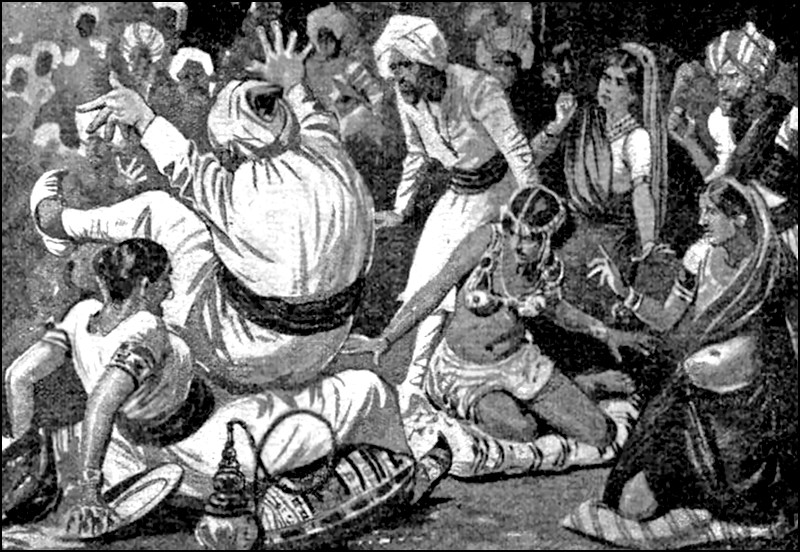
Das Weib kreischte laut auf, andere Kolleginnen kreischten mit ihr, aber das machte dem Lord nichts, er setzte sich noch gemütlicher auf dem Schoße der Schönen fest, grunzte vergnügt, führte mit der einen Hand den fallengelassenen Pfeifenschlauch in den Mund und pfropfte sich mit der anderen überzuckerte Rosenblätter hinein, und ob sich nun der echte Hofnarr ebenso ungeniert betragen hätte, oder ob seine Dummdreistigkeiten gemäßigter waren, das war dem edlen Lord ebenfalls ganz egal.
Und er schien in seiner Narreneigenschaft wirklich zu weit gegangen zu sein! Vor allen Dingen wurde dieser sein Streich von niemandem belacht, all die Männer blieben ernst wie zuvor, und von dem, der ihn gebracht, ward er ganz unsanft aufgerissen.
»Achtung, Pikuno, du stehst jetzt nicht hier als Softa.«
Leider wusste der Lord nun trotz all seiner indischen Kenntnisse nicht, was das Wort Softa bedeutet, und er ließ sich zunächst auch nicht irremachen, er grinste vergnügt und langte erst noch einmal in eine andere Schale, welche überzuckerte Pomeranzenschnitte enthielt.
Jetzt wurde er von hinten gepackt und festgehalten. Gleichzeitig trat ein anderer Inder neben ihn, jedenfalls den unteren Schichten angehörend, der auf den Knien, immer die Nase am Boden, bis an den Thron gekrochen war.
»Allmächtiger Fürst, heiliger Beherrscher aller Brahmanen, du Stern der Verheißung des freien Indiens«, begann dieser, und nachdem er noch mehr solcher schmeichelhafter Titel hinzugesetzt hatte, rückte er endlich mit der Hauptsache heraus: der Softa Nanda Pikuno habe ihm etwa vor zwei Stunden einen geweihten Talisman, einen kleinen, geschnitzten Stein, dem er schon so viel zu verdanken habe, gestohlen.
Ei, als der Taube das zu hören bekam, da ward ihm doch etwas unbehaglich zumute! Die Festlichkeit hatte sich also in eine Gerichtssitzung verwandelt, der Angeklagte war der Hofnarr, und dass sein Doppelgänger so ein Spitzbube war, das hatte der Lord nun freilich nicht gewusst, das hätte Sabasi auch gleich sagen können.
Zunächst hielt der falsche Hofnarr für angebracht, sich noch einmal loszureißen und wieder einer der braunen Schönen in den Schoß zu fallen, und als er wieder zurückgerissen wurde, wie ein trotziges Kind mit den Füßen zu strampeln.
Da öffnete der Maharadscha seinen bärtigen Mund.
»Wie hat er ihn dir gestohlen?«, fragte er mit tiefer Stimme. Und beim Klange dieser Stimme hörte der Lord verwundert auf, dabei nicht vergessend, als Narr ein möglichst dummes Gesicht zu machen.
Himmel, wo hatte er denn diese sonore Stimme schon gehört? Kannte er die nicht sehr gut? Hatte auch der indische Prinz mit den blauen Augen damals in Delhi solch eine Stimme gehabt, und hatte sich diese denn seinem Gedächtnis so fest eingeprägt?
Doch vorläufig lauschte der Taube der Antwort des Klägers.
»Er hat ihn mir aus der Hand gerissen, als ich meinen Talisman anbetete.«
»Konntest du ihn ihm nicht wieder abnehmen?«
»Er hat ihn gleich in den Mund gesteckt und verschluckt.«
»Nanu«, dachte der Lord, »ich habe ja einen netten Doppelgänger!«
»Wie groß war der Talisman?«, fragte der Maharadscha weiter. »Nicht viel größer als ein Kirschkern.«
»Na, dann geht's ja«, dachte der Lord wieder, »ich glaubte schon, es wäre ein Götze in Lebensgröße gewesen.«
»Aus was bestand der Talisman?«
»Aus dem heiligen Steine, den man am Sitze der Götter findet.«
»Was stellte er dar?«
»Einen Elefanten, und geweiht hat ihn der Brahmane, der am Sitze der Götter wohnt.«
»Vor zwei Stunden ward er gestohlen?«
»Ja.«
»Akim!«
Das ist der Arzt, der bei den Indern denselben Namen führt wie in der arabischen Sprache, nur dass diese noch ein H vorsetzen.
Ein anderer Inder trat vor, nicht so kostbar gekleidet, aber doch durch sein würdevolles Auftreten den vornehmen Hindu verratend und außerdem durch ein am Gürtel hängendes, büchsenartiges Tintenfass und Rohrhalter als Gelehrter gekennzeichnet, wie auch bei uns im Mittelalter die Gelehrten ihr Schreibgerät immer bei sich führten.
Zu diesem Hakim oder Akim sprach der Maharadscha einige wenige Worte, welche der Lord leider nicht verstand, es gibt ja in Indien eine ganze Masse verschiedener Sprachen.
Der Akim winkte, und ob der Lord nun folgen wollte oder nicht — er wurde jenem von kräftigen Armen nachgeschoben.
Es ging zum festlichen Saale hinaus, einen kurzen Korridor entlang, und der Lord ward in eine kleinere Kabine geschoben, in der es ganz nach Apotheke roch.
Grunzen tat Lord Seymour schon längst nicht mehr, der Hofnarr sollte ja nur vor Vergnügen grunzen, eines anderen Lautes nicht fähig sein, und der edle Lord fand kein Vergnügen an dieser Sache, aber er sträubte sich auch nicht, sondern versuchte noch immer Kapriolen zu machen.
»Dort die Flasche, Mansor.«
Ein Inder, der Apothekergehilfe, reichte dem Arzt aus einem Schranke eine Flasche, dieser füllte einen kleinen Becher mit einer gelblichen Flüssigkeit.
Verflucht, jetzt krieg ich Brechwein zu trinken! dachte der Lord verzagt.
Da hatte er allerdings richtig geahnt.
»Trink!«, sagte der Arzt.
Der Taube wollte nicht verstehen, als Stummer durfte er auch nicht die Versicherung abgeben, nichts von jenem Diebstahl zu wissen — und überdies wurde er auch gar nicht erst gefragt, der Arzt setzte ihm den Becher an den Mund, auch der Kopf wurde ihm festgehalten und etwas nach hinten gebogen, dann drückten ihm zwei Finger die blaue Gesichtsgurke zusammen, und als er, um Luft schnappen zu können, den Mund öffnete, ward ihm die Flüssigkeit auch schon in den Schlund gegossen, und da man ihm die Nase noch nicht freigab, musste er auch schlucken.
Das Zeug schmeckte ölig und süß, durchaus nicht widerlich, aber... in des Lords Magen machte es alsbald seine Wirkung geltend, mit einer Schnelligkeit, wie Brechwein es gar nicht vermag.
Schleunigst ward dem Delinquenten eine große Schüssel vorgehalten, und diese füllte der edle Lord mit allem an, was er vor einer Stunde gegessen, und er hatte eine reichliche Mahlzeit gehalten.
»Hoho, süßen Reis mit Rosinen!«, meinte der eine Gehilfe mit offenbarem Neide.
»Und Fleisch — heute zum heiligen Fasttag!«
»Er ist vorhin bei den Faringis gewesen, welche nicht mit zu fasten brauchen, da hat er gegessen«, erklärte ein Eingeweihter den anderen.
»Und dieser Schuft von Narr kann jetzt alles im Magen behalten, was er gefasst hat«, dachte der gepeinigte Lord ingrimmig, als er einmal Luft schnappte, und dann leerte er den Inhalt jenes Körperteils, den der römische Stoiker Epiktet immer verächtlich den Madensack nennt, vollends aus.
Jetzt begannen der Arzt und ein Gehilfe in dem verschieden gefärbten Brei mit Zangen herumzustochern. Der Inder dagegen, dem der Talisman gestohlen worden, war nicht so penibel, der krebste gleich mit den Fingern in dem nach Alkohol duftenden Breie herum, und...
»Da ist er!«
Ja, er hatte wirklich etwas zwischen den Fingern, und als das kleine Ding abgewischt war, zeigte sich, dass es ein winziger Elefant von grünem Steine war.
Lord Seymour hatte an sich schon Froschaugen, und diese quollen noch mehr hervor, als er den kleinen Gegenstand betrachtete.
Wenn er recht gesehen, so hatte der Inder den Talisman wirklich aus der Schüssel mit dem Speisebrei gefischt, aber der Lord wusste doch am allerbesten, dass er keinen Elefanten in seinem Magen gehabt.
»Das ist...«
Zum Tode erschrocken brach der Lord ab. Er sah sich schon verraten. Und es war doch bei weitem besser, einige Tage bei Wasser und Brot zu verbringen als den gänzlichen Tod zu erleiden. Schlimm konnte man doch solch einen Narren nicht bestrafen.
Zu seinem Glück hatte man auf die beiden englisch gesprochenen Worte gar nicht geachtet. Alle anderen waren noch ganz in den Anblick des Talismans vertieft gewesen, und der Besitzer hatte soeben über seinen Schatz eine Rede begonnen.
»Gestehst du, den Talisman gestohlen zu haben?!«, wurde jetzt der Übeltäter von dem Arzte mit gar nicht indischer Grobheit angeherrscht.
Der Lord begnügte sich, jenem die Zunge herauszustrecken.
»Ich weiß, du kannst nicht hören und nicht sprechen, leider auch nicht schreiben — aber da ist überhaupt gar nichts zu gestehen. Was soll nun mit dem Burschen geschehen?«
»Der Maharadscha hat bereits das Urteil gefällt, falls Pikuno des Diebstahls schuldig ist«, entgegnete der Angeredete, gleichfalls ein vornehmer Hindu.
»Nun?«
»Fünfzig Peitschenhiebe.«
»Das ist hart.«
»Ja, dieser unverbesserliche Dieb soll doch endlich einmal exemplarisch bestraft werden. Die Bestrafung ist sofort zu vollziehen.«
O weh — der edle Lord bekam einen förmlichen Hexenschuss. Solch einen Ausgang seines Abenteuers hätte er denn doch nicht geahnt! Und nun sich nicht einmal verteidigen zu können!
Vorläufig blieb er noch seiner Rolle getreu.
»Bääähhh«, machte er und streckte noch einmal die Zunge heraus.
Das half ihm aber alles nichts, er ward noch fester gepackt und durch den Korridor nach einer anderen Kabine geschleift, und was er hier zu sehen bekam, das raubte ihm vollends den Mut: eine nette Vorrichtung, um einen Menschen gerade recht handgerecht überzuspannen, und an der Wand eine ganze Auswahl der verschiedensten Peitschen.
So ganz ohne Zwang und Gewalt, wie Sabasi gesagt, schien es an Bord dieses friedlichen Schiffes also doch nicht abzugehen. »Zieht ihn aus — alles aus!«
Da richtete sich der Lord zwischen den ihn haltenden Händen zu seiner möglichsten Größe empor.
»Stopp!«, rief er gravitätisch, während ihm schon von flinken Händen der Kittel abgezogen wurde. »Wisst ihr braunen Kaffern, wen ihr eigentlich vor euch habt?«
Beim Klange seiner Stimme standen die anderen zuerst wie erstarrt.
»Bei Brahma und Vishnu, er hat seine Sprache wiederbekommen!!«, erklang es dann staunend im Chore.
»Nein, ich bin überhaupt nie taubstumm gewesen, ich — bin — der — Lord Archibald Seymour...«
»Aber verrückt ist er doch noch.«
»Peer und Earl von England...«
»Er ist bei den Faringis gewesen und hat da etwas gehört. Über den Bock mit ihm!«
»Major im zweiten Kürassierregiment Ihrer Majestät!«
»Zieht ihm auch die Hosen aus!«
Als alles nichts nützte, fing der unglückliche Seymour aus Leibeskräften zu strampeln an, und erst als er schon über dem Bocke lag, kam ihm die richtige Idee.
»Ich bin ja gar nicht euer Hofnarr«, heulte er, »der liegt in meiner Koje, seht doch erst einmal nach!!«
Aber auch das wollte nichts helfen.
»Los, ich werde die Schläge zählen.«

Die Peitsche pfiff durch die Luft, erst einmal probeweise.
»Es ist genug!«, ließ sich da eine tiefe Stimme vernehmen, und der erste Schlag fiel nicht.
»Der Maharadscha!«, erklang es im Chore der sich verneigenden Inder.
Hochaufgerichtet stand in der Kabine die majestätische Gestalt des Maharadschas.
»Führt diesen Narren, der die Wahrheit spricht, in die Kabine zu seinen Freunden zurück und holt den richtigen Narren dafür heraus!«
Dem Befehl ward umgehend Folge geleistet, die Kleider wurden dem Nackten umgeworfen und er in jene Räume zurückgebracht.
Die Zurückgebliebenen, welche sich ahnungslos bei einigen Flaschen Wein unterhielten, allerdings über die Möglichkeiten des Schicksals ihres Gefährten, erschraken trotz ihrer sonstigen Teilnahmslosigkeit nicht schlecht, als plötzlich unangemeldet einige Diener eindrangen, welche den falschen Hofnarren zurückbrachten und dafür den echten, den sie gleich in seiner Koje schlafend fanden, mitnahmen, sich dann ohne weitere Erklärung sofort wieder entfernend.
»Um Gottes Willen, was ist denn geschehen?!«
Lord Seymour hatte sich in ein Polster fallen lassen.
»Ich soll einen Elefanten verschluckt haben!«, ächzte er jetzt. »Einen lelelelebend'gen?«, fragte Mr. Fairfax.
»Nee, nur einen steinernen!«
»Auch das noch! Sie sind erwischt worden?«
»Ich habe mich selber erwischt, musste alles gestehen.«
Und der Lord erzählte, dabei wieder seinen leeren Magen mit den noch vorhandenen Resten des Abendbrotes füllend.
»Teufel noch einmal«, hieß es dann, als sie alles gehört hatten, »jetzt kommen wir alle zusammen in die Patsche!«
»Beruhigt euch, liebe Freunde«, erklang da eine fremde Stimme, »das war alles erst von mir arrangiert worden.«
Wie auf eine Geistererscheinung starrten die fünf auf den großen, langbärtigen Mann, prachtvoll gekleidet, der ungesehen eingetreten war,
»Der Maharadscha!«, flüsterte der Lord zuerst.
»Nicht für euch. Ich mache es kurz, ich habe keinen Geschmack am Komödienspielen mehr — ich bin Kapitän Richard Jansen.«
Da halfen alle abgestumpften Nerven nichts — die fünf Sportsmen waren außer sich vor Staunen, lange Zeit sprachlos, und dann wollten sie es nicht glauben. Also auch Lord Seymour nicht, der noch immer an einen Prinzen von Delhi dachte, nur nicht an Richard Jansen. Der schwarze Schnurrbart veränderte ihn total. Vielleicht waren auch seine Gesichtszüge etwas andere geworden, und zudem machte er in der kostbaren, weit aufgebauschten Kleidung einen so ganz anderen Eindruck als jener Richard Jansen, der bei seiner knochigen Schlankheit immer erst recht riesenhaft erschienen war, besonders wenn er so, wie er mit Vorliebe tat, in hohen Seestiefeln und Hemdärmeln ging.
Schließlich aber mussten sie es doch glauben. Jansen von den Toten auferstanden!!
Jansen erzählte bis Mitternacht, er verschwieg nichts; jetzt berichtete er auch sein damaliges Abenteuer mit Eloha, wodurch scheinbarerweise alles so gekommen war, dass man ihn zum Maharadscha gemacht — aber ein solcher war er jetzt nicht mehr, sondern eben der alte Richard Jansen, und er wusste, von wo die Diener den besten Wein zu holen hatten.
Und doch war er nicht mehr der alte — etwas wie Schwermut lag über ihn gebreitet, die nur langsam dem feurigen Traubensafte weichen wollte.
»So segle ich seit einem halben Jahre rast- und ziellos auf allen Meeren umher — ein moderner fliegender Holländer in indischer Ausgabe.«
Damit hatte er seinen ausführlichen Bericht über sich selbst beschlossen. Über Lord Seymours Abenteuer war noch gar nicht gesprochen worden, das hatte man jetzt ganz vergessen.
»Gefällt Ihnen denn dieses Leben?«, wurde dann gefragt.
Langsam und träumend strich Jansen die Asche von seiner Zigarre ab.
»Nein.«
»Wer war denn die Dicke, die zu Ihrer rechten Seite saß?«, mischte sich zunächst Lord Seymour ein.
»Eloha.«
»Aha, dachte ich mir gleich. Und die andere, die auf der linken Seite?«
»Eine Fürstin von Lahore.«
»Auch Ihre Frau?«
»Ja.«
»Fein, fein!«, schnalzte der Lord gleichzeitig mit Zunge und Fingern. »Wie viele Frauen haben Sie eigentlich?«
»Achtunddreißig.«
»Das ist weniger fein — wäre mir zu viel.«
»Mir auch.«
»Na, da schaffen Sie sich doch ein paar ab — geben Sie uns ein paar.«
»Ach, wenn ich das könnte!«, erklang es mit einem schweren Seufzer, obgleich Jansen dabei wohl kaum auf die etwas frivolen Worte des Lords Bezug nahm.
»Also Sie haben tatsächlich Ihr Schiff nur deshalb vernichtet, um an Bord der ›Indianarwa‹ zu kommen?«, fuhr Jansen dann fort.
Jetzt erzählten die Herren.
Jansen schüttelte dabei wiederholt den Kopf.
»Sie sind und bleiben doch tolle Brüder!«, sagte er dann. »Und ein Mann, ein Heizer, hat dabei sein Leben verloren? Nun, ich bin am wenigsten dazu berechtigt, deshalb über Sie zu Gericht zu sitzen.«
»Beobachteten Sie, wie das Schiff sank?«
»Ja, ich hatte gerade meine Blicke in jene Gegend gerichtet.«
»Machte es einen natürlichen Eindruck?«
»Nein, gar nicht. Und als ich dann die Boote kommen sah, und Sie darin erkannte, da wusste ich auch gleich ganz bestimmt, dass Sie Ihre ›Zingalia‹ mit Absicht vernichtet hatten, nur aus dem Grunde, um an Bord dieses indischen Schiffes zu gelangen, über das man sich ja so viel Geheimnisvolles erzählt — ganz grundlos.«
»Sie erkannten uns gleich?«
»Sofort.«
»Und da weigerten Sie sich zuerst, uns aufzunehmen.«
Jansen lächelte flüchtig.
»Abgesehen davon, dass ich hierzu eigentlich doch ein Recht gehabt hätte, oder doch, Sie nur ins Schlepptau zu nehmen — aber es war mein Kapitän, der dies zuerst Ihnen sagte. Dann rief ich ihn zu mir und gab ihm andere Instruktionen.«
»Richtig, wir wurden ja dann auch gleich aufgenommen! Weshalb haben Sie uns dann so als Gefangene behandelt?«
»Weil ich auf Ihre Pläne einging. Sie wollten doch ausspionieren, wie es hier zuging, und ich glaube kaum, dass Ihnen angenehm gewesen wäre, wenn Sie sofort überall herumgeführt wurden.«
»Allerdings nicht«, bestätigte der Lord.
»Ich beobachtete und belauschte Sie und bekam zu hören, dass ich auch ganz recht gehabt. Um Ihnen nun entgegenzukommen, hielt ich schon jenen Narren bereit, welcher zufällig dem Lord so ähnlich sieht wie ein Ei dem anderen.«
»Was? Das war schon eine abgekartete Geschichte?«, fuhr besonders der Lord betroffen empor.
»Wie ich Ihnen sage«, lächelte Jansen wiederum, doch machte dieses Lächeln gar keinen heiteren Eindruck. »Dieser Pikuno ist überhaupt gar nicht taubstumm.«
»Nicht?!«
»Nein, er kann hören und sprechen wie ein anderer Mensch, sogar Englisch. Er ist wohl etwas beschränkt, aber durchaus nicht so, wie er sich Ihnen gegenüber gab.«
»Ja, wozu denn das in aller Welt?!«
»Verstehen Sie nicht? Eben, um Ihren Plänen entgegenzukommen. Ich wusste nicht, dass Lord Seymour Indisch spricht, und so ließ ich Pikuno lieber gleich taubstumm sein, damit jener in seiner Verkleidung ganz leichtes Spiel habe.«
»Aber auch alle anderen behandelten ihn doch als Taubstummen!«
»Alles auf Verabredung, das ganze Schiff war instruiert.«
»Dann hätte mir Mr. Sabasi wohl überhaupt den Vorschlag gemacht, dass ich die Rolle des Narren spielen solle?«
»Gewiss, das war alles schon verabredet. Sie wären so nach und nach darauf vorbereitet worden, auf die eine oder die andere Weise. Monsieur Chevalier fasste nur einen ganz ähnlichen Plan, und als er meinem Sekretär die Pistole auf die Brust setzte, hatten wir erst recht leichtes Spiel.«
Eine Art von Beschämung beschlich die Herren. Sie hatten sich äußerst schlau geglaubt, und dabei hatte man mit ihnen gespielt.
»Da war auch das mit dem gestohlenen Talisman schon verabredet?«
»Alles, alles war ausgemachte Sache.«
»Ich habe auch gar keinen Elefanten im Magen gehabt?«
»Gott bewahre!«, lachte Jansen, aber es wollte immer noch nicht heiter klingen.
»Der Kerl tat nur so, als ob er seinen Talisman aus meinem halbverdauten Hirsebrei herausbringe?«
»Natürlich.«
»Ja, wozu denn nur diese Machinationen?«
»Sie verstehen immer noch nicht?«, sagte Jansen nach wie vor mit trübem Lächeln. »Bedenken Sie doch nur — ich sah die Boote kommen — erkannte Sie, meine alten Freunde, die ich wirklich in mein Herz eingeschlossen gehabt — ach, wie mir da plötzlich mein sonst so müdes Herz schneller zu schlagen begann — ich wurde plötzlich wieder ganz jung — und nun belauschte ich Sie — vernahm Ihre Pläne — und da stieg mir wieder mein alter Schalk in den Nacken — ja, besonders auf den dicken Lord hatte ich es abgesehen, der sollte für seine Neugier büßen — ach, ich hatte ja noch etwas ganz anderes vor — dazu, dass Sie wirklich gepeitscht worden wären, hätte ich es natürlich nicht kommen lassen — ach, ich hatte ja noch ganz anderes mit Ihnen vor — Sie hätten in den Wahn kommen müssen, dass Sie sich unter menschenopfernden Thugs befänden, dass wir hier der Göttin Kali dienten — Sie hätten solchen Menschenopfern beiwohnen müssen, einer Ihrer Freunde wäre selbst geopfert worden — und so wäre einer nach dem anderen zum Narren gehalten worden... ich habe es nicht getan.«
»Ja, warum denn nicht? Das wäre doch famos gewesen, auch wenn wir dabei, als die Genarrten, eine traurige Rolle gespielt hätten. Aber über so etwas sind wir doch erhaben.«
»Warum nicht? Bis zu dem Brechmittel kam ich, dann... hatte ich genug, genug — ich bin nicht mehr der Alte, der über so etwas lachen kann, ich bin...«
Jansen brach ab und ließ tief den Kopf auf die Brust sinken.
»Mensch, Kapitän, Sie sind ja ganz und gar unglücklich!!!«
Der Australier war es gewesen, der mit diesen Worten urplötzlich herausgeplatzt war, dabei seine herkulische Bärentatze wuchtig auf Jansens Schultern schlagend und ihn dann schüttelnd.
Es war gewiss nicht dieser Schlag, wenn er auch sonst einen Stier zu Boden geworfen hätte, der Jansen so bewegen konnte — diese als eine furchtbare Wahrheit ihn ins Gesicht geschleuderten Worte waren es, die ihn wie entsetzt mit plötzlich todblassem Antlitz auffahren ließen.
»Ich — unglücklich?!«, brachte er nur mühsam hervor.
»Na, nun machen Sie uns nichts vor! Natürlich sind Sie unglücklich!«
Ein Versuch, heiterer zu blicken — er misslang, Jansen ließ abermals den Kopf auf die Brust sinken.
»Ja, ich bin unglücklich, tief, tief unglücklich«, flüsterte er tonlos.
»Weshalb denn? Heraus damit, schütten Sie uns Ihr Herz aus.«
»Ich... weiß es selbst nicht.«
»Ist unter den achtunddreißig Frauen nicht gerade die, welche Sie gern haben möchten?«
»Torheit!«
»Was fehlt Ihnen sonst.«
»Mir fehlt eigentlich... gar nichts, absolut nichts.«
»Was treiben Sie denn eigentlich hier an Bord?«
»Nichts.«
»Nichts?«
»Ich regiere«, lächelte Jansen immer trüber. »Ja, ich sitze auf meinem Throne, in Samt und Seide gehüllt, mit schweren Ketten und Steinen behangen, rauche meine Pfeife, muss mir vorsingen und vortanzen lassen und regiere dazu so nebenbei, d. h. ich höre Klagen an und urteile, manchmal wie ein Salomo — gewöhnlich urteile ich nebenbei. Und so geht ein Tag wie der andere hin.«
»Haben Sie denn gar kein Ziel im Auge?«
»Nein. Wir schlagen eben die Zeit auf dem Meere tot, laufen nur einen Hafen an, wenn wir uns verproviantieren müssen.«
»Können Sie sich denn da nicht an Land amüsieren?«
»Amüsieren?«, klang es schmerzlich zurück. »Ich bin seitdem mit noch keinem Schritte an Land gekommen.«
Die Herren fragten nicht nach dem Weshalb, sie sahen das Törichte ihrer Sprache gleich ein. Sie wussten ja nur zu gut, was diesem weltflüchtigen Manne fehlte — seine ›Sturmbraut‹, all seine Getreuen!
»Gehen Sie denn nicht auf Abenteuer aus?«
»Nein.«
Auch deshalb wurde nicht weiter gefragt. Eben für die Welt abgestorben.
»Ihnen fehlt einfach Beschäftigung«, sagte der Australier jetzt sehr vernünftig, obgleich der selbst nichts von einer sogenannten Beschäftigung wissen wollte. Der vertrieb sich die Zeit nach seiner Weise, durch den Suff.
»Ja.«
»Sind Sie nicht Herr über dieses Schiff?«
»Absoluter.«
»Müssen Sie unbedingt immer auf dem Throne sitzen und mit den Weibsbildern poussieren?«
»Ich muss gar nichts.«
»Warum tun Sie es denn?«
»Weil man es wünscht, weil man das so von dem früheren Maharadscha gewöhnt ist, und ich tue ihnen den Gefallen.«
»Dürften Sie nicht von der Kommandobrücke aus selbst das Schiff führen?«
»Ich dürfte es, wenn ich wollte.«
»Warum wollen Sie es denn nicht?«
»Kapitän Ikomo ist ein zu tüchtiger Mann, es wäre geradezu eine Kränkung für ihn, wollte ich mich da einmischen.«
»Hm, sehr rücksichtsvoll, hm«, brummte Monsieur Chevalier, an diesem gesegneten Tage vielleicht seine sechzigste Zigarette drehend. »Mit einem Wort! Es gefällt Ihnen hier nicht.«
»Nein.«
»Und weil es Ihnen hier nicht gefällt, deshalb sind Sie unglücklich.«
»Ja.«
»Es fehlt Ihnen eben eine Tätigkeit.«
»Ja.«
»Was für eine Tätigkeit würden Sie da wählen?«
»Selbstverständlich die eines Seemannes. Ich möchte wieder als Kapitän in fremden Diensten fahren, natürlich nicht als Richard Jansen, unter anderem Namen. Dass ich nicht mehr wünsche, noch einmal als Sir Richard Jansen, Baronet von, auf und zu, verherrlicht zu werden, das können Sie sich wohl denken. Oder muss ich Ihnen das noch klar machen?«
»Nein, das brauchen Sie nicht, wir verstehen, so auf den Kopf gefallen ist von uns niemand. Also als einfacher Handelskapitän möchten Sie gehen, unter anderem Namen?«
»Ja.«
»Warum gehen Sie denn da nicht?«
»Weil ich nicht von hier fort kann.«
»Sie sind hier gebunden?«
»Ja.«
»Für ewig?«
»Bis zum Untergange dieses Schiffes.«
»Sie haben deshalb Ihr Ehrenwort abgeben müssen?«
»Nein.«
»Einen Schwur?«
»Auch nicht. So etwas hätte ich nie getan, niemals hätte ich mich zwingen lassen.«
»Und dennoch sind Sie gezwungen, hier zu bleiben?«
»Ja.«
»Na, zum Teufel noch einmal, wodurch denn nur?!«
»Verstehen Sie denn gar nicht?«
»Nein, da sind wir doch zu dumm dazu. So sprechen Sie bloß endlich.«
»Ich habe Ihnen doch ausführlich geschildert, wie ich zuletzt darauf einging, dennoch die Erbschaft des Maharadschas anzutreten, das heißt, sein Nachfolger zu werden. Ich wollte es durchaus nicht, wollte überhaupt gar nicht mehr auf diesem Schiffe bleiben, auch nicht als so ziemlich unsichtbarer Gast — da machte mir Graf Axel jene Eröffnung, wie ich Ihnen geschildert. Mehr als siebenhundert Menschen sollten oder wollten den Feuertod erleiden — nicht meinetwegen, aber ich, ich hätte ihr Leben doch retten, ihren Tod vermeiden können. Ich glaubte, stark genug zu sein, um diesem ganz undefinierbaren Zwang, den man auf mich auszuüben versuchte, trotzen zu können. Ich begab mich an Land, auf jene Toteninsel. Und da sah ich das schöne, junge Weib den Scheiterhaufen besteigen. Ich wollte nicht hinblicken, und doch musste ich es, ich musste, musste!! Und da sah ich die Flammen hochschlagen, welche gleich das ganze Deck ergriffen, auch allen anderen siebenhundert Menschen den Tod bereitend. Und da stürzte ich mich ins Meer — oder ich war schon längst drin — ich schwamm hin — und so bin ich der Nachfolger des Maharadschas geworden. Verstehen nun die Herren, was mich hier fesselt?«
»Hm«, wurde vorläufig nur gebrummt.
»Und deshalb kann ich auch nicht wieder von hier fort.«
»Sie meinen, wenn Sie das Schiff verließen, würden diese Fanatiker noch immer ihr Schiff und sich selbst verbrennen?«
»Sofort.«
»Das hat man Ihnen gesagt?«
»Hat man mir unverhohlen gesagt.«
»Das ist gewissermaßen eine moralische Erpressung.«
»Ich weiß es.«
»Darum brauchen Sie sich gar nicht zu kümmern.«
»Auch das weiß ich, aber...«
»Sie können eben nicht fort, es geht gegen Ihr Gewissen. Sie wollen es nicht mit der Schuld an dem Tode von siebenhundert Menschen belasten.«
»So ist es.«
»Glauben Sie, dass sich einer von uns an so etwas kehren würde?«
»Das glaube ich wohl, dass Sie sich verteufelt wenig aus siebenhundert oder siebentausendmal siebentausend Menschen etwas machen würden, wenn diese Ihren freien Willen beeinflussen wollten.«
»Sie aber lassen sich dadurch beeinflussen, lassen sich zwingen, gegen Ihren Willen zu handeln.«
»Ja«, gab Jansen offen zu.
Es war fast merkwürdig, dass keiner dieser fünf Männer, die sich doch sonst kein Blatt vor den Mund nahmen, Jansen nicht einen Narren schalt.
Oder auch nicht merkwürdig! Es waren eben durch ihre Lebensweise ganz besonders geartete Charaktere geworden — Übermenschen, würden wir jetzt sagen, jenseits von gut und böse, nichts anderes als ihren eigenen Willen anerkennend.
Sie selbst fanden es natürlich lächerlich, wegen seines Gewissens sich auf diese Weise zwingen zu lassen, das heißt, sie selbst hätten so etwas nie getan. Aber eben durch ihre Lebensweise waren sie auch wieder philosophisch genug gebildet, wenn auch ohne jede Schulung, um sofort zu verstehen, dass gerade für einen Charakter wie Jansen hier ein unüberwindliches Hindernis vorlag.
»Das ist ja entsetzlich!«, hieß es denn auch mit aufrichtigem Bedauern.
Jansen zuckte nur die Achseln.
»Sie wären auch nicht imstande, dadurch sich von diesem Zwange freizumachen, dass sie dieses ganze Schiff mit allen Menschen vernichten?«
»Dann brauchte ich nur davonzugehen.«
»Nein, wir meinen, indem Sie selbst mit zugrunde gehen.«
»Ich verachte den Selbstmord in jeder Weise, wenn er egoistischen Motiven entspringt.«
»Sie können mit unbeschränkter Vollmacht über das Schiff verfügen?«
»Mit absoluter Vollmacht, über Schiff und alle Menschenleben.«
»So weihen Sie sich und Ihr Schiff einem edlen Zweck, wobei Sie Ihren Untergang finden.«
»Welchem Zwecke?«
»Eben irgendeinem nützlichen. Schließen Sie sich einer kriegführenden Macht an, und lassen Sie sich in den Grund schießen.«
»Mit diesen Indern?«, war die spöttische Gegenfrage. »Versuchen Sie den Nordpol zu entdecken, und lassen die ganze Bande zu Konserven einfrieren.«
Wieder nur ein tiefer Seufzer.
»Ja, mit welchem Rechte versuchen denn diese Kerls solch eine Macht über Sie auszuüben? Ist das nur dadurch gekommen, dass Sie diesem als Reich geltenden Schiffe einen Erbprinzen geschenkt haben?«
»Nicht nur deshalb.«
»Weshalb sonst?«
»Es stand in den Sternen geschrieben. So sprach Graf Axel, der Maharadscha, so spricht Toghluk noch heute. Es stand in den Sternen geschrieben, dass ich, Richard Jansen, bestimmt sei, einst den Maharadscha nach dessen Tode zu vertreten, zu ersetzen.«
»Wie ist denn der Maharadscha eigentlich auf Sie aufmerksam geworden?«
»Das ist eine merkwürdige, schon mehr märchenhafte Geschichte. Diese indischen Mystiker, die Anachoreten zur See geworden sind — Seezigeuner, die sich auch mit Wahrsagen aus der Hand beschäftigen — haben eben nichts weiter zu tun, als aus Sternen und Träumen und Gott weiß was zu deuten, die Zukunft zu befragen. Wenn sich in der Weltgeschichte irgendein Mensch auszeichnet, in der Politik oder durch sonst eine Tat, und hier auf diesem Schiffe wird davon erfahren, so wird dem Betreffenden immer gleich das Horoskop gestellt, das heißt, die Sterne werden über seine weitere Zukunft befragt, zu keinem anderen Zwecke, als um zu prüfen, ob die Aussage der Sterne auch stimmt, weshalb der Lebensgang der Betreffenden natürlich auch weiter beobachtet werden muss, und dieser Maharadscha hat ja Verbindungen in aller Welt.
»Damals, als die Lady Blodwen sich auf das Meer flüchten wollte, kam auch mein Name in aller Mund, in alle Zeitungen. Auf der alten ›Indianarwa‹, die schon damals an der Fucusinsel lag, aber in guter Verbindung mit aller Welt stand, hörte man von mir, und auch mir wurde das Horoskop gestellt.
»Und da verkündeten die befragten Sterne, dass ich, dass dieser Richard Jansen, eng mit dem Schicksale der ›Indianarwa‹, mit dem dieser ganzen indischen Gesellschaft verknüpft sei, dass ich bestimmt wäre, dereinst die Führung über diese ganze geheime Sekte zu übernehmen.
»Diese Inder glauben an ein Verhängnis, das jedem Menschen bestimmt ist. Es erfüllt sich von ganz allein. Das hindert sie aber nicht, diesem Schicksale doch etwas unter die Arme zu greifen. Zunächst aber etwas anderes: ich habe Ihnen, vor denen ich keine Geheimnisse gehabt, doch erzählt, wie mir damals Karlemann die Lage der Fucusinsel angab.«
»In der Tat, wunderbar!«, bestätigten sofort die Herren, die samt und sonders leicht von Begriffen waren, mit offenem Staunen.
»Ja, es ist wirklich wunderbar. Ich bin überhaupt schon längst zu der Überzeugung gekommen, dass es wirklich solch ein Verhängnis gibt. Also, um auf das Vorangegangene zurückzukommen: das hindert diese Inder aber nicht, dem Schicksale manchmal helfend unter die Arme zu greifen. Man setzte sich mit mir in Verbindung, d. h. ganz heimlich, ohne dass ich davon etwas merken sollte. Und was meinen Sie, wen mir diese Inder als heimlichen Aufpasser beigesellten?«
»Nun?«
»Raten Sie. Ich möchte seinen Namen erst aus Ihrem Munde hören.«
»Tischkoff?«
»O nein. Ja, auch den, aber der erschien erst viel später als helfender Geist auf der Bildfläche.«
»Sie hatten einen heimlichen Aufpasser an Bord?«
»Ja, schon vorher.«
»Einen Ihrer Leute? Den Schiffsarzt?«
»Nein, der kommt gar nicht in Betracht. Ich will es Ihnen sagen, Sie würden wohl auch kaum darauf kommen — Goliath.«
»Was? Goliath?«, riefen denn auch die Herren in hellem Staunen. »Ihr treuer Goliath ein Verräter?!«
»Nicht doch, kein Verräter. Er war und blieb der treueste Mensch, den ich je kennen gelernt. Aber zu dieser indischen Geheimsekte gehörte er dennoch. Er war früher Seemann gewesen, hatte es bis zum Kapitän gebracht, fuhr von den westindischen Inseln aus, wo es ja auch genug schwarze Schiffe gibt — bis er jener indischen Sekte in die Hände fiel. Diese erkannten die hervorragenden Eigenschaften dieses Negers, der besonders ein fabelhaftes Gedächtnis besaß, sie bildeten ihn in einem indischen Kloster weiter aus, dann schickten sie ihn wieder hinaus in die Welt, dass er ihren Zwecken diene.«
»Welchen Zwecken? Was für eine geheime Sekte ist das eigentlich?«
»Ich drücke mich vielleicht falsch aus, wenn ich immer von einer Sekte spreche. Die Geschichte ist einfach so: Der Maharadscha war stets ein Phantast. Er wollte Indien wieder frei machen; da man aber zu Lande, in Indien selbst, mit England schon so trübe Erfahrungen gemacht, wollte er den zukünftigen Befreiungskampf auf das Wasser verlegen. So sammelte er tüchtige Seeleute um sich, sammelte noch anderes, und die Mittel dazu hatte man ihm ja gelassen. Sie kennen den Vogelberg. Aus dem hatte er einfach eine uneinnehmbare Seefestung machen wollen. Alles, was dort an Lebensmitteln und an Material aller Art angehäuft war, stammte nicht etwa von Seeräubern her, sondern das hatte der Maharadscha im Laufe der Jahrzehnte nach und nach heimlich gekauft und heimlich dorthin bringen lassen.«
»Aha, das ist allerdings eine Erklärung! Woher aber wusste er von der Existenz dieses hohlen Berges, woher von der Fucusinsel, wovon sonst die Welt noch nichts weiß?«
»Freunde, da fragt ihr mich zu viel. Dieses Geheimnis hat der Maharadscha mit in sein nasses Grab genommen. Aber er war wirklich ein Mann von eminenten Kenntnissen, alle sorgsam gehüteten Geheimnisse seines Landes standen ihm, dem Oberpriester aller Brahmanen, offen zur Verfügung, auch in China besaß er kolossalen Einfluss, und wir wollen uns erinnern, dass Chinesen schon in Amerika gewesen sind, wahrscheinlich dort schon blühende Kolonien gehabt haben, als wir in Europa noch mit dem Höhlenbären um unsere Existenz kämpfen mussten. Mag diese Erklärung, woher der Maharadscha seine Kenntnisse hatte, genügen. Schließlich will ich nur noch daran erinnern, dass auch Tischkoff den unterseeischen Tunnel von der Klippe nach der Osterinsel kannte, und auch die Osterinsel ist einst unbestreitbar von Chinesen besetzt gewesen.
»Also, als ersten Aufpasser hatte man mir Goliath beigesellt. Ja, er passte auf, was ich trieb, wusste die indische Gesellschaft immer über mich, über meine Pläne und Ziele zu benachrichtigen. Aber ein Verräter war Goliath nicht, ganz das Gegenteil. Unter dieser schwarzen Haut schlug das treueste Herz. Er ist den Heldentod gestorben — im Dienste der Menschenliebe — sein Andenken wird mir bis zum letzten Atemzuge heilig sein.
»Als zweiten Aufpasser, oder vielmehr als Berater, gab man mir Tischkoff bei. Er war gar kein Russe, sondern ein Schottländer.
Schon von frühester Jugend an ein Feuergeist, dabei stark zum Übersinnlichen neigend, auch immer schon die Gabe des zweiten Gesichtes besitzend, eine unleugbare Tatsache, welche Gabe man ja so häufig gerade in Schottland findet. In Sibirien und China hatte er diese Gabe unter entsetzlichen Kasteiungen des Körpers weiter ausgebildet. Er konnte willkürlich in Starrkrampf oder schon mehr in eine Art Scheintod fallen, wobei dann sein befreiter Geist wirklich in den fernsten Erdteilen schweifen konnte. So erzählt man mir jetzt, und... ich muss es fast glauben. Er hat in seiner Jugend viel in Politik gemacht, kennt alle Schrecken der sibirischen Bergwerke, hat auch zu Portland längere Zeit in der Tretmühle gearbeitet, immer wegen politischer Vergehen. Von dort hat er sich befreit, durch jenen unterirdischen Gang, dessen Entstehung mir nicht bekannt ist. Auch er kam in Verbindung mit jener indischen Sekte, und er war der Geeignetste, mich aus dem Zuchthause von Portland zu befreien, blieb dann als mein Berater immer bei mir. So, das ist eigentlich alles, was ich zur Erklärung zu erzählen habe.«
»Wo ist Mister Tischkoff jetzt?«
»Ich weiß es nicht. Der Maharadscha, seinen nahen Tod fühlend, gab ihm die Freiheit zurück.«
»Und wo sind z. B. alle die Menschen, welche doch offenbar einst in dem hohlen Vogelberge hausten? Was ist überhaupt aus dieser ganzen geheimen Gesellschaft, die sich über die ganze Erde erstrecken sollte, geworden?«
»Alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. In seinem letzten Jahre erkannte der Maharadscha, dass er doch nur einem Hirngespinste nachgejagt war, er gab allen die Freiheit zurück, sie konnten gehen, wohin sie wollten.«
»Nur die ›Indianarwa‹ blieb bestehen?«
»Ja, die behielt er für sich selbst, und ich war bestimmt, als sein Nachfolger dieses sein Schiff weiterzuführen, das ließ er sich nicht aus dem Kopfe bringen, und... mit Hilfe des Schicksals hat er seine Absicht auch zu erreichen gewusst. Ich bin hier ein Sklave, ohne Fesseln, ohne Schwur gebunden... und dennoch kann ich nicht fort, weil ich nicht siebenhundert Menschenleben auf meinem Gewissen haben will.«
Eine Pause trat ein.
Die Schiffsglocke verkündete, dass Mitternacht schon überschritten war, und Jansen erhob sich.
»Es ist Zeit, dass wir uns trennen — vorläufig. Wünschen die Herren noch hier zu bleiben?«
»Wenn wir dürfen?«
»Selbstverständlich steht Ihnen alles offen. Bei Ihnen ist das ja etwas ganz anderes. Und Ihr Ehrenwort habe ich doch, dass Sie über alles Schweigen beobachten.«
»Das haben Sie ebenso selbstverständlich.«
»Ich danke Ihnen. Nun wäre nur noch eins: haben die Herren irgendein Ziel, wohin Sie gebracht zu werden wünschen?«
»Nein.«
»Auch ich habe ja kein Ziel. Höchstens suche ich noch einmal die Stellen auf, an die alte Erinnerungen geknüpft sind. So hatte ich jetzt vor, noch einmal die Osterinsel zu besuchen.«
»Die Osterinsel?!«, wurde überrascht gefragt.
»Ja. Aber wenn die Herren an ein anderes Ziel denken, wenn dieses auch auf der anderen Hälfte der Erdkugel liegt — ich ändere sofort den Kurs, wie ich es so oft tue, manchmal mehrmals täglich, da mich absolut nichts bindet.«
»Auch wir wollten eigentlich die Osterinsel aufsuchen, obgleich auch wir kein bestimmtes Ziel hatten. Wir erfuhren nur so zufällig, dass wir uns nahe der Osterinsel befänden.«
»Gut, so fahren wir hin.«
»Angenommen. Was ist eigentlich aus der Osterinsel geworden?«
»Ich weiß gar nichts.«
»Haben die Erben Lady Blodwens auf sie Anspruch erhoben?«
»Mir ganz unbekannt.«
»Ob die wilden Bestien noch immer auf ihr hausen?«
»Meine Herren, ich habe seit länger denn einem Vierteljahr gar keine Verbindung mehr mit der Welt, vermeide absichtlich jede Nachricht.«
Die Unterredung war beendet, nach freundlicher Verabschiedung entfernte sich der germanische Inder mit dem langen Barte, der natürlich nur gefärbt, wenn nicht falsch war.
»Es ist doch unerhört, wie sich ein Mensch durch solche eingebildete Gewissensskrupel so zwingen lassen kann!«, sagte Mister Fairfax, als sich kaum die Tür hinter Jansen geschlossen hatte.
»Freunde, da können wir gar nicht mitreden!«
Der Australier und der Franzose hatten dies gleichzeitig gesagt, den Amerikaner so zurechtweisend.
»Das war auch nicht so gemeint«, verteidigte sich Fairfax, »aus meinen Worten sollte mehr das Mitleid sprechen.«
»Ja, zu bemitleiden ist er auch«, wurde allgemein bestätigt. »Er dürfte nicht hier bleiben.«
»Nein, das dürfte er nicht.«
»Dieser kostbare Kerl, dieser Richard Jansen, der noch zur Heroenzeit gehören sollte — der versauert hier ja ganz.«
»Ja, das tut er, ist es schon.«
»Für jeden ehrlich gesinnten Menschen wäre es eigentlich geradezu Pflicht, ihn aus diesen Verhältnissen wieder herauszubringen.«
»Eigentlich, ja.«
»Ja, aber wie?«
»Ja, aber wie?«
Die fünf Freunde blickten sich an, lange Zeit, und es waren ganz eigentümliche Blicke, die gewechselt wurden.
Dabei drehte der Franzose seine sechsundsechzigste Zigarette, ohne hinzusehen, immer den starren Blick mit denen der anderen kreuzend — und als die Zigarette fertig war, steckte er sie in den Mund — immer den starren Blick auf die anderen geheftet — und dann brachte er aus seiner Westentasche ein goldenes Feuerzeug zum Vorschein, entnahm ihm Stahl, Feuerstein und Zunder — schlug Funken, ohne den Blick von seinen Freunden zu wenden, bis der Zunder glimmte — er blies ihn an, blies, bis die Flamme aufschlug — und dann brannte er sich bedächtig die Zigarette an, aber noch immer die auf ihn gerichteten Blicke aushaltend — und dann blies er noch einmal auf den Zündschwamm, dass die Flamme heller leuchtete, und so warf er ihn auf den Boden, ließ ihn dort verbrennen.
»Da!«
Und die anderen vier nickten verständnisvoll.
Ja, sie waren ganz und gar einverstanden mit dem verbrecherischen Anschlage, den ihnen der Franzose soeben durch seine Pantomine klargemacht hatte. Aber es war ja nicht einmal eine Pantomime gewesen.
Und ein verbrecherischer Anschlag? Für diese Übermenschen gab es überhaupt kein Verbrechen. Sie kannten nur eins: ihren Willen! Und Menschen gibt es ja auf der Erde herdenweise, da kommt es doch nicht auf lumpige siebenhundert an.
Wieder einmal lag die einsame Osterinsel vor den Augen derer, die sich schon oft mit Erwartung auf sie gerichtet hatten. »Sie hat Besuch, es sind Fremde auf ihr!«
In dem Hafen lagen zwei große Dampfer, das konnte man schon aus weiter Entfernung erkennen.
Unsere fünf Freunde, wie wir sie nennen wollen, wenn man auch auf derartige Freundschaft nicht gerade stolz zu sein braucht, waren nicht die Männer, die sich lange mit Vermutungen aufhielten.
Jedenfalls aber dachten sie alle, wie auch eine diesbezügliche Bemerkung ergab, dass es entweder Schiffe einer Forschungs- oder einer Jagdexpedition sein würden. Die ersteren hätten es dann auf die Altertümer, die letzteren auf die wilden Tiere abgesehen.
Nur Jansen, der sich als Maharadscha jetzt auch öfters an Deck zeigte, war anderer Meinung.
»Gleich zwei? Dann wäre das doch ein merkwürdiger Zufall, wenn die gleichzeitig ein und dasselbe Ziel gehabt hätten.«
»Wir werden ja sehen«, lautete die phlegmatische Antwort der anderen.
Und sie sollten sehen.
Beim Näherkommen erkannte man, noch das Fernrohr zu Hilfe nehmen müssend, dass da am Ufer noch eine ganze Menge anderer kleiner Fahrzeuge lagen, aber doch zu groß, als dass sie für gewöhnlich von Schiffen mitgeführt wurden. So etwas wie ein Dampfbeiboot kannte man damals auch noch gar nicht, und das dort mussten, außer ganz ansehnlichen Segelbooten, schon mehr kleine Jachten zu nennen, richtige Dampfschaluppen sein.
»Da hat sich schon wieder jemand auf der Insel häuslich niedergelassen!«
»Wer könnte das sein?«
»Wer denn anders, als die Erben der Lady von Leytenstone!«
»Ja, sind denn die schon erbberechtigt?«
»Warum sollen sie es nicht?«
»Ist denn der Tod der Lady bekannt geworden?«
»Während meiner Untersuchung habe ich alles gebeichtet, nur nicht gerade, dass sie ihren Tod an einer noch unbekannten Insel in der großen Fucusbank gefunden hat«, entgegnete Jansen.
Dann allerdings konnte man mit Sicherheit darauf rechnen, dass die Erben auch von der New Yorker Bank die dreißig Millionen Dollar erhoben und sonst alles in Besitz genommen hatten, was einst Blodwen gehört, also auch diese Insel, und diesen ihren hohen Aristokraten würde die englische Regierung deswegen wohl keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt haben.
»Ich hätte Lust, gleich wieder umzukehren oder doch in weiter Entfernung vorbeizusegeln«, meinte Jansen mit finsterem Gesicht.
»Wollen Sie sich nicht erst überzeugen, ob dem auch wirklich so ist? Wir könnten uns ja auch irren.«
Jansen gab keine Änderung des Kurses an, es wurde weiter auf den Hafen zugehalten.
Es war noch frühe Morgenstunde, nur am Strande konnte man einige wenige Matrosen erblicken, dagegen war es auf den Dampfern schon lebendig, und das Durcheinander wuchs, als man dort erkannte, dass der äußerst große Dampfer auf die Insel zuhielt.
Jansen gab Befehl, den Namen des Schiffes zu nennen, und als die ›Indianarwa‹ ihre Farben zeigte, als die anerkannte und registrierte Standarte des Maharadschas gehisst wurde, da geriet dort drüben erst recht alles außer Rand und Band, man sah Boten nach der Stadt eilen, welche sich in einiger Entfernung vom Strande noch immer erhob.
Jetzt hissten auch die beiden Dampfer ihre Flagge, die englische, nannten Namen des Schiffes und des betreffenden Kapitäns, als Heimathafen beide London, und dann zeigten sie auch die gleiche Kontorflagge, unter welcher der Besitzer des betreffenden Schiffes registriert sein muss, gleichgültig, ob Kompanie oder Privatperson, auf weißem Grunde vier blaue ineinander verschlungene Ringe.
»Hektor, James, Ralph und Marion — stimmt, und sie machen in geschwisterlicher Liebe gemeinsame Sache.«
Jansen hatte nicht besonderen Scharfsinn zu haben brauchen, um sich die vier Ringe gleich in dieser Weise zu deuten, aber er gab noch immer keinen Befehl, den Kurs zu ändern.
Jetzt kam aus der Stadt ein berittener Bote angesprengt, der brachte die Antwort, Anweisungen, und alsbald gab der eine Dampfer Flaggensignale.
»Lord Hektor von Leytenstone, Besitzer der Osterinsel, heißt Seine Majestät den Maharadscha herzlich willkommen«, wurde durch mehrmaliges Aufziehen von Flaggenreihen ganz wörtlich ausgedrückt.
»Das glaube ich wohl, dass die mit diesem geheimnisvollen Maharadscha nähere Bekanntschaft machen möchten!«, knurrte Jansen ingrimmig. »Ha, wenn die ahnten!«
»Sie werden auch den Besuch abstatten?«
»Ja, ich werde! Ja, ich werde!!«
Die anderen kümmerten sich nicht um Wort- und Ausdrucksweise.
»Nur Lord Hektor nennt sich als Besitzer.«
»Bloß um das Signalisieren abzukürzen. Sie werden sich uns dann schon in anderer Weise vorstellen — als zusammengeschlungene Ringe. Und ich bin wirklich nicht zu erkennen?«
»Ganz und gar ausgeschlossen.«
»Aber Sie haben mich doch gleich erkannt, Mylord.«
»Nein, das habe ich nicht, ich dachte an einen ganz anderen, als mir die Stimme etwas bekannt erschien«, entgegnete Lord Seymour, »und eben dass ich Sie nicht wiedererkannt habe, das bietet Ihnen Garantie, dass auch kein anderer Mensch in der Welt Sie wiedererkennt, denn ich habe ein fabelhaftes Gesichtsgedächtnis. Ist es der Fall, werden Sie in dieser Kostümierung und mit diesem Barte von einem anderen als Richard Jansen erkannt, dann... sollen Sie meine Hosen haben!«
»Und wie wird es mit uns?«, fragte Mister Brown.
»Sie sind eben meine Gäste. Als Schiffbrüchige aufgenommen.
Sie haben mich veranlasst, die Osterinsel aufzusuchen; wollten sehen, was aus den wilden Tieren geworden ist.«
»Und werden Sie den Neugierigen eine Besichtigung des Schiffes gestatten?«
»O nein, durchaus nicht! Ich bin und bleibe der unnahbare Maharadscha, zu dem mich nun einmal das Schicksal gemacht hat. Bei Ihnen ist das etwas ganz anderes. Allerdings möchte ich diese vier Leutchen doch wieder gern einmal in der Nähe schauen. Machen wir das doch so: Sie als meine Gäste können sie auch an Bord dieses Schiffes empfangen. Aber nur das Deck und Ihre Kabinen, welche Sie damals innegehabt, dürfen sie betreten. Dort kann ich sie auch am besten beobachten und belauschen. Das Belauschen ist zwar sonst meine Sache nicht, aber... Ausnahmen bestätigen die Regel.«
»Einfach eine Kriegslist. Doch wollen Sie nicht auch die Insel betreten?«
»Wollen möchte ich schon...«
»Sie sind als Maharadscha in dieser Gestalt noch gar nicht bekannt?«
»Noch kein menschliches Auge, welches nicht zu diesem Schiffe gehört, Sie ausgenommen, hat mich je in dieser meiner neuen Gestalt erblickt. Graf Axel hat alles schriftlich geordnet.«
»Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag«, sagte Chevalier; »der Maharadscha mag unsichtbar bleiben, und Sie selbst geben sich für seinen Sekretär, für seinen Minister, für seinen Stellvertreter aus, als solcher betreten Sie das Land.«
»Nun, wir haben ja Zeit, das zu beraten«, entgegnete Jansen.
Dann ließ er, immer sich im Kajüteneingange verborgen haltend, wieder ein Signal hissen.
»Darf die ›Indianarwa‹ in den Hafen laufen?«
»Herzlich willkommen«, lautete die abermalige Antwort.
Die Matrosen loteten emsig, obgleich das gar nötig gewesen wäre, da Jansen hier jeden Fußbreit Wassers kannte und daher schon wusste, dass dieses große, tiefgehende Schiff nicht bis an die Küste und den schon von Blodwen gemauerten Kai gehen durfte, sondern in der Mitte des Hafens ankern musste, wie denn auch geschah.
Unterdessen hatte Jansen mit seinen Gästen und vor allen Dingen mit seinem Kapitän noch eine Unterredung.
Es war eigentlich ganz selbstverständlich, dass der Kapitän, wenn er auch nur nautischer Leiter des Schiffes war, als erster einen etwaigen Besuch zu empfangen hatte. Nur bei den fünf Sportsmen war eine Ausnahme gemacht worden, und das war ja auch auf hoher See gewesen, wo der Kapitän voll und ganz beschäftigt ist.
Sonst war ja schon immer Kapitän Ikomo in jedem Hafen die Hauptperson gewesen, an die sich alles zu wenden hatte, die indische Bevölkerung des Schiffes bekam man, wie schon erwähnt, im Hafen überhaupt niemals zu sehen.
So war Kapitän Ikomo bereits eine ziemlich bekannte Persönlichkeit geworden. Der schon ergraute Mann war ein echter Japaner aus der Kaste der Schiffer, klein und gedrungen, von ungeheueren Muskeln strotzend, die Finger kaum länger als mittelmäßige Flaschenkorke, aber auch ebenso dick; zwischen Daumen und Zeigefinger konnte er mit Leichtigkeit eine Haselnuss aufknacken, mit einem wahren Stiernacken, und dann vor allen Dingen mit einem Paar Schultern, dass er, wenn er ein wenig in die Kniebeuge ging, ebenso breit wie groß erschien.
Es war gesagt worden: von ungeheueren Muskeln strotzend. Der Schreiber dieses möchte sich nicht sagen lassen, dass er sich in Übertreibungen bewegt. Die größte menschliche Muskulatur, welche die Kunst wiedergegeben hat, zeigt wohl der farnesische Herkules, die bekannte Statue mit Keule, Bogen und Löwenfell. Der Verfasser aber hat einmal einen japanischen Matrosen gesehen, ist lange mit ihm als Schiffskamerad zusammengewesen, dessen Muskulatur jene des farnesischen Herkules noch bei weitem übertraf. Wenn man diese Gestalt bildlich oder als Statue wiedergeben wollte, es würde niemand an die Möglichkeit glauben, dass so etwas in Natur existieren könne. Das sei gar nicht mehr menschlich. Der kleine Kerl hatte Oberarme fast so stark wie sein Leib, und nicht etwa Fett, sondern alles Muskeln, aus denen beim Anspannen riesige Kanonenkugeln wurden, viel größer als sein dicker Kopf, etwa im Durchmesser eines Eimers. Kraftsport wurde nicht getrieben, aber manchmal bekamen wir bei der Arbeit doch eine Probe seiner fabelhaften Kraft zu sehen. So brach einmal beim Ankerhieven der Flaschenzug! Vier Männer mühten sich vergeblich ab, die Kette über die Winde zu legen, und darunter war ein Schwede, der selbst ein riesenhafter Herkules war — da sprang der kleine Japaner herbei, packte die Kette ganz allein und legte sie mit einem kleinen Ruck über die Winde, spielend leicht. —
Dabei war Kapitän Ikomo ein höflicher, bescheidener, durchaus gebildeter Mann, mit dem man sich über alles zu unterhalten vermochte, was in einem europäischen Salon nur besprochen werden kann, und die fünf Herren, die ja sonst für das indische Schiff gar kein Interesse gehabt, nur auf ein verrücktes Abenteuer ausgegangen waren, hatten sich denn auch während der drei Tage am meisten mit dem Kapitän unterhalten.
Die in einer Kajüte stattfindende Besprechung wurde, während man noch das Schiff verankerte, einmal unterbrochen.
»Da, was laden denn die dort aus?!«, rief der Haarwasseronkel, der zum Bullauge hinausgeblickt hatte.
Von dem einen Dampfer wurden durch die Winde einige mächtige Kästen an Land befördert, die man alsbald als Eisenbahnwaggons erkannte.
Und da kam auf dem anderen Dampfer eine ganze Lokomotive zum Vorschein, für deren Ausladung man umständliche Vorbereitungen traf.
»Sogar eine Eisenbahn wollen die anlegen! Die sind ja noch anspruchsvoller als die Lady Leytenstone! Na, so ein Beförderungsmittel wäre doch auf diesem Inselchen, das man fast überspucken kann, wirklich nicht nötig, da genügt ja eine Schubkarre.«
So wurde spöttisch gesagt.
»Da kommen sie schon!«, hieß es dann.
Ein Boot strebte der ›Indianarwa‹ zu. Außer der Rudermannschaft befanden sich fünf Personen in ihm.
»Die hätten auch erst fragen können, ob wir sie empfangen wollen«, meinte Jansen. »Doch schließlich sind wir ja schon in ihrem eigenen Wasser. Und wer ist das? Richtig! Lord Hektor als Familienältester, Lord James, Baronet Ralph und die Lady Marion. Und die andere Dame, die neben dem Baronet sitzt, der seinen Arm um sie geschlungen hält? Doch wohl seine Braut oder schon Frau, die er sich neu zugelegt hat — oder vielmehr Gemaaahlin, muss es bei diesen Herrschaften wohl heißen. Ach Gott, ach Gott, jetzt erkenne ich sie — auch wenn sie keine Trikots anhat oder doch noch etwas darüber — die mexikanische Hopskarline! — die Mercedes Dingsda — jawohl, die Señorita Calioni, die mich mal mit dem Regenschirm verhaute!! Ist die auch da! Na, nun sind wir ja alle hübsch beisammen!«
Jansen schien plötzlich seine gute Laune wiederbekommen zu haben. Unter solchen Verhältnissen aber konnte das gefährlich sein.
Das Boot hatte die ›Indianarwa‹ erreicht, die Herrschaften kletterten das Fallreep hinauf, wurden von Kapitän Ikomo, der sich vorstellte, empfangen. Die Besucher hielten noch nicht für nötig, ihren Namen zu nennen.
»Seine Majestät der Maharadscha ist doch zu sprechen?«, fragte Lord Hektor von oben herab, nachdem er sich schon wie die anderen suchend und noch mehr neugierig, aber gleichzeitig auch enttäuscht, an Deck umgeblickt hatte. Hier sah es so gar nicht ›indisch‹ aus, von Pracht und Glanz erst recht keine Spur.
»Bedauere, der Maharadscha ist nicht zu sprechen.«
»Was, nicht zu sprechen? Was soll das heißen? Ah so, er ist wohl krank?«
»Er ist nur zu sprechen, wenn er selbst wünscht, gesehen zu werden.«
»Wir haben ihn als unseren Gast eingeladen. Weshalb hat er dann die Einladung angenommen?«
»Ich laufe diese Insel nur an, weil einige Herren es wünschten.«
»Was für Herren?«
»Ihnen wohlbekannt; die wir als Schiffbrüchige aufnahmen.«
Die fünf Sportsmen, welche sich bisher im Hintergrunde verborgen gehalten, machten der Szene ein Ende, indem sie vortraten.
Jetzt war das Staunen natürlich grenzenlos, aber ehe sich die Herren auf eine Erklärung einließen, machte Monsieur Chevalier den englischen Herrschaften durch Vorstellung begreiflich, dass dieser Kapitän, wenn auch nach damaligen Verhältnissen ein verachteter, nicht zur zivilisierten Menschheit gerechneter Japaner, ein gleichberechtigter Gentleman sei, und hierbei stellte sich auch heraus, dass die mexikanische Tänzerin unterdessen wirklich eine Lady von Leytenstone geworden war. Sie hatte den Baron Ralph, der sich die gefeierte Schönheit bekanntlich schon vor Jahren einmal angeschafft, gar zu fest in ihrem Garn gehabt. Sie wurden in die Kajüte geführt, zunächst begleitet vom Kapitän, der sich dann aber wieder entfernte.
Diese Kajüte war nichts anderes als die größte Kabine, welche unsere fünf Freunde bisher innegehabt, aber tatsächlich ein ganz ansehnlicher Salon. Die Sicherheitsvorrichtungen fielen jetzt natürlich weg, dagegen hatten die Bewohner der ›Indianarwa‹ schon ihre Instruktionen bekommen.
Anfangs herrschte ein allgemeines Durcheinander, wie wohl immer, wenn Durchschnittsmenschen in größerer Menge zusammenkommen. Die Ankömmlinge wollten, dass die Sportsmen erzählten, und dabei schwatzten sie immer selbst, wobei der unvermeidliche Champagner getrunken wurde und man Erfrischungen genoss, von indischen Dienern serviert, die aber in ganz europäischer Livree erschienen.
Endlich hatten sie doch erfahren, dass der verbrüderten Seezigeuner gemeinschaftliche Jacht vor drei Tagen Schiffbruch gelitten hatte, und dass die Mannschaft, die sich in die Boote rettete von der ganz in der Nähe befindlichen ›Indianarwa‹ an Bord genommen worden war.
»Auf welche Weise ist die ›Zingalia‹ denn so plötzlich untergegangen?«
»Kesselexplosion.«
»Kesselexplosion? Gerade, als das indische Schiff in dichter Nähe war? Na, meine Herren, das wollen Sie uns doch nicht weismachen!«
Die englischen Geschwister hatten von diesen Seesportsmen ja nicht nur gehört, sondern auch besonders hier auf der Osterinsel, damals als Blodwens Gäste, ihre persönliche Bekanntschaft zur Genüge gemacht, um ihren Charakter zu kennen.
Die Sportsmen wiesen einen solchen Verdacht zurück, dass sie ihr eigenes Schiff versenkt haben könnten, aber mit nur sehr wenig Worten, ihnen war doch ganz egal, was man von ihnen dachte.
»Na, die Hauptsache ist, dass Sie Ihr Ziel dabei erreicht haben.«
»Welches Ziel?«
»Hier auf die ›Indianarwa‹ zu kommen.«
»Fiel uns ja gar nicht ein.«
»Nun gut — wie sieht es denn hier eigentlich aus auf diesem geheimnisvollen Schiffe?«
»Ja, wenn wir das wüssten!«
»Sie haben nichts zu sehen bekommen?«
»Absolut nichts. Hier diese sechs Kabinen stehen zu unserer Verfügung — Sie können sie sich ansehen — dann dürfen wir noch jederzeit an Deck spazieren gehen — das ist alles. Sonst werden wir wie die Gefangenen behandelt, und eben um dieser Gefangenschaft so schnell wie möglich zu entgehen, haben wir gebeten, uns nach dem nächsten Hafen zu bringen. Das wäre Valparaiso gewesen. Da kamen wir an der Osterinsel vorüber — wir sind ungeheuer erfreut, Sie hier zu finden. Sie scheinen sich ja schon wieder häuslich eingerichtet zu haben, und wir hoffen nur, dass Sie uns Gastfreundschaft gewähren.«
Die Geschwister waren grenzenlos enttäuscht.
»Sie haben den Maharadscha auch gar nicht zu sehen bekommen?«
»Nein.«
»Es soll ein junger, bildschöner Mann sein.«
Das waren natürlich die Damen, welche dies sagten.
»Möglich, wir haben ihn nicht gesehen. Wir verkehrten während der drei Tage mit dem Kapitän, sehen immer die japanischen Matrosen und diese indischen Diener, die aber in jedem englischen Salon servieren könnten — mehr wissen wir nicht zu sagen.«
»Will er denn hier liegen bleiben?«
»Keine Ahnung!«
»Sonst hätte er uns doch nicht erst zu fragen brauchen, ob er in unseren Hafen einlaufen dürfe, er hätte Sie doch bei der ruhigen See in Booten an Land bringen lassen können.«
»Eigentlich ja. Er wird wohl einmal die Insel betreten wollen. Ja, Mylords und Ladies, wollen Sie uns nicht erklären, wie Sie überhaupt hierher kommen, was Sie hier treiben?«
»Nun, wir haben eben die Erbschaft unserer Schwägerin angetreten.«
»Ach, es war doch eine liebe Seele!«, fing jetzt die Lady Marion in weinerlichem Tone an und putzte sich mit einem Tüchelchen Augen und Nase.
»Wann?«
»Immer, immer«, schluchzte die Marion weiter.
»Ich meine, wann sie die Erbschaft antraten?«
»Vor acht Monaten. Gleich nach dem Tode Richard Jansens — wollte sagen des Honorable Sir Richard Jansen. Hören Sie, wer hätte das gedacht, dass das so ein herrlicher Mensch ist!«
»Nanu! Hatten Sie denn früher etwas an ihm auszusetzen?«
»Sie haben recht, natürlich haben Sie recht, tausendmal recht, ich hatte mich ja auch nur falsch ausgedrückt — er war ja schon immer ein herrlicher Mensch, ein Ideal von einem Manne, der edelste Charakter, zu gut für diese Erde...«
Und so himmelten sie weiter, wobei die beiden Weiber die Männer nur wenig übertrafen. Über ihren Köpfen stand Jansen, konnte durch die Löcherchen am Boden alles sehen, ohne sich mit Anwendung einer besonderen Vorrichtung bücken oder gar hinlegen zu müssen, und konnte ebenso durch eine Art von Schallrohr alles hören.
Ob er sich amüsierte oder ob er sich ekelte, wollen wir nicht erörtern.
Und er bekam noch Besseres zu hören, was ihn aber wirklich belustigen musste. Denn er krümmte sich mehrmals, er hätte so gern gelacht, wie er es seit langer Zeit nicht mehr gekonnt hatte.
Nachdem sich Lady Marion ausgeschwärmt, legte sie ihre behandschuhte Rechte auf Admiral Nelsons unsterbliches Hosenknie.
»Und wissen Sie was?«, flüsterte sie mit tränenfeuchtem Auge.
»Nee.«
»Ach, wenn Sie es ahnten!«
»Nu, was denn?«
»Haben Sie es niemals gemerkt?«
»Nee.«
»Er hat mich geliebt!«
»Und mich auch«, setzte die mexikanische Tänzerin sofort mit entsprechendem Augenaufschlag und seligverklärtem Lächeln hinzu, obgleich sie jetzt verheiratet war und ihr Ehegespons neben ihr saß, was ihr aber jedenfalls ganz egal war. »Und mich hat Kapitän Jansen ebenfalls geliebt!«
»Wohl damals, als er Sie backpfeifte und durch die Schaufensterscheibe rammelte?«
Wir haben schon wiederholt die Gründe angegeben, weshalb keiner dieser fünf Sportsmen mehr an Land leben konnte. Das wäre gar nicht mehr möglich gewesen. Aus der rohesten Schifferkneipe wären sie nach den ersten zehn Minuten hinausgeschmissen worden. Im Hottentottenkral hätten sie sich gleich am ersten Tage unmöglich gemacht. Für die war auf der Erde kein Platz mehr, die konnten nur noch auf dem Meere existieren, aber auch nur auf ihrer eigenen Jacht, wo nichts weiter galt als ihr eigener Wille.
Wer jene Worte gesagt hatte, ist ganz gleichgültig, denn da war einer wie der andere. Freilich jeder in seiner Weise. Auch Monsieur Chevalier, sonst die Höflichkeit selbst, konnte unausstehlich werden, doch wieder ganz anders als der Australier oder der Lord Seymour oder sonst einer.
Nun, die vornehmen Geschwister kannten diese Geister ja schon. Hier hatte ein Beleidigttun gar keinen Zweck, da hätten sie sich nur lächerlich gemacht. Hier gab es auch keine Forderung und keine Revanche und gar nichts. Hier konnte es höchstens mörderliche Prügel und noch viel mörderlicheren Spott geben.
Also, als die anderen und besonders der gekränkte Ehegatte schon entsprechende Gesichter schnitten, so machte auch die frühere Tänzerin und jetzige Baronin schleunigst gute Miene zum bösen Spiel.
»O, das war von Kapitän Jansen ja gar nicht so gemeint!«
»Na, ich danke! Aber recht so, Mylady! Sie sind Optimistin, bleiben Sie dabei! Hatten Sie denn Schwierigkeiten?«
»Sie meinen mit dem Ladeninhaber? O, der fühlte sich vielmehr höchst geehrt...«
»Nee, mit dem Antritt der Erbschaft meine ich.«
»O, da hatten wir nicht die geringsten Schwierigkeiten. Kapitän Jansen hatte ja vor Gericht ausgesagt, dass Lady Blodwen ihren Tod gefunden, alle seine Leute hatten es bestätigt, und das war noch in der Voruntersuchung, da waren diese Aussagen gültig.«
»Wenn aber Jansen das nicht ausgesagt, dann hätten Sie nicht so leichtes Spiel gehabt.«
»Nein«, musste offen bekannt werden, »dann hätten wir noch fünf Jahre warten müssen, nachdem unsere liebe Schwägerin als verschollen erklärt wurde.«
»O, es ist doch ein charmanter Mensch gewesen, dieser Kapitän Jansen!«, fügte Baron Ralph dieser Erklärung seines Bruders noch mit einem verklärten Blick zur Decke hinzu.
Der Australier machte eine schnelle Bewegung, erschrocken fuhr der Baronet zurück, denn es hatte genau so ausgesehen, als wolle ihm jener eine herunterhauen — aber nach dieser blitzschnellen Hand- und Armbewegung griff Mr. Rug ganz phlegmatisch in die Brusttasche, brachte ein Püllchen zum Vorschein, sagte ›prost‹ und machte gluck gluck gluck.

Es war eine Szene gewesen, dass sich oben Jansen wiederum vor unterdrücktem Lachen krümmte.
»Hat es Ihnen denn etwas eingebracht?«, nahm Mr. Brown das Examen wieder auf.
»Meinen Sie mich?«, fragte der Australier, das Püllchen bedächtig wieder verkorkend und einsteckend. »O ja — das ist Spanisch Bitter mit Whisky und Pfefferminz.«
»Nein, ich meine die Herrschaften — ob Ihnen die Erbschaft etwas eingebracht hat.«
»Ei... Sie wissen doch.«
»Ich weiß gar nichts.«
»Nun, da waren doch vor allen Dingen die dreißig Millionen Dollar auf der New Yorker Bank.«
»Ja, dann freilich, dann freilich, dann freilich«, fingen da plötzlich die fünf wie aus einem Munde zu echoen an, als hätten sie sich das vorher einstudiert.
»Ja, dann freilich müssen Sie für Ihre Schwägerin ein liebevolles Andenken haben!!!«
Abermals drohte Jansen vor Lachen zu bersten. Dann vor allen Dingen die Gesichter der anderen, deren Sitze immer heißer zu werden schienen.
»Auch diese Insel ist Ihnen zugefallen?«
»Selbstverständlich! Auch die war ja unserer lieben Schwägerin Eigentum.«
»England hat Sie in diesem Besitze bestätigt?«
»Warum denn nicht?«, lautete die stolze Gegenfrage.
»Na, wissen Sie — wenn ich England wäre, ich hätte's nicht getan!«, wurde jetzt mit einem Male der Franzose grob.
»Und Sie haben sich dann hierher begeben?«, examinierte der Haarwasseronkel weiter.
»Sofort, nachdem in New York alles mit der Auszahlung geregelt war. Ja, wir wollen auch unserer Schwägerin geistige Erben sein.«
»Wie machen Sie denn das?«, fragte Lord Seymour und behielt dann gleich den Mund offen, als wäre er bereit, einen herausschlüpfenden Geist aufzuschnappen.
»Nun«, wurde gelächelt, »wir werden die Projekte, welche unsere geniale Schwägerin mit dieser Insel vorhatte, zum Teil auch schon einleitete, weiter ausführen.«
»Aha!«
»Ja, wir werden aus dieser Insel etwas machen, was die Welt noch nicht gesehen hat. Diese unsere Insel soll der Sammelpunkt der Elite der ganzen Menschheit werden.«
»Aha! Da bleiben Sie selber aber wohl nicht mit drauf?«
»Himmelbombenelement noch einmal!«, dachte Jansen oben im Himmel.
Doch was sollten die dort unten machen? Immer gute Miene zum bösen Spiel.
»O, wir werden alles großartig arrangieren! Zunächst hatten wir mit den vielen Raubtieren zu tun, die wir hier vorfanden.«
Das war sehr geschickt gemacht. Diese Herren waren doch auch Weltmänner.
Die fünf Sportsmen hörten wirklich mit Interesse zu, wie im Laufe einiger Monate die zahllosen Löwen, Tiger, Bären und anderes Raubzeug durch eine eingeladene Jagdgesellschaft erlegt, mehr noch aber lebendig gefangen worden waren, von professionellen Fallenstellern und dergleichen, die man eigens zu diesem Zwecke aus allen Weltteilen hatte kommen lassen. Und dann, auf welch geniale Weise man der furchtbaren Kaninchenplage endlich Herr geworden — durch Impfen einiger Exemplare aus jeder Kolonie mit einer ansteckenden Krankheit.
»Was für eine ansteckende Krankheit ist denn das, die man Kaninchen einimpfen kann?«
Eine kleine Verlegenheit trat ein, dann beugte sich der eine der Herren vor, um etwas zu flüstern, und Lady Marion blickte seitwärts und hustete, während sich die Mexikanerin mit Fächerwedeln begnügte.
Der Herr hatte geflüstert und war verstanden worden. Es war eine Krankheit, die man nicht nur Karnickeln einimpfen kann, auch Menschen, und es ist nicht einmal ein Impfmesser dazu nötig. Die Franzosen nennen diese Krankheit die ›galante‹.
»So, so«, sagte Monsieur Chevalier. »Na, da wünsche ich nur, dass diese Krankheit von den toten Karnickeln nicht auf die Herren und Damen und auf die ganze Elite der Menschheit übergeht. Also das hat wirklich die Karnickel weggeschafft?«
»In vier Wochen war alles tot.«
»Schade, dass es bei den Menschen nicht ebenso fix geht. Und was haben Sie denn nun mit den lebendigen Löwen und Tigern und Bären gemacht?«
»O, da haben wir etwas Großartiges vor!«, wurde fingerschnalzend gelächelt.
»Auch impfen?«
»Nein, o nein — wir hoffen, dass Sie selbst mit dabei sein werden!«
»Hier auf dieser Insel?«
»Ja, als unsere Gäste.«
»Sie hoffen, dass wir hier bleiben?«
»Wir hoffen doch zuversichtlich.«
»Sie sehen uns fünf wirklich gern als Ihre Gäste hier?«
»Aber, meine Herren, wir bitten Sie...«
»Schon gut, schon gut, dankbar angenommen!«
»Nein, der Dank ist ganz auf unserer Seite. Und könnten wir nicht auch Seine Majestät den Maharadscha von Radschputana zu den Festlichkeiten einladen, welche wir in den nächsten Tagen, vielleicht morgen schon, unseren werten Gästen geben wollen?«
»O ja! Warum sollen Sie ihn denn nicht einladen können? Nur müssen Sie das Majestät weglassen, das will er nicht hören, soviel wir wissen, und dann ist er auch nicht der Maharadscha von Radschputana, er hat den Titel Maharadscha ohne weitere Bezeichnung bekommen — ein Fürst ohne Land.«
»Ja, dürften wir ihn nicht einladen?«
»Ich sagte es ja schon. Warum sollen Sie ihn nicht einladen können?«
Die Falle, welche dieser niederträchtige Franzose stellte, wurde gewittert.
»Aber ob er auch kommt?«
»Aber ob er auch kommt — ja, das freilich ist eine andere Sache.«
»Warum soll er denn nicht kommen?«, ergriff da Lord Seymour, seine Menschenhautweste glatt ziehend und mit den Zähnen seiner Geliebten klappernd, phlegmatisch das Wort.
»Wie? Sie meinen?«
»Wenn ich ihn selbst darum bitte — warum denn nicht?«
»Ich denke, noch keiner von Ihnen hat den Maharadscha auch nur gesehen!«
»Weil wir uns gar nicht darum bemüht haben«, entgegnete der Lord, immer so gleichgültig wie möglich.
»Und Sie meinen, wenn Sie eine Audienz begehren, er würde Sie empfangen?«
»Nu sicher!«
»Und wenn Sie ihn bitten, so wird er den Schaustellungen beiwohnen?«
»Nu sicher!«
»Ach, Mylord, dann ersuchen Sie ihn doch darum, wir bitten Sie flehentlichst!«
»Nun gut, das können wir ja machen«, entgegnete der Lord und klapperte nach wie vor mit seiner seltsamen Uhrkette.
Hier muss etwas nachgeholt werden, wodurch auch begründet wird, weshalb sich die anderen, zum Teil doch selbst Lords, von diesen Sportsmen so unmenschlich viel gefallen ließen.
Es kam daher, weil als Oberhaupt dieser ganz besonderen Seezigeuner doch Lord Seymour gelten konnte, der einstige Vorstand des vornehmsten englischen Klubs, dessen Mitglieder zum Teil gekrönte Häupter waren.
Schon daraus lässt sich erkennen, was für eine Rolle dieser kleine, dicke, verschrobene Mann in der englischen Aristokratie, in ganz England spielte. Wenn der seinen Mietern kündigte, musste ein gutes Teil von London ausziehen. Dann kam noch das blaue Blut hinzu, fast so blau, wie das des königlichen Geschlechtes — Geschichtsforscher behaupteten sogar, noch viel blauer. Nur deshalb hatte dieser Lord und Earl und Peer die Präsidentschaft jenes Klubs niederlegen müssen, weil er, wie schon erwähnt, einem russischen Großfürsten eine heruntergehauen hatte. Das geht doch auf keinen Fall.
Gefährlicher hatte es mit ihm gestanden, als er damals in dem Vogelberg mit Jansen gemeinschaftliche Sache gemacht, sich einer Verhaftung wegen Hochverrats durch den englischen Stellvertreter entzogen hatte.
Aber gerade da hatte Lord Archibald Seymour gezeigt, dass er nicht umsonst Admiral Nelsons siegreiche Hose trug — ohne weitere Unterhosen. Er war nach London gegangen und hatte sich mit wenigen Worten gerechtfertigt, stand von da an fester denn je.
Deshalb waren die anderen englischen Aristokraten so äußerst devot gegen ihn, und Lord Seymour wusste selbst, was er zu bedeuten hatte — er glaubte, dass es nur eines Wortes bedürfe, und der Maharadscha würde auf alles eingehen.
So stellte er sich wenigstens. Dass dies eine schon ausgemachte Sache war, brauchten die anderen ja nicht zu wissen.
Ein Tag war vergangen. Der Maharadscha hatte die Einladung, den Vorstellungen im Zirkus beizuwohnen, angenommen, aber auch nichts weiter.
Sidi Sabasi hatte alles geregelt, mit den Inselbesitzern alles besprochen, hatte direkte Vorschriften gemacht, und es würde noch ganz anders zugehen, als wenn ein europäischer Landesfürst auf der Durchreise ein Städtchen besucht und vom Bürgermeister und von Ehrenjungfrauen empfangen wird.
Denn das ist doch nicht nur so... das ist so! Die Rede, mit der ihn der Herr Bürgermeister begrüßen wird, kann sich der Landesvater schon drei Tage vorher drucken lassen.
Es war ein unbekannter Würdenträger, den man so vorschriftsmäßig empfangen wollte oder musste, aber er trat auf als Stellvertreter des Maharatenfürsten, dessen Ahnen einst über vierzig Millionen Menschen herrschten und über ein Land, dem England all seinen Reichtum verdankt, obgleich es noch nicht einmal den tausendsten Teil der vorhandenen Schätze zusammengeräubert hat.
Und so, wie der Empfang hier auf dieser einsamen Insel stattfinden würde, ist es ja noch heute in Indien. Ja, dem Volke gegenüber treten die Engländer als anmaßende Herren auf — aber vor den eingeborenen Fürsten rutschen sie auf den Knien. Wohl konnten sie diese absetzen, ihnen früher auch das abnehmen, was sie vorfanden — heute geht das schon nicht mehr — aber wo die ungeheueren Schätze sind, über welche die indischen Fürsten noch am Anfange des vorigen Jahrhunderts verfügten, das weiß niemand außer ihnen selbst und ihren direkten Nachkommen und dann vielleicht noch Priester und Bettelfakire. Und die Engländer möchten es doch so gern wissen! Und die Folter darf ja heutzutage leider nicht mehr angewendet werden. Sie würde wohl auch nichts nützen.
Begleitet von einigen Hindus, ließ sich der Maharadscha an Land setzen. Sie trugen ihre einheimischen Kostüme mit Gürtelwaffen — ganz einfach, ohne Schmuck. Dennoch ging bei jeder Bewegung ein Strahlengefunkel in allen Regenbogenfarben von ihnen aus. Denn an solchen Kostümen ist ja manches mit Spangen festzustecken, und Groschensachen vom Jahrmarkt kauft sich so ein vornehmer Hindu nun freilich nicht.
Gleich am Strande fand die Generalvorstellung statt. Aber es war eine ganz einseitige. Der zungengewandte Sabasi rasselte eine Elle Namen herunter, die Herren verbeugten sich mit abgenommenem Hute, die Damen knicksten mit einem Schritte vorwärts und zwei Schritten zurück, und der Maharadscha neigte kaum etwas den Turban. Stehen geblieben war er überhaupt nicht.
»Welch majestätischer Mann!«, wurde hinter ihm geflüstert. »Fast so groß wie Kapitän Jansen.«
Jansen hatte genug gehört.
Auf der Insel gab es vorläufig nur zwei Pferde und eine Equipage, und die nahm den Maharadscha mit den zwei Ersten aus seinem Gefolge auf.
Nach einer Viertelstunde Fahrt hielt der Wagen vor dem Eingange eines Tunnels, der für den Maharadscha nicht hätte so verschwenderisch erleuchtet zu sein brauchen, er fand den Weg auch im Dunkeln.
Der Tunnel mündete in den Zirkus, den einst Blodwen für ihre und ihrer Gäste Belustigungen hatte einrichten lassen. Gleich die erste Vorstellung war bei dem Gladiatorenkampfe von Jansen so schnöde unterbrochen worden, und Blodwen hatte hier niemals wieder eine Schaustellung arrangieren können.
Ihre Erben hatten also die Fortsetzung aufgenommen. Äußerlich war davon nichts zu merken. Noch dieselben Stufen, noch dieselbe tiefliegende, mit Sand bestreute Arena, an den Seiten hin und wieder ein Tor oder ein Türchen.
Auf den steinernen Stufen saßen schon Zuschauer, offenbar Arbeiter, welche auf der Insel beschäftigt wurden, vielleicht hundert, welche aber in dem ungeheueren Raume verschwanden, und der Herrschaften, Gäste, die dem vorausgefahrenen Maharadscha zu Fuße nachkommen, mussten, waren auch nicht allzuviele, sodass sich der Eindruck gar nicht mit dem vergleichen ließ, den der Zirkus damals machte, als Blodwen die Eröffnungsvorstellung gab.
Beim Eintritt des Maharadschas erhob sich das Publikum, eine Gruppe schien aus vornehmeren Gästen zu bestehen, welche den indischen Fürsten aber nicht mit am Strande empfangen hatten, dort wurden ganz besonders Hüte und von Damenhänden Tücher geschwenkt.
Der Maharadscha ward mit seinen beiden Begleitern von einem Zeremonienmeister nach der anderen Seite geführt, sodass er jener aus Herren und Damen bestehenden Gruppe gegenüber zu sitzen kam, und bei dieser Isoliertheit würde es bleiben, so hatte Sidi Sabasi bestimmt. Nur die anderen seines Gefolges, welche wegen Wagenmangels zu Fuß nachkamen, würden natürlich neben oder hinter ihrem Herrn Platz nehmen.
Die fünf Sportsmen hatten die ›Indianarwa‹ schon früher verlassen, Jansens Falkenblick erkannte ihre Gestalten drüben bei den Herren und Damen, wo sie wohl Bekanntschaften erneuerten, wo sie auch blieben. Nur Monsieur Chevalier gesellte sich dann zu dem Maharadscha und setzte sich neben ihn.
»Die Geschwister und die ganze Bande sind nicht schlecht unglücklich darüber, dass Sie sich so isolieren«, war sein erstes Wort.
»Das glaube ich wohl«, entgegnete Jansen finster, »aber ich habe keine Lust, neben ihnen zu sitzen, ich mag schon die Luft in ihrer Nähe nicht einatmen.«
»Was haben Sie eigentlich gegen die Geschwister Ihrer Gattin? Kann wirklich menschliche Niederträchtigkeit Sie noch stören?«
»Ja — oder nein — aber ich ich ich... Chevalier, mir ahnt Fürchterliches!«
»Was denn Fürchterliches?«
»Diese Erben wollen Blodwens Phantasie in dem, was sie den Gästen hier bieten, doch jedenfalls noch übertreffen.«
»Ja, das wollen und werden sie allerdings. Sie sind auch hauptsächlich deshalb so unglücklich über Ihre Isoliertheit, weil Sie dadurch nicht auf sensationelle Überraschungen aufmerksam gemacht werden können, welche sich in der Entfernung dem Auge entziehen. Sie haben mich himmelhoch gebeten, dass wenigstens ich dieses Amt eines Mentors übernehmen möchte, in der Hoffnung, dass Sie mich neben sich dulden.«
In diesem Augenblicke begann eine Musikkapelle zu spielen, welche seitwärts zwischen dem Maharadscha und den gegenübersitzenden Gästen postiert worden war.
»Erlauben Sie also«, fuhr der Franzose fort, »dass ich die Rolle eines Erklärers übernehme. Zunächst mache ich Sie darauf aufmerksam, dass nur Ihretwegen jetzt schon trompetet und gefiedelt und geflötet wird, denn die Gastgeber sind ja noch gar nicht da, die latschen jetzt noch ihre Sohlen ab.«
»Großartig, diese Aufmerksamkeit!«, spottete Jansen.
»Wollen Sie nun, hochedler Fürst, diese Musikanten näher betrachten.«
»Etwa durch das Fernglas? Fällt mir ja gar nicht ein.«
»Nein, solch ein mikroskopisches Interesse würde sich für einen indischen Großfürsten auch gar nicht schicken. Aber fällt Ihnen an diesen Musikanten nicht etwas auf?«
In der Tat! Jansens Augen genügten, um zu erkennen, dass es mit den Instrumenten eine besondere Bewandtnis haben musste. Diese waren alle schneeweiß und zeigten eine eigentümliche, gleichmäßige Form, jedes Instrument war wie ein weißer Stab, selbst die Violinen, denen der ebenfalls weiße Bogen Töne entlockte. Nur die Trommeln hatten eine runde Form, waren aber viel kleiner als gewöhnliche Trommeln, und ebenfalls weiß.
»Was für Instrumente sind denn das?«
»Sie bestehen aus Knochen«, erklärte Chevalier, »und zwar nicht etwa aus Tierknochen, sondern aus Menschenknochen. Faktisch, echte Menschenknochen! Auf dieser Insel haben ja schon genug Menschen ihren Tod gefunden, besonders auch zuletzt, als der Vernichtungskampf gegen die Raubtiere geführt wurde, und noch ganz besonders hat deren lebendiges Einfangen zahlreiche Opfer gefordert. Zuerst hatte man sie begraben, bis die Herrschaften durch Auffinden einiger von früher herstammender Skelette, die schon von der Sonne hübsch gebleicht wurden waren, auf einen genialen Gedanken kamen. Die erste Idee von Lord James, sich aus solch einem weißen Schenkelknochen, der einem Riesen angehört, einen Spazierstock machen zu lassen, brachte sie auf Musikinstrumente! Zuerst wenigstens Flöten. Warum sollte man aus solch einem Knochen aber nicht auch ein Saiteninstrument herstellen können?
Manche Völkerschaften haben ja ebenfalls solche stockähnliche Geigen. Gedacht, getan — einer der Jagdgäste war zufällig ein ehemaliger Geigenbauer — der erste Versuch gelang — da die vorgefundenen Skelette nicht langten, wurden die schon Begrabenen wieder ausgepaddelt und nach den neuesten Errungenschaften der Chemie und anderer Wissenschaften fein sauber skelettiert und aus ihren Gebeinen Instrumente aller Art gefertigt. Ich habe sie in der Hand gehabt — wirklich famos gemacht — es lässt sich ganz hübsch auf solch einer Violine spielen, wenn sie auch nur zwei Saiten hat — auch einen ganz hübschen Ton — der hohle Knochen ist ja selbst ein Resonanzkasten. Ebenso haben auch die Trompeten und Posaunen einen ganz vortrefflichen Klang. Die Schallmündung, welche sie am Ende sehen, ist immer ein angesetzter Totenschädel, der obere Teil, die Hirnschale, und ebenso bestehen die Trommeln aus Totenköpfen.«
Mit wahrhaft entsetzten Augen blickte Jansen nach den Musikanten, die soeben einen lustigen Marsch aufspielten.
»Entsetzlich, entsetzlich!!«, hauchte er denn auch.
»Was, entsetzlich? O, hochedler Maharadscha, Ihr braucht Euer zartes Gewissen nicht zu beunruhigen. Würdet Ihr auch so stöhnen, wenn ich Euch sage, dass es nur die Knochen von Affen sind?«
»Ich denke, Menschenknochen?«
»Nein. Ich hatte vorhin nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Ich hatte gesagt, es seien echte Menschenknochen. Nein, so ganz richtige Menschenknochen sind es nicht. Oder glauben Sie, diese Engländer wären wirklich fähig, Knochen von richtigen Menschen zu Instrumenten zu verarbeiten und dann lustige Weisen darauf spielen zu lassen?«
Jansen starrte den Sprecher an. Es lag ein so beißender Hohn in seinem Ton.
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Auch einige der Jagd- und anderen Gäste, meist Engländer, haben bei der Geschichte den Heldentod gefunden. Aber ferne lag es diesen Herrschaften, aus deren Knochen Flöten und Fiedeln und Trompeten zu machen, auf ihren Schädeln herumtrommeln zu lassen — die haben ein ehrliches, ein christliches, sogar ein hochnobles Begräbnis gefunden, mit Flinten und Kanonen hat man über die blumengeschmückten Erdhaufen hinweggeschossen; es wurde gebetet, gepredigt und außerdem geweint. Grabsteine und Monumente mit Engeln sind bereits in Auftrag gegeben worden. Nein, hochedler Maharadscha, Sie tun diesen vier Geschwistern wirklich unrecht, wenn Sie ihnen solch eine Taktlosigkeit zutrauen. Jene Knochen dort, in die die Musikanten hineintuten, auf denen sie herumkratzen und herumtrommeln — da, da: so leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage tschinterätä bumbumbum — das sind nur die Knochen von elenden Negern, Kulis und anderem menschenähnlichen Affengesindel.«
O, dieser zigarettendrehende Franzose hatte eine furchtbare Art zu sprechen! Jansen war nur noch mehr erschüttert.
»Entsetzlich!«, hauchte er nochmals.
»Ja, Sir, ich verstehe Ihre Gefühle«, sagte der Franzose jetzt in einem ganz anderen Tone; »denn ich erinnere mich, dass auch ich früher einmal ein Mensch gewesen bin. Heutzutage ist mir ganz schnuppe, ob die Instrumente dort lachen oder weinen, ob sie aus Kuchen gebacken sind oder aus Menschenknochen bestehen, aber, wie gesagt, auch ich bin einmal ein Mensch gewesen — habe sogar sehr viel Gefühle gehabt — habe das glücklicherweise überwunden. Faktisch, ich bin gar kein Mensch mehr, bin entweder etwas Höheres oder etwas Niedrigeres.«
»Mir ahnt Schreckliches!«, flüsterte Jansen nach wie vor, und es klang fast wie ein Stöhnen.
»Von was für Ahnungen werden Sie wieder einmal geplagt?«
»Diese Instrumente aus Menschenknochen lassen schon auf das schließen, was wir hier zu sehen bekommen werden.
»Da mögen Sie nicht so unrecht haben.«
»Schon Blodwen hatte vor, hier die Zeiten Neros wieder einzuführen — auch sie wollte uns damals Tierkämpfe zum besten geben.«
»Die Sie leider vereitelten.«
»Jedenfalls sollten wilde Bestien auf Menschen losgelassen werden.«
»Ganz sicher. Es war zu dumm von Ihnen, dass Sie uns um dieses herrliche Schauspiel brachten.«
»Und diese vier Geschwister wollen doch noch Blodwens Phantasie überbieten.«
»Können sie auch, haben noch ganz andere Mittel dazu. Lady Blodwen hatte nur einige Dutzend wilde Tiere zur Verfügung, jetzt sind hier viele hundert eingesperrt, ich habe schon die Menagerie besichtigt. Großartig!«
»Und es haben sich Menschen gefunden, welche sich zu so etwas hergeben?!«
»Warum nicht? Mit Gold kann man alles machen. Dann brach hier einmal eine Meuterei aus, wobei viele Morde und Totschläge vollbracht wurden — die Übeltäter sitzen hier noch hinter Schloss und Riegel, und sie haben die Wahl, nach England an den Galgen abgeliefert zu werden, oder mit wilden Tieren zu kämpfen, wobei sie doch hier noch immer die Hoffnung haben, mit dem Leben davonzukommen und auch noch eine erkleckliche Summe zu verdienen.«
Ob das nach Paragraf soundsoviel statthaft war, das war jetzt ganz Nebensache, das wurde gar nicht erörtert.
»Chevalier, Chevalier, das kommt zu einer Katastrophe!«, flüsterte Jansen, und er fing förmlich an allen Gliedern zu zittern an.
»Sie werden sich wiederum einmischen?«
»Ich kann so etwas nicht sehen — einen regelrechten Zweikampf, ein Wettspiel, und wäre es auch noch so blutig, ja — — aber eine Hinschlachterei, ein Massenmord — ich kann so etwas nicht sehen, ich kann nicht, ich kann nicht!!«
»Und die denken gerade, Ihr Herz zu erfreuen, dass Sie sich erweichen lassen, ihnen an Bord Ihres Schiffes etwas Sehenswertes zu bieten.«
»Ha, wie die sich irren! Die schließen eben von sich auf andere.«
»Na, gedulden Sie sich mal mit Ihrer Dazwischenspringerei. Gewiss, das wird ja auch eine ganz effektvolle Szene, aber das kommt dann erst im vierten Akte. Die drei vorhergehenden sind ganz unschuldig. Ich weiß ja alles schon, was es geben wird, werde aber nichts verraten. Sie sollen tatsächlich überrascht werden.«
Jetzt trafen auch die zu Fuß gekommenen Herrschaften ein. Sie grüßten nach dem Maharadscha hinüber und begaben sich auf die andere Seite zu den übrigen europäischen Gästen, während sich die Inder zu ihrem Herrn gesellten.
Kaum hatten die Ankömmlinge Platz genommen, als ein lautes Geschmetter der Menschenbeintrompeten ankündete, dass jetzt etwas Besonderes käme, und da öffnete sich auch schon eine Pforte, in die Arena herein hüpfte eine Gesellschaft von Männlein und Weiblein und Kindlein, chinesisch kostümiert und wohl auch echte Chinesen; Leitern, Bambusstangen und andere Requisiten wurden ihnen nachgebracht, auf dem Sand ein Teppich ausgebreitet, und alsbald begann der erste Teil der Vorstellung.
Chinesische Gaukler. Das heißt, keine Taschenspielerei, dazu war die Entfernung zu groß, sondern akrobatische Kunststückchen.
Ja, es war erstaunlich, wie die Kerls miteinander jonglierten, wie sie an freistehenden Leitern und Bambusstangen emporkletterten und sich oben auf den Kopf stellten, aber... auch hierfür war die Entfernung zu groß, um das richtig ›genießen‹ zu können, und dann hatten wohl alle diese Weltreisenden Ähnliches schon geschaut, ganz abgesehen von den indischen Gästen.
Jedenfalls aber hatten die Erben auch das von Blodwen gelernt, erst mit Nichtigkeiten zu beginnen, damit das Nachfolgende um so sensationeller wirkte — was ja schließlich auch jeder andere Zirkus tut.
Die Chinesen rückten unter Applaus wieder ab, dafür brachten Diener Gegenstände angeschleppt, sie in der Arena verteilend, von denen schwer zu sagen war, was sie vorstellen sollten.
Es waren große Massen, rund und spitz...
»Was soll denn das bedeuten?«, fragte Jansen seinen Mentor. »Wenn Sie es nicht ahnen, so ist das verzeihlich. Das soll Natur vorstellen.«
»Natur?«
»Sie werden es gleich wissen, wenn der zweite Teil der Natur kommt.«
Unten wurden verschiedene Pforten aufgemacht, und gleich darauf sprang unter einem tüchtigen Knall eine andere auf, welche sich in ziemlicher Höhe der Umfangsmauer befand, und aus dieser heraus drang... ein mächtiger Wasserstrom, sich als ansehnlicher Wasserfall in die Arena ergießend.
Jansens Staunen war aufrichtig.
»Die Arena wird unter Wasser gesetzt! Wahrhaftig, das nenne ich das klassische Altertum wieder zurückzaubern!«
Ja, die alten Römer haben das alles schon gehabt, was jetzt wieder unsere Zirkusse als die neueste Sensation hervorkramen, die Manege in eine Wasserbühne zu verwandeln, und zwar meist in recht kläglicher Weise.
Schon im Jahre 20 vor Christo veranstaltete Kaiser Augustus im Zirkus Flamininus eine Wasserjagd auf Krokodile und Nilpferde, zur Belustigung des römischen Volkes!
Doch wenn wir die Zeiten des klassischen Altertums zurückwünschen, so wollen wir lieber nicht römischen Kunststücken, sondern griechischer Kunst nacheifern.
Denn es sei hier einmal gesagt: für jeden selbstdenkenden Menschen, der das Herz auf dem rechten Flecke hat, trifft Ulrich von Huttens Wahlspruch: ›Es ist eine Lust zu leben!‹ nicht mehr zu. Nein, es ist wahrhaftig kein Genuss mehr! Wir Nordländer, die wir die Träger der Kultur geworden, sind trotz aller Fortschritte in Wissenschaften und Technik — oder gerade dadurch — als Menschen ganz jämmerlich weit heruntergekommen!
Glücklicherweise aber weiß der weitschauende Geist auch, dass nichts stirbt, nicht für immer, dass alles wieder geboren wird. Von den Führern der Völker ist die Förderung solch einer Wiedergeburt freilich nicht zu erwarten. Aus dem Volke selbst kommt alles Gute, Starke und Schöne! So sind die öffentlichen Wettspiele, ist sogar jedes Sonnenbad als Rückkehr zu einer Zeit zu begrüßen, da es wieder gesunde Menschen geben wird, gesund an Leib und Seele, daher auch empfänglich für alles Große und Schöne — natürlich immer wacker bekämpft vom ebenso unsterblichen Geiste des Widerspruchs, heutzutage bekleidet mit der Uniform eines Polizisten. Aber so muss es sein, ohne Kampf kein Sieg.
Ununterbrochen rann der mächtige Wasserfall, von entsprechender Musik begleitet, immer höher wuchs die Flut in der Arena, drang auch in die offenen Tore hinein, fand aber durch sie keinen Abfluss.
»Wie ist das nur möglich?!«, staunte Jansen.
»Was soll denn da unmöglich sein?«
»Woher kommt das Wasser?«
»Nanu, hochedler Maharadscha, Sie müssen in Ihrem Königreiche Bunterkund doch noch ganz andere Wasserkünste gehabt haben als solche Spielereien! Hier braucht nicht einmal durch Menschenkraft gepumpt zu werden, das besorgen Dampfmaschinen, von denen schon die alten Römer nichts gewusst haben. Was ist denn weiter dabei?«
»Wie ist aber da nur der Untergrund beschaffen?«
»Fest — wasserdicht.«
»Aber er muss doch hohl sein.«
»Warum soll er nicht? Gutgefügte Holzplanken, Zement darüber geschmiert — fertig ist der Kitt.«
»Das Wasser fließt nicht wieder ab.«
»Soll es ja auch nicht.«
»Ich meine, weil Türen offen stehen.«
»Hinter jeder befindet sich einfach noch eine wasserdichte Tür.
Man braucht doch Gänge, wo das vorbereitet wird, was das Publikum nicht sehen soll.«
»War das alles schon zu Blodwens Zeiten?«
»Alles erst ihr Werk. Oder das des Papa Popelmann, wie Mr. Rug ihn immer nannte. Auch Lady Blodwen hatte uns eine Wasserpantomine vorgeführt, Sie haben das durch Ihr verrücktes Zwischenspringen freilich vereitelt.«
»Und was soll uns hier vorgeführt werden?«
»Werden's gleich sehen. Ich will doch den Weihnachtsmann nicht verraten. Was die vorhin undefinierbaren Dinger bedeuten, das wissen Sie ja jetzt.«
Ja, das war nun sofort zu erkennen.
Klippen, Felsmassen, und der Wasserfall erzeugte Unruhe genug, dass es daran ganz tüchtig schäumte. Mit einiger Phantasie konnte man sich recht wohl hineintäuschen, ein aufgeregtes Meer mit von Brandung umtobten Felsen vor sich zu haben.
Nachdem sich der Wasserfall erschöpft hatte, stand das Wasser in der Arena ungefähr einen Meter hoch — und da begann die Musik die französische Nationalhymne zu spielen — aber nicht etwa die Marseillaise — wer die zu jener Zeit in Frankreich sang, kam ins Loch, wenn er nicht gleich einen Kopf kürzer gemacht wurde — und unter diesen Klängen und unter einem allgemeinen ›Aaaaahhh!‹ kam seitwärts aus einem der Gänge ein Segelschiffchen heraus — nein, keine Spielerei, sondern ein richtiges, stattliches Segelschiff von altertümlicher Bauart. Das heißt, es war höchstens zwei Meter lang und dementsprechend hoch, jetzt aber unterlag auch der Phantasieloseste der perspektivischen Täuschung, dass es ein richtiges, großes Schiff sein müsse.
Und wie ein richtiges Schiff benahm es sich auch wirklich! Mit geschwellten Segeln steuerte es herein, jetzt ging es über Stag, d. h. die Rahen wurden herumgeschwenkt, und dass man dabei die arbeitenden Matrosen nicht sehen konnte, war ganz in der Ordnung, es schien eben weit, weit entfernt zu sein, und jetzt senkte es grüßend die am Heck wehende französische Kriegsflagge, während am Top die Admiralsflagge flatterte.
»Das ist ja, das ist ja...« staunte Jansen.
Das Wort blieb ihm stecken, denn jetzt folgte ein zweites solches Schiff, nur ein wenig kleiner, und dann kam immer noch eins aus dem Tunnel heraus, ein viertes, ein fünftes — gleich große und auch viel kleinere — sie wurden gar nicht alle — und nachdem der Tunnel endlich geleert war, konnte man sie nicht mehr zählen, weil sie sich durcheinander bewegten.
Oder auch nicht durcheinander, wenigstens nicht planlos. Zuerst waren die Fahrzeuge dem Admiralsschiff immer im Kielwasser gefolgt, während noch immer neue aus dem durch Felsenberge maskierten Tunnel hervorkamen, waren so rund um die Arena herumgefahren, jedes Schiff wiederholt grüßend, die Nationalflagge senkend — da kletterten am Kreuz des Admiralsschiffes eine Reihe bunter Läppchen empor, überall gingen die Verstandenzeichen in die Höhe, und wie das Admiralsschiff selbst die Rahen mit vollgesetzter Leinwand herumschwenkte, so taten ihm auch alle anderen Schiffe nach, bis sie eine lange Reihe bildeten, in Linie vorgingen — und immer eifriger signalisierte das Flaggschiff, die Linie entwickelte sich zum Halbmond, dann schien wieder alles durcheinander zu gehen, aber es war ein ganz planvolles Manöver, die Kriegsflotte rangierte sich anders, und ganz besonders in der Nähe der Klippen wurden die schwierigsten Evolutionen ausgeführt.
Wir haben schon oft gesagt, dass Jansen staunte. Jetzt geriet er vor Staunen außer sich, zugleich aber auch wurde er von einer Art kindlichen Jubels berauscht.
»Das ist ja reizend, das ist ja entzückend!!«, rief er ein übers andere Mal, selbst wie die anderen in die Hände klatschend.
»Nein, wie ist das nur möglich! Diese Schiffchen fahren und manövrieren doch ganz wie richtige Segelschiffe, und — und — es geht doch gar kein Wind — ach, was sage ich denn, Wind — ja aber, wie werden die Schiffchen denn nur so in Bewegung gesetzt, und wie wird die Takelage bedient?!«
»Sie kommen nicht von selbst drauf?«, fragte der Franzose.
»Durch einen Mechanismus? Durch ein aufgezogenes Uhrwerk?«
»O nein, so kompliziert ist es nicht, das könnte nun wieder ich mir nicht vorstellen, wie das mit einem Federmechanismus zu ermöglichen wäre.«
»Durch Elektrizität? Die Schiffe werden durch elektrische Drähte dirigiert?«
Da sprach Jansen eine ungeheuer gewagte Vermutung aus. Damals gab es wohl schon elektrische Klingeln und anderen Kleinkram, auch schon elektrische Bogenlampen, welche nur niemals strahlen wollten, und an solch eine Fernleitung durch Elektrizität war nun gar nicht zu denken.
»Durch Elektrizität?«, lächelte denn auch Monsieur Chevalier. »Da sieht man doch, Sie geben ein Beispiel, in welch phantastische Fernen der Mensch schweifen kann, wenn er nach einer Erklärung sucht, weil er etwas sieht, was nicht gleich in seinen Schädel geht, während das Einfache und Wahre doch so nahe liegt. Na, lichtet sich noch immer nicht die neblige Atmosphäre Ihres Verstehstdumichballons?«
Nein, Jansen schüttelte seinen Verstehstdumichballon noch immer.
»Rätselhaft, einfach rätselhaft. Da möchte man fast an... eine übernatürliche Kraft glauben, welche dieses Schiffchen treibt und dirigiert, an eine Fernwirkung der Willenskraft.«
»Richtig, richtig, jetzt sind Sie auf den Trichter gekommen!«
»Was? Wirklich eine Fernwirkung? Achnöööhh!«
»Nun zweifeln Sie auch wieder daran? O, Menschen, Menschen, wie ähnelt ihr doch einander!! Ein Glück nur, dass wir nicht wie die Schafe Wolle auf der Haut haben, sondern Kleider tragen, und dass die Kleider und Hüte verschieden sind. Und Sie wissen's immer noch nicht? In jedem Schiffe steckt ein Kerl, der schiebt's so sanft vorwärts. Er läuft am Boden und hat über seinem Oberkörper das hochbordige Schiff, über seinem Kopfe einen besonderen Aufbau, den Sie auf jedem Fahrzeug bemerken werden. Das ist der ganze Zauber.«
Da schlug sich Jansen mit der Faust vor seinen Verstehstdumichballon, und dann lachte er. Und dann stiegen doch immer wieder neue Zweifel in ihm auf.
»Ja aber... das Richten der Rahen — das Hissen der Flaggen...«
»Alles nicht übersinnlich, hat nichts mit Spiritismus zu tun — nur einfach ein bisschen Bindfaden, an dem der Kerl da drin herumzieht, das ist der ganze elektrische Mechanismus. Beunruhigt Sie sonst noch etwas?«
Nein, nun hatte Jansen genug des Spottes.
»Sie hätten mir das gar nicht sagen sollen. Doch es ist gleichgültig, die Täuschung bleibt — das ist das Reizendste, was ich je geschaut!«
»Ja, es ist reizend«, bestätigte sogar dieser abgebrühte Franzose. »Aber gar nicht maharadschanisch ist es, dass Sie sich vor die Stirn schlagen und so lachen und jubeln. Das passt sich nicht für so einen kaffeebraunen Heiduckenfürsten. Ein Glück, dass alles nur Augen für die Kinderspielerei hat.«
Mit Mühe gelang es Jansen, sich so weit zu bezwingen, dass er wenigstens nicht mehr laut aufjubelte. Aber mit leuchtenden Augen verfolgte er die Manöver der vereinigten Flotte, und immer mehr nahm die perspektivische Täuschung überhand, in so natürlicher Weise ward alles ausgeführt.
Jetzt schlossen sich die Schiffe mehr zusammen, die ganze Flotte lief in eine durch zwei Felsen markierte Bucht.
»Einige Schiffe führen doch die spanische Kriegsflagge«, begann Jansen wieder.
»Bemerken Sie das erst jetzt?«
»Richtig, und da ist ja auch noch eine spanische Admiralsflagge, doch nur halb geführt, das bedeutet, dass es kein kommandierendes Flaggschiff ist, sondern dass sich die spanischen Kriegsschiffe dem französischen Admiral unterordnen.«
»Und die beiden Felsen, zwischen denen die vereinigte französischspanische Flotte jetzt liegt, sollen den Eingang zum Hafen von Cádiz markieren.«
»Von Cádiz?!«, fuhr Jansen empor. »Ach, jetzt geht mir eine Ahnung auf!«
»Na, endlich!«
»Das wird die Seeschlacht bei Trafalgar!«
»So ist es.«
»Wo aber bleiben die Engländer?«
»Da kommen sie schon.«
Aus einem anderen Wassertunnel, geschickt durch Felsen maskiert, kam wieder ein stattliches Linienschiff hervor, hochbordig, mit zahllosen Pforten für die Geschütze versehen, wie sie damals vor jetzt genau hundert Jahren waren, die Takelage unter einer Unmasse von weißer Leinwand verschwindend, und an diesem führenden Schiffe die englische Admiralsflagge, dann wieder eine Menge anderer Schiffe folgend, grüßend die englische Kriegsflagge senkend.
Und jetzt brach der Tumult los. Das Erscheinen der französischspanischen Flotte war applaudiert worden, das Händeklatschen hatte der ganzen Idee, dem geschickten Manövrieren gegolten, jetzt aber zeigte sich, dass doch meistenteils Engländer hier versammelt waren, die Herren wie die Damen wie die Arbeiter — die französische Nationalhymne hatte dem ›God save the Queen‹ weichen müssen, jetzt also wurde die Sache politisch, jetzt kam das Nationalgefühl hinzu, und das Publikum fing an zu toben, wie eben nur der Engländer es fertig bringt, wenn er durch einen Angriff auf seinen Nationalstolz aus seinem sonstigen Phlegma aufgerüttelt wird.
»Hip hip hip hurra!!!«, gellte und heulte und brüllte es ohne Unterlass. »Hip hip hip hurra für Admiral Nelson!!!«
Denn Admiral Nelson bleibt für den Engländer eben Admiral Nelson.
Was die Seeschlacht bei Trafalgar anbetrifft, so nahm diese ihren Anfang bei Cádiz. Die aus vierundvierzig Schlachtschiffen bestehende vereinigte spanischfranzösische Flotte hatte unter dem französischen Geschwaderchef Admiral Villeneuve die englische Flotte unter Admiral Calder bei Coruna geschlagen und lief in den Hafen von Cádiz, wo sie sich ihres Sieges freute. Mit England sah es damals sehr faul aus. Da erschien der zu Hilfe gesandte Admiral Nelson mit Englands letzter Seemacht, mit siebenundzwanzig Linienschiffen.
Nelson griff den im Hafen liegenden Feind sofort an. Doch es war nur ein Scheinmanöver, nach dem Verlust eines Schiffes wandte er sich zur Flucht — er wollte nur den Feind herauslocken, gerade dorthin, wo er ihn haben wollte.
Bei Trafalgar, in der Nähe von Gibraltar, stießen die beiden Flotten zusammen: am 18. Oktober 1805 begann die vier Tage währende Seeschlacht, wie sie von solcher Furchtbarkeit und Dauer die Weltgeschichte noch nicht erlebt hatte.
Die Engländer siegten. Geentert wurde nicht mehr, nur noch in den Grund geschossen und gerammt. Und am 22. Oktober gelang es nur noch vier französischen Schiffen, die Flucht zu ergreifen, alle anderen lagen auf dem Meeresgrunde. Das englische Admiralsschiff hatte im Zweikampf das französische vernichtet, Admiral Villeneuve wurde gefangen, Admiral Nelson in der Stunde des Sieges von einer Musketenkugel tödlich getroffen.
Das Jubelgetöse wollte nicht aufhören, während die englische Flotte jetzt ihre Manöver machte, und Jansen konnte sich nicht helfen, er wurde von dem allgemeinen Enthusiasmus angesteckt.
Selbst Monsieur Chevalier schien dieser Suggestion zu unterliegen, obgleich er als Franzose doch gar nicht so für die Engländer hätte Partei nehmen sollen.
»Famos, famos gemacht!«, rief er ein über das andere Mal, während die Flotte exerzierte. »Nein, das hätte ich dem Admiral Nelson wirklich nicht zugetraut!«
Da fiel Jansen ein anderer Gedanke ein, er spähte nach den anderen Gästen hinüber.
»Wo ist denn unser Lord Seymour? Der muss in des Admirals siegreicher Hose jetzt doch ganz aus dem Häuschen sein.«
»Was? Sie wissen nicht? Nein, woher sollen Sie denn? Nun denn: in dem englischen Flaggschiff steckt auch nichts anderes als Admiral Nelsons siegreiche Hose, und in dieser unser Freund Seymour.«
»Was? Lord Seymour dirigiert dieses Schiff?!«, rief Jansen in hellem Staunen.
»Ach, Sir, das müssen Sie sich erzählen lassen! Sie hätten dabei sein sollen! Das wäre eine Arznei gegen Ihre Melancholie gewesen! Wir besuchten doch schon gestern diese englische Bande, die scharwenzelte immer um uns herum, von wegen dass Sie Ihre Zurückgezogenheit aufgeben möchten, und so wurden wir auch schon eingeweiht, was es heute zu sehen geben würde. Man führte uns hinter die Kulissen, zeigte uns alles. Also ein Wasserzirkus, wir sahen die aus Holz und Pappe zusammengeleimten Schiffchen, die Seeschlacht bei Trafalgar sollte dem verehrlichen Publikum vor Augen geführt werden. Ach, Sir, da hätten Sie nun unseren Freund Seymour sehen sollen! Die Schlacht bei Trafalgar! Die englische Flotte, kommandiert von Admiral Nelson! Der Lord geriet doch ganz... nicht aus dem Häuschen, sondern aus dem Höschen. Faktisch, er strampelte vor Erregung dermaßen, dass seine unsterbliche Hose hinten und vorn platzte, wo es nur etwas zu Platzen gab.
›Das bin ich, das bin ich! Nur ich kann die Flotte kommandieren! Ich habe doch Admiral Nelsons Hosen an!‹
So schrie er ein über das andere Mal. Und er blieb dabei, er wollte selbst in dem englischen Flaggschiff stecken. Was wollte man machen? Man konnte doch dem Lord nichts abschlagen. Nun ist diese Geschichte aber nicht so einfach, dass alle diese Manöver so klappen — der Zirkus ist schon oft unter Wasser gewesen, die in den Schiffen steckenden Kerls haben sich das tüchtig eingeübt. Dem Lord konnte das alles nun bloß so theoretisch erklärt, ihm auf dem Papier vorgezeichnet werden, wie die einzelnen Manöver vor sich gehen. Aber wirklich, er macht seine Sache ja ganz famos, das erkennt man schon jetzt.«
Nach dieser Erklärung betrachtete Jansen das englische Flaggschiff mit doppeltem Interesse, welches durch die Hose, welche drin steckte, viel mehr Anspruch auf historische Wirklichkeit machen konnte als alles andere.
Bisher hatte die manövrierende englische Flotte die im Hafen liegende französische ignoriert.
Jetzt wurde darauf vorbereitet, dass etwas anderes käme, auf den englischen Schiffen ward eifrig mit den bunten Fähnchen signalisiert, die Musik intonierte einen schmetternden Kriegsmarsch, und da ging die englische Flotte gegen den Hafen von Cádiz vor.
Dort war der Feind gesichtet worden, das Admiralsschiff gab durch Flaggen Befehle, große Aufregung, alles ganz deutlich markiert, die unierte Flotte suchte noch den Ausgang des Hafens zu gewinnen, was ihr nur zum Teil gelang, und da — bumberumbumbumbum — das englische Flaggschiff gab die erste Breitseite ab, und nun ging der Spektakel los, ein ununterbrochenes Geschützfeuer, alles wurde eingehüllt von Pulverdampf, der aber doch nicht dicht genug war, sodass man noch deutlich sehen konnte, wie die Schiffe mächtig hin und her schwankten, das ganze Wasser in Aufruhr bringend, und wie die Rahen herabstürzten und ganze Masten abknickten.
Nicht nur Jansen mochte vor Staunen außer sich sein.
»Ja, wie machen die denn das nur?!«
»Was ist weiter dabei?«, entgegnete der Franzose phlegmatisch. »Ein bisschen Feuerwerk, nichts weiter!«
Nun, gut denn, nichts weiter als ein bisschen Feuerwerk. Aber jedenfalls großartig gemacht!
Da begann eins der großen englischen Linienschiffe noch mehr zu schwanken, auch in ganz anderer Art, es senkte sich, immer tiefer ging es hinab — und es war bis zur letzten Mastspitze verschwunden.
»Ja, wo ist denn das geblieben?«, staunte Jansen.
»In den Grund geschossen, wie die Historie es vorschreibt.«
»Und der Mann, der es dirigierte — ich habe doch ganz genau aufgepasst!«
»Der schwimmt einfach unter Wasser hinter die Kulissen, das heißt, in solch einen Tunnel, wo er unsichtbar wieder auftauchen kann. Man hat als Dirigenten der Schiffe die besten Schwimmer und Taucher auserwählt, und der Untergang eines Schiffes muss immer in der Nähe solch eines Tunnels stattfinden. Außerdem haben die Schwimmer noch eine Leine bei sich, die haken sie zuvor in dem untersinkenden Fahrzeug fest, so wird dieses dann ebenfalls unter Wasser in einen Tunnel gezogen, damit die anderen nicht darüber stolpern. Alles doch ganz einfach.«
Ja, alles ist ganz einfach... nachdem der geniale Kopf es erdacht hat!
Der Verlust eines seiner größten Schlachtschiffe und wohl vor allen Dingen der Umstand, dass der Feind unterdessen den Hafen verlassen hatte, bewog Admiral Nelson zum Rückzuge zur Flucht. Die unierte Flotte rangierte sich erst, ehe sie langsam folgte.
Das Verhältnis musste natürlich gewahrt werden. Wie die Schiffe klein waren, so ging auch alles sehr schnell.
Die englische Flotte zog sich hinter einen Felsen zurück, welcher den von Trafalgar vorstellte, die Franzosen und Spanier folgten, Admiral Villeneuve ließ einen Halbmond bilden — nicht Halbkreis genannt, weil der Kreis doch nur aus einer Linie besteht, während diese Schiffe sich in mehrfacher Reihe rangierten, um so die englische Flotte in der Bucht einzuschließen.
Aber das wartete Nelson nicht ab, er brach hervor, noch ehe der Feind sich ganz geordnet hatte, und nun ging erst recht der Spektakel los, gegen den der vorige nur eine Kleinigkeit gewesen war.
Ununterbrochen feuerten die Schlachtschiffe, hin und her kreuzend, ihre Breitseiten ab, und dann, als sie einander nahe genug waren, kam es zum Rammen, obgleich die Schießerei noch immer fortwährte.
Schiff sank nach Schiff, um nicht wieder aufzutauchen, und wer in der Geschichte so genau bewandert war und die kleinen Flaggen entziffern oder gar die Namen am Heck erkennen konnte, der bemerkte, dass auch hierbei die historische Treue gewahrt wurde, nur die, welche in Wirklichkeit gesunken, besonders von den Engländern, sanken auch hier, und das rammende Schiff, welches sich hier seinen eigenen Untergang bereitete, hatte auch bei Trafalgar gerammt.
Immer mehr lichteten sich die Reihen der Franzosen und Spanier, aber auch die der Engländer, und dann standen sich die beiden Flaggschiffe gegenüber, Admiral Villeneuve und Admiral Nelson wollten sich einen Zweikampf liefern, der wohl die ganze Schlacht entscheiden musste, mit Ausschluss der Geschütze, nur Stoß um Stoß. Sie fuhren aufeinander los und wichen einander aus, und so ging das mehrmals hin und her.
Da aber passierte etwas, was sich bei Trafalgar nicht ereignet hat, und was daher wohl auch nicht hier im Programm stand.
Das französische Flaggschiff rammte das englische in die Seite, und zwar mit einer Wucht, dass von dem Schiffchen gleich der aufgeleimte oder aufgenagelte Oberbau abflog und... über dem Deck des ungeheueren Linienschiffes tauchte erst eine ebenso ungeheuere, blaurot angelaufene Nase auf, der dann, als noch etwas abbrach, Lord Seymours Kopf und ganzer Oberkörper folgte.
Es war ein Anblick, der sich leider nicht beschreiben lässt — wie da der glatzköpfige Lord mit seiner Gesichtsgurke über dem Schlachtschiffe auftauchte!
Und dabei sollte es nicht bleiben.
»I du Halunke, du denkst wohl, ich habe Admiral Nelsons Hosen umsonst an, i, du Lausbub elendiglicher...«
So und noch ganz anders fing jetzt der edle Lord zu schimpfen an, und dabei hob er das ganze Kriegsschiff über seinen Kopf, packte es noch fester mit zwei Händen und begann nun mit diesem Kriegsschiff auf seinen Gegner los zu pochen. Im Nu war das französische Flaggschiff kurz und klein geschlagen, und da tauchte zwischen den Trümmern auch schon Admiral Villeneuves erschrockenes Gesicht auf, und weil Admiral Nelson sein Flaggschiff ihm um die Ohren schlug, nahm Villeneuve schleunigst Reißaus, nach einem Tunnel zu, watend und mit den Händen rudernd, um seinen Leib noch die Trümmer seines Schiffes.

Lord Seymour folgte ihm nicht, er war nun einmal ins Prügeln gekommen, also er pochte mit seinem zur Kriegskeule verwandelten Kriegsschiffe auf das nächste los, immer unter entsprechenden Ausrufen, und so schlug der wütend gewordene Admiral Nelson alles kurz und klein, was in seinen Bereich kam, und überall wurden plötzlich Menschenköpfe und Oberkörper sichtbar.
Die anderen erkannten, dass es mit der Seeschlacht per Schiff jetzt vorbei war, sie kamen aus ihren Kästen heraus, zuerst die Engländer, und pochten gleichfalls auf die französischen Kriegsschiffe ein, bis auch die Franzosen und Spaniolen herauskamen, eine allgemeine Spritzerei entstand, aus der eine regelrechte Keilerei wurde.
Lord Seymour oder Admiral Nelson war und blieb der Anführer.
»Naus, naus mit den Franzosen und Spaniolen — haut sie, haut sie, haut sie — naus, naus, naus mit dieser Lumpenbagage — hip hip hip hurra für Nelsons siegreiche Hose!!!«
Schließlich befand er sich allein in dem Bassin, auch seine Streitkräfte hatten es verlassen. Und Lord Seymour wusste, was er getan, gravitätisch präsentierte er sich im Wasser, grüßend in der erhobenen Hand sein Flaggschiff schwingend, und ›hip hip hip hurra für Admiral Nelson!!‹ brüllte das vor Lachen sich krümmende Publikum.
Auf dem Rücken schwimmend und mit den Beinen strampelnd, so hatte auch Lord Seymour die wässrige Schaubühne verlassen. Ein solches Ende hatte die Seeschlacht bei Trafalgar nun freilich nicht gehabt, das war auch in diesem Programm nicht vorgesehen worden.
Aber köstlicher hatte der Schluss jedenfalls nicht sein können. Die Herren und Damen kollerten vor Lachen die Stufen des Amphitheaters herunter, und Jansen hatte Mühe, dass es ihm nicht auch so ging, schüttelten sich doch selbst die sonst so ernsten, über alles erhabenen echten Inder vor Lachen.
Nur Monsieur Chevalier steckte sich gleichmütig eine neue Zigarette an.
»Sehen Sie sich vor, Sie könnten sich verraten«, warnte er.
»Ach was, lassen Sie mich lachen! Sehen Sie doch meine Inder an. Teufel noch einmal, soll da ein Mensch nicht lachen! Sie freilich sind ja gar kein Mensch.«
Schließlich hatte sich Jansen doch wieder in der Gewalt.
»Wenn die Gastgeber unterlassen könnten, mir noch ein blutiges, grausames Schauspiel vorzuführen«, erklärte er, »so könnte ich mich mit ihnen aussöhnen, würde sie auch an Bord der ›Indianarwa‹ bewirten, dermaßen hat mich diese Seeschlacht en miniature ergötzt. Der köstliche, von unserem Lord aus dem Stegreif herbeigeführte Schluss wäre dabei gar nicht nötig gewesen.«
»Die Geschwister werden sich glücklich schätzen, wenn sie diese Ihre Worte erfahren«, entgegnete der Franzose, »und ich kann sie ihnen ja hinterbringen. Wenn sie Ihre Geschmacksrichtung kennen, werden sie den grausamen Tierkampf wohl auch unterlassen.
Doch ich muss Ihrer Dankbarkeit gegen die Gastgeber einen Dämpfer aufsetzen. Ehre, wem Ehre gebührt! Diese Idee mit der Seeschlacht stammt gar nicht von den Geschwistern.«
»Von wem denn sonst?«
»Nun, die ganzen Requisiten waren noch vorhanden, das hatte alles schon Lady Blodwen arrangiert, vielleicht mit Hilfe von Papapopulos. Jedenfalls hätten wir das alles schon damals zu sehen bekommen, wenn Sie der Vorstellung nicht solch ein Ende bereitet hätten.«
Ja, das war allerdings ein Dämpfer auf Jansens vorige Ansicht!
»Soll ich ihnen hinterbringen, dass der Tierkampf lieber unterbleiben soll?«, fragte Monsieur Chevalier nochmals.
»Lassen Sie!«, entgegnete Jansen finster. »Nicht die Befolgung eines Befehls, sondern der freie Wille entscheidet den Charakter des Menschen. Ich will doch sehen, wessen diese meine lieben Verwandten fähig sind, das soll die Entscheidung geben, und dass unnütz kein Menschenblut fließt, werde ich zu verhindern wissen. Was bringt der nächste Akt?«
»Etwas höchst Sensationelles, tatsächlich.«
»Was ist es?«
»Ich möchte es Ihnen lieber nicht verraten. Tatsächlich eine übergroße Überraschung.«
»Eine blutige?«
»Ganz harmlos.«
»Well, so können wir ja noch diesen Akt abwarten, ehe wir weiter darüber sprechen.«
Das Wasser in der Arena sank, es wurde ausgepumpt, floss vielleicht auch direkt ab.
Drüben wurden den anderen Gästen Erfrischungen angeboten — zu den Indern kam kein dienstbarer Geist, auch in dieser Hinsicht hatte Sidi Sabasi für seinen Herrn Unnahbarkeit gefordert. Da aber kam Lord Seymour, in einen weißen Bademantel gehüllt, und brachte in die ernst gewordene Gesellschaft auf dieser Seite wieder heiteres Leben.
»Na, meine Herren, was sagen Sie zu diesem Schlusse der Seeschlacht bei Trafalgar?«
»Großartig gemacht, Mylord, großartig!«, wurde gelacht.
»Wollte der schuftige Admiral Villeneuve mich in den Grund rammen, i, d'r Deiwel noch einmal, weiter fehlte nichts!«
»Sie sind wohl noch mit dem Abtrocknen beschäftigt?«, fragte der Franzose. »Oder gar noch im Badekostüm?«
»O nein.«
Der Lord schlug seinen Bademantel auseinander und zeigte, dass er wirklich schon wieder angezogen war — aber nur bekleidet mit seiner Menschenhautweste, Vorhemdchen, Kragen und Schlips, an den Füßen Strümpfe und Stiefeletten, die Beine hingegen waren nackt.
»Das ist mein neues Kostüm, so werde ich immer bleiben.«
»Was?! Sie wollen auch fernerhin keine Hose mehr tragen?«
»Ja, soll ich meinen braven Beinen etwa die Schmach antun, dass sie sich mit irgendeinem obskuren Stoffe umhüllen, nachdem sie zwanzig Jahre lang die Hosen des größten Seehelden mit Stolz getragen haben?«, fragte der Lord mit kläglicher Stimme.
»Wo sind denn Ihre unsterblichen Hosen?«
Der Lord brachte einen kleinen Flecken zum Vorschein.
»Das ist alles, was von Admiral Nelsons siegreicher Hose übriggeblieben ist — nur der Hosenboden — alles Übrige hat sich in Atome aufgelöst. Einem nochmaligen Siege bei Trafalgar waren diese ja dennoch irdischen Hosen nicht gewachsen. Aber«, setzte der Lord gleich mit strahlendem Gesicht hinzu, »sie haben ihre Pflicht getan — sie haben ein heldenhaftes Ende gefunden — Ehre ihrem Angedenken! Von jetzt an wird dieser Hosenboden mein größtes Heiligtum sein. Meine Beine freilich kann ich mit diesem Fetzen nicht mehr bedecken.«
»Wollen Sie denn da immer so mit nackten Beinen herumlaufen?«
»Ich kann doch von jetzt an immer solch einen Mantel tragen.«
»Das können Sie allerdings. Dann können Sie aber ebenso gut Ihre Untertanen mit einem anderen Paar Unaussprechlicher umhüllen.«
»Mit einem Paar anderer Hosen? Nie, niemals! Solch eine Schmach werde ich meinen Beinen, die ich nun einmal an Stolz gewöhnt habe, nie antun.«
»Na, da laufen Sie fernerhin im Bademantel herum.«
»Das werde ich nicht tun.«
»Dann in einem Schlafrock, in einem Talar, Kaftan oder sonst etwas Frauenhaftem.«
»Nein, ich bin gewöhnt, mit meinen Beinen frei herumzuschlenkern und wie ein Mann zu schreiten.«
»Und wollen sich dennoch keine anderen Hosen anschaffen? Dann wollen Sie also nackt gehen?«
»Auch nicht.«
»Wie wollen Sie denn dieses Problem lösen?«
»Ja, das eben ist die Kunst«, blinzelte der Lord schlau. »Aber ich will's Ihnen sagen, ich möchte sogar Ihren Rat haben. Ich werde meine Beine mit einer haltbaren, wetterbeständigen Farbe anstreichen lassen. Na, was gibt's denn da zu lachen? Sehr enge Hosen, so eng wie möglich, sind jetzt doch überhaupt Mode, dass man sich darin gar nicht mehr bewegen kann. Und ich werde die allerengsten haben und mich dennoch ganz frei in ihnen bewegen können.
Ich werde mir diese Erfindung überhaupt patentieren lassen. Sie hat ja noch viele andere Vorzüge. Diese auf die Beine gemalte Hose wird beim Baden immer gleich mit gewaschen, platzen kann sie überhaupt nicht, und entsteht in der Farbe einmal ein Riss — na, da pinselt man einfach drüber. Die Frage ist nur die, welches Muster ich wähle. Was meinen die Herren, schwarz und weiß kariert? Oder lieber gestreift?«
»Wenn Sie nun einmal Ihre Beine mit Farbe bekleistern wollen, können Sie sich doch jeden Tag ein anderes Muster anmalen.«
»Ach nein, ach nein! Sie wissen doch, wie ich bin. Ich bin treu in jeder Hinsicht. Deshalb wasche ich mich nicht einmal gern.
Wenn ich nun einmal ein Muster anmale, das muss auch etliche Jahre halten.«
Die Unterhaltung ward durch die Vorbereitungen unterbrochen, welche jetzt in der Arena getroffen wurden.
Das Wasser war abgeflossen, weiß wie Schnee lag der Sand wieder da.
»Was? Da soll wohl eine Eisenbahn gebaut werden?«
So war es. Wenigstens wurden Schienen gelegt, gleich zwei Stränge, welche aus einem Tunnel herauskamen, quer durch die Arena liefen und in einem anderen Tunnel wieder verschwanden.
Während der ziemlich zeitraubenden Arbeit des Zusammenschraubens wurde das Publikum wieder durch eine Artistentruppe unterhalten, doch genügte das nicht, um die Spannung zu verscheuchen, was man denn hier nach der gottvollen Wasserschlacht durch Eisenbahnschienen oder durch eine ganze Eisenbahn vorführen wolle. Denn ein Akt muss den anderen doch immer überbieten; nachlassen durften die Effekte wenigstens nicht, so wenig wie man nach einem guten Wein schlechteren vorsetzt. Und was für eine Überraschung wollte man dem Publikum durch eine Eisenbahn bereiten?
Nun, Jansen war schon viel zu sehr schweigsamer Inder geworden, um deshalb eine Frage zu stellen, von selbst sprach Monsieur Chevalier nicht, und der Lord hatte sich wieder nach der anderen Seite begeben, um auch dort die Herren und Damen wegen seiner anzulackierenden Beine zu Rate zu ziehen.
Das Legen der beiden Schienenstränge war beendet, in der Mitte der Arena erkannte man eine Weiche, neben ihr wurde ein Bahnwärterhäuschen aufgebaut, die Künstlertruppe verabschiedete sich unter Kusshändchen, die eigentliche Vorstellung konnte beginnen.
Aus dem Häuschen kamen der Bahnwärter und seine Frau, die beiden führten eine stumme und inhaltlose Pantomime auf, schienen sich zu unterhalten, deuteten in die Ferne, tranken aus der Pulle, machten andere Faxen.
Da ertönte an dem Bahnwärterhäuschen das Läutewerk.
Der Beamte machte noch ein paar Kapriolen, ging an die Weiche, drehte die Kurbel herum, man sah ganz deutlich, wie sich die Schienen wirklich bewegten, sich anders verbanden.
Jetzt ein gellender Pfiff, noch einer, und aus dem einen Tunnel brauste eine Lokomotive hervor, eine ganz richtige, hinter sich vier Personenwagen, vollbesetzt mit Menschen, welche fröhlich zu den Coupéfenstern nach dem Publikum winkten.
Der Eisenbahnwärter hatte mit der Flagge salutiert, dann widmete er sich nebst seiner Frau wieder der Schnapsflasche, die Pause mit Faxen ausfüllend.
Wieder ertönte die Signalglocke, der Weichensteller warf die Kurbel herum, der Zug meldete sich an, er kam von der anderen Seite angebraust, und zwar erkannte man sofort, dass es tatsächlich eine andere Lokomotive war.
Die fröhlichen Fahrgäste winkten zum Coupéfenster heraus, in aller Schnelligkeit einige komische Zwischenfälle. Aus einem Coupéfenster flogen ein Hut, ein Schirm, ein ganzer Hund heraus, und der Zug war wieder auf der anderen Seite verschwunden.
Diese Durchfahrt der beiden Züge nacheinander wiederholte sich noch mehrmals.
Dann ein Schrei des Schreckens seitens des Publikums — die beiden Züge kamen einander entgegengebraust.
Aber harmlos fuhren sie in der Mitte der Arena aneinander vorüber, nach wie vor hatten die Passagiere fröhlich zu den Coupéfenstern herausgewinkt.
Und doch — der schließliche Knalleffekt dieser Szene war wohl niemandem unklar, auch Jansen nicht.
Er rührte sich jedoch nicht, beobachtete nur immer mit starren Augen.
»Und ich mag es nicht glauben, ich mag es nicht glauben!«, flüsterte er wiederholt.
Dieses Kreuzen auf der Weiche wiederholte sich noch einmal. Die Frau kam aus dem Häuschen, mit einem Korbe, verbot dem Manne, noch viel zu trinken, ging fort, nach der Stadt.
Der Bahnwärter indessen trank nach wie vor aus der Flasche, taumelte, setzte sich vor das Haus auf eine Bank, schlief ein.
Der Signalapparat meldete einen Zug, zwei Züge. Aber der Bahnwärter ging nicht nach der Weiche, rührte sich nicht, schlief weiter.
Da kam aus dem Häuschen eine andere Gestalt hervor, ein Gerippe — der Tod mit der Sense.
Die Figur war sehr hübsch gemacht, von dem anderen Körper sah man durch Wahl einer besonderen Farbe nicht viel, nur die daraufgemalten Knochen, und in dem Totenschädel war deutlich das Grinsen zu erkennen.
Grinsend nahm der Tod neben der Weiche Platz, aber rührte die Kurbel nicht an.
Und über dem ganzen Theater lag selbst die Stille des Todes. Da kündigten sich die nahenden Eisenbahnzüge an, die Lokomotivführer erkannten die Gefahr, gellende Notpfiffe — da kamen die beiden Züge gebraust — die Passagiere hatten die Notpfiffe noch nicht verstanden, fröhlich winkten die Sonntagsausflügler aus den Coupéfenstern — da, ein schmetternder Krach, ein gellendes Heulen, eine Dampfwolke — — es war geschehen!
Die beiden Züge, diesmal außergewöhnlich schnell fahrend, waren mit voller Kraft ineinandergelaufen.
Schnell hob sich die Dampfwolke, von den explodierten Kesseln herrührend. Das Bild der Verwüstung war ein grauenhaftes.
Eine Lokomotive war über die andere gefahren, noch über die nächsten Wagen hinweg, aber nichts mehr ganz, gar nichts mehr erkennbar, alles ein wüster Trümmerhaufen von Eisen- und Holzteilen, und dazwischen menschliche Körper, Gliedmaßen noch in weitem Umkreise zerstreut.
Und nun ein entsetzliches Zetern und Wimmern!
Und auch der erwachte und von seinem Rausche kurierte Weichensteller musste seine Rolle noch weiter spielen, gebärdete sich wie ein Wahnsinniger, bis er sich an seinem Häuschen aufhing.
Dafür tauchten andere Personen auf, mit dem Leben davongekommene Passagiere, welche händeringend um die Unglücksstätte rannten, sich ebenfalls wie Wahnsinnige gebärdend, die Trümmer auseinander zu reißen suchten, während andere stumpfsinnig herumhockten, wieder andere noch außerhalb des Trümmerfeldes sich in Todeszuckungen wälzten, herumkrochen, mit Blut überdeckt — scheußlich anzusehen.
Jansen hatte alles beobachtet. Endlich kam Leben in seinen erstarrten Körper. Er sprang auf.
»Und es ist nicht wahr, und es ist nicht wahr, dass die Erde solche Bestien trägt!!!«, schrie er in einem fort.
»Was für Bestien?«, fragte Chevalier gleichmütig, sich eine neue Zigarette drehend. »Beruhigen Sie sich doch, das ist ja alles nur Täuschung!«
»Was? Täuschung?!!«
»Niemand hat seinen Tod gefunden.«
»Was?!! Dort, dort unten...«
»Es waren nur Puppen, die sich in den Wagen befanden.«
»Nein, nein, sie winkten mit Tüchern!«
»Die nur vom Luftzug bewegt wurden.«
»Nein nein, ich habe deutlich gesehen, dass es wirkliche Menschen waren!«
»Ja, zuerst. Aber jetzt zuletzt wurden sie hinter den Kulissen durch Puppen ersetzt, nur hinter den Kulissen wird so geschrien und gewimmert.«
»Und die Verwundeten dort unten...«
»Kommen nur aus den letzten Wagen, welche sich noch in den Tunnels befinden, kommen erst hinter den Kulissen hervor. Alles nur einstudierter Kram.«
Jansen musste es wohl glauben, hätte sich jetzt beruhigen können — aber er tat es nicht.
»Und doch, und doch«, stöhnte er nach wie vor, »es ist und bleibt eine Bestialität, an so etwas seine Freude zu haben!!!«
Die anderen Herrschaften dachten nicht so. Nachdem der erste Schrecken überwunden, eilten sie, von den Gastgebern dazu aufgefordert, hinab, um sich das Werk der Zerstörung eingehend in der Nähe zu betrachten.
Dass es sich nur um Puppen handelte, hatten sie vielleicht schon erfahren, und wer es noch nicht wusste, merkte es unten.
Das Trümmerfeld wurde umringt, genauer untersucht.
»Großartig, himmlisch!«
»Eigentlich hätten die Wagen auch in Brand geraten sollen«, meinte einer der Gastgeber ärgerlich, »die Vorrichtung dazu war vorhanden, scheint aber nicht funktioniert zu haben.«
»Wenn nur auch der Maharadscha herunterkommen wollte!«
Es wurde hinaufgewinkt.
»Mylord, Mylady«, lobte einer der Gäste, »dieses künstlich arrangierte Eisenbahnunglück ist das Großartigste, was ich je gesehen, mein ganzes Leben lang werde ich...«
Da abermals ein furchtbarer Knall, eine alles einhüllende Dampfwolke, aus der noch ein ganz anderes Zetergeschrei erscholl als das vorige hinter den Kulissen, viel natürlicher klingend, ebenso wie das nachfolgende Wimmern.
Die Dampfwolke verteilte sich. Jetzt waren es wirkliche Menschen, welche still dalagen oder sich unter entsetzlichem Brüllen herumwälzten.
Nur der Kessel der einen Lokomotive war bei dem Zusammenstoße geplatzt, der der anderen war unversehrt geblieben. Aber die Sicherheitsventile hatten sich verstopft, und nun war eine richtige Kesselexplosion erfolgt.
Alles, was das Trümmerfeld umstand, fast alle die sich unten in der Arena befunden hatten, waren getötet, verbrüht.
Man trug die Toten und die Sterbenden hinaus. Unter ihnen befanden sich auch Lord Hektor, Lord James, Baronet Ralph und seine Gattin, ebenso Lady Marion.
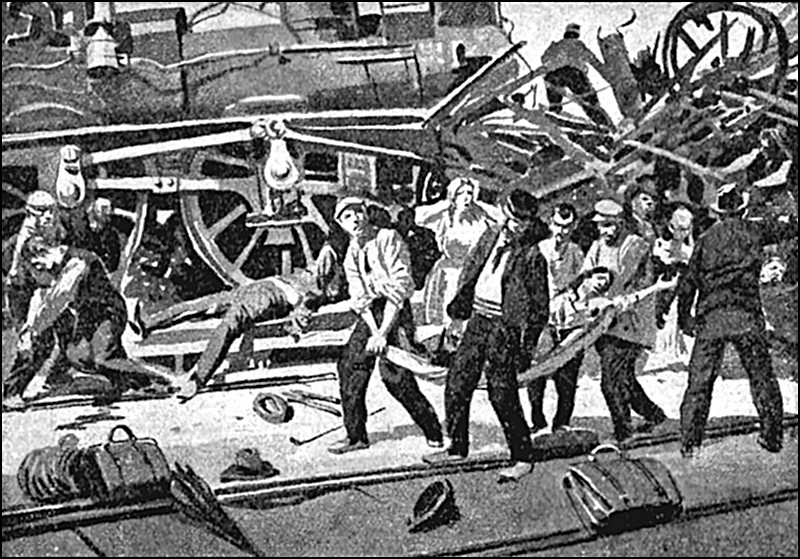
»Es rächt sich alles schon auf Erden!«, sagte Jansen erschüttert, als er das Endresultat erfuhr, sich schon wieder an Bord seines Schiffes befindend. »O Gott, du gerechter, allmächtiger Gott, du hast wieder einmal bewiesen, dass vor dir der Gedanke schon die Tat ist!«
Er hatte recht. Dem ideellen Prinzipe, dem geistigen Sinne nach, oder, wollen wir sagen, mit Gottes Augen betrachtet, war ganz gleichgültig, ob die beiden Eisenbahnzüge nur mit Puppen oder wirklich mit lebenden Menschen besetzt waren, welche dabei ihren Tod gefunden hätten.
Würden jene, welche ihre abgestumpften Nerven hatten kitzeln wollen, Menschen gefunden haben, welche sich zu so etwas gegen Geld hergegeben hätten, oder hätten sie über Leben und Tod von Sklaven zu befehlen gehabt, und hätten sie sich schließlich, durch Erziehung Kinder ihrer Zeit geworden, nicht vielleicht doch etwas vor ihrer Mitwelt geniert — — sie würden ohne Bedenken die zusammenstoßenden Züge mit lebenden Menschen besetzt haben, damit die Katastrophe gar nichts an Realität einbüße.
So hatten sie sich zuletzt mit Puppen begnügen müssen. Aber im geistigen Grunde genommen ist da kein Unterschied zu machen. In Gedanken hatten sie mit Wollust lebendige Menschen hingeopfert. Und vor Gott ist der Gedanke schon die Tat selbst.
Und dann waren sie selbst die Opfer der Katastrophe geworden!
Es rächt sich alles schon auf Erden — wenn es für uns blinde Menschlein auch nicht immer mit solch furchtbarer Deutlichkeit geschieht!
Dem Andenken Karlemanns und aller anderen Seezigeuner, welche schon auf dem Meeresgrunde ruhten, ob sie ein Andenken verdienen oder nicht!«
Mit diesen Worten, den ersten seit langer, langer Zeit, hatte Monsieur Chevalier sein dampfendes Punschglas erhoben und an den Mund geführt.
Nur Jansen folgte, diese Worte als einen Trinkspruch auffassend, seinem Beispiel. Die anderen waren viel zu faul oder nicht mehr fähig dazu.
Es war Nacht. Auf dem Kajütentisch stand die frischgefüllte Punschterrine, in der Selleriescheiben schwammen, durch geeignete Vorrichtungen festgeklemmt, wie jedes Glas und jeder andere Gegenstand, der auf dem Tische bleiben sollte, denn das Schiff bockte wie ein toller Stier, dazwischen rollte ein fast ununterbrochener Donner.
Nur die Füße des Mister Fairfax, die er auf den Tisch gelegt, hatten solch eine Befestigung nicht nötig, eher schon der Kopf Mister Rugs, der ihn schlafend zwischen die Arme gelegt hatte, und da er gegenwärtig doch nicht mehr so ganz seefest war, machte er auch im Schlafe alle Bewegungen des Schiffes mit, schusselte mit den gekreuzten Armen und mit der Nasenspitze immer auf dem Tische hin und her, in dem reichlich vergossenen Punsche herum. Der Franzose drehte, wenn er nicht, wie jetzt, mit dem Glase beschäftigt war, wie gewöhnlich sein Zigarettchen, während Lord Seymour seine Menschenhautweste flickte, die er auf seinen nackten, aber wunderschön in blau und gelb kariertem Muster bemalten Beinen hielt, und neben dem Tische stand breitbeinig Jansen und betrachtete diese ganze Gesellschaft.
Es war kein neues Bild, das er erblickte, er hätte sich eigentlich schon längst sattsehen müssen.
Seit acht Wochen befand sich die ›Indianarwa‹ wieder unterwegs, und wenn die Herren nicht schliefen oder aßen, dann saßen sie in dieser europäisch eingerichteten Kajüte um diesen Tisch, ebenso wie jetzt, in ganz genau derselben Situation, und tranken Selleriepunsch — seit acht Wochen — und schließlich ward das Schlafen und Essen auch gleich hier so nebenbei besorgt.
Kurz nach der Abfahrt von der Osterinsel hatten die Herren in einer Proviantkammer einen großen Vorrat von Sellerieknollen entdeckt, sie hatten darüber gesprochen, dass man Sellerie auch zur Herstellung von Getränken verwenden könne, und zwar nicht nur zur Bowle, sondern es gäbe auch einen Selleriepunsch. Der Versuch war gemacht worden; die Mischung hatte geschmeckt — und so tranken die fünf Herren seit acht Wochen Selleriepunsch.
Das war ihre Lebensaufgabe. Die Sache war so interessant gewesen, wenigstens im Anfange, dass Mister Fairfax darüber ganz seine Spänehobelei verlernt hatte. Jetzt begnügte er sich damit, immer die Beine auf dem Tische liegen zu haben und dazu Tabak klein zu kauen. Beiden Leidenschaften hatte er allerdings schon früher gehuldigt, und man konnte sogar als ein gefährliches Zeichen betrachten, dass er sich keine andere Beschäftigung angewöhnt hatte: ebenso wie, dass Mister Brown jetzt damit zufrieden war, die Zigarre im Munde zu haben und vor sich hinzustieren. Ja, selbst Lord Seymour wurde mit seiner Flickerei immer säumiger. Nur der Franzose und der Australier waren sich noch ganz treu geblieben: der eine drehte und rauchte Zigaretten, der andere bezechte sich und schlief seinen Rausch aus.
Chevalier hatte an seinem dampfenden Punschglase nur genippt.
»Heiß, heiß!«, sagte er.
Der Puppenkleidermacher brachte eine seiner Hände aus den Hosentaschen zum Vorschein, nahm sein leeres Glas und hielt es vor sich hin. Jansen füllte es ihm, er führte es vorsichtig an den Mund.
»Und viel zu süß!«, sagte er, hob den Fuß und warf die ganze Punschterrine um.
Kreischend fuhr Lord Seymour empor. Die kochend heiße Flüssigkeit hatte sich über seine nackten Beine ergossen, die durch die Farbe nicht geschützt wurden.
»Ich bin verbrüht, ich bin verbrüht!!«, heulte der Lord.
Man stelle sich vor, so etwas passiere in einer anderen Gesellschaft, was für eine Aufregung das gäbe, abgesehen davon, dass so ein Runks von jedem, der nicht ganz und gar ein Waschlappen ist, doch gleich geohrfeigt würde, und wenn er außer der Brust auch noch den ganzen Rücken voll Orden hätte.
Doch in einer anderen menschlichen Gesellschaft ist so etwas wohl gar nicht möglich, dass jemand aus Abneigung gegen das Getränk es gleich vom Tische wirft, ob nun mit dem Fuße oder mit der Hand — so etwas konnte eben nur hier passieren, und so war auch die Wirkung hier eine ganz andere.
Mister Rug begann, durch das Schreien im Schlafe gestört, in einem anderen Tone zu schnarchen, Mister Brown war, wohl selbst von dem heißen Punsch getroffen, nur etwas zusammengezuckt, Chevalier drehte ruhig seine Zigarette fertig, und der Übeltäter nun gar steckte einfach die Hand in die Hosentasche zurück, ohne sonst seine Stellung zu verändern.
»Pardon, es geschah nicht mit Absicht, es tut doch nicht sehr weh?«, sagte er sonst nur, wie die anderen beiden den zappelnden Lord mit Interesse betrachtend.
Nur Jansen nahm den Fall nicht so leicht hin.
»Teufel noch einmal, das war ein starkes Stück!«, fuhr er mit plötzlich rot werdendem Kopfe empor, zornsprühend nach dem Amerikaner hinüberblickend. »Wenn das...«
Er vollendete seine Drohung nicht, sondern sprang dem jammernden Lord zu Hilfe.
»Schmerzt es denn sehr?!«
»Na, ich danke; ich danke!!«, jammerte jener. »Ich bin total verbrüht...«
Mit einem Male, als der Lord noch auf seine angemalten Beine hinabblickte, begann sich jedoch plötzlich sein Gesicht zu verklären.
»Nu guckt bloß mal, was für Blasen ich hier in meine Hosen kriege!«, frohlockte er.
Und er setzte sich wieder und beobachtete freudestrahlend, wie sich auf seiner karierten Haut immer größere Blasen entwickelten, dieses Fortschreiten mit entsprechenden Bemerkungen begleitend, aber nur mit solchen einer stolzen Freude.
Ob er dabei wirklich keinen Schmerz empfand, oder was hier sonst vorlag, das hätte kein Mensch entscheiden können. Jedenfalls sah Jansen ein, dass hier kein Mitleid und keine Hilfe am Platze waren.
»Eine andere Terrine; aber nicht wieder so süß!«, kommandierte Fairfax, und damit schien die Sache erledigt zu sein.
Nur Monsieur Chevalier dachte anders.
»Mister Fairfax ist für sein Tun nicht verantwortlich zu machen, er ist wahnsinnig«, sagte er.
»Ich wahnsinnig?«
»Sie nicht allein, sondern wir alle zusammen sind wahnsinnig — geistesgestört.«
Niemand widersprach diesen Worten, eine Pause trat ein, und dann schien Mr. Brown die Ansicht aller anderen auszusprechen, als er sagte:
»Ja, das sind wir — wahnsinnig, geistesgestört.«
Er hatte recht. Der Wahnsinn braucht ja nicht nur darin zu bestehen, dass man in einer eingebildeten Welt lebt und Faxen macht. Wahnsinnig, irrsinnig — — die Maschinerie des Gehirns funktioniert nicht mehr richtig. Und bei diesen Herren traf das zu. Sie waren keine normalen Menschen mehr.
Das war ihnen trotz ihres Wahnsinns schon so oft deutlich zum Bewusstsein gekommen, dass sie es jetzt gar nicht erst bestätigten.
»Und nun fängt es an, schon gefährlich zu werden, einer gefährdet den anderen«, setzte der Franzose noch hinzu.
Wieder eine lange Pause. Nur hin und wieder ein stummes Kopfnicken.
»Ich habe die Geschichte satt!«, platzte endlich der Haarwasseronkel heraus.
»Ich auch!«, stimmte der Puppenkleiderfabrikant bei.
Sein Freund, Mr. Brown, legte auf den Tisch seine linke Hand, an der ebenfalls eine Brandblase zu sehen war.
»Mister Fairfax.«
»Und?«
»Sie haben mich verbrüht.«
»Bedaure!«
»Sie taten es mit Absicht!«
»Nein!«
»Sie taten es dennoch mit Absicht!«
»Nein!«
»Und ich behaupte: Sie taten es mit Absicht!!«
»So oft Sie das sagen, werde ich mit nein antworten.«
»Sie sind ein Esel!«
»Meinen Sie mich?«
»Ja.«
»Hm.«
»Haben Sie es gehört?«
»Was?«
»Sie sind ein Esel!«
»Stimmt, bin ich.«
»Sie sind ein Schuft!«
»Ja.«
»Sie sind ein meineidiger und wortbrüchiger Halunke!«
Mr. Fairfax schnitt sich eben ein Stück Kautabak zurecht, hielt inne und blickte aufmerksam nach dem anderen hinüber.
»Was wollen Sie eigentlich von mir, Mister Brown?«
»Soll ich Ihnen erst ins Gesicht spucken?«
»Wenn Sie sich mit mir schlagen wollen, haben Sie das nicht nötig.«
»Das will ich allerdings, aber nicht schlagen, sondern Sie töten möchte ich.«
»Zweikampf?«
»Ja.«
»Auf Leben und Tod?«
»Ja.«
»Bedaure; duelliere mich nicht mehr — wenigstens auf Waffen nicht mehr.«
»Aber noch nach der Sitte Ihres Landes?«
»Ja.«
»Well, ich habe Sie beleidigt, bestimmen Sie die Art des Loses!«
»Kopf oder Wappen. Wer den Kopf hat, hat sich durch seinen eigenen zu schießen.«
»Well!«
Mr. Fairfax griff, ohne seine Beine vom Tisch zu nehmen, in die Hosentasche, brachte eine Silbermünze zum Vorschein.
»Wer soll werfen?«
»Sie.«
»Wer ratet zuerst?«
»Ich.«
Fairfax warf die Münze in die Luft, fing sie, behielt die Hand noch geschlossen.
»Was liegt oben?«
»Wappen!«
Fairfax öffnete die Hand — oben war das Wappen zu sehen.
»Verloren«, sagte der amerikanische Puppenonkel phlegmatisch, steckte die Münze langsam in die Hosentasche zurück, brachte schneller etwas anderes heraus, setzte es gegen seine Schläfe — ein Knall, ein Feuerstrom — — die Beine lagen noch immer auf dem Tische, er hatte nur den Kopf in dem bequemen Lehnstuhl etwas mehr zur Seite geneigt, und in der Schläfe war ein Löchelchen, aus dem ein Tropfen Blut sickerte.
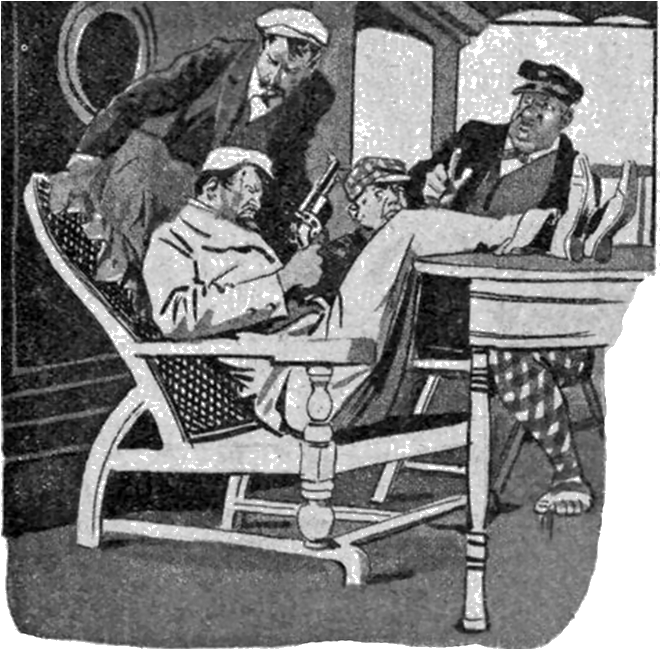
Der ihm zunächst sitzende Franzose beugte sich über ihn.
»Tot!«, sagte er gleichgültig.
»Alle Wetter, dass ging aber fix, das lobe ich mir!«, staunte der Lord.
Der Australier hob einmal etwas den Kopf.
»Verfluchte Knallerei!«, murrte er und schlief weiter.
Ja, das alles war außerordentlich schnell vor sich gegangen, schon das einleitende Zwiegespräch.
Mit weit hervortretenden Augen, als sähe er eine Geistererscheinung, blickte Jansen nach dem Toten, der also noch genau so dasaß wie zuvor.
»Es — ist — nicht — möglich!«, brachte er endlich hauchend hervor.
»Warum nicht?«, ließ sich Brown phlegmatisch vernehmen. »Ich wählte Wappen, so hatte er Kopf — also musste er sich eins vor den Kopf knallen.«
»Das ist kein Mensch mehr!«, hauchte Jansen nach wie vor. »Nein, das war er schon lange nicht mehr«, stimmte Chevalier bei. »Wir alle sind keine Menschen mehr — Sie ausgenommen, Kapitän. Deshalb sollen Sie auch am Leben bleiben.«
Er erklärte den dunklen Sinn seiner letzten Worte nicht näher. Mr. Rug hob einmal den Kopf, schien etwas zu sich zu kommen — er nahm sein Glas, griff mit der anderen Hand dorthin, wo vorhin die Punschterrine gestanden, tat, als ob er den Löffel nähme, schöpfte sich vermeintlich sein Glas voll, führte dieses zum Munde, goss die eingebildete Flüssigkeit hinunter.
»Fein«, lallte er, »etwas heiß — und süß — aber sonst fein.«
Sprach's, legte wieder den Kopf auf die Arme und schlief weiter. »Sehen Sie«, erklärte der Franzose, »der ist schon so weit, dass er in der Einbildung besoffen wird. Und ähnlich geht's uns allen. O, wir haben es herrlich weit gebracht.«
Es war, als ob erst diese Tat des hellen Wahnsinns Jansen auch das Vorangegangene zum Bewusstsein gebracht — er wandte sich plötzlich und verließ in fluchtähnlicher Eile die Kajüte, den Toten den anderen überlassend.
Auch Chevalier wollte sich wohl aller Verpflichtungen überheben, er stand auf.
»Das war der Schluss des ersten Aufzuges in dieser zweiaktigen Tragikomödie«, sagte er, »jetzt kommt der zweite Akt.«
Sprach's, und auch er verließ die Kajüte, begab sich an Deck. Er sah Jansen auf der Kommandobrücke stehen, kümmerte sich aber nicht um ihn.
Es herrschte nicht eigentlich ein Unwetter, auch die See ging gar nicht hoch, der Dampfer wurde nur tüchtig von der Seite gefasst, und dazu kamen Blitz und Donner.
Chevalier hielt einen vorübergehenden Steuermann an.
»Wo sind wir eigentlich?«
»In drei Stunden haben wir unser Ziel erreicht.«
»Was für ein Ziel?«
»Nun, Marseille«, lautete die lächelnde Antwort.
»Marseille? Den Hafen von Frankreich?«
»Gewiss.«
»Also wir sind im Mittelmeer?«
Es war sehr leicht möglich, dass keiner dieser Sportsmen wusste, dass sie sich im Mittelmeer befanden.
»Was wollen wir denn in Marseille?«
»Proviant einnehmen.«
»Hm, und was dann?«
»Die Herren wollten doch einmal die Ausgrabungen am Suezkanal besichtigen.«
»Wollten wir? Dann ist's ja gut. Wie weit sind wir von der Küste entfernt?«
»Kaum zehn Meilen, wir benutzen die nördlichste Dampferstraße.«
»Auch sehr gut.«
Chevalier ließ den Steuermann stehen, begab sich wieder in den Kabineneingang, nahm aber einen anderen Weg als den gewöhnlichen, der ihn in die eigentlichen Wohnräume gebracht hätte.
Der seine führte ihn in die Magazinabteilungen, und wenn er die Korridore und Treppen weiter verfolgte, so musste er in die Heiz- und Maschinenräume gelangen.
Bald hörte die Beleuchtung in diesen Gängen auf. Aber der Franzose musste diese Wege, welche auf Personendampfern den Passagieren verboten sind, schon öfters gewandelt sein, er fand sich auch im Dunkeln zurecht.
Vor einer Kammertür blieb er stehen, öffnete sie, und wenn wir Augen besitzen, welche das Dunkel durchdringen, so könnten wir sehen, dass es eine große Petroleumkanne war, die er dem Wandschranke entnahm.
Ganz eigentümlich, wie genau der Franzose Bescheid wusste! Gerade, als hätte er sich auf diese Petroleumflasche schon vorbereitet gehabt.
Er ging weiter, durch enge Gänge und auf Treppen und Leitern immer tiefer hinab.
Er befand sich bereits in der Unterwasserregion, im Reiche der Maschinen und Kessel.
Ein Lichtchen kam ihm entgegen. Schnell verschwand Chevalier in einem Nebengang, ließ die Heizer an sich vorüber, die auf Wache zogen.
Dann ging es immer noch tiefer hinab, bis auch er seine Taschenlaterne zu Hilfe nehmen musste,
Kohlen, nichts als Kohlen, zur Hälfte schon abgestochen, d. h., dieser Bunker, durch dessen Mitte einer der eisernen Masten ging, war schon halb geleert.
Dass diese Kohlen festliegen, durch die Bewegungen des Schiffes nicht ins Rollen kommen, das eben ist die Kunst des Kohlenstechens, welche der Trimmer oder Kohlenzieher gelernt haben muss. Denn das ist nicht nur so, Kohlen einschaufeln und nach dem Heizraum schleifen, auch das will gelernt sein, und schon mancher hat seine Unerfahrenheit mit dem Leben bezahlt, ist von den rollenden Kohlen begraben worden.
»Stimmt! Noch ganz so wie heute früh!«, nickte der Franzose zufrieden.
Und er ging sofort ans Werk. Nachdem er die Petroleumkanne und die Lampe festgesetzt hatte, dass sie nicht umfallen konnten, begann er, aus Kohlenstücken eine Art Herd aufzuschichten, Zwischenräume lassend. In wenigen Minuten war er damit fertig, betrachtete noch einmal sein Werk, wiederum zufrieden nickend, dann nahm er die große Petroleumkanne, entkorkte sie, ließ die Hälfte des Inhalts über den Herd laufen, die andere Hälfte über die zunächst liegenden Kohlen verspritzend.
Sorgsam hatte er dabei darauf geachtet, dass er nicht seine Hände mit Petroleum befleckte — nämlich deshalb, weil er sich jetzt erst einmal eine Zigarette drehte.
Hiermit fertig, zog er eine Zündholzschachtel aus der Tasche, riss ein Streichholz an, brannte sich die Zigarette an, mit tiefen Zügen den Rauch inhalierend.
Noch ein Zug, noch ein Zug — dann warf er das noch brennende Streichholz auf den durchnässten Boden.
An den Ecken der Kohlen fing das Petroleum sofort Feuer, dieses verbreitete sich schnell in die weitere Umgebung. Doch die Kohlen selbst mussten erst noch mehr Hitze bekommen.
Mit zufriedenem Kopfnicken beobachtete der Franzose das um sich greifende Petroleumfeuer, er war sich des Erfolges seiner Arbeit sicher — dabei sog er immer den Tabakrauch mit langen Zügen in die Lunge ein, in der rechten Hand die Zigarette, die linke an den eisernen Mast gelegt... da ein knatternder Knall und gleichzeitig eine den ganzen Raum ausfüllende Feuererscheinung, die nichts mit dem brennenden Petroleum zu tun hatte — in das Schiff war der Blitz geschlagen, den eisernen Mast als Weg benutzend.
Verbrecherischer Menschenwahnsinn wäre gar nicht nötig gewesen — der Himmel selbst hatte beschlossen gehabt, dieses Schiff in Flammen aufgehen zu lassen.
Jansen kam an Deck nicht dazu, seinen Empfindungen freien Lauf zu lassen.
Wie gewöhnlich hatte sein erster Blick der Takelage gegolten, wenn diese jetzt auch keine Segel führte, und erschrocken war er aufgefahren.
»Kapitän Ikomo, zum Teufel, seht Ihr denn gar nicht, dass am Großmast das St. Elmsfeuer fehlt?«
Die anderen beiden Mastspitzen zeigten jene Erscheinung, welche man St. Elmsfeuer nennt, weiße Flämmchen, welche zwar unruhig flackern, sonst aber auch vom heftigsten Sturme nicht bewegt werden.
Es ist einfach eine Ausströmung der Elektrizität, wie man sie auch zu Lande an hohen, spitzen Gegenständen, besonders bei Kirchtürmen zur Zeit von Gewittern und noch mehr kurz zuvor, beobachten kann.
Der Blitzableiter ist dazu da, die gespaltene Elektrizität, die sich in der Umgebung des Hauses in der Erde angesammelt hat, rechtzeitig auszustrahlen, sodass die darüber ziehende Wolke, positiv oder negativ geladen, keine Ursache mehr hat, den Ausgleich durch einen Funken, Blitz, zu bewirken. Befände sich hoch über dem Hause eine große Kugel, nicht durch besondere Blitzableiter geschützt, so würde sich in ihr alle Elektrizität der Umgebung ansammeln, gerade wie bei einer Leydener Flasche, hier wäre die Gefahr eines Blitzschlages am allergrößten.
Früher hat man überhaupt sogenannte Blitzableiter, von Benjamin Franklin erfunden oder doch eingeführt, gar nicht gekannt. Man sollte meinen, dass damals die Schiffe, mit ihren Masten die einzigen Erhebungen auf endloser Fläche bildend, den Blitz äußerst stark angezogen hätten. Aber das Wasser ist an sich schon ein sehr starker Elektrizitätsleiter, deshalb kam schon früher nicht allzu häufig vor, dass Schiffe vom Blitze getroffen wurden, und heute brauchen nur die an den Masten angebrachten Kupferdrähte in Ordnung zu sein, so strahlen sie die aufgespeicherte Elektrizität noch besser aus und leiten einen dennoch angezogenen Blitz unbeschadet ins Wasser.
Böse aber wird es, wenn das Schiff wohl mit Blitzableitern versehen ist, aber die Vorrichtung nicht intakt ist, wenn etwa nur der eine Mast nicht als Ableiter funktioniert, so wie es hier der Fall war, was gleich daran zu erkennen, dass an diesem das St. Elmsfeuer fehlte.
Das war von der Mannschaft nicht bemerkt worden. Schnell ging man daran, die Leitung abzusuchen. Man kam zu spät.
Als Jansen noch an dem Maste emporblickte, sah er es mit einem schmetternden Krachen an diesem herabflammen.
Einen schädigenden Einfluss auf die Umgebung hatte der einschlagende Blitz nicht gehabt, und auch sonst stand erst abzuwarten, ob er im Innern des Schiffes einen Brand verursacht habe, was durchaus nicht immer geschieht.
Ein Augenblick des Schreckens, dann wurden des japanischen Kapitäns Kommandos befolgt, um eines etwa ausbrechenden Feuers schnell Herr zu werden, Matrosen wurden zur Untersuchung hinabgeschickt.
Da kamen diese an Deck gestürzt.
»Feuer im Schiff, Feuer im Schiff!!!«, schrien sie, und die Flammen folgten ihnen fast auf dem Fuße.
Der Blitz hatte viel gründlicher besorgt, was der Franzose beabsichtigte. Dessen Petroleum hatte freilich viel mit beigetragen, gleich den ganzen Kohlenbunker in ein Feuermeer zu verwandeln, und solch ein Brandherd konnte nicht mehr gelöscht werden.
Eine kurze Bemühung, die Kohlenbunker unter Wasser zu setzen, dann musste alle Hoffnung aufgegeben werden.
»Klar bei den Rettungsbooten!«, donnerte Jansens Stimme. »Kapitän, klar bei den Booten!«
Der japanische Kapitän aber verschränkte die Arme über der Brust, und die ganze Mannschaft mit ihm.
Die nachfolgenden Szenen lassen sich nicht beschreiben. Wohl wurden die siebenhundert, jetzt schlafenden Menschen geweckt, wohl kamen sie an Deck gestürzt — aber als sie erkannten, dass das ganze Schiff in Flammen aufgehen würde, dachten sie an keine Flucht mehr — sie fingen an zu singen, von Brahma, Vishnu und Shiva, allen voran Toghluk, und priesen die Götter, die ihnen diesen Tod in den Flammen bereiteten.
Jansen hatte sein Möglichstes getan, um diese Inder und Japaner zur Rettung anzutreiben. Alles vergeblich, und gegen solch eine Menschenmenge konnte er allein ja gar nichts ausrichten. Er vermisste Eloha, noch viele andere Weiber, hauptsächlich auch die Kinder, wollte nach deren Räumlichkeiten und musste vor den Flammen zurückweichen.
Als er wieder an Deck erschien, hatte er auf dem Rücken eine große Blechrolle hängen. Sie barg seine Manuskripte.
An Deck waren Brown und Lord Seymour beschäftigt, ein Boot auszusetzen.
»Kommen Sie mit, Kapitän?«, wurde ganz gemütlich gefragt.
»Wo ist Mr. Rug?«, schrie Jansen.
»Den konnten wir nicht mit heraufbringen, der ist zu sehr besoffen.«
Es rette sich, wer kann! Und Jansen wollte sich retten, der Selbsterhaltungstrieb war zu stark in ihm. Den Franzosen hatte er ganz vergessen.
Als die drei abstießen, schlugen die qualmenden Flammen schon über allem, was sich an Deck befand, zusammen, und doch erscholl noch immer das jauchzende Loblied zu Ehren Brahmas, Vishnus und Shivas.
Jansen war wieder frei, Herr seiner selbst. Er musste nur noch das Land gewinnen. Der Himmel hatte ausgeführt, was Chevalier beabsichtigt.
Wir machen — wolle der geneigte Leser nicht erschrecken — einen Sprung von vierzehn Jahren. An der Südküste von Frankreich, zwischen Toulon und Cannes, liegt dort, wo die Seealpen vor einer großen Ebene zurücktreten, ein isoliertes Waldgebirge, l'Esterel genannt, drei geografische Meilen lang und zwei breit, bestanden mit Fichten und Korkeichen, aber auch mit anderen, welche, wie in fast ganz Italien, essbare, süße Eicheln tragen, wie auch diese Fichtenart in ihren Zapfen wohlschmeckenden Samen hat, wozu dann noch der nie fehlende Johannesbrotbaum und die Edelkastanie kommen.
In diesem mächtigen Walde, der ohne jede Arbeit einige tausend Menschen ernähren könnte, durch den sich auch die von Napoleon angelegte Heerstraße hinzieht, gibt es nur ein einziges kleines Dorf mit kaum hundert Einwohnern, Logis l'Esterel, mit dem dazugehörenden Schlosse, in dem sich jetzt die Oberförsterei befindet.
Heute ist dieser ganze Wald Staatseigentum, da lässt sich diese Unbenutztheit des reichen Bodens erklären; der Fiskus will dem Lande seinen größten Wald als Rarität erhalten, hat es nicht nötig, verkauft nichts, zieht kaum Nutzen aus dem Holze, lässt nur das nötige schlagen, sorgt nicht einmal für Wege und Bequemlichkeit für Spaziergänger oder Durchreisende.
Weshalb aber dieses mächtige Waldgebiet schon früher niemals Kolonisten gefunden hat, als es noch Privatpersonen gehörte, die sogar sehr oft nur zu gern Land verkauft hätten, um zu Gelde zu kommen, das werden wir gleich erfahren.
Dieses Waldgebirge war schon seit Jahrhunderten im Besitze der uralten Familie der Grafen von Esterel gewesen, welche, wie schon angedeutet, in ihrer letzten Ahnenreihe sich in fortwährenden Geldverlegenheiten befunden hatten, trotz dieses riesigen Waldbesitzes.
Der letzte Besitzer, mit dem unsere Erzählung in diesem Schlusskapitel wieder anhebt, war Graf Alexander d'Esterel, der sich durch eine reiche Heirat wieder aufgeholfen hatte, und nun bot ihm auch noch die französische Regierung für Abtretung seines Waldes etliche Millionen, und Graf Alexander konnte das Anerbieten ruhig annehmen, seinetwegen brauchte sich kein Ahne im Grabe herumzudrehen; denn der kinderlose Graf war der letzte seines Stammes.
Bevor er den Wald abtrat, wollte er ihn noch einmal besuchen, noch einmal in ihm der Jagdlust frönen, nicht allein, sondern er hatte eine Anzahl Gäste eingeladen.
Die Zusammenkunft fand in Marseille statt, und die Gäste hatten Freunde mitgebracht, welche dem Grafen erst vorgestellt werden mussten.
Unter ihnen auch ein Kapitän Higgin, der einen amerikanischen Dampfer führte, jetzt in Marseille liegend, nebst seiner jungen Gattin, die er mit an Bord hatte — gewissermaßen Hochzeitsreise.
Als die junge Frau den schon ältlichen Grafen sieht, schrickt sie zusammen, dann bricht sie in Weinen und Jammern aus, kann sich gar nicht wieder beruhigen.
Allgemeine Bestürzung! Auch der Graf ist sich nicht im Geringsten bewusst, die junge Dame schon früher gekannt zu haben.
Endlich kann Mrs. Higgin hinter ihrem Taschentuche auch vernehmbare Worte hervorbringen.
»Einer von uns achtundzwanzig, o Gott, o Gott!«
Diese Worte mehren nur noch das Rätsel. Der Gatte, Kapitän Higgin, hätte wohl gleich eine Erklärung geben können, aber er ist gerade nicht zugegen.
»Von den achtundzwanzig? Was meinen gnädige Frau damit?«
»Sie hingen in der Wante festgefroren!«, wird weitergeschluchzt.
Da aber fährt auch der Graf empor, plötzlich todesblass werdend.
»Was?! Sie meinen doch nicht — den Untergang der ›Frankia‹ bei Portsmouth?«
»Auch ich war auf dem Schiffe«, erklingt es schon etwas gefasster.
Das Rätsel ist gelöst, aber nur ein größeres ist hinzugekommen. Fünfzehn Jahre ist es her, die jetzige Mrs. Higgin war ein vierjähriges Kind, als sie den fürchterlichen Untergang der ›Frankia‹ mitgemacht, und sie hat immer ihrem Gatten gegenüber behauptet, dass sie jeden einzelnen Menschen noch heute wiederkennen würde, der damals auf dem Deck gegen die eisigen Wogen gekämpft hatte.
Außerordentlich natürlich hat sie allerdings die einzelnen Vorgänge immer schildern können, besonders auch, wie die ›Sturmbraut‹ unter Kapitän Jansens Führung angekommen war — aber dass sie noch jeden einzelnen Menschen gleich wiederzukennen vermöge, das hatte ihr der Gatte oder ein anderer nie geglaubt.
Jetzt hat sie den Beweis der Wahrheit geliefert. —
Von Marseille ging es bis nach Toulon mit der Eisenbahn, von hier mussten Wagen benutzt werden.
Das frisch aufgerührte Unglück der ›Frankia‹, wobei das vierjährige Kind die Mutter, Graf Alexander den Bruder verloren hatte, beherrschte natürlich ausschließlich das Gespräch. Alles, alles wurde noch einmal vorgenommen, und in Toulon beim Frühstück galt das erste Glas dem Kapitän Richard Jansen und seiner heldenhaften Mannschaft.
Auch bei der Wagenfahrt wurde dieses Gespräch fortgesetzt. Es war ja unerschöpflich. Erst als man in den herrlichen Wald drang, änderte sich das Thema.
»Wie ist nur möglich, dass dieser Wald so verödet ist?«
»Weil hier ein Waldteufel haust.«
»Ein Waldteufel?«
»Haben Sie noch nichts von dem Waldteufel von Esterel gehört?«
»Nein«, antworteten diejenigen, denen diese Einladung ganz unvermutet kam, und aus Gefälligkeit gegen sie erzählte der Graf die sonst ziemlich bekannte Geschichte noch einmal ganz ausführlich.
An dieser südfranzösischen Küste, Riviera di Ponente genannt, haben seit Menschengedenken See- und Landräuber gehaust. Das ist tatsächlich ganz merkwürdig. Zuerst die Ligurer, die sich den Griechen als Seeräuber furchtbar machten. Sie wurden von den Römern vertrieben, die aber bald den Langobarden unterlagen, welche wiederum als Räuber Land und See unsicher machten. Dann erfolgte wieder eine politische Umwälzung, durch welche der ganze Küstenstrich an das genuesische Geschlecht der Grimaldis kam, dessen letzter Spross der jetzige Fürst von Monaco ist. Und diese Grimaldis sind von jeher Seeräuber gewesen. Das darf man offen sagen; denn das steht in der Chronik, die man in Monte Carlo zu kaufen bekommt. Nun, und was ist denn heutzutage der Fürst von Monaco? Der plündert noch immer lustig die Reisenden aus, die zu Lande und zu Wasser in sein Gebiet kommen.
Da war im 15. Jahrhundert auch so ein wackerer Kämpe, der von seiner Seefestung aus alles unsicher machte, zugleich ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Lucanus soll er geheißen haben. Aber als Räuber weniger edel. Er nahm den Reisenden nicht nur die Habe, sondern zog ihnen auch die Haut vom lebendigen Leibe ab. Ein alter Eremit, der in diesem Walde hauste, hatte ihm schon oft mit der Rache des Himmels gedroht. Und als der Graf einmal einen Nebenbuhler auf den Rücken eines wilden Hirsches schmieden ließ, war endlich das Maß seiner Schandtaten voll.
Der fromme Eremit sprach einen Fluch über ihn aus. Bis in alle Ewigkeit solle der Graf in diesem Walde rastlos wie ein wildes Tier hausen, und der Wald selbst, damals noch von vielen Dörfern belebt, sollte veröden, zur Wildnis werden — nur die Geburtsstätte des Eremiten, jenes Dörfchen, jetzt Logis de l'Esterel genannt, am Fuße des MontVinaigre, solle von diesem Fluche verschont bleiben.
»Und so geschah es«, fuhr der Erzähler fort. »Der Graf verschwand unter den Lebenden, um als Waldgeist wieder aufzutauchen, der die Bewohner des Waldes dermaßen schreckte, dass nach und nach alles auswanderte, bis auf die Bewohner jenes Dörfchens, das von dem Waldteufel verschont wurde. Und so ist es noch heute. Es ist Tatsache, in Chroniken verbürgt, dass sich in früherer Zeit oft Fremde in diesem Walde angesiedelt haben, aber sie alle haben ihn wegen des Waldteufels wieder verlassen. Auf diese Weise wurde dieser ungeheure Wald meinen Vorfahren ein ganz wertloser Besitz, einem unspaltbaren Diamanten vergleichbar, dessen Wert niemand bezahlen kann, und dasselbe galt ja auch noch von mir. Jetzt endlich hat mich der Staat von dieser Last befreit.«
Besonders die Amerikaner schüttelten ob solchen Aberglaubens im aufgeklärten Europa stark den Kopf, obwohl sie sich an der eigenen Nase hätten zupfen sollen.
»Ist er denn schon einmal gesehen worden?«, wurde gefragt.
»Fortwährend wird er gesehen, vor Jahrhunderten und heute noch, manchmal in Pausen von Monaten, manchmal täglich.«
»Haben Sie ihn selbst schon gesehen?«
Der Graf lächelte über diese Frage der Amerikaner.
»O nein, ich lasse mich nicht durch die Flechten der Korkeichen täuschen!«
»Also nur Baumflechten sind es?«
»Selbstverständlich! Die Fabel ist nun einmal da, die Gestalt genau beschrieben — da hilft sich die Phantasie von allein.«
»Wie soll er denn aussehen?«
»Ein riesiger Mann mit langem, weißem Bart und Haar, mit krallenartigen Fingern, ganz verwildert, nur in Tierfelle gehüllt, manchmal aber auch ganz nackt.«
»Tut er denn den Menschen etwas?«
»Wenn das geschähe, dann würde bald der Beweis seiner Existenz oder Nichtexistenz erbracht sein. Nein, er begnügt sich damit, die Waldbewohner zu schrecken, und seine Erscheinung soll so fürchterlich sein, dass sie schon genügte, um den ganzen Wald zu entvölkern.«
»Da, da!!«, schrie Mrs. Higgin plötzlich entsetzt auf, mit der Hand nach einer großen Eiche deutend, die dicht an der Landstraße stand.
Erschrocken fragte man sie, was sie denn gesehen habe.
»Den Waldteufel — ein Menschengesicht mit langem, weißem Bart und glühenden Augen — dort oben zwischen den Zweigen — und ich glaube, er winkte mir.«
»Jawohl, nun fange du auch schon an!«, lachte ihr Gatte.
Die Zitternde, die sonst aber durchaus nicht nervös oder schreckhaft sein wollte, wurde beruhigt. Das könne nur ein Gebilde der Korkeiche gewesen sein, und sie glaubte es schließlich, lachte über sich selbst.
»Sehen Sie, so kann die menschliche Phantasie selbst am helllichten Tage arbeiten«, setzte der Graf noch hinzu. »Übrigens kann er es gar nicht gewesen sein, denn der Waldteufel nähert sich dieser Landstraße nur bis auf eine gewisse Entfernung, betreten darf er sie nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Damit nicht auch die durch den Wald wandernden Fremden von ihm geängstigt werden. Dafür hat jener weitsichtige Eremit gleich gesorgt. Das ist ja eine alte Römerstraße, Napoleon hat sie nur wiederhergestellt. Wie stark aber der Glaube an den Waldteufel ist, das sehen Sie an den Kreuzen, welche überall zu Seiten der Straße errichtet sind. Napoleon fand zum Baue dieser Waldstrecke keine Arbeiter. Sie fürchteten sich vor dem Waldteufel. Der freidenkende Napoleon musste einen Bischof kommen lassen, der die Arbeiter durch Segenssprüche schützte; er ließ überall auch gleich diese Kreuze errichten, und so ist diese Straße noch heute vor dem Waldteufel geschützt, er darf sich ihr nicht einmal nähern.«
Das Dörfchen war erreicht, der Graf, welcher vorläufig noch immer der Herr war, wurde mit seinen Gästen von den Bewohnern mit vorschriftsmäßiger Freude empfangen, der Schulze redete eine Rede, dann ging es in das Schloss, wo sich die Gäste nach der anstrengenden Fahrt zur Ruhe zurückzogen, während der Graf erst einmal den Bericht des Oberförsters anhörte.
Viel zu berichten hatte der ja nicht. Brief empfangen, alle Vorbereitungen zur Jagd getroffen.
»Aber Treiber bekommen wir nicht.«
»Warum nicht?«
»Der Waldteufel spukt mehr denn je.«
Der Oberförster erzählte. Er war länger als zehn Jahre hier angestellt, hatte den Waldteufel von seinem Vorgänger mit übernommen. Gespukt hatte dieser Geist also schon immer im Walde, aber wie er es in der letzten Zeit trieb, das war mehr, als die Polizei erlaubt.
Innerhalb des letzten Monats war er von dreiundzwanzig Personen gesehen worden, welche der Oberförster namentlich anführen konnte.
»Jetzt treibt er sich immer hier in der Nähe des Dorfes herum, die alte Ursy hat ihn erst vorgestern gesehen, wie er am hellen Tage über eine Waldwiese ging.«
Aufmerksam blickte der Graf den akademisch gebildeten Oberförster an.
»Mir kommt fast vor, als ob Sie selbst an diesen Waldteufel glauben.«
Der Oberförster zuckte die Schultern.
»Ja, man wird fast gezwungen, dies zu tun.«
»Haben Sie selbst ihn gesehen?«
»Nein, aber die Aussagen aller derer, die ihn gesehen haben wollen, lauten gar zu übereinstimmend.«
»Wie soll er denn aussehen?«
»Ein alter Mann mit langem, weißem Barte und ebensolchen Haaren, in Felle gehüllt...«
»Und mit krallenartigen Nägeln. Einer schwatzt einfach dem andern nach.«
»Nein, Herr Graf, es muss etwas daran sein.«
»Wieso?«
»Ich befand mich vorgestern in der Försterei, als die alte Ursy schreiend unter allen Zeichen des Entsetzens angelaufen kam und ihre Begegnung mit dem Waldteufel erzählte. Früher habe ich niemals etwas auf derartige Gespenstergeschichten gegeben. Aber ich war doch stutzig geworden. Ich also sofort hin mit meinen besten Hunden. Eine Spur war nicht zu erkennen, wohl aber fanden die Hunde eine Fährte, d. h., sie benahmen sich ganz sonderbar, heulten ängstlich, liefen hin und her, wollten aber die Fährte nicht aufnehmen.«
»Hm. Haben Sie Hunde, welche sonst die Fährte eines Menschen verfolgen?«
»Gewiss, einige.«
»Und auch die weigerten sich?«
»Unter allen Zeichen der Angst.«
»Hm. Haben Sie einmal daran gedacht, dass ein Wilddieb die Maske des Waldteufels benutzen kann, um ungestört sein Handwerk treiben zu können? Und es gibt ja Mittel, um jedem Hunde die Spur zu verleiden.«
»Herr Graf, ich glaube kaum, dass jemand in diesem Walde Wilddieberei zu treiben wagt, und nun gar noch unter der Maske des Waldteufels.«
»Oho! Es gibt auch aufgeklärte Köpfe.«
»Ich habe noch nichts von den Spuren eines Wilddiebes gemerkt.«
»Nun gut. Ich will mir die Sache überlegen.«
Als der Graf mit seinen Gästen wieder zusammenkam, erzählte er diesen nichts von dem Berichte seines Oberförsters.
Am späten Nachmittage erging sich Mrs. Higgin in der Umgebung des Schlosses, an das der Wald, ohne in einen Park umgewandelt zu sein, dicht heranreichte.
Als sie so die kaum noch erkennbaren Wege einher wandelte, hörte sie ein leichtes Geräusch, und als sie seitwärts blickte, gewahrte sie eine Gestalt, deren Anblick wohl auch das Herz des mutigsten Mannes hätte erzittern machen.
Eine riesige Gestalt, der weiße Bart bis zur Brust gehend, die Haarmähne, ebenfalls schneeweiß, bis auf die Schultern, die Haut des ganzen Körpers lederartig, nur ein Stück Fell um die Hüften geschlungen — mehr sah Mrs. Higgin nicht, nur noch, dass dieses menschliche Ungeheuer mit nach ihr ausgestreckten Händen, an der wirklich zolllange Nägel zu sehen waren, auf sie zuschlich... dann floh sie unter gellendem Geschrei wieder dem Schlosse zu.
Ihrem Berichte durfte man keinen Unglauben mehr entgegensetzen. Sie konnte die Stelle, wo sie das Ungeheuer gesehen, ziemlich genau beschreiben. Graf Alexander sofort mit Förstern und Hunden hin, auch die meisten der Herren schlossen sich an.
Ja, die Hunde zeigten wiederum eine Fährte an, weigerten sich aber unter allen Zeichen der Angst, sie zu verfolgen. Resultatlos musste man zurückkehren. Nur die Förster fuhren fort, die Umgegend zu durchstöbern.
Von jetzt an drehte sich das Gespräch natürlich nur um den Waldteufel. Es wurde die Behauptung aufgestellt, dass es nur ein Mensch sein könne, der sich einmal in diesem großen Walde verirrt habe und darin gänzlich verwildert, zum Tiere herabgesunken sei. Solche Fälle sind in den großen Urwäldern Amerikas, Afrikas und Asiens allerdings oft genug vorgekommen, aber hier in diesem französischen Walde, umgeben von der höchsten Kultur, durch den eine Landstraße führt, dicht am belebten Meere gelegen?
Diese Ansicht stieß doch auf großen Zweifel. Aber an einen Wahnsinnigen konnte man eher glauben.
Am anderen Morgen saß die Gesellschaft auf der Veranda beim Frühstück, besprechend, wie man nicht auf Hirsche und Wildschweine, sondern auf diesen Waldteufel pirschen, wie man seiner habhaft werden wolle, als die anwesenden Hunde ängstlich anschlugen, und da sah man sie schon selbst, dieselbe Gestalt, wie Mrs. Higgin und alle Dorfbewohner sie beschrieben hatten.
Das menschliche Ungeheuer schaute halb aus einem Gebüsch hervor, und kaum sah es sich bemerkt, als es wie flehend die Hände hob und langsam hervorkam, mit den Bewegungen eines wilden Tieres auf die Veranda zuschlich.
Der Schreck der Gesellschaft lässt sich denken. Doch lange währte er nicht. Zwei Herren sprangen auf, wollten hin — da floh das Ungeheuer wieder zurück.
»Er wollte zu uns, lasst ihn gewähren, wir wollen ruhig sitzen bleiben.«
So geschah es, und bald kam der Waldteufel wieder zum Vorschein, schlich sich abermals näher, immer mit solch bittenden Handbewegungen, ab und zu auch niederkniend und so erst recht stehende Bewegungen machend.
So kam er bis dicht an den Tisch heran, und zwar hatte er es direkt auf Mrs. Higgin abgesehen, wollte sie zärtlich streicheln. Freilich wich die junge Frau entsetzt vor den braunen, haarigen, mit langen Krallen bewehrten Pranken zurück, aber die Annäherung war nun doch einmal hergestellt, der Mann ließ sich ruhig von den übrigen untersuchen.
Noch einmal zu beschreiben brauchen wir ihn nicht, haben höchstens noch hinzuzusetzen, dass sich seine Haut, immer aller Witterung preisgegeben, in eine Art braunes Leder verwandelt hatte. Zu sprechen vermochte er nicht, konnte nur tierähnliche Laute ausstoßen. Besondere Merkmale fehlten an seinem Körper, und nur an der starken Muskulatur und an den vollzähligen, blendendweißen Zähnen konnte man erkennen, dass es noch kein so sehr alter Mann sein könne, wie er es nach seinen weißen Haaren hätte sein müssen.
Die Hauptsache aber war, dass er es ausschließlich auf Mrs. Higgin abgesehen hatte, und diese war nicht etwa die einzige junge Dame in diesem Kreise. Ob er die in verschiedenen Sprachen an ihn gestellten Fragen verstand, wusste man nicht, unausgesetzt forderte er sie mit flehenden Zeichen auf, ihr zu folgen, in den Wald hinein; wenn aber die Herren ihm folgen wollten, so drückte er aus, dass er damit nicht einverstanden sei.
Endlich erklärte sich die mutige Frau bereit, ihm zu folgen. Der Waldmensch wollte doch offenbar jemanden dorthin führen, wo man nähere Aufklärung über sein Geheimnis bekam, und er hatte es eben mit dem Instinkt eines Tieres gerade auf sie abgesehen. Die Herren konnten ja mit Förstern unbemerkt folgen, ein Schuss aus ihrem Revolver würde ihr sofort Hilfe bringen.
So folgte Mrs. Higgin dem vorausschreitenden und immer winkenden Ungeheuer in den Wald hinein, wohl zwei Stunden weit, die Gegend wurde immer gebirgiger, sie kroch ihm sogar durch ein Gebüsch nach, wo nur er einen Durchgang zu finden wusste, und dann öffnete sich vor ihr eine Höhle.
Eine Lagerstätte aus Fellen, Vorräte an Eicheln, Kastanien und Nüssen — dann machte sich der Waldmensch im Hintergrunde der Höhle zu schaffen, brachte einen eisernen Koffer zum Vorschein, öffnete ihn, Mrs. Higgin sah eine Menge beschriebener Papiere, nahm das erste, brauchte nur die ersten Zeilen zu lesen...
»Mein Gott — Sie sind doch nicht etwa... der Kapitän Richard Jansen?!«
Da zuckte es wieder so seltsam in dem bärtigen Gesicht des Waldmenschen, wie es schon manchmal geschehen, wie ein Krampf ging es durch die Züge, und da plötzlich brachen aus seinen Augen Tränen hervor, und mit menschlicher Stimme laut weinend, warf er sich zu Boden nieder.
»Ich bin es!«
Er hatte die Sprache wiedergefunden, die Erinnerung; gleich hier in der Höhle erzählte er, wie er damals bei der Katastrophe der ›Sturmbraut‹ nicht seinen Tod gefunden hatte, sondern von der ›Indianarwa‹ aufgenommen worden war, wie er jener stellvertretende Maharadscha gewesen sei, wie das indische Schiff hier an der französischen Küste in Flammen aufgegangen war.
Nur zwei seiner Freunde entkamen mit ihm im Boote dem Flammentode. Das Boot wurde von der Strömung nach Osten gerissen, langes Hungern und Dursten, dann ein Sturm, der das Boot zum Kentern brachte.
Lord Seymour und Brown mussten dabei ihren Tod gefunden haben, die letzten beiden Seezigeuner. Denn nie hat man wieder etwas von ihnen gehört.
Jansen aber rang stundenlang mit den Wogen, auf dem Rücken den Blechkoffer, der sogar wie eine Schwimmblase wirkte.
Endlich erreichte er eine mit Wald bedeckte Küste. Merkwürdigerweise hielt er sie zuerst für die algerische, die stellenweise ebenfalls stark bewaldet ist.
Bald erkannte er seinen Irrtum. Doch wohin nun? Jansen hatte keine Lust, sich wieder unter Menschen zu begeben. Dazu kam wieder seine ganze Gemütsverfassung. Er war wirklich schon dem Wahnsinne nahe. Jedenfalls menschenscheu bis zum höchsten Grade.
Er erkannte, was für ein großer Wald das war, und ob er nun beschloss, in diesem zu hausen, oder ob es unfreiwillig geschah — kurz, er sollte ihn nicht wieder verlassen.
Er floh jedes Haus, jeden Menschen, sogar die Landstraße, wollte das Meer nicht mehr erblicken; er hätte sich Waffen verfertigen können, um Wild zu erlegen, aber das hätte Spuren hinterlassen, ebenso wie jede Feuerstelle: so nährte er sich nur von Wurzeln und Früchten, nur das Fell eines gefallenen Tieres wagte er zu benutzen — und eben durch diese übergroße Vorsicht sank er selbst zum Tiere herab — die Fabel war zur Wirklichkeit geworden, die Gegend hatte ihren lebendigen Waldteufel erhalten.
Gestern hatte er sich zufällig nach der Landstraße verirrt. Immer darauf bedacht, keine Spur zu hinterlassen, war er schon zum wirklichen Menschenaffen geworden, der lieber auf den Bäumen von Ast zu Ast wandert als auf dem Erdboden, und so hatte er von einem Baume aus die Equipage gesehen. Da hatte er eine Gestalt erblickt, die mächtige Erinnerungen in ihm rege gemacht — Mrs. Higgin. Ob er sich wirklich noch an das vierjährige Kind erinnert, das er einst von der ›Frankia‹ gerettet, das freilich konnte er nicht sagen.
Kurz, diese junge Frau war es gewesen, die ihn so mächtig daran erinnert, was für ein unglückliches Geschöpf er doch sei, kein Mensch mehr, nur noch ein Tier — da auch hatte er zum ersten Male gemerkt, dass er schon die Sprache verlernt habe. Und so hatte er sich jener Gesellschaft genähert, der Mrs. Higgin, um sich ihr anzuvertrauen.
Es war geschehen. Und als er hörte, dass er schon vierzehn Jahre hier so lebe, da brach bei ihm noch einmal der ganze Jammer hervor.
Und dann flehte er sie an, nicht den anderen zu verraten, wer er sei. Wohl wolle er fort von hier, wieder ein Mensch werden, aber nicht wieder ein Richard Jansen. Als solcher habe er sein Leben abgeschlossen.
Mrs. Higgin sagte zu. Die Sache wurde arrangiert, der Koffer mit den Manuskripten anderswo versteckt, die Gesellschaft herbeigerufen.
Jetzt spielte Jansen mit Absicht den wilden Mann, stellte sich taubstumm. Er hatte die junge Frau, für die er einmal eine besondere Vorliebe besaß, nur hierher geführt, um ihr seine Höhle zu zeigen.
Dann folgte er der jungen Frau wie ein Hund nach, jetzt und immerdar. Der Fall musste angezeigt werden, aber vergebens mühten sich die scharfsinnigsten Detektivs und Gelehrten ab, in den Fall Aufklärung zu bringen.
Schließlich war es ja auch ganz einfach: eben ein Schiffbrüchiger, der hier gestrandet, in dem großen Walde verwildert war.
Dann wurde er freigegeben, folgte dem Kapitän Higgin und dessen Gattin auf ihr Schiff.
Auf diesem hat Jansen viele Jahre zugebracht, aber sich nicht an der Führung oder Arbeit beteiligend, sondern als einsamer, schweigsamer Mensch, dessen vieles Schreiben von den anderen für eine Art von Irrsinn gehalten wurde.
Als Mrs. Higgin dann den Gatten verließ, um sich an Land der Erziehung ihrer Kinder zu widmen, folgte ihr Old Dick, wie er genannt worden, auch dahin. Aber er war und blieb nach wie vor menschenscheu.
Einige Jahre später scheiterte Kapitän Higgin und fand seinen Tod bei Rolandsriff; seine edle Gattin ließ an dieser gefährlichen Stelle einen Leuchtturm errichten, und Old Dick erbat sich die Gunst, der Wächter dieses Leuchtturmes zu werden, als Gehilfen einen taubstummen Neger wählend.
Hier also hat unser Held, der letzte Seezigeuner, noch zehn Jahre gehaust, noch immer seine Erinnerungen niederschreibend, und als ihm der Tod die Feder aus der Hand genommen, da hatten seine letzten Gedanken noch immer seiner Blodwen gegolten.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.