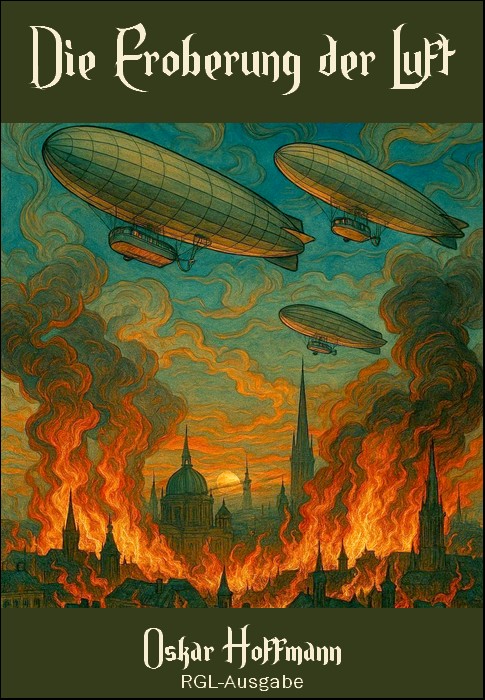
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
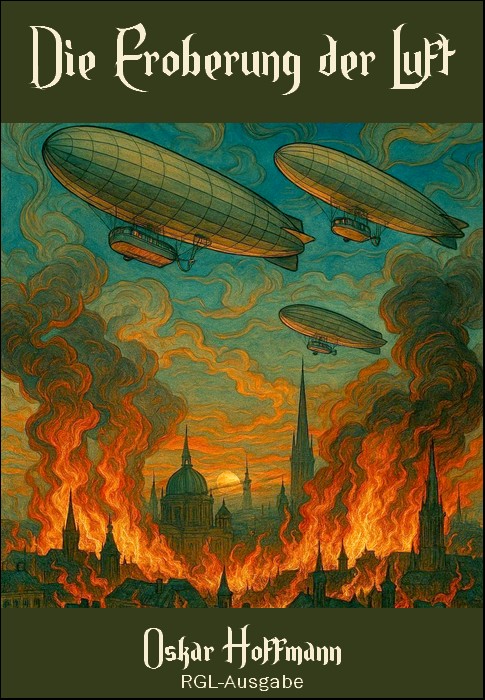
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
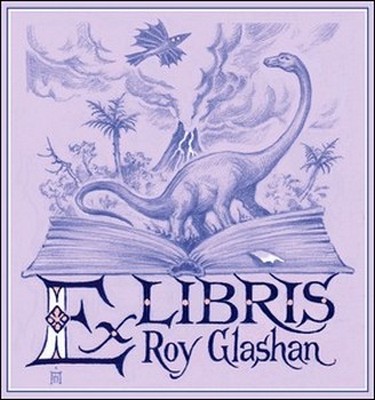
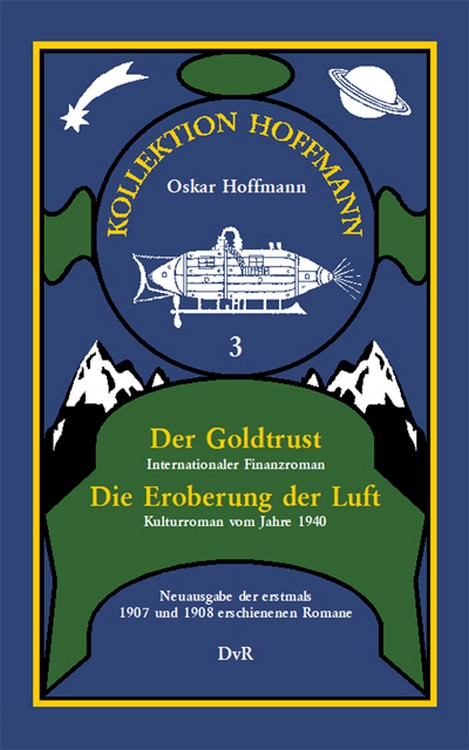
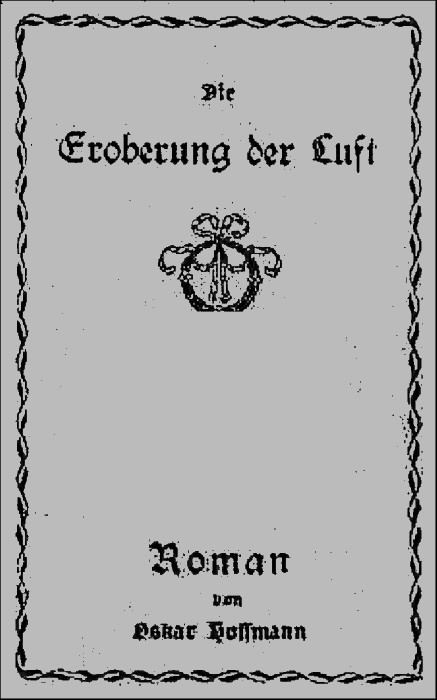
Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft
(Champion-Romane. Bd. 2).
Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger o.J.
[wahrscheinlich 1. Aufl. 1908],
Einbanddeckel einer gebundenen Ausgab
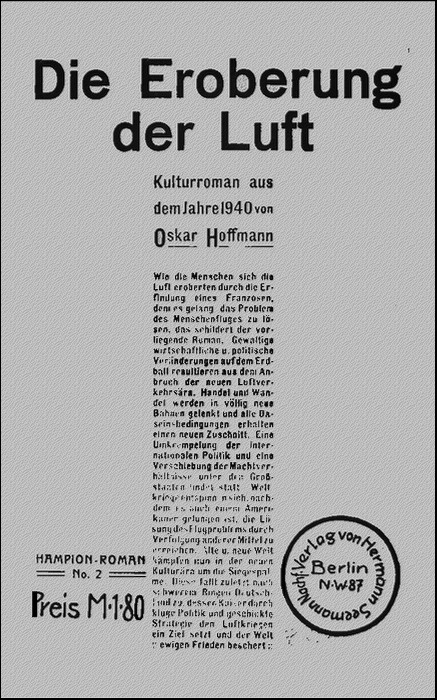
Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft
(Champion-Romane. Bd. 2).
Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger o.J.,
Einbanddeckel einer broschierten Ausgabe
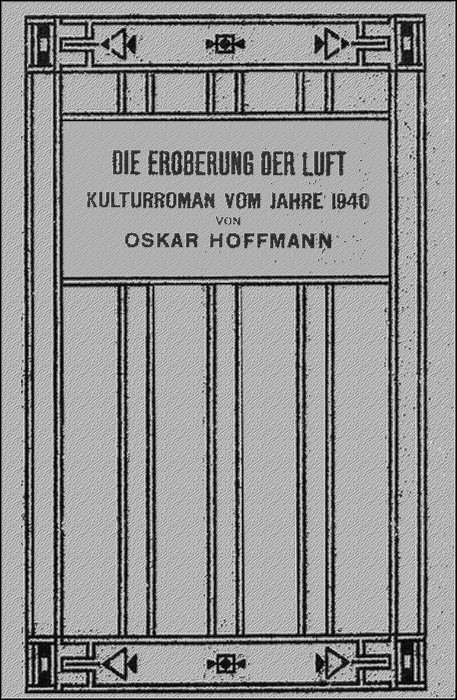
Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft
(Champion-Romane. Bd. 2).
Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger,
7. Aufl. o. J. [1908], Einbanddeckel.
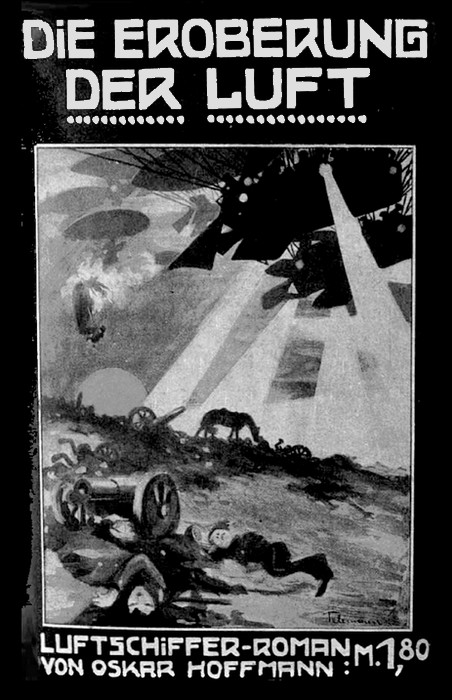
Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft
(Champion-Romane. Bd. 2).
Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger o.J.,
Einbanddeckel einer broschierten Ausgabe
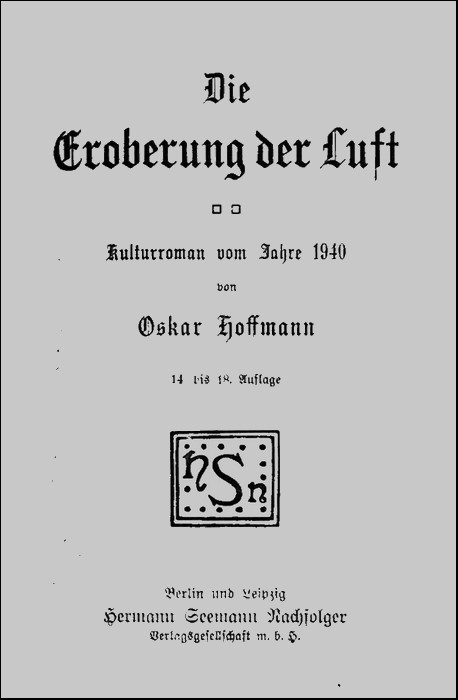
197
Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft
(Champion-Romane. Bd. 2).
Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger,
14.-18. Aufl. o.J. [1910],
Titelseite (S. 3, unpaginiert)
Jahrtausende hindurch hat der Mensch die Segler der Lüfte, die Vögel, beneidet, wenn dieselben im blauen Luftozean dahinschwebten. Wer sich wie ein Adler über die höchsten Alpengipfel mühelos zu erheben vermöchte — mit solchem Wunsche haben sich in jedem verflossenen Säkulum der Erdgeschichte gar viele Sterbliche getragen. Als das Jahr 1782 hereingebrochen war, da sollte sich der jahrtausendalte Wunsch zum ersten Male für die Menschheit erfüllen. Montgolfier trat zu dieser Zeit als Pionier einer zukünftigen Aeronautik vor seine Mitwelt in die Schranken.
Mit seinem Ballon, der Montgolfière, sollten zwei zum Tode Verurteilte einen ersten Aufstieg in die Lüfte unternehmen. So hatte es König Ludwig XVI. bestimmt. Über dieses Dekret des Souveräns ergrimmte ein Edelmann namens Pilâtre de Roziers. Zwei elende Verbrecher sollten den Erstlingsruhm genießen, in den Lüften zu segeln? Nein! — Der Monarch mußte umgestimmt werden. In heller Begeisterung für die grandiose und erhabene Erfindung seines Landsmannes flehte Pilâtre de Roziers Ludwig XVI. an, ihm und seinem Freunde, dem Marquis d'Arlandes, den ersten Aufstieg in der Montgolfière zu gestatten. Der König willigte schließlich ein, und es fand zunächst ein erster Probeversuch in der Weise statt, daß sich Pilâtre de Roziers mit einem durch erhitzte Luft gefüllten Ballon, welcher an Stricken gehalten wurde, 30 Meter über den Erdboden erhob. Einige Wochen später fand dann eine Luftreise in einem freischwebenden Ballon statt.
Die nötigen Vorbereitungen dazu hatte man im Garten de la Muette, nahe dem Boulogner Walde, in Gegenwart des versammelten Hofes getroffen. Nach einer Fahrt von fünfundzwanzig Minuten waren dann die kühnen Luftschiffer an der entgegengesetzten Seite von Paris, nahe der Mühle von Croulebarbe, wieder gelandet. Ihr Ballon war mit erhitzter Luft gefüllt gewesen; dazu befand sich in der Mitte des Ballons eine Pfanne, auf der sie von Zeit zu Zeit ein Bündchen Stroh verbrannt hatten, um die Ausdehnung der Luft zu unterhalten. Man sieht leicht ein, wie gefährlich dieses Verfahren war, da sich das Feuer jeden Augenblick dem Ballon mitteilen konnte. Einige Tage später wurde dann das Experiment von de la Muette im Tuileriengarten durch den Physiker Charles und die Gebrüder Roberts wiederholt, aber nicht mit Hilfe jenes gefährlichen Strohfeuers, das die erste Luftfahrt zu einem fast schrecklichen Schauspiel gemacht hatte, sondern mittels Wasserstoffgases.
Zu jener Zeit waren dann noch zahlreiche Luftschiffahrten unternommen worden. Einen traurigen Ausgang hatte unter anderen die, bei welcher der unglückliche Pilâtre de Roziers sein Leben einbüßte. Er hatte, um weit genug fahren und nach Belieben fallen und steigen zu können, eine Montgolfière mit einer Charlière verbunden. Sein Apparat fing aber Feuer, und der unglückliche Luftschiffer stürzte aus bedeutender Höhe nieder und wurde zerschmettert. Dann fiel der Luftschiffer Blanchard seinem Flugversuche zum Opfer. Dieser fuhr am 7. Januar 1785 in Begleitung des Doktors Jeffries zum ersten Male über den Kanal von Dover nach Calais, woselbst man ihm zur Erinnerung an diese Luftfahrt ein Denkmal errichtete. Übrigens waren diese beiden Luftschiffer damals nahe daran, ins Meer zu fallen und erreichten die französische Küste nur, nachdem sie allen Ballast, Instrumente und zuletzt ihre Kleidungsstücke ausgeworfen hatten, wodurch der Ballon erleichtert wurde.
Wie der Leser ersehen hat, hatte also die Wiege der Aeronautik im belle La France gestanden, und der Zufall wollte es nun, daß etwa zweihundert Jahre später wiederum denen jenseits der Vogesen der Ruhm zufallen sollte, durch Erfindung eines elektrischen Luftvehikels die Ära eines wirklichen Luftverkehrs zu eröffnen.
Zwei Säkulen hindurch hatten sich Menschen aller Kulturstaaten und Berufe abgemüht, ein lenkbares Luftschiff und eine Flugmaschine zu konstruieren. Erst nach Anbruch des Jahres 1900 gelang es, eine Lenkbarkeit der Luftfahrzeuge zu erzielen und letztere dadurch unmittelbar von jeder Luftströmung unabhängig zu machen. Männer, wie Santos Dumont, Zeppelin, Lebaudy und andere waren mit neuen Ballonkonstruktionen bahnbrechend hervorgetreten. Ihren später verbesserten Konstruktionen folgte dann die französische Flugmaschine, und mit deren Erfindung im Jahre 1940 begann die grandiose Ära des Luftverkehrs. Seine Hoheit der Mensch war von da ab nicht mehr an den Boden gefesselt, auf den ihn einstmals der Schöpfer gestellt hatte.
Brechen wir nun hier den Faden unserer Vorrede ab und schweifen über in das Gebiet und die Zeit, in der die vorliegende Erzählung spielt.
Der Schauplatz der folgenden Begebenheiten, der Ort, der in den Annalen der Aeronautik allzeit als Geburtsstätte des Menschenfluges gelten sollte, hieß Auteuil, ein Vorort von Paris, der aber bereits zum Weichbild des Seinebabels gerechnet wurde.
Dort, wo die Baumwipfel an der Lisière des Bois de Boulogne einander zurauschten, daß auf der Erde eine neue Kulturepoche hereinbräche, dort gaben sich an einem sonnigen Frühlingstage eine Anzahl hochangesehener Männer ein Rendezvous.
Monsieur Chapelle, Marquis d'Espingal, Verkehrsminister Villemain, René Lemonnier und die Rektoren der École polytechnique und der École centrale des arts et manufactures, Crébillon und Mercier, waren nach Auteuil herübergekommen, um mit noch anderen hochstehenden Persönlichkeiten in Gegenwart des Helden des Tages, Victor de Saint-Martin, aeronautische Beratungen zu pflegen.
Monsieur de Saint-Martin, dem die Menschheit den Anbruch einer neuen Kulturära zu verdanken hatte, war durch seine Erfindung des Menschenfluges mit einem Schlage aus den Reihen obskurer Techniker in den Vordergrund getreten und wurde von seiner Mitwelt gebührend angestaunt und verehrt.
Das war alles so plötzlich gekommen. Monsieur de Saint-Martin hatte nämlich einen neuen elektrischen Akkumulator erfunden und diesen sofort in praxi bei einer von ihm schon früher konstruierten Flugmaschine angewandt. Diesem seinem Tun entsprang nun eine große Weltumkrempelung. Der Verkehr sollte damit in neue Bahnen einlenken und ließ im voraus Perspektiven gewahren, deren Parallelen ins Endlose zu verlaufen schienen.
Besagte Herren Deputierten hatten sich in dem Gebäude der internationalen aeronautischen Gesellschaft zusammengefunden und waren im Begriff, im Konferenzzimmer eine für alle Kulturstaaten wichtige Beratung zu pflegen.
Der Vorsitzende des Aeroklubs, François Levasseur, ein erfahrener, technisch durchgebildeter Mann, nebenbei gesagt von hochgewachsener Gestalt und leicht ergrautem Haar, hatte das Präsidium in der kleinen Versammlung inne.
»Monsieur de Saint-Martin ist leider noch nicht erschienen,« ließ sich Levasseur vernehmen, als die anwesenden Herren sich gegenseitig begrüßt hatten und sich eben auf Sitzen niederließen, um in die Debatte einzutreten. »Ich habe sogleich einen Boten nach seiner Wohnung entsandt und hoffe bestimmt, daß wir auf sein Erscheinen rechnen können.«
Levasseur hatte, wenn er sprach, immer etwas schnarrendes in der Stimme, er befleißigte sich auch stets langsam zu sprechen, da er ein Mann von dem Schlage derer war, welche jedem gesprochenen Worte einen gewissen Wert beimessen. So kam es denn, daß alles, was über Levasseurs Lippen kam, stets, wie man zu sagen pflegt, Hand und Fuß hatte. Diese Eigenheit war ihm immer zum Vorteil gereicht, ein übereilig gesprochenes Wort konnte ihn nie schädigen, weil er eben ein solches niemals aussprach. Es ist nötig, dies hier so eingehend hervorzuheben, da die Eigenheit, seine Rede stets wohl zu erwägen, Levasseur als einen unbedingt glaubwürdigen Mann hinstellte. Nicht zum wenigsten hatte er ihr den hohen Posten, den er als Präsident des Aeroklubs einnahm, zu verdanken.
»Ich möchte vorschlagen,« fuhr Levasseur fort, »unsere Verhandlungen nicht eher zu beginnen, als bis Monsieur de Saint-Martin zur Stelle ist.«
»Sehr richtig.« echote die klangreiche Stimme des Verkehrsministers Villemain.
»Wir können ja einstweilen die neuen Satzungen des Aeroklubs einer näheren Betrachtung unterziehen,« meinte Marquis d'Espingal.
Da die anderen Herren diesem Vorschlage zustimmten, so erhob sich Levasseur wieder, nahm ein vor ihm liegendes Schriftstück zur Hand und ließ sich wie folgt aus:
»Meine Herren. Nachdem die bisherigen Satzungen des französischen Aeronautenklubs durch die geniale Erfindung de Saint-Martins für die Bestrebungen des Klubs nicht mehr gut verwendbar sind und weil sich unsere Vereinigung zu einer internationalen Gesellschaft umgestempelt hat, war es an der Zeit, neue Statuten zu entwerfen. Die Mitglieder des Aeroklubs haben unter meinem Vorsitze die wichtigsten Punkte der neuen Satzungen versuchsweise festgelegt, und es handelt sich jetzt darum, ob der Entwurf in den Grenzen, in denen er sich bewegt, allseitige Zustim>mung findet.«
»Lassen Sie hören, wie die Paragraphen formuliert worden sind,« entgegnete der Verkehrsminister und verschränkte seine Arme, eine Stellung die er gern einnahm, wenn er einer wichtigen Ausführung andächtig folgen wollte. Villemain ähnelte etwas Monsieur Levasseur insofern, als auch er ein Freund großer Bedachtsamkeit war. Anderseits ließ ihn sein cholerisches Temperament aber nur zu leicht die Grenzen einer wohl erwogenen Rede überschreiten, so daß er mitunter doch recht unbedachte Worte hervorstieß. Solche ihn überkommende Momente ärgerten den Verkehrsminister hinterher immer gewaltig.
»Die neuen Satzungen des internationalen Aeroklubs enthalten vorläufig nur die wichtigsten Paragraphen,« begann Levasseur und schlug das Schriftstück in seiner Hand auseinander. »Eine internationale Kommission wird zu dem Entwurf Stellung nehmen müssen ..._«^
Hier wurde Levasseur durch den Verkehrsminister unterbrochen. »Ich hoffe, daß die einzelnen Paragraphen so zugeschnitten sind, daß Frankreich als das Prioritätsland die Vorteile daraus schöpfen kann, welche ihm gebühren,« warf Villemain dazwischen und der Tonfall seiner Worte klang sehr bestimmt, ja fast scharf.
Der Präsident verneigte sich vor dem Sprecher.
»Sehr wohl, Herr Minister,« versetzte Levasseur. »Alles ist so formuliert, daß Frankreich ohne Zweifel dabei auf seine Rechnung kommt.«
Villemain nickte befriedigt.
»Paragraph eins,« fuhr Levasseur fort, »regelt von vornherein Frankreichs Vormachtstellung und verleiht uns das Recht, die Satzungen der internationalen Aerogesellschaft jederzeit zu ändern, sobald Mißstände gezeitigt werden, die Frankreich unmittelbar schaden.«
»Ich möchte doch bezweifeln, daß die internationale Kommission diesen Passus unverschnitten läßt,« warf Marquis d'Espingal sonoren Tones ein und kraute sich mit den wohlgepflegten Fingern in seinem Henriquâtre, dabei nach dem Verkehrsminister hinüberschielend.
Ha! wie machte sich da das cholerische Temperament Villemains schnell einmal Luft. »Wir schreiben vor und die anderen müssen sich nolens volens fügen!« rief Villemain.
Der Präsident des Aeroklubs wagte hierauf nichts zu erwidern. Er begann ein wenig mit den Augenbrauen zu zucken und hielt es für geraten, diesen heiklen Paragraph schnell zu verlassen und auf den folgenden überzugehen.
»Paragraph zwei handelt von dem aeronautischen Völkerrecht,« fuhr Levasseur schnarrenden Tones fort.
»Bei diesem Paragraph kann es leicht zu niedlichen Auseinandersetzungen in der internationalen Konferenz kommen,« meinte mit leichtem Sarkasmus René Lemonnier, ein bekannter Dozent der Sorbonne in Paris.
Villemain, der Verkehrsminister, zuckte gleichgültig mit den Achseln.
»Paragraph drei,« sagte Levasseur weiter, »regelt die aeronautischen Handelsbeziehungen.«
»Wie man die Zollgrenzen oben im Luftmeer markieren will, das erscheint mir vorläufig noch recht schleierhaft,« warf Monsieur Chapelle ein.
»Die Zollgrenzen — — — hm — —« versetzte Villemain und wiegte seinen Kopf ein wenig hin und her. Dieser Punkt erschien ihm tatsächlich auch recht heikel.
»Wir können doch weder blauweißrote Grenzpfähle noch Trikoloren in die Luft rammen,« sagte mit leichtem Spott Chapelle. »Die Auslandszölle werden wohl unbedingt fallen müssen oder der Schmuggel wird im größten Maßstabe seine Blüten treiben.«
»Verzwickte Sache,« meinte Villemain, dem es jetzt erst so recht klar zu werden schien, vor welch schwierigen Aufgaben Staat und Gesellschaft standen, um eine völlige Neuordnung aller kulturellen Beziehungen so günstig durchzuführen, daß man sich dabei nicht ins eigene Fleisch schnitt.
»Die neue Ära gibt uns jetzt Nüsse zu knacken auf,« meinte Mercier, der Rektor der École centrale des arts et des manufactures.
Crébillon, sein Kollege von der École polytechnique, stimmte ihm mit einem lebhaften Kopfnicken bei.
»Die Ära des Luftverkehrs wird zunächst einmal Handel und Wandel in gräßlichste Unordnung bringen,« meinte Monsieur Chapelle.
»Ja, der Ansicht bin ich auch. Es wird alles drunter und drüber gehen,« ließ sich Lemonnier vernehmen. »Ich bin fest überzeugt, daß die nächsten Folgen gewaltige kriegerische Verwicklungen zwischen allen Kulturländern sein werden.«
»In der Erkenntnis dessen,« erwiderte der Verkehrsminister, »müssen wir bei der Festsetzung der Satzungen eben ganz besonders vorsichtig verfahren. Vorläufig haben wir das Heft noch in der Hand. Uns gehört die Flugmaschine und das Geheimnis ihrer Konstruktion, und darum können wir den anderen Bedingungen vorschreiben, die wenigstens uns vor Krieg und sonstigen Verwicklungen schützen.«
Da die einzelnen Paragraphen hinsichtlich ihrer Details zunächst nicht zur Debatte kommen sollten, so ging Levasseur dazu über, den Inhalt des vierten Paragraphen anzuschneiden.
»Meine Herren! Der Paragraph vier regelt die Rechte von Privatpersonen, soweit sich dieselben auf die Luftsäule über ihrem Besitztum beschränken.«
»Nach oben hin gibt es da wohl keine Grenze,« spöttelte wieder Monsieur Chapelle und suchte die Wirkung seiner Worte auf den Gesichtern der Anwesenden abzulesen. Besonders heftete sich sein Auge auf Villemain, der für die Zukunft mit allen möglichen neuen Grenzen zu rechnen hatte, wollte er sich in seinem Ressort behaupten und sich die Dinge nicht über den Kopf wachsen lassen.
Diesmal aber hatte Villemain einen Trumpf zur Entgegnung in der Hand. »Die natürliche Grenze der Atmosphäre über uns,« sagte er, »bildet auch die Grenze für jedes Lebewesen, für jeden Staat.«
»Dieser unumstößlichen Tatsache muß ich beipflichten,« erwiderte der Präsident des Aeroklubs und schickte sich an, nachdem er wieder einen Blick in das Schriftstück, welches er in der Hand hielt, geworfen hatte, auf den nächsten Paragraph der Satzungen überzugehen. »Nun der Paragraph fünf. Er verlangt ein internationales Schiedsgericht für Streitigkeiten öffentlicher Natur, sofern sich solche aus dem neuen Luftverkehr ergeben. Frankreich fordert ein für allemal den Vorsitz in der schiedsgerichtlichen Kommission.«
»Der Paragraph wird in dieser Fassung kaum genügen,« warf Villemain ein.
»Ich bin derselben Ansicht,« fügte Monsieur Chapelle hinzu, »und bin außerdem noch der festen Überzeugung, daß sich alle Kommissionsmitglieder sicher nach den Fleischtöpfen der selig entschlafenen Haager Friedenskonferenz herzlich sehnen werden.«
Diese witzige Auslassung entlockte allen mit Ausnahme des immer streng denkenden Villemain ein Lächeln.
»Ein sechster Paragraph,« fuhr Levasseur fort, »sichert ein für allemal Frankreich das Prioritäsrecht in allen übrigen Dingen, welche aus der neuen Verkehrsära entspringen und nicht unter den einen oder den anderen Paragraphen dieser Satzungen fallen.«
»Das ist wohl der vernünftigste Paragraph von allen,« meinte Villemain zufriedengestellt. »Darin ist doch wenigstens klipp und klar gesagt, daß wir in allen Streitfällen obenauf schwimmen.«
Während man sich nun in einen Gedankenaustausch über die einzelnen Paragraphen erging, wobei Villemain das Wort führte, Levasseur gesunde Anschauungen äußerte, Monsieur Chapelle spöttelte und Lemonnier sarkastische Bemerkungen machte, erschien plötzlich der Held des Tages auf der Bildfläche, de Saint-Martin, der Stolz der Franzosen.
In Anbetracht der gewaltigen Rolle, welche dieser Mann durch seine Erfindung des Menschenfluges spielte, empfiehlt es sich hier, dessen Persönlichkeit einmal einer Kritik zu unterwerfen.
Viktor de Saint-Martin, mütterlicherseits von deutscher Abkunft, verkörperte äußerlich einen Durchschnittsmenschen. Nicht groß, nicht klein, nicht dick, nicht mager, besaß er auch keine außergewöhnlichen Merkmale, die irgendwie auf höhere geistige Qualitäten oder gar auf sein Erfindergenie hätten deuten können. Das blasse Gesicht zierte keine Denkerstirn, und das einzige Regelmäßige in demselben bildete die wohlgeformte Nase. Ein paar blaue Augen blickten unter wenig buschigen Brauen freundlich in die Welt und hatten sich schon manche Freunde auf der Erde erworben. Nicht zum wenigsten mochten sie auch ein Merkmal dafür bilden, daß in de Saint-Martins Adern ein gut Teil deutsches Blut rollte. Wer die Charaktereigenschaften dieses zu Anfang der Dreißiger stehenden Mannes näher kannte, schätzte dieselben, denn de Saint-Martin war ein Mensch, den die Mutter Natur mit einer Anzahl guter Eigenschaften ausgestattet hatte. Dessenungeachtet besaß er aber auch einige Fehler und diese bestanden in zu großer Gutmütigkeit, die sehr oft falsch am Platze war, und, was in gar keinem Verhältnis zu seinem sonstigen Wesen stand, in einer sich zeitweilig äußernden Rücksichtslosigkeit gegen seine Mitmenschen. Letztere Eigenschaft trat jedoch nur dann in Erscheinung, wenn er seine Gutmütigkeit einmal gründlich mißbraucht oder verkannt sah, oder, was eigentlich noch öfters der Fall war, wenn man sein sanguinisches Temperament gelegentlich recht stark erregte, dann kam es in der Regel zu einem plötzlichen Aufbrausen, welches sich dann für Augenblicke in großer Rücksichtslosigkeit gegen jedermann urkräftig äußerte. Im allgemeinen war de Saint-Martin aber ein besonnener und ruhiger Mensch, und sein Benehmen zeigte sehr oft eine gute Dosis Harmlosigkeit und Naivität, weshalb man gern mit ihm verkehrte. War er bisher als der Typus eines Durchschnittsmenschen angesehen und danach behandelt worden, so hatte sich das mit einem Male geändert, sobald das Erfindergenie dieses Mannes vor die ganze Welt in die Schranken trat. Die ihn gekannt, hatten die Köpfe geschüttelt, als sie von seiner verkehrsumstürzenden Erfindung hörten. So etwas hatte ihm niemand zugetraut, und als die Erfindung des Menschenfluges sich als unumstößliche Tatsache erwiesen hatte, da wußten die Freunde de Saint-Martins, was sie an diesem Manne hatten. Rasch wurde er der Held des Tages und sein Name der populärste auf dem Erdball, einen Marconi, Edison und andere weltberühmte Geister in den Schatten stellend.
»Seien Sie gegrüßt!« rief Villemain und beeilte sich, dem Eintretenden, der in Gesellschaft eines jüngeren Mannes kam, entgegenzukommen und ihm die Hand zu drücken. Der sonst so stolze Minister versäumte es nicht, sich gegen de Saint Martin möglichst herablassend und herzlich zu benehmen. Er rechnete im stillen damit, daß ihm dies sicher Früchte tragen werde.
»Ich habe mich etwas verspätet. — — Die Herren werden entschuldigen,« begann nach allseitiger Begrüßung de Saint-Martin. »Man ist wohl inzwischen auch ohne mich fertig geworden.«
»Sie kommen gerade zur rechten Zeit,« versetzte der Präsident des Aeroklubs und nötigte den Ankömmling, sich auf den von ihm bisher eingenommenen Platz zu setzen.
»Mein verspätetes Kommen werde ich jetzt durch Mitteilung einer Neuigkeit wieder wettmachen,« sagte de Saint-Martin.
Alle horchten gespannt auf.
»Meine Herren. Es wird Sie überraschen, wenn ich Ihnen mitteile, daß ich meiner Erfindung noch eine neue hinzufügen kann, und zwar repräsentiert diese eine Vorrichtung, welche den Aufenthalt des Menschen auch in den allerhöchsten Luftregionen ermöglicht, so daß also ein Aufstieg über zehntausend Meter keine Gefahr für den Fliegenden mit sich bringt.«
Diese Mitteilung überraschte die Anwesenden natürlich auf das Höchste.
»Das verleiht Ihrer Erfindung einen erhöhten Wert,« meinte Villemain. »Darf man erfahren, wie die Vorrichtung beschaffen ist? Oder wollen Sie die Details geheimhalten?«
»Vorläufig, ja,« versetzte de Saint-Martin. »Ich möchte erst die neue Erfindung erproben, ehe ich sie der Öffentlichkeit überweise. In Anbetracht der von mir gemachten Mitteilung möchte ich Ihnen hier meinen Mitarbeiter vorstellen, durch dessen Hilfe ich erst in den Stand gesetzt worden bin, die neue Verbesserung meiner Flugmaschine durchzuführen. Darf ich die Herren bekannt machen — Monsieur Walther Bögelshausen — Monsieur Villemain, Mitglied des französischen Ministerrates — Marquis d'Espingal — Monsieur Chapelle — Monsieur Lemonnier — und hier Monsieur Crébillon und Mercier.«
Der Neuvorgestellte wurde von allen Seiten mit unverhohlenem Mißtrauen betrachtet, da sowohl sein Name als auch sein Äußeres nur zu deutlich deutsche Abkunft verrieten. Und da man gegen alles Deutsche eine Voreingenommenheit hatte und gerade auch augenblicklich, wo so große Umwälzungen bevorstanden, sich am wenigsten von den unliebsamen Nachbarn jenseits der Vogesen ins Handwerk pfuschen lassen wollte, so blieb es nicht aus, daß jener Bögelshausen hier auf eine kühle Reserve stieß.
Jetzt, wo die Hauptperson zur Debatte zur Stelle war, wurde sofort in dieselbe eingetreten, wobei außer der Beratung der Paragraphen auch über den Ankauf der Erfindung durch die französische Regierung Worte gewechselt wurden.
Zum Schluß — die Debatte nahm einen für den Regierungsvertreter günstigen Abschluß — kam de Saint-Martin nochmals auf seine neueste Verbesserung der Flugmaschine zu sprechen. »Meine Herren!« schloß er mit gehobener Stimme seine Ausführungen. »Der Menschenflug in den Regionen des luftverdünnten Raumes dürfte der Wissenschaft wohl sicher neue Aufschlüsse physikalischer und meteorologischer Natur bringen. Ob es dann noch gelingen wird über die Peripherie der Atmosphäre hinaus einmal ins Weltall zu schweifen, vermag ich augenblicklich noch nicht zu sagen, rechne aber solches nicht zu den Unmöglichkeiten.«
Die Anwesenden erfaßte jetzt so etwas wie Begeisterung, als ihnen de Saint-Martin dieses Zukunftsbild entrollte.
Der Menschenfuß nicht mehr an die Erdscholle gebannt! Dem Schöpfer ein Schnippchen geschlagen, der sicherlich nie im Sinn gehabt hatte, daß sich die Erdenbürger noch einmal im ungeheuren Universum herumtummeln sollten.
Die neue Ära war angebrochen, und was sie noch alles zeitigen konnte, das vermochten selbst gewiegteste Geister nicht im entferntesten auszudenken. Die Lösung des Problems des Menschenfluges gab der Kultur einen solchen Ruck, daß für Augenblicke die Welt aus den Angeln gehoben schien. Verschwommen, wie im Nebel liegend, sahen die Menschen ein neues Dasein vor ihrem geistigen Auge sich eröffnen. Und was die neue Ära schon jetzt ahnen ließ, sollte alles eintreffen und noch weit mehr.
Einige Wochen waren seit der denkwürdigen Konferenz des Aeroklubs dahingerauscht, als die Welt bereits ganz im Zeichen des Luftverkehrs stand. Parlamente, Zeitungsredaktionen, Handelskorporationen und sonstige Körperschaften, welche öffentliche Interessen in bezug auf Handel und Industrie vertraten, sowie zahlreiche ihre Interessen wanken sehende Privatpersonen erörterten bang Tag für Tag, was der neue Luftverkehr im großen und im kleinen zeitigen werde.
So gewaltig die Menschheit auch ihre neueste Errungenschaft bezeichnen durfte, so groß war aber auch nun ihre Sorge angewachsen, denn keiner wußte, was das Heute oder Morgen für Mißstände noch bringen konnte.
Wie ein Festland in diesem Gedankenozean nahm sich der einstweilig angenommene Satzungsentwurf des internationalen Aeroklubs aus und bot für den irrenden Menschen den einzigen Boden, auf dem er augenblicklich festen Fuß zu fassen vermochte.
Paris — nein, ganz Frankreich war durch die geniale Erfindung de Saint-Martins so halb in einen Taumelzustand versetzt.
Aus aller Herren Ländern waren Deputierte eingetroffen. um die technische Errungenschaft der Franzosen an Ort und Stelle zu besichtigen. Vor allem waren die Luftschifferkorps sämtlicher Militärstaaten durch abgesandte Offiziere vertreten. Daneben waren aber auch Ingenieure und Techniker gekommen, um einen Blick in de Saint-Martins Fluggeheimnisse zu werfen und womöglich die Erfindung daheim nachzuahmen. Doch in Frankreich war man schlau genug, solche Leute nicht zu tief in Dinge sehen zu lassen. welche vorläufig noch Geheimnis bleiben sollten.
Am 13. Dezember sollte in Paris der große internationale Aerodynamikerkongreß stattfinden, auf welchem eine besondere Kommission den Satzungsentwurf des Aeroklubs zu beraten hatte, damit die neuen Verkehrsbeziehungen zwischen allen Staaten eine einheitliche Regelung erführen. Diesem Kongreß sollte sich dann ein Festmahl anschließen, welches eine Art Verbrüderungsmahl bilden sollte.
Daß gerade der Dreizehnte des Monats gewählt worden war, schien manchen abergläubischen Leuten wie ein böses Omen, und rasch fanden sich welche, die da prophezeiten, daß die neue Ära der Untergang des Weltfriedens sei. Die Stimmen dieser Schwarzseher verhallten aber ohne von jemand irgendwie ernst genommen zu werden.
Der Weltkongreß, dessen Präsidium Villemain, der französische Verkehrsminister, und de Saint-Martin inne hatten, tagte also an dem ominösen Dreizehnten und verlief allseits zufriedenstellend bis auf einige nicht klar zu stellende völkerrechtliche Punkte. Die Vertreter der fremden Staaten hatten Vollmacht, Frankreich alle Prioritätsrechte zuzusichern, sofern dieses die Lösung des Flugproblems öffentlich bekannt gäbe, so daß der Luftverkehr mit den neuen Fahrzeugen allerorten auf Erden betrieben werden könne.
Da es den Franzosen darauf ankam, daß ihnen in jeder Beziehung das Prioritätsrecht im Luftverkehr zugestanden wurde, so konnten schwierige Fragen auf dem Weltkongreß schnell gelöst werden, nachdem man allseits auf Frankreichs Wünsche eingehen wollte.
Villemain war über den günstigen Ausgang des Kongresses hocherfreut. Er hatte sich eigentlich die Sache gar nicht so leicht abwickelbar vorgestellt. Mit Grauen hatte er vorher an die Regelung des einen oder anderen Punktes gedacht und hatte im Geiste schon zahllose Verwicklungen gesehen, die Frankreichs Prioritätsrecht nahezu illusorisch zu machen schienen. So sah man denn den französischen Verkehrsminister in recht rosiger Laune in Begleitung de Saint-Martins zu dem internationalen Festmahl gehen.
Das große Mahl der Aerodynamiker fand im Elysée an der Faubourg St. Honoré statt und sollte für alle Teilnehmer eins der glänzendsten Feste sein, die es in Paris jemals gegeben hatte.
Der Speisesaal des prächtigen alten Palastes war mit duftenden, kostbaren Blumen schier übersät. Inmitten zahlreicher, mächtiger Topfpalmen, blühender Oleander, saftgrüner Schlinggewächse, unter den eine Lichtflut ausstrahlenden gewaltigen Deckenlustren zogen sich riesenhafte Tafeln durch die ganze Länge des Saales hin. Auf ihnen prangte herrliches Silbergeschirr aus der ehemaligen Kaiserzeit, kostbarstes SêvresPorzellan, goldköpfige Flaschen und reicher Chrysanthemen- und Orchideenschmuck. Drei Infanteriekapellen stellten die Tafelmusik. Ihr Programm bestand aus fast allen Nationalhymnen der bei dem Festmahl vertretenen Kulturstaaten.
Im Verlauf des lukullischen Festmahles erhoben sich die Vertreter der Großmächte und feierten den Helden des Tages, de Saint-Martin, welcher an der superben Tafel selbstverständlich den Ehrensitz einnahm.
Auf der Haager Friedenskonferenz von Anno dazumal konnte nicht mehr von tiefstem und ewigem Frieden geredet worden sein, als hier bei dem Festmahl der Aerodynamiker. Die Staatsvertreter drückten die herzlichsten Beziehungen zueinander beim perlenden Veuve Cliquot aus und versicherten insgesamt wieder ihrem gallischen Gastgeber, daß jetzt, wo der Luftozean dem Verkehr erschlossen worden sei, nichts in der Welt ihre Regierungen dazu bestimmen könnte, mit Frankreich jemals wieder in Uneinigkeit zu leben. Niemals sollte eine Differenz zu einer dunklen, drohenden Wolke am Friedenshimmel anschwellen.
Nach diesem Austausch ihrer tiefsten freundschaftlichen Gefühle zu urteilen, war damit zweifellos jeder Krieg für alle Zeiten eine undenkbare Sache. Da aber nicht bloß Skeptiker und Pessimisten Zweifel an den in süßesten Tönen abgegebenen Versicherungen der fremden Würdenträger hegten, sondern auch gar viele andere Leute und vor allem die wie Turteltäubchen untereinander verkehrenden Gesandten selbst ihrem Gesinnungsausdruck herzlich wenig Wert beimaßen, so waren also nur trügerische Klänge der Friedensschalmei entlockt worden. Und die Zukunft sollte es auch lehren, daß gerade mit Anbruch der Luftverkehrsära die Uneinigkeit der Großmächte erst recht wachsen und Handel und Wandel in gräßlichste Unordnung geraten sollte. Doch greifen wir unserer Erzählung nicht vor.
Der Präsident der französischen Republik, Bourdeau, hatte es nicht versäumt, an dem Festmahl der Aerodynamiker mit teilzunehmen und behauptete einen Platz neben de Saint-Martin.
Dieser Mann, der Frankreichs Geschicke für die Zeit seiner Präsidentenschaft in den Händen hielt, war ein durchaus energischer Charakter und regierte nicht schlecht, da er in den hohen Künsten der Diplomatie bewandert war und die eine oder andere politische Partei im Lande sich nicht über den Kopf wachsen ließ. Bourdeau war ein gemäßigter Republikaner und verstand es, mit den Radikalen, Ralliierten, Sozialisten und anderen Volksparteien sich auf guten Fuß zu stellen, ein Kunststück, das ihm in Frankreich noch niemand nachgemacht hatte. Infolge einer von ihm durchgeführten Steuerreform und Neuorganisation der bewaffneten Macht hatte er sich einer ständig zunehmenden Beliebtheit beim Volke zu erfreuen. Nur hin und wieder stieß er auf eine Verstimmung des letzteren, so, wenn die Orientfrage angeschnitten wurde oder die Regierung Stellung zu den Ententemächten zu nehmen hatte. Zu verschiedenen Malen hatte die radikalsozialistische Opposition es versucht, ihn zu Maßnahmen zu drängen, welche ihm unter Umständen den Präsidentenstuhl kosten konnten. Doch der schlaue Bourdeau wußte sich immer aus allen Affären geschickt herauszuziehen, ohne dabei allzuviel Konzessionen zu machen.
Bourdeaus Rede, welche den Abschluß des Festmahls bildete, war für alle Beteiligten eine denkwürdige. In groben Konturen entwarf er darin ein Zukunftsbild, wie ein solches sich nach den von ihm zu ergreifenden Maßnahmen gestalten würde. Die aufgetragenen Farben in der Rede waren licht, so daß die Festteilnehmer mit den besten Eindrücken und Hoffnungen scheiden konnten, sofern sie nicht in die Reihe der krassen Pessimisten gehörten.
Den eigentlichen Abschluß des Festmahles bildete die Dekorierung de Saint-Martins. Bourdeau heftete ihm in Frankreichs Namen selbst den Orden der Ehrenlegion auf die Brust und verlieh ihm den Titel eines Staatsrates. Der Vertreter Englands zeichnete ihn im Namen seiner Regierung mit dem Hosenbandorden aus, dessen Devise: »Honni soit qui mal y pense!« bekanntlich jedermann geläufig ist. Deutschland seinerseits ehrte de Saint-Martin durch die Verleihung des roten Adlerordens, und die übrigen Großmächte sowie kleineren Staaten schütteten ebenfalls einen reichen Ordenssegen über den Gefeierten aus.
Nunmehr ergriff im Namen der europäischen Großmächte der Gesandte Deutschlands, Baron von Arnim, das Wort und versicherte de Saint-Martin, daß er sowohl sich der vollen Huld Sr. Majestät des greisen Kaisers Wilhelm II. sowie der Gnade aller übrigen europäischen Souveräne zu erfreuen habe. Des weiteren ließ der Gesandte durchblicken, daß in des großen Erfinders Adern doch auch etwas deutsches Blut rolle, was sich sein Vaterland zur Ehre anrechnen dürfe.
Diese Anspielung des deutschen Gesandten trübte ein wenig die rosige Stimmung der Franzosen, da sie doch de Saint-Martin als den Sprossen eines vollbürtigen Sohnes ihrer Nation ansahen. Der deutsche Gesandte mochte wohl diese Empfindung der Franzmänner herausgewittert haben und bemühte sich darum nun, das Freundschaftsverhältnis zwischen Deutschland und Frankreich als ein inniges hinzustellen, mit der Bekundung, daß man somit doch eigentlich verbrüdert sei.
Kaum war die Rede des Barons zu Ende, als Bourdeau die Tafel aufhob und Arm in Arm mit de Saint-Martin das Elysée verließ. Schmetternde Fanfaren begleiteten den Abgang der beiden, die augenblicklich die Fäden der neuangebrochene Kulturära in ihren Händen vereinigten.
Draußen vor dem Elysée hatte sich inzwischen die Menge gestaut und harrte des Augenblickes, wo die zwei populärsten Bürger Frankreichs den alten Bourbonenpalast verließen, und aus vielen tausend Kehlen schallte beiden ein Vive de Saint-Martin! ein Vive Bourdeau! ein Vive la France! entgegen, und der benachbarte ChampsElysée gab ebenso vielstimmig diese begeisterten Zurufe als Echo wieder.
Seit fast zwei Jahrzehnten hatten sich bereits verschiedene Konstruktionen lenkbarer Ballons die Luft erobert. Seit das Problem der Lenkbarkeit aeronautischer Fahrzeuge restlos gelöst, war ein regelrechter Luftverkehr möglich geworden. Derselbe machte aber dem Verkehr zu Land und zu Wasser nur eine bescheidene Konkurrenz, da die Luftfahrzeuge infolge der mitzuführenden Motoren eine gewisse Schwerfälligkeit besaßen, die weder eine größere Geschwindigkeit noch einen erheblichen Lasttransport zuließen. Wohl bestand ein fahrplanmäßiger Luftverkehr zwischen den Kulturstaaten der Erde, aber er vermochte keine größeren Dimensionen anzunehmen. Ballons starren, halbstarren und unstarren Systems mit Gasmotoren und anderen Antriebsmaschinen dienten nur zur Personenbeförderung, so vor allem zwischen Deutschland, England und Frankreich, auch über die Alpen hinweg fand eine regelmäßige Luftschiffahrt statt. Die Militärverwaltungen der europäischen Staaten hatten das aeronautische Fahrzeug in den Dienst von Krieg und Frieden gestellt. Einige Großmächte waren seit Jahren dabei, ganze Luftflotten zu schaffen, wonach es den Anschein hatte, als wenn sich die Kriege der Zukunft statt zu Lande oder Wasser in höheren Regionen abspielen sollten. Vorläufig war natürlich ein reiner Ballonkrieg zwischen zwei Staaten ohne gleichzeitiges aktives Eingreifen des Landheeres und der Seeflotte noch ein Unding. Die Luftschiffe vermochten bei ihrer nicht allzugroßen Tragfähigkeit nur eine beschränkte Belastung auszuhalten. Die Mitnahme vieler Mannschaften und schwerer Geschütze war von vornherein ausgeschlossen.
So wurden denn die Militärluftschiffe vorläufig nur für den Aufklärungsdienst verwendet. Sie hatten im Kriegsfalle die Bewegungen feindlicher Heere und Flotten auszukundschaften, eine Aufgabe, der sie auch leichthin gerecht werden konnten, da sie sich bei ihrer großen Auftriebsfähigkeit jederzeit außer Schußweite zu bringen vermochten.
Victor de Saint-Martins Erfindung eines federleichten Akkumulators brachte nun mit einem Schlage eine völlige Umgestaltung der Aeronautik mit sich. Konnte man doch die neue Elektrizitätsquelle auch zum Antrieb der Luftschiffe mit größtem Vorteil verwenden. Mit dem Saint-Martinschen Akkumulator war aber auch gleichzeitig das Problem des Menschenfluges gelöst worden. Und das war wohl das Wichtigste bei der ganzen Sache.
Soweit das, was der Leser zum Verständnis der weiteren Begebenheiten in vorliegender Erzählung wissen muß. — —
Der Winter des Jahres, mit welchem die neue Luftverkehrsära anbrach, hatte ziemlich stark mit Frost eingesetzt und erschwerte so die Versuchsfahrten, welche de Saint-Martin und einige Kommissionsmitglieder des aeronautischen Klubs in der Nähe von Paris unternahmen.
Ein eisiger Ostwind, ein seltener Gast im sonnigen Frankreich, hatte tags zuvor, als de Saint-Martin und Monsieur Chapelle beschlossen hatten, gemeinsam einen Aufstieg mit der Flugmaschine zu unternehmen, eingesetzt und lud nicht gerade zu einem Besuche in luftigen Höhen ein. Dennoch aber beharrte de Saint-Martin bei seinem Vorhaben, und auch Chapelle ließ sich durch die herrschende Kälte nicht beirren.
Einige erste Probefahrten waren de Saint-Martin schon vor Wochen gelungen, und diesmal sollte ein Versuch unternommen werden, höhere Regionen zu erklimmen, was in Anbetracht der Witterungsumstände gefahrbringend sein konnte. Saint-Martins Angehörige, seine alte Mutter und seine einzige Schwester, ein hübsches Mädchen von zwanzig Jahren, sträubten sich sehr gegen das Vorhaben und rieten mahnend und flehend davon ab, bei solcher Kälte Probefahrten zu unternehmen.
Babette de Saint-Martin mußte wohl von dunklen Ahnungen beschlichen sein, daß ihres Bruders Auffahrt diesmal eine unglückliche werden könnte.
Ein gleiches Interesse besaß auch Babettes intimste Freundin, Louise Michelet, welche Victor de Saint-Martins Herzen sehr nahe stand. Aber auch ihr Flehen konnte den Entschluß des jungen Mannes nicht wankend machen. Zudem fühlte er sich ja auch sehr sicher, da er der Konstruktion seiner Flugmaschine in jeder Weise vertraute. Das bißchen Kälte dort oben konnte ihm doch nicht allzuviel anhaben.
So bereitete denn de Saint-Martin alles zu einem Aufstieg vor. Mit Hilfe einiger dienstbereiten Leute waren die beiden Vehikel, welche den Helden des Tages und seinen Begleiter in den Luftäther hinaufheben sollten, nach einem Wirtshaus in der Nähe von Auteuil gebracht worden. Dem geplanten Aufstieg wohnten eine Anzahl hochstehender Persönlichkeiten bei. Darunter befanden sich auch Villemain, Marquis d'Espingal und Lemonnier.
Saint-Martin führte zunächst allen seine Flugmaschine einmal vor, und gar viele neugierige Blicke richteten sich auf das äußerlich eigentlich unscheinbare Vehikel, welches ein Fliegen des Menschen in der Luft zur Möglichkeit machte. Die Konstruktion des Fahrzeuges konnte auf die Dauer niemand ein Geheimnis bleiben, denn bis auf die Zusammensetzung des Akkumulators war auch das kleinste Teilchen deutlich sichtbar. Das eigentliche Geheimnis der Maschine ruhte in der neuen Elektrizitätsquelle, dem Akkumulator, dessen Zusammensetzung jetzt schon zu verraten sich sein Erfinder wohlweislich hütete. Der kleine, kaum zwanzig Zentimeter lange Aluminiumakkumulator vermochte, wie sich längst ergeben hatte, gewaltige Mengen hochgespannter Elektrizität jederzeit abzugeben, ohne sich nach 100stündigem unausgesetzten Gebrauch zu erschöpfen. Der Apparat stellte eigentlich eine direkte Elektrizitätsquelle dar, welche im Prinzip darauf beruhte, daß durch elektrolytische Zersetzung von Wasser der dabei freiwerdende Sauerstoff und Wasserstoff getrennt in komprimierter Form in ihm aufgespeichert wurde. Durch die Wiedervereinigung beider Gase mit Hilfe einer sinnreichen mechanischen Vorrichtung konnte dann in dem kleinen Akkumulator eine auf mehr als zehn Pferdestärken sich bemessende Kraft erzielt werden.
Der Saint-Martinsche Akkumulator war gleich nach seiner Erfindung von der französischen Regierung als Ankaufsobjekt vorgesehen. Trotzdem sich seine Brauchbarkeit in hohem Maße gezeigt hatte, war es zwischen Staat und Erfinder noch nicht zu einem finanziellen Abschluß gekommen. Dahingegen hatte ein großes Elektrizitätswerk in Lyon mit Saint-Martins Genehmigung von der Staatsregierung den Auftrag erhalten, unverzüglich 100,000 Akkumulatoren für Flugmaschinen herzustellen. Gleichzeitig waren aber auch solche von großen Dimensionen in Auftrag gegeben worden, um mit ihnen Luftschiffe auszurüsten. Die französische Regierung sah ein, daß sie jetzt schnell handeln müsse, damit nicht etwa andere Staaten Saint-Martins Geheimnis ergründeten und für ihre Zwecke ausnützten.
Die Versuchsfahrt welche de Saint-Martin und Chapelle zu unternehmen gedachten, sollte für den Erfinder noch weitere wichtige Aufschlüsse in aeronautischer Hinsicht ergeben.
Beide Männer hatten sich über ihre Kleidung einen Gummikaftan geworfen, der sie oben in der Luft vor Durchnässung schützen sollte.
»Ich verspüre eigentlich große Lust,« sagte Villemain, als er die beiden Männer ihre Flugmaschinen besteigen sah, »mich auch einmal in die Lüfte zu erheben. Es muß doch ein herrliches Gefühl sein, wie eine Schwalbe im Äther dahinzufliegen.«
»Sie haben recht,« versetzte de Saint-Martin, »es ist ein erhebendes Gefühl, das einen beherrscht, den Vögeln gleich die Lüfte durchqueren zu können.«
»Unvergleichlich muß es sein, wenn man, statt auf staubiger Straße zu gehen, durch die reine Luft dahinschweben kann,« meinte enthusiastisch Chapelle.
»Eine unmittelbare Folge des Luftverkehres wird entschieden auch eine Verminderung aller Krankheiten herbeiführen,« ließ sich der Verkehrsminister weiter vernehmen.
»Ohne Zweifel,« pflichtete Chapelle ihm bei: »Wer da oben den reinen Äther trinkt, der wird sicher neu gestärkt an Leib und Seele.«
»Auch ein poetisches Gefühl muß einen überkommen, wenn man droben im unendlichen Raum mühelos die Lüfte durchfliegt. Lange genug war der Mensch an den Boden gefesselt, Jahrtausende hindurch hat er die Vögel beneidet, jetzt ist aber auch seine Stunde gekommen,« warf Lemonnier ein.
»Andererseits werden aber wohl die Schrecken eines Krieges durch die Flugmaschine noch vermehrt,« meinte Villemain, »denn ein Kampf in der Luft ist zweifellos schlimmer als zu Lande oder zu Wasser.«
Chapelle zuckte mit den Achseln und erwiderte: »Das ist der Welt Lauf. Der Luftverkehr mußte einmal kommen und wird natürlich auch seine Opfer fordern im Krieg und im Frieden.«
Unter solchem Gespräch hatten sich Saint-Martin und Chapelle zum Aufstieg fertig gemacht. Es wurden noch einige Abschiedsworte gewechselt, und dann begannen die Flügelräder der beiden Vehikel zu rotieren.
Ein Druck auf einen Kontakthebel und die Flugmaschinen hoben sich erst langsam, dann aber das Aufstiegstempo verdoppelnd, schnurgerade in die Höhe und schwebten schon nach wenigen Sekunden haushoch über den Köpfen der Zurückbleibenden.
Ein letzter Gruß von oben, begeisterte Zurufe von unten, und die Flugmaschinen gelangten bald aus dem Bereich der Hörweite.
Chapelle hatte bei seinem ersten Aufstieg das seltsame Gefühl, als wenn die Schwerkraft im Raum mit einem Male aufgehoben sei. Enthusiastisch pries er dem in seiner Nähe fliegenden Saint-Martin, wie herrlich doch so ein Aufstieg ins Luftmeer sei.
Bald hatten die Maschinen eine Höhe von 500 Meter erreicht, und die Beiden sahen ein herrliches Landschaftsbild unter sich ausgebreitet. Das gewaltige Babel Paris mit seinem Häusermeer, die im Sonnenschein wie ein glitzerndes Band sich ausnehmende Seine, die prächtigen Landschaften in der Ebene von Paris und weit noch darüber hinaus bis zur nördlichen Landesgrenze, wo der Kanal wie ein silberner Streifen aus weiter Ferne herüberglänzte, mußten das Auge der Fliegenden geradezu entzücken. Chapelle ließ es denn auch nicht an bewundernden Ausrufen fehlen, während Saint-Martin sich weniger für die sich unter ihm ausbreitenden Schönheiten der Landschaft zu kümmern schien, sondern sein Augenmerk mehr auf das Funktionieren seines Vehikels richtete.
Kleine, an den Maschinen angebrachte, durch ein Drahtgehäuse geschützte Barometer ließen jederzeit die Höhe, die man erreicht hatte, schnell erkennen. Zehn Minuten nach der Abfahrt von der Erde zeigte die Quecksilbersäule schon einen Höhenflug von rund 850 Meter an. Und noch weiter hinauf stiegen die Fahrzeuge.
Saint-Martin wollte jetzt einmal das Auftriebsvermögen der Maschinen gründlich erproben, weshalb er das eine der beiden Flügelräder, welches zur vertikalen Fortbewegung diente, allein laufen ließ, während das andere, welches die horizontale Bewegung ermöglichte, vorläufig in Ruhelage blieb.
Saint-Martin hatte Chapelle vor der Abfahrt die nötigen Weisungen in bezug auf die Handhabung der Armatur der Maschine erteilt, so daß dieser kaum einen Mißgriff in der Betätigung der verschiedenen Hebel tun konnte.
So strebten denn die beiden Flugmaschinen mit annähernd gleicher Geschwindigkeit immer weiter aufwärts. Mit rasender Schnelligkeit drehte sich das untere Flügelrad und erteilte der Maschine und dem Fahrer eine fortgesetzte Erschütterung. Nach Saint-Martins Angaben machte sich letztere aber nur bemerkbar, wenn eins der Flügelräder allein funktionierte. Sobald beide in Aktion traten, wurde die Erschütterung, welche das eine Flügelrad erteilte, durch die des anderen paralysiert.
Nach Saint-Martins Chronometer war man um 9 Uhr 20 Minuten vormittags aufgestiegen. Zwanzig Minuten später hatten die Maschinen schon tausend Meter Höhe erreicht. Der erste Kilometer in vertikaler Richtung war zurückgelegt, und Saint-Martin hatte im Sinn, das Sechs- bis Achtfache dieser Höhe noch zu erreichen. Das war wagehalsig, denn noch hatte man keine Garantien, wie sich die Flugmaschinen in dieser Höhe bewähren würden und ob den Fliegenden der Luftzustand in solcher Region nicht Beschwerde verursachen konnte. Für den Menschen gehört schon ein Aufenthalt in der Höhe des Montblancgipfels nicht gerade zu den Annehmlichkeiten. Die Verdünnung der Luft wirkt bekanntlich stark auf den Körper ein. Hierzu tritt noch die große Kälte, welche in höheren Regionen herrscht. Doch Saint-Martin schien sich vor diesen Umständen wenig zu fürchten, und Chapelle seinerseits dachte an solche Faktoren in diesem Augenblicke nicht.
Mit zunehmender Höhe verlangsamte sich der Aufstieg der Maschinen. Die Ursache hierfür vermochte Saint-Martin nicht zu ergründen. Ob die Schwerkraft hier von oben sich mehr geltend machte — was physikalisch betrachtet nicht gut annehmbar war — oder ob ein anderer noch unbekannter Faktor die Verlangsamung hervorrief, darüber vermochten die Fliegenden keine Rechenschaft zu geben.
9 Uhr 50 Minuten zeigte das Barometer eine erreichte Höhe von zweitausend Meter an, und nun machte sich die Kälte recht schnell bemerkbar. Trotz dicker Fausthandschuhe und warmer Kleidung fröstelte es beide ziemlich stark. Im weiteren Verlauf des Aufstieges wurde die Kälte dann _so ^groß, daß den Fliegenden die Finger verklommen.
Einstimmig beschlossen sie nun, den Höhenflug zu unterbrechen und die Fahrt in horizontaler Richtung fortzusetzen.
Saint-Martin und Chapelle nahmen ihren Kurs jetzt nordwärts und strebten dem Kanal zu. Trotz der enormen Höhe, in welcher sie schwebten, war die Landschaft unter ihnen deutlich sichtbar. Der Blick reichte fast bis Schottland hinauf. Ostwärts sahen sie das ganze Alpengebiet. Südwärts dehnten sich vor ihnen die herrlichen Landschaften ihres Vaterlandes aus, bis weit hinab nach Lyon. Und drüben im Westen sahen sie die unermeßliche Wasserfläche des Atlantischen Ozeans in graublauer Tönung liegen. Soweit das Auge schauen konnte, lag Sonnenschein über allen Gegenden. Kein Wölkchen trübte den Fliegenden die Aussicht nach unten.
Nordwärts verriet ein dunkler Fleck den Ort, wo die Riesenmetropole Albions sich an der Themse ausdehnte.
Tief unter den Fliegenden kreuzte eben ein lenkbares Luftschiff den Kanal. Dasselbe gehörte einer französischen Gesellschaft, welche einen regelmäßigen Luftverkehr zwischen Frankreich und England unterhielt. Von den Insassen dieses Fahrzeuges mochte wohl keiner die zwei dunklen Punkte in höheren Regionen, die beiden Flugmaschinen, gewahren. Desto deutlicher aber konnten Saint-Martin und sein Begleiteter das Luftschiff beobachten. Die beiden Fliegenden hatten sich wohlweislich mir scharfen Feldstechern versehen und sahen mit diesen Ferngläsern mancherlei, was unten auf der Erde vorging. Um noch deutlicher sehen zu können, ordnete Saint-Martin an, daß die Fahrzeuge in geringerer Höhe über der Erde schweben sollten. So fand denn nun ein Abtrieb nach unten statt, und als der Chronometer 10 Uhr 5 Minuten anzeigte, flogen beide Luftschiffer nur noch in einer Höhe von etwa tausend Meter.
Die Geschwindigkeit der Flugmaschine in horizontaler Richtung vermochte die in vertikaler Richtung bedeutend zu übersteigen. Das elektrisch angetriebene Flügelrad bewegte das Vehikel, wenn ein formierter Flug stattfinden sollte, stündlich um hundert Kilometer vorwärts, eine Geschwindigkeit, welche etwa der der modernen Luxuszüge entspricht. Bei solcher rasenden Fahrt konnte unter Umständen den Insassen der Atem vergehen, deshalb war von vornherein am Apparat ein kleiner Schutzschirm vorgesehen, hinter welchem der Fliegende das Gesicht verbergen und so besser atmen konnte.
Die schneidende Kälte zwang jedoch die Luftschiffer, nach kurzer Fahrt ein bedeutend gemäßigteres Tempo einzuschlagen. So fuhren sie denn mit einer Stundengeschwindigkeit von nur etwa 40 Kilometer. Die beiden ElektroAeroplane, so hatte Saint-Martin seine Flugmaschinen getauft, hielten sich während der Fahrt ziemlich dicht nebeneinander. so daß sich ihre beiden Insassen bequem unterhalten konnten.
Eine Stunde mochte wohl seit der Abfahrt verflossen sein, als die Fliegenden in die Nähe von Dünkirchen, der französischen Hafenstadt, gelangten und nun das breite, schimmernde Wasserband des Kanals vor sich liegen sahen. Es war ein herrliches Bild, so aus der Vogelperspektive herab auf das Meer blicken zu können, das hier von zahlreichen Schiffen der verschiedensten Nationen belebt war.
»Wenn man es sich überlegt,« meinte Chapelle, »bildet die Lösung des Flugproblemes doch etwas so Ungeheuerliches, daß man sich noch gar nicht recht die sich daraus resultierenden Umwälzungen auf der Erde vorstellen kann. Wenn erst alles in der Luft fliegt, so werden die Verkehrsmittel zu Lande und Wasser doch eigentlich überflüssig. Ein jeder wird es vorziehen, sich mit seiner Flugmaschine lieber der Luft anzuvertrauen, als mit der Eisenbahn und dem Schiff zu reisen, die doch viel eher Gefahren für das Leben der Menschen mit sich bringen, als wie ein sanfter Flug im Äther.«
»Das Zeitalter des Menschenfluges mußte einmal kommen,« versetzte Saint-Martin und dirigierte seine Maschine jetzt so, daß ihr Kurs mehr nordöstlich wurde.
Chapelle folgte nun ebenfalls der Richtung des Saint-Martinschen Vehikels. »Wissen Sie schon, daß man Ihnen in Ihrer Vaterstadt ein Denkmal zu setzen beabsichtigt?«
Saint-Martin lachte. »Zu viel der Ehre!« rief er seinem Begleiter zu.
»Dem Schöpfer der neuen Luftverkehrsära gebührt ohne Zweifel ein Monument,« antwortete Chapelle. »Die Welt hat Ihnen viel zu verdanken. Sie lenken Politik und Handel in völlig neue Bahnen. Ein Umschwung aller Dinge steht bevor.«
»Dessen bin ich mir wohl bewußt,« sagte Saint-Martin. »Die Zeit mußte doch endlich für die Menschheit kommen, wo es gelang, einen leichten Akkumulator zu schaffen, der zum Bahnbrecher einer neuen Kultur taugte.«
»Wenn ich darüber nachdenke,« erwiderte Chapelle, »wie sich nun alles gestalten wird, so türmen sich meine Gedanken in einer Weise auf, daß ich dabei fast verwirrt werde. Der Verkehr zu Wasser und zu Lande mußte jetzt eine Entlastung erfahren, denn die Unglücksfälle mehren sich täglich trotz der größten Sicherheitsmaßregeln.«
»Derartiges ist im Luftverkehr nicht zu erwarten,« meinte Saint-Martin und musterte mit seinem Fernglas Dünkirchen, über welches er soeben hinwegflog. »Der Verkehr zu Wasser und zu Lande ist immer an eine Ebene gebunden, während im Luftverkehr Tausende von Ebenen zur Verfügung stehen. Es kann hier kreuz und quer gefahren werden ohne daß Kollisionen zur Häufigkeit werden.«
»Wo gedenken Sie zu landen?« fragte jetzt unvermittelt Chapelle und lugte voraus nach dem britischen Inselreich.
»Ich habe London als Ziel im Auge,« versetzte der Gefragte. »Bei der jetzigen Geschwindigkeit werden wir in etwa zwei Stunden dort eintreffen.«
»Ich möchte aber raten, daß wir uns an einer möglichst abgelegenen Stelle außerhalb Londons niederlassen. Die Herren Engländer könnten sonst die schöne Gelegenheit benützen, uns mit unseren Flugmaschinen in ihre Gewalt zu bekommen. Wenn die französische Regierung erfährt daß wir uns über die Landesgrenze hinausgewagt haben, so wird sie zetern und schreien. Sagen wir also beileibe nicht, daß wir uns auf englisches Gebiet gewagt haben.«
»Sie haben recht, lieber Chapelle,« versetzte Saint-Martin. »Wir sind zu kostbare Vögel, um in die Hände der Englishmen zu fallen.«
»Daß ich es nicht vergesse,« sagte Chapelle hastig sprechend. »Ich las heute morgen in den Zeitungen die Nachricht, daß man in Rußland und England mit dem Gedanken umgehe, Ihnen für die Überlassung Ihrer Erfindung insgeheim große Geldsummen zu bieten.«
»Wie steht das aber im Verhältnis zu den internationalen Abmachungen des Kongresses,« meinte Saint-Martin.
»Es war zu erwarten, daß die anderen Staaten im stillen auf Mittel sannen, wie sie aus der von Ihnen geschaffenen neuen Lage besonderen Nutzen für sich zu schöpfen vermöchten.«
»Die zahllosen Schreiben und Telegramme, welche ich von allen Seiten in den letzten Tagen erhielt, haben mich genügend darüber unterrichtet,« erwiderte Saint-Martin. »Die durch mich geschaffene Weltlage ist so kritisch, man könnte sagen gemeingefährlich, daß ich es gutheißen muß, wenn die französische Regierung alle für mich eingehenden Postsachen einer steten Zensur unterwirft. Es ist mir auch strikte verboten worden, mich in Unterhandlungen irgend welcher Art, soweit sie meine Erfindung betreffen, einzulassen, und es wundert mich eigentlich, daß man mich nicht direkt interniert. Wenn ich heute ins Ausland entwischen wollte, so wäre mir das doch ein leichtes, da ich jetzt schon bereits über Frankreichs Grenzen fliege. Aber als reichstreuer Franzmann denke ich nicht daran und trage mich nicht mit der Absicht, andere Staaten das Fett abschöpfen zu lassen.«
»Aus diesem Grunde möchte ich raten,« sagte Chapelle, »überhaupt nicht jenseits der Grenze zu landen, um allen Eventualitäten aus dem Wege zu gehen.«
Saint-Martin hielt dies schließlich auch für das Geratenste und beschloß, nicht Englands Boden zu betreten, sondern nach kurzem Rundfluge wieder ins heimische Gelände zurückzukehren.
Vorläufig behielten die beiden Fliegenden noch den eingeschlagenen Kurs bei.
Als die Flugmaschinen dann über dem Kanal schwebten, wurden deren Insassen durch eine starke Luftströmung beunruhigt, welche die Vehikel ganz aus dem Kurs brachten.
Saint-Martins Versuche, durch erneuten Höhenflug aus dem Bereich der Luftströmung zu kommen, waren nicht von Erfolg begleitet. So fühlte er sich denn gezwungen, seine Maschine nach unten zu dirigieren. Auch Chapelle tat ein gleiches.
Der Abtrieb ging infolge des Winddruckes in schräger Richtung von statten und verschlug die Fahrzeuge ein gut Teil nach Osten. Diese unfreiwillige Fahrtrichtung stand nicht auf dem Programm der Luftschiffer und bewies eigentlich, daß man doch nicht so ganz Herr im Luftozean war. In Saint-Martin stiegen daher allerlei Bedenken hinsichtlich der Manövrierfähigkeit seines Fahrzeuges auf. Diese schien bei starkbewegter Atmosphäre viel zu wünschen übrig zu lassen.
So kam es denn, daß die Fliegenden ihr Vehikel bis auf eine Höhe von 500 Meter herabsinken zu lassen gezwungen waren. In dieser Region fanden sie erst eine ruhige Luftströmung und hatten ihre Fahrzeuge wieder in der Gewalt Da die letzteren bis nahe an den belgischen Strand zurückgetrieben worden waren, so behielt jetzig Saint-Martin die Richtung bei und steuerte auf Brüssel zu, dessen Turmspitzen er in weiter Ferne bereits zu erkennen vermochte.
»Wäre es nicht geratener,« frug Chapelle, der sich nicht mehr ganz so sicher in seinem Vehikel fühlte, »wenn wir uns wieder heimwärts wendeten?«
»Wir können dies auf einem Umwege tun,« antwortete Saint-Martin, der sich durch die mißlungene Fahrt durchaus nicht eingeschüchtert fühlte. »Wir wollen den Kurs über Brüssel und Antwerpen nehmen und über die Ardennen nach Paris zurückkehren.«
Chapelle versuchte noch einmal, Saint-Martin zur unmittelbaren Rückfahrt zu veranlassen.
»Was verschlägt es,« antwortete ihm Saint-Martin, »wenn wir auch einmal durch die Luftströmung vom Kurs abweichen müssen, damit hat sich die Unbrauchbarkeit meines Fahrzeuges noch lange nicht ergeben. Sie sehen ja, wie glatt der Flug jetzt vor sich geht. Der Akkumulator funktioniert in sehr zufriedenstellender Weise und solange er nicht erschöpft ist, haben wir keinerlei Hindernisse zu befürchten.«
Chapelle fügte sich dem Vorhaben seines Begleiters und sah jetzt nach seinem Chronometer. Die Uhr zeigte an, daß die Mittagszeit heranrückte. Fast drei Stunden flogen sie nun bereits in der Luft und hatten eine gewaltige Strecke zurückgelegt. Noch einige Minuten und die Fahrzeuge schwebten über der belgischen Küste. War die Luft bisher sehr durchsichtig gewesen, so machte sich jetzt allmählich über dem Lande Nebel bemerkbar, der, je weiter man fuhr, sich mehr und mehr verdichtete und bald über der ganzen Gegend wie ein Schleier ausgebreitet lag. Dazu nahten von Norden her auch große Wolkenmassen.
»Der Wind hat sich gedreht,« meinte Chapelle.
»Wir haben Nordwest,« antwortete Saint-Martin, »und steuern gerade auf Wolken los.«
»Wir wollen lieber südwärts fahren,« sagte Chapelle.
»Bah! Die paar Wolken sollen uns nicht genieren. Allenfalls können wir über dieselben aufsteigen.«
Und weiter ging die Fahrt im alten Kurs. Bald verschwand die Sonne hinter den Wolken, die jetzt dicht über den Flugmaschinen dahinzogen. Kurz darauf wurden unsere beiden Luftschiffer dann durch einen dichten Schneefall überrascht. Damit hatten sie nicht gerechnet.
Die Flocken fielen unaufhörlich, und bald lastete eine solche Menge Schnee auf den Fliegenden, daß sie darunter nicht nur weidlich froren, sondern auch den Druck der Schneemassen empfanden.
»Wir müssen unseren Flug unterbrechen,« meinte Saint-Martin. »Wir wollen sofort landen.«
Chapelle war damit ohne weiteres einverstanden.
Zu ihren Füßen breitete sich eben ein mächtiger Wald aus. Nirgends war eine lichte Stelle, an der man hätte niedergehen können, zu entdecken.
»Fatal — —« meinte Saint-Martin, als er die Gegend unter sich musterte. »Wenn wir jetzt landen, so geraten wir unmittelbar zwischen die Wipfel der Bäume, und das möchte ich vermeiden. Ich sehe auch kein Ende des Waldes, und eine forciertere Fahrt läßt die Schneelast auf uns nicht zu.«
»Das ist wirklich eine unangenehme Lage,« versetzte Chapelle. »Dazu verspüre ich einen starken Appetit. Weit und breit ist kein Haus zu sehen, wo wir für einige Augenblicke Unterschlupf finden könnten.«
»Wie sehr doch so ein bißchen Schnee auf einem lasten kann,« sagte Saint-Martin und versuchte den auf seinem Rücken und der Maschine liegenden Schnee zu beseitigen, was ihm aber, da er sich in dem Fahrzeuge nicht sehr bewegen konnte, nicht recht gelingen wollte.
»Teufel! Was sollen wir nun tun!« brummte Chapelle und war durch die Lage, in der er sich befand, etwas übel gelaunt.
Saint-Martin spähte und spähte nach einem Punkte, wo sie hätten landen können, aber nichts als Wald und wieder Wald dehnte sich unter ihnen aus.
Unter der Schneelast sanken die Fahrzeuge tiefer und tiefer, trotzdem man die Auftriebsräder der Vehikel in Aktion versetzt hatte.
»Versuchen wir es einmal, langsam zu Boden _zu ^gleiten,« meinte Saint-Martin. »Wenn wir dann unmittelbar über den Wipfeln der Bäume hinfliegen, so werden wir doch einmal eine Lücke in dem Waldbestand finden, die wir zur Landung ausnützen können.«
Gesagt, getan. Wenige Augenblicke später senkten sich die Fahrzeuge bis dicht über den Wald herab, fast die Kronen der Bäume berührend.
Chapelle war mit seinem Vehikel etwas zurückgeblieben und geriet bald mit mehreren Baumwipfeln in unliebsame Kollision. Er sah sich gezwungen, die horizontale Fahrt nach Möglichkeit zu mäßigen, wenn er nicht noch verunglücken sollte.
Inzwischen aber war Saint-Martin ihm aus den Augen entschwunden, da dieser sein altes Fahrtempo beibehalten hatte. Jetzt wurde die Lage für Chapelle kritisch. Der dichte Schnee fall ließ ihn keine zwanzig Schritt weit sehen und auch seine Rufe nach Saint-Martin verhallten in der Luft, und wenn er glaubte eine Antwort von diesem gehört zu haben, so stellte sich hinterher heraus, daß es das Echo aus dem Walde gewesen war, das ihn genarrt hatte.
Chapelle verringerte die Fahrtgeschwindigkeit seines Vehikels auf ein Minimum, und als er sich dem breiten Wipfel eines gewaltigen Eichbaumes näherte, stellte er die Tätigkeit der Maschine ganz ein und versuchte aufs Geratewohl zwischen den Zweigen des Baumes hängen zu bleiben. Das gelang ihm auch. Zum Glück war er auf Äste aufgefahren, welche die Last, die jetzt auf ihnen ruhte, zu tragen stark genug waren.
Wo war Saint-Martin geblieben? Mit der ganzen Kraft seiner Lunge rief er dessen Namen nach allen Richtungen hin, ohne jedoch irgend ein Zeichen von dem Vermißten zu erhalten. Seit zehn Minuten hatte er von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Das war in der Lage, in der er sich befand, nicht gerade ermutigend.
Das starke Geäst der stolz über die anderen Bäume des Waldes emporragenden Eiche beugte sich unter dem Druck der auf ihm ruhenden Schneemassen. Kleine Zweige, welche durch die Anfahrt Chapelles vom Schnee befreit worden waren, zeigten durch den vorausgegangenen Frost einen glitzernden Behang. Die kleinen Eiskriställchen flimmerten an ihnen wie tausend Diamanten. Der Rauhreif der vergangenen Nacht hatte im Walde alles mit einem schimmernden Überzug versehen. Ein in der Krone des Baumes hängendes Vogelnest nahm sich mit seinem verdorrten Geäst in der kristallfunkelnden Umgebung einsam und absonderlich aus.
Die Stille des Waldes wurde durch kein Zirpen, durch keinen Singsang geflügelter Bewohner unterbrochen. Alles war in Eis und Schweigen erstarrt. Als jetzt aber das Gewölk des dichten Schneehimmels sich zu zerteilen begann, und das Tagesgestirn von Zeit zu Zeit sichtbar wurde, da umspielten die sich herniederstehlenden Sonnenstrahlen die eisbereiften Zweige in Chapelles Umgebung, und ihr wundersamer Glanz fand seinen Weg in das Auge des Menschenkindes, welches hier oben in dem Wipfel des Baumes hockte.
Chapelle war ein zu großer Naturschwärmer, als daß ihm trotz seiner mißlichen Lage die Schönheiten eines Frosttages im Walde entgingen. Während sein Ohr nach irgend einem Zeichen von Saint-Martin auslauschte, ergötzte sich sein Auge an dem eisigen Farbenspiele des Geästes. Noch nie im Leben hatte er von den Naturschönheiten des Winters solche Notiz genommen als in diesem Augenblicke.
Schließlich aber konnte er hier die Zeit doch nicht verträumen. Dazu gemahnte ihn auch ein Frösteln und ein Hungergefühl, daß er an diesem Ort nicht bleiben könne.
Nachdem er sich in seinem Vehikel zum Flug wieder zurechtgelegt hatte, setzte er den Antriebsmechanismus in Funktion und versuchte, nachdem er sich von der drückenden Schneelast befreit hatte, sich möglichst hoch über den Wald zu erheben, um bei der jetzt rasch folgenden Aufklärung des Wetters nach seinem entschwundenen Begleiter zu forschen.
Die feierliche Stille der Gegend wurde also nun plötzlich durch das Rasseln seiner Maschine recht unpoetisch unterbrochen, und der von der Last der letzteren befreite Baumwipfel reckte und streckte sich wieder in die Höhe, dabei den Rest Schnee von sich abschüttelnd, und das in den Sonnenstrahlen schimmernde Geäst sandte Chapelle einen lichtfunkelnden Gruß nach.
Hinauf in den reinen, kühlen Äther ging es nun. Gleich einer Lerche erklomm Chapelle senkrecht die Höhe, und schon wenige Minuten später lag der Wald tief unter ihm und bot den Anblick eines weiten, weiten Schneefeldes.
So angestrengt Chapelle auch nach allen Richtungen ausspähte, vermochte er doch nichts von seinem Gefährten zu entdecken. Er konnte kaum glauben, daß Saint-Martin ihn so ohne weiteres im Stich gelassen habe und weitergefahren sei; er war von ihm sicher schon nach wenigen Minuten vermißt worden. Warum kehrte er aber nicht zurück? — — —
Während Chapelle noch darüber nachdachte und den Höhenflug unterbrach, um sich nur in horizontaler Richtung fortzubewegen, vernahm er unerwartet Rufe von unten her zu sich heraufdringen. Fast geisterhaft klangen die Töne an sein Ohr. Das konnte Saint-Martins Stimme nicht sein. Mit Adlerblicken suchte sein Auge die Gegend unter sich ab, ohne etwas gewahren zu können. Da erinnerte er sich seines Fernglases. Schnell riß er dasselbe an die Augen und entdeckte bald darauf eine Waldlichtung, auf deren Grund sich etwas zu bewegen schien.
Sofort dirigierte er sein Vehikel abwärts nach dieser Richtung hin.
Wie eine Windesbraut fegte Chapelle hinab und war nach wenigen Minuten in der Nähe der besagten Waldlichtung.
Zu seinem großen Erstaunen erblickte er dort Saint-Martin, welcher sich über eine auf dem Boden sitzende weibliche Gestalt beugte und dieselbe mit Schnee abzureiben schien.
Das Surren von Chapelles Flugmaschine schlug jetzt an Saint-Martins Ohr und er blickte auf, den Ankömmling freudig begrüßend.
»Schnell, Monsieur Chapelle, landen Sie hier!« tönte es zu Chapelle hinauf.
Letzterer traf sofort Anstalten, sich niederzulassen. Das Abtriebsrad rotierte, und dem betätigten Mechanismus gehorchend, senkte sich das Vehikel schnell in der Waldlichtung nieder und landete ohne Unfall.
»Kommen Sie schnell! — — — Sie müssen mir helfen!« rief Saint-Martin.
»Ja — was ist denn hier passiert?« frug Chapelle zurück und löste die Riemen, welche ihn mit seiner Flugmaschine verbunden hatten. Dann schritt er, so schnell es seine vor Kälte verklommenen Glieder gestatteten, auf Saint-Martin zu.
»Ein hilfloses Mädchen, welches dem Tode des Erfrierens nahe ist — — —« sagte Saint-Martin und rieb fortgesetzt die bewußtlose Gestalt mit Schnee.
Chapelle schüttelte den Kopf, da er sich nicht zu erklären vermochte, wie Saint-Martin hier mit der Verunglückten zusammengekommen war. Doch er frug nicht erst lange, sondern betätigte sich ebenfalls, um die Scheintote wieder ins Leben zurückzurufen.
Kurz darauf wurden auch die Bemühungen der beiden Männer mit Erfolg gekrönt, denn die Bewußtlose schlug die Augen auf. Und es waren ein Paar dunkle, liebliche Augen, deren Blicke jetzt denen der beiden Männer begegneten. Langsam hob die Verunglückte ihren halberstarrten Arm und faßte sich wie verwirrt an die Stirn, als suche sie die Erinnerung an Vorangegangenes wieder wachzurufen. Dann lispelte sie ihren Rettern zu: »Warum laßt ihr mich nicht sterben — — — ich wollte sterben — — wollte erfrieren und ihr weckt mich nun wieder zum Leben auf — — —«
Verdutzt sahen sich Saint-Martin und Chapelle an. Sie glaubten, daß sich der Geist des Mädchens verwirrt habe.
»Wie fühlen Sie sich?« frug Saint-Martin, richtete die Gestalt der Daliegenden auf und reichte ihr einen kleinen Becher voll Kognak, welchen er seiner Feldflasche entnommen hatte. Das junge Mädchen mußte die dargebotene Stärkung annehmen, da Saint-Martin ihr den Becher auf die Lippen drückte.
Nachdem sich die belebende Wirkung des Kognaks auf die Verunglückte äußerte, erzählte letztere mit schwacher Stimme, daß sie absichtlich in den Wald gegangen sei, um sich dort zu verirren und zu erfrieren. Sie habe sich vor den Mißhandlungen ihres dem Trunke ergebenen Vaters, der ein Forsthaus in diesem Walde bewohnte, geflüchtet. Sie sei todunglücklich und könne und wolle nicht mehr leben.
Saint-Martins und Chapelles vereinten Bemühungen und Zureden gelang es schließlich, die Unglückliche von ihren Selbstmordgedanken abzubringen und dem Leben wieder geneigt zu machen. Die Situation, in der man sich befand, war für jeden der Beteiligten nicht gerade eine angenehme zu nennen. Fernab von jedem bewohnten Orte, inmitten eines völlig verschneiten Waldes wußte man nicht, wohin des Wegs.
Chapelle hatte inzwischen erfahren, daß Saint-Martin erst bei seiner Landung in dieser Waldlichtung bemerkt hatte, daß sein Begleiter ihm nicht gefolgt war. Im Begriff, wieder umzukehren und denselben aufzusuchen, hatte er die im Schnee liegende Gestalt der Unglücklichen gewahrt und war ihr eiligst zu Hilfe gekommen.
Es blieb den beiden Männern jetzt nichts anders übrig, wollten sie die Verunglückte unter ein sicheres Obdach bringen, als entweder den Weg aufs Geratewohl nach einer Richtung hin zu Fuß anzutreten, oder einer von ihnen mußte mittels der Flugmaschine die Gegend abstreifen und Hilfe herbeiholen.
Da beide das letztere für das zweckmäßigste hielten, so erbot sich Chapelle, auf die Suche nach einer menschlichen Behausung zu fahren, und machte sich mit seiner Flugmaschine eiligst auf den Weg.
Saint-Martin blieb unterdessen bei der Geretteten zurück und ließ sich von ihr des näheren erzählen, welcher tiefe Kummer sie in den Tod hatte treiben wollen.
Wieder richteten sich die schwarzen Augensterne des Mädchens auf Saint-Martin, und er fühlte sich von dem Zauber, der in den schmerzerfüllten Blicken lag, seltsam berührt. Wenn er die junge Maid länger ansah, so fand er in ihren hübschen Zügen vieles Sympathische. Wenn sie auch nicht schön genannt werden konnte, so verliehen ihr doch die wohlgeformten kleinen Ohren, der zierliche Mund und die dunklen Augen etwas sehr Angehendes. Das halb aufgelöste, in dunklen Strahlen herabfallende Haar bedeckte eine Baschlikmütze. Ein lose gestrickter Shawl war halb um den Hals geschlungen, und seine beiden Enden hingen über den Rücken herab. Die zierlichen Hände waren vor Kälte blaurot geworden. Noch immer von innerem Schmerz erfüllt, blickte das junge Mädchen todestraurig vor sich hin, nachdem sie das Wissenswerteste über ihre Lage ihrem Retter gebeichtet hatte.
Saint-Martin, der ein außerordentliches Interesse für die Verunglückte verriet, suchte diese noch weiterhin auszuforschen und bekam nun sehr traurige Dinge zu hören.
Inzwischen kehrte Chapelle zurück und überbrachte die Nachricht, daß er nicht allzuweit ein Dorf an der Waldlisière gefunden und einige Bauern alarmiert habe.
Nach einer reichlichen Viertelstunde traf dann auch die Hilfe aus dem Dorf ein und nahm Jeanne Ponchon, wie sich die Unglückliche nannte, in Empfang.
Nach herzlicher Verabschiedung trennten sich Saint-Martin und Chapelle dann von Jeanne Ponchon, die ersterem unvergessen bleiben und noch eine Rolle in seinem Leben spielen sollte.
Einige Minuten später schwebten die Vehikel wieder über dem Walde und ihre Insassen hielten einen heimwärts gerichteten Kurs inne — — —
Im weiteren Verlauf des Fluges, der nicht wieder durch Witterungsunbilden gestört wurde, gelangten sie glücklich über die Vogesen, und als die Sonne im Scheiden war, mochten sie nur noch einige sechzig Kilometer von Paris entfernt sein. Da man sich für das Dunkel der Nacht nicht mit Signallaternen versehen hatte, so konnte es bei den nebeneinander hingleitenden Vehikeln gar nicht ausbleiben, daß dieselben einmal unvermutet in Kollision gerieten.
Chapelle fuhr nämlich bei einer kleinen Wendung direkt in Saint-Martins Maschine und die Flügelräder erlitten dabei eine solche Verbiegung, daß sie nicht mehr funktionierten, wodurch ein so schneller Abtrieb der Vehikel nach unten stattfand, daß ihre Insassen in Gefahr waren, zerschmettert werden.
»Um Gottes willen!« rief Saint-Martin, »versuchen Sie es, Ihre Maschine von der meinigen abzustoßen!«
Chapelle war der Schreck über die Kollision und das darauf erfolgende rasche Niederfallen so in die Glieder gefahren, daß er nicht sogleich zu antworten vermochte, aber dem Rate seines Begleiters doch eiligst folgte.
Hatten die Fahrzeuge vor wenigen Augenblicken noch über 800 Meter hoch geschwebt, so waren sie jetzt mit rapider Geschwindigkeit bis auf 150 Meter über den Erdboden herabgesunken.
Unter ihnen breitete sich ein Dorf aus, und es lag die Gefahr nahe, daß die Vehikel bei ihrem weiterem schnellen Abtrieb auf das Dach irgend eines Gebäudes fallen könnten.
Die Lage war für beide eine ziemlich verzweifelte, da der Mechanismus der Maschinen versagte.
Die Dunkelheit hatte schnell zugenommen und gestaltete die Situation nur noch gefährlicher.
Saint-Martin und Chapelle hatten wenig Hoffnung auf eine glückliche Landung, verloren aber die Geistesgegenwart nicht.
Als ihre Fahrzeuge zur Seite eines Kirchturmes des Dorfes herabsanken, riefen sie so laut als es ihre Lungen erlaubten nach Hilfe. Ob sie unten in der Ortschaft von jemand gehört wurden, blieb allerdings zweifelhaft, da bekanntlich der Schall der Stimme weniger nach unten als nach oben hin dringt.
Saint-Martin sowohl wie Chapelle bereiteten sich auf einen schlimmen Sturz vor. Aber die Sache sollte noch einmal verhältnismäßig glücklich für sie ablaufen. Saint-Martins Fahrzeug fiel auf das flache Dach eines Bauernhauses, und Chapelle fand sich am Schlusse seiner Fahrt auf einem mächtigen Düngerhaufen wieder.
Es war ein Wunder, daß beide so ohne jegliche Kontusionen bei dem Sturz geblieben waren. Saint-Martin rief von dem Dache aus, auf dem er lag, laut nach Hilfe. Inzwischen aber waren die Bewohner des Bauernhauses durch den Aufprall des Fahrzeuges auf das Dach aufmerksam geworden und vor der Tür erschienen.
Mit größtem Erstaunen sahen die Bauern Chapelle in seiner Flugmaschine liegen und wußten nicht sogleich, was sie aus dem seltsamen Gaste und seinem Apparat machen sollten.
Droben auf dem Dache rief Saint-Martin immer noch um Hilfe. Bei der herrschenden Dunkelheit konnten die Bauern nicht gleich gewahren, woher die Hilferufe kamen, bis Chapelle sie darüber verständigte. Nachdem dieser aus seiner Maschine befreit worden war, reckte er seine Glieder und betastete und befühlte sich, ob er nicht irgendwie körperlichen Schaden genommen hätte. Er konnte noch von Glück sprechen, er war unverletzt.
Die aufs höchste erstaunten Bauern machten sich nun daran, Saint-Martin mit seinem Vehikel vom Dache herabzuholen, was immerhin mit einigen Schwierigkeiten verknüpft war.
Als die beiden Geretteten sich schließlich einander die Hände drückten, brach sich die große Neugierde und Verblüfftheit der Dorfbewohner Bahn und sie verlangten Auskunft, woher die beiden mit ihren Flugmaschinen gekommen seien.
»Durch die Luft,« antwortete Chapelle.
Die Bauern schüttelten ungläubig den Kopf, und einer derselben meinte, daß man nicht so dumm wäre, ihnen das zu glauben.
Die guten Leutchen des Ortes hatten in ihrer Abgeschiedenheit von der großen Errungenschaft der Technik in bezug auf den Menschenflug noch nicht ein Sterbenswörtchen gehört und man konnte es ihnen nicht verargen, wenn sie den Aussagen der beiden Luftschiffer mit großem Mißtrauen begegneten.
Die Heimreise mußten Saint-Martin und Chapelle jetzt, wo ihre Maschinen völlig defekt waren, mit Hilfe der Bahn antreten. Der folgende Morgen sah sie erst wieder in Paris, wo sie sofort dem Präsidenten Bourdeau von ihrem ersten Probeflug eingehenden Bericht erstatteten.
Hatte das 19. Jahrhundert im Zeichen des Dampfes gestanden, so stand das 20. in dem der Elektrizität. Und diese gewaltige Zauberin unter den Naturkräften gab dem neuen Säkulum noch ein besonderes Gepräge, indem sie eine Luftverkehrsära in die Wege leitete.
Das letzte Ergebnis des elektrischen Zeitalters war Saint-Martins Akkumulator gewesen, mit dessen Erfindung die Motorluftschiffahrt ihre endgültige Ausgestaltung erfuhr. Bis dahin hatte der angestrebte Luftverkehr in dem Stadium eines unsicheren Tastens und Fühlens nach einem idealen Fahrzeuge gestanden. In den Annalen der Aeronautik waren viele technische Versuche und Erfindungen verzeichnet, welche in ihrer Gesamtheit eine Riesensumme geistiger Arbeit darstellten, die ihrerseits wieder von weitgehendster Aufbietung hochpotenzierter Intelligenz Zeugnis ablegte.
Die, welche die Luftschiffahrt in moderne Bahnen lenkten, ein Zeppelin, Santos Dumont, Henry Farman u. a., hatten sich immerhin sehr verdient gemacht, wenn es ihnen auch nicht gelungen war, das Problem der Luftschiffahrt ganz zu lösen.
Von dem Zeitpunkte ab, wo die Lenkbarkeit der Ballons zur Tatsache geworden war, trat die Aeronautik in ein neues Stadium. Zahllose Konstruktionen liefen sich nun einander den Rang ab. Was wurde nicht alles zur Fortbewegung der Ballons ersonnen und zu Hilfe genommen. Die Motoren wurden bald mit Benzin, bald mit Spiritus, selbst sogar mit Wasserdampf und Leuchtgas angetrieben. Der Sieg über alle sollte aber einzig und allein der Elektrizität vorbehalten bleiben. Ihre Anwendung in der Aeronautik mußte notgedrungen eine Umwälzung hervorrufen, da sie die gesuchte ideale Betriebskraft für die Luftfahrzeuge repräsentierte. Die Indienststellung der elektrischen Energie gestattete, Motoren kleinster Abmessungen zu verwenden, was wesentlich zur Entlastung der Fahrzeuge beitrug.
Von dem Augenblicke an, wo die Elektrizität sich in der Aeronautik einen Platz eroberte, bemächtigte sich die französische Militärverwaltung der Saint-Martinschen Erfindung und stattete eine Anzahl Ballons mit dem neuen Akkumulator aus, nachdem ein Probeversuch ergeben hatte, daß dieser die gesuchte ideale Kraftquelle darstellte.
Hei! Wie gedachten die Herren Franzmänner nun mit ihren elektrischen Luftschiffen die anderen Staaten gänzlich auszustechen. Sie allein hatten es jetzt in den Händen, regelrechte Luftkriege zu führen und den Feind aus der Vogelperspektive anzugreifen. Das alles kam dem politisch geschwächten Frankreich äußerst gelegen. Über die Bemühungen des deutschen Michels, John Bulls und Jonathans jenseits der »großen Pfütze«, das Prée im Luftverkehr an sich zu reißen, brauchten sie sich nun keine Sorge mehr zu machen. Mit Stolz und Spott konnten sie in dieser Hinsicht auf Freund und Feind jenseits ihrer Grenzen herabsehen.
Alle die Ballonkonstruktionen, waren es nun solche nach starrem, halbstarrem oder unstarrem System, verhielten sich fürderhin zu dem neuen französischen Luftschiff wie Archen Noahs gegen das modernste Hochseeschlachtschiff.
Mit Saint-Martins Akkumulator ausgerüstet, vermochten jetzt die französischen Ballons nicht nur eine Geschwindigkeit von rund hundert Kilometer in der Stunde zu erzielen, sondern auch sich wochenlang in der Luft aufzuhalten, ohne die elektrische Zelle, welche die Antriebskraft lieferte, mit neuer Energie speisen zu müssen. Einen weiteren großen Vorteil bei der Benutzung des Saint-Martinschen Akkumulators bildete neben dem großen Aktionsradius die sehr gesteigerte Manöverierfähigkeit des Ballons. Und last not least stellten auch der ruhige Gang der Antriebsmaschinerie und eine beliebig zu steigernde oder abzuschwächende Geschwindigkeit der Ballonfahrt nicht unwesentliche Faktoren dar, die den elektrischen Antrieb in ein besonders günstiges Licht rückten. All diese Vorteile hatte die Militärverwaltung in Paris nicht unterschätzt. Mit einem gewaltigen Trumpf in der Hand vermochte sie jetzt im Konzert der Mächte den Ton anzugeben.
Bevor hier noch des weiteren wichtige Dinge aus den aeronautischen Geheimakten der französischen Regierung zur Sprache gebracht werden, soll der Leser zunächst einen Blick in die Annalen der Luftschiffahrt werfen. Jahrbücher lassen bekanntlich die Fortschritte, welche die Menschheit in bezug auf Erfindungen und Entdeckungen gemacht hat, in geordneter Zusammenstellung erkennen. So auch die, welche die aeronautische Gesellschaft, deren Sitz in Paris war, alljährlich herausgab.
Seit Zeppelins und Santos Dumonts Zeiten waren hinsichtlich der Konstruktion der Luftschiffe recht wesentliche Neuerungen zu verzeichnen gewesen. Stöbern wir darum einmal in den Annalen etwas herum.
Ein Kapitel des letzterschienenen aeronautischen Jahrbuches, betitelt »Rückblick auf die Errungenschaften des letzten Dezennium« führte unter anderem folgendes aus:
»Hatte bis vor wenigen Jahren noch das halbstarre System der Ballonkonstruktionen zu militärischer Verwendung die meisten Anhänger, so
hat sich das seit kurzem geändert. Jetzt hat das starre System sich den ihm gebührenden Vorrang erstritten. Der große Vorläufer und Bahnbrecher der Luftschiffahrt, Graf Zeppelin, hatte damals von vornherein dem starren System bei seinen Ballonkonstruktionen den Vorzug gegeben, und es gelang ihm damit auch, das Problem der lenkbaren Luftschiffahrt nach jeder Seite hin zu lösen. Dieser Aeronautiker war von Anfang an seine eigenen Wege gegangen. Stets hatte er sein Augenmerk darauf gerichtet gehabt, praktische Erfolge im großen zu erzielen. Immer hatte er angestrebt, ein Luftschiff zu konstruieren, welches als Transportmittel zu dienen und auch eine größere Anzahl Personen zu befördern vermag. So
kam es, daß sich seine Fahrzeuge durch eine außerordentliche Größe auszeichneten. Die letzte Type seiner Konstruktionen war ein Ballon, welcher eine Länge von nicht weniger als 128 Meter hatte, bei einem Durchmesser von fast 12 Meter. Eine derartige gewaltige Ballonhülle konnte die ihr zugedachte Form nur beibehalten, wenn das starre System zur Anwendung kam. Deshalb verwandte Zeppelin ein Gerippe von Aluminiumstangen, über welche er die Ballonhülle spannte. Letztere war durch 16 Querwände in ebenso viele Abteilungen geteilt, in welch letzteren sich wiederum je ein mit Gas gefüllter Ballon befand, so daß also das Luftschiff beim Defekt eines einzelnen Ballonets noch nicht außer Betrieb gesetzt wurde. Nach ähnlichem Muster ist auch die neueste Tvpe des Franzosen Briand gebaut, welche heute das französische Militärluftschiff repräsentiert, und das jetzt mit dem neuen Saint-Martinschen Akkumulator an Stelle des bisherigen Gasmotors ausgerüstet werden soll. Das Problem der straffen Form ist von Briand in der Weise gelöst worden, daß er an der tiefsten Stelle des Ballonkörpers ein elastisches Stück Paragummistoffes in die gefirnißte Seitenhülle einfügte, wodurch der Ballon bei zunehmendem Gasdruck sich entsprechend ausdehnen kann und anderseits bei Gasverlust in seiner Spannung nachgibt. Für den Fall, daß einmal ein zu hoher Gasdruck im Ballon vorherrscht, hat der Erfinder Sicherheitsventile vorgesehen, die in Tätigkeit treten, wenn die größtmöglichste Spannung des Gummistoffes erreicht ist. Eine Doppelgondel, aus einem starren Aluminiumgerüst bestehend, hängt unterhalb des Ballonkörpers und trägt den Antriebsmotor mit der übrigen Armatur. Zur Höhensteuerung ist unterhalb des Gondelgerüstes eine Art Flügelwelle angebracht. In betreff der Eigengeschwindigkeit, welche für jedes Luftschiffvon größter Wichtigkeit ist, ist ein hohes Maß bei der Briandschen Konstruktion erreicht worden. Der neue Ballon vermag leicht gegen denWind anzufahren, in welcher Hinsicht es sonst bei den früheren Konstruktionen meist übel bestellt war. Die Eigengeschwindigkeit ist ein unbedingtes aeronautisches Erfordernis. Dies leuchtet am besten ein, wenn man bedenkt, daß der Wind, mit Ausnahme von Orkanen, eine Geschwindigkeit von etwa 12 Meter in der Sekunde erreicht, und daß der Ballon diesen Winddruck nicht nur zu überwinden hat, sondern auch derLuftströmung entgegengesetzt sich verhältnismäßig schnell fortbewegen muß. Zur Steuerung im horizontalen Sinne dient bei dem Briandballon eine 10 qm große vertikal gestellte Fläche, während Neigungsänderungen des Ballons im vertikalen Sinne durch zwei je 15 qm große horizontale Flächen bewirkt werden. Der durch den Saint-Martinschen Akkumulator gespeiste Dynamomotor setzt an beiden Enden der Doppelgondel je eine spiralige Turbinenschraube in Bewegung und vermag dieser eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 5000 Touren in der Minute zu verleihen. Die bei Probeversuchen erzielte Schnelligkeit hat einen Stundenrekord von rund 100 km ergeben.«
Nächst diesen Auslassungen über den augenblicklichen Stand der Luftschiffahrt war in den Annalen der Aeronautik natürlich auch des Kardinalstücks menschlichen Erfindungsgeistes, der Saint-Martinschen Flugmaschine, ausreichend Erwähnung getan. Das gelöste Problem des Menschenfluges war bis in alle Details hinein erörtert worden.
Es genügt, wenn der Leser von folgenden Einzelheiten, wie sie in dem Jahrbuch verzeichnet waren, Kenntnis nimmt:
»Zahlreiche Vorläufer hat die Saint-Martinsche Flugmaschine in den letzten fünfzig Jahren gehabt. Das aviatische Problem war auf alle mögliche Art und Weise zu lösen versucht worden, aber erst Saint-Martin solltees gelingen, den Versuchen die Krone aufzusetzen. Als die Aeroplane, Drachenflieger und andere Konstruktionen ersonnen worden, fehlte den Technikern noch jenes Kraftmittel, welches eine schnelle Fortbewegung des Menschen in der Luft zu bewirken vermochte. Solange die Elektrizität nicht in den Dienst der Aviatiker trat, mußte die Flugfrage eine ungelöste bleiben. Da dem Menschen für das Fliegen in der Luft das Wichtigste, die Flügel, fehlen, so ist er unbedingt darauf angewiesen, den zur Fortbewegung dienenden Flügelschlag durch maschinelle Hilfsmittel zu ersetzen.
Das ist nun Saint-Martin gelungen. Die Erfindung seines Akkumulators ermöglichte eine sofortige Lösung des Flugproblems. Freilich spielt hier bei auch die eigenartige Konstruktion des Saint-Martinschen Flugapparates eine gewisse Rolle. In der Hauptsache verkörpert seine Flugmaschine eine Art Aeroplan. Ein Aluminiumgestell, in welchem der Fliegende eine bequeme, gestreckte Lage innehalten kann, trägt zu beiden Seiten zellenartig zusammengesetzte rhombisch geformte Flügel aus gepreßtem Holzstoff, während am Schwanzende des Apparates eine spiralig gewundene Luftschraube sitzt. Der Antriebsmechanismus mit dem elektrischen Akkumulator befindet sich vorn an der Maschine und kann von den Fliegenden mit beiden Händen leicht dirigiert werden. Zwei schlittenkufenartig geformte, unterhalb der Flugmaschine in der Längsrichtung angebrachte Stahlblechflächen dienen sowohl zur Steuerung als auch zum Landen.
Dieser genial erdachten Flugmaschine hat nun Saint-Martin soeben noch zwei Verbesserungen zuteil werden lassen. Die eine ermöglicht es, mit nur einem Flügelrade horizontale und vertikale Fortbewegungen auszuführen, indem für die eine oder andere Fahrtrichtung die Luftschraube nur eine Lageänderung erfährt. Die zweite Verbesserung repräsentiert eine Vorrichtung, welche es ermöglicht, mit der Flugmaschine hohe, luftverdünnte Regionen zu erreichen und sich dort eine Zeitlang aufzuhalten.
Wie verlautet, soll an der letztgenannten Verbesserung ein Deutscher, namens Bögelshausen, seinen Teil zu deren Ausgestaltung beigetragen haben.«
Soweit lauteten die Berichte in den Annalen der Aeronautik, in denen zum Schluß die anbrechende Ära des Luftverkehres in einer Weise gepriesen wurde, die für den ersten Augenblick sehr überschwenglich erschien, aber doch, wie es die Zukunft lehren sollte, ein vorausgesehenes Spiegelbild kommender Zeiten war.
»Wir werden immerhin mit einer Temperatur von dreißig(*) Grad Celsius zu rechnen haben,« hörte man den bekannten Nordpolforscher Thorlak sprechen, während sein Gegenüber, ein anscheinend in Mitte Fünfziger stehender Mann, damit beschäftigt war, eine Landkarte zu studieren.
(*) Anmerkung des Herausgebers: Gemeint sind offenbar Minusgrade.
»Wieso?«
»Wenn man bei einem solchen Kältegrad nicht die geringste körperliche Bewegung hat und stundenlang in einer Ruhelage verharren muß, so werden Sie wohl begreifen, daß man da die Kälte in doppeltem Maße verspürt,« versetzte Thorlak, ein hagerer, in Mitte Dreißiger stehender Mann, dessen ganze Erscheinung verriet, daß er schon viele körperliche Strapazen im Leben durchgemacht hatte.
»In dieser Hinsicht muß ich Ihnen beipflichten. Wir müssen sogar sehr darauf bedacht sein, daß uns die Kälte nicht zu fliegenden Leichen macht.«
»Wir setzen überhaupt unser Leben dabei in verschiedener Hinsicht aufs Spiel,« meinte Thorlak. »Sie haben von der mörderischen Gegend dort keine Ahnung. Ja, könnte man den lieben Nordpol mit Hilfe eines der Luftschiffe aufsuchen, so wäre das ein leichtes. Aber Sie wissen ja, daß sämtliche Versuche in dieser Hinsicht bisher gescheitert sind.«
Der graubärtige, über die Landkarte gebeugte Mann nickte lebhaft mit dem Kopfe und erwiderte. »So lange sich die Ballons mit Hilfe von Gas in der Luft halten müssen, wird der Nordpol niemals mit ihnen erreicht werden. Das Gas muß ja notgedrungen in solcher andauernden Kälte sich in einer Weise verdichten, daß der Ballon jede Form verliert und zusammenschrumpft wie ein vertrockneter Apfel.«
»So bleibt es also der Flugmaschine vorbehalten und wir werden wohl die ersten Opfer sein, welche die Nordpolforschung mit diesen Dingern fordert,« sagte Thorlak.
Sein visàvis blickte auf und wiegte den Kopf bedenklich hin und her. »Denken Sie? ... Sollte unser Flug zum Pol wirklich so enden? — — Wenn wir mit solcher Voraussicht die Reise antreten sollen, so wäre es doch besser, wir blieben gleich zu Hause.«
»Dann werden eben andere den Erstlingsruhm der Polentdeckung genießen.«
»Nun, vorläufig haben noch keine anderen Wagehälse das Projekt ins Auge gefaßt. Wir werden die ersten Pioniere sein, welche den eisigen Luftozean zum Pol durchqueren.«
»Es ist mir der Gedanke gekommen, daß wir, bevor wir von Spitzbergen abfahren, erst einmal einen Höhenaufstieg vornehmen. Vielleicht können wir von der Vogelperspektive aus mit Hilfe unserer Ferngläser den Nordpol liegen sehen und gewahr werden, ob es sich dort um Festland oder offenes Wasser handelt.«
»Der Gedanke ist nicht übel,« sagte Lebaudy, der ältere, die Landkarte noch immer studierende Mann. »Ehe wir eine solche Musterung aus der Vogelperspektive vornehmen können, müssen wir doch erst ein gut Teil Wegs in horizontaler Richtung nordwärts zurücklegen, damit wir auch den Nordpol innerhalb des Horizontes zu erblicken vermögen. Und dann ist es auch sehr fraglich, ob dort eine günstige Witterung herrscht und ein klarer Himmel einen Ausblick gewährt.«
Was letzteres anbetraf, schien Thorlak durch seine bisherigen Erfahrungen als Nordpolforscher die besten Hoffnungen zu hegen. »Wenn wir den Pol von oben aus der Luft her sichten könnten, so hätten wir ihn eigentlich schon entdeckt.«
»Entdeckt, ja, aber nicht betreten.«
»Das wäre also nur halbe Sache und halber Ruhm,« meinte Thorlak, »und für Halbes bin ich nicht.«
»Einen wunden Punkt für unser gefahrvolles Unternehmen bildet auch die Verproviantierung. Wir können doch unmöglich soviel Nahrungsmittel mit uns schleppen, daß wir acht bis vierzehn Tage vor Hunger und Durst bewahrt bleiben.«
»Darüber habe ich schon nachgedacht,« meinte Thorlak. »Wie mir Saint-Martin mitteilte, können die Maschinen schlimmsten Falles eine Mehrbelastung von etwa 20 Kilo aushalten, freilich auf Kosten einer höheren Auftriebsfähigkeit.«
»Wenn wir noch einen Wagehals chartern könnten, der uns den Proviant nachschleppt, so wäre dieser angeschnittene Punkt gar nicht so bedenklich,« sagte Lebaudy. »Als mein Großvater mit seinem Ballon im Jahre neunzehnhundertsechs oder sieben so berechtigtes Aufsehen erregte, da trug er sich auch schon damals mit dem Gedanken, mit Hilfe einer Flugmaschine den Nordpol zu erreichen, und er hatte eine Konstruktion derselben noch nicht einmal ersonnen, als ihm schon die Frage der Verproviantierung aufstieg und lebhafte Sorge bereitete ...«
»Hunger und Durst sind bei einer Nordpolfahrt recht schlimme Gäste,« versetzte Thorlak. »Ich kann davon ein Liedchen singen. Haben wir uns doch schon einmal bis zum Genuß von Menschenfleisch verstiegen.«
»Pfui Teufel! — — Davon habe ich übrigens in Zeitungsberichten gelesen,« entgegnete Lebaudy.
»Ich möchte vorschlagen, daß wir uns mit komprimierten Nahrungsmitteln versehen,« sagte Thorlak. »Dieselben nehmen wenig Platz ein, haben wenig Gewicht und reichen länger als frische Nährstoffe. So würde dann nur das mitzunehmende Wasser den Hauptballast bilden.«
Lebaudy fand den Vorschlag gut und erklärte sich bereit für die Beschaffung solchen Proviantes Sorge zu tragen.
»Die Welt wird ja die Augen aufreißen, wenn sie mit einem Male erfährt, daß wir den Nordpol entdeckt haben,« meinte lachend Thorlak. »Vorläufig weiß noch niemand von unserem Vorhaben, und ich hoffe, daß auch keiner vorzeitig etwas gewahr wird.«
»Wären wir nur erst mit unseren Flugmaschinen über die Grenze,« ließ sich Lebaudy vernehmen. »Die Douaniers haben jetzt auf alles ein scharfes Auge, was sich in der Luft bewegt.«
»Wir müssen die Nacht zu unserem Flug benützen.«
Die beiden Männer, welche eine so ungeheuerliche Reise planten, taten dies ohne Vorwissen der französischen Regierung, welche es wohl schwerlich zugelassen haben würde, daß jene mit ihren Flugmaschinen über die Grenzen des Landes hinausfuhren. Im stillen trafen Thorlak und Lebaudy ihre Vorkehrungen, im stillen wollten sie den Pol aufsuchen und dann, heimgekehrt, die Lorbeeren entgegennehmen, nach denen schon lange die Nordpolfahrer aller Nationen geizten.
Thorlak hatte bereits verschiedenfach Reisen im Eismeer zur Erforschung der Polargegend unternommen, aber das Glück war ihm nie recht hold gewesen. Dann, nach der Erfindung der Flugmaschine, tauchte sofort der Gedanke in ihm auf, mit einer solchen zu versuchen, dem Nordpol zu Leibe zu rücken. In Lebaudy hatte er einen begeisterten Anhänger für diese Idee gefunden. Der einzige, der von beider Vorhaben wußte, war Saint-Martin. Sie hatten ihn ins Vertrauen ziehen müssen, um überhaupt in den Besitz von Flugmaschinen zu gelangen. Saint-Martin fand die Idee großartig, versprach den beiden tiefstes Stillschweigen und stellte ihnen heimlich zwei Flugmaschinen, die ersten, welche die Werften unter seinem Regime geliefert hatten, zur Verfügung. Mit den nötigen Unterweisungen im Gebrauch derselben hatten die beiden Helden, welche auf die Suche nach dem Nordpol gehen wollten, inmitten der Nacht heimlich Probeflüge vorgenommen. Dann, als sie mit den Regeln der Flugkunst näher vertraut waren, trafen sie die letzten Vorbereitungen. um die Reise anzutreten.
Es war eine dunkle Dezembernacht, kurz nach Weihnachten, welche Thorlak zur Abfahrt aus Paris zu benützen gedachte.
Saint-Martin gab den beiden Wagehälsen das Geleite. Und als gegen Mitternacht das Mondlicht sich durch die Wolken stahl, rief Saint-Martin den abfahrenden Nordpolforschern seinen letzten Gruß zu.
Dann erhoben sich die Flugmaschinen und stiegen im Dunkel der Nacht, Lerchen gleich, senkrecht in die Lüfte. Zehn Minuten nach der Abfahrt sah Saint-Martin sie im Mondlicht hinter den Wolken verschwinden.
Ob die beiden wagemutigen Männer wohl den Pol erreichen würden? Mit dieser Frage legte sich Saint-Martin zur Nachtruhe nieder und fand die Antwort darauf im Traume, wo er mit geistigem Auge zwei ihm bekannte Gestalten auf der Polkappe des Erdballes stehen sah, welche ihm jubelnd zuwinkten.
Einige Wochen später finden wir die beiden Nordpolfahrer auf einem Vergnügungsdampfer wieder. Sie hatten es vorgezogen, die lange Reise über den Kontinent nicht mit ihren Flugmaschinen zurückzulegen, um nicht vorzeitig zu ermatten und den Proviant aufzuzehren. Ohne Aufsehen zu erregen, hatten sie sich mit ihren verpackten Vehikeln als Passagiere von dem Hamburger Dampfer »Augusta Viktoria« durch die Fluten der Nordsee tragen lassen und landeten eben bei Spitzbergen, wo der Dampfer bei Nacht vor Anker ging.
Thorlak und Lebaudy hatten jetzt die günstigste Gelegenheit, bei Nacht und Nebel mit ihren Maschinen das Schiff zu verlassen. Dieses Unternehmen hatte jedoch einige Schwierigkeit, insofern als die unter Deck verstauten Vehikel heimlich hervorgeholt werden mußten. Da dies nicht ganz ohne Aufsehen zu erregen unternommen werden konnte, so bestachen sie zwei Matrosen, welche die Nachtwache hatten. Mit deren Hilfe gelang ihnen ihr Vorhaben, und nachdem sich die beiden Matrosen durch einen heiligen Schwur zum Stillschweigen verpflichtet hatten, empfingen sie ihren Lohn in klingender Münze. Dann machten sich Thorlak und sein Genosse zur Abfahrt fertig. Nun hätte man die erstaunten Gesichter der beiden Matrosen sehen sollen, als sich die Flugmaschinen in der Stille der Nacht erhoben und sich bald über den Mastspitzen im Finstern verloren. Die Matrosen, welche bislang noch nichts von der Erfindung des Menschenfluges gehört hatten, standen wie zu Salzsäulen erstarrt da und glaubten es mit Beelzebub und einem seines Gelichters zu tun gehabt zu haben.
Noch herrschte hier oben unter dem achtzigsten Parallelgrad die drei Monate lang währende eisige Polarnacht. Wie aber auf dem Schiffe bekanntgegeben war, sollte diese in den folgenden Tagen ihr Ende erreichen. In längstens zweimal vierundzwanzig Stunden nach Ankunft des Dampfers auf Spitzbergen mußte die Sonne zum ersten Male wieder über den Horizont treten. Ein scharfer Ostwind machte die ohnehin schon herrschende starke Kälte noch unerträglicher.
Schon aber kündigte sich das Nahen des Tagesgestirns an, welches solange für diesen Breitengrad unsichtbar geblieben war. Ein heller Dämmerungsschein brach das Dunkel der Nacht und ließ die in Eis und Schnee erstarrte Gegend in ihrer ganzen Trostlosigkeit deutlicher wahrnehmen. Über einen Teil des Firmamentes wölbte sich ein farbenreiches Nordlicht, an Gestalt einer herrlichen Lichtdraperie gleichend, dem Himmel ein rötliches Kolorit verleihend.
Wunderbar eine solche Polarnacht! Leider wurde sie durch die bereits herrschende Dämmerung in ihrer Pracht wesentlich beeinträchtigt. Thorlak und Lebaudy waren von den Schönheiten der nordischen Nacht anfänglich bezaubert, bald aber verscheuchte die herrschende Kälte ihre Begeisterung und dämpfte sie bis auf ein Minimum ein.
Die beiden Flugmaschinen hatten nach der Abfahrt vom Schiff ihren Kurs stracks nordwärts genommen und hielten sich dicht hintereinander. Thorlak hatte die Tête übernommen, da er in der Polargegend allein Bescheid wußte.
»Wir können jetzt schon um unsere Gliedmaßen besorgt sein,« rief Thorlak Lebaudy zu und seine trivial klingende Mahnung ernüchterte den Angerufenen, der noch in die Naturschönheiten der Polargegend bewundernd versunken war.
»Es ist gut, daß wir in einer Pelzkleidung stecken, die uns eine gute Weile bei warmem Blut halten wird,« versetzte Lebaudy.
»Aber keine Bewegung — keine Bewegung!« rief Thorlak. »Unsere Glieder werden deshalb mit der Zeit erstarren.«
Diese entrollte Perspektive mochte wohl nicht nach Lebaudys Geschmack sein. »Wir werden unseren Flug von Zeit zu Zeit unterbrechen und uns unten ein wenig Bewegung machen müssen,« meinte er.
»Wenn es die Eisverhältnisse auf dem Meer gestatten ... Gelegentlich könnten wir vielleicht einmal auf einer besonders großen Scholle landen,« versetzte Thorlak.
»Jedenfalls wird die Kälte Herr über uns werden,« sagte Lebaudy. »Wir können unmöglich acht Stunden hintereinander, ohne uns einmal zu bewegen, fliegen.«
»Machen wir am besten jede Stunde eine Pause,« meinte Thorlak. »Der Weg in der Luftlinie bis zum Pol beträgt rund neunhundert Kilometer. Bei forcierter Fahrt können wir hundert Kilometer pro Stunde zurücklegen. Unter Einrechnung der Zeit mehrmaligen Landens hätten wir dann in etwa zwölf Stunden den Pol erreicht.«
»Ob unsere Fahrt auch so glatt sein wird wie Ihre Rechnung, lieber Freund,« scherzte Lebaudy und hielt sich scharf hinter Thorlaks Vehikel.
»Das will ich hoffen,« gab Thorlak zurück. »Aber in der Regel macht man die Rechnung ohne den Wirt. Der Kältefaktor wird uns viel zu schaffen machen. Wir können noch von Glück sagen, daß morgen die Sonne ihr Regiment hier wieder antritt.«
Unten breitete sich das Polarmeer mit den übereinandergetürmten Eisschollen in seiner ganzen Majestät aus. Das Nordlicht warf einen fahlrötlichen Schein auf den Eispanzer, mit dem sich die See umgürtet hatte. Von Zeit zu Zeit drang das Dröhnen brechender und berstender Eismassen hinauf zu den Ohren der Polentdecker. Wehe, wenn jetzt ihre Vehikel einmal den Dienst versagen und in die Tiefe hinabsinken würden! Die beiden kühnen Männer würden dann mit ihren Fahrzeugen gleich wie Nußschalen zwischen den sich ineinanderschiebenden Blöcken des Packeises zerdrückt werden. Unten also lauerte immer der Tod in seiner Schreckensgestalt auf sie.
Soweit der Blick reichte, sah man kein offenes Meer, nichts als Eis und wieder Eis.
Der Wind machte sich jetzt dazu noch stärker auf und schwoll bald orkanartig an, so daß die Propellerschrauben der Fahrzeuge nicht gegen die Luftströmung anzukämpfen vermochten. Das war ein neues Unheil. Nicht vom Fleck zu kommen oder gar nach rückwärts getrieben zu werden, das bedeutete fürwahr keinen Gewinn.
»Irgendwo in der Nähe muß eine Zyklone sein. Gott möge uns davor bewahren, daß wir in ihr Zentrum geraten,« sagte Thorlak.
Das Glück war aber den beiden hold, denn nach Verlauf einer weiteren Viertelstunde flaute der Wind wieder ab. Wie die mitgenommenen Instrumente anzeigten, befand man sich zu dieser Zeit auf einer Höhe von 87 Grad nördlicher Breite.
»Noch drei Grad und das Ziel ist erreicht,« rief Thorlak.
»Hätten wir sie nur erst zurückgelegt,« hörte man Lebaudy seufzen. »In welcher Höhe schweben wir jetzt?« fragte er dann.
Thorlak warf einen Blick auf das Barometer und erwiderte: »Rund hundert Meter!«
»Wir wollen doch einmal den Versuch machen,« sagte Lebaudy, »zu größerer Höhe aufzusteigen, um von dort aus vielleicht den Nordpol sichten zu können.«
Thorlak war damit einverstanden. In den nächsten Minuten erhoben sich dann die Fahrzeuge mit ziemlicher Geschwindigkeit in senkrechter Richtung bis zu fast 1000 Meter Höhe.
Weiter und weiter wurde der Rundblick, aber der Dämmerschein ließ eine scharfe Rekognoszierung in die Ferne nicht zu.
»Wir müssen den Tag abwarten,« meinte Thorlak, als er das Vergebliche des Vorhabens einsah. »Wenn wir hier oben noch zehn Minuten verweilen, so sind wir Kinder des Todes. Das Barometer zeigt über fünfzig*) Grad Celsius. Also schnell wieder hinab!«
Die Abtriebsschrauben rasselten, und die Vehikel sanken schnell wieder in die Tiefe. Als sie etwa 75 Meter über dem Meere schwebten, wurde der Abtrieb gestoppt und die Fahrt ging in horizontaler Richtung weiter, dem ewigen, weltfremden Pol zu.
Unter sich sahen die Luftschiffer jetzt einen breiten klaffenden Spalt in der Eisdecke des Meeres und nordwärts von diesem schien sich eine gewaltige Scholle eben abzulösen.
»Sehen Sie die Scholle dort treiben?« rief Thorlak. »Das wäre ein
*) Anmerkung des Herausgebers: Gemeint sind offenbar Minusgrade. Landungsplatz für uns. Meine Glieder sind kalt wie Eiszapfen. Ich muß mir entschieden etwas Bewegung machen.«
Lebaudy war gleichfalls für eine Landung, da auch er die halberstarrten Arme fast nicht mehr zu rühren vermochte.
Die Landung auf der Scholle ging glatt vonstatten und gab den Polarfahrern sogar Gelegenheit, hier etwas von ihrem mitgenommenen Proviant zu verzehren. Auf einer kleinern überlagernden Scholle sich niederlassend, trieben sie mit der schwimmenden Eisinsel nach Nordosten.
Thorlak gemahnte bald wieder, nachdem sich beide reichlich Bewegung geschafft hatten, an den Aufstieg. Die Zeit war kostbar und mußte ausgenützt werden.
Und weiter sausten die Flugmaschinen dem hohen Norden zu. Bald flogen sie über Packeis, bald über Stellen offenen Meeres. Von Zeit zu Zeit sichtete man auch einen treibenden Eisberg, einen Bären oder eine Robbenherde. Zum Glück machte die Dämmerung im Laufe der nächsten Stunden einem schwachen Tageslicht Platz. Schon stahlen sich die ersten Strahlen der Sonne über den Horizont hinauf zu den Wolken, diese grell beleuchtend. Die Kälte hielt sich merkwürdigerweise immer auf demselben Temperaturgrad, trotzdem man dem Pol doch näher kam. Etwa sechs Stunden mochten seit der Abfahrt von Spitzbergen verflossen sein, als Thorlak mit seinem Fernglas nordwärts einen dunklen Streifen zu Gesicht bekam.
»Hallo! Lieber Lebaudy! Dort vor uns sehe ich offenes Meer!«
Lebaudy lugte nach der angedeuteten Richtung hinüber. »Sollte also um den Nordpol herum doch offenes Wasser sein?« fragte er. »Verschiedene Nordpolfahrer haben das immer mit Bestimmtheit behauptet.«
»Aber ich, der ich die Gegend auch kenne, behaupte, daß der Nordpol ein Ort vollständiger Vereisung ist,« versetzte Thorlak. »Verlassen Sie sich darauf, lieber Lebaudy, Eis und nichts als Eis bedeckt den Pol.«
Eine Viertelstunde später sahen sich die beiden Männer wieder gezwungen, irgendwo Rast zu machen und wählten dazu einen ostwärts schwimmenden Eisberg als Ziel. Die Landung ging auf diesem Ungetüm nicht so glatt vonstatten wie vordem auf der Scholle. Bald wären die Fahrzeuge miteinander kollidiert und dann würde guter Rat teuer gewesen sein. Passierte hier in dieser Eiswüste einer der Maschinen das Geringste, so hieß das für den Insassen den sicheren Tod. Also Vorsicht und nochmals Vorsicht war für beide geboten.
Kurz nach ihrer Landung auf dem Eisberge, dessen groteske Formen für die ersten Augenblicke das Auge der Polfahrer fesselte, stieg die Sonne über den Horizont und sandte ihre ersten Strahlen herüber. Wie in eine Lichtflut schien plötzlich die ganze Gegend getaucht. Wie aus Millionen Kristallen schimmerte das goldene Sonnenlicht von Eis und Schnee reflektiert.
Endlich war der Tag angebrochen und der Augenblick gekommen, wo man den Versuch machen konnte, hoch in die Lüfte zu steigen, um aus der Vogelperspektive die Gegend des 90. Breitengrades zu überschauen.
Nachdem sich die beiden Männer auf ihrer Eisinsel etwas Bewegung gemacht und auch einen kleinen Imbiß eingenommen hatten, wurde von neuem der Flug angetreten.
Thorlak prüfte vorher noch einmal die Akkumulatoren der Maschinen, um sich zu versichern, daß ihre völlige Entladung vorläufig noch keineswegs zu befürchten war. Nach einer oberflächlichen Schätzung war man noch für mindestens 30 Stunden Fahrt mit elektrischer Energie versehen.
Also aufwärts ging es wieder. 100 — — — 300 — — — 500 Meter.
Der Rundblick über die im hellsten Sonnenschein liegende Gegend ließ erkennen, daß fern am Horizont, dort, wo der Pol liegen mußte, ein verschwommener, dunkler Streifen sichtbar war.
»Sehen Sie drüben den grauen Strich am Horizonte?« fragte Thorlak seinen Begleiter.
Dieser bejahte.
»Das ist entweder Packeis oder Festland. — — — Wir befinden uns jetzt etwa einen halben Grad vom Pol entfernt. Wenn wir noch einige hundert Meter steigen, so muß er uns zu Gesicht kommen.«
»Die Kälte hier oben ist aber entsetzlich,« hörte man Lebaudy antworten. »Kaum habe ich mir durch das bißchen Bewegung etwas warmes Blut verschafft und nun verspüre ich, daß meine Glieder wieder zu Eiszapfen erstarren.«
»Ich will Ihnen etwas sagen,« rief Thorlak zu ihm hinüber. »Da ich weniger die Kälte verspüre, so will ich allein höher steigen. Bleiben Sie hier in dieser Region oder fliegen Sie auch meinetwegen wieder hinunter in die Tiefe.«
Lebaudy war damit einverstanden, hielt sich aber doch in der erreichten Höhe, wo er gleich einem Kondor sich unbeweglich schwebend in der Luft erhielt.
Thorlak schoß inzwischen mit rapider Geschwindigkeit in die Höhe, während ihn Lebaudy mit den Blicken verfolgte, um den Kameraden nicht etwa aus den Augen zu verlieren.
Thorlak suchte, als sein Barometer etwa 900 Meter erreicht hatte, den nördlichen Horizont mit seinem Fernglas ab. Der dunkle Strich, den er vordem dort gewahrt hatte, entpuppte sich jetzt als Land. Schnell ermittelte er nun den genauen Breitengrad, auf dem er weilte, und fand, daß der 90. Grad nur noch 80 Kilometer weit entfernt sein könne. Nach oberflächlicher Schätzung war der dunkle Randstreifen etwa 40 Kilometer vom Standort der Flugmaschine entfernt. Nach diesen Ermittelungen stand es für Thorlak fest, daß der Nordpol ein kleines Festland inmitten offenen Meeres bildete. So hatten also doch die Polarforscher recht behalten, welche sich immer zu der Ansicht bekannt hatten, daß der Nordpol keine Wasserfläche bilde. Schnell ließ sich Thorlak zu seinem Gefährten wieder hernieder und rief ihm jubelnd von oben zu, daß er den Pol gesichtet habe.
»Nun, wie schaut er aus?« fragte Lebaudy mit größtem Interesse zurück.
»Insel oder Festland und bis dorthin offenes Meer,« antwortete Thorlak. »Jetzt vorwärts lieber Freund. In einer Stunde ist der Pol erreicht. Lassen wir uns bis auf hundert Meter hernieder und dann los, was die Maschinen hergeben!«
Fünf Minuten später sausten die beiden Vehikel dicht über dem Eismeer dahin und strebten dem heißersehnten Pol zu.
Näher und näher rückte das Land, welches Thorlak schon erschaut hatte. Bald unterschieden die Männer, daß es eine stark vergletscherte Küste war, auf die sie lossteuerten.
»Ja, zum Teufel!« rief Lebaudy, als er einen Blick auf seinen Kompaß geworfen hatte. »Wir fahren aber gar nicht in der Richtung nach Norden. Die Nadel zeigt doch stracks nach Osten!«
..Aber nein, lieber Lebaudy, dort ist Norden und dort ist der Pol.« Bei den letzten Worten warf er ebenfalls einen Blick auf seinen Kompaß und schien dann zu stutzen. »Alle Wetter. Sie haben recht, Lebaudy. Wir sind in einen falschen Kurs geraten. Ich verstehe aber nicht — — — Aha! Jetzt weiß ich es. Die Magnetnadel ist abgelenkt. Sie müssen nämlich wissen, daß dies hier zu erwarten war, denn der Ort des magnetischen Nordpoles deckt sich nicht mit dem des wahren Nordpoles.«
»Davon habe ich auch schon einmal gehört,« sagte Lebaudy »Das also wäre die Ursache.«
»Der magnetische Nordpol soll auf dem siebzigsten Breitengrad und sechsundzwanzigsten Längengrad westlich von Greenwich auf der Halbinsel Boothia Felix liegen.«
Thorlak berechnete nach diesen Worten schnell die Abweichung der Magnetnadel und fand heraus, daß die Vehikel wirklich genau nordwärts fuhren.
Jeder Kilometer Fahrt steigerte jetzt die Erregung unserer beiden Helden. Der Gedanke, daß ihr Fuß nun bald den Nordpol betreten sollte, versetzte sie in eine seltsame Stimmung.
So flogen sie, jeder seinen Gedanken nachhängend, dem Ziele zu. Schon tauchte die Küste, von der sich Eiszungen ins Meer hinabschlängelten, in ihrer zerklüfteten Form deutlicher vor ihnen auf, und als Thorlak sein Fernglas wieder einmal vors Auge hob, stieß er einen Ruf des Erstaunens aus.
»Was haben Sie, Thorlak?« rief Lebaudy und nahm ebenfalls sein Fernglas zur Hand.
»Bei Gott!« antwortete Thorlak. »Auf der Küste steht ein lebendes Wesen. Dort bewegt sich eine Gestalt.«
»Sollte es am Pol Menschen geben? — — Eskimos — — — undenkbar wäre es nicht, denn das Klima finde ich nicht so kalt wie bei Spitzbergen,« sagte Lebaudy.
Plötzlich lachte Thorlak laut auf. »Es ist ja nur ein Eisbär. — — Ich sehe den Meister Petz jetzt deutlich!« tönte es zu Lebaudy herüber.
Bald mußte auch Lebaudy das bestätigen.
»Hoffentlich kommen wir mit einer solchen Bestie nicht in Berührung, denn wir haben keine Waffen bei uns,« sagte er.
»Vorläufig bleiben wir in der Luft,« erwiderte Thorlak. »Wir überfliegen das Land und lassen uns erst dort nieder, wo der Polpunkt liegen muß.«
Die beiden Männer überflogen jetzt die Küste und glitten über ein weißes Schneefeld, in welchem sie von Zeit zu Zeit mächtig klaffende Spalten bemerkten.
Nach Verlauf einer halben Stunde hieß Thorlak seinen Begleiter die Maschine stoppen.
»Wir müssen uns jetzt unmittelbar in der Nähe des Poles befinden,« sagte er und prüfte seine Instrumente.
»Ich hätte mir den Pol aber doch etwas interessanter vorgestellt,« meinte Lebaudy. »Das ist ja nichts weiter als ein einziges Schneefeld.«
Thorlak gab keine Antwort, sondern maß und rechnete. Da diese Manipulation sich in der Maschine aber nicht gut mit erstarrten Händen vornehmen ließ, so gab Thorlak Lebaudy zu verstehen, daß er wieder landen wolle. Letzterer hatte nichts einzuwenden, nachdem er sich versichert hatte, daß weit und breit kein Eisbär zu erblicken war.
Die Flugmaschinen rasselten nun nieder, und zum ersten Male betrat ein Menschenfuß den Pol der Erde, den entdecken zu wollen so viele Menschen schon mit dem Leben bezahlen mußten.
Nachdem sich Thorlak ein wenig Bewegung geschafft hatte, ging er unverzüglich daran, seine Rechnung fortzusetzen und bald kam er nun auch zum Resultat.
»Hurra! noch einen Kilometer bis zum Pol!« rief er begeistert aus.
»Die kleine Strecke können wir zu Fuß zurücklegen,« meinte Lebaudy. »Machen wir uns sofort auf den Weg.«
Wenige Minuten später eilten die beiden dem Punkt zu, den man als Pol herausgerechnet hatte. Thorlak hatte es nicht versäumt, die kleine Fahne, welche an seiner Maschine eingerollt befestigt gewesen war, mitzunehmen, um diese Trikolore Frankreichs dort aufzupflanzen.
Nach einem Dauerlauf von etwa zehn Minuten, der sie einmal gründlich warm machte, gelangten die beiden Männer in die Nähe eines breiten Erdspaltes und sahen hier zu ihrer maßlosen Verwunderung ein vereistes Kreuz in den Boden gerammt
Was sollte das bedeuten? Wie kam dieses Kreuz, das nur Menschenhand dahin gesetzt haben konnte, hier an den Nordpol?
Thorlak und Lebaudy eilten starr vor Staunen auf das Holzkreuz zu, auf dem sie eingeschnitten eine Inschrift gewahrten.
»Der Pol ist also vor uns doch schon entdeckt worden!« rief Thorlak enttäuscht aus. »Der Ruhm ist uns vorweggenommen.«
»Wie schade — — — Da hätten wir also das Nachsehen,« antwortete Lebaudy und ließ sich vor dem Holzkreuz nieder, um die Inschrift zu entziffern.
Da die Inschrift auf dem Kreuz fast ganz von einer Eiskruste überzogen war, so machte sich Thorlak daran, letztere mit einem Taschenmesser zu beseitigen, was ihm schließlich auch gelang.
In schwedischer Sprache war nun folgendes zu lesen:
25. Juli 1897. Hier auf dem Nordpolpunkt schied
André, der große Polentdecker, aus dem Leben.
Seine Leiche haben wir dem nassen Grab übergeben,
und bald werden wir ihm im Tode folgen müssen.
Strindberg * Fränkel.
Erstaunt blickte Thorlak seinen Gefährten an und fand nicht gleich Worte.
»Der unglückliche André hat mit seinem Ballon damals also doch den Pol erreicht,« sagte Lebaudy, nachdem ihm Thorlak die Inschrift übersetzt hatte.
»Ja,« versetzte Thorlak. »Sie hatten ihr Ziel erreicht. Der Pol gab aber die, welche es gewagt hatten, ihn zu betreten, nicht wieder den Lebenden zurück.«
In Thorlaks Stimme lag etwas Feierliches, und Lebaudy sah, wie sein Gefährte tief ergriffen war und eine Träne im Auge zerdrückte.
Plötzlich wurden beide durch ein eigentümliches Grunzen in der Nähe aufgeschreckt.
Über den Rand der naheliegenden Eisspalte kletterte eben ein gewaltiger Eisbär, dem die beiden armen Menschlein, wenn sie sich nicht schnell genug retten konnten, zum Opfer fallen mußten.
Lebaudy war bei dem Anblick des zottigen Ungetümes zu Tode erschrocken. Aber auch Thorlak. Doch dieser ermannte sich am ehesten wieder und riß seinen Gefährten mit sich fort. So schnell als ihre Füße sie tragen konnten, eilten nun beide dem Orte zu, wo ihre Flugmaschinen lagen.
Der Eisbär schien sich aber seine Beute nicht entgehen lassen zu wollen. Einen so fetten Bissen fand er in dieser Einöde nicht wieder. Das schien er instinktiv zu fühlen, darum setzte auch er seine Beine so schnell als möglich in Bewegung.
Das war ein Laufen um Tod und Leben! Zum Glück vermochte der Bär aber nicht so schnell zu folgen. Als die beiden Männer ihre Flugmaschinen erreicht hatten und keuchend sich zur Abfahrt fertig machten, war der zottige Geselle immer noch hundert Schritt weit von ihnen entfernt.
Im letzten Augenblick vor der Abfahrt stieß Thorlak die eiserne Stange der Trikolore in den vereisten Boden des Pollandes. Dann rasselten die Auftriebsschrauben, und die Maschinen hoben sich empor, gerade in dem Augenblick, als der Bär fauchend in eine bedenkliche Nähe gekommen war.
Wehe den beiden, wenn der Mechanismus ihrer Vehikel nicht sofort funktioniert hätte. Sie hätten dann wohl das Los Andrés und seiner Genossen hier teilen müssen.
Tief aufatmend erhoben sich Thorlak und Lebaudy, in die Lüfte. Und fort ging es, rückwärts, dem sonnigen Süden zu.
So glücklich ihre Reise bisher abgelaufen war, so sollten sie aber doch auf der Rückfahrt Unglück haben.
Wie spätere Berichte in französischen Zeitungen der Welt zur Kenntnis brachten, waren die beiden Luftschiffer durch einen Wirbelsturm in die Nähe von Grönland verschlagen worden, wo ihre Maschinen miteinander kollidierten. Einem Walfischfänger hatten dann Thorlak und Lebaudy ihre Rettung zu verdanken.
Als zwei bleiche, abgezehrte Gestalten kehrten die kühnen Polentdecker wieder in ihre Heimat zurück, die ganze Welt durch ihre Mitteilungen in größtes Erstaunen versetzend.
Der Nordpol war entdeckt, aber nicht von französischen Forschern, Schweden erntete den Ruhm, sein André war seit dem Tage der Schöpfung der erste Mensch gewesen, der den Polpunkt der Erde betreten hatte.
Hatte den Kulturvölkern des Abendlandes bis vor kurzer Zeit noch gebangt, daß einmal die gelbe Rasse im Osten ans Ruder der Weltherrschaft gelangen könnte, so schwanden diese Bedenken bei ihnen von dem Augenblicke an, wo die Technik ihnen die Mittel in die Hand gegeben hatte, den Luftozean zu erobern. Wie ohnmächtig waren doch jetzt »die Gelben«, deren Flotten und Heere in den letzten Jahrzehnten so bedrohlich gewachsen waren. Ein kleines Luftgeschwader war bei einer Offensive gegenüber den gewaltigsten Wehrmitteln zu Lande und zu Wasser allzeit im Vorteil.
Die großmächtig gewordenen Japaner und ihre Verbündeten, die Chinesen, waren seit Saint-Martins Erfindung mit einem Schlage samt ihren hochfliegenden Plänen, ganz Asien in ihre Gewalt zu bringen, aufs Trockene gesetzt und politisch zu einer Null geworden.
Drüben im Abendlande baute man Luftflotten, mit denen man die ganze Welt zu erobern gedachte. Die europäischen Großmächte hatten sich sämtlich alliiert und ein Vertragsabkommen getroffen, wonach keine die andere unter Zuhilfenahme von Militärballons und Flugmaschinen bekämpfen durfte. Zu Wasser und zu Lande waren Kriege untereinander gestattet. Die Franzosen allein, aus deren Mitte derjenige hervorgegangen war, welcher als der Begründer der Luftverkehrsära angesehen wurde, hatten sich vertraglich das Recht vorbehalten, im Kriegsfalle ihre Luftflotte gegen den Feind zu verwenden, gleichviel wer es sei. Dieses Zugeständnis seitens der anderen Staaten hatte aber durch einen besonderen Passus eine Beschränkung erfahren. Dieser bestimmte, daß Frankreich seine Luftflotte im Kriegsfalle nur bei einer Defensive anwenden dürfe, das heißt, wenn es von einer Macht angegriffen wurde. Erklärte Frankreich einem anderen Staat den Krieg und ging zum Angriff über, so war es ihm nicht gestattet, seine Militärballons dabei zu verwenden.
Diesem europäischen Abkommen hatten die amerikanischen Staaten beizutreten sich noch nicht entschließen können. Die tonangebenden Vereinigten Staaten von Nordamerika hatten vorläufig von den europäischen Luftflotten nicht allzuviel zu befürchten, da diese schwerlich die lange Reise über den Ozean zurückgelegt hätten, nur um Bruder Jonathan etwas zu bombardieren. Präsident Bryan und seine Untertanen jenseits der »großen Pfütze« wollten es zunächst einmal abwarten, wie sich die Dinge während der neuen Luftverkehrsära gestalten würden, ehe man sich mit den Europäern alliierte. Unter den europäischen Großmächten schwamm Frankreich zunächst einmal obenauf, und es war der erste Staat, welcher sich eine aeronautische Wehrkraft und ein eben solches Verteidigungssystem schuf. Wenn die anderen Großmächte die Schaffung der französischen Luftflotte mit bedenklichen Augen ansahen und diesem Bedenken auch Worte verliehen, so beschwichtigte der Franzmann sie mit der von ihm abgegebenen Erklärung, daß er seine aeronautischen Schiffe zum wenigsten für den Kriegsfall erbaut hätte, daß er vielmehr damit eine friedliche Durchdringung Europas im Sinne habe.
John Bull und der deutsche Michel zuckten bei dieser von Frankreich abgegebenen Erklärung jedesmal nervös mit den Augenwimpern, wenn sie dieselben zu hören bekamen. Diese beiden Großmächte, besonders Deutschland, hatten ja seit den Zeiten der brenzlichen Marokkoangelegenheit her allen Grund, einer »friedlichen Durchdringung« sich recht mißtrauisch gegenüberzustellen.
So standen also die Dinge, als man in Paris eifrig daran ging, besondere Werften zur Erbauung einer Luftflotte zu errichten. Der Marschall Mirabeau, der augenblickliche Oberbefehlshaber des französischen Landheeres, war von dem Präsidenten Bourdeau zum Chef der Luftflotte im voraus ernannt worden, und dieser bildete sich nun einen Generalstab, zu welchem er alle bisherigen Offiziere des Luftschifferkorps heranzog. In aller Eile wollte er dann eine neue Taktik und Strategie für einen zukünftigen Ballonkrieg schaffen. Was eine solche Aufgabe bedeuten will, das kann man ermessen, wenn man bedenkt, daß eine Kriegführung in der Luft weder an ein Gelände noch an eine Wasserfläche gebunden ist, sondern daß sich eine solche in tausenden von Ebenen bewegen kann. Hierzu kommt noch, daß Blockaden und Bombardements durch Luftschiffe eine ganz andere Ausführung erlangen, als solche jetzt üblich sind.
Genug! Die Herren Luftstrategen hatten alle Hände voll zu tun, wollten sie mit ihrer Zukunftsflotte rasch ins richtige Fahrwasser geraten.
Anschließend an die Werft, auf der die Militärballons erbaut wurden, hatte man ein gewaltiges Arsenal errichtet. Dieses Gebäude, fast einen halben Kilometer lang und ebenso breit, dessen Bedachung ineinander verschiebbar war, sollte Raum für nicht weniger als fünfzig Militärballons bieten. In unmittelbarer Nähe des Arsenals sollte dann noch ein zweites für eine Flugmaschinenabteilung errichtet werden. Dieses Depot und das Arsenal nebst der Werft stellten die Anfänge der Gründung einer französischen Luftschifferarmee dar.
An allen Landesgrenzen wurden dort, wo sich Militärforts befanden, kleine aeronautische Arsenale errichtet. Der Instandhaltung der Festungen und Forts schenkte man fürderhin nicht mehr solche Aufmerksamkeit wie zuvor und verwendete die dafür bisher verausgabten Summen in der Hauptsache zur Erbauung der Luftflotte.
In aller Eile wurden die bisherigen Militärballons, soweit sich dies nach den vorliegenden Plänen ermöglichen ließ, umgebaut und mit den Saint-Martinschen Akkumulatoren versehen. Da man die Militärballons sowohl der Feuersgefahr halber, als auch um sie nicht zu überlasten, nicht mit schweren Geschützen armieren konnte, was man gar zu gern getan hätte, so trug man sich mit der Absicht, dieselben mit einem Granatenmagazin auszurüsten.
Ein Schauder überfällt den Leser, wenn er sich im Geiste vorstellt, wie die Kriegsluftschiffe einen Granatenhagel auf die Feinde herabsenden, der unter diesen Tod und Verderben speit.
Mord ist's, kein Krieg mehr, wenn Menschenmassen durch solche Schreckensprojektile in Stücke zerrissen werden.
Von den umgebauten Militärballons harrten bereits zwei, »La Patrie« und »La Flêche« ihrer Indienststellung. Gleich bei den ersten Probeflugversuchen sollten deren vom Kapitän Favre eigens für diesen Zweck konstruierten Granatschleudern in Aktion treten. Um die verheerenden Wirkungen dieses Geschoßhagels studieren zu können, hatte Präsident Bourdeau die Kammern veranlaßt, in den Ankauf eines zehn Kilometer westlich von Paris liegenden Dorfes einzuwilligen. Die Bewohner des letzteren wurden für ihr Besitztum ausreichend vom Staat entschädigt und hatten den Ort binnen drei Tagen zu verlassen. Als das ganze Dorf leer war, sollten dann die beiden Militärballons über ihm manöverieren. In dem einen derselben, dem Flaggschiff, »La Patrie«, befanden sich Präsident Bourdeau, Kriegsminister Quesnel, Marschall Mirabeau, Saint-Martin, zwei Maschineningenieure und noch eine Anzahl hohe Militärs nebst dem Kapitän des ehemaligen Luftschifferkorps, Raymond. Der Ballon La Patrie führte keine Geschosse mit sich und diente während des Manövers ausschließlich zur Beobachtung.
Der andere Militärballon dagegen barg einige tausend Granaten in seinem Geschoßmagazin unterhalb der Gondel, und sein Kapitän Vernois hatte die Ordre, stets zwanzig Meter unter dem Kommandoballon zu manöverieren.
Saint-Martin fungierte bereits in seiner ihm verliehenen neuen Stellung als Chefingenieur der Luftflotte. Ihm unterstanden sämtliche Chargen, die technisch im Luftschifferkorps tätig waren, also alle Ingenieure, Aeronautiker, Maschinisten und ähnliche Mannschaften. Als Generaldirektor der neuen Luftschiffwerft kommandierte Saint-Martin über nicht weniger als rund dreitausend Mann Arbeitspersonal. Im Aeroadmiralstab spielte er als erster technischer Beirat selbstredend die größte Rolle.
Trotzdem er alles andere aber kein Militär war, zogen ihn die militärischen Berater des Präsidenten bei ihren Erwägungen hinsichtlich der zu Schaffenden neuen Taktik und Strategie zu Hilfe, da sie hierbei über technische Einzelheiten, wie die Feststellung des Aktionsradius, der Auf- und Abtriebsgeschwindigkeiten und anderes mehr aufs Genaueste orientiert sein mußten.
Also, das erste Ballonmanöver begann. Die Witterung war der Auffahrt der beiden Fahrzeuge durchaus günstig. Kein widriger Wind machte eine volle Inanspruchnahme der Akkumulatoren nötig.
Heller Sonnenschein lag über dem Dorf La Muette, welches einer Beschießung durch die Luftschiffe zum Opfer fallen sollte. In einem Umkreise von mehr als zehn Kilometer war die verlassene Ortschaft durch eine Militärpostenkette gegen die Außenwelt abgesperrt. Hinter diesem Schutzring hatte sich eine ungeheure Menge Menschen aller Stände zu Fuß, zu Wagen oder zu Pferde eingefunden, und ungezählte Tausende Ferngläser aller Gattungen richteten sich von diesem Menschengewühl auf die hoch oben in der Luft manövrierenden Ballons.
Die vorteilhafteste Stellung unter dieser Menge hatten eine Anzahl hohe Militärs, Deputierte und sonstige Würdenträger der Republik eingenommen. Für sie war eine Tribüne innerhalb der militärischen Absperrung errichtet worden. Unmittelbar neben dieser befand sich noch eine zweite für die Spezialberichterstatter der Presse. Von diesen waren freilich nur die Vertreter französischer Zeitungen zugelassen, und es herrschte eine strenge Aufsicht, daß kein unbefugter fremder Korrespondent sich in ihre Reihen unbemerkt einnistete, der der Welt vielleicht unliebsame Enthüllungen über militärische Transaktionen in der Auslandspresse öffentlich bekanntgeben konnte. Den französischen Berichterstattern war es andrerseits zur strengsten Pflicht gemacht worden, intimeren Einzelheiten des kleinen Manövers in ihren Artikeln keine Erwähnung zu tun.
Wie zwei Adler kreisten die Militärballons, La Patrie und La Flêche, hoch oben in den Lüften, im Zenit des Dorfes La Muette. Unter sich eine herrliche, sonnenbeschienene Landschaft, deren Peripherie ein breiter schwarzer Saum von Menschenmassen bildete, hinter dem südwärts zahllose Türme und Kuppeln von Paris lichtumsäumt herüberglänzten. Dazwischen schlängelte sich seitwärts wie ein schimmerndes Band die Seine in ihrem Lauf nach Norden. Der kalte Wintertag — es war Mitte Januar — war der Fernsicht vom Ballon aus überaus günstig, da die Luft ungemein klar war und die Morgennebel sich längst zur Erde gesenkt hatten.
Hin und wieder schossen Vögel in ihrem Fluge durch das luftige Manöverterrain und schienen sich zu beeilen, aus der Nähe der schwankenden, braunen Ungetüme, die sich da oben in ihrem Element tummelten, zu kommen.
Unten wartete begierig die gaffende Menge auf das angesetzte verderbenspeiende Feuerwerk der neuen Luftartillerie. Schon über eine Stunde manöverierten die Ballons über La Muette und man schien mit dem Bombardement noch gar keine Anstalten zu treffen. Das hatte seinen Grund darin, daß die Besatzung der Ballons erst allerlei andere taktische und strategische Versuche unternahmen. Es wurde zunächst die Manövrierfähigkeit der Fahrzeuge ausprobiert, die günstigste Höhenlage für einen artilleristischen Angriff ermittelt, die mechanische Rückwirkung der zwanzig Geschoßschleudern auf die Ballongondel im voraus theoretisch berechnet und auch Ermittelungen angestellt, welchen Aktionsradius die fortgeschleuderten Granaten nordsüd- und ostwestwärts bedecken würden. Und noch tausenderlei andere strategische und technische Dinge hätten bei diesem Probemanöver eigentlich in Beratung gezogen werden müssen, aber die Zeit war zu kurz, darum konzentrierte der aeronautische Generalstab seine Berechnungen und Aufmerksamkeit nur auf die allerwichtigsten Fragen und Punkte.
»In welcher Höhe schweben wir jetzt?« fragte im Kommandoballon Präsident Bourdeau den Manöverleiter.
Mirabeau warf einen Blick auf das Barometer. »Fünfhundertzwanzig Meter, Herr Präsident,« erwiderte der Marschall.
»Halten Sie diese Höhe zur Abschleuderung der Granaten für geeignet?« frug Bourdeau weiter.
»Ich vermag hierauf keine definitive Antwort zu geben. Die Versuche werden uns darüber erst orientieren.«
»Eine Grundbedingung im Kriegsfalle wäre es für jeden Ballon, sich möglichst außer Schußweite feindlicher Landartillerie zu halten,« meinte Quesnel, der Kriegsminister.
»Bei den letzten artilleristischen Versuchen ist doch der höchste Punkt der Flugbahn der Geschosse ermittelt worden?« fragte Bourdeau weiter.
»Sehr wohl, Herr Präsident,« versetzte Quesnel. »Es ist mit einem Vierzigzentimeterküstengeschütz ermittelt worden, daß bei einer Elevation des Rohres von fünfundvierzig Grad das Geschoß eine Höhe von rund zehntausend Meter zu erreichen vermag, während die gesamte Länge der Flugbahn etwa dreißig Kilometer beträgt.«
»Dieses Ergebnis ist für die Militärballons ein recht bedenkliches,« sagte der Präsident und runzelte die Stirn. »Da ist doch kein Luftfahrzeug vor den Kugeln der Landartillerie sicher.«
»Nein,« versetzte Quesnel hastig. »Die Ballons können von den Landgeschützen wie Spatzen aus der Luft heruntergeschossen werden. Trotzdem aber sind die Ballons gegen die Artillerie im Vorteil, denn die Treffsicherheit der letzteren auf sich schnell bewegende Ballons im Zenith ist eine äußerst geringe. Hierzu kommt noch, daß die Luftartillerie die feindliche Landartillerie, ehe diese vielleicht zum Feuern kommt, bei Nacht überraschen und durch einen Granatenhagel vernichten kann.«
»Der Feind wird aber Tag und Nacht vor den Ballons auf der Hut sein und im Dunkeln sicher mit Scheinwerfern operieren,« sagte Bourdeau.
Die von dem Präsidenten eingeworfenen Argumente waren stichhaltig genug, um den Strategen der Luft klar zu machen, daß der Entwurf einer neuen Taktik ihnen noch zahllose Nüsse zu knacken aufgab.
Der Kommandoballon führte unter anderen Instrumenten auch einen Funkentelegraphenapparat mit sich, dessen dreißig Meter lange Antennendrähte zur Aufnahme der elektrischen Wellendepeschen unterhalb der Gondel hingen.
Einige Kilometer von dem Dorfe La Muette entfernt hatte eine Funkentelegraphenabteilung Aufstellung genommen, mit der man jetzt zu korrespondieren anfing, um ein Bild zu gewinnen, ob ein telegraphischer Verkehr vom Lande zu den Luftfahrzeugen hinauf ein günstiges Ergebnis liefere.
Nachdem auch diese Versuche gelungen waren, wurde vom Kommandoballon nach unten hin durch ein Flaggensignal ein Zeichen gegeben, daß nunmehr mit dem Bombardement gegen La Muette begonnen würde.
11 Uhr 25 Minuten vormittags setzten sich die durch elektrischen Antrieb betätigten Geschoßschleudern in stark pendelnde Bewegung. Die Mannschaft des Ballons La Flêche ließ dann durch die Röhren der Schleudern die Granaten gleiten. Eine nach der anderen. Und alles ging so blitzschnell, daß innerhalb weniger Minuten hunderte der furchtbaren Geschosse wie ein dichter Hagel nach allen Seiten hin geschleudert wurden und auf die Häuser des Dorfes mit rapider Schnelligkeit hinabsausten.
Das Platzen der zahllosen Granaten und das Zusammenstürzen der dadurch stark beschädigten Gebäude verursachte in der Umgebung von La Muette ein so starkes Getöse, daß sich viele der Zuschauer die Ohren zuhielten. Dazu wirbelten Staubsäulen und grauschwarze Rauchwolken im Verein mit züngelnden Flammen von der Trümmerstätte auf. Zur Nachtzeit hätte dies wohl ein schauerlich schönes Bild abgegeben.
Die Wirkung der alles vernichtenden Geschosse war von den Ballons aus genau zu verfolgen und die Zerstörung des Dorfes wurde von den Luftschiffern etappenweise im Bild photographisch festgehalten.
Kein Haus in La Muette blieb von den Granaten verschont. Die Zerstörung war tatsächlich eine allgemeine. Und mit Zufriedenheit sahen die, welche das Werk der Vernichtung angerichtet hatten, auf das Dorf, welches jetzt dem Erdboden fast gleich gemacht war. Aber auch mancher von den hohen Herren im Ballon mochte im stillen an einen Zukunftskrieg zwischen zwei Staaten denken und sah bereits im Geiste ganze Armeekorps verstümmelt auf dem Schlachtfelde liegen. Ja, die Kriege der Zukunft mußten durch die neuen Luftschiffe wahrhaft schrecklich werden! Konnte es in diesem Falle noch eine ehrliche Schlacht geben, wo die Gegner im Kampfe einander gegenüberstanden und dem Mutigsten von ihnen der Sieg blieb? Nein. Ein großes Morden hieß fürderhin jeder Krieg — — —
La Patrie und La Flêche manöverierten, nachdem das Dorf in Trümmer geschossen war, einige hundert Meter tiefer, ihre Insassen wollten das Werk der Zerstörung aus der Nähe betrachten. Die bis über Kirchturmshöhe zu den Ballons aufsteigenden Rauchsäulen brennender Gebäude und das Dröhnen einzelner nachträglich noch krepierender Granaten gemahnten die Luftstrategen an ihre eigene Sicherheit.
Die große schwarze Menge aber, welche wie eine endlose Schlange das Trümmerfeld belagerte, hatte dem Bombardement mit echt chauvinistischer Begeisterung zugesehen, und donnernd pflanzte sich durch ihre Reihen ein Vive la France! nach dem andern fort.
Punkt 12 Uhr wurde das Manöver der Ballons abgebrochen, und letztere fuhren sodann ihrem Arsenal zu, um dort zu landen.
Das erste französische Luftmanöver hatte die Verwendbarkeit der neuen Militärballons in ausreichendem Maße dargetan. Für die Franzosen schien es jetzt nur noch eine Luftschifferarmee zu geben, für Heer und Marine hatten sie kaum ein Auge, sie sahen das Heil ihres Vaterlandes in der Zukunft liegen und erhofften von der neuen Ära alles Kriegsglück. Der gallische Hahn fühlte sich deshalb mit einem Male stärker als der britische Löwe und der teutonische Adler, darum fing er nun an, in allen Tonarten zu krähen, so daß seinen Nachbarn auf dem Kontinent recht bänglich zu Mute wurde.
Doch der Schöpfer läßt keine Bäume in den Himmel wachsen. Das wurden auch die Triumphatoren an der Seine gar bald gewahr.
Nahezu ein Jahr war seit der Lösung des Menschenflugproblems dahingerauscht. Sylvester 1940 bot die Kulturwelt ein grundverschiedenes Bild von der, wie sie sich zwölf Monate früher präsentiert hatte. In der kurzen Spanne Zeit hatte eine Verkehrsumwälzung stattgefunden, wie eine solche die Lösung eines so gewaltigen Problems unbedingt nach sich ziehen mußte.
Die Luftverkehrsära hatte alles in ihren Bereich gezogen. Handel und Wandel glitten in völlig neuen Bahnen dahin. Alle Verkehrsmittel zur Erde schienen, soweit es sich nicht um gewaltige Lasttransporte handelte, nahezu überflüssig geworden zu sein. Eisenbahnen, Schiffe, Automobile und sonstige Wagen hatten das Regiment an das Luftschiff und die Flugmaschine abgeben müssen. Diese beiden Fahrzeuge waren jetzt die dominierenden Verkehrsmittel. Die Straßenbilder der Großstädte wie auch aller kleineren Ortschaften zeigten ein gänzlich verändertes Aussehen. Nicht mehr herrschte auf ihnen jener an manchen Stellen übermäßige, ja lebensgefährlich werdende Betrieb, nicht mehr überkreuzten Hochbahnen die früheren Fahrdämme und die Fußsteige wurden nur noch von wenigen Personen benutzt, ja, man sah beinahe mehr Tiere als Menschen auf den Straßen.
Ein Blick nach oben aber zeigte, daß das Luftmeer dem menschlichen Verkehr eröffnet war. Dort oben wimmelte es an manchen Stellen von Fahrzeugen aller Art. Luftschiffe größter Dimensionen, Flugmaschinen kleinster Abmessungen glitten zu Hunderten horizontal oder vertikal auf ebensoviel verschiedenen Ebenen im Luftozean dahin. Wären die Großväter dieser Kulturmenschen jetzt aus ihren Gräbern auferstanden und hätten einen Blick zum Himmel geworfen, so würden sie die Welt nicht wieder erkannt haben. Wie Heuschreckenschwärme zogen zahllose Vehikel über den Häusern und Straßen der Städte dahin. Und besonders in Paris hatte dieser Luftverkehr die ungeheuersten Dimensionen angenommen. Hier schwebte einfach alles in der Luft. Waren doch innerhalb eines Jahres nicht weniger als eine Million Flugmaschinen in der Hauptstadt an der Seine hergestellt worden und hatten schnell ihre Abnehmer gefunden. Gleichwie früher jedermann fast ein Fahrrad besessen hatte, so gab heute jeder seine ganzen Ersparnisse dahin, wenn er dafür eine Flugmaschine erstehen konnte. Und wem es nicht vergönnt war, Geld für ein derartiges Vehikel ausgeben zu können, der fand genügend Gelegenheit, gegen einen billigen Fahrpreis sich eine solche Maschine auf Stunden oder Tage zu mieten, sofern der Betreffende es nicht vorzog, im Luftverkehr die großen lenkbaren Ballons der Pariser Luftschiffgesellschaft zu benützen.
Für letztere waren sogenannte Luftbahnhöfe, zu Hunderten in der Stadt verteilt, errichtet worden. Diese bildeten mächtige, eiserne Bauwerke, welche dem alten Eiffelturm in Gestalt und Aussehen nicht unähnlich waren. Zu den Plattformen dieser turmartigen Bahnhöfe ließen sich in regelmäßigen Abständen von 5 Minuten zu 5 Minuten Luftschiffe, Schwalben gleich, zur Aufnahme von Passagieren oder zum Absetzen solcher nieder. Diese Riesenfahrzeuge besaßen Gondeln, welche mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet waren. Für eine Fahrt quer über ganz Paris hatte der Passagier nur 20 Centimes zu entrichten. Der Fahrtarif für den Fernverkehr war im Verhältnis zu den früheren Fahrpreisen zu Schiff oder per Bahn ein wesentlich niedriger.
In Paris hatte sich wie gesagt der Luftverkehr am ehesten Bahn gebrochen und im Verlauf eines Jahres einen ungeheueren Umfang angenommen. Da die Straßen fast entvölkert waren, so bewegte sich der Sicherheitsdienst selbstverständlich ebenfalls oben in der Luft. Es war eigens eine Luftpolizei geschaffen worden, welche in ihren für jedermann deutlich erkennbaren Flugmaschinen die Luft in allen Ebenen abpatrouillierte.
Dieser Luftverkehr hatte zur unabwendbaren Folge gehabt, daß die Frauenkleidung in erster Linie eine Reform erfuhr. Kein weibliches Wesen durfte die Luftverkehrswege benutzen, sofern es nicht das vorgeschriebene, der männlichen Kleidung sehr ähnliche Kostüm trug. Aber auch in vielen anderen Beziehungen hatte die neue Luftverkehrsära Wandlungen geschaffen, die in das Wirtschaftsleben der Menschheit von tiefeinschneidender Wirkung waren.
Solange der Luftverkehr sich noch im ersten Stadium befand, war jedes Fahren zur Nachtzeit behördlicherseits streng untersagt. Man wollte dadurch Unglücksfälle verhüten, solange nicht ein Verkehrsreglement ausgearbeitet und dem großen Publikum geläufig geworden war.
Die Vorschriften, welche für Tagesfahrten bestanden, zählten nach Dutzenden und ahndeten Unaufmerksamkeiten seitens der Fahrenden oder Fliegenden mit ziemlich strengen Strafen.
So spielte sich zu Sylvester 1940 das Leben in der französischen Hauptstadt wie auch anderwärts in völlig neuen Bahnen ab.
Auf dem Boulevard des Italiens, jener zu den schönsten Straßen Paris zählenden Avenue, mußte jedem ein herrlicher Sandsteinpalast im modernen Barockstil ins Auge fallen. Vor dem Gebäude zog sich eine Säulenflucht hin, welche von der eigenartigen Fassade des Hauses insoweit abstach, als sie nicht mit dem Baustil in Einklang zu bringen war. Es war unverkennbar, daß der Besitzer des Palastes seinem Baumeister nicht freie Wahl bei seinem architektonischen Entwurf gelassen hatte. Ob der entwickelte Geschmack nun etwas bizarr war oder nicht, das eine stand fest, es war ein monumentaler Palast, der von einem außerordentlichen Reichtum seines Besitzers zeugte. An dem hohen Portal prangte ein kleines Messingschild, auf welchem der Name Victor de Saint-Martin zu lesen war.
Aus dem ehemals obskuren Ingenieur war im Verlaufe eines Jahres ein vielfacher Millionär geworden. Zudem zählte Saint-Martin nächst denen, welche am Regierungsruder saßen, zu den tonangebenden, einflußreichsten Personen, die nur mit dem Finger zu winken brauchten und eine kleine Legion Mitmenschen standen dienstbeflissen zu ihrer Verfügung.
Wer nun aber annehmen wollte, daß Saint-Martin nach Erreichung großer irdischer Glücksgüter vielleicht stolz und unnahbar geworden wäre, der hatte sich geirrt. Er, der eine neue Kulturära geschaffen hatte, war und blieb, der er früher gewesen war.
Seitdem Saint-Martin seine Erfindung an die französische Regierung verkauft hatte, lebte er ganz den Seinen. Als zärtlicher Sohn vermochte er jetzt seiner alten Mutter einen schönen Lebensabend zu bereiten, und wenn seine Schwester Babette früher ihrer Armut wegen von niemand gefreit worden war, so hatte das Blättchen sich jetzt gänzlich gewendet. Seit gerüchtweise umlief, daß Saint-Martin seiner Schwester eine fürstliche Mitgift zu geben bereit war, schwirrten Scharen von Freiern wie Schmeißfliegen um den Palast am Boulevard des Italiens.
Der älteste Adel und die höchststehendsten Personen des Landes rechneten es sich zur großen Ehre an, von Saint-Martin hin und wieder einmal zur Tafel geladen zu werden.
Am letzten Tage des Jahres 1940 hatte Saint-Martin eine Sylvesterfeier großen Stiles in seinem Palais geplant. Einladungen hierzu waren an den Präsidenten der französischen Republik, an die Minister und sonstige hervorragende Persönlichkeiten der Hauptstadt ergangen.
Auch die beiden Polentdecker Thorlak und Lebaudy waren diesmal Gäste Saint-Martins. Beide trugen sich neuerdings mit der Absicht, auch den Südpol aus der Liste der unbekannten Erdteile zu streichen. Im Verein mit Saint-Martin hatten sie nämlich geplant, die zweite Polfahrt mittels eines lenkbaren Luftschiffes zu unternehmen, um nicht wieder den Fährlichkeiten wie ehemals ausgesetzt zu sein.
Geschäftige Diener eilten die teppichbelegten Treppen des Foyers im Saint-Martinschen Palast auf und ab, die letzten Vorbereitungen zu einer Sylvesternacht treffend, welche von großer Bedeutung für die ganze Welt werden sollte.
Die Lüster in den Zimmerfluchten des Palais ergossen eine wahre Lichtflut über die sich um die neunte Stunde hier versammelnden Gäste, und der liebenswürdige Herr des Hauses begrüßte die Ankömmlinge, welche zumeist mittels Luftschiff auf dem zu einem Garten umgewandelten Dache des Gebäudes eingetroffen waren. Die wenigsten Gäste kamen durch das Portal des Hauses, die Mehrheit von ihnen hatte den Luftweg benutzt und betrat das Palais von der Dachplattform aus, wo ein geräumiger elektrischer Lift die Ankommenden schnell in die unteren Räume beförderte.
Unter den Gästen fiel ein Herr mittleren Alters jedem musternden Blick sofort auf. Ein wohlgepflegter blonder Vollbart umrahmte das blasse Oval seines Gesichtes, welches unverkennbar die germanische Abstammung des Betreffenden verriet. Wohl gut, aber lässig gekleidet, schien er nicht allzuviel auf Etikette und gesellschaftliche Formen zu halten. Die französische Sprache beherrschte er mit einer Fertigkeit und Akzentuierung, wie sie Fremden, welche längere Zeit in Paris gelebt haben, eigen ist. An den unbehandschuhten Händen glänzte neben einem breiten Siegelring ein ungewöhnlich großer Diamant. Wäre sein Träger zu einem geringeren als Saint-Martin geladen worden, so würde man in bezug auf die Echtheit dieses selten großen Steines einige Zweifel gehegt haben.
Alexander Zumpe nannte sich der Herr mit dem blonden Vollbart und war angeblich Bankier von Beruf und in Geldgeschäften zu kurzem Aufenthalt in Paris.
Die meisten der geladenen Gäste kannten sich untereinander. Alexander Zumpe kannte niemand. Wie kam er in diesen Kreis? Diese Frage legte sich im stillen mancher Beobachter vor. Zweifellos stand dieser wenig distinguiert aussehende Mann zu Saint-Martin in irgendwelcher näheren Beziehung.
Im Verlauf des Abends, die letzte Stunde des Jahres rückte schon näher, sah man Saint-Martin mit Zumpe häufiger in leisem Gespräch begriffen.
Selbst der Präsident Bourdeau konnte sich nicht rühmen, an diesem Abend von dem Herrn des Hauses mehr in die Unterhaltung gezogen zu werden als dieser obskure Mann mit dem deutschen Gesicht.
Erst als sich der Präfekt des Seinedepartements Dubois zu einer Ansprache erhob, um dem alten Jahr den Abschied zu geben, unterbrach Saint-Martin die Unterhaltung mit Zumpe und lenkte seine Aufmerksamkeit auf den Redner und auf seine Gäste.
Dubois hielt eine wohlgeformte Rede, in der er die ungeheuer großen Errungenschaften, welche das scheidende Jahr Frankreich und der ganzen Welt gebracht hatte, hervorhob und vom kommenden Jahr noch viel erwartete. Während er die neuangebrochene Ära als dem Frieden besonders günstig hinstellte, wurde er von Zumpe, welcher sich plötzlich lebhaft erhob, untaktmäßig unterbrochen.
In ziemlich korrektem, den Ausländer aber doch sofort verratenden Französisch, platzte der Genannte die Worte heraus. »Ich finde es unbegreiflich, weshalb man hier nicht der Wahrheit die Ehre gibt, warum man den tiefsten Frieden verkündet, wo an allen Türen der Krieg hockt.«
Alle Anwesenden und auch Saint-Martin waren über die Zwischenrede des deutschen Gastes verblüfft. Am meisten der Seinepräfekt. Was erdreistete sich jener Mann, wenn er seine, Dubois, Rede in so ungebührlicher Weise korrigierte? Schon wollte er sich mit einigen scharfen Worten an Zumpe wenden, als Saint-Martin an diesen eine Frage stellte, um sich Aufklärung über seines Gastes Worte zu verschaffen. Saint-Martin mochte wohl eine Erklärung empfangen haben, welche nicht tauglich war, daß sie dem Staatshaupt Frankreichs und seinen Beratern bekanntgegeben wurde, weshalb Saint-Martin schnell einige Worte an seine Gäste richtete, welche den Einwurf Zumpes jedweder politischen Wichtigkeit und alles Sensationellen entkleidete.
Zumpe wollte nun auch Saint-Martins Rede korrigieren. Dieser aber bedeutete ihm durch einen heimlichen Wink zu schweigen.
Bourdeau und auch der Seinepräfekt hatten dies versteckte Zuwinken bemerkt und wußten nicht recht, was sie davon denken sollten.
Schließlich ließ sich Bourdeau mit Saint-Martin in ein Gespräch über den Vorfall ein.
»Ich glaube, man spinnt außerhalb der Grenzen des Landes Intrigen,« meinte im Verlauf desselben der französische Präsident und suchte in Saint-Martins Augen zu lesen.
»So lange es Politik auf Erden gibt, Herr Präsident, so lange werden in allen Staaten auch Intrigen gesponnen,« versetzte Saint-Martin, »und gerade zu dieser Zeit. Man gönnt Frankreich nicht seine Vormachtstellung und möchte es gern zu Fall bringen ...«
»Besonders Deutschland,« warf der Präsident ein. »Ha! Das flickt uns ja immer am Zeuge. Der neue internationale Vertrag scheint ihm recht an der Seele zu fressen — — Ihr werter Gast hier, Monsieur de Saint-Martin, ist ja zweifelsohne ein Deutscher und hat wohl recht angedeutet, wenn er sagte, daß vor der Tür Frankreichs der Krieg hockt. Natürlich meint er damit die Tür im Osten.«
»Aber, Herr Präsident, Sie mutmaßen ...« erwiderte Saint-Martin.
»Verehrter Freund, ich mutmaße nichts. Ich weiß, daß die Herren drüben über den Vogesen uns nicht den fetten Bissen gönnen, zu dem Sie uns durch Ihre geniale Erfindung verholfen haben.«
»Und ich versichere Ihnen,« versetzte Saint-Martin mit ernstem und bestimmten Tone, »daß Sie sich irren. Deutschland allein will mit uns in Frieden leben, denn es trägt sich mit dem Gedanken, mit uns einen Zweibund zu gründen, um die anderen Mächte, welche bereits Allianz unter sich heimlich geschlossen haben, in Schach zu halten.«
»Woher sind Sie so genau unterrichtet?« frug Bourdeau und forschte wieder in Saint-Martins Zügen.
»Es ist hier nicht der Ort, Herr Präsident, die Dinge weiter zu besprechen. Jedenfalls würde ich Ihnen raten, meinem deutschen Gaste, Herrn Zumpe, mit etwas freundlicheren Gesinnungen näher zu treten.«
Bourdeau streifte mit seinen Blicken den Genannten, welcher sich soeben mit Lebaudy unterhielt und erwiderte: »Sagen Sie mir das Eine, Monsieur de Saint-Martin, stehen Sie in irgend welchen anderen als privaten Beziehungen zu diesem Deutschen?«
»Halb und halb, ja,« versetzte Saint-Martin und sein Gesicht umzog ein feines Lächeln, welches der Präsident nicht zu deuten vermochte. »Wie schon gesagt, Herr Präsident, es ist hier nicht der Ort, wo man sich etwas freier über die Dinge aussprechen könnte. Wenn Sie vielleicht Herrn Zumpe morgen eine Audienz zu geben gewillt sind, so dürften Sie sicher einige wichtige und interessante Fakten erfahren. — — Ich darf wohl darum bitten, daß wir uns jetzt über gleichgültigere Sachen unterhalten. Sie sehen, man wird schon aufmerksam auf uns.«
Das war auch der Fall, denn verschiedene Minister und sonstige im politischen Leben stehende Personen tuschelten miteinander, von Zeit zu Zeit ihren Gastgeber und den Präsidenten und nicht zuletzt auch Zumpe mit eigentümlichen Blicken streifend. Die Herren schienen sich allerlei zuzuraunen und mochten wohl aus dem Vorkommnis gewisse Schlüsse ziehen.
Inzwischen war das neue Jahr angebrochen und jeder wurde darauf erst aufmerksam, als der Deputierte Paspoil Glückwünsche für die Zukunft in kurzer aber zündender Rede ausbrachte.
Saint-Martin wollte sich nun ebenfalls zu einem Sylvestertoast erheben, als ein Diener eilig zu ihm herantrat und ihm die Mitteilung machte, das sich vor wenigen Augenblicken ein schreckliches Unglück in Paris ereignet habe. Fast zu gleicher Zeit seien oberhalb der Rue St. Honoré und der Pont Notre Dame zwei mit zahlreichen Passagieren besetzte Luftschiffe der städtischen AeroverkehrsKompagnie durch Explosion zugrunde gegangen und alle Insassen der Fahrzeuge hätten einen grauenhaften Tod gefunden.
Diese furchtbare Schreckensnachricht rief unter den fröhlichen Gästen natürlich eine wahre Panik hervor.
Saint-Martin war für den ersten Augenblick fast betäubt. Wie das Unglück sich ereignen konnte, darüber vermochte er sich selbst keine Rechenschaft zu geben. Bald aber zuckte der Gedanke ihm durchs Hirn, daß die Akkumulatoren nicht richtig funktioniert und eine explosionsfähige Vermischung von Sauerstoff sich gebildet haben könnte, die den Anlaß zu dem Untergang der Luftschiffe dann gegeben haben mochten, welche Vermutung sich auch bald bestätigen sollte.
Die Hiobsbotschaft setzte dem Feste im Palais natürlich sofort ein Ende, und Sylvester 1940 fand für Paris und seinen genialen Bürger Saint-Martin damit einen jähen Abschluß.
Wo Politik ist, ist auch Lug und Trug. Welcher Diplomat hätte das nicht schon erfahren. Herrscher lügen sich bei privaten oder öffentlichen Rendezvous einander vor aller Welt ins Gesicht und sie küssen sich und drücken sich die Hände, als wollten ihre Völker ewig wie Turteltäubchen zusammenleben. Bei solchen Gelegenheiten entlocken Majestäten mitsamt ihren Diplomaten und Höflingen der Friedensschalmei die süßesten Töne. Insgeheim aber stehen die Vasallen der am Staatsruder Sitzenden mit scharf geschliffenem Schwert bereit, unbekümmert um die eben abgegebenen friedlichsten Versicherungen ihrer Monarchen, einander zu zerfleischen, wenn auszunützende Situationen dies erheischen.
Das ist das Lied von der hohen Politik, die gewinnshalber das Heiligste verletzt, wenn es ihr im Wege steht. So lange der internationale Vertrag zwischen Frankreich und den Großmächten der Erde hinsichtlich des neuen Luftverkehrs bestand, respektierte letztere die französische Vormachtsstellung. Als aber verlautete, daß in Amerika das Problem des Menschenfluges in einer von der französischen Lösung verschiedenen Art stattgefunden habe, schien plötzlich alles außer Rand und Band geraten zu wollen. Nun wollte keine der Mächte, welche den internationalen Vertrag mit Frankreich unterzeichnet hatten, diesen noch weiter respektieren. Als erstes Resultat ergab sich hieraus ein umfangreicher Notenwechsel zwischen den Kabinetten unter sich und dem Ministerium am Quai d'Orsay in Paris.
Doch halten wir uns bei diesen diplomatischen Auseinandersetzungen nicht auf und sehen zu, wie sich die Dinge drüben in Amerika inzwischen angelassen hatten.
Seit einem Jahrzehnt befand sich bereits der Sitz der Staatsregierung nicht mehr in Washington sondern in der Riesenmetropole des Landes, in New York. Hier in dieser Stadt lebte jetzt auch der Konkurrent des großen französischen Erfinders, dem es gelungen war, das Problem des Menschenfluges nach seiner Art zu lösen.
Ehe wir auf die Persönlichkeit des Erfinders, welcher sich James Stanwood nannte, hier des näheren zu sprechen kommen, wollen wir einiges darüber verlauten lassen, welcher Art seine Erfindung war.
Wie die Natur bei allen fliegenden Geschöpfen, insbesondere bei den Vögeln, das Erheben des Tieres und Fortbewegen desselben in der Luft dadurch ermöglicht, daß sie diesen einen besonderen Organismus verlieh, so hatte auch Stanwood in ähnlicher Weise Vorkehrungen getroffen, um einen Menschenflug möglich zu machen. Der findige Amerikaner hatte die physiologische Seite des Vogelfluges vorher genau studiert und wußte, daß ein aktives Fliegen nur möglich ist, wenn der Körper des Menschen nicht nur mit künstlichen Flügeln versehen wird, welche durch mechanisches Schlagen der Luft diese unter sich zu treiben vermögen, sondern wenn er auch selbst leichter gemacht wird. Bei den Vögeln hat es bekanntlich die Natur so vorgesehen, daß zur spezifischen Erleichterung ihres Körpers sich in letzterem Luftsäcke bilden können, die von den Atemorganen aus mit Luft gefüllt werden und die sich in die Knochen verzweigen, so daß diese hohl bleiben. Ähnlich verhält es sich auch mit den Insekten, bei denen sich Luftgänge im Innern des Körpers zu großen Kanälen und Blasen entwickeln können, die ebenfalls mit Luft vollgepumpt werden.
In der Erkenntnis dieser Tatsachen hatte nun Stanwood sein Flugsystem konstruiert. Er hatte eine Körperhülle erfunden, welche elektrisch behandelten Wasserstoff enthielt, die, wenn sie um den menschlichen Körper gelegt wurde, diesen spezifisch leichter machte. In Verbindung mit dieser Gashülle hatte er ein leichtes Bambusgestell gebracht, an welchem sich vorn rechts und links fledermausartige Flügel befanden, welche durch einen Mechanismus gespannt und durch die Arme des Fliegenden beliebig betätigt werden konnten. Diese Flügel bestanden ebenfalls aus einem Bambusgestell, welches mit einer sehr elastischen Gummihaut überzogen war. Zur Steuerung hatte Stanwood ein ähnliches Gummihautgestell vorgesehen, welches seinen Platz unterhalb der Brust des Fliegenden fand und das durch die Bewegung des rechten oder linken Beines beliebig verstellt werden konnte.
Dieses Flugsystem war nun ein von dem französischen völlig verschiedenes und gegen dieses insoweit im Nachteil, als nur eine geringe Fluggeschwindigkeit dabei erreicht werden konnte, während das Saint-Martinsche Vehikel bis zu 100 Kilometer in der Stunde zurückzulegen vermochte und auch einen Aufstieg zu den höchsten Regionen ermöglichte. Das amerikanische Flugsystem hatte dagegen den Vorteil für sich, daß das Fliegen ein naturgemäßeres und in jeder Beziehung angenehmeres war, als in dem französischen Fahrzeug, worin der Körper regungslos eingezwängt war.
Die lenkbare Luftschiffahrt selbst profitierte von Stanwoods Erfindung gar nichts, während in Frankreich der neue Akkumulator sie erst zur wahren Ausgestaltung brachte. Insoweit waren die Franzosen also den Amerikanern bedeutend überlegen. Trotz alledem aber schien Stanwoods Erfindung der Saint-Martinschen ziemlich Abbruch zu tun. Und als dann auch noch ein gewisser Winsor einen Gasentwickelungsapparat erfand, der trotz seiner Kleinheit, was eben sein Vorzug war, ungeheure Quanten Gas zu entwickeln und einen Explosionsmotor damit zu treiben vermochte, da profitierte auch die Luftschiffahrt, und für die Amerikaner brach nun ebenfalls eine Luftverkehrsära an.
Mr. Stanwood, der bisher in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt, hatte aber nun mit seiner Erfindung das große Los gezogen. Sofort nach einigen Probeversuchen mit seinem Flugapparat hatte sich eine Aktiengesellschaft gegründet, welche die Erfindung in großem Maßstabe auszunützen gedachte. Diese Gesellschaft nannte sich AeronauticKompany und taufte Stanwoods Erfinderprodukt Avion. Für hunderttausende von Dollars fanden sofort Anschaffungen in Bambusholz und Rohgummi statt. Ein Heer Arbeiter wurde angestellt, und Tag und Nacht das Rohmaterial für die zukünftigen Flugapparate zubereitet.
Aber auch die Erfindung Winsors wurde von amerikanischen Großindustriellen mit Energie ausgebeutet. Die Regierung selbst gab hierzu den Ansporn, indem sie vorweg eine Anzahl Gasentwickelungsapparate von größeren Dimensionen in Auftrag gab, um ihre Luftschiffe unverzüglich damit auszurüsten.
So standen also die Dinge drüben im Lande der Yankees.
Bei einem Bankett, welches die Regierung den beiden Erfindern zu Ehren in New York gab, wurden diese seitens des Präsidenten Harrison im Auftrag des Kongresses mit einer Staatsdotation von je einer Million Dollar bedacht.
Seitdem Amerika mit Frankreich in Konkurrenz getreten war, weigerte sich letzteres hartnäckig, neue Akkumulatoren nach den Vereinigten Staaten zu exportieren und verbot der Regierung in New York strikt jede unbefugte eigene Fabrikation ihrer durch sogenanntes Weltpatent geschützten Erfindungsprodukte und drohte, im Übertretungsfalle sofort den Krieg zu erklären, wobei es noch die versteckte Andeutung machte, daß die übrigen europäischen Großmächte mit ihm gemeinsame Sache machen würden.
Doch die Yankees ließen sich nicht die Flügel beschneiden, die ihnen gewachsen waren und trumpften auf. Sie strebten schon lange nach der Weltherrschaft und wollten dieselbe nun erreichen. England, als den früher stärksten Gegner, hatte man nicht mehr zu fürchten, höchstens konnte Deutschland einige Schwierigkeiten bereiten.
Stanwood und Winsor waren im eigenen Interesse ihrer Sache ungeheuer tätig. Sie agitierten im ganzen Lande. Sie bewirkten, daß fast jeder amerikanische Bürger eine kleine oder größere Summe zur Erbauung einer gewaltigen Luftflotte zeichnete. Die Milliardäre, welchen es besonders daran liegen mußte, daß ihre Nation als zukünftige Siegerin hervorginge, bewilligten ungeheure Summen. Und nun ließ sich auch der Kongreß nicht lumpen und gab seinerseits die Summe von — sage und schreibe — hundert Millionen Dollar her. So kam insgesamt ein Fonds von rund einer Milliarde Dollar zusammen. Nach oberflächlicher Kalkulation konnte man dafür 10 000 Militärluftschiffe bauen, die als ein Riesengeschwader alle keimende Macht in Europa glatt vernichten konnten. Man sieht hier wieder einmal, wie die Amerikaner mit Riesenmitteln arbeiten, um Riesenerfolge zu erzielen.
Nachdem die Mittel für die zukünftige Luftflottille ausgebracht waren, nahm die Regierung die Erbauung der Fahrzeuge selbst sofort mit eiserner Energie in die Hand. Im Staate Pennsylvania wurden nicht weniger als hundert Werften errichtet, auf denen die Erbauung der Luftschiffe vor sich gehen sollte. Die größten Fabriken des Landes wurden mit der Herstellung der Maschinen und der sonstigen starren Teile der Ballons beauftragt. Gleichzeitig wurde in staatlichen Geschützfabriken mit der Herstellung vieler Millionen Granaten größten Kalibers begonnen.
Jeden amerikanischen Bürger mußte es im stillen grausen, wenn er daran dachte, was die 10 000 Luftschiffe mit ihrem entsetzlichen Granatenhagel auf dem Erdball für eine Verwüstung anzurichten vermochten.
Die Erbauung einer so gewaltigen Luftflottille konnte natürlich dem Auslande nicht unbekannt bleiben, und die liebe Presse allerwärts besprach die Rüstung Amerikas in einer Flut spaltenlanger Artikel. Wenn man täglich die tonangebenden Zeitungen der Erde studierte, hatte man bei der Lektüre den Eindruck, als würde nun ein Vernichtungskampf in Erscheinung treten, wie ein solcher seit Menschengedenken noch nicht dagewesen sei.
Phantasiestrategen schrieben flugs dicke Bände über einen Weltkrieg, wobei die Verleger durch den ungeheuren Umsatz, den solche Schriften fanden, erkleckliche Sümmchen für sich herausschlugen. In den Büchern und Zeitungen schossen also die Völker schon lustig aufeinander los. Die Phantasieliteraten sahen bereits Millionen von Menschen hingeopfert und alles, was eine tausendjährige Kultur geschaffen hatte, in Grund und Boden zerstört.
Insgeheim hielt aber die amerikanische Regierung die Fäden, welche ihre Diplomatie spann, eng beisammen, um ihren geplanten Coup nicht vorzeitig in die Brüche gehen zu lassen.
Die zukünftige Weltherrschaft im Luftozean schien den Yankees im voraus so sicher, daß sich in Amerika niemand mit dem Gedanken trug, die Sache könne für sie jemals schief gehen.
Mr. Stanwood und Mr. Winsor hatten miteinander einen Pakt geschlossen, die Staatsregierung zu veranlassen, ihnen noch weitere hohe Summen für ihre Erfindungen zu zahlen. Doch das Vaterland wollte sich erst dann weiter erkenntlich zeigen, sobald der geplante große Luftkrieg mit Erfolg beendet worden wäre. Der Kongreß ließ sich zu weiter nichts verstehen, erst sollte die Praxis die wirkliche Brauchbarkeit der Erfindungen im Kriegsfalle beweisen.
Das paßte nun weder Winsor noch Stanwood. Und die beiden berieten darum eines Nachts in des ersteren Wohnung, wie sie zur Erlangung weiteren Mammons einen Druck nach oben hin ausüben könnten.
Winsor hatte sich ein prächtiges Gebäude am Broadway zur Wohnung auserkoren. War er doch bereits ein kleiner Millionär, der sich in einer so fashionablen Straße ein Heim gründen konnte.
In Winsors Arbeitszimmer, welches im ersten Stockwerk des Hauses lag, fand sich also eines Abends spät Stanwood ein.
»Nehmen Sie Platz, mein Lieber,« sagte Winsor zu seinem Besucher und drückte ihm die Hand. »Sie haben Ihre Ansichten wohl inzwischen nicht geändert?«
Der Gefragte verneinte.
»Wir können weit mehr ausrichten, wenn wir gemeinsam unsere Interessen vertreten.«
Stanwood nickte.
»Aber wie am besten?« sagte Winsor, der sich in die Nähe seines Besuchers gesetzt hatte und nachdenklich mit den Fingern auf der polierten Mahagoniplatte eines in der Nähe stehenden kleinen Tischchens trommelte.
»Frankreich belohnt seine Erfinder besser,« sagte Stanwood. »Jener Saint-Martin kann sich jetzt als zehnfacher Millionär aufspielen, während wir beide rund nur eine lumpige Million einheimsen konnten.«
»Wirklich eine lumpige Abfindung,« pflichtete Winsor den etwas erbittert gesprochenen Worten seines Besuchers bei.
»Wenn ich mir es aber richtig überlege, stehen wir eigentlich den Dingen ohnmächtig gegenüber,« sagte Stanwood und zog die Stirne kraus. »Jetzt, wo wir unser Fabrikationsgeheimnis aus den Händen gegeben haben, spielen wir eben die Dummen, bis es vielleicht einmal dem hohen Kongreß einfällt, uns noch mit einer weiteren Abfindungssumme zu bedenken.«
»Ehe die Regierung einen gewaltigen Luftkrieg vom Zaune bricht, müssen wir unser Schäfchen völlig ins Trockne gebracht haben,« meinte Winsor, »denn wer weiß, wie ein solcher Weltkrieg für Amerika endet. Vielleicht stempelt er uns gar wieder zu bettelarmen Leuten.«
»Ich denke, wir machen noch einmal einen Versuch, Kongreß und Regierung zur Auszahlung einiger Millionen Dollar an uns zu veranlassen. Leisten sie unseren Wünschen keine Folge, so pfeifen wir auf unser Vaterland und machen den Herren da oben einfach einen Strich durch die Rechnung,« meinte Stanwood.
»Ahso — — —« versetzte verständnisvoll Winsor. »Sie glauben, daß man uns drüben in England oder in Deutschland etwas mehr entgegenkommen wird.«
»Daran zweifle ich nicht,« antwortete Stanwood. »Die Englishmen werden sich den fetten Happen, den wir ihnen reichen, sicher nicht entgehen lassen.«
»Damit würden wir eigentlich einen Verrat am Vaterland und an der Sache begehen.«
»Bah!— —« erwiderte Stanwood und knipste mit den Fingern. »Ich mache mir keine Skrupel darüber.«
»Und ich erst recht nicht,« versetzte Winsor.
»Na, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben.«
»All right!«
»Ich sehe es aber schon im voraus, daß wir unsere Koffer packen müssen.«
»Ich glaube auch.«
»Von unserem Verschwinden darf natürlich niemand etwas merken,« meinte Stanwood. »Machen wir also zunächst unsere Kapitalien flüssig. Wir können sie bei der Bank of England deponieren.«
»Wird das hierorts nicht auffallen?« frug Winsor.
»Nun, wir dürfen keine Vorsicht außer acht lassen, dann wird es schon gehen.«
»Wäre es nicht vielleicht besser, wir setzten uns mit Deutschland ins Einvernehmen?« frug Winsor, der in seinem Denken und Handeln immer schwankte, sobald es sich um wichtige Dinge drehte.
»Haben Sie denn nicht gehört, daß Deutschland mit Frankreich gemeinsame Sache gemacht hat?«
»Meinen Sie? Die Allianz zerschlägt sich doch wieder,« sagte Winsor.
»Die Dinge werden schon tiefer liegen,« meinte Stanwood. »Im übrigen halte ich die Englishmen für freigiebiger und darauf kommt es uns ja an. Dem Verdienste seine Kronen, und wenn sie uns daheim nicht werden, so winken sie uns anderwärts.«
»Wenn wir bei Nacht und Nebel Amerika verlassen und man uns hinterher vermißt, so wird ein großes Zetergeschrei hier erhoben werden. Und wehe, wenn man uns wieder in die Gewalt bekommt! Sie wissen ja, das Volk ist mit dem Lynchen fix zur Hand.«
Stanwood war keine ängstliche Natur, die sich durch die Konsequenzen, welche Winsor eben gezogen hatte, ins Bockhorn jagen ließ. »Es wird wohl keiner daran denken, daß wir einmal das Weite suchen könnten,« sagte er.
»Wollen Sie die Angelegenheit allein weiter verfolgen, Mr. Stanwood? Sie können ja in meinem Namen auch für mich Forderungen stellen. Was meinen Sie, wenn ich für meinen Teil noch eine Million Dollar verlange?«
Standwood platzte mit einem Lachen heraus. »Sie werden sich doch nicht mit einer solchen Lappalie zufrieden geben? Ich nicht. Wir haben immer noch das Heft in der Hand.«
»Wieviel gedenken Sie noch zu fordern, Mr. Stanwood?«
»Fünf Millionen _...« ^warf der Gefragte in einer so lässig gesprochenen Weise hin, als ob er gewohnt wäre, mit Millionen Fangball zu spielen.
»Hätten wir von vornherein Mr. Carnegie unsere Erfindungen zum Kauf angeboten, ehe der Staat sie für sich in Anspruch nahm, so hätten wir wohl eine solche Summe herausschlagen können,« meinte Winsor.
»Und ich will meine Millionen dafür haben!« rief Stanwood und schlug mit der Faust auf den Tisch, daß ein daraufstehender elektrischer Kandelaber fast umgestürzt wäre.
Winsor war bei dieser Bekräftigung von Stanwoods Antwort etwas nervös zusammengeschrocken. »Könnte man nur hinter das Geheimnis Saint-Martins kommen,« sagte Stanwood.
»Ahso — — die Konstruktion des Akkumulators?«
Stanwood nickte.
»Im großen und ganzen ist man ja mit den Einzelheiten des Akkumulators bekannt, aber es sind noch einige Details dabei, welche das Fabrikationsgeheimnis des Erfinders bilden.«
»Im Kriegsfalle werden die französischen Luftschiffe die amerikanischen an Kraft und Schnelligkeit sicher überflügeln.«
»So fest steht das noch nicht, der nächste Krieg wird das erst beweisen,« meinte Winsor. »Mein Gasexplosionsmotor ist ebenso leistungsfähig.«
Während die beiden Männer hier die Maßnahmen, welche sie in Kürze zu treffen gedachten, noch hin und her besprachen, hatte ein Dritter, ein Lauscher hinter der Tür, von der Geheimniskrämerei das Wissenswerteste erfahren. Winsors Diener, ein gewitzigter und gar nicht dummer Kopf, hatte bald die Wichtigkeit, welcher der geheimen Unterredung zwischen Winsor und Stanwood innewohnte, spitz gekriegt. Das Lauschen hinter der Tür hatte John Smith, so hieß der Diener, bisher in allen seinen früheren Stellungen schon mit Erfolg betrieben. Er verstand durch die dicksten Türen und Wände zu horchen, auch eine Spezialität.
Also besagter John Smith fand jetzt heraus, daß die geheime Verhandlung seines Herrn mit Mr. Stanwood ein gut Stück Geld einbringen konnte, wenn er nicht reinen Mund hielt.
Die Sache mußte also für die beiden Erfinder schief ablaufen.
Als sich Stanwood von Winsor trennte, war die nähere Vereinbarung endgültig getroffen worden und schon die nächsten Tage sollten das Resultat ihrer Versuche, noch weitere Geldsummen aus dem Staatssäckel herauszupressen, bringen.
Inzwischen suchte der AeroImperialismus der Yankees seine Fittiche noch weiter zu regen, was man auf dem europäischen Kontinent und auch im fernen Asien aus diesen und jenen Anzeichen gewahr wurde.
»Ist Monsieur de Saint-Martin zu sprechen?« frug ein großgewachsener Herr in elegantem Gehpelz, dem man den Englishman auf zehn Schritte weit ansah, den Pförtner des uns schon bekannten Palais auf dem Boulevard des Italiens in Paris. Der Pförtner verneinte.
»Wann kann ich den Herrn antreffen?«
Der Türhüter zuckte mit den Achseln. Wollte oder konnte er keine Auskunft geben? Das war aus seinem Gesicht nicht herauszulesen. Wahrscheinlich war ersteres der Fall. Saint-Martin wurde nämlich, seitdem er eine berühmte Persönlichkeit geworden war, täglich von zahlreichen Leuten aller Stände aufgesucht, welche die verschiedensten Anliegen hatten. So kam es, daß der Pförtner Leute oft gar nicht vorließ, von denen er glaubte, daß sie zu denen gehörten, welche das Haus überliefen.
»Ich habe Monsieur de Saint-Martin in sehr dringlichen Angelegenheiten zu sprechen,« sagte der Fremde weiter, in welchem wir Mr. Stanwood erkennen.
Dringliche Angelegenheiten. Wie viele Besucher hatten diese Worte nicht schon in den Mund genommen. Sie machten also auf den Portier gar keinen Eindruck, denn er erwiderte kurz. »Lassen Sie gefälligst Ihre Karte da. Wenn Monsieur de Saint-Martin Sie zu sprechen wünscht, so wird er Ihnen wohl Mitteilung zugehen lassen.«
Der Portier besaß eine impertinente Art, fremde Besucher abzufertigen. Das verspürte Stanwood und hatte schon eine Zurechtweisung auf den Lippen, als er sich eines Besseren besann und ohne ein weiteres Wort zu erwidern auf eine Visitenkarte einige Zeilen schrieb, diese in ein Kuvert steckte und dann letzteres verschlossen dem Pförtner einhändigte. Dann verließ Stanwood das Palais.
Um die vierte Nachmittagsstunde hielt es der Pförtner erst für notwendig, die Karte des Fremden in Saint-Martins Hände gelangen zu lassen. Kaum hatte dieser einen Blick auf die Zeilen im Kuvert geworfen, als er von seinem Schreibsessel aufsprang und unverzüglich den Pförtner zu sich herauf befahl.
»Wann war der Herr hier?« herrschte er den Türhüter an, unwillig, daß der Fremde abgewiesen worden war.
Der Pförtner mußte sich einen Augenblick besinnen, welcher Herr gemeint war. Es kamen des Tages über so viele Leute, daß er nicht gleich wußte, um wen es sich handelte.
Saint-Martin half seinem Pförtner nun sich des Betreffenden zu erinnern, indem er von dessen abgegebener Karte sprach. Das Hastige und Nervöse, was in Saint-Martins Rede augenblicklich lag und das seine Verstimmung darüber, daß er den Fremden bei seinem ersten Vorsprechen nicht gleich hatte empfangen können, zur Genüge ausdrückte, machte den Pförtner stutzig. Das war der Herr mit den dringlichen Angelegenheiten gewesen, und er hatte dessen Gesuch so wenig Wert beigemessen.
Der Pförtner mußte nun seinem Herrn des näheren beschreiben, wie der Fremde ausgesehen hatte, und Saint-Martin befahl, daß der Besucher, sobald er wiederkäme, unverzüglich zu ihm heraufgeführt würde. Dann setzte er sich an den Schreibtisch, brachte einige Zeilen zu Papier und übergab diese im versiegelten Kuvert dem Portier, damit der Brief unverzüglich an seine Adresse befördert würde.
Als der Portier das Zimmer verlassen hatte, versank Saint-Martin in Grübeln — —
Sein amerikanischer Konkurrent hier in Paris, mit der Absicht, gewisse Vorschläge machen zu wollen? — — Was konnte jenen bewegen, mit ihm in nähere Berührung zu treten? Welche Vorschläge hatte er zu machen? — —
Wieder nahm Saint-Martin Stanwoods Karte zur Hand und las halblaut vor sich hin. »Mr. Stanwood gibt sich die Ehre eines Besuches und bittet um Angabe der Zeit, wann ein Vorsprechen genehm ist. Es handelt sich um Erörterung hochwichtiger Dinge, hinsichtlich derer er mit Vorschlägen herantreten möchte — —«
Kopfschüttelnd legte Saint-Martin die Karte in seine Brieftasche und grübelte weiter darüber nach, welches Anliegen an ihn jener Stanwood wohl haben könnte. Doch er kam bei allem Sinnen zu keinem Resultat. In etwa einer Stunde mußte Stanwood kommen, dann erst wurde seine erwachte Neugierde befriedigt. Solange beschäftigte sich nun Saint-Martin noch damit, nach Anhaltspunkten zu suchen, welche den Besuch seines amerikanischen Konkurrenten etwa rechtfertigen konnten.
Während er sich behaglich auf seinem Divan hinstreckte und eine echte Bockzigarre in Brand setzte, klopfte es an der Tür, und ein Diener erschien, um mitzuteilen, daß eine junge Dame Saint-Martin zu sprechen wünsche.
Der Herr des Hauses erhob sich und erwiderte, daß er die Besucherin im Salon unten empfangen werde.
Der Diener verschwand, und Saint-Martin warf schnell einen Blick in den Spiegel, um zu prüfen, ob seine Toilette genügend in Ordnung sei, einer Dame gegenüberzutreten.
An häufige Besuche gewöhnt, sann er nicht lange darüber nach, mit welchem Anliegen die Dame, deren Karte er von dem Diener in Empfang genommen hatte, gekommen sei. Der Name Jeanne Ponchon war ihm völlig fremd.
Als Saint-Martin den Salon betrat, stutzte er. Das Gesicht der Besucherin hatte er schon einmal im Leben gesehen, fremd war es ihm keinesfalls.
»Monsieur de Saint-Martin ...« sagte die junge Dame, indem sie sich erhob und einige Schritte auf den Herrn des Hauses zutrat.
Die leise, melodiöse Stimme hatte er auch schon einmal gehört, weshalb er sein Auge forschend auf die Besucherin richtete.
»Ich habe die Ehre mit Mademoiselle Ponchon zu sprechen?« frug Saint-Martin und erfaßte die ihm entgegengestreckte Rechte der Dame.
»Erinnern Sie sich meiner nicht mehr?« frug sie mit leiser, schüchtern klingender Stimme.
»Ich kann mich wirklich nicht recht entsinnen — — — Wo sind wir eigentlich im Leben schon zusammengetroffen?«
»Im Walde bei Brügge ...« hörte man die melodische Stimme leise erwidern.
Das Auge der Besucherin senkte sich jetzt in das Saint-Martins.
Wie ein Blitz zuckte nun die Erinnerung an jenen Vorfall in ihm auf, wo er bei seinem ersten Probeflug jenes junge Mädchen vor dem Tode des Erfrierens gerettet hatte das ihm dann gänzlich aus der Erinnerung geschwunden war.
»Mademoiselle ... bei Gott! Ich hätte Sie nicht wieder erkannt!« rief Saint-Martin aus und seine Stimme nahm einen herzlichen Klang an.
»Verzeihen Sie, daß ich Sie aufgesucht habe,« sagte Jeanne Ponchon, »aber es drängte mich, meinen Retter wenigstens noch einmal zu sprechen. Ich habe lange Zeit nach Ihnen geforscht, ohne erfahren zu können, wer Sie seien und wo Sie sich aufhielten. Kürzlich ist es mir aber doch gelungen. — Seien Sie mir nicht böse, daß ich komme, um Ihnen nochmals für Ihren Beistand von Herzen zu danken.«
Wieder traf ein warmer Blick Saint-Martins Auge.
»Es war reine Christenpflicht, daß ich Ihnen damals half,« antwortete Saint-Martin. »Und ich mache es mir zum Vorwurf, mich später nicht einmal nach der Verunglückten erkundigt zu haben, welche so schwer an ihrer Lebensbürde zu tragen hatte.«
Bei diesen letzten Worten drückte er wiederholt Jeannes Hand und der Ton seiner Stimme verriet zur Genüge, daß ihm seine Besucherin alles andere aber nicht gleichgültig war.
»Es würde mir eine Freude bereiten, Sie in den Kreis meiner Familie einführen zu können,« sagte er dann weiter.
»Sie sind verheiratet — — — Monsieur de Saint-Martin,« frug Jeanne leise zurück und ihre Stimme zitterte ein wenig.
Saint-Martin verneinte und tauschte wieder einen warmen Blick mit seiner Besucherin aus.
»Meine Mutter und meine Schwester Babette werden Sie herzlich willkommen heißen,« fuhr er dann fort. — »Gedenken Sie länger in Paris zu bleiben?«
Jeanne verneinte und erzählte nun, daß ihr Stiefvater, welcher sie einstmals immer so mißhandelt hatte, inzwischen gestorben sei und sie allein in der Welt stehe. Sie habe bei einer Familie in Brügge Stellung als Erzieherin angenommen und sei dort durch Zeitungsartikel aufmerksam geworden, daß der große Erfinder des Menschenfluges bei seiner ersten Probefahrt durch belgische Lande gekommen sei. Das hätte sie auf den Gedanken gebracht, daß er derjenige gewesen, welcher ihr damals so hilfreich Beistand geleistet habe. Sie habe dann weiter geforscht und ihre Vermutung bestätigt gefunden. So sei sie denn unverzüglich nach Paris gekommen und es gereiche ihrem Herzen zur Erleichterung, ihm nochmals ihren Dank abstatten zu können.
Während Saint-Martin noch mit seiner Besucherin Worte wechselte und sie zum Abendtee zu kommen bat, wo er ihr seine Angehörigen vorzustellen beabsichtigte, ließ sich Mr. Stanwood gerade anmelden.
Das Eintreffen seines amerikanischen Besuchers gab Veranlassung zur sofortigen Verabschiedung Jeanne Ponchons. Sie versprach der Einladung Folge zu leisten, und mit einem warmen Händedruck und ebensolchem Blick verließ sie Saint-Martin, welcher die junge Dame mit eigentümlichen Gefühlen bis zur Tür geleitete.
Einige Augenblicke später wurde Mr. Stanwood vorgelassen.
Die beiden sich jetzt gegenüberstehenden Männer maßen sich mit einem schnellen Blick. Dann folgte eine höfliche Begrüßung, und Stanwood ließ sich auf einen Sessel nieder. Sein scharfes Auge ruhte nun wiederum auf seinem visàvis.
»Mr. Stanwood, es ist mir eine große Ehre, daß Sie mich aufsuchen,« begann Saint-Martin. »Ich bin natürlich sehr neugierig, welcher Art das Anliegen ist, welches Ihren persönlichen Besuch bedingt. Wenn ich nicht irre, teilten Sie mir in einigen Zeilen mit, daß Sie Vorschläge zu machen hätten, welche hochwichtige Dinge ...«
»Sehr recht,« versetzte ihm ins Wort fallend Stanwood. Dann sah er sich im Zimmer um, sich vergewissernd, daß kein unberufener Dritter anwesend war. »Ich trete mit einer außerordentlich wichtigen Angelegenheit an Sie heran, Monsieur de Saint-Martin. — Wir sind doch hier ungestört?«
Saint-Martin bejahte und schien mit Ungeduld der weiteren Ausführungen seines Besuchers zu harren.
»Es ist uns beiden gelungen,« fuhr nun Stanwood bedächtig in seiner Rede fort, »das Problem des Menschenfluges zu lösen. Jedem nach seiner Art. Wir haben deshalb auch gemeinsame Interessen. Die Welt hat uns viel zu verdanken. Zweifelsohne. — Außer uns beiden hat aber noch ein Mr. Winsor ein Anrecht, sich in unsere Interessen zu teilen ...«
»Ah! Jener Winsor, welcher den neuen Gasexplosionsmotor für die Luftschiffahrt erfand?« fiel Saint-Martin dem Sprecher in die Rede.
Stanwood bejahte. »Mr. Winsor ist mein Freund und ist soeben mit mir nach Paris herübergekommen. Er hat mich beauftragt, sein Interesse mit wahrzunehmen. Ich bin nun gekommen, um Ihnen mit einem grandiosen Vorschlag näherzutreten.«
»Und der wäre?« fragte Saint-Martin hastig.
Wieder holte Stanwood zur Begründung des von ihm zu machenden Vorschlages etwas weiter aus. »Wir wissen beide, daß jetzt Frankreich sowohl als auch Amerika sich um die Siegespalme streiten, und daß jeder von beiden Staaten nach der Weltherrschaft im Luftozean strebt. Wer diese erringen wird und welche Zustände sich überhaupt noch durch unsere Erfindungen herauskristallisieren, das vermag kein Mensch zu ermessen. Die Zukunft sowohl in politischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht liegt augenblicklich noch von einem dichten Schleier bedeckt vor uns da.«
Saint-Martin saß wie auf glühenden Kohlen. Der Amerikaner holte weit aus und kam gar nicht auf den Kern seines Anliegens zu sprechen.
»Das Streben nach der Weltherrschaft kann zu einer Selbstvernichtung der beiden jetzt tonangebenden Nationen führen,« fuhr Stanwood in der ihm gewohnten gelassenen Art zu sprechen fort. »Ich bin Amerikaner und Sie sind Franzose. Unser Vaterland weiß aber keinem so recht den Dank, wie er einem großen Erfinder unbedingt gebührt.«
Saint-Martin wußte jetzt mit einem Male, wohinaus Stanwood wollte. Ein Unzufriedener stand vor ihm, einer, dem es nach ungeheurem Reichtum und großer Macht gelüstete.
»Ich weiß zwar nicht genau,« fuhr Stanwood fort, und sein Auge ruhte forschend auf dem Gesicht seines französischen Konkurrenten, »wie Ihr Vaterland Sie belohnt hat, mit welcher Summe man Sie abgefunden, nehme aber an, daß auch Sie nicht zufriedengestellt sind.«
»Ich geize nicht nach Kronen und einem fürstlichen Vermögen,« antwortete Saint-Martin. »Es ist ja ganz schön, ungezählte Reichtümer zu sammeln, aber man muß sich auch mit wenigerem zu bescheiden wissen.«
»Ich sehe nicht ein — —« versetzte Stanwood, »warum man der Welt gegenüber so bescheiden sein soll. Ich will es Ihnen nicht verhehlen, daß ich sowohl wie Mr. Winsor uns jeder mit einer Million Dollar als Abfindung begnügen mußten. Man hat Ihnen vielleicht mehr gegeben, ich weiß es nicht.«
»Da Sie so offen über Ihre Abfindung seitens der amerikanischen Regierung sprechen,« antwortete Saint-Martin, »so will ich auch nicht mit Angaben meinerseits zurückhalten. Etwa soviel wie Sie in Dollar erhalten, habe ich in Franks bekommen. Ich stehe mich eigentlich noch schlechter als Sie.«
»Das ist verteufelt wenig,« hörte man Stanwood sprechen. »Und damit haben Sie sich zufrieden gegeben?«
»Ich denke, daß man mir in Zukunft noch weitere Einnahmen zufließen lassen wird.«
»Unsichere Sache ...« murmelte Stanwood. »Wollen Sie einen Vorschlag von mir entgegennehmen?« sagte er dann etwas lauter und sah sich wieder im Gemach um, ob kein Lauscher vorhanden war.
»Auf Ihren Vorschlag bin ich neugierig,« versetzte Saint-Martin und bot seinem Gast eine seiner duftenden Havannazigarren an.
»Darf ich bitten?«
»Thank you ...«
Während blaue Ringel der in Brand gesetzten Zigarre entwichen, fuhr Stanwood fort: »Wollen wir gemeinsame Sache machen? Wollen wir ein Komplott schmieden gegen Frankreich und die Vereinigten Staaten, um sie in die Zwangslage zu bringen, sich uns gegenüber erkenntlicher zu zeigen.«
»Glauben Sie, daß wir damit etwas ausrichten würden?«
Der Amerikaner reckte sich etwas in die Höhe und erwiderte mit blitzenden Augen: »Haben wir nicht das Fabrikationsgeheimnis unserer Erfindungen in der Hand? Ich, Sie und Mr. Winsor? — — Jede andere Großmacht würde uns fürstlich entschädigen, wenn wir uns, unzufrieden mit unserem Vaterlande, ihr mit einem Angebote nähern würden und unser Erfindungsgeheimnis an sie verkaufen. England zum Beispiel ...«
»Das wäre doch Verrat an unserem Vaterlande,« unterbrach Saint-Martin hastig seinen Besucher.
»Sie sind wohl ein glühender Patriot?« frug Stanwood zurück und suchte in den Mienen seines Gegenübers die Antwort im voraus abzulesen.
»Das nicht gerade,« versetzte Saint-Martin, »denn ich habe mehr Grund deutsch gesinnt zu sein.«
»Wieso?« frug jetzt neugierig Stanwood.
»Von mütterlicher Seite her fließt ein gut Teil deutsches Blut in meinen Adern. Mein Vater war zwar Franzose, aber er hat nicht viel französischen Chauvinismus in mir verpflanzt. Ich liebe Frankreich, hege aber in meinem Innern deutsche Gesinnung.«
»Das ist so etwas wie ein patriotisches Zwitterding,« meinte der Amerikaner und schien innerlich froh zu sein, es nicht mit einem enragierten Franzosen zu tun zu haben. »Also Verehrtester, Sie wären für eine gemeinsame Sache mit uns?«
»Ich bin eigentlich zufrieden ...«
»Sie können gar nicht voraussehen, wie die Dinge noch einmal ausgehen werden,« versetzte Stanwood. »Ringt Amerika Ihrer Nation die Weltherrschaft ab, so kann es passieren, daß Sie vielleicht einmal alles das wieder verlieren, was Sie bekommen haben und noch mehr dazu. Ich möchte Ihnen raten, sich beizeiten vorzusehen und das, was Sie aus Ihrer Erfindung herausgeschlagen haben und noch herausschlagen können, wenn Sie schlau sind, in irgend einem anderen Großstaate sicherzulegen.«
»Aber jeder andere Staat kann bei der allgemeinen Weltkrise auch in Verhältnisse geraten, durch die wir vielleicht ebenfalls um alles kommen können,« versetzte Saint-Martin.
Nachdem Stanwood seinem französischen Kollegen klar gemacht hatte, daß man mit einem fremden Staate in bezug auf die Sicherheit des erworbenen Vermögens besser daran sei als im eigenen Vaterlande, wo ja doch von jeher das Wort »Undank ist der Welt Lohn« für große Erfinder gegolten habe, ging er dazu über, Saint-Martin die Vorteile eines gemeinsamen Wirkens ins rechte Licht zu stellen und hatte schließlich auch damit Glück.
Als Stanwood sich von Saint-Martin verabschiedete, hatten sich beide dahin geeinigt, mit Winsor im Bunde, ihre aeronautischen Erfindungen an Deutschland gegen eine Entschädigung abzutreten, wenn sich Frankreich und Amerika nicht bereit erklären würden, sofort das Zehnfache der bisher geleisteten Abfindungssumme an die Erfinder zu zahlen. Ein diesbezüglicher Vertrag war von den beiden aufgesetzt und unterzeichnet worden.
Als Stanwood fort war, reute es jedoch Saint-Martin, sich mit dem Amerikaner eingelassen zu haben, aber es war nun zu spät, um unter irgend einem Vorwande wieder zurückzutreten.
Hätten Amerika und Frankreich von dem Abkommen der beiden Erfinder Kenntnis erhalten, so würden sie sicher ein gewaltiges Lamento angeschlagen und die Unzufriedenen, denen sie soviel zu verdanken hatten, in sicheren Gewahrsam gebracht haben. So aber blieb vorläufig alles Geheimnis, und es war nicht vorauszusehen, wie die Dinge noch ablaufen und wer die Weltherrschaft im Luftozean antreten würde.
In der deutschen Reichshauptstadt Berlin herrschte am 13. Mai des Jahres 1941 große Aufregung. Die Ursache war eine Verletzung des internationalen Völkerrechtes durch die Franzosen gewesen, die dazu angetan, die Deutschen daran zu erinnern, daß die Nachbarn jenseits der Vogesen durchaus nicht zu den Machthabern gehörten, von denen sie sich solches hätten gefallen lassen müssen.
Der gallische Hahn war nämlich im Bewußtsein dessen, daß er die Oberherrschaft im Luftmeer besitze, über die Grenze auf deutsches Gebiet hinübergeflattert und hatte sich dort entgegen den internationalen Abmachungen, herumgetummelt. Französische Luftschiffe hatten über dem deutschen Festungsgürtel manöveriert, und ihre Insassen sollten, wie die deutschen Zeitungen berichteten, photographische Aufnahmen der ganzen befestigten Zone in ElsaßLothringen gemacht haben. Eine solche beispiellose Frechheit konnte man sich in Berlin nicht gefallen lassen. Es hieß bereits, daß die deutsche Diplomatie ihre Verbindungen mit Paris abbrechen wolle, und daß der deutsche Gesandte, Graf von Isenburg, telegraphisch abberufen werden solle. Die Franzosen wußten nun, was ihnen bevorstand. Deutschland zog vom Leder, und jede Stunde konnte die offizielle Kriegserklärung in Paris eintreffen.
Die Herren an der Seine hatten durch das unbefugte Manöverieren mit ihren Militärballons über der deutschen Festungszone Deutschlands ganzen Zorn heraufbeschworen. Hatten sie noch vor einem Jahrzehnt die deutsche Militärmacht gefürchtet, so sahen sie jetzt kaltblütig der Entwicklung der Dinge entgegen. Ein Krieg mußte für sie bestimmt einen günstigen Ausgang nehmen, da die französische Luftflottille allein schon genügte, der Militärkraft der verhaßten Deutschen das Lebenslicht auszublasen.
Wie die Dinge hüben und drüben in diesem Augenblicke standen und welches Verhalten die anderen Großmächte zeigten, das illustrierten am besten die Leitartikel des »Figaro« und des »Germanikus«. Besonders letzteres Blatt, welches das deutsche Regierungsorgan war und seit sechs Jahren die Tête der deutschen Presse bildete, beleuchtete die durch Frankreichs Übermut geschaffene Weltlage und ließ durchblicken, daß der jetzt vom Zaun gebrochene deutschfranzösische Krieg die Ouvertüre zu einem gewaltigen Völkerringen auf dem Erdball sei.
Der Figaro brachte in seiner Morgenausgabe vom 12. Mai 1941 folgenden, aller Orten heißes Blut erzeugenden Leitartikel:
»Auf dem Welttheater haben gewisse Herrscher als Souveräne bisher tonangebender Staaten ihre Rolle ausgespielt. Was will heute noch eine Militärmacht wie Deutschland oder eine Seemacht wie England gegen die französische Luftmacht ausrichten? Die Antwort ergibt sich von selbst, wenn man einen Blick auf die stolze Ballonflottille unseres Vaterlandes wirft. Lange genug hat deutsche Macht und englisches Geld die Welt beherrscht, jetzt wird der große Tag für Frankreich anbrechen. Der gallische Hahn wird den teutonischen Adler bezwingen. Und ist er einmal niedergeworfen, sind ihm die Fänge verschnitten und die Krallen gestumpft, so wird er das Feld räumen müssen. Alle Kniffe und Schliche eines deutschen Reichskanzlers, alle brutalen militärischen Aktionen unserer lieben Nachbarn im Osten verlachen wir jetzt, wir stehen auf der Höhe der Zeit, uns gehört die Welt! Und was man jenseits des Ozeans gleich uns technisch errungen haben will, das dürfen wir mit Recht bespötteln, denn die amerikanische Luftflotte ist wie ein Kinderspielzeug, schwach und gebrechlich. Eines Winsors Konkurrenz braucht Saint Martin nicht zu fürchten, und Stanwoods Erfindung mag im Frieden von Nutzen sein, im Kriege wird sie nie und nimmer eine Rolle spielen. Darum wird Frankreich es vermögen, jede Großmacht aufs Sterbebett zu werfen. Es werden bald von Paris aus die Geschicke der Völker gelenkt werden, an der Seine wird die Weltpolitik gemacht und der Handel und Verkehr aller Welt von dort aus geleitet werden.«
Der »Germanikus«, die in der deutschen Presse das Wort führende Tageszeitung, reagierte auf den vorstehenden französischen Leitartikel mit einem ebensolchen, dessen Inhalt verriet, daß er dem Redakteur des Blattes von einem Geheimrat aus der Ministerkanzlei des Äußeren direkt in die Feder diktiert worden war. Es bleibt hier zu erwähnen übrig, daß der Deutsche Reichstag sich im Laufe der Zeiten genötigt gesehen hatte, der Presse hinsichtlich hochpolitischer Auslassungen in den Spalten ihrer Blätter etwas die Flügel zu beschneiden, indem er ein Gesetz formuliert hatte, wonach die Preßpolitik einer täglichen Zensur unterworfen war. Die Kommission, welche diese Zensur ausübte, bestand aus Reichstagsmitgliedern regierungsfreundlicher Parteien, denen das Wohl und Wehe ihres Vaterlandes und seines Herrschers am Herzen lag. Als jenes Gesetz erlassen worden, war es die höchste Zeit, daß die soviel Unheil anrichtende Tätigkeit der politischen Redakteure eingedämmt wurde. Dadurch erreichte es die Regierung, daß ihre äußere Politik immer Staatsgeheimnis blieb. So kam es denn, daß besagter Leitartikel im »Germanikus« mit diplomatischem Geschick den französischen Größenwahn ruhig wuchern und textlich wenig von den Absichten deutscherseits verlauten ließ, um so mehr aber konnte man zwischen den Zeilen lesen. Der Artikel hatte folgenden Wortlaut:
»Die sonnigen Tage des Friedens scheinen unserem französischen Nachbarn nicht mehr zu behagen. Es regen sich in ihm Expansionsgelüste. Seit Saint-Martin eine Luftflottille geschaffen, finden es die Herren an der Seine an der Zeit, dies ihren Nachbarn merken zu lassen. Wie es den Anschein hat, träumt man drüben am Quai d'Orsay von einer neuen napoleonischen Weltherrschaft. Wenn dem nur nicht ein unliebsames Erwachen auf dem Fuße folgt ... Deutschland ist stark und einig und wird es allzeit zu Lande und zu Wasser mit der französischen Luftflotte aufnehmen. Und über dem Kanal wird man den Dingen auch nicht gleichgültig gegenüberstehen. Auch Rußland und die anderen Großmächte werden nicht untätig zusehen, wie sich ein Staat durch seine Luftflotte eine Welt machtstellung zu verschaffen sucht. Und last not least dürfte noch Amerika hier ein Wörtchen mit dreinreden; die aeronautische Wehrkraft der Yankees mögen die Herren Franzosen nicht unterschätzen! Noch allzeit ist Übermut zu Fall gekommen. Ein zweites Sedan kann unseren lieben >Nachbarn vielleicht in der Luft zuteil werden.«
Die deutsche Regierung versuchte mit den in dem Leitartikel des »Germanikus« angeschlagenen Tönen Frankreich zur Besinnung zu bringen, ihm zu denken zu geben, daß die angestrebte Weltherrschaft doch nicht so leicht zu erringen sei, als es den Anschein habe. Aber der Franzmann vertraute seiner Überlegenheit, glaubte blind an die Zukunftserfolge seiner Luftflotte. Die Dinge gingen also weiter ihren Lauf.
»Auf diese Wendung der Dinge hatte ich nicht gerechnet,« sagte der Reichskanzler, als in der Nacht vom 13. zum 14. Mai 1941 im Palais an der Wilhelmstraße der Ministerrat über die Lage, in die Deutschland durch das freche Vorgehen Frankreichs gekommen war, beriet.
»Der Bankier Zumpe ist seiner Aufgabe in einer Weise gerecht geworden, daß Se. Majestät gnädigst geruht hat, ihm in meiner Gegenwart den Adel zu verleihen,« versetzte Graf von Hohenau, der Minister des Äußeren, und strich sich bei diesen Worten wohlgefällig durch seinen prächtigen Vollbart.
»Dem Stanwood ist aber doch nicht recht zu trauen,« meinte Fürst von Wutenau, der Reichskanzler.
»Ew. Durchlaucht haben dasselbe Gefühl wie ich,« warf jetzt der Minister des Innern, Graf von Friedberg, ein.
»Ich habe auch zeit meines Lebens weder einem Engländer noch einem Amerikaner in politischer Hinsicht Vertrauen entgegenbringen können«, ließ sich nunmehr der Kriegsminister Loebell vernehmen und breitete dann vor dem Reichskanzler ein Aktenstück auseinander.
»Der Vertrag mit Stanwood und Winsor?« frug Fürst von Wutenau und warf einen Blick in das Aktenstück.
»Ja, Ew. Durchlaucht.«
»Ich werde ihn Sr. Majestät morgen früh vorlegen. — Er bedarf noch der Genehmigung des Reichstages. Natürlich wird ihn die Mehrheit annehmen, dies unterliegt keinem Zweifel mehr.«
»Die zusammengeschmolzene Gegnerschaft des schwarzroten Blocks haben wir keinesfalls zu fürchten,« pflichtete der Kriegsminister bei.
»Gott sei Dank! daß bei der letzten Reichstagswahl Zentrum und Sozialdemokratie wiederum niedergerungen worden sind,« sagte der Fürst. »Eins macht mir aber noch Bedenken. Wird unter dem Ausschuß der Parteivertreter des Reichstages, welche über die Annahme des Stanwoodschen Angebotes zu entscheiden hat, sich nicht ein Verräter an der Sache finden? Wie könnten wir uns dagegen sichern? Dies ist noch ein überaus wunder Punkt. In Paris darf man beileibe nichts von diesen Dingen erfahren, wenn wir nicht wollen, daß sie noch in letzter Stunde zuschanden werden.«
Der Reichskanzler sah sich im Kreise seiner Minister um, aber keiner schien Rat zu wissen. Niemand traute den Volksvertretern des schwarzroten Blockes, die wie Kletten aneinander hingen, seit sie von Legislaturperiode zu Legislaturperiode mehr und mehr zusammengeschmolzen waren.
»Soweit ich die Sache in Erwägung gezogen habe,« fuhr Fürst von Wutenau fort, »bleibt uns nichts anderes übrig, als die Reichstagsmitglieder, welche über den Stanwoodschen Antrag zu entscheiden haben, vor Bekanntgabe des letzteren auf unverbrüchliches Stillschweigen zu vereiden. In der Geschäftsordnung des Reichstages ist ein solcher Fall der Vereidigung von Mitgliedern des Hauses nicht vorgesehen, oder vielmehr es existiert kein Paragraph, welcher einer Vereidigung entgegensteht.«
Des Reichskanzlers Vorschlag fand unter den Ministern allgemeine Zustimmung. Nur so konnte das Geheimnis gegenüber dem Auslande gewahrt bleiben. Es war kaum anzunehmen, daß sich unter den Abgeordneten des schwarzroten Blockes ein Meineidiger finden würde, denn wohl jeder hätte die außerordentlich schwere Strafe, welche auf Falscheid und Landesverrat stand, gefürchtet.
»Kaufen wir Stanwoods und Winsors Erfindung ab,« ließ sich jetzt der Kriegsminister vernehmen, »so gehen wir unvermeidlich auch einem Kriege mit den Vereinigten Staaten entgegen, und wir können noch einen schwierigen Stand bekommen, wenn Amerika sich mit Frankreich alliiert.«
Fürst von Wutenau schien dies bereits erwogen zu haben, denn er zeigte sich keineswegs durch die Bemerkung Loebells überrascht.
»Dieser Gedanke liegt sogar sehr nahe,« versetzte der Fürst. »Es gilt deshalb, ehe eine Alliierung zustande kommt, Frankreich niederzuringen. Die amerikanische Luftflotte allein wird uns dann nicht viel anhaben können. Da die Niederlande und Belgien unsere Verbündeten sind, können wir an an deren Küsten, sowie an unserer eigenen, große StrandBatterien aufstellen, durch deren Geschoßbahnen die amerikanische Luftflotte ihren Kurs nehmen müßte. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß die Amerikaner auch von den Alpen her einen Angriff unternehmen oder eine Invasion aus größter Höhe unmittelbar auf unser Land, vielleicht gar auf Berlin selbst entrieren können.«
»In Anbetracht dieser Gefahren,« sagte der Kriegsminister, »bleibt uns nichts anderes übrig, als sofort eine eigene Luftflotte zu schaffen. Es dürfen keine Mittel gescheut werden, dies so schnell wie möglich zu erreichen.«
Der Reichskanzler nickte und antwortete. »Sobald die Reichstagskommission zugestimmt und für den Ankauf der Erfindung und Erbauung einer Luftflotte dreißig Millionen Mark bewilligt hat, soll sofort eine Legion Arbeiter Tag und Nacht beschäftigt werden.«
»Welche Garantien haben wir aber,« meinte der Minister von Friedberg, »daß nicht aus der Arbeiterschar heraus Verrätereien stattfinden?«
Das war wieder ein Punkt, der zu denken gab.
Doch der Reichskanzler schien auch in dieser Beziehung nicht verlegen zu sein. Er erwiderte. »Die Herstellung der Einzelteile zu den Luftschiffen müßte unbedingt eine getrennte sein, so daß niemand als die Eingeweihten wissen, zu welchen Zwecken die hergestellten Fabrikate dienen sollen. Die Zusammenstellung der Einzelteile zu kompletten Luftschiffen müßte dann an einem isolierten Ort und durch eine Arbeiterschar erfolgen, welche von der Außenwelt völlig abgeschlossen ist. Eine strenge Aufsicht und Kontrolle würde schon hinreichen, damit nichts in die Öffentlichkeit dringt, was dem Auslande unsere Pläne verraten könnte.«
»Ich bin der festen Überzeugung,« ließ sich jetzt Finanzminister Röttger vernehmen, »daß unsere Pläne an Verräterei scheitern werden.«
»Ich möchte noch bemerken, daß sich Se. Majestät noch mit einem anderen Plane trägt,« versetzte der Reichskanzler. »Se. Majestät will aus seiner Privatschatulle die Abfindungssumme von fünfzehn Millionen Mark an Stanwood zahlen und ein Bankkonsortium soll vorerst die Summe zur Erbauung einer Luftflotte vorstrecken. Dadurch will Se. Majestät erreichen, daß der Reichstag damit nichts zu schaffen habe und alles Privatangelegenheit bleibe, wodurch einem Verrat oder einem vorzeitigen Bekanntwerden unserer Pläne vorgebeugt wird.«
Nach längerer Debatte hatte der Reichskanzler dann den Entschluß gefaßt, dem Kaiser nahezulegen, daß der Ministerrat eine private Abwicklung der Luftflottenangelegenheit gleichfalls empfehle.
Es wurde ferner beschlossen, daß schon am nächsten Tage mit der Erbauung der Luftschiffe begonnen werden solle. Da selbiges in das Ressort des Ministers Freiherrn von Henkell fiel, so ermächtigte Fürst von Wutenau diesen sofort, die erforderlichen Maßnahmen dafür zu treffen.
Die nächste Sitzung des Ministerrates endigte erst in früher Morgenstunde. So geheim sie auch gehalten worden war, brachte doch eine Berliner Zeitung in ihrer Morgenausgabe eine Notiz darüber. Freilich wußte der Berichterstatter über die Verhandlung in der Sitzung nichts zu berichten, immerhin aber genügte die Notiz dazu, im Volke Aufregung zu verursachen und auch dem Auslande zu denken zu geben.
Im alten Wallothause in Berlin erlebten die Regierungsvertreter und Abgeordneten die stürmischste Sitzung, welche der Reichstag seit seinem Bestehen zu verzeichnen hatte.
Das hohe Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Am Tische des Bundesrats war kein Sitz mehr frei. Die Herren Minister waren vollzählig erschienen, an ihrer Spitze der Reichskanzler. In der Hofloge hatte der Kaiser mit dem Kronprinzen und einer Anzahl Fürstlichkeiten Platz genommen, ein Fall, welcher seit langem nicht dagewesen war. Die Tribünen waren von Herren und Damen aus den höchsten Gesellschaftskreisen dicht besetzt und lange Reihen Berichterstatter der Presse vervollständigten das Bild des überfüllten Hauses.
Den Grund für diese denkwürdig werden sollende Reichstagssitzung am 19. Mai 1941, hatte das vorzeitige Bekanntwerden der geheimen Luftflottenpläne gebildet. Die Schuld daran wurde dem Bankier Zumpe beigemessen, welcher bei einem Interview mit dem Führer der Sozialdemokraten in dessen Wohnung unvorsichtigerweise ein Schriftstück liegen gelassen hatte, das eine private Abmachung mit dem Amerikaner Stanwood enthielt. Dieser Fund war Wasser auf die Mühle der Reichsfeinde gewesen.
Der schwarzrote Block hatte diesmal Stoff genug, gegen die Regierung zweischneidige Reden zu führen, denn es war nicht nach dem Sinn der Sozialdemokraten und Zentrumsleute, daß der Reichstag abermals große Summen für die Erbauung einer Luftflotte hergeben sollte, ganz abgesehen davon, daß mit der neuen luftigen Taktik Deutschland unbedingt kriegerischen Zeiten entgegenging.
Nachdem die erste Lesung des neuen Luftverkehrsgesetzes beendet war, wurde in die Debatte betreffs der deutschen Luftflotte eingetreten. Der Führer der Sozialdemokraten, Storbeck, hatte in einer voraufgegangenen Rede den Reichskanzler interpelliert, mit welchen Absichten sich die Regierung hinsichtlich einer zu schaffenden Luftflotte trage.
Der Reichskanzler war halb und halb vorbereitet in der Sitzung erschienen und hatte sich im stillen eine Rede zurechtgelegt, welche die durch Zumpes Unvorsichtigkeit enthüllten geheimen Pläne wieder zu verschleiern geeignet erschien.
Der Präsident, Graf von Hollweg, erteilte zunächst dem Nationalliberalen Eichberger das Wort. Dieser galt als gewandter Redner und hatte sich schon manches Verdienst um die Einigkeit der liberalen Blockpartei erworben.
Der Abgeordnete begab sich zur Rednertribüne und führte mit sonor klingender, weithin schallender Stimme folgendes aus:
»Der Abgeordnete Storbeck will einen wichtigen Fund gemacht haben, woraufhin er und seine Genossen sofort eine Interpellation bei dem Reichskanzler erlassen haben. Die reichsfeindliche Sippe zur Linken...«
Der Präsident unterbrach hier den Redner und sagte: »Herr Abgeordneter, Sie dürfen das Wort Sippe nicht gebrauchen, das ist unparlamentarisch. Ich rufe Sie zur Ordnung!«
Darob großes Gelächter und Zwischenruf: »Schwarzrote Sippe!«
Der Vizepräsident läutete mit der Glocke!
Andauerndes Gelächter zur Rechten, Gebrüll zur Linken.
Nachdem wieder Ruhe eingetreten war, fuhr der nationalliberale Abgeordnete fort:
»Da das Wort Sippe unparlamentarisch ist, so darf ich vielleicht sagen ›Coloured People‹. — — — Der Abgeordnete Storbeck wütet, daß, nachdem er ein Regierungsgeheimnis aufgedeckt hat, dem deutschen Volke wieder neue Steuerlasten aufgelegt werden sollen, um eine Luftflotte gegen Frankreich zu schaffen. Ich glaube, daß unser vielgeliebter Herr Storbeck in dem Augenblick, wo er durch das aufgefundene Schriftstück darüber instruiert wurde, daß die Regierung eine Luftflotte bauen will, beinahe in Krämpfe gefallen ist. Ein aeronautisches Geschwader zu schaffen, heißt bei ihm soviel, wie dem kleinen Manne die letzte Kartoffel aus dem Topf zu nehmen ...«
Zwischenruf: »Das letzte Huhn!« Schallendes Gelächter rechts und in der Mitte.
Die Glocke des Präsidenten ertönte wieder. Es trat Ruhe ein.
Der Redner fuhr dann fort:
»Ich wünschte, daß Deutschland in der Lage wäre, sich eine Luftflotte schaffen zu können. Leider hat sich in unserem Volke kein genialer Kopf gefunden, welcher in Konkurrenz mit Saint-Martin oder Winsor treten könnte ...«
Hier wurde der Redner wieder unterbrochen. Aus den Reihen der Sozialdemokraten kam der Zuruf. »Ist auch gar nicht nötig. Der Amerikaner will ja gegen einige Millionen dem Kriegsminister sein Geheimnis verkaufen.«
Der Abgeordnete Eichberger setzte darauf seine Rede wie folgt fort:
»Wie es sich mit dem aufgefundenen Schriftstück verhält, darüber wird der Herr Reichskanzler hier wohl die nötigen Erklärungen heute geben. Wenn die Sozialdemokraten zetern und schreien, daß die Regierung eine Luftflotte schaffen will, so kann ich die für das Wohl des deutschen Volkes so treusorgenden Herren wohl dahin beruhigen, daß es sich, falls irgend etwas an der Sache ist, hier nur um private Abmachungen handeln kann. Der schwarzrote Block ist ja seit einiger Zeit so furchtbar nervös geworden, daß er allüberall Gespenster sieht.«
Höhnisches Gelächter bei den Sozialdemokraten und den Ultramontanen.
Da der Redner die Tribüne jetzt verließ, so erteilte der Präsident dem Reichskanzler das Wort.
Fürst von Wutenau begann, nachdem er einige Schriftstücke vor sich ausgebreitet hatte, in welche er von Zeit zu Zeit einen Blick warf, die von dem Antiblock eingereichte Interpellation wie folgt zu beantworten:
»Ich bin darüber interpelliert worden, wie es sich mit einem Schriftstück verhält, welches der Bankier Zumpe bei dem Abgeordneten Storbeck verloren hat und nach welchem die Regierung die Erbauung einer Luftflotte ins Auge gefaßt haben soll. Von der Existenz dieses Schriftstückes habe ich bisher keine Ahnung gehabt. Wie ich ermittelt habe, enthält dasselbe private Abmachungen eines deutschen Finanzkonsortiums mit dem Amerikaner Stanwood zur Ausbeutung von dessen Erfindung innerhalb der deutschen Grenzen, die Regierung hat mit dieser Abmachung nichts zu schaffen. Sie steht in keiner Beziehung zu jenem Stanwood. Von der Erbauung einer Luftflotte kann eher keine Rede sein, als bis wir in den Stand gesetzt sind, durch eine ähnliche Erfindung wie sie Saint-Martin in Frankreich gemacht hat, eine Basis für dieselbe zu gewinnen.
Ich verhehle es nicht, daß wir ernsten Zeiten entgegengehen und daß wirallzeit militärisch ohnmächtig sind, so lange wir keine aeronautischeWehrkraft besitzen. — — Meine Herren! Frankreichs letztes Verhalten hat bei uns im Volke viel böses Blut gemacht und es hätte bereits zu schlimmen Folgen führen können, wenn nicht die Regierung das Sicherheitsventil gewesen wäre, durch welches der arg geschwollene deutsche Unmut wieder auspuffte. Noch schützen uns die internationalen Abmachungen gegen Frankreichs Angriffe. — Welche Abmachungen und Verträge sind aber nicht schon verletzt worden? Wie wir uns vor weiterenähnlichen wie zuletzt schützen können, das ist mir allerdings vorläufig selbst noch nicht recht zum Bewußtsein gekommen. Es sind im Volke wiederholt Stimmen laut geworden, welche an die Regierung die Forderung stellten, mit anderen Großmächten gemeinsame Sache zu machen, um den überstark gewordenen Gegner im Westen in Schach zu halten. — — Meine Herren! Mit Allianzen hat Deutschland bisher wenig Glück gehabt, deshalb hat sich auch Se. Majestät nach der Auflösung des Dreibundes nicht wieder entschließen können, neue Verbündete zu suchen. Zudem haben wir auch die ganzen Jahre hindurch unter den Nachwehen der englischen Einkreisungspolitik zu leiden gehabt. So isoliert das deutsche Pflänzchen auf seinem heimischen Boden aufwuchs, so erstarkte es dennoch und trug Blüten und Früchte zum Verdruß aller derer, welche es gar zu gern geknickt hätten. Haben wir bisher alle Schwierigkeiten, die uns entgegenstanden, immer mit Glück überwunden so hat sich das freilich etwas geändert, seitdem unser Nachbar im Westen sich eine neue Wehrkraft geschaffen hat. Die französischen Revanchegelüste sind in letzter Zeit wieder aufgelebt, und sehen wir uns natürlich gezwungen, ihnen einen Druck entgegenzustellen. Unsere aeronautischen Verteidigungsmittel sind sehr schwache, aber vielleicht doch nicht ganz zu unterschätzen. Unsere Versuche — leider sind sie vor dem Ausland kein Geheimnis geblieben — deutsche Personenverkehrsluftschiffe für den Kriegsfall zu benutzen und sie entsprechend auszurüsten, sind nicht negativ ausgefallen. Jedenfalls sind wir mit ihnen in der Lage dem französischen Luftgeschwader immerhin einigen Schaden zuzufügen, wenn wir die Fahrzeuge mit Geschützen armieren. Die letzten Manöver haben gute Resultate gezeitigt, und sehen wir im Vertrauen darauf den kommenden Dingen ruhig ins Auge. Deutschlands eiserner Reichskanzler sagte einstmals: ›Der Deutsche fürchtet Gott, sonst nichts auf der Welt!‹ Und dieser Wahlspruch soll auch fernerhin der deutsche bleiben.«
Nachdem der Reichskanzler seine Rede beendet hatte, wurde ihm stürmischer Beifall im Hause zuteil. Die jubelnden Zurufe des liberalen Blocks übertönten die Stimmen des schwarzroten Antiblocks, welcher unter gleichzeitigem Gelächter den Worten Fürst von Wutenaus mit Spott begegnete.
Nachdem wieder Ruhe eingetreten war, ergriff der Zentrumsabgeordnete Dr. Michael, der gemäßigtste der Klerikalen, das Wort zu einer im versöhnlichen Tone gehaltenen Rede und begann wie folgt:
»Nach meiner Ansicht und der meiner Freunde ...«
Hier wurde der Redner durch den Zuruf: »Die Sozialdemokraten!« welcher aus dem Lager des liberalen Blocks kam, unterbrochen. Nachdem sich der den Zuruf begleitende allgemeine Heiterkeitsausbruch gelegt hatte, fuhr der Redner mit überlauter Stimme fort:
»Nach meiner festen Ansicht und der meiner Freunde wird das Deutsche Reich, wenn die Regierung im alten Fahrwasser weitersegelt, sicher seinem Untergange entgegengehen. Daß die Regierung eine Luftflottenpolitik insgeheim betreibt und damit dem Volke neue Steuerlasten auferlegen will, das unterliegt für mich keinem Zweifel mehr. Diese Tatsache — der Reichskanzler leugnet sie ab — wird wohl einen Faktor abge ben, der die bisher immer mühsam aufrecht erhaltene Einigkeit der liberalen Blockparteien zerstört. — Der schöne Block, der sich immer so zweifelhaft bewährt hat, wird zum Sterben kommen, die Luftflottenpolitik wird der Nagel zu seinem Sarge werden ...«
Michael wurde hier durch schallendes Gelächter, von rechts und aus der Mitte kommend, für Augenblicke unterbrochen, dann fuhr er fort:
»Deutschland befolgt das Sprichwort: Einigkeit macht stark. Ja, eine wirkliche Einigkeit würde dem Volke wohl zu Nutze sein, aber sie ist im deutschen Staate eben nicht da. Die Katholiken und die kleinen Leute, welche letztere das Hauptkontingent der Sozialdemokratie stellen, werden von der Regierung so stiefmütterlich behandelt, daß sie allen Grund haben, mit denen, welche von der Sonne kaiserlicher Gunst beschienen werden, in Uneinigkeit zu leben. Ja! würde man auch den bescheidenen Forderungen der katholischen Bevölkerung ...«
Wieder erschallte großes Gelächter im Hause, dann ließ sich der Redner weiter vernehmen:
»Lachen Sie nur über das Wort bescheiden, so viel Sie wollen! — — — — Würde die Regierung die Interessen der Katholiken eben so pflegen, wie die der Protestanten, so stände es fürtrefflich im Deutschen Reiche. Unser Herrscher könnte auf ein Volk zufriedener Untertanen herabsehen und auf deren Einigkeit uneinnehmbare Burgen bauen. Der Katholizismus ist nun einmal da und hat die gleiche Berechtigung wie der Protestantismus. Man lasse doch jedem seine Rechte. Der katholische Untertan kann ein ebenso großer Patriot sein wie der protestantische. Katholiken und Protestanten sind Christen und nur geringe Glaubensunterschiede trennen sie voneinander. Warum ist man also oben so feindlich gegen uns gesinnt? Seit der Los-von-Rom-Bewegung hat man den allmählichen Untergang der katholischen Religion prophezeit. Diese Pro>pheten haben aber mit ihren Voraussagungen wenig Glück gehabt; denn die deutschkatholische Gemeinde ist noch ebenso groß wie vor dreißig Jahren. Fortgesetzt hat man uns die Flügel beschnitten, unsere Bestrebungen eingedämmt, noch immer besteht das Jesuitengesetz, ja es sind noch neue Gesetze hinzugekommen, welche in mancher Hinsicht unserer Religion schaden. Und unter solchen Verhältnissen verlangt der Staat von uns, daß wir reichstreue Untertanen und Patrioten sein sollen? — — Auf diese unsere Vorhaltungen hin sind wir schon oft damit vertröstet worden, daß man in Zukunft auch unsere Interessen in höherem Maße wahrnehmen wolle, bei den Worten ist es aber immer geblieben. Der Reichskanzler hat uns einmal erwidert, daß in der inneren Politik Wollen und Können oft zwei Dinge seien und man hätte für uns alles getan, was man gekonnt. Als Schlußrefrain dieses, uns schon oft vorgesungenen Liedes, bekamen wir dann wiederholt das gelassen ausgesprochene Wort: Ultra posse nemo obligatur zu hören, damit hat man uns stets abgespeist. Man verschreit uns immer als den Erbfeind der Protestanten. Im Mittelalter hatte das seine Berechtigung, im modernen Kulturleben aber würde der Katholik gut Freund mit dem Protestanten sein, wenn er von der Regierung nicht eine fortgesetzte Hintansetzung erführe. Unter solchen Verhältnissen kann eine wirkliche Einigkeit unter der Bevölkerung in Deutschland nicht zustande kommen. Man gebe uns dieselben Rechte wie den Protestanten und wir werden die feste Versicherung abgeben, keine eigne Politik zu treiben, um eine Machtstellung über den Protestantismus zu gewinnen. Die Regierung sollte unseren Bestrebungen freien Lauf lassen, wir würden die besten Patrioten werden. Ich will es nicht ableugnen, daß unser Klerus und auch die früheren Führer des Zentrums nach Herrschaft und Übergewicht gestrebt haben. Heute denken wir nicht mehr daran. Das soziale Leben hat in den letzten Jahrzehnten aber eine völlig veränderte Gestalt angenommen, es hat einen solchen Zuschnitt bekommen, daß es sowohl den Protestantismus wie auch den Katholizismus nicht mehr in die Reihe der ausschlaggebenden Faktoren stellt, welche für das Wirtschafts- und Geistesleben der Menschen in Betracht kommen. Religion ist leider nahezu überflüssig geworden. Die Kinder werden mehr und mehr philosophisch-pädagogisch erzogen, philosophisch wird ihnen der Unterschied zwischen Mein und Dein gelehrt. Wir können nicht ableugnen, daß der Protestantismus dabei auch nicht auf seine Rechnung kommt, aber in vieler Beziehung doch weit mehr als der Katholizismus. Es ist schon wiederholt gesagt worden, daß sich zwischen beiden Religionen keine Brücke schlagen ließe. Das ist falsch. Jetzt, wo die christliche Lehre nicht mehr der dominierende Faktor bei der Erziehung der Jugend ist, wo vielmehr eine philosophische Pädagogik zur Heranbildung der jungen Staatsbürger ans Ruder gekommen ist, läßt sich sehr wohl eine Brücke schlagen. Man gebe dem Katholizismus seine Lebensrechte wieder, und wir werden Patrioten, wie sie sich der Staat nicht besser wünschen kann. Man folge unserem gestellten Antrage, das Jesuitengesetz fallen zu lassen, und wir werden jede Luftflottenpolitik unterstützen.«
Die Rede des Zentrumsführers wurde vom liberalen Block ziemlich beifällig aufgenommen. Weniger von den Sozialdemokraten.
Als nächster Redner erhielt nun ein Abgeordneter aus der Partei der Unitarier das Wort. Es muß hier erwähnt werden, daß diese Partei sich erst vor der letzten Reichstagswahl gebildet hatte und ein Programm verfolgte, welches eine Einigkeit und ein Handinhandgehen des Protestantismus und Katholizismus zum Wohle des Vaterlandes anstrebte. Die, welche diese Partei ins Leben gerufen hatten, waren fast durchweg wirklich liberal gesinnte Katholiken gewesen, die jedem Fanatismus abhold waren.
Der Redner machte folgende Ausführungen:
»Mein Vorredner, der Abgeordnete Michael, hat bereits heute das alles berührt, was auch ich vorbringen wollte. Er hat mir quasi aus der Seele gesprochen und ich hoffe, daß seine Worte und Wünsche an höherer Stelle die Berücksichtigung finden, welche sie verdienen. Der Kultusminister hielt unsere Bestrebungen für erfolglos und meint, daß Protestanten und Katholiken niemals unter einen Hut zu bringen seien. Ich verkenne durchaus nicht, daß manche Hindernisse im Wege stehen, aber unsere Zeit kann sie wegräumen, wir sind nicht mehr rückständig, wir sind vorgeschritten. Wir werden einen Antrag einbringen, dessen Annahme vom hohen Hause uns unserem Ziele näher rückt. Jetzt in der kriegsschwangeren Zeit müssen Regierung und Vertretung darauf hinarbeiten, daß sie ihrer und unserer Devise: Viribus unitis gerecht werden und das können sie nur, wenn unseren und des Zentrums Wünschen endlich einmal Erfüllung zuteil wird. Der Dank unsererseits wird sich in einer kräftigen Unterstützung der Luftflottenpolitik äußern.«
Der Präsident des Reichstages hatte sich, nachdem der Abgeordnete Storbeck zu Beginn der Sitzung das Wort ergriffen hatte, in die Hofloge begeben, um den Kaiser in längerer Unterhaltung auf die Parteigruppierung und besonders bemerkenswerte Persönlichkeiten im Hause aufmerksam zu machen. Se. Majestät schien den Ausführungen des Präsidenten sehr interessiert zu folgen, denn er machte wiederholt lebhafte Gestikulationen und blickte bald nach rechts, bald nach links auf die Reihen der Abgeordneten. Den Kaiser mochte das von den Abgeordneten zur Sprache gebrachte Luftflottenthema nicht gerade angenehm berühren, denn er gab durch wiederholtes Stirnrunzeln seiner Abneigung, geheime Absichten hier so vor dem Auslande an den Pranger gestellt zu sehen, unverhohlen Ausdruck. Die geschickte Beantwortung der Interpellation durch den Reichskanzler glättete aber seine Stirn bald wieder. Gespannt folgte der greise Herrscher dann den weiteren Reden der verschiedenen Abgeordneten und verließ die Hofloge erst, als es gegen den Schluß der Sitzung hin zu einer tumultuarischen Szene kam. Den Grund hierfür hatte eine Äußerung eines Zentrumsabgeordneten abgegeben welche den Herren im sozialdemokratischen Lager völlig wider den Strich ging. Der Abgeordnete hatte nämlich angedeutet daß, falls die Regierung das Jesuitengesetz fallen lasse, seine Partei sofort jede fernere Gemeinschaft mit der Sozialdemokratie aufgeben und sich dem liberalen Block für alle Zeiten anschließen würde.
Infolgedessen erhoben jetzt die »Roten« ein wahres Zetergeschrei, und ihr Führer kanzelte, trotzdem ihm der Präsident das Wort nicht erteilt hatte, von seinem Sitz aus die treuen Verbündeten wutschnaubend ab.
Da die Ruhe nicht wieder herzustellen war, vertagte der Präsident die Sitzung, und die Vertreter der Regierung entfernten sich schleunigst, um nicht länger Zeugen der unerquicklichen Auseinandersetzung zwischen der roten und der schwarzen Partei zu sein.
Die Abendausgaben aller Berliner Zeitungen besprachen den Vorfall im Reichstage in spaltenlangen Artikeln, worin der deutsche Reichsbürger lesen konnte, daß es zwischen den Führern der Schwarzen und Roten in den Gängen des Reichstagsgebäudes zu einer solennen Keilerei gekommen sei. Der Antiblockbund hatte einen gewaltigen Riß bekommen.
Der Weltkrieg war entbrannt! Im wunderschönen Monat Mai, wo in unseren heimischen Fluren die Natur zu neuem Leben erwacht, wo der Saft in den Zweigen quillt, Knospen sprießen, und alles um den Menschen herum sich verjüngt — da geschah es, daß zwei Nationen Europas den Frieden zu Grabe trugen.
Deutschland hatte an Frankreich den Krieg erklären müssen. Die Franzosen hatten sich fortgesetzt Übergriffe erlaubt, indem sie wiederholt mit ihren neuen Militärballons über die deutsche Grenze geflogen waren und aus der Vogelperspektive unerlaubte Blicke auf die fortifikatorischen Anlagen im elsaßlothringischen Gebiet geworfen hatten. Es war offenbar, daß Frankreich dadurch einen Krieg heraufbeschwören wollte. Selbst einen solchen vom Zaune zu brechen, hütete es sich; denn es hätte solchenfalls seine Luftflotte, laut den internationalen Abmachungen, nicht ins Feld führen können.
Sofort nach der Mobilmachung verteilte Frankreich sein Luftgeschwader, welches aus etwa hundert Fahrzeugen bestand, längs der ganzen Grenzlinie. Die Deutschen schoben zwei Armeekorps gegen Frankreich vor, während ein französisches Heer jenseits der Grenze hinter der aeronautischen Verteidigungszone bereit lag, den Feind, falls es diesem wider Erwarten gelang, die Feuerlinie des Luftgeschwaders zu durchbrechen, zurückzutreiben.
In Erwägung dessen, daß ein Vorrücken geschlossener Truppenmassen im Bereich der Verteidigungszone der französischen Luftflotte unbedingt ein negatives Ergebnis liefern mußte, befolgte der deutsche Oberbefehlshaber neue strategische Maßnahmen, indem er die Truppen so manöverieren ließ, daß es bei den Franzosen den Anschein erwecken mußte, als wenn die deutsche Armee an einem bestimmten Punkt der Grenze mit ihrer Hauptmacht durchzubrechen gedenke. Dies sollte den Gegner veranlassen, sein Luftgeschwader mehr dorthin zu konzentrieren, wo das deutsche Landheer eine Invasion vorzunehmen gedachte. Während dieses Scheinmanövers sollte dann die aus dem Innern des Reiches inzwischen herangekommene Truppenmacht unerwartet an den schwächer verteidigten Punkten der Grenze die Offensive gegen die französischen Befestigungen ergreifen. Generalfeldmarschall von Hülsen, in dessen Hände der Kaiser den Oberbefehl über die süddeutsche Armee gelegt hatte, war der vollen Überzeugung, daß gegen das Luftgeschwader nur dann etwas auszurichten sei, wenn dieses an einer bestimmten Stelle mit seinen ganzen Streitkräften in Anspruch genommen wurde.
Die dem Personenverkehr im Frieden dienenden Luftfahrzeuge, sowie die Militärballons der deutschen Luftschifferabteilung waren in aller Eile für Kriegszwecke armiert worden. Ein Teil, und zwar die Verkehrsballons, wurden mit Geschützen kleinen Kalibers ausgerüstet, und ihre Führer vor die heikle Aufgabe gestellt, das französische Luftgeschwader zu beschießen. Die Militärballons dagegen wurden mit Granaten, Schrapnells und Melinitbomben versehen, um die französische Landarmee, sobald sie deutsches Gebiet berührte, mit einem Hagel von Sprenggeschossen zu begrüßen.
Die Seestreitkräfte beider Kriegführenden waren ebenfalls mobil gemacht worden, und die Nordsee mußte aller Voraussicht nach der Schauplatz maritimer Kämpfe werden.
England verhielt sich zu alledem vorläufig neutral. Es ging aber das Gerücht um, daß die Briten sich insgeheim ebenfalls kampfbereit machten. Welche Politik sie im stillen verfolgten, das vermochten weder die Diplomaten an der Seine, noch die an der Spree zu erkennen. Beide aber schienen dunkel zu ahnen, daß sich England aller Voraussicht nach schlauerweise auf die Seite desjenigen Kriegführenden schlagen würde, dem das Kriegsglück günstig war.
Rußland und die anderen Staaten hielten es für geraten, überhaupt nicht aus ihrer Neutralität herauszutreten.
Deutschlands einziger Verbündeter war ÖsterreichUngarn und dieses zog jetzt ebenfalls vom Leder, es dirigierte eine Armee nach ElsaßLothringen hinüber, das deutsche Landheer damit beträchtlich unterstützend.
In Amerika und Asien sah man den Dingen gleichgültiger zu. Präsident Harrison und die Herrscher der gelben Nationen mochten sich wohl im stillen freuen, daß man sich drüben in Europa gegenseitig zerfleischte.
Der deutschfranzösische Krieg vom Jahre 1941 sollte aber nur die Ouvertüre zu einem gewaltigen Völkerringen auf dem ganzen Erdball sein. Der große Weltkrieg, der schon lange vor der Tür hockte, trat jetzt vor die Propheten aller Länder als schwarzes, drohendes Gespenst besonders in Erscheinung.
Der französische Heerführer, Mirabeau, hatte den Oberbefehl über die Luftflotte dem ehemaligen Kapitän des Luftschifferkorps Raymond übertragen.
Der Kommandoballon »La Patrie« hatte den aeronautischen Generalstab an Bord. Er war der Flaggballon, von welchem aus die Befehlssignale gegeben wurden. Die Steuerung dieses Fahrzeuges hatte Saint-Martin selbst übernommen.
Die von der Heeresoberleitung befolgte Taktik war in ihren Grundzügen vom Großen Generalstab schnell entworfen und für einen Luftkrieg speziell zugeschnitten worden.
Unter solchen gegen früher gänzlich veränderten Verhältnissen prallten jetzt also zwei Völker mit ihren Streitkräften aufeinander, während im Hintergrunde die anderen Großmächte, in Waffen starrend, den sich entwickelnden Dingen vorläufig parteilos zusahen, aber jeden Augenblick bereitstanden, ebenfalls loszuschlagen, falls es die Sicherheit ihres Besitzstandes erheischte.
»Wir haben uns eine Situation geschaffen, uns in eine Lage gebracht, die keineswegs beneidenswert ist,« meinte Stanwood zu Winsor, als beide sich auf dem Wege zum Reichskanzlerpalais befanden. Fürst von Wutenau hatte nämlich die amerikanischen Erfinder zu einer nochmaligen Aussprache zu sich beschieden, denn es galt Maßnahmen zu treffen, um die zwischen beiden Teilen schwebende Angelegenheit völlig zur Erledigung zu bringen.
»Es tut mir heute leid,« versetzte Winsor in ziemlich gedrückter Stimmung, »daß ich Ihren Vorschlägen damals Gehör schenkte. Ich hätte mich mit dem, was mir meine Erfindung daheim eingebracht hatte, zufrieden geben sollen. So aber habe ich mich in eine Lage gebracht, die ich zu allen Teufeln wünschen möchte.«
»Die Deutschen sind schlau,« fuhr Winsor fort. »Seitdem sie gemerkt haben, daß wir in die Enge getrieben sind, indem uns die Rückkehr nach Amerika ein für allemal verschlossen ist, üben sie einen Druck auf uns aus, um so billig wie möglich bei dem Ankauf wegzukommen.«
»Könnte man die Sache nur etwas in die Länge ziehen, bis der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich beendet ist,« meinte Stanwood.
»Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten uns nach England gewandt,« sagte Winsor.
»Bah! Das ist wohl gehupft wie gesprungen, die Englishmen hätten uns vielleicht noch mehr übers Ohr gehauen.«
»Haben Sie bemerkt, Mr. Stanwood, wie uns Mr. Walpole, der amerikanische Gesandte, Tag und Nacht beobachten läßt?«
»Goddamn!« fluchte Stanwood. »Seine Spione sind auch sicher jetzt hinter uns.«
Stanwood und Winsor schauten sich unwillkürlich um.
»Natürlich — —« fuhr Stanwood fort, »drüben auf der andern Seite geht der Mensch, der uns nun schon seit Wochen wie unser Schatten folgt.«
»Nehmen wir schnell einen Wagen,« sagte Winsor.
Ein zufällig vorüberfahrendes Mietautomobil kam den beiden gelegen, und wenige Augenblicke später hatte der von den Amerikanern als Spion bezeichnete Mann das Nachsehen.
Stanwood hatte dem Chauffeur den Auftrag gegeben, bis zum Pariser Platz zu fahren. Absichtlich hatte er es vermieden, sich und seinen Verbündeten bis vor das Palais des Reichskanzlers bringen zu lassen, weil er vermutete, daß der Spion sich möglicherweise die Nummer des Automobils gemerkt haben könnte und dadurch in den Stand gesetzt war, Nachforschungen über das Endziel der Fahrt anzustellen.
Die beiden Amerikaner wurden bei ihrer Ankunft auf der Stelle vom Fürsten von Wutenau empfangen.
Das Resultat der geheimen Unterredung mochte für beide Teile ein zufriedenstellendes gewesen sein, denn Stanwood sowohl, wie Winsor, verließen das Palais in sehr gehobener Stimmung. In Stanwoods Tasche ruhte ein wichtiges vom Kaiser unterzeichnetes und vom Reichskanzler gegengezeichnetes Vertragsdokument, welches beiden Amerikanern die Summe von 30 Millionen Mark zusicherte.
Die deutsche Regierung hatte nunmehr endgültig die amerikanischen Erfindungen aufgekauft und Stanwood und Winsor zu tiefstem Stillschweigen verpflichtet. Letzteres war eigentlich unnötig, denn alle Welt wußte bereits, wie die Dinge standen.
Amerika hatte am ersten davon Witterung bekommen, daß Stanwood und Winsor nach Deutschland geflohen waren, um dort ihre Erfindungen zum Kauf anzubieten. Stanwoods ehemaliger Diener hatte die amerikanischen Behörden auf die Spur seines flüchtigen Herrn gebracht. Die Yankees fluchten und wetterten natürlich nach Noten, aber das half ihnen alles nichts, ihre Geheimnisse waren verraten, und der Schuldigen konnten sie nicht habhaft werden.
Die Franzosen hatten mit sehr gemischten Gefühlen von den Vorgängen in Deutschland Kenntnis erhalten und beschleunigten ihre kriegerischen Maßnahmen, damit nicht erst eine deutsche Luftflotte erstände, die ihrer aeronautischen Vorherrschaft ein Ende bereiten könne.
England johlte vor Vergnügen, daß die Yankees wieder einmal düpiert worden waren. Andererseits aber wurde es den Englishmen schwül, wenn sie daran dachten, daß nun bereits drei Großmächte eine Luftmacht schufen, und sie gezwungen waren, sich mit jeder derselben gut Freund zu halten.
Ihre Diplomaten mochten daher wohl auf Schliche sinnen, wie sie in ähnlicher Weise wie Deutschland auf ihre Rechnung kämen. Und wirklich, es geschah etwas Unglaubliches. Was die Engländer nicht gutwillig oder durch Zufall erlangen konnten, das suchten sie sich mit List und Gewalt zu verschaffen.
Eines Tages, es war etwa zwei Wochen nach Ausbruch des deutschfranzösischen Krieges, ging wie ein Lauffeuer durch die ganze Presse des Kontinents die Nachricht, daß Saint-Martin aus Paris verschwunden sei.
Der Genannte hatte während des Krieges durch Demolierung des Flaggballons »La Patrie« seitens der Deutschen einen Unfall erlitten, welcher ihn zwang, als Invalid von seinem Posten als Chefingenieur zurückzutreten.
Saint-Martin war dann eines Tages aus seinem Palais verschwunden, und keiner seiner Angehörigen und Dienerschaft konnte über seinen Verbleib Auskunft geben. Eins hatte man aber herausbekommen, der Vermißte mußte allem Anscheine nach über Nacht gewaltsam entführt worden sein.
Der Krieg zwischen den Deutschen und Franzosen wurde mit vieler Erbitterung geführt, und ungeheuere Verlustziffern an Toten und Verwundeten legten über das gewaltige Ringen zweier Nationen das beredetste Zeugnis ab. Die französische Luftflotte richtete die furchtbarsten Verwüstungen unter dem deutschen Heer an, aber auch sie selbst erlitt durch Beschießung außerordentlich große Verluste, und als weitere zwei Wochen ins Land gegangen waren. war die Zahl der französischen Militärluftschiffe von hundert auf zwanzig herabgesunken. Damit war die Luftflotte eigentlich lahmgelegt, und die weiteren Entscheidungskämpfe gingen nun zu Lande und zu Wasser vor sich. Endlos erschien der Krieg mit seinen Schrecken, als sich noch einige europäische Staaten in die Dinge mischten und sich darin so verwickelten, daß Europa der Wetterwinkel für den ganzen Erdball wurde, von wo aus sich die dräuenden Kriegswolken nach allen Seiten hin verbreiteten. Da zu erwarten stand, daß Deutschland über Frankreich den Sieg davon tragen würde, so hielt es England an der Zeit, ersterem seine Dienste anzubieten, um den gefürchteten Franzosen mit dem Rest ihrer Luftmacht vollends das Lebenslicht auszublasen.
Das war aber den Vereinigten Staaten von Amerika wider den Strich. Nicht nur, daß diese Großmacht in helle Wut über die deutsche Hinterlistigkeit entbrannt war, sie hegte auch keine freundschaftlichen Gefühle gegen England; Amerika bot daher Frankreich seine Streitkräfte an und drohte gleichzeitig den Deutschen und Engländern damit, seine Luftflotte, deren Bestand auf 2000 Fahrzeuge bereits angewachsen war, über den Ozean zu schicken und mit dieser in Europa tabula rasa zu machen.
Doch weder die Deutschen noch die Engländer schienen Amerikas Drohungen für ernst zu halten, vor allen Dingen glaubten sie nicht, daß die Luftschiffe nach ihrer Ankunft auf dem Kontinent noch sonderlich groß aktionsfähig seien, da die Gasvorräte für die Betriebsmotoren fernab von der Heimat sicherlich bald aufgebraucht worden wären. Daß sich die Amerikaner aber in letzter Hinsicht mit ihrem praktischen Sinn zu helfen wußten, das hatte man in Europa nicht in Erwägung gezogen.
Als England seine gewaltigen Seestreitkräfte mobil gemacht hatte, wurde es den Franzosen himmelangst und sie sandten Kabeldepeschen über Kabeldepeschen nach Amerika, um die Yankees zu schnellstem Beistand herbeizurufen.
Rußland und die übrigen Staaten des europäischen Kontinents hielten es nun für geraten, sich mit Deutschland und England ebenfalls zu alliieren, damit der gewaltige, neuerstehende Gegner nicht etwa den Sieg über die alte Welt errang und sich mit seiner ungeheueren Luftflotte in Europa festsetzte.
Ehe aber noch Frankreich amerikanische Hilfe bekam, schlugen die Engländer und Russen auf das geschwächte Frankreich los und versetzten ihm den Todesstoß.
Während der ganzen Kriegszeit hatte Deutschland an der Herstellung einer Luftflotte nach amerikanischem Muster gearbeitet, und zu dem Zeitpunkt als die Yankees in Sicht kommen mußten, vermochten die Deutschen nicht weniger als zweihundert Militärballons in den Kampf zu stellen. Auch England hatte sich eine kleine Luftmacht inzwischen geschaffen. Das Mittel, dessen sich John Bull aber bedient hatte, um nicht hinter anderen Großmächten zurückzustehen, war ein der modernen Kultur höchst unwürdiges gewesen. Es schien fast unglaubhaft, aber es war trotzdem Tatsache, daß die Engländer, nachdem sie Saint-Martin gewaltsam entführt hatten, diesen durch inquisitorische Maßnahmen zum Verrat seiner Geheimnisse gezwungen hatten. Der französische Erfinder war, wie durchgesickerte Gerüchte in der Presse besagten, in London regelrecht nach mittelalterlichem Stile gefoltert worden. Daß sich ein moderner Kulturstaat soweit vergessen konnte, schien aller Welt unglaublich, aber verwunderlich war es eigentlich nicht; denn von jeher war es Englands Devise gewesen, daß der Zweck das Mittel heiligt.
Während die Völker der Welt aufeinanderplatzten, hielten die Engländer Saint-Martin, nachdem derselbe dem Barbarismus zum Opfer gefallen war, in sicherem Gewahrsam. Trotzdem er sein Erfindergeheimnis, dem Zwange gehorchend, preisgegeben hatte, hielt man es für ratsam, ihm seine Freiheit vorläufig noch nicht wiederzugeben. Dann kamen Tage der Krankheit für ihn. Er wurde dem St. Thomashospital überwiesen und dort unter Aufsicht gepflegt.
Hier war es, wo Saint-Martin eines Morgens den Besuch eines jungen Mannes erhielt. Dieser entpuppte sich aber, als er mit dem Kranken allein war, als Mademoiselle Ponchon, welche in Manneskleidung in das Hospital geschlichen war.
»Mademoiselle Ponchon! — — — Sehe ich recht?« rief Saint-Martin erstaunt aus.
»Ich bin gekommen, um Sie zu retten,« flüsterte Jeanne Ponchon.
Nachdem sich beide die Hände gedrückt und einen warmen Blick ausgetauscht hatten, sagte Saint-Martin im Flüstertone: »Sie kommen, um mich zu retten? — — — — O, wie danke ich Ihnen! — — Aber es wird vergeblich sein,« setzte er dann mit schmerzlicher Betonung hinzu. »Ich werde mit Argusaugen bewacht.«
»Ich habe einen Plan, Monsieur de Saint-Martin, und er wird und muß mir gelingen,« versetzte Jeanne flüsternd und sah sich scheu im Zimmer um.
»Was könnten Sie tun? — — Ich bin erstaunt, daß man Ihnen den Eintritt zu mir nicht verwehrt hat.«
»Die Pflegerin, welcher ich vorgab, daß ich Ihr Verwandter sei und Ihnen zu Ihrem Namenstage einige Geschenke brächte, ließ mich ungehindert hier herein,« antwortete Jeanne. »Wir haben aber jetzt keine Zeit zu verlieren — — — . Hier, nehmen Sie bitte dieses Paket, es enthält einige Kleidungsstücke von mir. Sie können damit als Frau verkleidet aus dem Hospital entweichen, ohne daß es auffallen dürfte.«
»Liebe Mademoiselle Jeanne,« erwiderte Saint-Martin im Flüstertone und drückte seiner Besucherin dankbar die Hand. »Sie stellen sich das leicht vor, — — — aber ich werde es versuchen. — — Kommen Sie aus Paris? Wie geht es meiner Mutter und meiner Schwester?«
»Ich soll Ihnen viele, viele Grüße übermitteln,« antwortete Jeanne. »Daheim schweben sie freilich fortgesetzt in großer Angst um Sie, und ...«
Die Sprecherin stockte und sah sich im Gemach um. Sie glaubte Stimmen in der Nähe vernommen zu haben.
»Meine Zimmernachbarn unterhalten sich,« sagte Saint-Martin, nahm das ihm von Jeanne gereichte Paket entgegen und verbarg es hastig unter seinem Bett.
»Ich halte eine Flucht bei Tage für günstiger als wie zur Nachtzeit,« sagte Jeanne. »Sie werden unauffällig das Haus verlassen können, wenn Sie vorsichtig zu Werke gehen.«
»Ich muß die Vesperstunde abwarten,« versetzte Saint-Martin; »die Pflegerinnen sind dann in der Regel für eine Viertelstunde abwesend und das ist Zeit genug, um einen Versuch der Flucht machen zu können.«
»Nun leben Sie wohl, Monsieur de Saint-Martin,« sagte hastig Jeanne und ergriff seine Hand zum Abschied. »Noch eins. Sie werden in dem Paket eine Geldsumme finden, mit welcher Sie die Rückreise nach Frankreich antreten können.«
»O, wie danke ich Ihnen tausendmal, Jeanne!« rief Saint-Martin im warmen Flüstertone.
»Adieu, — — es wird besser sein, ich gehe jetzt, auf Wiedersehen! — — — Oder soll ich Sie in London irgendwo erwarten?«
»Nein, nein, ich will meine Flucht allein bewerkstelligen. Ich möchte Sie keinesfalls mit in Gefahr bringen,« erwiderte hastig Saint-Martin.
»So leben Sie wohl, — — auf Wiedersehen in Paris — — —!«
Ein letzter Händedruck, und die zierliche Gestalt Jeannes verschwand hinter der Tür.
Saint-Martin sah ihr wie traumverloren nach. Er hegte jetzt mit einem Mal ein heißes Gefühl für das Mädchen, das ihn eben verlassen hatte. Er hatte sie einst aus Lebensgefahr errettet und sie vergalt ihm dieses nun damit, daß sie ihm Gelegenheit bot, sich aus den Händen der Engländer zu befreien.
Saint-Martin war noch eine geraume Weile in tiefes Sinnen über das Vorangegangene versunken, als die Pflegerin ins Zimmer trat und ihm das Mittagsmahl brachte.
Während er Speise und Trank zu sich nahm, unterhielt er sich scheinbar gleichgültig über allerlei nichtige Dinge mit der Pflegerin. Er plauderte von seinem jungen Verwandten, welcher ihn soeben besucht hatte und deutete an, daß dieser jetzt wohl öfters kommen würde, da er in London wohne und gar nicht weit zum Hospital habe.
Wie Saint-Martin aus allem herausmerkte, hatte die Pflegerin keinerlei Verdacht geschöpft. Wäre dies der Fall gewesen, so hätte Frankreich seinen genialen Bürger wohl nicht so bald wieder innerhalb seiner Grenze zu sehen bekommen.
Es mochte etwa eine Woche verstrichen sein, als alle Zeitungen des Kontinents die Nachricht durchflatterte, daß Saint-Martin sich wieder in Paris eingefunden habe. Die Flucht war ihm also geglückt, und jenseits des Kanals schimpfte man nun weidlich darüber, daß ein Franzmann dem englischen Garne entschlüpft war.
Draußen in der Welt hatten sich unterdessen die Dinge in beängstigender Weise entwickelt. Der wahre, wirkliche Weltkrieg setzte jetzt unmittelbar nach der Niederlage Frankreichs ein.
Die einzelnen Großmächte Europas, welche sich mit Deutschland zu alliieren gedachten, hatten in letzter Stunde davon Abstand genommen. Die Ursache lag darin, daß jeder Staat bei einer Allianz sich dem Verbündeten militärisch nicht unterordnen wollte. Besonders England war darauf wie besessen, die Führung bei einem gemeinsamen Vorgehen zu haben. Deutschland hätte den Engländern dieses Recht auch zugestanden, wenn nicht Rußland und Österreich hier ein Votum eingelegt hätten. Die Ursachen dafür lagen tiefer und waren in der Kolonialpolitik zu suchen.
Nachdem sich also eine Zersplitterung unter den europäischen Staaten in letzter Stunde herauskristallisiert hatte, hielten es Spanien, Portugal und Italien für geraten, ihren romanischen Brüdern, den Franzosen, beizustehen, während England auf eigne Faust sein Kriegsglück versuchen wollte, indem es sich hinterlistig in Dinge mischte, welche Deutschland angingen. Rußland dagegen hielt jetzt den Zeitpunkt für gekommen, wo es, statt sich in europäische Händel zu verwickeln, eine Invasion in Indien vornehmen konnte, ohne von dem in Europa stark engagierten England allzusehr gehindert zu werden. Als in London dieses Vorhaben Rußlands bekannt wurde, da gerieten die Diplomaten in der DowningStreet arg in Verlegenheit. Sie bekamen für einige Augenblicke heftige Beklemmungen und wußten nicht, wohin sie ihre Flottenmacht zuerst dirigieren sollten. Wieder erwog man den Gedanken sich doch mit Deutschland zu alliieren, das kleinere Übel dem größeren vorzuziehen. Der König von England wollte sich jedoch lieber mit den Amerikanern verbünden, deren heranrückende Luftmacht ihm Furcht einzuflößen schien. Doch seine Minister zeigten hierzu keine Neigung und hatten mehr Vertrauen zu Deutschlands Militärmacht und Deutschlands ehrlicher Gesinnung, als wie zu der Luftflotte und der Gesinnung ihrer stammverwandten Nachbarn jenseits des Ozeans.
In dieser politischen Zwickmühle sitzend, kamen die Engländer auf den genialen Gedanken, sich für alle Fälle ihre Haut zu sichern, indem sie ein, in der Geschichte der Weltpolitik wohl einzig dastehendes diplomatisches Manöver entrierten.
Was taten die Englishmen?
Sie arrangierten ein Doppelspiel, bei welchem sie auf alle Fälle siegen mußten. Insgeheim schlossen sie nämlich mit Deutschland einen Vertrag ab, wonach sie diesem in einem Krieg gegen Amerika als Verbündeter mit ihrer gesamten Seemacht beistehen wollten, wenn sich ergeben würde, daß die amerikanische Luftflotte allzusehr im Vorteil sei. Ebenso geheim trafen die Engländer ohne Vorwissen Deutschlands zur selben Zeit ein Abkommen mit der romanischen Vierbundmacht, mit Frankreich und seinen Verbündeten. Diesen versprachen die Herren von der Themse dasselbe, was sie Deutschland in Aussicht gestellt hatten. Natürlich wußte Frankreich von dem englischen Vertrag mit seinem deutschen Erbfeind nichts. Die schlauen Briten engagierten sich also, um, je nach Entwicklung der Dinge, im Trüben fischen zu können, nach zwei Seiten hin, im vorhinein von der festen Absicht beseelt, hier oder dort vertragsbrüchig zu werden, wenn die Situation es erheischt.
Die militärischen Aktionen zwischen Deutschland und Frankreich waren noch immer nicht eingestellt worden, trotzdem die Franzosen längst als überwunden galten. Jetzt, wo die übrigen romanischen Länder Anstalten trafen, dem Franzmann zu helfen, konzentrierte Deutschland seine ganze Militärmacht an die Westgrenze. Von Rußland hatte es die Versicherung erhalten, daß es mit diesem in keinerlei kriegerische Verwicklungen geraten würde, sofern es dessen Vorstößen nach Indien keine Hindernisse in den Weg lege.
Auf der Balkanhalbinsel fing es nunmehr auch zu rumoren an, und im Norden rüsteten Schweden, Norwegen und Dänemark, um auf alle Fälle kampfbereit zu sein gegen die Nationen, welche sich vielleicht mit dem Gedanken einer Annexion Skandinaviens trugen.
Die Kriegsfackel in Europa flammte also jetzt grell auf. Handel und Wandel stockten, und die friedfertigsten Bürger der Staaten gerieten außer Rand und Band. Die Diplomaten der verschiedenen Groß- und Kleinmächte hatten viele schlaflose Nächte und bemühten sich fortgesetzt vergeblich mit ihrem Federschwert in das Kunterbunt friedlicher und feindlicher Beziehungen einige Ordnung zu bringen. Doch alles umsonst.
Die gelbe Rasse im fernen Osten mochte über die krasse Uneinigkeit der europäischen Mächte triumphieren. Sicher empfand man dort eine helle Freude darüber, daß sich die Völker der weißen Rasse einander so in den Haaren lagen. Die Japaner hielten darum den Zeitpunkt für gekommen, im Verein mit ihren nach europäischem Muster militärisch längst reorganisierten Verbündeten, den Chinesen, die übrigen auf dem asiatischen Kontinent ihnen noch nicht gehörenden Ländermassen, insbesonders Indien, zu verschlucken.
Die Gelben planten also ebenfalls eine Invasion nach Indien. Die Russen waren schon im Anmarsch, als die Gelben den gleichen Schritt beschlossen. Das mußte England unbedingt Indien kosten.
Europa starrte in Waffen. Die abendländische Kulturwelt erlebte die furchtbarste Zeit ihres ganzen Daseins. Der Kulminationspunkt wurde aber erst erreicht, als das riesige Gespenst der amerikanischen Flotte in Sicht kam.
Am 17. Juni kam von Holland, das sich mit Belgien auf Deutschlands Seite geschlagen hatte, die Nachricht nach Berlin, daß die Amerikaner in Sicht seien.
Auch die anderen europäischen Staaten erlangten hiervon Kenntnis. Hatten die Großmächte immer gehofft, daß die amerikanische Luftflotte die lange Reise über den Ozean nicht überstehen würde, so hatten sie sich darin schmählich getäuscht. Man kann sich den Schrecken der Holländer vorstellen, als sie seewärts der Scheldemündung die aeronautische Flottille der Amerikaner wie eine langgestreckte, schwarze Wolke am Horizont auftauchen sahen. Daß der Granatenhagel der Yankees jetzt über ihre Häupter herniedergehen würde, unterlag für sie keinem Zweifel mehr. Der Weltluftkrieg mußte sich ihrer Ansicht nach über Belgien und den Niederlanden abspielen.
Und so kam es auch. Die Länder an der Nordsee sollten der Kriegsschauplatz werden, wo die Völker der Alten Welt mit denen der Neuen Welt zusammenstießen und wo Blut über Blut bald den Boden tränkte.
Zum Glück hatten Holland und Belgien bereits mobil gemacht und standen nun kampfbereit den Ankömmlingen aus dem fernen Westen entgegen. Unverzüglich dirigierte jetzt auch der deutschösterreichische Zweibund seine Land- und Seemacht nach Holland. Der romanische Vierbund tat ein gleiches, benützte aber auch die Gelegenheit zu Ausfällen über die deutschfranzösische Grenze, an welcher jetzt nur ein schwaches Militärkontingent stand. Deutschland gelangte dadurch in Bedrängnis und erinnerte darum den englischen Nachbar an sein Abkommen mit ihm. Doch dieser rührte sich nicht und wollte nur eingreifen, wenn der deutsche Gegner seine Schlachten gewann und die Gefahr für den deutschen Verbündeten wirklich eine große wurde.
Mit dem 20. Juni brach der Tag an, an welchem das seit Menschengedenken gewaltigste Völkerringen begann.
Betrachten wir hier einmal die Streitkräfte, die sich auf holländischem Boden einander gegenüberstellten.
Deutscherseits waren 13 Armeekorps im Anrücken. Ihnen attachiert waren 4 Luftschifferabteilungen, die zum Teil schon Kriegsluftschiffe amerikanischen Typs besaßen. Auch 20 MaschinengewehrAbteilungen rückten mit auf den Kampfplatz. Diesen lag es vor allem ob, die deutsche Luftflotte zu unterstützen, indem sie die amerikanische Flottille zu beschießen hatten. Sie bildeten für den sich entwickelnden Krieg so recht eigentlich die Kerntruppen; denn von deren Geschicklichkeit hing es ab, ob die Amerikaner mühelos ihre Siege errangen, oder ob sie ihre Aktionen unter großen Verlusten führten. Der deutsche Große Generalstab hatte in Erwägung dessen, daß das Maschinengewehr die beste Waffe im Luftkrieg sei, den Beschluß gefaßt, einen Teil der Landarmee unverzüglich dazu zu verwenden, Schutzgräben mit Panzerplattenüberdachung an der deutschbelgischholländischen Grenze für die MaschinengewehrAbteilung herstellen zu lassen, damit dieselben nicht allzu stark dem amerikanischen Granatenhagel ausgesetzt seien. Über 100 000 Mann warfen darum jetzt Tag und Nacht solche Schutzgräben auf, und zahllose Waggons voll Panzerplatten, die für diese Fälle vorbereitet auf dem Kruppschen Gußstahlwerk in Essen lagerten, wurden an der Grenze entleert.
Die gesamte deutsche Flottenmacht rückte zu derselben Zeit zum Kriegsschauplatz an der belgischholländischen Küste vor. Die Schiffe waren in aller Eile mit Geschützen armiert worden, deren Rohre so verstellbar gelagert waren, daß ein Feuern damit in vertikaler Richtung wie auch unter jedem anderen beliebigen Höhenwinkel möglich war. Diese Schiffskanonen waren Maschinengeschütze neuesten Typs, deren Feuerabgabe fast ebenso schnell wie bei den Maschinengewehren stattfand, und bei denen der Rückdruck der Pulvergase selbsttätig das Auswerfen der Kugelhülse und das Einbringen des neuen Geschosses sowie das Abfeuern bewirkte. Die mächtigen Geschoßpatronen dieser Geschütze befanden sich in langen Metallbändern, welche sich automatisch bei der Feuergabe bewegten. Mit solchen Maschinengeschützen konnte ein Dauerfeuer geschossen werden, und vermochte eine Kanone allein gegen 200 Schüsse in der Minute abzugeben. Diese Geschosse waren zwei Pfund schwere Granaten. Jedes Metallband vermochte 300 Geschosse aufzunehmen vom Kaliber 5,5 cm. Die Durchschlagkraft war eine große, betrug sie doch auf einen Kilometer Entfernung in einen Fichtenstamm über 0,40 m.
Die Kanonen der gesamten deutschösterreichischen Artillerie waren mit ihren Lafetten so gerichtet worden, daß sie unter einem Höhenwinkel bis zu 60 Grad Schüsse in die Luft abzugeben vermochten. Soweit als möglich wurden die Geschütze mit Tragpanzerplattenverschalung versehen, um die Kanoniere und Offiziere vor dem amerikanischen Granatenhagel zu schützen.
Auf seiten des romanischen Vierbundes war die Land- und Luftartillerie ebenfalls eine höchst achtunggebietende Wehrkraft. Interessant war besonders der Luftschiffpark. Zwischen den französischen Militärballons tummelten sich in besonderen Zügen eine Anzahl von Spanien und Italien gestellte Luftfahrzeuge aller Art. Mit welchen Vehikeln zogen diese Südländer in den Kampf? Man sah Drachenflieger, Aeroplane und sonstige aviatische Fahrzeuge, ferner alle Gasballons der letzten dreißig Jahre. Kurz, das ganze war eine so zusammengewürfelte Luftwehrkraft, daß sie jedem, der sie sah, vor allem aber den deutschen Strategen, unwillkürlich ein Lächeln entlockte.
Wäre Doktor Faust von den Toten erwacht, so hätte er beim Anblick einer solchen gespenstig aussehenden Legion von Luftvehikeln ausgerufen: Was kraucht da in der Luft herum? — — Ich atme kaum, mich zittert, es stockt das Wort, es ist ein Traum, verschwunden Tag und Ort!
Von einem noch schlimmeren Grauen als es Faust ergriffen hätte, wurden jetzt bei der Anwesenheit der amerikanischen Luftflotte Stanwood und Winsor erfaßt. Fielen sie wieder in die Hände ihrer Landsleute, so wurden sie sicher standrechtlich erschossen. In Anbetracht dieser hochnotpeinlichen Lage verschwanden darum eines Tages Stanwood und Winsor von der Bildfläche, und kein Mensch konnte Auskunft geben, wohin beide geflohen waren, um ihre Haut zu salvieren.
Bereits zwölf Stunden hindurch kreiste die Yankeeflottille wie eine gewitterschwangere Wolke über den Häuptern der Europäer ohne die Offensive zu ergreifen. Erst als das aeronautische Sammelsurium des romanischen Vierbundes sich zu den Amerikanern gesellte, kam Leben unter die Yankees. Sie sandten in der Nacht vom 21. zum 22. Juni einige ihrer Ballons als Vorposten gegen die Feindeslinie vor.
Mitternacht mochte kaum verflossen sein, als Amerika den Kriegsreigen eröffnete. Die Feuerschlünde ihrer Vorpostenballons spieen einen ersten Granatenhagel auf den verstreut biwakierenden Feind, der sich vom Dunkel umhüllt, vorläufig noch sicher wähnte.
»Erschrocken springt die Soldateska auf,
stürzt planlos fort,
waffenlos im hastigen Lauf — — —.«
Schnell loderte nun die Kampfesfackel auf. Grell blitzten jetzt die Feuerschlünde der deutschen Geschütze und ihr Donner machte in kurzen Intervallen weithin die Luft erzittern.
Ins Dunkel hinein schoß die deutsche Artillerie, bis mächtige elektrische Scheinwerfer die feindliche Flotte im Luftmeer sichtbar machten.
Die Yankees ließen ihre Ballons eilends höher steigen, um aus der Lichtflut der Scheinwerfer zu gelangen. Über der Wolkendecke waren sie in geschützter Lage und konnten trotzdem nach unten hin operieren. Der deutsche Generalstab hielt es nun an der Zeit, die Amerikaner über den Wolken zu beschäftigen und sandte seine Luftschiffe ebenfalls nach oben. Der Oberkommandant der letzteren, Kapitänleutnant Fischer, ließ seine Ballons so manöverieren, daß sie keinem Granatenhagel der Amerikaner ausgesetzt waren, aber doch so nahe blieben, daß sie auf dieselben zu feuern vermochten. Den Deutschen kam es hierbei zu statten, daß sie sich durch mitgeführte Scheinwerfer betreffs der Lage des Feindes über den Wolken zu orientieren vermochten.
Nun sollte die Welt eine Überraschung sondergleichen erleben. Ein Deus ex machina trat plötzlich in Aktion! — — — Zum erstenmal wollten die Deutschen mit einem neuen Kampfmittel auf das Kriegstheater treten, mit einer seltsamen Waffe, dem LloydOszillator. Mit diesem konnten nämlich elektrische Wellen ausgesandt werden, die, als hochgespannte Energie, auf alles in nächster Umgebung befindliche Lebendige todbringend zu wirken vermochten. Mit dieser furchtbaren Waffe, welche erst in den letzten Wochen von einem Elektrotechniker ersonnen war, gingen nun die Deutschen gegen den übermächtigen Feind ins Feld. Elektrische Nah- und Fernkämpfe sollten also jetzt in der Kriegsführung eine völlig neue Phase bilden. — Ob sich der Oszillator in der Praxis auch so bewährte, wie er es in der Theorie getan, das mußte die nächste Stunde schon lehren.
Der elektrische Oszillator, die Waffe der Zukunft, mußte das furchtbarste Kampfmittel werden, wenn er hielt, was er versprach. Von seiner Existent hatte niemand, am wenigsten aber die Yankees, eine Ahnung.
Der Oszillator sollte den Völkern des Erdballes den ewigen Frieden bringen und Deutschland für alle Zeiten zur Weltmacht erheben.
Der Leser wird nun neugierig sein, von welcher Beschaffenheit die neue elektrische Kriegswaffe war. Da dieselbe im Prinzip schnell beschrieben ist, so soll nachstehend der Gedanke publiziert werden, der den Erfinder des Oszillators zur Konstruktion des letzteren leitete.
Von der Idee ausgehend, daß mittels des Funkentelegraphen elektrische Energie ohne Draht auf beliebig weite Entfernung versandt und am Ziel zu den verschiedensten Kraftwirkungen verwendet werden kann, ersann der Erfinder einen auf den Grundprinzipien des Funkentelegraphen beruhenden Apparat, mit welchem er hochgespannte elektrische Energie in Wellenform in den Raum auszusenden vermochte.
Bekanntlich arbeiten die Funkentelegraphen nur mit sehr niedrig gespannter Elektrizität, das heißt mit äußerst schwacher Elektrizität. Für den Erfinder des Oszillators galt es, den elektrischen Starkstrom in Wellenform zu bringen, um ihn so auf irgend ein bestimmtes Ziel wirken zu lassen.
Die hochgespannten Energiewellen sollten dann eine todbringende Kraft auf alles Lebendige äußern. Es wird jedem Leser einleuchten, daß der Erfinder des Oszillators bei der Konstruktion seines Apparates sofort an eine Verwendung desselben im Kriege gedacht hatte. Einige solcher Apparate vermochten ein ganzes Armeekorps zu ersetzen. Künftig brauchten also nicht mehr große Truppenmassen zur Vernichtung des Feindes ins Feld geführt zu werden, man stellte einfach einige Dutzend Oszillatoren der Grenze entlang auf und der Feind wurde damit, ob er nun zu Land, auf dem Wasser oder in der Luft heranrückte, mühelos vernichtet. Besonders aber wurden den Luftflotten die Oszillatoren gefährlich, konnten ihnen doch mit einem Schlage die gesamte Mannschaft von Ferne her getötet werden.
Als die deutsche Regierung von der Erfindung des Oszillators zu hören bekam, vermochte niemand der Sache Glauben zu schenken, bis daß einige Probeversuche dargetan hatten, daß derselbe in der von dem Erfinder angedeuteten Weise brauchbar war. Anfänglich trat die deutsche Heeresleitung der Erfindung des Oszillators skeptisch gegenüber. Nicht sowohl, daß man die Wirkung desselben für eine sehr beschränkte hielt, hegte man des weiteren schwere Bedenken, daß durch die durch den Apparat in den Raum gesandten und sich dort verbreitenden Wellen auch ihre Erzeuger und alles Lebendige, was in und um die Sendestation und noch weiter zurück sich befand, ebenfalls dem Tode geweiht war. Doch der Erfinder hatte hiergegen geeignete Vorkehrungen getroffen und einen WellenGleichrichter konstruiert, mit welchem die ausgesandte elektrische Energie nach einer bestimmten Richtung hin dirigiert werden konnte; bei dessen Verwendung also wurde vermieden, daß sich die elektrischen Wellen im Raume gleichmäßig verbreiteten.
Es war eigentlich verwunderlich, daß der elektrische Oszillator nicht schon längst erfunden war. Einem weitschauenden Blicke mußte sich doch gleich bei der Erfindung der Funkentelegraphie die Frage aufdrängen, daß, wenn man schwache, also niedriggespannte elektrische Energie ohne Zuhilfenahme einer Drahtleitung in Wellenform nach einem beliebig entfernten Ziele versenden kann, es doch eigentlich auch gelingen müßte, unter Zuhilfenahme geeigneter Apparate welche nach dem Muster des Funkentelegraphen konstruiert, starke, also hochgespannte Elektrizität, die geeignet ist einen Menschen zu töten, in Wellenform in den Raum hinauszuschicken.
Doch erst das Jahr 1941, just zum Anbruch der Luftverkehrsära, sollte das Geburtsjahr der Erfindung werden, welche zur schrecklichen Mordwaffe und doch auch wieder zur segenbringenden Zwillingsschwester der Funkentelegraphie ausreifte.
Die Versuche mit dem Oszillator waren ziemlich zufriedenstellend gewesen. Jetzt galt es nun, die Erfindung im großen Maßstabe zur Anwendung zu bringen. Wie sie sich für die Folge bewährte, das wird der Leser aus der nachstehenden Schilderung, welche das Ende des Weltkrieges zum Gegenstand hat, ersehen können.
»Jetzt kommt es darauf an, ob unsere Oszillatoren auch wirklich das vermögen, womit wir bei unserer Taktik gerechnet haben,« hörte man den Kapitänleutnant Fischer im Kommandoballon zu dem Chef des deutschen Generalstabes, Freiherrn von Haussen, sprechen.
»Exzellenz,« versetzte der Angeredete, »bewährt sich der Oszillator, so siegen wir mit einem Schlage auf der ganzen Linie.«
Nach diesen Worten erhoben beide Führer ihre Feldstecher und beobachteten den im Lichtschein lavierenden Feind.
Von Ferne her hörte man das Knattern der Granaten, mit denen die Amerikaner die deutschen Landtruppen fortgesetzt überschütteten.
Es muß hier noch bemerkt werden, daß ein Teil der amerikanischen Kriegsballons der auf der Nordsee heranrückenden deutschen Flotte entgegengesandt war, um diese möglichst noch vor ihrer Ankunft kampfunfähig zu machen.
Noch operierten die Landarmeen der sich angreifenden Nationen nicht. Die Führer beiderseits schienen den kommenden Tag abwarten zu wollen. Die deutschen Truppen, welche sich tagsüber gegen die Amerikaner vorgewagt hatten, zogen sich weiter und weiter zurück, was im gegnerischen Lager triumphierend begrüßt wurde.
Von der Existenz der Oszillatoren hatten, wie schon gesagt, die feindlichen Truppen keine Ahnung, weshalb niemand im entferntesten daran dachte, daß noch im Laufe der Nacht der große Weltkrieg mit einem Schlage beendet sein sollte. Die Sache mit dem Oszillator war so geheim betrieben worden, daß nur der Große Generalstab und einige wenige Mannschaften der deutschen Militärballons davon wußten.
Nachdem alle Vorbereitungen getroffen worden waren, gab Kapitänleutnant Fischer den Befehl, daß die elektrische Waffe nunmehr in Tätigkeit treten sollte
Es war zwei Uhr nachts. Noch hörte man das Zischen und Knattern der amerikanischen Granaten, die verderbenbringend ihren Weg nach unten nahmen. Die Szenerie des Kampfplatzes in den hohen Regionen bot in diesem Augenblick ein Bild eigenartigsten Reizes. Man konnte sie schauerlich schön nennen. Während am Firmament der inzwischen aufgegangene Mond sein bleiches Licht über die deutsche Luftflotte ergoß, entluden sich unter derselben die schwarzen Gewitterwolken, und feurige Blitze flammten auf, von tiefgrollendem Donner begleitet. Dazu kam noch das Geknatter der feindlichen Geschosse und das Surren und Sausen der PropellerSchrauben, welche die Ballons schwebend auf dem Höhenniveau erhielten.
»Es gilt jetzt noch einen Punkt zu erwägen,« meinte Kapitänleutnant Fischer. »Wollen wir alle vier Oszillatoren gleichzeitig in Betrieb setzen oder zunächst nur mit einem operieren?«
»Da unsere Erfahrungen mit der neuen Waffe noch sehr ungenügende sind, so möchte ich Ew. Exzellenz vorschlagen, erst einen Apparat funktionieren zu lassen,« antwortete der Chef des Generalstabes.
»So soll der Oszillator unseres Ballons den Anfang machen,« versetzte Fischer und gab dem den Apparat im Kommandoballon bedienenden Offizier die nötigen Befehle. Dann ließ er durch Flaggsignale den Führern der übrigen Ballons der Luftflotte die Weisung zugehen, ihre Fahrzeuge hinter den Kommandoballon zu bringen. Es durfte auf keinen Fall eins derselben in der Richtung sich befinden, nach welcher hin sich die elektrischen Wellen des Oszillators fortpflanzten.
Eine Minute verfloß nun in banger Erwartung. Die Offiziere im Kommandoballon »Kaiser Wilhelm II«, sowie die Mannschaft desselben, lugten gespannt hinüber zu der feindlichen Luftflotte, um die Wirkungen des Oszillators gewahr zu werden.
Hatte das Knattern der amerikanischen Geschosse bis jetzt, die halbe Nacht hindurch, ununterbrochen angehalten, so konnten die Führer der deutschen Luftflotte nach Verlauf von zwei Minuten feststellen, daß sich dasselbe mit einem Male stark abgeschwächt hatte und daß es nach Verlauf einiger weiterer Minuten ganz verstummt war.
»Drüben wird's wahrhaftig still!« rief der Kommandeur der deutschen Luftflotte und ein Freudenstrahl huschte über sein Gesicht hinweg. »Ich nehme an, daß die Amerikaner unserem Oszillator zum Opfer gefallen sind. Wer hätte in aller Welt gedacht, daß so ein unscheinbares Ding solche furchtbare Wirkungen äußern könne.« Bei diesen Worten glitten seine Blicke über den verderbenspeienden Oszillator, welcher noch immer geräuschlos funktionierte.
»Die Amerikaner haben das Geschoßfeuer tatsächlich gänzlich eingestellt,« erwiderte Generalmajor von Haussen mit freudig erregter Stimme. »Zweifelsohne hat unser Apparat es zum Schweigen gebracht. — Bei Gott! ich bin maßlos erstaunt.«
»Jetzt haben wir das Schicksal der ganzen Menschheit in den Händen!« rief der Kommandant begeistert aus. »Wir können Krieg und Frieden nach Belieben bestimmen! Was helfen den Amerikanern und Franzosen ihre Luftflotten? Ein Hebeldruck auf unsern Apparat, und der stärkste Feind ist vernichtet.«
Der Kapitänleutnant gab nach diesen Worten einem Offizier die Weisung, daß der Oszillator außer Tätigkeit gesetzt werde.
»Jetzt wollen wir den Yankees auf den Leib rücken,« sagte er dann und erteilte Befehl, daß die gesamte Luftflotte sich zum Angriff auf die Amerikaner klar halte.
Wenige Augenblicke später rasselten die Steuerpropellerschrauben, und im gemäßigten Tempo fuhren die deutschen Militärballons auf den Feind zu.
Bei den Amerikanern hatte sich unterdessen nichts gerührt, auch jetzt, als die deutsche Luftflotte zum Angriff vorrückte, regte sich dort nichts. Wie Gespensterschiffe schwebten die feindlichen Ballons über der Wolkendecke.
Als die Deutschen bis auf eine Entfernung von etwa 500 m vorgedrungen waren und sich drüben noch immer nichts rührte, gab Kapitänleutnant Fischer Befehl zu einer formierten Fahrt.
In diesem Augenblicke begann aber unerwartet wieder das Granatengeknatter auf der Seite des Feindes.
»Teufel noch mal!« rief der Kapitänleutnant verdutzt aus und riß sein Fernglas an die Augen. »Drüben geht's wieder los. — —«
»Sollte die Wirkung des Oszillators vielleicht nur eine vorübergehende gewesen sein?« meinte mit bedenklicher Miene Freiherr von Haussen.
»Es scheint bald so,« versetzte der Kommandant und gab Befehl, daß die gesamte Flotte ihre Fahrt stoppen solle, und daß alle vier Oszillatoren, welche auf den verschiedenen Ballons verteilt waren, jetzt gleichzeitig in Tätigkeit treten sollten.
Eine Minute später wurde auf Feindesseite abermals alles still, und es schien unter die Fahrzeuge der amerikanischen Luftflotte Unordnung zu kommen. Einige Ballons sanken plötzlich langsam in die Tiefe, andere stiegen höher und dritte schlugen einen Kurs nach verschiedenen Richtungen ein. Etwa zwanzig amerikanische Militärballons behaupteten allein nur noch die alte Stellung.
Jetzt gab der Kommandeur der deutschen Luftflotte seinen Offizieren wieder Befehl, gegen die Amerikaner in formierter Fahrt vorzugehen.
Bald ließen nun die Fernstecher erkennen, daß sich in dem auf ihrem Platze verweilenden Ballons nichts regte, und als man näher kam, entdeckten die deutschen Offiziere, daß viele leblose Gestalten in den amerikanischen Ballongondeln lagen.
Die Opfer des Oszillators!
Als die Deutschen dann so nahe an die feindliche Luftflotte herangekommen waren, daß sie deren Ballons entern konnten, stießen sie allenthalben auf Leichen. Und das Seltsamste war, daß keiner der zahllosen Toten irgend welche äußere Verletzung aufwies. Das elektrische Kampfmittel mußte also auf den Feind gewirkt haben wie ein Blitzstrahl, wenn er den Menschen trifft.
Mit Hurra und Jubel wurden nun die amerikanischen Ballons in Beschlag genommen. Deutsche Mannschaften stiegen in die geenterten Fahrzeuge und brachten diese zum Sinken. — Ein Sieg war es wirklich auf der ganzen Linie gewesen.
Während die Deutschen noch mit dem Niederbringen der amerikanischen Vehikel eifrig beschäftigt waren, wurden sie im Dunkel der Nacht plötzlich wieder vom Feind überrascht. Von allen Seiten kamen unerwartet amerikanische und französische Luftschiffe, um von neuem den Kampf mit den Deutschen aufzunehmen. Gefährlich wurde die Situation für letztere dadurch, daß sie sich nicht nur von allen Seiten umringt sahen, sondern daß der Feind auch über ihnen Stellung zu gewinnen suchte. Eröffneten die oberhalb befindlichen Militärballons erst ihr Granatenfeuer, so konnte dies der deutschen Luftflotte schlecht bekommen; sie wäre möglicherweise in den Grund gebohrt worden.
Doch Kapitänleutnant Fischer verlor in dieser heiklen Lage den Kopf nicht, er erteilte kaltblütig seine Befehle.
Ein Oszillator mußte seine todbringende elektrische Energie zunächst nach obenhin abgeben, um dort den Feind aus dem Wege zu räumen, ehe dieser sein Feuer eröffnete.
In den nächsten Sekunden hagelten jedoch schon die französischen Granaten hernieder und rissen in den einen oder andern Militärballon große Löcher.
Zum Glück hörte aber das Geschoßfeuer bald wieder auf, — — der Oszillator mochte seine Schuldigkeit getan haben. Unterdessen hatte der Kommandeur der deutschen Luftflotte auch schon Befehl gegeben, die übrigen Oszillatoren in Tätigkeit zu setzen. Hierbei wurde aber ein schwerer taktischer Fehler begangen, in dem einige deutsche Ballons in den Bereich der Oszillatorenwellen gerieten, und ihre Mannschaften dies mit dem Leben büßen mußten.
Im weiteren Verlauf des Kampfes trugen, wie nun nicht mehr anders zu erwarten, die elektrischen Fernwaffen deutscherseits den Sieg davon. Die französischamerikanischen Luftschiffer waren samt und sonders den elektrischen Wellen zum Opfer gefallen und ihre Ballons pendelten jetzt herrenlos im Luftmeer umher.
Der Jubel über den erneuten Sieg brach sich unter den Deutschen aber nicht recht Bahn, da diese selbst mitsamt ihrer Flotte erhebliche Verluste erlitten hatten. Die besten und größten Fahrzeuge hatten durch den Granatenhagel derart gelitten, daß sie infolge des entströmenden Gases tiefer und tiefer sanken.
Der Luftkrieg war unter diesen Umständen zu Ende, und der Rest der deutschen Luftflotte landete mit Morgengrauen im Lager der Südarmee, welche auf holländischem Boden den Erfolg der Luftschifferabteilung abwartete.
Als die französischen Landtruppen und ihre Führer von der gänzlichen Niederlage ihrer und der Amerikaner Luftflotte vernahmen, da vermochte niemand sich diesen leichten Sieg der Deutschen zu erklären. Es konnte dies nicht verwundern, weil der Feind von der Existenz der Oszillatoren noch immer keine Ahnung hatte.
Wutentbrannt ergriffen nun die Franzosen und ihre Verbündeten die Offensive gegen die deutschösterreichische Landmacht.
Unterdessen erhielt der deutsche Generalstab Funkendepeschen von seinen in der Nordsee weilenden Kriegsschiffen. Darin verlangte der kommandierende Admiral sofortige Hilfe, um den Attacken der von oben her angreifenden amerikanischen Luftschiffe nicht zum Opfer zu fallen.
Sofort wurde einer der noch intakt gebliebenen Ballons mit einem Oszillator versehen nach der Nordsee gesandt, um den Feind dort zu vernichten.
Weitere Funkendepeschen meldeten dann noch das Heranrücken der englischen Flotte, von der man nicht wisse, welche Absichten sie im Schilde führe.
Dies machte nun noch die Entsendung eines zweiten Luftschiffes nebst Oszillator notwendig, um die deutsche Flotte auf alle Fälle auch gegen englische Angriffe zu schützen.
Als die Sonne blutrot über den Horizont stieg, hatte das gewaltige Völkerringen bereits sein Ende erreicht. Die deutschen Oszillatoren hatten zu Lande und zu Wasser alles vernichtet, was sich als Feind genähert. Die elektrischen Wellen hatten sich als Massenmordmaschinen entpuppt, denn es waren ihnen mehr als 100 000 Mann auf Feindesseite zum Opfer gefallen.
Die Schlußapotheose war dann, daß den Rest der feindlichen Armee, wie auch die Engländer ein wahrhaft panischer Schrecken ergriff, und was noch lebte, suchte jetzt sein Heil in der Flucht.
Als der Vorhang über dem Kriegstheater fiel, war es den Überlebenden zur festen Gewißheit geworden, daß das neue Kampfmittel der Deutschen ein für allemal den Kriegsgelüsten der Kulturvölker ein Ende setzte.
Deutschland und sein greiser Kaiser Wilhelm II. hatte im Weltkrieg den Sieg davongetragen und beherrschte nun mit der furchtbaren elektrischen Waffe den ganzen Erdball.
Hatte man zu Anbruch der aeronautischen Ära geglaubt, daß es nunmehr zwischen den Kulturstaaten Luftkriege ohne Ende geben würde, so erlebte man jetzt mit dieser Annahme völlig Fiasko: an die Verwendung einer elektrischen Massenmordwaffe, wie eine solche der Oszillator war, hatte niemand gedacht.
Am 1. Juli 1941 hielten es sämtliche Kulturstaaten der Erde für dringend geraten, mit Deutschland einen ewigen Weltfrieden zu schließen.
Stolz kreiste jetzt der teutonische Adler über des Erdballs Runde, ihm war alles Lebendige fortan untertan.
Die Morgenröte einer neuen Zukunft — — — War sie der Menschheit nicht jetzt erglüht, da ein für allemal die Kriege, als der Vergangenheit angehörend, vom Erdball verschwunden waren?
Hielt nicht die gewaltige Zauberkraft Elektrizität die Völker nun für alle Zeiten in Schach?
Deutschland war jetzt groß geworden — eine Weltmacht, aber es gebärdete sich nicht als solche. Es ließ jedem Volke sein angestammtes Land, seine Rechte und Sitten. Es gerierte sich eigentlich mehr als das Oberhaupt einer großen Familie, als der Lenker einer einzigen Menschengemeinde der Erde. Tyrannei und Bevormundung lag dem deutschen Machthaber so fern, wie Übermut und Eigennützigkeit. Kaiser Wilhelm II. war der beste GrandPotentat, den sich die Völker der Erde nur wünschen konnten. Ihn gelüstete es nicht danach, Völker zu bekriegen und zu vernichten. Unter seinem weisen Regime mußte die Kultur im ewigen Frieden erstarken. Zu Luft, Wasser und Land war der deutsche Monarch Alleinherrscher. Dank seiner elektrischen Waffe. Daß diese Macht aber nie einen Mißbrauch erfahren sollte, dafür bot Deutschlands Friedensliebe und ehrliche Gesinnung die besten Garantien.
Unter den Fittichen des teutonischen Adlers sollte sich die Menschheit fürderhin geborgen sehen.
Zu Ehren kam die Bibelstelle:
» ... und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!«
Es mögen hier nun noch ein paar Worte über das Schicksal derer gesagt sein, welche die Kulturwelt im Jahre 1940 in neue Bahnen gelenkt hatten, über die, denen die Welt so große technische Errungenschaften verdankte. Saint-Martin, Stanwood, Winsor und jener, der sie alle bemeistert hatte, der Erfinder des Oszillators.
Während Saint-Martin in Paris die Früchte seines Schaffens weiter genießen konnte und mit der von ihm erwählten Lebensgefährtin, Jeanne Ponchon, ein glückliches Dasein führte, erging es den beiden amerikanischen Helden recht übel. Die Yankees hatten es mit List verstanden, ihre beiden verräterischen Landsleute wieder in die Gewalt zu bekomme. In Anbetracht ihrer früheren Verdienste sah man von einer standrechtlichen Erschießung der beiden Hochverräter ab und verurteilte sie nur zu lebenslänglicher Deportation nach einer unwirtlichen Gegend Australiens.
Die Transaktionen des Bankiers Zumpe, aus den aeronautischen Erfindungen der Franzosen und Amerikaner in Deutschland für sich Kapital zu schlagen, mißlangen vollständig, denn die deutsche Regierung hatte ein berechtigtes Mißtrauen und verweigerte Zumpe jede Konzession.
Die Kriegsniederlagen, welche die Franzosen und Amerikaner erlitten hatten, kosteten den Oberhäuptern dieser beiden Staaten den Präsidentenstuhl und riefen auch sonst noch große Umwälzungen in diesen Ländern hervor.
Nachdem die Suprematie der Franzosen und Yankees in aeronautischen Dingen gebrochen war, wurden die technischen Errungenschaften jener drei genialen Erfinder Gemeingut der ganzen Menschheit, Deutschland als regierender Weltstaat regelte das gesamte Luftverkehrswesen und spannte ein aeronautisches Netz über den ganzen Erdball.
Damit brach erst die wahre, neue Kulturära für die Völkerschaften der Erde an.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.