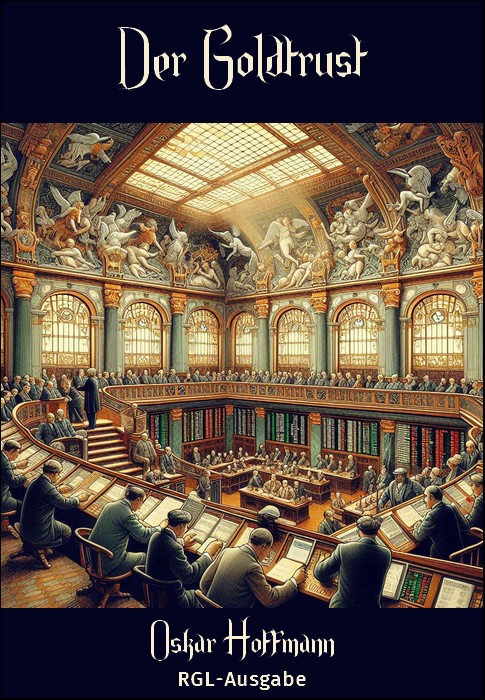
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
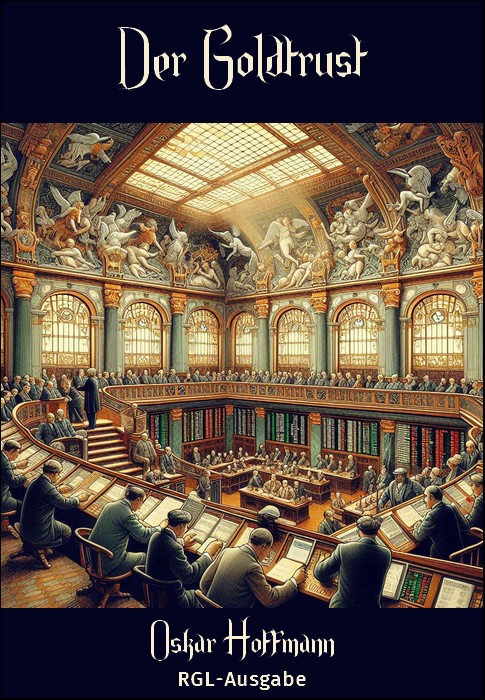
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
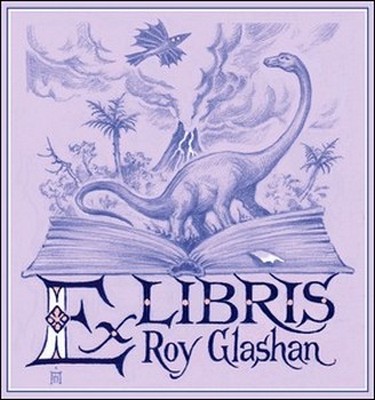
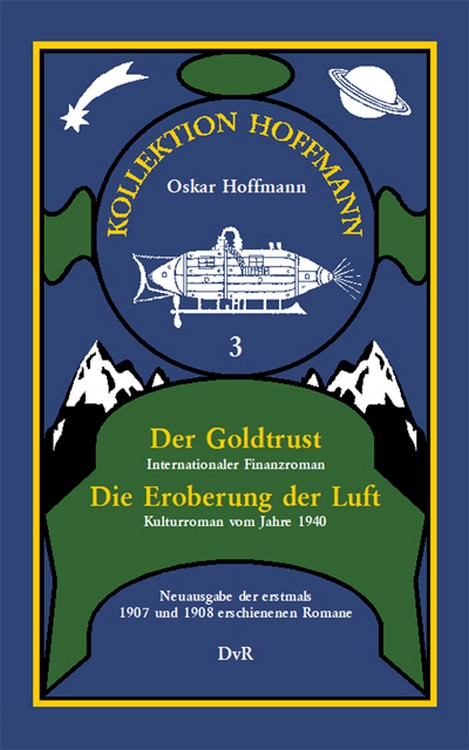
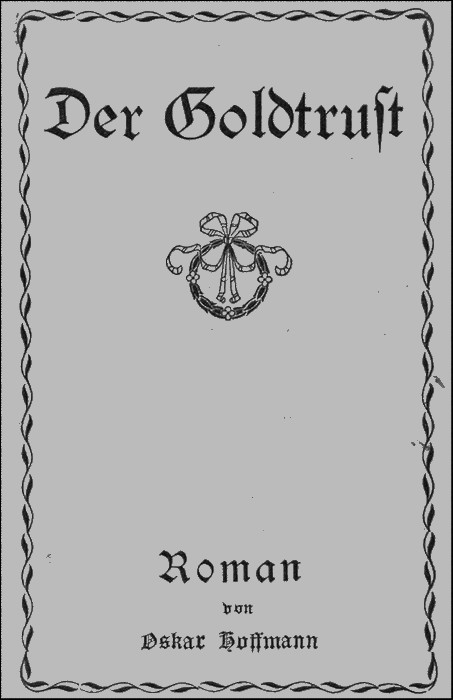
Oskar Hoffmann: Der Goldtrust.
Berlin: Seemann Nachfolger 1907,
Einbanddeckel der gebundenen ersten Ausgabe
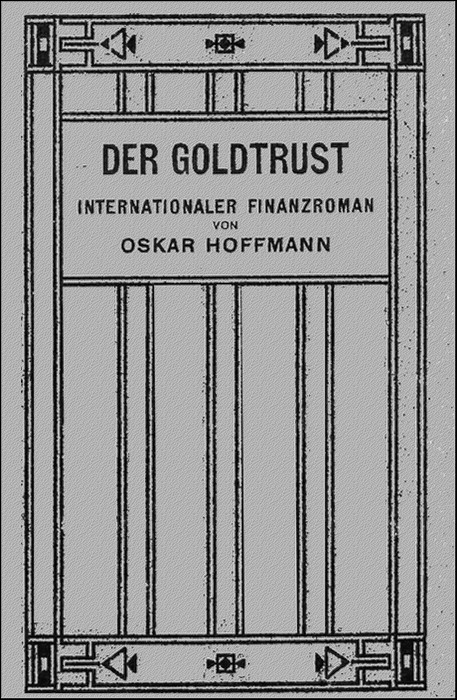
Oskar Hoffmann: Der Goldtrust
(Champion-Romane. Bd. 1).
Berlin: Seemann Nachfolger o.J. [ca. 1908],
Einbanddeckel einer gebundenen Ausgabe
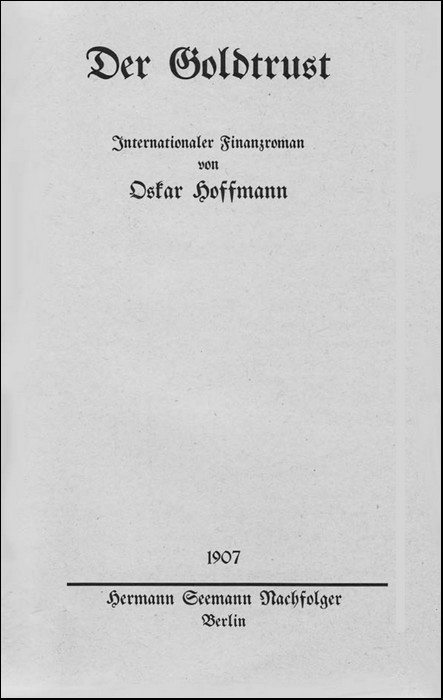
Oskar Hoffmann: Der Goldtrust.
Berlin: Seemann Nachfolger 1907,
Titelseite (S. 3, unpaginiert)
Ein an Kriegen und Seuchen reiches Säkulum war wieder einmal über die Kulturwelt dahingeflossen. Die Landkarten des europäischen Kontinentes hatten infolge der beträchtlichen Gebietseroberungen verschiedener Großmächte eine solche tief eingreifende Änderung in politischer Hinsicht erfahren, daß sie nach ihrer Korrektur ein ganz anderes Aussehen gegen früher bekamen. Weite Landstriche, wo seit den Jahren der Franken der gallische Hahn nistete, waren in die Hände der ruhmreichen Nachkommen der Germanen gefallen; der Koloß »auf tönernen Füßen«, das ehemals so gewaltige Zarenreich, hatte sich in seinen wiederholten Kämpfen mit der gelben Rasse im fernen Osten und mit den ewig ländergierigen Söhnen Albions, den Verbündeten der Schlitzäugigen, nahezu aufgerieben, und der langwierige Zwiekampf zwischen den Beschützern der absoluten Monarchie und den Anhängern einer konstitutionellen Herrschaft, sowie die finanzielle Mißwirtschaft hatten ihr übriges noch dazu beigetragen, die russische Großmacht als solche auf das Sterbebett zu werfen. Die deutschen Länder ÖsterreichUngarns hatten sich dem umsichtigen und klugen germanischen Souverän angeschlossen, während die Ungarn und Tschechen, gerade wie Polen und Finnland, Republiken mit eigener Regierung bildeten, die in Allianz mit dem mächtig gewachsenen und aufgeblühten germanischen Reiche standen. Letzteres hatte sich unter einer weisen, fürsorglichen Regierung zum Herrn von Europa aufgeschwungen, während John Bull, der schlaue Brite, die unumschränkte Macht und Herrschaft in Asien behauptete. Die dritte allein noch in Frage kommende Weltmacht, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, war zu einer Riesenrepublik angewachsen; fast alle Länder des amerikanischen Erdteils hatte sie unter ihre schützenden Fittiche gebracht und benamste sie seit einiger Zeit: Freie Republik der amerikanischen Nord- und Südstaaten. Italien, Frankreich und noch andere kleinere Nationen des europäischen Festlandes spielten nur untergeordnete Rollen in der Weltpolitik; sie waren trotz ihrer Allianz untereinander gegenüber den Riesenmächten ohnmächtig und schraken schon bei einem Wimperzucken der letzteren zusammen. Die früher, als einmal ans Ruder kommen könnende, gefürchtete »gelbe Gefahr« war nicht in Aktion getreten, die Engländer hielten ihre schlitzäugigen asiatischen Verbündeten, zu denen auch die Chinesen gehörten, im Zaume. Wußten sie doch nur zu genau, daß, wenn diese die Oberhand einmal erlangen würden, sie selbst am ersten und ein für allemal gerichtet seien.
Zu dieser Zeit war es, als durch die gesamte Tagespresse das Gerücht lief, daß ein Ingenieur mit völlig obskurem Namen, der seiner Abstammung nach ein Russe war, dem ungeheuer wichtigen Geheimnis der künstlichen Golderzeugung auf die Spur gekommen sei. Diese durch alle Blätter kolportierte Nachricht entlockte anfangs natürlich gar Vielen, besonders den Fachleuten ein Lächeln. Die Vertreter der Wissenschaft fanden die Naivität, mit welcher die Redaktionen, selbst die der größten Tageszeitungen und Journale, einer solchen utopischen Mitteilung eines kecken Alchemisten, der sicherlich nur die Welt ein wenig mystifizieren wollte oder der reif fürs Irrenhaus war, die Spalten ihrer Organe öffneten, geradezu unbegreiflich. In den Kreisen der Gebildeten fand also die sensationell aufgebauschte Nachricht anfänglich keine besondere Beachtung; wäre sie gerade am 1. April aufgetaucht, so hätten sicher die meisten geglaubt, daß es sich hier um einen regelrechten und wohlgelungenen Aprilscherz handelte. Freilich gab es auch von vornherein eine Anzahl Leichtgläubige, welche den Zeitungsberichten aufs Ungewisse hin mehr als flüchtige Beachtung schenkten. Nachdem aber der Goldmacherei von der Presse ständig neue Aufmerksamkeit entgegengebracht und diese Angelegenheit der Leserwelt immer wieder aufgetischt wurde, begannen sich gewisse Leute damit zu beschäftigen, den Dingen einmal auf den Grund zu gehen und für den Fall, daß es sich wirklich nicht um bloßen Humbug handle, Perspektiven zu ziehen, welche Folgen die Entdeckung reifen würde. Schließlich befaßte sich sogar die Gelehrtenwelt mit der Sache. Sie prüfte das wenige, was über die Goldfabrikation in chemischer und physikalischer Hinsicht verlautet war und bestritt dann auf das entschiedenste, daß an der ganzen Geschichte etwas Wahres sei. Das Resultat ihrer Untersuchung faßten sie dahin zusammen, daß es sich nur um die frivole Mystifikation eines Spaßvogels handle, der in geschickter Weise eine Legion Menschen an der Nase herumzuführen gedachte.
Trotz dieses aufklärenden Protestes von kompetenter Seite kam die Sache nicht zum Schweigen; fortgesetzt tauchten bald hier, bald dort neue Berichte über die Person des Weltbeglückers, wie der obskure Alchemist von Treviso bereits mehrfach genannt wurde, auf, und als dann ein amerikanischer Gelehrter für die Entdeckung in die Schranken trat, indem er die Lösung des Problems der Goldmacherei für gar nicht so utopisch hielt, da beschloß die italienische Regierung insgeheim, einmal die Sonde anzusetzen. Im stillen trug sie sich bereits mit dem Gedanken, falls etwas Wahres an der Entdeckung sei, den Adepten für ihre Zwecke zu gewinnen. Die Lösung des Problems war ja von einer so weittragenden Bedeutung, daß der Staat, der das Glück hatte, den Entdecker dauernd in seinen Grenzen zu beherbergen oder ihn gar als Untertan betrachten zu dürfen, für alle Zukunft derjenige blieb, der die ganze Welt beherrschen mußte. Das wurde von den verschiedenen Regierungen fast zu ein und derselben Zeit erwogen; zuvörderst freilich nur im geheimen, denn erstens wollte sich kein Staat endlos blamieren, wenn die Goldmacherei sich zum Schluß doch nur als ein gewaltiger Humbug oder als eine Mystifikation sondergleichen entpuppte, und zweitens wollte jeder, wenn eine wirkliche Lösung des Problems stattgefunden hätte, der erste sein, der das unendlich wichtige Geheimnis kennen lernte, um sofort allen und jeden Nutzen daraus zu schlagen.
Also eine ganze Weltumkremplung stand jetzt möglicherweise in naher Aussicht; da hieß es seitens der Machthaber auf der Hut zu sein.
Natürlich machte die italienische Regierung den modernen Adepten zuerst ausfindig, weil er auf ihrem Gebiete weilte. Aber auch die Nachforschungen der andern Staaten blieben nicht ohne Erfolg, und bald war es in der ganzen Welt bekannt, daß der Mann, vor dem bereits im stillen Nationen zitterten, ein russischer Untertan war, Wassilowitsch hieß und in Treviso, einem Orte in der Nähe Venedigs, lebte.
Der Genannte, der so schnell der Mittelpunkt des Interesses aller Kulturstaaten zu sein schien, war ein noch in jüngeren Jahren stehender Mann von untersetzter Gestalt, dessen Gesicht sich durch eine besondere Häßlichkeit auszeichnete und der dem Anschein nach von der Mutter Natur stiefmütterlich behandelt, auf der linken Seite seines Rückens eine merkbare Erhöhung hatte, die von Spöttern meist als ein regelrechter Buckel bezeichnet wurde. Freilich war Wassilowitsch immer sehr darauf bedacht, daß sein Mißwuchs nicht allzusehr ins Auge fiel, weshalb er stets, Sommer und Winter, eine breite Pelerine über den Rücken hängte und nur bei Dunkelheit ausging. Seinen Charakter kannte niemand; kein Eingeborener von Treviso konnte sich rühmen, mit ihm, dem Sonderling, jemals in nähere Berührung als vielleicht geschäftlich gekommen zu sein. Einige scharfblickende Bürger glaubten aus dem Aussehen und Benehmen des Einsiedlers zu entnehmen, daß dieser ein verschlagener Mann sei, dem man nicht trauen könne und der unfehlbar eine Vergangenheit hinter sich habe, die düster und unheimlich genug war, um sie Fremden ängstlich zu verbergen.
»Er ist ein Nihilist ... was kann ein Russe anderes sein?« sagten die einen und hüteten sich deshalb, mit dem Sonderling in irgend welche näheren Beziehungen zu treten.
»Verrückt wird er sein,« meinten andere.
»Bah! sicher ein Falschmünzer oder so etwas,« behaupteten Dritte. Und so hatte bald jeder eine besondere Meinung von Wassilowitsch. Der aber ließ sich von niemand in die Karten schauen, er mied sorgfältig jeden, der ihn einmal auf den Zahn fühlen wollte. Fast barsch kam er Leuten entgegen, die es wagten, ihre Neugier durch Fragen an ihn zu befriedigen. Ein solches Benehmen ließ natürlich die allgemeine Ansicht, daß der Fremdling irgend etwas auf dem Kerbholze oder sonstwie etwas zu verbergen habe, nur noch fester Wurzel fassen. Hierzu trug noch der auffällige Umstand bei, daß Wassilowitsch niemals die Laden vor seinen Fenstern öffnete und auch stets, wenn er das Haus verließ, dieses sorgfältig hinter sich verschloß. Die weiblichen Wesen von Treviso gingen dem seltsamen Manne immer aus dem Wege, wo sie ihn trafen; sein unruhig flackerndes Auge war ihnen unheimlich. Wassilowitsch hatte etwas Stechendes in seinem Blick, wie einer, der nie Gutes im Schilde führte.
Oft vergingen Tage, ja auch zuweilen Wochen, ehe jemand ihn zu Gesicht bekam. Und gerade in der letzten Zeit, bevor die unglaublichen Gerüchte über die Goldmacherkunst die Tageszeitungen durchschwirrten, war Wassilowitsch seltener noch als sonst zu sehen gewesen. Einmal mochten wohl rund vier Wochen verstrichen sein, als ihn, den Sonderling von Treviso, ein ehrsamer Bürger dieses Städtchens, der dem geheimnisvollen Hause gegenüber wohnte und wegen eines Gebrechens nie ausging, wieder zu Gesicht bekam. — — Als nun bekannt wurde, daß Wassilowitsch derjenige sei, der die Kunst des Goldmachens verstünde, da glotzten die braven Bürger von Treviso den seltsamen Mann mit fast entsetzten Blicken an, glaubten sie doch nun erst recht, daß er mit dem leibhaftigen Gottseibeiuns Gemeinschaft habe.
Die Berichte in den Zeitungen hatten ihren Ursprung eigentlich in den Nachforschungen einiger Bankdirektoren, denen Wassilowitsch einmal einen gediegenen Goldbarren zum Kauf anbot. Anfänglich glaubten die Herren von der hohen Finanz, daß der unscheinbare Mann aus Treviso ein früherer Goldgräber sei, worin sie auch durch die Reden des Russen, der jene bei dem Glauben ließ, noch bestärkt wurden, bis dann aber der erstandene Goldbarren seine Farbe wechselte und Stellen aufwies, die hier und da einen derben Stich ins Grüne erkennen ließen. Die sofort angestellten chemischen Analysen und sonstigen Probeversuche, wie solche bei den Goldschmieden üblich sind, ergaben jedoch, daß an der Echtheit des Goldbarren nicht zu zweifeln sei. Trotzdem aber wurden die entstandenen Zweifel nicht sofort wieder verscheucht; der Stich ins Grüne war da und den Finanziers zu auffällig. Sie forschten daher nach, wo Wassilowitsch hauste und wie er zu dem Goldbarren käme. Da ergab sich denn mancherlei, was die gehegten Bedenken wohl rechtfertigte. Besondere Beachtung fand die Tatsache, daß Wassilowitsch sehr abgeschieden lebte und völlig unzugänglich war. Das bildete so gravierende Momente, daß diejenigen, welche die Nachforschungen angestellt hatten, sich mit vielen Fachleuten darüber besprachen, ob der bucklige Mann von Treviso nicht doch ein Falschmünzer sein könne. Schließlich erfuhr dann ein Vertreter der heimischen Presse von diesen Erörterungen, und flugs fand sich in den Spalten eines Abendblattes die Nachricht, daß die Kunst des Goldmachens jemand gelungen sei, wenngleich der, welcher die inhaltsschweren Zeilen geschrieben hatte, keineswegs zu denen gehörte, die der Sache den nötigen Glauben beimaßen; Reporter sind eben manchmal Menschen mit weitem Gewissen und Spaßvögel, welche die Welt nur zu gern mit einem Sensationsartikel überraschen.
Das Resumee der Nachforschungen ergab, daß die Sache mit Wassilowitsch keineswegs stimmte; daß sich da etwas Geheimnisvolles im Hintergrund verbarg, dem nicht so ohne weiteres beizukommen war.
Als der Adept schließlich gewahr wurde, daß die Menschen hinter sein Tun und Treiben einen Blick werfen wollten, ließ er jede Beziehung zu der Bank, mit der er jenes Geldgeschäft gemacht hatte, fallen und versuchte nun bei Nacht und Nebel seine Goldbarren im Auslande unterzubringen. Die österreichische Grenze war nicht weit und Segelboote kreuzten genügend oberhalb Venedigs, um ein solches für seine Überfahrt nach Triest, welches unweit auf dem jenseitigen Gestade des Adriatischen Meeres lag, zu gewinnen. Doch die italienische Regierung, welche schon längst über das geheime Treiben des buckligen Russen in Treviso unterrichtet war, und der es sehr daran lag, Licht in die dunkle Sache zu bringen, machte Wassilowitsch einen Strich durch die Rechnung.
An einem stürmischen Herbstabend um die zehnte Stunde verließ der Adept sein Haus, nachdem er sich vergewissert hatte, daß er unbeobachtet war, und schritt mit einer Kiste, an welcher er schwer zu tragen hatte, durch die einsamen Straßen zur Stadt hinaus. Nach etwa einhalbstündiger Wanderung erreichte er keuchend unter seiner Last das Ziel, den Piavefluß. Nach allen Seiten hin spähend, blieb Wassilowitsch am Ufer des hier nahe seiner Mündung besonders breiten Stromes stehen.
Soweit sein Blick die dichte Dunkelheit zu durchdringen vermochte, sah er nirgends ein Fahrzeug auf dem durch den brausenden Wind bis in die Tiefe aufgewühlten Wasser des Piave. Die tagsüber hier sonst zahlreich kreuzenden Boote waren wohl sämtlich bei Ausbruch des Wetters an geschützten Stellen des Ufers vor Anker gegangen. Und das besonders weiter flußabwärts.
Ratlos hielt der Bucklige Umschau und ein leiser Seufzer, oder war es ein Fluch, entrang sich seinen Lippen. Die Last hatte er neben sich auf den sandigen Boden gelegt, und von Zeit zu Zeit huschte eine flüchtige Welle darüber hin, ihren brandigen Schaum zurücklassend.
»Maladetto!« murmelte Wassilowitsch, als ihm eben der Sturm die Mütze wegfegte. Zum Glück blieb diese an einem nahestehenden Gestrüpp hängen, so daß sie der Bucklige wiederzuhaschen vermochte.
Da — — was war das?
Männerstimmen klangen vom andern Ufer herüber und ließen Wassilowitsch erschreckt zusammenzucken. Undeutlich vernahm er auch ein Geräusch, das von dem Aufschlagen über die Wasserfläche klatschender Ruder herzurühren schien.
Beim schärferen Hinsehen konnte er dann bald darauf am gegenüberliegenden Gestade zwei Gestalten erblicken, die ihrem Berufe nach Fischer oder Schiffer zu sein schienen.
Der Bucklige duckte sich schnell, um nicht gesehen zu werden, denn er wußte nicht, ob er Freund oder Feind vor sich hatte. Er konnte jetzt, wo alle Welt ihm auf den Fersen war, nicht vorsichtig genug sein.
Doch drüben schien man ihn wohl schon bemerkt zu haben, denn die beiden Männer lugten eben herüber und an ihren Gestikulationen war zu erkennen, daß ihnen die Gestalt des Buckligen nicht entgangen war.
Wieder schlüpfte ein »Maladetto!« über Wassilowitschs dürre Lippen. Er sah sich entdeckt und war nun unschlüssig, was er tun sollte.
Inzwischen zauderten die drüben aber nicht und setzten mit einem Boot, das im Uferschilf versteckt gelegen hatte, über das tosende Wasser. Vier kräftige, stark sonnengebräunte Fäuste handhabten die Riemen des leichten Fahrzeuges mit einer solchen Kraft, daß dasselbe wie ein Pfeil die schaumige Flut des windgepeitschten Piave durchquerte und in wenigen Minuten den Strand erreichte, wo sich Wassilowitsch noch immer still in schlechter Deckung verhielt. Seine krumme Gestalt hatte er vollends in den Sand gleiten lassen und verbarg sich, so gut es ging hinter der Kiste.
»Halloh!« tönte es ihm jetzt mit rauher Stimme entgegen.
Der Bucklige hob sich empor, er sah ein, daß hier kein Verstecken mehr half.
»Wer seid Ihr?« frug der Schiffer und in seiner Hand blinkte ein Revolver, den er für alle Fälle bereitzuhalten schien.
Das Boot, von dem zweiten Manne gelenkt und vollends ans Ufer gebracht, fuhr jetzt auf dem Sande auf.
»Ich komme von ... Treviso —« antwortete Wassilowitsch und blinzelte auf die Waffe.
»Und was habt Ihr zu so später Stunde hier bei Sturm und Regen zu suchen?« frug die kernige Männergestalt im Boote.
»Ich habe mich verirrt,« entgegnete der Bucklige, der nicht recht wußte, welche Antwort er geben sollte.
»Verirrt —« gab der andere zurück und schien der Angabe keinen Glauben beizumessen.
»Könnt Ihr mich am Ufer drüben absetzen? Ich lohn's Euch gut,« sagte Wassilowitsch.
»Vorerst, wer seid Ihr, Mann?« Mit diesen Worten stieg der Sprecher aus dem Boot und bewegte sich auf sein Visavis mit behäbigen Schritten zu.
Das Pistol ließ in dem Buckligen allerlei Gedanken aufsteigen. Hatte er es mit ausgesandten Häschern zu tun, oder mit Räubern, Schmugglern, wie sich solches Gesindel an der nahen Grenze mit Vorliebe herumtrieb?
»Wenn Ihr's durchaus wissen wollt, so sage ich Euch, daß ich ein Russe bin,« versetzte er.
»Hm ...« machte der fremde Schiffer und wendete sich dann seinem Gefährten zu, diesem einige Worte ins Ohr flüsternd. »Spioniert wohl hier so'n bißchen rum?« begann er dann wieder und sah den Buckligen, der sich inzwischen vor seine Kiste gestellt hatte, mit forschendem Blicke an.
»Was denkt Ihr ...« entgegnete Wassilowitsch.
»Ist das Euer Handgepäck?«
»Die Kiste ist mein Eigentum.«
»Wozu wollt Ihr ans Ufer hinüber?« forschte der Schiffer weiter.
»Je nun, ich möchte ins Österreichische hinein,« meinte Wassilowitsch.
Die beiden Schiffer sahen sich einander verständnisvoll an.
»Sagt mal, Ihr schmuggelt wohl?« frug der eine wieder und lenkte seine Blicke auf die Kiste.
»Ehe ich hierauf eine Antwort gebe, möchte ich wissen, wer Ihr seid, lieber Freund,« versetzte der Bucklige.
»Wir — — wir sind Schmuggler ...«
»Pusch ...« klang es überrascht aus Wassilowitschs Munde und ein Lächeln glitt flüchtig über sein Gesicht.
Das Pistol wurde um einige Zoll gehoben.
Der, dem die Mündung der Waffe entgegengerichtet war, faßte jetzt sein Gegenüber ins Auge.
»He, guter Mann, ich glaube Ihr könnt mir nützlich sein, wenn Ihr wollt ... ein besseres Zusammentreffen als mit Euch hätte ich mir nicht wünschen können,« gab Wassilowitsch zur Antwort, als er durch die leise Bewegung der Pistole daran erinnert wurde, daß man Grund hatte, ihm nicht zu trauen.
»Habt Ihr Papiere bei Euch?« forschte der zweite Schiffer jetzt.
»Papiere ...« Der Bucklige kramte in seiner weiten Rocktasche herum. »Papiere ... hm — — nein, nichts dergleichen. Kann Euch leider nicht damit dienen, aber Geld könnte ich Euch geben ... Hundert Lire ...«
Der andere ließ das Pistol sinken. »Bah — wir sind keine Straßenräuber. Wir wollen Euch Eures Geldes nicht berauben. Wir wollen nur wissen, wer Ihr seid und was Ihr jetzt hier wollt.«
»Ich bin Schmuggler wie ihr,« versetzte Wassilowitsch. »Was ich über die Grenze schaffen möchte, das ist schon des Lohnes wert ... Topp! hundert Lire, wenn Ihr mich und die Kiste dort bis über die Grenze bringt.«
»Hundert Lire. — Dafür tragen wir unsere Haut nicht zu Markte, alter Freund. Da werdet Ihr wohl selbst zusehen müssen, wie Ihr Euch vor dem Grenzposten vorbeidrückt. Seid aber vorsichtig, die Kerle haben in ihren Flinten Dinger stecken, die unter der Haut mächtig jucken.«
»Neunkalibrige ...« setzte der andere Schiffer hinzu.
»Für dreihundert Lire seid Ihr auch nicht zu haben?«
Ehe der Bucklige noch eine Antwort erhielt, stutzten die beiden anderen, sie glaubten in der Nähe ein verdächtiges Geräusch gehört zu haben.
Das Pistol hob sich wieder etliche Zoll.
»St! ...« stieß der eine Schiffer hervor.
»'s war 'ne Rohrdommel im Schilf, Pepp,« flüsterte der zweite Schiffer.
Der mit Pepp angeredete Mann ließ das Pistol sinken.
»Dreihundert Lire, sagtet Ihr ...« wendete er sich wieder an Wassilowitsch.
»Ich bin nicht knickrig, wenn's ohne Flintenschüsse abgeht,« gab der Gefragte zur Antwort. »Meinetwegen auch — — fünfhundert.«
Die Freigebigkeit, die Art und Weise, wie jener mit den Hundertlirescheinen umsprang, erregte bei den Schmugglern gewisse Bedenken. Vielleicht war das ganze eine Falle, in die sie hineinschlüpfen sollten. Die zwei Männer flüsterten untereinander und schienen die aufgetauchten Bedenken nicht loszuwerden.
»Wenn Ihr kein ehrliches Spiel treibt, so könnte es Euch wohl schlecht bekommen,« meinte dann der ältere der Schmuggler zu Wassilowitsch.
»Ihr mißtraut mir? Hier, meine Hand zum Pfande. Übrigens, ich habe noch mehr Grund als Ihr, mich vor den Douanen und Häschern zu hüten.«
Erstaunt sahen ihn die anderen beiden an.
»Teufel! Habt Ihr soviel auf dem Kerbholz?« frug Pepp und streifte den Buckligen mit einem Blick, der vieles ausdrückte.
Der Russe lachte hämisch in sich hinein. »Ihr ratet's nicht ...«
»Wenn Ihr vielleicht einen Mord auf dem Gewissen habt, so ist der Sprung übern Piave für Euch schon fünfhundert Lire wert,« meinte Pepp.
»Sehe ich aus wie einer, der mordet und brennt?«
Pepp zuckte die Achseln.
»Sehr schmeichelhaft ... doch ich habe keine Zeit zu verlieren mit müßigem Geschwätz ... wollt Ihr mich mit meinem Gepäck für die genannte Summe über die Grenze bringen?« versetzte Wassilowitsch.
Ein gewaltiger Windstoß sackte sich in diesem Augenblick gerade vor den Männern in den Wassern der Piave und erzeugte eine breite, auf das Ufer sich zuwälzende Woge, deren weißer Gischt den Männern ins Gesicht spitzte.
»Hundewetter!« stieß der eine, »Maladetto!« der andere Schmuggler hervor und beide wischten sich die Schaumspritzer aus den Augen.
»Na, Freunde, wie ist's? Ich habe keine Zeit zu verlieren,« sagte Wassilowitsch.
»Gebt Eure Kiste her ...« antwortete Pepp und bückte sich, dieselbe aufzuheben. »Heiliger Ubaldus! ... Das Ding ist ja verteufelt schwer.«
»Wenn Euer Boot sie nur trägt,« versetzte der Russe und schielte nach dem Fahrzeug. Er schien wenig Vertrauen auf die Tragfähigkeit desselben zu hegen.
Der andere Schmuggler begann jetzt ebenfalls zu helfen und wenige Augenblicke später lag die Kiste im Boot. Dann betraten die Männer das Fahrzeug, als letzter Pepp, der sich nach geschicktem Abstoßen vom Ufer mit einem gewandten Satz auf die Kiste schwang und sofort ins Ruder griff.
»Eure Last wiegt schon a Stückel ... habt Ihr sie bis zum Piave geschleppt?«
Der Bucklige nickte. »Also Ihr helft mir, daß ich ungefährdet über die Grenze komme?«
»Heute nacht noch, wenn sich der verdammte Wind nur legen wollte. Das Wasser schlägt das ganze Boot voll,« knurrte der Führer.
Die Wellen der Piave schienen heute nicht zu spaßen, sie warfen das leichte Boot wie eine Nußschale umher, kaum daß es Pepp und seinem Kumpan gelang, es in der Gewalt zu behalten.
»Wenn wir versaufen, so ist Euer Handgepäck daran schuld,« fluchte der eine Pascher.
»Was steckt eigentlich darin ... Ihr müßt, beim heiligen Georg, Steine mit Euch herumschleppen,« meinte Pepp und legte sich jetzt mit Macht in die Riemen, um das Fahrzeug über die reißenden Wasser hinüberzubringen.
»Der Ballast ist schon des Paschens wert ... verlaßt Euch darauf,« antwortete Wassilowitsch und verzog sein Gesicht zu einem Grinsen.
»Die fünfhundert Lire habt Ihr doch parat?« fragte nach einer kleinen Weile Pepp. »Und echte Scheine, was? Gutes Gold, was? Man munkelt jetzt soviel von falschem Geld und Gold.«
»Tut man das?« frug Wassilowitsch mit lauernder Miene zurück.
»In Treviso soll ja der Teufel sitzen und Gold fabrizieren.«
»Was Ihr sagt ...« versetzte der Bucklige hierauf und unterdrückte ein leises Lachen.
»Habt Ihr denn einen Winterschlaf gehalten, daß Ihr davon noch nichts hörtet,« gab Pepp zurück und sprang, da das Boot das Ufer erreicht hatte, aufs Land.
»Könnt Ihr mich nicht mit dem Fahrzeug bis an die Grenze bringen?« meinte Wassilowitsch.
»Bei diesem Höllensturm ... sollen wir im Golf vielleicht Wasser schlucken?« erwiderte Pepps Kumpan.
»Mit Tagesanbruch muß ich auf dem Österreichischen sein, koste es was es wolle,« sagte Wassilowitsch hierauf.
»Der Wasserweg ist zwar der sicherste und schnellste für Euch und Euer Gepäck, aber der Teufel soll so'n kleines Krägboot durch den stürmischen Golf rudern. — — — Was legt Ihr noch drauf, wenn ich's riskiere?« Pepp sah beim Festmachen des Fahrzeuges den Buckligen scharf an, um zu erforschen, wieweit er mit seiner Unverschämtheit bezüglich des Passagegeldes gehen dürfe. Für ihn schien das Mienenspiel seines Fahrgastes der untrügliche Barometer zu sein, nachdem er seine Forderung schrauben konnte.
»Noch hundert Lire,« erwiderte Wassilowitsch gelassen.
»Sechshundert Lire ... ein Wort! Zahlt hundert an, und die Fahrt geht sofort weiter,« ließ sich der raffinierte Schmuggler vernehmen.
»Wollen wir bei der hohen See mit der verdammt schweren Kiste auf den Grund gehen?« hörte man jetzt den andern Schmuggler rufen.
»So bleib. Ich schaff's allein,« versetzte Pepp hierauf.
Doch der andere besann sich schnell eines besseren. Auch bei ihm waren sechshundert Lire kein Pappenstiel.
Das Unwetter hatte inzwischen nur wenig nachgelassen Der Orkan pfiff um die Ohren der drei Männer, daß es nur so seine Art hatte. Dazu kam nun noch ein wolkenbruchähnlicher Regenschauer, der sie alle bis auf die Haut durchnäßte. Die Schleusen des Himmels schienen auch nach einer Viertelstunde noch lange nicht geneigt, sich schließen zu wollen.
Das kleine Krägboot tanzte längst wieder auf den Wellen des Piave und nahm unter der kundigen Führung und den nervigen Fäusten seiner Besitzer den Kurs nach der Mündung zu. Die letztere lag nach den Angaben Pepps etwa zwei Stunden weit entfernt.
Auf der Fahrt wurde nur wenig gesprochen, denn Wind und Wetter nahm die ganze Aufmerksamkeit der beiden Schmuggler in Anspruch. Mehr als einmal war Gefahr vorhanden, daß das infolge seiner schweren Last ungewöhnlich tiefgehende Boot voll Wasser zu schlagen drohte. Die dichte Finsternis tat dann noch ihr übriges, um eine Unterhaltung nicht aufkommen zu lassen.
Wassilowitsch saß daher, nachdem er die Anzahlung von hundert Lire geleistet hatte, in Stillschweigen versunken da, schaute den auf die Wellen niederklatschenden Rudern zu und hing dabei seinen Gedanken nach. Von Zeit zu Zeit versäumte er es nicht, einen Blick nach rechts und links zu den in tiefer Dunkelheit liegenden Ufern zu werfen.
Nach Verlauf einer Stunde Fahrt schwächte sich endlich die Kraft des Sturmes ab, die Wasser des breiter gewordenen Flusses beruhigten sich, und von Zeit zu Zeit fiel ein Strahl Mondlicht durch das sich langsam zerteilende, vielfach zerrissene Gewölk des Himmels hernieder.
Der Bucklige war noch immer in Gedanken versunken. Er zog wohl kühne Perspektiven, deren Ausgangspunkt seine Entdeckung war. Jedenfalls stürmten allerlei Gedanken auf ihn ein, denn er übersah, trotzdem sein Auge zum rechten Ufer des Piave gelenkt war, einen schwachen Lichtschein am Lande.
Pepp und sein Kumpan hatten ihn längst gewahrt.
»Sapristi ... heiliger Nepomuk — — Douanen ... pst!« flüsterte Pepp.
Sofort hörte das Klatschen der Ruderschläge auf, und das Boot trieb mit den Wellen dahin. Die Schmuggler duckten sich und befahlen dem erschrockenen, so jäh aus seinen Sinnen gerissenen Wassilowitsch, dasselbe zu tun.
»Was ist? ... Gefahr ...« frug der Russe hastig und erregt.
»Halts Maul ...« knurrte Pepp.
Der Lichtschein mochte sich wohl nähern, denn bald war zu erkennen, daß er von einer Taschenlaterne herrührte, wenngleich der Träger derselben noch keineswegs sichtbar war.
»Die verdammten Douanen suchen mal wieder 's Wasser ab,« murmelte grimmig der andere Schmuggler, während Pepp seinen Revolver lockerte und ihn neben sich legte.
»Mensch ...« flüsterte er dann dem Buckligen ins Ohr. »Ihr habt doch sicher Steuerbares in der Kiste?«
Wassilowitsch zögerte einen Augenblick mit der Antwort, er wußte nicht, was er erwidern sollte.
»Zum Henker! antwortet doch ...«
»Freilich, Steuerbares ist's schon, aber ...«
»So werden sie uns jetzt am Zeuge flicken ... habt Ihr eine Waffe?«
»Einen Sechsläufigen ... aber wir sind doch gar nicht auf Grenzgebiet.«
»Gleich ... sie werden uns trotzdem anhalten. Die fahnden schon lange auf uns, und Ihr seid ihnen vielleicht auch ein guter Fang ... wer weiß,« antwortete Pepp. Zum Kuckuck sagt doch nur endlich, was Ihr in der Kiste mit herumschleppt.«
Der Lichtschein kam bereits in bedrohliche Nähe, und damit wurden auch gleichzeitig die Umrisse eines größeren Fahrzeuges sichtbar.
»Nun, so sollt Ihr's wissen, wer ich bin und was in der Kiste steckt,« erwiderte Wassilowitsch, als er einsah, daß es jetzt nicht gut ein Verbergen mehr gab. »Ich bin der Teufel, von dem ihr spracht, der in Treviso das falsche Gold fabriziert ...«
Die Wirkung dieser Erklärung zog eine gewaltige Verblüffung der anderen beiden nach sich, die fast so weit ging, daß Pepp die nahende Gefahr vergaß und sein Visavis mit weitaufgerissenen Augen anglotzte. Auch sein Helfershelfer zeigte eine Überraschung, die sich in allen seinen Mienen wiederspiegelte.
»Die Kiste enthält neben verschiedenen anderen Dingen, die ich gern jenseits der Grenze wissen möchte, auch Gold ... pures Gold ... Barren,« sagte Wassilowitsch weiter. »Es liegt mir viel daran, daß dies alles nicht in die Hände von gewissen Leuten fällt, die mich und mein Tun fortgesetzt kontrollieren ... Tausend Lire, Freund, wenn Ihr es fertig bringt, was Ihr versprochen.«
»Zu spät ...« murmelte Pepp, »da sind sie schon.«
Wassilowitsch schrak zusammen. »So wollen wir die Kiste ins Wasser werfen ... schnell!«
»Holla, das soll geschehen ... wir fischen sie später wieder heraus,« antwortete Pepp eifrig.
Kaum eine Minute später hörte man ein Klatschen des Wassers, der staatsgefährliche Ballast des Bootes war über Bord und sank auf den Grund. Nun konnten sie kommen. Und sie kamen auch. Eine geschickte Wendung des sich nahenden Fahrzeuges brachte dieses dicht in die Nähe der Schmuggler. Ein voller Lichtschein bestrahlte plötzlich das kleine Boot.
»Ho! ...« tönte es herüber.
»Was beliebt euch unsere Fahrt zu stören?« frug Pepp in scharfer Tonart.
»Ach, wir kennen uns ja ... keine Verstellung, alter Freund!« rief eben ein graubärtiger, hochgewachsener Mann, in dessen Hand eine Schußwaffe im Licht der grellscheinenden Laterne blitzte. Neben ihm sah man mehr als ein halb Dutzend Gestalten stehen, die auch schußfertig zu sein schienen.
»Wenn Ihr mich kennt, so erspart Ihr mir ja die Vorstellung,« antwortete trotzig Pepp.
»Habt wohl einen neuen Kollegen in Dienst genommen?« frug der Graubärtige in hämischem Tone wieder und streifte mit einem Blick die Krüppelgestalt des Russen. »Ei! das ist ja Signor Wassilowitsch ... Buona sera ! Zu so später Zeit auf dem Piave, Signor?«
»Sie kennen mich, Signor?« gab der Angeredete so gleichmütig als möglich zur Antwort.
»Wer sollte Signor Wassilowitsch nicht kennen ... alle Welt spricht ja von ihm. Die Menschen nennen Sie schon in einem Atem mit den Gekrönten der Welt. Es ist für mich eine hohe Ehre, den zukünftigen Herrn der Erde in persona begrüßen zu dürfen.«
Die Rede des Graubärtigen wies einen spöttelnden Ton auf, er schien nicht zu denjenigen zu gehören, die in Wassilowitsch die weltumkrempelnde Person sahen. Er wie noch viele andere glaubten in der ganzen Sache nichts anderes, als einen Humbug zu erblicken, dem selbst Regierungen und Souveräne zum Opfer zu fallen schienen.
Wassilowitsch richtete sich auf und ließ sich keineswegs aus der Fassung bringen. »Wenn's der Menschheit beliebt, mich den Herrn des Erdballs zu nennen, so habe ich keine Veranlassung, auch nur einen Finger zu rühren, um sie auf das Unsinnige ihrer Gedanken aufmerksam zu machen,« versetzte der Russe.
»Nun zur Sache ... wir müssen Euer Boot ins Schlepptau nehmen, teurer Freund,« sagte der Graubärtige zu Pepp gewendet.
»Tut, was Ihr nicht lassen könnt ...« knurrte der Pascher. »Daß wir nichts an Bord haben, davon könnt Ihr Euch ja überzeugen.«
»Wirklich nicht?« ließ sich der Graubärtige vernehmen, nachdem er einen Blick in das dicht neben dem großen Fahrzeug dahingleitende Krägboot geworfen hatte. »Beim heiligen Antonius! Ihr schwimmt wahrhaftig leer. Das ist doch sonst nicht Eure Mode, lieber Freund ... werdet den Kram wohl ins Wasser geworfen haben, was? ... Konnt mir's denken.«
Pepp ließ die weiteren Reden unbeantwortet. Er zündete sich gleichmütig eine Pfeife an und schien sich um sein weiteres Schicksal absolut keine Gedanken zu machen. Ihn mochte mehr die von Wassilowitsch in Aussicht gestellte Summe beschäftigen. Wahrscheinlich fing er an, darüber nachzugrübeln, wie er trotz des Mißgeschicks zu den tausend Lire kommen könne.
Das Fahrzeug des Graubärtigen war, wie Wassilowitsch jetzt erkannte, ein Douanierboot, dies bewies nicht bloß die Besatzung, sondern auch der kleine am Maste flatternde Wimpel. Nachdem nun Segel aufgesetzt waren, ging die Fahrt stromaufwärts.
Daß die Douanier einen guten Fang gemacht hatten, das verrieten ihre vergnügten Gesichter und wichtigen Mienen, die sie ab und zu im Gespräch unter sich aufsteckten. Und sie hatten auch alle Ursache, sich Glück zu wünschen. denn sie waren ihrer Aufgabe gerecht geworden und hatten — — — — den zukünftigen »Dominateur du monde« eingefangen, der allem Anschein nach in der stürmischen Nacht mit seinem Geheimnis das Weite suchen wollte.
Das »russische Nest«, so hatten die Bürger von Treviso die Behausung des Adepten getauft, bildete nun schon seit Wochen den Wallfahrtsort zahlloser Fremden. Aus der stillen, weltvergessenen Klause war ein Bienenstock geworden, durch dessen Pforte tagsüber Personen aller Stände schritten. Der unglückliche Besitzer des Häuschens mußte die Menschenflut über sich ergehen lassen, wollte er nicht, daß sie sein Heim mit Gewalt stürmten, um sich Einlaß zu erzwingen.
Wassilowitsch hatte seit dem nächtlichen Abenteuer mit den Douaniern keine Ruhe mehr gefunden. Er sann darum hin und her, was er beginnen könne, um die Menschen von der Idee wieder abzubringen, daß er das große Geheimnis der Goldfabrikation entdeckt habe. Noch zweifelte er ja selbst, daß das Problem gelöst sei, wenngleich er schon größere Mengen Gold hergestellt hatte. Der »Stich ins Grüne«, den sein Fabrikat aufwies, war für ihn noch verdächtiger, wie den Beamten der Bank, der er den ersten gediegenen Barren angeboten. Somit also konnte und durfte er alle Menschen, die seine adeptischen Versuche im besten Glauben, daß sie gelungen seien, begeistert feierten, nicht mehr länger bei ihrer Ansicht lassen. Zudem gestaltete sich das ganze Leben um ihn herum täglich auch bunter, so daß er selber bald nicht mehr aus noch ein wußte und sich schon mit dem Gedanken trug, Italiens Boden, der ihm unter den Füßen zu brennen anfing, heimlich zu verlassen. Er erinnerte sich aber dessen, daß er streng bewacht wurde, und zwar seit jenem Tage, an welchem er durch die Douanier aufgegriffen worden war. Ein Entkommen ins Ausland mußte ihm diesmal noch schwerer werden als das letzte Mal, wo er eigentlich nur die Absicht gehabt hatte, eine Menge des künstlichen Edelmetalles, sowie gefährliche Papiere, Schriftstücke aus der Zeit seines Aufenthaltes in der Heimat, jenseits der Grenze in sicheren Gewahrsam zu bringen. Wassilowitsch befürchtete nämlich gelegentlich eine Beschlagnahme seiner Effekten. Seit einigen Tagen hatte er die Entdeckung gemacht, daß seine gesamte postalische Korrespondenz einer behördlichen Zensur unterstand. Hatte der Bucklige bisher schon immer wenig geschrieben, so unterließ er von dem Augenblicke an, wo er von der Durchsicht seiner Briefschaften eine bestimmte Ahnung bekam, es überhaupt, auch nur eine Zeile zu schreiben. Alle die unzähligen Telegramme und Briefe blieben darum unbeantwortet. Somit passierte es manchem Staatsoberhaupt und gekrönten Manne, daß ihnen auf ihre Anfragen von einem so gewöhnlichen Sterblichen, wie es ja der Bucklige war, nicht einmal eine Antwort zuteil wurde. Statt daß nun aber diese absichtliche oder vielmehr unfreiwillige Nichtbeachtung der einlaufenden wichtigen Schriftstücke ihre Absender dahin belehrte, daß sie allem Anschein nach mystifiziert worden seien, hatte dies gerade das Gegenteil zur Folge. Die einlaufende Korrespondenz nahm von Tag zu Tag an Umfang zu.
Wassilowitsch geriet infolgedessen, daß er sich zum Mittelpunkt der ganzen Welt gemacht sah, in eine eigene merkwürdige Stimmung. Er verspürte so etwas wie eine Ohnmacht, vortreten und gegenüber der Welt verkünden zu können: Ich habe das Problem gelöst! Belohnt mich nach Gebühr!
Er trug sich eben noch mit quälenden Zweifeln. Er vermochte es nicht, das Produkt seiner geheimnisvollen Tätigkeit als unbestreitbar echt anzusehen. Das war es, was ihn seelisch fast aufrieb.
Der Stich ins Grüne!
Er war und blieb. Wassilowitsch hatte somit nach seiner eigensten Meinung die Natur nicht bemeistern können. Dieser Gedanke beherrschte ihn unausgesetzt — selbst im Schlafe. Im Wachen wie im Traume erblickte er vor seinem geistigen Auge den Stich ins Grüne.
In solcher Seelenqual beschloß der Bucklige, einmal gründlich die Probe aufs Exempel zu machen. Nicht in chemischer Hinsicht. Da waren die tausendfachen Proben, die er schon vorgenommen hatte, immer stichhaltig gewesen. Nein, eine rein physikalische Probe sollte diesmal den Wert der Entdeckung bestimmen — — für ihn und für die Welt.
Wassilowitsch war von Natur viel zu ehrlich veranlagt, als daß er seine Mitmenschen schmählich zu betrügen vorhatte. Die physikalische Stichprobe mußte auf das allergenaueste gemacht werden. Er selbst war sich Rechenschaft über sein Tun schuldig.
Mit solchen Gedanken ging der Russe an die Vorbereitungen, welche die von weittragender Bedeutung werden könnende Untersuchung erforderte. Vorerst sollte niemand zugegen sein. Später, wenn er zu einem Resultat gekommen war, gleichviel, ob zu einem positiven oder negativen, wollte er sein Tun und Treiben nicht mehr bemänteln, offen sollte es dann vor der Mitwelt liegen, damit ihm niemand eine Beschuldigung ins Gesicht schleudern könne. Der Bucklige dachte so, wie es sich für einen Menschen von Charakter geziemt. Aber bei diesem Gedankengang machte er abermals die Rechnung ohne den Wirt. Er sollte in kürzester Zeit die Wahrnehmung machen, daß der Mitwelt absolut nicht mit rückhaltloser Offenheit gedient war.
Wassilowitsch traf nun alle Vorbereitungen, damit er nicht von den alltäglich ihn überlaufenden Besuchern gestört werde und verschloß sein Haus für einen vollen Tag. Auch die Fensterladen der Rückseite des Gebäudes zeigten sich auf zweimal zwölf Stunden den Nachbarn fest verriegelt.
Zu der vorzunehmenden eingehenden Prüfung hatte sich Wassilowitsch allerlei neue physikalische Wäg- und Meßapparate subtilster Konstruktion, soweit diese ihm noch gefehlt hatten, besorgt.
Der kleine Schmelzofen in der Ecke des geräumigen Laboratoriums wurde zunächst von dem Adepten in Betrieb gesetzt, und bald flammte ein von Sauerstoff und Wasserstoff unterhaltenes Feuer unter dem Tontiegel auf, das an Wänden des getünchten Raumes einen gespenstischen Lichtschein hervorrief.
Dann entnahm der Bucklige einem kleinen in die Mauer eingelassenen Schranke einen Glaskasten, der in seinem Innern eine Balkenwage enthielt, deren pendelnder Zeiger eine elektrische Kontaktvorrichtung auswies, die mit einer galvanischen Batterie durch einen zarten Platindraht in Verbindung gebracht werden konnte. Wassilowitsch hatte diese Wage bisher noch nicht besessen.
Sie war es, die ihm vollen Aufschluß geben sollte. Da der Wagebalken in einem Vakuum, einem luftleeren Raume, schwang, so mußten sich damit die unnennbar feinsten Wägungen vornehmen lassen, ohne daß dabei auch nur Atome sich verflüchten konnten.
Wassilowitsch gedachte Wägungen einer größeren Anzahl Proben seines Kunstgoldes vorzunehmen, da die zu verschiedenen Zeiten hergestellten Mengen möglicherweise trotz allen einheitlichen Arbeitens voneinander abweichende physikalische Eigenschaften und Erscheinungen besitzen konnten, wenngleich sie allesamt dieselbe chemische Natur ohne die geringste Abweichung unter sich aufwiesen.
Das Durchproben in dieser Weise betrachtete Wassilowitsch als einen Akt besonderer Vorsicht, denn er besaß eine hinreichende Portion Skeptik, um nicht ohne weiteres auf äußeren Augenschein hineinzufallen und somit selbst ein Opfer eigenster Düpierung zu werden.
Ehe Wassilowitsch an die Prüfung, die ihn von den gewaltigen quälenden Zweifeln befreien sollte, ging, speiste er seinen Muffelofen mit einem Zufluß komprimierten Sauerstoffs und Wasserstoffs. Dann schüttete er in den feuerfesten, unschmelzbaren Tiegel drei Substanzen. Es waren die Stoffe, die er um keinen Preis, sei er auch noch so immens, seiner Mitwelt ihrem Namen und ihrer Zusammensetzung nach vorzuenthalten dachte. Die Ehrlichkeit, mit der der Bucklige sich trug, sollte aber doch bald einem sich gewaltsam in seinem Denken und Handeln Platz machenden Egoismus weichen.
Das Laboratorium, das mit all seinen Retorten, Phiolen und Instrumenten beim Schein der grellen Muffelofenflamme wie eine mittelalterliche Hexenküche aussah, füllte sich alsbald, nachdem Wassilowitsch eine Destillationsprobe vorgenommen hatte, mit schweren, dichten Dämpfen. In dem Tiegel schmolz eine graugrüne Masse und brodelte bereits lustig, als der Adept herantrat, um das Schmelzprodukt zu prüfen. Sein Auge leuchtete wie die glutflüssige Masse, in welche er soeben schaute. Ein zufriedenes Lächeln huschte über das häßliche Gesicht des Mannes, der es hier unternahm, der Kulturmenschheit höchstes materielles Gut wertlos zu machen.
Den Moment, wo bei dem Brodeln der metallischen Komposition im Tiegel jener »Stich ins Grüne« eintrat, den das Kunstgold auch im erkalteten Zustand nicht verlor, durfte Wassilowitsch nicht verpassen, denn im selben Augenblick mußte die Schmelze unterbrochen werden. Um hierbei völlig sicher zu gehen, verfolgte der Bucklige den Prozeß im Muffelofen mit Hilfe eines Spektroskopes. Genau dreieinhalb Sekunden später von dem Zeitpunkt ab, wo in dem Spektralapparat die dunkle Linie C beim 34. Skalastrich im Orange des farbigen Lichtbandes auftauchte, mußte der Schmelzprozeß unterbrochen werden, denn dann stellte sich der »Stich ins Grüne« ein. Das Verpassen von nur einer Zehntelsekunde genügte, um alles zu verderben.
Mit fieberhafter Ungeduld harrte also jetzt Wassilowitsch vor dem Spektroskop, den Moment zu erhaschen, wo die Linie C 34 im Spektrum erschien. Diesmal wollte er besonders scharf den wichtigen Augenblick erfassen und ausnützen, um ein nach Theorie und Praxis tadelloses Resultat zu erzielen. Nur die allergrößte Peinlichkeit und Genauigkeit konnte ihm Aufschluß darüber geben, ob er das große Problem restlos gelöst hatte oder nicht.
Stunde um Stunde nach der Erscheinung jenes Stiches ins Grüne verrann, und endlich nahte der Augenblick, wo die eigens für die gründliche Prüfung hergestellten amorphen Goldmengen die neue Stichprobe in der Vakuumwage zu bestehen hatten. Dieser letzten Etappe ging eine gründliche Untersuchung auf die Lösbarkeit des Kunstgoldes voraus, die ergab, daß das gewonnene Produkt nur von den Substanzen angegriffen wurde, die allein auch das echte Naturgold lösten, also Königswasser, Chlor, Brom und Cyankalium.
Die Vakuumwage trat nunmehr in Aktion.
Zehn Minuten später jubelte Wassilowitsch auf. Die kleine Gestalt des Buckligen reckte sich stolz empor, und zwei leuchtende Augen, vereint mit einer glückseligen Miene, verrieten, daß das uralte Problem restlos gelöst war. Das Atomgewicht des Kunstproduktes betrug haarscharf 197,2, genau entsprechend dem Gewicht des echten Naturgoldes.
Die Probe auf das Exempel war gemacht und geglückt!
Von diesem Moment an fühlte sich der überglückliche Erfinder als das gottbegnadete Wesen, das unter Millionen und Abermillionen Menschen die Siegesfahne in der Ergründung eines der größten Naturgeheimnisse davontrug.
D +ie heilige Grotte in Lourdes konnte nicht ehrfurchtsvoller von der pilgernden Menschheit betrachtet werden, als das unscheinbare Häuschen in der einsamen Gasse, welches Wassilowitsch nun schon seit geraumer Zeit bewohnte. Nicht bloß waren es die guten Bürger von Treviso, welche das »russische Nest«, Wassilowitschs Einsiedlerklause, mit andächtigen Augen anstarrten, sondern auch zahllose Fremde, die herbeiströmten, um den modernen Adepten zu Gesicht zu bekommen.
Je mehr Menschen sich von Tag zu Tag in der Gasse einstellten, desto sorgfältiger verschloß der Bucklige seine Fensterladen und Türen, und destoweniger ließ er sich auch blicken.
So zeitigte denn, in Anbetracht des immer festeren Fuß fassenden Glaubens an die ungeheuere Entdeckung des Russen, diese bereits allerlei Angenehmes und Unangenehmes. Für Wassilowitsch vorläufig nur Unangenehmes. Er fühlte sich wie ein Verbrecher, dem man fortgesetzt scharf auf die Finger sieht, und an dessen Fersen sich Tag und Nacht Spione heften.
Da seit einigen Tagen der Zuspruch von Leuten, die als Vertreter von Behörden in dem »russischen Nest« Einlaß begehrten, immer größer geworden war, so hatte sich Wassilowitsch schließlich genötigt gefühlt, jemand für sein Hauswesen zu engagieren. Er hatte es nur ungern getan, denn es war ihm nicht gleichgültig, sich von fremden Augen in die Karten gucken zu lassen. Weiber sind schwatzhaft, trotzdem aber war seine Wahl auf eine Frau gefallen.
Signora Tittoni hieß die Haushälterin, die fürderhin im »russischen Nest« die Einlaßbegehrenden zu empfangen hatte.
Alle die aufdringlichen Menschen, welche den buckligen Russen überliefen, waren zumeist Ungläubige oder doch starke Zweifler in bezug auf den wahren Wert der epochalen Erfindung; jeder nur von dem Drange beseelt, einmal seine Nase in die geheimnisvolle Sache zu stecken.
Die Völkerwanderung durch die sonst so einsame Gasse nahm natürlich täglich zu, bis sich schließlich auch Vertreter höchster Behörden aus der Residenz einstellten. Es waren Abgesandte der Regierung des Landes. Ein Kommissar, ein Gelehrter und ein Polizeidirektor, die eigens von Rom herübergekommen waren.
Wassilowitsch war auf den Besuch so halb und halb vorbereitet. Er hatte bereits ein längeres, durch einen Kurier überbrachtes, vielfach versiegeltes Schreiben aus dem Geheimen Königlichen Kabinett erhalten, welchem ein amtliches Telegramm voraufgegangen war.
Der Russe empfing die drei Abgesandten der Regierung mit sehr geteilten Empfindungen. Er hatte absolut keine Lust, sich von den hohen Herren in die Karten sehen zu lassen. Es hatte Wassilowitsch überhaupt gewaltig geärgert, daß von seinem Geheimnis schon so viel an die Öffentlichkeit gedrungen war.
Beim Eintreffen der erwähnten Regierungskommission war Wassilowitsch gerade in seinem Laboratorium und eben dabei, neue Goldproben, die er am Tage zuvor durch seine chemischphysikalische Methode gewonnen hatte, einer wiederholten Analyse zu unterziehen.
Die Haushälterin, Signora Tittoni, meldete die in der zehnten Morgenstunde eingetroffenen Herren an.
Wassilowitsch, obwohl hierauf vorbereitet, war ärgerlich, mitten in seiner Arbeit gestört zu werden. Er erhob sich und bescheidete die Signora dahin, daß sie die Ankömmlinge in das Nebengemach führen solle.
Mit sich selbst im unklaren, wie er seinen Besuch empfangen solle, ob es geraten sei, nachdem sein Geheimnis schon halb in der Welt bekannt war, noch weitere Details preiszugeben, betrat Wassilowitsch das Gemach, in welchem die drei Männer mit ungeheuerer Spannung seiner warteten.
Als die Türangeln knarrten und die Gestalt des Adepten auf der Schwelle des Gemaches sichtbar wurde, sprangen die Besucher von ihren Sitzen auf. Sie schienen drei echte Gläubige zu sein, die keinen Augenblick an der Entdeckung, welche Wassilowitsch gemacht hatte, zweifeln mochten, und aus diesem Grunde in dem Manne, der jetzt vor ihnen stand, den leibhaftigen Gott Mammon zu sehen wähnten.
»Signor Wassilowitsch ...,« begann der Regierungskommissar mit einer tiefen Verbeugung, wobei er mit seiner Nase fast an die Ecke der nächsten Stuhllehne gestoßen hätte.
Die Bücklinge der beiden anderen gaben an Ähnlichkeit dem des Sprechers nicht um ein Haar breit nach. Zwar hatte der Gelehrte, den die Regierung mitgesandt und der eine Kapazität auf dem Gebiete der Chemie war, bisher keine Gelegenheit gehabt, die Entdeckung seines vor ihm stehenden Kollegen ihrem Werte nach zu prüfen, trotzdem aber hielt auch er es für angebracht, in so respektvoller Weise als möglich zu dienern.
»Ich heiße die Herren willkommen. Nehmen Sie bitte Platz!« Mit diesen Worten ließ sich auch Wassilowitsch auf einen Stuhl nieder. »Ich weiß, was mir die Ehre des Besuches verschafft. Die Herren sind mit einer wichtigen Mission betraut. — Glauben Sie wirklich, daß ich das große Problem, Gold künstlich herzustellen, gelöst habe?« Wassilowitsch sah die Kommission mit forschendem Blick an. Sein Auge hatte dabei etwas von dem undefinierbaren mystischen Ausdruck, wie er Leuten eigen ist, die sich mit Geheimnistuerei umspinnen. Die Mitglieder der Kommission sahen sich bei dieser Anrede einander fragend an. Sollte die ausposaunte Entdeckung doch eine Mystifikation sein? — —
»Schenken Sie, meine Herren, den Nachrichten, welche jetzt die Zeitungen der Welt durchflattern, rückhaltlos Glauben? Sind die sensationellen Berichte der Reporter Evangelium für Sie?«
Abermals ein verdutztes Sichanschauen der drei Besucher.
»Ich sehe, Sie stecken nach meinen jetzigen Äußerungen bis über die Ohren im Zweifel,« fuhr Wassilowitsch fort und keine Miene in seinem Gesicht verriet, daß er innerlich froh war, in der Kommission berechtigte Zweifel erweckt zu haben. Es lag durchaus nicht in seiner Absicht, die Leute hier, überhaupt die ganze Menschheit jetzt schon mit der von ihm tatsächlich gemachten Entdeckung bekannt, geschweige denn gar mit den Einzelheiten derselben vertraut zu machen. Deshalb war es sein Bestreben, die Sache als eine Mystifikation darzustellen, welche sich ein Spaßvogel zu erlauben gewagt hatte.
Eine Staatsregierung zu düpieren, das war doch ein starkes Stück. — So mochten wohl in diesem Augenblicke die entsandten Kommissare denken und fühlten sich schon halb und halb in ihrer Würde als Vertreter der Regierung gekränkt, als Wassilowitsch durch eine unvorsichtige Äußerung den Glauben der drei an die Wahrheit der Sache schnell wieder aufrichtete.
»Wenn ich nun der Lösung des Problems, wie Sie annehmen, doch auf die Spur gekommen sein sollte, was hätten Sie mir da in bezug auf Ihre Mission mitzuteilen? — — — Entschuldigen Sie, daß ich so neugierig bin.«
»Signor Wassilowitsch,« begann der Kommissar. »Wir sind im Auftrage der italienischen Regierung gekommen, nicht sowohl um die Lösung des Problems zu prüfen, als auch Ihnen Angebote betreffs des Ankaufs der Entdeckung unter Verpflichtung des Verschweigens gegen andere an Sie herantretende Staaten zu machen.«
»Was Sie mir da sagen, das hat einen lieblichen Klang, und ich wünschte, ich wäre in der Lage, mit Ihnen in Verhandlung treten zu können,« erwiderte der Russe.
»Wie hoch bewerten Sie Ihre Erfindung?« frug der Kommissar unvermittelt weiter und sein Auge heftete sich an die Lippen des Gefragten.
Als Wassilowitsch jetzt drei Paar ungeheuer neugierig blickende Augen auf sich gerichtet sah, beschloß er, auf die Sache scherzeshalber einzugehen.
»Hm — —« kam es von seinen Lippen und ein verdächtiges Blinzeln seiner Augen wurde bemerkbar. Es zu deuten war unmöglich. »Signor Oriola, Sie treten mit dem Kaufpreis an mich heran, gerade so, als wenn es sich um die Bewertung irgend eines beliebigen Dinges handelte.«
»Es ist die Frage der Regierung, welche ich, wie es mir die Mission auferlegt, als erste anschneide. Ich bitte Sie nochmals, mir die Pauschalsumme zu nennen, welche Sie von der Regierung fordern, wenn Sie Ihre Entdeckung mit allen Rechten an uns abtreten?« versetzte der Kommissar.
Wassilowitsch versank einen Augenblick in Nachdenken.
»Hundert Millionen Lire,« sagte er dann mit Nachdruck und schien schon im voraus zu wissen, welche Wirkung die Nennung einer solchen fabelhaften Summe auf die Kommission ausüben werde.
Wie drei abgeschossene Pfeile schnellten die würdigen Besucher von ihren Sitzen auf und starrten ihr kalt lächelndes Visavis an. Das Entsetzen über die geforderte Summe war anfänglich größer als die sich unmittelbar darauf Platz machende Bewunderung über den Mann, der eine solche im Bereiche des Fabelhaften liegende Summe so gelassen aussprach, als wenn es sich um einen Bagatellbetrag handele.
»Hundert Millionen Lire — — —« klang es aus dem Munde der wie Salzsäulen dastehenden Männer.
»Hundert Millionen Lire und keinen Centesime weniger,« wiederholte Wassilowitsch.
Als sich die Verblüfftheit der Antragsteller etwas gelegt hatte, notierte sich Signor Oriola, der Kommissar, die Summe.
»Die zweite Frage erlaube ich mir nun zu stellen,« begann jetzt der Gelehrte, welcher als Vertreter der Wissenschaft der Kommission beigeordnet war.
»Lassen Sie hören,« erwiderte Wassilowitsch gelassen.
»Auf welcher Methode fußt die Lösung des Problems?«
»Ich könnte es meinem Gewissen gegenüber nicht verantworten, wenn ich selbst gegen mich indiskret wäre,« gab der Russe zur Antwort.
»Vor Ankauf der Erfindung müßte doch natürlich die Methode, nach welcher Sie arbeiten, der Regierung bekanntgegeben werden, damit wir dieselbe auf ihre Richtigkeit hin wissenschaftlich zu prüfen vermögen. Signor Wassilowitsch, geben Sie uns wenigstens einige Andeutungen, in welchen Geleisen sich Ihre Methode bewegt.«
»Bedaure, auch damit nicht dienen zu können,« lautete die Antwort.
»Ja, aber ...«
»Sie verhandeln hier in dem Glauben, daß die Lösung des Problems mir gelungen sei. Verzeihen Sie, aber ich habe weder bestätigt, daß die Entdeckung meinerseits erfolgt ist, noch daß ich gewillt bin, überhaupt einen Handel diesbezüglich abzuschließen.«
»Sie sind Russe, Signor Wassilowitsch?« nahm jetzt der Polizeidirektor als Dritter das Wort.
Der Gefragte bestätigte dies.
»Würden Sie anstehen, der russischen Regierung Ihre Methode zu verkaufen, falls Sie von dieser Seite angegangen werden?«
»Aber, ich bemerkte doch schon einmal, daß von einem Handel bezüglich einer Entdeckung, die mir zugeschrieben wird, vorläufig nicht eher die Rede sein kann, als bis ich die Erfindung tatsächlich gemacht habe,« erwiderte Wassilowitsch trockenen Tones.
»Dann wäre unsere Mission zunächst natürlich beendet. — — Gestatten Sie, daß wir uns empfehlen?« Mit diesen Worten machte der Kommissar vor dem Russen eine Verbeugung und wandte sich dann zum Gehen.
Seine beiden Begleiter taten dasselbe.
In der Tür blieb Signor Oriola noch einmal stehen und sagte: »Also hundert Millionen Lire ...«
»Hundert Millionen Lire,« replizierte Wassilowitsch und quittierte die letzte Äußerung des Kommissars mit einem verbindlichen Lächeln.
Dann verließ der respektable Besuch das Gemach, und die Signora des Hauses geleitete die Herren auf die Straße. Auf die Frage des Polizeidirektors an die Hausgenossin Wassilowitschs, ob sie schon künstliches Gold zu Gesicht bekommen hätte, erwiderte die Gefragte, daß die roten Metallstücke im Laboratorium ein täuschend ähnliches Goldaussehen hätten. Über weitere Fragen vermochte sie keinerlei Auskunft zu geben.
So zog denn die Kommission unverrichteter Dinge von dannen.
Kaum hatte sich Wassilowitsch wieder in sein Laboratorium begeben, als von verschiedenen Seiten Depeschen eintrafen.
Staatsregierungen, amerikanische Krösusse und noch andere hochgestellte Leute, welche alle die Adresse des Erfinders herausbekommen hatten, buhlten in ihren Telegrammen um die Gunst Wassilowitschs.
Jetzt kam es dem genialen Manne wieder so recht zum Bewußtsein, welchen unermeßlichen Wert seine Entdeckung repräsentierte. Hatte er sie noch vor wenigen Minuten mit 100 Millionen Lire scherzeshalber bewertet, so griff nunmehr die volle Überzeugung bei ihm Platz, daß die Höhe dieser Summe eigentlich gar nicht so fabelhaft war, in Erwägung dessen, daß er als Ergründer des großen Geheimnisses jetzt die Geschicke aller Staaten und Völker in den Händen hatte.
Dieser Gedanke, der ihm bislang gar nicht zum Bewußtsein gekommen war, berauschte ihn fast. Hatte er sich nicht auf einmal zum Herrn der ganzen Welt aufgeschwungen?
Wie ein Fieber überkam es Wassilowitsch. Ein geistiger Taumel ergriff ihn. Er, den die Menschen bisher immer so über die Achsel angesehen hatten, der sich jahrelang abgequält, sein bescheidenes Dasein zu fristen und so viele Unbill über sich ergehen lassen mußte, nun urplötzlich mächtiger als alle Kaiser und Könige der Welt. — Der Gedanke war in seinem vollen Umfange gar nicht auszudenken, er sprengte ihm fast das Hirn.
Der Tag schien gekommen, wo er Rache nehmen konnte an denen, die sein Leben bisher so sehr verbittert hatten. Die Hiebe der russischen Knute, welche unverwischbare Spuren auf seinem Rücken zurückgelassen hatten, vermochte er nun mit Zinseszinsen heimzuzahlen.
Wassilowitsch ging wie ein von Haschisch Berauschter ins Laboratorium, um seine Arbeit, in der er durch das Erscheinen der Kommission gestört worden war, wieder aufzunehmen. Die Analysen, welche ihn jetzt beschäftigten, sollten ihn überzeugen, daß er tatsächlich am Ziele seiner alchemistischen Experimente war, daß das auf chemischphysikalischem Wege von ihm künstlich hergestellte goldfarbige Metallpulver, welches in einer Anzahl Häufchen auf dem Tische lag, echtes, pures Gold war.
Obgleich Wassilowitsch auf Grund der Analysen, die er als eine Probe aufs Exempel gemacht harte, nicht mehr daran zu zweifeln brauchte, daß das große Problem von ihm gelöst war, konnte er sich doch nicht des ihn immer wieder peinigenden Gedankens erwehren, daß das Produkt seiner Arbeit möglicherweise nicht in aller und jeder Beziehung der Natur des echten Goldes entsprach. Dieser fortwährende Zweifel und andrerseits der berauschende Gedanke, daß ihm nun die Welt gehören sollte, durchtobten und erschlafften den Mann in einer Weise, daß er, als der Abend herannahte, schon frühzeitig sein Lager aufsuchen mußte.
In einem Halbschlafe verbrachte Wassilowitsch die nächste Nacht. Allerlei wahnwitzige Bilder umgaukelten seine erregten Sinne. Er warf smaragdbesetzte Königskronen achtlos von sich, wie jemand Kieselsteine beiseite wirft. Er setzte den Fuß auf den Nacken von Fürsten, die es nicht verschmähten, vor ihm, um seine Gunst bittend, im Staube zu knien. Er sah die ganze Menschheit sich um ihn scharen. Auf sein Geheiß schöpften Legionen Menschen ganze Meere aus. Und noch viele solcher phantasiestrotzender Bilder zogen kaleidoskopartig vor seinem traumbefangenen Geiste vorbei.
Erschöpfter als am Abend wachte Wassilowitsch am folgenden Morgen in Schweiß gebadet auf.
Schon harrten seiner in aller Herrgottsfrühe wieder eine Anzahl Briefe, Depeschen und Besucher.
Letztere hatten sich vor dem Hause postiert und warteten bereits seit dem ersten Morgengrauen, einige sogar schon seit Mitternacht, des Augenblicks, wo sich die Türe des Hauses öffnen würde.
Es war unglaublich, wer im Laufe des Tages alles um eine Audienz bat. Zumeist waren es die Besitzer großer Kapitalien, Vertreter von bedeutenden Banken, überhaupt Menschen, welche durch die ungeheuerliche Entdeckung berechtigten Grund hatten, sich vor dieser zu fürchten. Alle diese Leute erschraken wohl vor dem Gedanken, daß nun sicherer Voraussicht nach eine völlige Entwertung des Goldes eintreten werde, wodurch sie sich dann durch nichts von den Ärmsten unterscheiden würden.
Wassilowitsch fertigte diese Leute mehr oder weniger kurzerhand ab, indem er ihnen bedeutete, daß er keine Zeit habe, Besucher zu empfangen, die in dem Glauben seien, daß er den Stein der Weisen gefunden.
Nachdem sich Wassilowitsch die Leute vom Halse geschüttelt hatte, unternahm er einen Spaziergang ins Freie, um die kühle Morgenluft auf sein brennendes Hirn einwirken zu lassen.
Soweit er sich auch von seinem Wohnorte entfernte und durch die umliegenden Wiesen und Felder streifte, bemerkte er doch immer, was sonst nie der Fall gewesen war, daß seinen Spuren unausgesetzt Männer folgten. Bald tauchte hier, bald dort einer vor oder hinter ihm auf, die sich anscheinend nicht um ihn bekümmerten, trotzdem aber Wassilowitsch immer im Auge behielten.
Es war nicht zu verkennen, der Chemiker fühlte sich beobachtet. Das verleidete ihm den Spaziergang, weshalb er wieder seine Schritte heimwärts lenkte. Für ihn unterlag es bereits keinem Zweifel mehr, daß die ihn verfolgenden Gestalten Geheimpolizisten und Detektive waren. Wahrscheinlich von der italienischen Regierung beauftragt, auf ihn, den Goldvogel, Obacht zu haben, damit er nicht aus dem Lande flöge und der Beglücker einer andern Nation würde.
Mehr und mehr empfand er jetzt die Schattenseiten, welche seine geniale Entdeckung nach sich zog.
Daheim angekommen, harrte seiner wieder die Kommission, welche er am Tage zuvor schon einmal empfangen hatte. Ehe Wassilowitsch sich in das Gemach begab, wo die Abgesandten der Regierung, die wahrscheinlich neue Order von Rom erhalten hatten, auf sein Erscheinen warteten, durchflog er die Briefe und Telegramme, welche zu Dutzenden im Verlaufe der letzten Stunde eingetroffen waren.
Unter den Schriftstücken befanden sich als wichtigste für ihn Angebote der russischen und englischen Regierung, welche beide von einem Handschreiben ihrer Monarchen begleitet waren. Nachdem der Chemiker sie gelesen hatte, empfing er die Kommission.
Wieder trug die Begrüßung seitens der Besucher den Stempel tiefster Ergebenheit. Trotzdem Wassilowitsch am vergangenen Tage den Mitgliedern der Kommission durch seine Äußerungen Zweifel betreffs der ihm zugeschriebenen Entdeckung eingeimpft hatte, schien sich der Glaube zur Sache wieder gestärkt zu haben.
»Habe ich wieder die Ehre und das Vergnügen, die Herren vor mir zu sehen?« frug Wassilowitsch.
Die drei Besucher wiederholten ihre devote Verbeugung, nur daß sie noch um einige Zoll tiefer als zuvor war.
Dann begann der Sprecher der Kommission: »Signor Wassilowitsch, die Regierung unseres Landes ist bereit, sofern Sie uns überzeugen, daß Sie imstande sind, Gold künstlich so herzustellen, daß es chemisch wie physikalisch die Eigenschaften aufweist, welche dem Naturgolde eigen sind, die von Ihnen geforderte Summe zu zahlen.«
Nach den Worten des Kommissars sah Wassilowitsch wieder drei paar Augen lauernd auf sich gerichtet.
Nachdem nun einmal alles soweit gediehen war, daß die Menschen sich von dem Glauben an seine Entdeckung nicht abbringen ließen, und daß die Landesregierung ihn so eifersüchtig durch Kriminalbeamte bewachen ließ, da faßte er den schnellen Entschluß, jetzt Farbe zu bekennen, nur um vor den ihn umflatternden Vampyren Ruhe zu bekommen.
»Forderte ich gestern hundert Millionen Lire?« frug Wassilowitsch.
»Sehr wohl,« antwortete der Kommissar. »Freilich haben wir soviel gemünztes Gold nicht im Lande; wir werden den Betrag in Raten innerhalb von fünf Jahren an Sie auszahlen.«
»Wie nun, wenn mir von anderer Seite viel größere Versprechungen gemacht worden sind?« frug Wasstilowitsch.
»Wir wissen, daß Ihnen seitens der englischen und russischen Regierung hohe Anerbieten vorliegen,« versetzte der Sprecher der Kommission.
»Wie — wer hat Sie darüber unterrichtet?«
»Unsere Regierung hat sich in Anbetracht der ungeheuren Wichtigkeit der Sache genötigt gesehen, alle die für Sie eingehenden Postsendungen und Depeschen aus dem Ausland einer behördlichen Zensur zu unterwerfen.«
»Ah ...« entrang es sich den Lippen des Russen.
»Sie werden mit der festgesetzten Kaufsumme zufrieden sein?« ließ sich der Kommissar weiter vernehmen.
Wassilowitsch überlegte einen Augenblick.
»Wenn ich es nun nicht bin?«
»Sie werden es sein müssen.«
»Wer könnte mich dazu zwingen?«
»Der Staat, in dem Sie leben.«
»Ein Staat, dessen Untertan ich gar nicht bin?«
»Danach wird man in diesem Falle höheren Ortes nicht fragen,« lautete die Antwort.
Die entsandte Kommission schien von Rom aus energische Order erhalten zu haben, den Vogel keinesfalls entschlüpfen zu lassen.
»Man will mich also zwingen ...« versetzte Wassilowitsch und trat einen Schritt zurück. »Ich bin Russe ...«
»Ich dächte, Signor Wassilowitsch,« fiel der Kommissar dem Chemiker in die Rede, »daß Sie keinen allzugroßen Wert auf ihre Nationalität zu legen brauchen.«
»Warum?« frug jener zurück.
»Nun, die Erinnerung an die Heimat dürfte, soweit wir etwas über Ihr Vorleben in Erfahrung gebracht haben, in Ihnen nicht gerade die angenehmsten Gefühle wachrufen. Sie haben doch allen Grund, der russischen Regierung zu grollen.«
»Das habe ich,« erwiderte Wassilowitsch. »Trotzdem aber verleugne ich meine Heimat durchaus nicht und trage mich mit der Absicht, meine Entdeckung Rußland zugute kommen zu lassen.«
»Das ist ausgeschlossen. Solange Sie sich in den Grenzen unseres Landes befinden, werden Sie sich dem Willen der italienischen Regierung in allen Punkten fügen müssen, ob Sie wollen oder nicht.«
»Das wird sich finden, mein Herr. Sie können mich nicht dazu zwingen, daß ich Sie mit den Einzelheiten meiner Entdeckung bekannt mache,« meinte Wassilowitsch.
»Sie weigern sich also, auf den Vorschlag der Regierung einzugehen und im Anschluß daran der wissenschaftlichen Kommission Ihre Methode bekanntzugeben?«
»Ja!« lautete die bestimmte Antwort des Russen, der nicht geneigt war, sich irgend einem Zwang zu unterwerfen.
»Ist das Ihr letztes Wort?«
»Mein letztes Wort.«
»So werden Sie die Folgen zu tragen haben. — Signor Wassilowitsch, wir empfehlen uns.«
Die Kommission verließ darauf das Zimmer, und Wassilowitsch schaute ihr mit sehr geteilten Gefühlen nach. Schon bereute er und wollte die Herren zurückrufen, da bäumte sich aber sein Stolz in ihm auf; nein, er wollte sich nicht zwingen lassen.
Daß er unklug gehandelt hatte, zeigten schon die nächsten Stunden. Im Verlaufe derselben erschienen in Begleitung von zehn Polizeibeamten der Bürgermeister des Ortes, sowie eine Abordnung der Gerichtsbehörde. Wassilowitsch wurde veranlaßt, den erschienenen Beamten die Räumlichkeiten seines Hauses, vor allem aber sein Laboratorium zu zeigen. Sogar eine Durchsuchung seiner Sachen und Papiere mußte er dulden. Ja, man ging noch weiter, indem man ihm erklärte, daß er solange mit Hausarrest belegt würde, bis er sich den Wünschen der Staatsregierung und des Königs fügen würde.
So empört Wassilowitsch über das Vorgehen gegen seine Person war, so konnte er doch nichts dagegen tun und war gezwungen, die Beamten selbst in sein Allerheiligstes zu führen.
Hier, im Laboratorium, kamen so mancherlei Dinge zum Vorschein, welche das höchste Interesse der durchsuchenden Beamten erweckten. Vor allem waren es die Goldpulverhäufchen, von denen Proben entnommen wurden.
In der Werkstätte eines großen Falschmünzers hätte keine genauere Durchsuchung und keine schärfere Kontrollaufnahme stattfinden können, als in dem Laboratorium des genialen Adepten.
Auf eine Frage der die Haussuchung leitenden Gerichtsperson, nach welchem Verfahren Wassilowitsch Gold künstlich herzustellen imstande sei, erklärte der Gefragte, daß er nicht die geringste Neigung verspüre, dies jemandem auseinanderzusetzen.
Die Hartnäckigkeit des Russen war nicht zu besiegen, wenngleich ihm auch angedeutet wurde, daß er nun gewärtig sein müsse, daß ihm der Prozeß als Falschmünzer gemacht werde.
Nachdem die Beamten sich unter Versiegelung vieler Gegenstände, welche sich im Laboratorium befanden, entfernt hatten, hing Wassilowitsch seinen Gedanken nach.
Vor der Pforte des Quirinals, dem römischen Königspalast, stand wie ein Schemen die Schicksalsgöttin der Menschheit und begehrte Einlaß. Der Herrscher des Römerlandes, Viktor Emanuel VII . sah mit wechselnden Gefühlen dem Augenblick entgegen, wo er einem simplen Menschlein eine Weltmacht aus den Händen reißen sollte.
Minister hatten befohlen, und Schergen gehorcht. Ein Mann war in ihrer Gewalt, dem es gelungen war, den Schleier von einem der größten Naturgeheimnisse zu lüften, der Mann, in dessen Hände mit einem Schlage die Macht über das Wohl und Wehe aller Völker des Erdballes gelangt war. Rücksichtslos hatten die Stützen des italienischen Thrones diesen Gewaltstreich geplant, um ihren Souverän zum Leiter des Menschengeschickes auf diesem Planeten zu machen. Und sie hatten es wahrhaft gut eingefädelt. Sie zwangen die Schicksalsgöttin, die sich in den Dienst jenes simplen Menschleins stellen wollte, ihre Schritte zu dem Palaste des Potentaten zu lenken.
Wassilowitsch war zum König von Italien befohlen worden und harrte nun, von den Adleraugen der ihn begleitenden Schergen bewacht, der Audienz.
Drinnen in einem Empfangssaale des Quirinals saß die Majestät und konferierte mit dem Ministerrat. Draußen im Vorzimmer hockte das Schicksal der Menschheit und fühlte sich trotz seiner Größe so unendlich klein und nichtig.
Viktor Emanuel und seine Minister zerbrachen sich inzwischen die Köpfe, in welcher Form man dem gefährlichen Mann im Vorzimmer seine Macht entreißen und ihn selbst dauernd unschädlich machen konnte.
Schlug Bofferio, der Minister des Äußeren vor, man solle Wassilowitsch im Interesse der gesamten italienischen Nation und des Königshauses, nach Entlockung seines Geheimnisses in eine Irrenanstalt internieren, so rückte der Kriegsminister Farini mit dem Plane heraus, den gefährlichen Mann zwecks Deportation auf einer der Ligurischen Inseln unterzubringen. Der Minister der heiligen Justitia seinerseits hielt es für das geratenste, Wassilowitsch den Prozeß wegen Falschmünzerei zu machen und ihn dauernd in das Gefängnis zu schicken. Der Handelsminister Settembrini war dagegen menschlicher gestimmt. In seiner humanen Denkweise riet er der Majestät, den Mann, über dessen Schicksal soeben gehadert wurde, mit den höchsten Ehren, die eine Nation und ein König zu vergeben habe, zu bedenken, und ihm, seinem Verdienste gebührend, die leitende Stelle in der italienischen Finanzwaltung zu übertragen.
Hei! wie da der Finanzminister von seinem Sitze emporschoß und fast alle Etiquette und Ehrerbietung vor der Majestät vergaß. Von einem solchen simplen Menschen, wie Wassilowitsch es war, hatte er keine Lust, sich das Heft aus der Hand nehmen zu lassen.
So machte denn nun jeder der hohen Würdenträger einen anderen Vorschlag, Viktor Emanuel wußte in diesem Wirrwarr weder aus noch ein.
»Ew. Majestät wollen in Betracht ziehen,« sagte der Ministerpräsident, »daß es noch nie im Menschenleben, seit Urbeginn an, so wichtige Augenblicke gegeben hat, als die sind, die wir jetzt durchleben. Alle Geschicke der Völker stehen auf dem Spiel. Es liegt in unserer Macht, die Oberherrschaft auf Erden zu erringen. Italien wird dann für alle Zeit die Politik machen, den Nationen die Wege vorschreiben, die sie nach unserem Willen zu wandeln haben. Der gesamte Handel und die Industrie empfangen künftighin ihre Initiative von Rom aus.«
»Ew. Majestät werden als König aller Könige herrschen,« hörte man sodann Bofferio sprechen.
»Ew. Majestät bedürfen keiner Quadrupelallianz mehr,« ließ sich Settembrini vernehmen.
»Unsere Weltherrschaft würde die Großmächte der Jetztzeit auf das Sterbebett werfen,« meinte der sich mit Vorliebe in poetischen Schnörkelwörtern und geistreich klingenden Phrasen gefallende Kultusminister Pascarella.
Der Majestät schwindelte vor den Augen. Nein, auch nicht in seinen kühnsten Träumen hätte er geglaubt, einmal zur höchsten Machtentfaltung auf Erden zu gelangen.
»Meine Herren — —« begann Viktor Emanuel VII., dessen Blicke und Mienenspiel die hohe seelische Erregung in seinem Inneren verrieten, »machen Sie die Rechnung nicht ohne den Wirt. Denken Sie an Rußland. Jener Wassilowitsch ist ein Untertan des Zaren, und es könnte passieren, daß die russische Regierung diesen Mann für sich in Anspruch nimmt. Es ist anzunehmen, daß er einem ehrenvollen Rufe in seine Heimat Folge leisten wird. Wir würden das Völkerrecht schmählich verletzen, wenn wir einer diesbezüglichen Aufforderung Sr. Majestät des Zaren nicht nachkämen.«
Man konnte jetzt über die Gesichter einzelner der Würdenträger ein feines, kaum merkbares Lächeln huschen sehen. Die im Dienste grau gewordenen Männer der hohen Diplomatie fanden die ängstliche Ansicht des jungen Herrschers betreffs der Verletzung des Völkerrechtes in Anbetracht dessen, daß Italien die tonangebende Macht wurde, naiv.
»Gestatten mir Ew. Majestät eine Bemerkung hierzu,« sagte der Justizminister. »Der völkerrechtliche Verstoß der Verweigerung einer Auslieferung unsererseits könnte spielend umgangen werden.«
Die Majestät kannte die Schlauheit desjenigen, dem die Wahrung der Rechtspflege in seinem Lande oblag. Er lächelte.
»Ew. Majestät wollen befehlen, daß dem Wassilowitsch der Prozeß wegen Falschmünzerei gemacht werde,« fuhr mit einer leichten Verbeugung der Justizminister fort.
Viktor Emanuel richtete sich auf und sah den Sprecher etwas ungnädig an. Er schien in seinem Inneren eine moralische Anwandlung gegen den eben gemachten Vorschlag, der für ihn eine Ungerechtigkeit darstellte, zu empfinden.
»Herr Minister, etwas ehrlicher müssen wir dabei aber doch zu Werke gehen,« versetzte der König.
Der in allen Künsten der hohen Diplomatie erfahrene Staatsmann war von der versteckt gehaltenen Rüge seines jungen Herrschers nicht allzusehr verletzt. Staatsmänner wie er, die mit allen Wassern gewaschen waren, durften es in gewissen politischen Lagen mit der Moralität und gar erst mit der Sentimentalität nicht zu genau nehmen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, mit ihren Plänen zu scheitern. Einem Souverän, der sich mit den besten Absichten für sein Volk trägt, bleiben sehr oft die Schliche seiner Diplomaten und Berater unbekannt. Wer am Ruder des Staatsschiffes sitzt, muß nun einmal verstehen, auch die gefährlichsten Klippen zu umsegeln, selbst auch dann, wenn zu Mitteln gegriffen werden muß, die Ausfluß höchsten Egoismus sind, und den Nachbar auf das allerempfindlichste schädigen.
Darin war sich das Kabinett einig, daß es in der Angelegenheit Wassilowitsch weder humane Bedenken noch ein Zögern, die Situation rücksichtslos auszubeuten, geben dürfe. Für die Diplomaten war es eine ausgemachte Sache, daß eine solche ungeheuerliche Macht, wie das Goldproblem sie demjenigen in die Hände gab, der die Lösung zuwege brachte, diesem nicht so ohne weiteres belassen werden dürfe.
Das Schwanken des Monarchen mußte energisch einstimmig von seiten des Ministerrates beseitigt werden. Die Frage, was aus dem Mann »im Vorzimmer« werden sollte, ließ man vorläufig noch offen. Jedenfalls herrschte darüber die eine Ansicht, daß der Goldvogel auf keinen Fall entschlüpfen dürfe.
Viktor Emanuel hatte auf das Drängen seiner Minister den Entschluß gefaßt, vom Wege der Billigkeit und Gerechtigkeit, wenn es die Situation erforderte, abzuweichen. Der Selbsterhaltungstrieb forderte das als Agens.
»Meine Herren,« sagte der Monarch. »Haben Sie auch schon die Konsequenzen gezogen, die entstehen können, wenn Italien mit einem Male zur ersten Weltmacht emporschnellt?«
»Wenn Ew. Majestät eine Allianz sämtlicher Mächte im Auge haben, so gestatte ich mir darauf zu erwidern, daß die isolierte italienische Nation immer noch obenauf bleibt,« antwortete der Ministerpräsident.
»Einer von allen Staaten gemeinsam in Szene gesetzten Entwertung des Goldes wären wir doch wohl nicht gewachsen,« versetzte der König, dem es keineswegs an Logik mangelte und der sich von seinen Ministern nicht immer übertrumpfen ließ.
»Ew. Majestät vergessen in Betracht zu ziehen, daß der Durchführung einer Entwertung des Goldes unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen,« gab der Chef des Kabinetts zur Antwort.
»Und die wären?« frug der König. Er war neugierig zu erfahren, welche Argumente seine erste Staatsstütze ins Treffen führen würde.
»In erster Linie gibt es keinen passenden Ersatz für das Gold.«
»Platin vielleicht — —?«
»Dieses Metall kann seines seltenen Vorkommens halber für eine internationale Währung nicht in Betracht kommen.«
»Und Papiergeld?«
»Reichskassenscheine und Banknoten vermögen auf die Dauer niemals Geld und Geldeswert zu ersetzen,« antwortete jetzt der Finanzminister. »Wir müssen das Papiergeld immer als unverzinsliche Schuldscheine betrachten, für die keine Deckung vorhanden ist.«
»Ich kann mich nicht von dem Gedanken freimachen,« erwiderte der Monarch, »daß die Staaten trotzdem, wenn auch nur vorläufig, die Papiergeldwährung unter Zuhilfenahme eines Zwangskurses einführen werden. Ich unterschätze die Gefahr, welche eine Währung mit sich bringt, keineswegs, denn es hat schon mancher Staat seine bittersten Erfahrungen damit gemacht. Macauley hat einmal den Ausspruch getan: Es ist zweifelhaft, ob schlechte Könige, unfähige Minister, Parlamente und Richter in einem Vierteljahrhundert in einem Lande soviel Schaden bringen konnten, wie schlechte Kronen und Schillinge in einem einzigen Jahre.«
»Ew. Majestät Ansicht stimme ich in jeder Beziehung bei,« versetzte Se. Exzellenz, der Premierminister. »Auf alle Fälle müssen wir aber damit rechnen, daß ein einziger großer Staatenbund uns sozusagen boykottiert, der die Papiergeldwährung als Notbehelf einführt und so versuchen wird, die Macht unseres Goldes zu brechen. Dieser Zustand wird nach meinem Dafürhalten aber kein dauernder sein. Es werden bald Hadereien und Zwistigkeiten entstehen, die dazu führen, daß wir schließlich doch wieder obenauf schwimmen.«
Se. Majestät teilte so halb und halb die Meinung seines ersten Beraters, konnte aber nicht umhin, aus der, die Welt aus ihren Angeln hebenden Sache noch weitere Konsequenzen zu ziehen.
»Meine liebe Exzellenz,« redete er den Ministerpräsidenten an, »was wollen wir aber tun, wenn die Großmächte über unser armes Land herfallen? — — sie werden uns erbarmungslos zerfleischen.«
Exzellenz schien im stillen die Weitsichtigkeit seines jungen Herrschers zu bewundern, er wollte aber als alter Schlaufuchs und erfahrener Staatsmann sich nicht die Blöße geben, merken zu lassen, eine solche Wandlung der Dinge nicht in Betracht gezogen zu haben. »Ew. Majestät wollen gnädigst bedenken, daß es mit der Einigkeit der Großmächte seit jeher schlecht bestellt gewesen ist. Ich kann bestimmt behaupten, daß die eine oder die andere Großmacht es sicher für geraten hält, sich auf unsere Seite zu schlagen, selbst auf die Aussicht hin, daß sie sich uns als Vasallenstaat unterordnen muß.«
Diese Ansicht des Premiers schien unter den anderen Ministern Billigung zu finden. Die Exzellenzen gaben dies durch wiederholtes Kopfnicken unverhohlen zu verstehen.
»Hm — — Ihre Ansicht, meine liebe Exzellenz, entbehrt durchaus nicht jeder Begründung. Aber ich sehe es schon kommen, wir werden reich sein und doch arm,« meinte der König.
»So wie die Sache jetzt liegt,« warf der Kriegsminister ein, lassen sich eigentlich eine Unmenge Konsequenzen ziehen. Die in nächster Aussicht stehende und bereits schon erwähnte Folge dürfte zweifellos eine Boykottierung unseres Landes sein. Dieser müssen wir unbedingt vorbeugen.«
»Lieber Farini,« entgegnete der König, »was schlagen Sie in dieser Hinsicht vor?«
Die übrigen Minister spitzten die Ohren, sie waren neugierig zu erfahren, welche Abwehrmittel ihr Kollege für geeignet hielt.
»Ew. Majestät müssen unverzüglich, heute noch, eine Note aus dem Kabinett an die eine oder die andere Macht senden, von der wir annehmen können, daß sie sich zu uns schlagen wird. Des Inhaltes, daß wir unter Sicherung aller Vorrechte, dem betreffendem Staat ein Bündnis antragen ...«
»Sie meinen Halbpart machen?«
»Ew. Majestät — — so ungefähr denke ich. — — Ich bin überzeugt, daß, wenn wir jetzt in dieser Weise vorgehen, noch ehe der gewaltige Moment eintritt, wir einem Antistaatenbund im geeigneten Augenblicke die Stirn bieten können.«
»Und welchen Staat haben Sie im Auge — — Rußland?« frug Viktor Emanuel.
Eine abwehrende Bewegung des Ministers verriet, noch ehe er verneint hatte, daß diese Macht auf keinen Fall in Betracht kommen könne.
»Ew. Majestät wollen bedenken, daß jener Wassilowitsch ein russischer Untertan ist — —«
»Ah so!« rief der König. »Nein, nein! die Russen würden mit uns niemals Halbpart machen, das liegt auf der Hand. Sie werden kein Mittel unversucht lassen, ihren Untertan für sich zu gewinnen, um die verlorene Großmacht wieder auf die alte Höhe zu bringen. — — — Aber Frankreich, das mit uns doch schon alliiert ist, dürfte wohl in Frage kommen.«
»Die Mächte unserer Quadrupelallianz sind zu schwach,« versetzte der Ministerpräsident.
»So bleiben nur noch Deutschland, England und Amerika übrig ...«
Der Ministerpräsident nickte und sagte. »England mit seiner Selbstsuchtspolitik müssen wir ebenfalls ausschalten, und was den amerikanischen Staatenbund anbetrifft, so kann dieser für eine Allianz ebenfalls nicht in Frage kommen. Wir brauchen eine ehrlich gesinnte Weltmacht auf dem europäischen Kontinent.«
»Also Deutschland ...« warf Viktor Emanuel ein.
»Jawohl, Ew. Majestät. — — — Was dann die anderen kleineren Nationen angeht, zum Beispiel Holland mit seiner VogelStraußPolitik, so werden sich diese sicher den deutschen Verbündeten angliedern.«
»Und wie stellen sich die anderen Herren zu diesem Vorschlage?« rief der König und ließ seine Blicke im Kreise der Minister schweifen.
Die Mehrzahl der Exzellenzen war für eine Alliierung mit Deutschland; nur der Minister für Handel und der Justizminister schienen hinsichtlich einer Einlassung mit den Teutonen Bedenken zu hegen.
»Ich meinerseits,« ließ sich Viktor Emanuel vernehmen, »würde mich am liebsten mit Frankreich verbünden.«
»Am Quai d'Orsay sehen sie dies sicher gern,« meinte Bofferio. »Aber zur Konstituierung eines Zweibundes wäre es ein Nonsens, wenn man die zusammengeschrumpfte französische Macht hierbei auch nur in Vorschlag bringen würde.«
»Was hindert uns, dieser Nation mit unserem Gold das Rückgrat zu stärken,« antwortete Se. Majestät.
»Ich für meinen Teil sähe auch lieber den gallischen Hahn neben uns, als wie den teutonischen Adler, dessen Fänge sich leichthin in unser Fleisch schlagen könnten,« ließ sich Pascarella vernehmen.
»Sind schon auf die Angelegenheit bezügliche Noten von den Mächten eingelaufen?« frug Viktor Emanuel Boffrerio.
»Von Tokio und Peking ist eine Anfrage gekabelt worden,« versetzte ehrerbietig der Gefragte. »Der ganze Osten befindet sich in Spannung.«
»Ich wünsche, daß alle diesbezüglichen Anfragen dahin beantwortet werden, daß wir in eine Prüfung der Sache eingetreten seien und das Ergebnis seiner Zeit allen hiesigen Bevollmächtigten mitteilen würden,« versetzte der König.
»Sehr wohl, Ew. Majestät,« antwortete der Ministerpräsident mit einer tiefen Verbeugung.
»Meine liebe Exzellenz, nehmen Sie einmal Fühlung mit Frankreich und Deutschland, wie sich die beiden Regierungen zu einem Kompromiß verstehen. — — — Natürlich lassen Sie nur das allernotwendigste von unseren Plänen durchblicken.«
»Wenn Ew. Majestät so wie ich es für zweckmäßig erachten, daß eine persönliche Zusammenkunft Ew. Majestät mit dem Präsidenten Favre und dem deutschen Kaiser der Sache förderlich wäre, so könnte eine solche gleichzeitig mit eingeleitet werden.«
»Beileibe keine Übereilung,« erwiderte der König. »Ehe überhaupt irgend welche Schritte zur Anbahnung eines Bündnisses von uns getan werden, muß ich Wassilowitsch sprechen.« — — —
Mit diesen Worten rief er durch ein Klingelzeichen den diensttuenden Kammerherrn herein.
»Ich bitte, Signor Wassilowitsch zur Audienz vorzulassen,« befahl der König.
Wenige Augenblicke später trat das Schicksal der Völker in Menschengestalt vor den Thron des italienischen Herrschers.
Der Monarch winkte Wassilowitsch sehr gnädig zu, was dieser mit einer devoten Verbeugung erwiderte.
»Peter Wassilowitsch — — —« begann Viktor Emanuel und ließ sein Auge forschend auf dem Manne ruhen, dem eine höhere Fügung menschliche Allmacht in die Hände gelegt hatte.
Die Blicke der Minister hefteten sich ebenfalls auf die Gestalt des Russen und sie suchten ihm die Worte schon vorher aus dem Gesicht abzulesen.
»Ew. Majestät haben befohlen ...« sagte der Bucklige, dem es die Etikette auferlegt hatte, in audienzgemäßer Kleidung zu erscheinen.
»Treten Sie näher ...« unterbrach ihn Viktor Emanuel.
Wassilowitsch leistete der Aufforderung Folge.
»Der Zweck Ihrer Herbescheidung dürfte Ihnen wohl bekannt sein —« begann der König wieder.
»Meine Entdeckung — —«
»Ganz recht, Ihre Entdeckung. Da diese von einer Bedeutung ist, daß sie für mein Land und meine Dynastie unter Umständen sehr verhängnisvoll werden kann, so sehe ich mich gezwungen, hier persönlich in die besagte Angelegenheit einzugreifen ... Zuvor eins. Sie sind fest überzeugt davon, das Problem gelöst zu haben?«
»Ja, Ew. Majestät.«
»Restlos gelöst?«
»Bis auf den Stich ins Grüne.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Gestatten Ew. Majestät, daß ich darüber Aufklärung gebe,« warf die Exzellenz von der Finanz ein.
»Wenn Sie es vermögen, bitte ... ich bin neugierig,« antwortete der König.
»Der sogenannte Stich ins Grüne, welcher dem Kunstgolde anhaftet und der das einzige Unterschiedsmerkmal gegenüber dem Naturgold ist, stellt eine Farbenabweichung dar, die beobachtet werden kann, wenn man einen Goldbarren im gediegenen Zustande seitlich betrachtet. Man kann dann einen leichten grünlichen Schein im Farbenglanze des Imitationsproduktes augenfällig wahrnehmen.«
»Ja, aber — —« sagte Viktor Emanuel. »Wenn das Kunstgold nicht identisch ist mit dem echten, so kann doch auch von einer restlosen Lösung des Problems nicht gesprochen werden.«
Es hatte den Anschein, als wenn der Monarch so etwas wie eine Erleichterung empfand, daß bei der Sache etwas nicht in Ordnung war. Den Beratern der Krone war es wohl bekannt, daß ihr junger Fürst es weit lieber gesehen hätte, wenn die große Entdeckung Wassilowitschs überhaupt nicht erfolgt wäre, während sie, die eigentlich Regierenden des Landes, über die Lösung des Goldproblems baß erfreut waren.
»Nach Ansicht aller Sachverständigen, und wir haben die ersten Kapazitäten der Wissenschaft herangezogen,« erwiderte der Ministerpräsident, »ist das Kunstprodukt durchaus identisch mit dem Naturprodukt. Es sind die subtilsten Untersuchungen vorgenommen worden, und auch die Feststellung des Atomgewichtes ist erfolgt. Jeder Zweifel gilt als beseitigt.«
Nach diesen Worten des Kabinettchefs schüttelte der junge Herrscher den Kopf und sagte. »Und der Stich ins Grüne?«
»Er beruht nach Ansicht der Physiker auf einer optischen Irradiation beziehungsweise Aberration, die für die chemische Natur des Kunstgoldes gänzlich belanglos sein soll,« gab der Minister zur Antwort.
»Signor Wassilowitsch, wie stellen Sie sich zu dieser Anschauung?« frug Viktor Emanuel.
Der Gefragte, der sich entschlossen hatte nicht mehr zu leugnen, daß er das Goldproblem gelöst habe, gab in seiner Entgegnung der Ansicht Ausdruck, daß in chemischer Hinsicht die Identität festgestellt sei und es lediglich auf die stoffliche Zusammensetzung, nicht aber auf völlige Farbengleichheit ankomme Er schloß seine Ausführung dahin ab, daß er andeutete, daß er die Farbenabweichung bei einigen Goldproben weit weniger wahrgenommen habe.
»Signor Wassilowitsch, haben Sie sich schon einmal überlegt, welche Tragweite Ihre Entdeckung besitzt?« frug der König.
»Ja — — mein Gold wird einen gewaltsamen Umsturz verursachen, und die Rückwirkung auf meine Person selbst läßt sich noch nicht ausdenken ... Entweder häufe ich Reichtümer auf Reichtümer, oder ich werde ärmer sein als je zuvor. Ich habe eine dunkle Ahnung, daß die Stunde nahe ist, in der ich mein glückhaftes Experiment bis in den Orkus verdammen werde,« erwiderte der Bucklige.
»Signor, Sie würden aller dieser Sorgen ledig sein, wenn Sie meiner Regierung Ihr Rezept verkauften,« entgegnete der Monarch.
»Ew. Majestät ... ich bin russischer Untertan und fühle mich moralisch verpflichtet, meine Erfindung der heimatlichen Regierung zu überlassen.«
»Signor Wassilowitsch, ich dächte Sie hätten Ursache genug, sich Ihrem Heimatlande gegenüber moralisch gar nicht so verpflichtet zu fühlen.«
»Wie man's auffaßt, Ew. Majestät,« versetzte der Bucklige mit einem Achselzucken.
»Sie haben es jetzt in der Hand, Vergeltung für empfangene Maßregelungen zu üben, und Sie tun dies nicht ... das finde ich meiner Treu edel gehandelt — aber auch nicht klug. Die russische Regierung wird Ihnen nun erst recht den Fuß auf den Nacken setzen, sobald Sie sich innerhalb ihrer Grenzen blicken lassen ... Der Nihilist darf ihnen keinesfalls übers Haupt wachsen. — — Verstehen Sie mich?«
Der König hatte die letzten Worte mit besonderem Nachdruck gesprochen, und es schien einen Augenblick, als wenn in Wassilowitsch die Erinnerung an früher erlittene Unbill geteilte Empfindungen wachriefe. Ein Zucken seiner Gesichtszüge zeigte dies in unverkennbarer Weise.
»Signor Wassilowitsch,« fuhr der Monarch, dem das Mienenspiel des Buckligen nicht entgangen war, fort. »Ich ließ Ihnen durch meine Kommissare bereits sagen, daß meine Regierung gewillt ist, Ihnen Ihre Erfindung abzukaufen. Sie forderten hundert Millionen Lire, und wir stehen nicht an, Ihnen diese horrende Summe zu zahlen.«
»Ew. Majestät, ich bin nicht in der Lage, meine Erfindung auch nur annähernd zu bewerten.«
»Hundert Millionen stellen für einen einzelnen Manschen ein Kapital dar, das ihn an die erste Stelle der Hochfinanz einrangiert,« antwortete Viktor Emanuel.
»Mit Verlaub — — wenn ich nicht irre, besitzen gewisse Rockefeller, Goulds und Astors in den amerikanischen Staaten weit größere Kapitalien. Ich denke, daß diese Milliardäre mich dann über die Achsel ansehen werden.«
»Ich meine, daß wir ihnen beizeiten ihre Geldmacht aus den Händen reißen ... sie werden im italienischen Goldstrom rettungslos untergehen. — — Sie werden einzig als Großkapitalist dastehen.«
Wassilowitsch schien der Ideengang des jungen Monarchen nicht zu imponieren, er hatte sich den Verlauf der ganzen Sache im wesentlichen anders vorgestellt.
»Ew. Majestät wollen mir verzeihen, wenn ich hier dem Gedanken Ausdruck verleihe, daß es in meiner Absicht steht, meine Erfindung weder zu veräußern noch im Rezept zu verraten,« sagte Wassilowitsch und ließ seine Augen im Kreise der Anwesenden herumschweifen, um die Wirkung seiner Worte auf den Gesichtern der hohen Würdenträger im voraus abzulesen.
Die Minister tuschelten jetzt mit vielsagenden Mienen untereinander, und der König tauschte mit ihnen Blicke aus, in denen sich Überraschung mit Unmut paarten.
»Lieber Zanelli,« wendete sich Viktor Emanuel an seinen Kanzler. »Wie hätten wir uns in diesem Falle Signor Wassilowitsch und seiner Sache zu stellen? — Es ist doch wohl auch dieser Fall bei Erörterung der Angelegenheit in Betracht gezogen worden?«
Der oberste Berater der Krone verfärbte sich etwas. Diese Auslenkung des Russen hatte in Kabinettsberatungen nicht den unmittelbaren Gegenstand einer Erörterung gebildet. Deshalb wußte er nun nicht recht, wie er der Majestät gegenüber seine Antwort formulieren sollte, so daß sie auch Wassilowitsch hinreichend belehrte, welche Maßregelungen er solchen Falles seitens der Regierung des Landes zu erwarten habe, innerhalb dessen Grenzen er sich befand.
»Ew. Majestät wollen dann geruhen zu befehlen, daß das Ministerium nach Gutdünken Schritte tue.«
»Signor Wassilowitsch, wenn Sie auf einem Standpunkt uns gegenüber verharren sollten, der keine Einigung zwischen uns aufkommen läßt, so müßte ich die Sache zur Regelung meinem Ministerium überlassen, und es könnte dann leichthin geschehen, daß die Dinge eine für Sie unliebsame Wendung nehmen. — — Dies wollen Sie doch nicht außer acht lassen. Stoßen Sie nicht glänzende Anerbieten zurück, um sie nachher mit bitteren Folgen zu vertauschen. Wir boten Ihnen hundert Millionen Lire ... ich stehe sogar nicht an, Sie in den Grafenstand zu erheben ... ich bin sogar bereit, Ihnen den Fürstentitel zu verleihen. Überlegen Sie es sich, schlagen Sie das Anerbieten nicht aus. Es könnte Sie gewaltig reuen.«
Der König hatte sich in Eifer und Erregung hineingesprochen. Er mochte wohl allmählich eingesehen haben, daß er die Zügel straff halten müsse, wenn es nicht sein und seiner Dynastie Untergang einst werden sollte.
Wassilowitsch hatte die Rede des Monarchen ohne Wimperzucken angehört. Nur bei der in Aussicht gestellten Verleihung des Fürstentitels schien seine bisherige Gelassenheit zu schwinden. Seine tiefliegenden Augen leuchteten und über das Gesicht glitt ein Strahl hellster Freude, der fast einer Verzückung ähnelte.
»Ew. Majestät haben die große Gnade und gewähren mir eine Bedenkzeit,« sagte der Bucklige.
»Bedenkzeit ... hm ... Können wir diesem Wunsch entsprechen?« frug Viktor Emanuel seine Minister.
»Jeder Tag ist kostbar,« meinte Bofferio und zuckte mit den Achseln.
»Die Entscheidung muß diese Stunde bringen,« versetzte Farini.
»Kein Aufschub, Ew. Majestät ...« ließ sich Settembrini hören.
»Bedenkzeit! Nein ... Wer weiß, was schon die nächste Stunde uns schwarz verschleiert bringen wird,« sagte Pascarella. »In dem Heute wandelt schon das Morgen.«
»Ein Fürstentum auszuschlagen, bedarf es keiner Bedenkzeit,« begann Viktor Emanuel wieder zu Wassilowitsch gewendet. »Sagt Ihr nein, so stehe ich für nichts, was Euch passieren könnte. Sagt Ihr ja, so hat das Herzogtum Parma morgen einen neuen Landesfürsten.«
»Kann man mich zwingen, mein Geheimnis zu verraten?« frug Wassilowitsch, und in seinen Worten lag etwas wie Trotz gegen die Maßregelung, der er hier ohnmächtig gegenüberstand.
»Die Zeiten der Inquisition sind zwar vorbei,« antwortete der König, »doch weiß ich nicht, wie sich mein Volk dazu stellt, wenn ihm das wieder aus den Händen gerissen wird, was es schon für sich in Anspruch genommen hat.«
»So mögen sie alle tun, was ihnen beliebt ... Der Menschen Haß und Rache fürchte ich nicht,« versetzte der Bucklige, dessen Trotz sich jetzt unverhohlen offenbarte.
»Signor Wassilowitsch, ich warne Sie,« sagte der Monarch. »Vermessen Sie sich nicht, den Unwillen einer ganzen heißblütigen Nation herauszufordern.«
»Rußland wird mich schützen,« versetzte Wassilowitsch und hoffte mit dieser Äußerung den starren Sinn des Machthabers zu brechen.
»Italien ist groß, und der Zar weit,« spottete der König.
»Ew. Majestät wollen mir die Bedenkzeit also nicht gewähren?«
»Die Gewährung des Wunsches könnte unsere Pläne vereiteln. Sie werden begreifen, daß in so wichtiger Sache, wo das Wohl und Wehe eines ganzen Landes auf dem Spiele steht, der Herrscher Sorge tragen muß, daß keine Minute vergeudet wird, die einen Verlust bedeuten könnte.«
»Und trotzdem möchte ich von Ew. Majestät die Gnade erbitten, mir eine vierundzwanzigstündige Frist zu gewähren. Mein Wort zum Pfande, daß Italiens Interessen von mir respektiert und gewahrt werden.«
»Gut, Signor Wassilowitsch, die Frist will ich gewähren,« erwiderte Viktor Emanuel, nachdem er nochmals seine Minister interpelliert hatte.
Der Bucklige, froh, wenigstens eine kurze Bedenkzeit zugestanden erhalten zu haben, dankte durch eine devote Verbeugung.
Se. Majestät verließ hierauf mit gnädiger Handbewegung den Saal, gefolgt von den mehr oder weniger unwirsch dreinschauenden Würdenträgern, die über die Vertagung der so eminent wichtigen Angelegenheit wenig befriedigt schienen.
Der diensttuende Kammerherr erschien und geleitete den Buckligen respektvoll zum Vorzimmer.
Die bedeutungsvolle Audienz hat ihr Ende erreicht, und zweimal zwölf Stunden später sollte ihr Ergebnis bestimmend für das Geschick vieler Völker werden.
Ganz Rom war in einer beispiellosen Aufregung. Die Stadt der sieben Hügel barg seit zwei Tagen den Mann in ihren Mauern, der mächtiger war als alle Imperatoren der Welt — — mächtiger schien, mochte wohl, in Anbetracht dessen, daß er sich in der Gewalt eines Königs befand, richtiger sein.
Jedermann wußte und fühlte es, daß etwas Gewaltiges im Werke war. Schon die nächsten Stunden konnten Zustände bringen, wie sich solche nie ein Mensch hätte träumen lassen.
Die Gedanken und Ansichten der Römer schwirrten und flatterten durcheinander, daß die öffentliche Meinung schier wie ein Chaos erschien.
Da der Telegraph das ganze Land von der stattgefundenen Audienz Wassilowitschs bei dem König in Kenntnis gesetzt hatte, so herrschte nicht bloß in der »ewigen Stadt«, sondern überall innerhalb der italienischen Grenzen eine Aufregung, die Handel und Wandel auf Tage hinaus fast lahmlegte. Jedermann wollte erst das Ergebnis der ungeheuerlich klingenden Angelegenheit abwarten, ehe er ferner seiner Tätigkeit nachging — — — So hielt Dämon Gold schon jetzt die Gemüter in Schach!
Die Untertanen Viktor Emanuels VII. teilten sich schnell in zwei sich hart einander gegenüberstehende Lager. Optimisten kontra Pessimisten. Erstere hatten die Oberhand, und das Vorhandensein der letzteren Partei schien mehr dazu ausersehen zu sein, dem frenetischen Jubel der alles im rosigsten Lichte erblickenden Leute einen Dämpfer aufzusetzen.
Ins Lager der Schwarzseher mußte auch der König gerechnet werden. Gerüchte, welche in Rom kursierten, wollten wissen, daß Viktor Emanuel bangen Herzens die Anwartschaft auf die Suprematie der Welt angetreten habe. Gewöhnliche Sterbliche, denen es nie vergönnt ist, einmal einen Blick hinter die Kulissen der hohen Diplomatie zu werfen, formulieren sich ihre Ansichten und Meinungen aus bald hier, bald dort auftauchenden Pressemitteilungen, und werden solche dementiert, so ändert auch das Gros der Untertanen seinen Gedankengang über die Sache.
Das aber stand für die meisten fest, das Kunstgold würde seinen Triumphzug über den ganzen Erdball nehmen. Und da hierbei Italien den Ausgangspunkt bildete, so rechneten schon viele Leute des heiligen römischen Reiches damit, zuerst das Fett abzuschöpfen.
Noch nie seit Bestehen der Telegraphie hatte mit dem gesamten Ausland ein so reger Depeschenwechsel, wie es jetzt der Fall war, stattgefunden. Besonders waren es die Börsen aller Länder, die die Telegraphenlinien, soweit diese nicht von den ebenso interessierten Regierungen vieler Nationen mit Beschlag belegt worden waren, fortgesetzt in Anspruch nahmen. Waren doch gewaltige Kursrückgänge bereits allerorten zu verzeichnen, und der größte, den gesamten Geldmarkt wie ein Nervenschlag treffende Hauptkurssturz stand noch bevor. Wie ein Sturm war alles herangebraust, und daß es kein Sturm im Wasserglase war, das mochten wohl auch die beschränktesten Leute instinktiv ahnen.
Es herrschte also im Lande eine seltsame Stimmung, die durch die Ungewißheit in bestimmten Grenzen gehalten wurde. Während die Pessimisten sich schon halb und halb in einem Prokrustesbett liegen sahen, zog durch die Seele der optimistisch Denkenden so etwas wie ein rosiger Lichtschein — die leuchtende Morgenröte der Zukunft.
Die Tageszeitungen des Landes predigten Vorsicht und Energie. Sie legten in langen Leitartikeln dar, welche Perspektiven sich bei der geringsten Vernachlässigung oder bei laxer Behandlung der Sache entrollen würden. Auch die ausländische Presse besprach in vielspaltigen Artikeln die politischen und wirtschaftlichen Folgen, welche die Erfindung Wassilowitschs unbedingt nach sich ziehen mußte. Tonangebende Blätter, die ihre Inspirationen von »oben« bekamen, die mehr oder weniger Sprachrohre der Regierungen waren, hatten bezüglich der Abfassung ihrer Mitteilungen über die Sache einen sehr schweren Stand. Einesteils durften sie die Gefühle der Regierenden nicht verraten, andernteils durften sie aber auch nicht zurückhaltend sein.
Die Times, der Figaro, der New York Herald und die Kölnische Zeitung besprachen die Erfindung des Russen mit ihren unabsehbaren Folgen des langen und breiten und ihre Ansichten klangen nahezu in einen und denselben Akkord aus. Die drohende Gefahr der Goldentwertung mußte im Keime erstickt, zum wenigsten rechtzeitig eingedämmt werden. Das Lamento einzelner konservativer Tageszeitungen war ergötzlich. Sie prophezeiten, daß über ungezählte Tausende Elend und Armut hereinbrechen werde, alles würde untergraben und dem Handel und der Industrie vieler Länder unermeßlicher Schaden zugefügt werden, wenn das Kunstgold zum »dominateur du globe terrestre « würde. Sozialdemokratische Blätter stießen dagegen ins Hüfthorn der Freude und jubelten, daß einmal im Besitzwechsel eine Änderung eintreten sollte, wenngleich sie keinen Schimmer hatten, welchen Ausgang die bevorstehenden Umwälzungen für die arbeitenden Klassen mit sich brachten.
Preßorgane der gelben Rasse zeterten in allen Tonarten. Sie sahen nun wieder eine neue Gefahr vom Westen her nahen. Die Parlamente in Tokio und Peking ergingen sich in zahllosen Erörterungen und türmten Vorschläge und Abwehrmaßregeln aufeinander, um das Drohgespenst des fernen Westens zu erwürgen, sobald es das Terrain der Antipoden betreten würde.
Das Yankeetum schien allein der Sache mit größerer Ruhe entgegenzusehen. Die hohe Finanzwelt, die Multimillionäre, mochten wohl für ihren Teil für ihre Milliarden zittern, aber die Demokraten und sonst alles was in Handel und Industrie, in Nord und Süd der »Neuen Welt« beschäftigt war, mochten eine bevorstehende gründliche Verschiebung der Geldlage mit gar nicht so erschreckten Mienen ansehen.
Aber überm Kanal sahen die Kontinentalen die Söhne Albions in heller Verzweiflung. Die Leutchen mochten wohl ahnen, daß sie ihre dominierende Rolle auf dem politischen Welttheater bald ausgespielt haben würden. John Bull wetterte und schimpfte in allen Tonarten.
Kurz, an allen Ecken und Kanten der Welt gab es Aufregung. Dynastien sahen sich bereits abgesetzt, ihrer Macht beraubt und gewöhnlichen Sterblichen gleichgestellt. Hohe Finanziers bebten, wenn sie an die ihnen drohende Verarmung dachten. Noch aber war das Schreckgespenst nicht unmittelbar in die Erscheinung getreten, noch hofften Ungezählte, daß sich alles als ein krasser Schwindel entpuppe. Solange dies freilich nicht geschah, und die oft verzweifelt bestimmt klingenden Nachrichten der allwissenden Presse über die endgültige Lösung des Problems sich häuften, ohne auch nur einmal wieder dementiert zu werden, stand alle Welt unter dem gewaltigen Eindruck, den Wassilowitschs Entdeckung hervorgerufen hatte. Dem gesamten Handel und Wandel der Menschheit drückte die angebliche Lösung des Goldproblems seinen Stempel auf. Niemand wagte etwas zu unternehmen. Kein Herrscher, keine Regierung einen Coup auszuführen, kein Börsianer eine Geldspekulation oder ähnliches aufzunehmen. Gewitterschwangere, düstere Wolken schienen sich aufzutürmen und den Himmel der Zukunft zu verfinstern. Wie tot lag alles danieder, was bisher den Impuls für tief ins große Leben einschneidende Handlungen abgegeben hatte.
In verschwommenen Konturen, in nebelhafter Ferne tauchte wie ein wahres Drohgespenst der »Goldtrust« auf, um die Herrschaft der Welt anzutreten. Wie ein böser Dämon, ausgerüstet mit höllischen Kräften, hielt es einstweilen die Gemüter in Schach — — — — —
Die zweimal zwölfstündige Frist war verstrichen und ihr Ergebnis war, daß Wassilowitsch dem König von Italien in einem versiegelten Schreiben den Vorschlag machte, daß er gewillt sei, einem russischitalienischen Zweibund seine Erfindung zu verkaufen.
Diese nicht erwartete Entscheidung Wassilowitschs hatte wieder eine lange Ministerberatung zur Folge gehabt, deren Resultat war, daß man beschloß, unverzüglich mit der russischen Regierung in Verbindung zu treten.
Hatten sich bisher hervorragende Kapazitäten der Wissenschaft für die Echtheit des Wassilowitschschen Kunstgoldes verbürgt, so erfolgte plötzlich ein Rückschlag in Gestalt einer Behauptung seitens eines obskuren Forschers, von dem die Welt bisher noch nichts vernommen hatte.
Der Kecke, der es wagte, die Prüfungsergebnisse berühmter Gelehrten so mir nichts dir nichts über den Haufen zu stoßen, war ein simpler Studiosus der Physik, namens Vittore Sforza.
Dieser noch im halben Jünglingsalter stehende Mann scheute sich nicht, in der hervorragenden Zeitung »Tribuna« die hohen Autoritäten auf dem Gebiete der Physik und Chemie glattweg bloßzustellen und von neuem schwere Zweifel betreffs der Wassilowitschschen Entdeckung aufkommen zu lassen.
Der Artikel in der genannten italienischen Zeitung hatte im Auszug unter der Spitzmarke »Das Kunstgold, eine Düpierung der Menschheit« folgenden Wortlaut:
»Seit Menschengedenken hat noch niemals eine solche Mystifikation Platz gegriffen, wie solche durch die pompöse russische Adeptenkrämerei in Treviso in Szene gesetzt worden ist. Wenn der so schnell weltberühmt gewordene Erfinder Wassilowitsch glaubt, daß es ihm tatsächlich gelungen sei, ein der Elementengruppe angehöriges Edelmetall auf künstlichem Wege herzustellen, so gibt sich derselbe einer Selbsttäuschung hin, die ihresgleichen sucht. Noch hat es kein Sterblicher bis heute vermocht, die Stoffe, welche die Wissenschaft als Grund- und Urstoffe ansieht, der Einheitlichkeit ihrer Natur zu entkleiden. Wenn sich ein Adept unseres Jahrhunderts vermißt, auf chemischem Wege ein goldähnliches Metall zu erzeugen, so ist und bleibt dieses ein Falsifikat. das der Menschheit mehr Schaden als Nutzen zu bringen vermag. Der Nutzen der neuen Legierung — als etwas anderes darf man das Produkt des Adepten nicht betrachten — besteht nur darin, daß die Technik unserer Zeit um eine neue Metallkomposition reicher geworden ist. Der Schaden aber darin, daß jetzt und solange überhaupt das Naturgold Geldeswert besitzt, eine Imitation geschaffen worden ist, die schwerer Unterscheidbarkeit wegen für Handel und Wandel im höchsten Grade gefährlich werden kann. Meine Mitmenschen, und vor allem die Vertreter der Wissenschaft möchte ich nicht in dem Glauben lassen, daß ich mir die Anmaßung herausnehme, ihre eingehenden Prüfungsergebnisse so ohne weiteres als unrichtig hinzustellen. Errare est humanum! Meine Untersuchung, auf die hin ich es wage, öffentlich das Wort gegen die angebliche Lösung des Goldproblems zu ergreifen, basiert auf einer neuen physikalischen Methode, die klipp und klar bewiesen hat, daß das Kunstgold in physikalischer Hinsicht hervorstechende Merkmale aufweist, die beim Naturgold von mir nicht beobachtet worden sind. Meine Analyse fußt auf dem Verhalten der Wassilowitschschen Metallkomposition gegenüber der Elektrizität und dem Magnetismus und last not least auf einer optischen Aberration der Farbe. Was die Unterschiedlichkeit in dieser Hinsicht anbetrifft, so dürfte es bei chemischen Analysen sicher aufgefallen sein, daß ein Stich ins Grüne bei der Imitation vorhanden ist. Diese Farbabweichung ist zu offenkundig, alsdaß sie abgestritten werden könnte. Das Resümee meiner Untersuchung veranlaßt mich also, meine Mitwelt aufs dringlichste zu warnen und stehe ich nicht an, meine Behauptung an höchster Stelle strikte zu beweisen.
Vittore Sforza.«
Auf diese öffentliche Erklärung, welche binnen wenigen Tagen den Weg durch die ganze Welt fand, folgte ein jäher Rückschlag der Meinungen, wenngleich derjenige, der den Artikel in der »Tribuna« verfaßt hatte, völlig unbekannt war. Selbst in den Gelehrtenkreisen griffen wieder neue Zweifel Platz, da die kühne Behauptung jenes Sforza einen sehr sachlichen Charakter trug.
Schnell wurde von der italienischen Regierung eine Untersuchungskommission, welche aus den ersten Gelehrten bestand, zusammengesetzt. Vittore Sforza, der Artikelschreiber, mußte sich vor dieser rechtfertigen.
Kein Mensch ahnte nun, daß derjenige, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Wassilowitsch aus allen Himmeln zu stürzen, und wie er vorgab, diesen mit seiner ganzen Macht zu entlarven, ein von einer fremden Regierung gedungener Unterhändler war, dem man die Aufgabe gestellt hatte, ein Kuckucksei unterzuschieben.
Eine plötzliche Angst trieb gewisse Machthaber Europas dazu, hier durch eine raffinierte List das furchtbare Drohgespenst der ungeheuren italienischen Zukunftsweltmacht zu vernichten.
Vittore Sforza hatte den Anfang, sich seiner Aufgabe zu entledigen, mit außerordentlicher Geschicklichkeit inszeniert. Jetzt blieb ihm nur noch übrig, durch eine raffinierte Machination den Beweis seiner Behauptung anzutreten. Der Plan, den er sich zu diesem Zwecke ausgetüftelt hatte, gereichte seinem Scharfsinn und seiner Verschlagenheit zur Ehre. Die italienische Prüfungskommission mußte auf die geschickteste Weise getäuscht werden. Um dieses zu bewerkstelligen, mengte Sforza den zur Untersuchung vorliegenden Goldproben heimlich eine magnetablenkende, metallische Substanz bei, deren Farbe die des Kunstgoldes nicht veränderte.
Im Beisein Wassilowitschs trat nun Sforza den Beweis seiner Behauptung an. Unter Zuhilfenahme eines Galvanometers und einer Deklinations- und Inklinationsbussole, sowie verschiedener anderer elektrischer Apparate, zeigte er ad oculos, daß sich Wassilowitschs Goldprobe in physikalischer Hinsicht sehr unterschiedlich von der zur Prüfung vorliegenden echten Goldprobe verhielt.
Die der Untersuchung beiwohnenden Gelehrten konnten nun nicht mehr umhin, ihren Irrtum zu bekennen. Es hatte eben keiner bislang einmal eine Probe aufs Exempel in physikalischer Hinsicht gemacht. Daß diese so negativ ausfiel, darüber waren nun alle verwundert, gleichzeitig aber auch überzeugt, daß das Goldproblem noch keinesfalls gelöst, die Welt nur um ein Falsifikat reicher geworden sei.
Wassilowitsch war bei der Beweisführung Sforzas natürlich ganz perplex. Trotzdem gab er seine Sache aber noch nicht verloren. Nur zu leicht war es möglich, wie er bestimmt annahm, daß seine zu verschiedenen Zeiten angefertigten Mengen Goldpulver im amorphen Zustande, wenn sie erst eingeschmolzen waren, ein ähnliches Verhalten zur Elektrizität und zum Magnetismus zeigten, wie das Naturgold. Diese Ansicht äußerte er auch, aber die Gelehrten und vor allen Sforza, ließen verlauten, daß, wenn das amorphe Pulver so abweichende Eigenschaften aufweise, das gediegene Gold sich keineswegs anders verhalten werde.
Wassilowitsch ließ sich jedoch nicht beirren und blieb bei seiner Ansicht. Ohne den Mut zu verlieren, verließ er die Kommission, und voll von Gedanken und widerstreitendsten Gefühlen schritt er seiner Behausung zu.
An seiner Tür standen aber bereits Poliziottos, welche Order erhalten, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Der vorgewiesene Haftbefehl lautete dahin, daß ihm, Fedor Peter Wassilowitsch, wegen Falschmünzerei und Betrugs der Prozeß gemacht werden solle.
Vittore Sforza war seiner Ausgabe gerecht geworden, das chemische Kuckucksei, dessen er sich bedient hatte, stempelte die geniale Erfindung Wassilowitschs fälschlich zu der Mystifikation, als welche sie anfänglich betrachtet worden war. Die Welt konnte jedoch wieder aufatmen, eine furchtbare Gefahr war vorübergezogen, ohne verderbliche Spuren zu hinterlassen.
Eine Woche war seit jenen Vorfällen vergangen, und Wassilowitsch hatte inzwischen seine Wohnung mit dem Gerichtsgefängnisse vertauschen müssen. Die Regierung schien mit der äußersten Strenge gegen den Mann vorgehen zu wollen, der nach der Meinung der Sachverständigen kein genialer Entdecker, sondern ein raffinierter Falschmünzer war, der es verstand, ein goldähnliches Produkt zu gewinnen, das nur bei strengster Stichprobe sich als ein weitaus minderwertiges Falschmetall erwies.
Der kommende Tag, dem die ganze Kulturwelt mit großer Spannung entgegensah, sollte den Beginn des Prozesses gegen Wassilowitsch bringen.
Der Russe schien in Anbetracht der ganzen Sachlage, jetzt, nachdem eine ganze Anzahl Gelehrter chemische und physikalische Analysen seines Goldproduktes gemacht hatten, beinahe selbst Zweifel an seiner Entdeckung zu hegen. Er fühlte sich wie ein aus allen Himmeln Gestürzter.
Wie kam es nur, daß seine Analysen, die er doch mit allerpeinlichster Sorgfalt vorgenommen hatte, von denen der Sachverständigen abwichen? — Er hatte kein echtes Gold, sondern nur ein gefahrbringendes Falschmetall erzeugt. Nein, das vermochte er nicht auszudenken.
Nach reiflicher Überlegung und unter Erwägung aller Umstände kam Wassilowitsch kurz vor Beginn, als ihm der Prozeß wegen Falschmünzerei gemacht werden sollte, zu dem Entschluß, volles Licht in die Sache zu bringen und seine mühsam erklügelte Methode zur Lösung des Problems der Menschheit preiszugeben, immer noch von der schwachen Hoffnung beseelt, daß sich die Sachverständigen und nicht er bei den Analysen geirrt hätten.
Der Prozeß begann. Wassilowitsch saß auf der Anklagebank und harrte mit fieberhafter Unruhe der Dinge, die da kommen sollten.
»Meine Herren!« begann der Vorsitzende des Gerichtshofes, indem er die Verhandlung eröffnete. »Ehe wir in puncto Anklage gegen Signor Wassilowitsch eintreten, richte ich an denselben zunächst das Ersuchen, wahrheitsgemäß und klar zu berichten, welcher Art seine Arbeiten zum Zwecke der Lösung des Problems der Herstellung künstlichen Goldes waren. Es kommt jetzt voll und ganz auf die Aussage an, um die Anklage aufrecht zu erhalten oder sie wieder fallen zu lassen. — Peter Wassilowitsch,« fuhr der Präsident, zu dem Angeklagten sich wendend, fort, »was haben Sie uns über Ihre vermeintliche Entdeckung zu sagen? — Ich bitte die Herren Sachverständigen, welche hier geladen sind, genau auf die Angaben des Angeklagten zu achten, und gestatte Ihnen, wo Sie es für angebracht halten, dem Angeklagten mit Fragen und Einwendungen in die Rede zu fallen. — Peter Wassilowitsch, erheben Sie sich und statten Sie uns jetzt einen wahrheitsgetreuen Bericht ab.«
Im Sitzungssaale herrschte eine atemlose Stille. Auf den Tribünen, welche von zahlreichen Neugierigen dicht besetzt waren, unter denen sich auch viele Berichterstatter von Zeitungen des In- und Auslandes befanden, wagte sich niemand zu rühren, jedermann war ängstlich, es könnte ihm auch nur ein Wort aus dem Munde des berühmten Angeklagten entgehen.
Wassilowitsch begann »Was ich über meine Entdeckung zu sagen habe, läßt sich mit wenigen Worten darlegen. Zunächst will ich vorausschicken, daß es mein ehrlichstes Bestreben gewesen ist, der Welt und der Wissenschaft einen Dienst zu leisten. Das Problem des Goldmachens beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Mein Beruf als Chemiker ist mir stets heilig gewesen und ich wollte ihn durch eine Tat verherrlichen. Entweder ist mir nun das, was ich alles erstrebt habe, gelungen oder ich habe Jahre eifrigsten Studiums und mühseligen Experimentierens zwecklos verschwendet. Um mich nun kurz zu fassen und gleich auf den Kernpunkt meiner Methode zu sprechen zu kommen, berichte ich folgendes. Der von mir eingeschlagene Weg beruht in der Hauptsache auf der Lehre von den Atomgewichten.«
Hier wurde der Sprecher durch ein lautes »Ah«, welches den Lippen der Sachverständigen entschlüpfte, unterbrochen.
»Bekanntlich besitzt jedes Element ein gewisses Atomgewicht. Auf Grund dieses Gewichtes gruppieren wir Chemiker die Elemente, von denen es bekanntlich über siebzig gibt, in Klassen, und zwar so, daß alle Elemente, deren Atomgewichte nahe beieinander liegen, jedesmal bis zu einer Zahlengrenze eine Familie bilden. So gehören beispielsweise die Elemente Blei, Quecksilber und Thallium zu einer Gruppe, deren Atomgewichte über 200 liegen; Sauerstoff, Wasserstoff, Lithium, Beryllium und Stickstoff zur Klasse derer, welche die niedrigsten Atomgewichte ausweisen ... Kurz gesagt, jeder Urstoff rangiert in eine bestimmte Kategorie. Ich gehe nun von der Idee aus, daß, wenn man einen Stoff herstellen könnte, dessen Atomgewicht dem des Goldes entspricht, das also gleich 197,2 ist, so muß man zweifellos ein dem natürlichen Golde in jeder Beziehung entsprechendes Produkt erhalten. Ich habe also auf dieser angenommenen Basis experimentiert und durch Vermischung zweier Stoffe, deren Atomgewichte zusammensummiert genau 197,2 Einheiten betragen, ein Metallpulver erhalten, das meiner wiederholten analytischen Untersuchung zufolge echtes Gold sein muß ...«
Hier wurde Wassilowitsch unterbrochen.
»Ich habe mit einer Gelehrtenkommission sowohl eine chemische als auch eine physikalische Analyse vorgenommen und gefunden, daß die letztere untrüglich erwies, daß das künstliche Gold andere Merkmale aufweist, als das natürliche,« warf Vittore Sforza, welcher als Sachverständiger fungierte, ein. »So verhält sich das Kunstprodukt dem Magnetismus gegenüber anders als wie das echte Gold. Ferner zeigt es auch eine verschiedene Leitungsfähigkeit für den elektrischen Strom ... Alles wichtige Merkmale, sehr wichtige Merkmale.«
»Wenn dies der Fall ist,« fuhr der Angeklagte fort und seine Stimme zitterte merklich, »so kann das Atomgewicht meines Kunstproduktes auch nicht 197,2 betragen.«
»Wir haben das Gewicht geprüft und müssen zugeben, daß es genau dem des Naturgoldes entspricht,« erwiderte der Sachverständige.
»Auf einen winzigen Bruchteil das Gewicht festzustellen, das ist nicht möglich. Schon wenn es nur um ein Billionstel differiert, ist das Produkt kein dem Golde völlig identisches. — So wird die Sache also auch bei mir liegen, wenn die physikalischen Analysen der Herren Sachverständigen stimmen. — — Meine jahrelange Arbeit wäre also vergeblich gewesen ... ich bin nicht zu dem heißersehnten Ziele gelangt.« Mit diesen Worten schloß Wassilowitsch seinen Bericht. Er fühlte sich mit einemmal wieder so nichtig — all der erträumte Glanz und Ruhm, die unermeßlichen Reichtümer und was in der letzten Zeit ihm sonst noch Berückendes vorgeschwebt hatte, das alles sollten nur Luftschlösser, Hirngespinste und wahnwitzige Phantasien gewesen sein? — Nein, er vermochte sich nicht sogleich an den Gedanken zu gewöhnen. Mit einem brustsprengenden Seufzer sank er auf seinen Sitz nieder und schaute mit verglasten Augen die Menschen um ihn herum an.
Die, welche hier über den unglücklichen Mann zu Gericht saßen, schienen mit dem aller seiner Hoffnungen Beraubten Mitleid zu haben.
Der Vorsitzende des Gerichtshofs ergriff jetzt wieder das Wort. »Signor Wassilowitsch, da gegen Sie die Anklage wegen Falschmünzerei erhoben ist, so können wir Sie, so sehr wir Ihrem Berichte auch vollen Glauben beimessen, doch nicht freisprechen, sondern müssen Sie auch weiterhin in Haft behalten, bis sich Ihre Unschuld völlig erwiesen hat und Ihre vermeintliche Entdeckung als nichtig anerkannt worden ist.«
Wassilowitsch erwiderte nichts. Ihm war es ganz gleich, ob er jetzt, wo alle seine goldenen Träume zerronnen waren, in die Untersuchungshaft zurückgebracht wurde, oder in seinem Heim sich in den trübseligsten Gedanken erging. So wanderte er denn dahin, wo er schon über eine Woche gehaust hatte.
Tage vergingen, Wochen waren ins Land gezogen, und noch immer hielt die italienische Regierung es für ratsam, Wassilowitsch im strengsten Gewahrsam zu halten. Der Mann war zu gefährlich, als daß man ihn frei seiner Wege gehen lassen durfte.
Nach langen geheimen Sitzungen des Ministerrates war mit vollstem Einverständnis Viktor Emanuels das Ergebnis der neusten wissenschaftlichen Untersuchungen und der gerichtlichen Klarstellung der Welt mitgeteilt worden, wonach Wassilowitschs Erfindung als Mystifikation und Falschmünzerei hingestellt wurde. Die diesbezüglich zwischen den Regierungen gewechselten Noten schienen das politische Gleichgewicht wiederhergestellt zu haben. Die Presse allein nur war es, die die Angelegenheit noch nicht für abgetan hielt. Die Times witterte Unrat. Der New York Herald bezichtigte die italienische Regierung sogar der gröbsten Unwahrheit, und die russischen Blätter waren über die Inhaftierung und über die gewalttätige Prozeßmacherei eines ihrer Untertanen so empört, daß sie in allen Tonarten zeterten und Italien mit Krieg bedrohten.
Italien bewahrte diesen gegenüber eine unerschütterliche Ruhe. Freilich hatte die Diplomatie einen schweren Stand, um das gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Mächte mochten das kategorische Dementi, welches Viktor Emanuel und seine Berater in betreff der Lösung des Goldproblems erlassen hatten, nicht nolens volens glauben. Sie witterten ein Vertuschungssystem, mit dem sie samt und sonders hinters Licht geführt werden sollten. Mehr noch als vorher türmten sich jetzt für die Herren an der Tiber Schwierigkeiten auf, die zu beseitigen sie sich völlig ohnmächtig füllten. Ein Meer von Tinte wurde mit zahllosen Noten verschrieben, die von Rom aus nach allen Richtungen der Windrose an die Höfe und Kabinette versandt wurden, um den stark beunruhigten Mächten die Hintergedanken zu nehmen.
Darüber waren Wochen ins Land geflossen. Wassilowitsch war und blieb Gefangener, bis ihm eines Tages eröffnet wurde, daß er seinen ferneren Aufenthalt auf den Liparischen Inseln zu nehmen hätte
Der Bucklige zuckte bei Eröffnung dieses Regierungsbeschlusses zusammen. Nach der Strafkolonie sollte er deportiert werden? — — Der Zorn bäumte sich in ihm auf. Man wollte ihn allmählich unschädlich machen — — er war sich keinen Augenblick mehr darüber im Zweifel. Solche unbequeme und gefährliche Leute wie er, mußten der menschlichen Gesellschaft entzogen werden. Das also war das Ende vom Lied? Welch ein Tor war er gewesen, als er täglich hoffte, man werde ihm die Freiheit wiedergeben, oder Rußland würde seinen Untertanen gewaltsam aus den italienischen Fesseln befreien.
Die Liparischen Inseln — — die Verbrecherinseln ... Italiens Bagno. Der Archipel der Spitzbuben.
Wassilowitsch schauderte es.
Er, der jahrelange Tätigkeit an eine Sache gesetzt hatte, die, wenn sie geglückt, einen Goldstrom über die ganze Welt ergossen hätte, sollte nun unter die Diebe und Mörder rangiert werden. Die Entehrung dünkte ihm schlimmer als sonst eine harte Strafe. Daß hier ein Lamentieren oder Begnadigungsgesuch nichts zu ändern vermochten, darüber war Wassilowitsch keinesfalls im Zweifel, und so ergab er sich denn zähneknirschend in sein Schicksal.
Wie lange er auf Lipari bleiben und was überhaupt noch aus ihm werden sollte, das war für ihn in tiefstes Dunkel gehüllt.
Die italienischen Behörden hatten sein Haus, sowie alle Laboratoriumsgegenstände und vorgefundenen Papiere mit Beschlag belegt und unter Gewahrsam bringen lassen. Daß man Wassilowitsch nicht traute, hatte seinen Grund darin, weil man fest annahm, er hätte Helfershelfer. Berechtigung hierzu gab ein Vorkommnis in Triest, wo zu derselben Zeit, in welcher Wassilowitsch der Prozß gemacht wurde, einer dortigen Bank von zwei Italienern ein gediegener Goldbarren zum Verkauf angeboten wurde. Dem Direktor des Bankinstitutes kam die Sache verdächtig vor und er ließ das Nationale der Männer feststellen. Eine daraufhin eingeleitete Untersuchung ergab dann, daß die beiden Männer zwei den Behörden schon längst bekannte und äußerst verwegene Schmuggler waren.
Pepp und sein Kumpan, die ihr Unwesen am Piave trieben, hatten in stiller Nacht die im Flusse liegende Kiste ihres ehemaligen Passagiers unter großen Mühen wieder herausgefischt und den darin befindlichen Goldbarren über die Grenze geschmuggelt, um ihn in Triest zu Gelde zu machen.
Dieser Vorfall ließ Wassilowitsch hinreichend verdächtig erscheinen, daß er sein alchemistisches Unwesen nicht allein betreibe. Die Deportation des Adepten betrachteten Viktor Emanuel und sein Ministerrat als das geeignetste Mittel, um den gefährlichen Mann dauernd unschädlich zu machen.
In derselben Woche, in der Wassilowitsch bekanntgegeben wurde, daß er seinen ferneren Aufenthalt auf Lipari zu nehmen habe — man sprach hierbei absichtlich nicht von Deportation —, brachte man ihn auf einem stark armierten Kriegsschiff nach dem Archipel der Spitzbuben.
In Lipari wurde der Unglückliche nun auf das schärfste bewacht, und nachts sperrte man ihn in eine besondere Zelle des Hauptgefängnisses.
Wochen waren darauf verstrichen, und Wassilowitsch verlor mehr und mehr den Glauben, daß sich sein Dasein noch einmal zum Besseren wenden könne.
Aber die Welt hatte den Mann nicht ganz vergessen, dem es gelungen war, eine Metallkomposition zu erfinden, die sich in chemischer Hinsicht in nichts von dem echten Golde unterschied.
Im stillen bereitete sich darum etwas vor, was die Völker des Erdballes erst recht in Erregung bringen sollte.
Eine steife Brise schwellte das breite Segel des zum Bewachungsdienst gehörenden Regierungsbootes. Die schaumgesäumten Wogen des Tyrrhenischen Meeres, in dessen Wasserbett der »Archipel der Spitzbuben« liegt, klatschten an den schlanken Rumpf des leichten Fahrzeuges und sandten ihren weißen Gischt auf das Deck.
Gegen Mitternacht war's, als im Osten, weit draußen im Meer, ein Licht aufblinkte. Der Mond hatte sich hinter einer sich ausbreitenden Wolkendecke soeben verborgen, und die Dunkelheit hüllte alles bis zur Unkenntlichkeit in ihr schwarzes Gewand.
Einem aufmerksamen Wächter am Strand konnte der Lichtschein am fernen Horizont nicht entgehen, doch niemand schien ihn zu gewahren. Es blieb nach wie vor ruhig. Weder ein Schritt noch eine Stimme unterbrach die tiefe Stille, die nur von Zeit zu Zeit durch das Sausen des auffrischenden Windes gestört wurde.
Das Licht konnte nur einem Schiffe angehören, das draußen auf der Reede lavierte. Selten kam ein Dampfer so dicht an die Inselgruppe heran, mit Aunahme der Transportschiffe, welche ab und zu anliefen, um zur Deportation verurteilte Gefangene zu bringen. Derartige Dampfer wurden aber jedesmal vor ihrer Ankunft dem Kommandanten signalisiert, und dann standen die Hafenbeamten zur Inempfangnahme des neuen Menschenmaterials bereit. Vor kurzem war nun erst ein Transport, zu dem auch Wassilowitsch gehört hatte, auf Lipari eingetroffen, somit war für die nächsten Wochen ein derartiges Schiff nicht wieder zu erwarten.
Eine Viertelstunde später, nachdem der Lichtschein aufgetaucht war, konnte ein scharfes Auge trotz der Dunkelheit in nordöstlicher Richtung von der Insel die Umrisse eines ungewöhnlich großen Dampfers erkennen, der sich sehr vorsichtig der Küste soweit als möglich zu nähern suchte. Das Licht, durch welches er sich signalisiert hatte, war jetzt völlig abgeblendet. Dies war offenbar erfolgt, um vom Lande aus nicht gesehen zu werden. Verdächtig war es auf alle Fälle.
Auf ganz Lipari rührte sich aber nichts. Was atmete, schien im tiefen Schlafe zu liegen. Der Dampfer blieb ungesehen.
Nach einer weiteren Viertelstunde konnte man das leichte Plätschern von Rudern vernehmen. Ein Boot nahte sich und legte hart am felsigen Strande an.
Fünf vermummte Gestalten entstiegen dem Fahrzeug, betraten den Strand und blieben eine kleine Weile lauschend stehen.
»Folgt mir ...« hörte man darauf eine Stimme flüstern, und einer der Männer schritt den andern vier vorauf und wendete sich landeinwärts.
»Wir gehen einen Felsenpfad entlang, der sehr schmal ist. Wer einen Fehltritt tut, büßt es mit dem Leben ...« hörte man dieselbe Stimme wieder flüstern.
»Maladetto! In der verdammten Dunkelheit ...« knurrte eine zweite Stimme.
Der kleine Trupp schlich nun eine kleine Strecke in der Nähe des Gestades entlang und bog dann hinter einer bizarr aufstrebenden Felspartie nach links ab. Jetzt beschleunigte der Führer seine Schritte, ohne allzu ängstlich aufzutreten. In der engen Schlucht, welche eben durchwandert wurde, schien er keine Überraschung zu gewärtigen.
»Haltet eure Pistolen bereit,« sagte der Führer. »Ihr wißt, daß für uns eine Summe von zweitausend Pfund auf dem Spiele steht.«
»Kennt Ihr den Weg auch genau?« frug einer der Vermummten.
»Zehn Jahre auf Lipari ... goddam! Da lernt man das Felsennest wie seine Westentasche kennen,« brummte der Führer auf gut Englisch.
»Ihr seid aber schon mehr als fünf Jahre fort ...« meinte einer der Männer.
»St!« flüstere der Cicerone und blieb plötzlich stehen.
Ein nicht zu unterscheidendes Geräusch mochte ihn stutzig gemacht haben.
»Weiter!« befahl der Führer, als er sich wieder sicher fühlte.
Schweigend setzte sich die kleine Schar von neuem in Bewegung.
»Nehmt den Dolch zur Hand, ein Schuß würde zuviel Lärm verursachen und könnte die Poliziottos herbeilocken.«
Jeder der Fünf lockerte jetzt die italienischen Pugnales in den ledernen Scheiden, jene spitzen Mordinstrumente, die unter der heißblütigen Rasse der apenninischen Halbinsel eine so große Rolle spielen.
»Was uns begegnet wird niedergemacht ... sind doch nur Poliziottos,« befahl der Anführer. »Wir dürfen keinen schonen, sonst könnte es passieren, daß wir fünf morgen im Sonnenschein an irgend einem Olivenaste nebeneinander baumeln.«
Das war für die andern wohl keine verlockende Aussicht, darum sah man die Fäuste die Griffe der Dolche fester umspannen.
»Für zweitausend Pfund trägt man nun seine Haut zu Markte. — Glatt geht die Geschichte keineswegs ab,« brummte eine sonore Stimme aus der Reihe der Männer.
»Ich glaube, ihr macht Späne ...« sagte der Führer und blickte sich nach dem Sprecher grimmig um. »Für zweitausend Pfund verlangen wir einen ganzen Mann, keinen, der für seinen Hals besorgt ist.«
Der andere schwieg.
»Mitgegangen — — mitgehangen, das heißt, wenn's schief geht,« lachte ein Dritter und der Spott, der in seinen Worten lag, kennzeichnete den Sprecher als einen, der sein Leben für einen Skudo in die Schanze geschlagen hätte.
Der Cicerone des kleinen Trupps mochte mit diesem Mann wohl eher zufrieden sein. Solche Draufgänger konnte er aber auch nur brauchen, wo zweitausend englische Pfund gegen fünf Köpfe auf dem Spiele standen.
Allmählich verstummte das Gespräch, denn der Weg wurde immer schmäler und schlechter und lief so hart an einem Abgrund hin, daß ein einziger Fehltritt einen Absturz zur Folge gehabt hätte.
Dazu kam noch die Dunkelheit, die so groß in der Schlucht war, daß keiner auch nur weiter als sechs Schritte hätte zu sehen vermögen.
Im Gänsemarsch schlängelten sich die Fünf den steinigen Bergpfad entlang, und bald schlüpfte dem einen, bald dem anderen ein leiser Fluch über die Lippen.
»Halt!« rief nach einer Weile Wanderns der Cicerone und blieb stehen.
»Was ist?« flüsterte einer der Männer.
»Noch wenige Schritte, dann kommen wir aus der Schlucht heraus und können von Wachtposten gesehen werden,« erwiderte der Cicerone.
»In der Finsternis?« frug der dicht neben dem Führer stehende Mann.
»Wo habt Ihr denn Eure Augen? — Seht Ihr denn nicht, daß dort der Mond wieder zum Vorschein kommt ?«
»Ja so ...«
»Von jetzt ab muß alles Sprechen unterbleiben. Ein Wort, und wir haben ein halbes oder ganzes Dutzend von Poliziottos auf dem Halse ... nun weiter — — — und leisen Schrittes.«
Die Bande folgte ihrem Führer so vorsichtig und schweigsam, wie er es verlangt hatte. Durch dichtes Gestrüpp, über und zwischen gewaltigen Steinblöcken hindurch nahm der Cicerone seinen Weg auf einer Berghalde entlang. Der Mond ergoß soeben sein Licht über die unwirtliche Gegend eines benachbarten Kraters. Die Vulkanasche knisterte unter den Füßen der Männer und es war unvermeidlich, daß bald hier, bald dort ein Lapilli oder ein Steinchen ins Rollen geriet und die Halde hinabkugelte.
Zehn Minuten mochten verstrichen sein, als der Führer nach vorwärts zeigte, wo im Halbdunkel schwacher Lichtschein an verschiedenen Orten sichtbar wurde.
»Dort sind Wachtstuben. Wir müssen dicht an ihnen vorbei,« sagte er in flüsterndem Tone.
Der Trupp bewegte sich jetzt auf die Lichter zu und mochte nur noch hundert Schritte davon entfernt sein, als in der Ferne eine dunkle Gestalt sich vom Hintergrund deutlich abhob.
Sofort blieb der Cicerone wie angewurzelt stehen, und eine rasche Handbewegung rückwärts zu seinen Gefährten ließ auch diese Halt machen. Wie Salzsäulen standen die fünf Männer auf einem Fleck und starrten nach vorn, um zu entdecken, ob Unheil nahe sei.
»Pst! ... Wir kommen allsamt schwerlich ungesehen vorbei. Geht zum Ausgang der Schlucht zurück und laßt mich allein die Sache machen. Einer schlüpft schon vorbei. Meinen Notpfiff kennt ihr ja ... Pst!«
Da der Cicerone allein in Lipari Bescheid wußte, so wagte es keiner der Männer, ihm zu widersprechen. Schweigend trennte man sich. Der unerschrockene Führer schritt vorsichtig wie ein Indianer auf dem Kriegspfade dem Lichtschein entgegen, während sich seine vier Kumpane auf den Rückweg machten. Die dunkle Gestalt war inzwischen in eins der naheliegenden Häuschen verschwunden, ohne von den Männern auf der Berghalde etwas bemerkt zu haben.
Der Führer des kleinen Trupps, der sich Filippo nannte, war eine herkulische Gestalt, besaß markante Gesichtszüge und verwegen blickende Augen. Von Geburt ein Sizilianer, hatte er fast zehn Jahre hindurch als Maat auf italienischen Kreuzern gedient, dann aber erstach er eines Tages im Streit einen der Heizer auf dem Kriegsschiff »Garibaldi« und wurde darauf zu fünfjähriger Deportation verurteilt und nach Lipari geschickt. Nach seiner Entlassung war er als Mitglied in die gefürchtete Camoraa und Mafia eingetreten, dies war aber den Behörden durch Zufall bekannt geworden, und er wurde sofort des Landes für immer verwiesen. Filippo hatte sich dann nach England gewandt und dort in der Marine eine Anstellung gefunden. Nun war aber die Zeit der Rache für ihn gekommen. Filippo hatte nämlich von der englischen Regierung den Auftrag erhalten, den auf Lipari von den Italienern gefangen gehaltenen Adepten Wassilowitsch gewaltsam zu entführen. Der Premierminister hatte gerade ihn zu der Mission ausgesucht, weil ihm zu Ohren gekommen war, daß er, der Maat vom Kriegsschiff Dreadnought, lange Zeit zu den Deportierten der Lipariinsel gezählt hatte und somit die dortigen Verhältnisse genau kennen mußte.
Filippo war auch sofort bereit gewesen, eine gewaltsame Entführung Wassilowitschs in Szene zu setzen. Als er dann noch gar die respektable Summe von zweitausend Pfund Sterling für den Fall des Gelingens in Aussicht gestellt erhielt, da war er Feuer und Flamme für die gefährliche Sache.
Die Regierung von Großbritannien und Indien hatte beschlossen, den Mann in ihre Gewalt zu bringen, der für alle Welt so gefährlich war, mochte er nun das Goldproblem gelöst oder nur ein Falsifikat geschaffen haben. Wo Wassilowitsch zu suchen war, dafür sorgte die italienische Presse, daß niemand darüber im Zweifel blieb.
Draußen auf der Reede lag nun das englische Kriegsschiff »Duke of Edinburgh«, das mit versiegelter, erst auf hoher See zu öffnender Order von Plymouth abgedampft war. Es hatte Filippo nach Lipari gebracht und harrte nun auf die Rückkehr des Maaten und der ihm beigegebenen vier übrigen Begleiter, durchweg handfeste Matrosen, Leute, die ihr Leben nur wenige Schillinge bewerteten.
Es war ein Glücksumstand für Filippo, daß der steife Seewind wieder Wolken herauftrieb, die den Mond für eine Zeit vom Firmament verschwinden ließen. An den Wachthäusern war der couragierte Bursche bereits vorbeigeschlichen ohne irgendwelche Behelligung erfahren zu haben. Jetzt klomm er eben wieder einen steilen Pfad an einem Kraterkegel hinauf, verfolgte dann, sich abwärts wendend, einen der ihm von früher her wohlbekannten Obsidianströme, jene erstarrten vulkanischen Glasflüsse, die sich wie pechschwarze Schlangen von der Bergeshöhe hinab ins Tal winden. An einer Gabelung des Obsidianstromes wendete er sich dann nach rechts und lief hastig, ohne sich zu bemühen, den Schall seiner Schritte zu dämpfen, über ein bimssteinbedecktes Plateau und umschritt eine der heißen Schwefelquellen, den Rest einer früheren eruptiven Tätigkeit der liparischen Vulkane. Die nächsten Minuten ließen ihn dann ans Ziel gelangen. Er stand vor einer hohen Mauer, die auf halber Höhe des Berges ein düsteres, mächtiges Gebäude umschloß. Nirgends war ein Licht zu erblicken, jedes Fenster lag im Dunkel.
Jetzt hielt es Filippo für notwendig, mit der allergrößten Vorsicht die Mauer zu umschleichen und jedes Geräusch zu vermeiden. Seine nervige Faust umspannte den gezogenen Dolch fester. Wehe dem Unglücklichen, der in diesem Augenblick dem nächtlichen Wanderer begegnete! Er war ein Kind des Todes, und wenn Filippo durch ihn auch nicht Verrat zu fürchten gehabt hätte.
Die Eingangspforte der Mauer war bald gefunden, und der verwegene Maat lugte nun durch das halbverhüllte, niedrige Fenster der Torwachtstube.
Bei schwachem Lichtschein gewahrte er hier zwei Poliziottos. Der eine lag auf einer eisernen Feldbettstelle und schien sich des Schlafes der Gerechten zu erfreuen. Der andere saß an einem kleinen Tischchen und schmauchte eine kurze Pfeife. Der Tabaksqualm lagerte bereits in Wolken über den Häuptern der beiden Männer, das Licht der altersschwachen Lampe ziemlich dämpfend. Die Wanduhr unterbrach durch ein eintöniges Ticken die tiefe Stille.
Filippo war einen Augenblick unschlüssig, was er tun sollte. Er schien mit einem Entschluß zu kämpfen. Plötzlich klopfte er leise an die gesprungene, schmutzbedeckte Scheibe des Fensters und zog sich behende ins Dunkle des Gemäuers zurück.
Einige Sekunden später öffnete sich die Pforte des Wachthauses, eine Gestalt trat heraus und forschte umher. Als der Wächter nichts sah, klirrte er mit dem Schlüsselbund in seiner Hand und steckte einen der rostigen Schlüssel ins Schloß der hohen Eingangstür, welche den Zutritt von außen her versperrte. Dann trat der Poliziotto ins Freie hinaus und hielt hier Umschau.
Wie der Blitz stürzte Filippo hervor und bohrte dem Ahnungslosen den Dolch in die Brust.
Der tödlich Getroffene sank mit einem kaum hörbaren unartikulierten Schrei zusammen. Filippo zog nun den Körper des Poliziottos durch die offene Pforte und lauschte einen Moment, ob er nichts Verdächtiges vernehme.
Kein Laut unterbrach die tiefe Stille.
Leise klinkte Filippo jetzt die Pforte des Wachthäuschens auf, schlüpfte hinein und stand nun vor dem Schläfer, zu dessen Häupten eine geleerte Absinthflasche und ein Wasserglas auf einem hinter dem Bett befindlichen Tischchen umgestürzt lagen.
Unvermutet erwachte eben der Poliziotto und stierte, den Kopf von dem Lager hebend, Filippo an.
Dieser wollte sich schon mit gezücktem Dolch auf den Mann stürzen, um auch ihn unschädlich zu machen, als derselbe mit lallender Stimme frug:
»Pietro — — — maladetto! — — Verdammter Absinth — — — gib mir Wasser ...« Bei dem letzten Worte sank das Haupt des Trunkenen auf das Bett zurück und die Augen schlossen sich zu neuem, tiefem Schlafe.
Als Filippo den Mann in solchem Zustände fand, glaubte er nichts von ihm zu befürchten zu haben. Darum steckte er den Dolch wieder in die lederne Scheide und trat dann ins Freie hinaus, abermals angestrengt lauschend.
Da sich nichts Verdächtiges vernehmen ließ, hob er den Getöteten vom Boden auf und trug ihn in die Wachtstube, wo er den Leichnam entkleidete und ihn dann unter die Lagerstatt des Betrunkenen schob.
Filippo warf sich nun in die Gewänder des Poliziottos, trotzdem diese stellenweise von Blut durchtränkt waren. Seine eigene Kleidung schnürte er zu einem Bündel zusammen und verbarg dasselbe in einer Ecke der Wachtstube.
Wenige Minuten später trat er als Poliziotto gekleidet auf den Hofraum hinaus, nicht aber, ohne sich vorher noch einmal von dem festen Schlafe des Betrunkenen überzeugt zu haben.
Die Anstaltsuhr schlug soeben zwölf.
Mit einer kleinen Laterne ausgerüstet, die er im Wachtzimmer gefunden hatte, schritt Filippo über den Hof und öffnete mittels des Schlüsselbundes des Toten die Hauptpforte des düsteren Gebäudes.
Hier hatte Filippo fast zehn Jahre zugebracht. Er kannte jede Treppe, jeden Raum des mächtigen Gefängnisses, denn ein solches war das aus mächtigen Quadersteinen gebaute Haus.
Vorsichtig schlich der wagehalsige Geselle die knarrenden Stufen zum ersten Stock empor, in welchem der Aufseher schlief, der den Schlüssel zu Wassilowitschs Zelle besaß.
Zum Verständnis der Situation möge hier eingeschaltet werden, daß Filippo durch seine Auftraggeber genau über den Ort, wo er den inhaftierten Buckligen zu suchen hatte, unterrichtet worden war. Ein vor wenigen Wochen erst entlassener Sträfling aus Lipari hatte der englischen Regierung gegen klingendes Entgelt die nötigen Angaben gemacht. Wassilowitsch war als berühmter Falschmünzer binnen kurzem nach seiner Einlieferung auf der Insel allen Gefangenen bekannt geworden, es konnte somit wohl jeder die nötige Auskunft über seine Unterbringung in dem Gefängnis geben.
Einzelzelle 69. Das war der enge Raum in dem düsteren Gebäude, in welchem der genialste Mann des Erdballes jetzt seine Nächte verbrachte. Die Zelle lag im ersten Stockwerk, getrennt von den übrigen am Ende eines langen Korridors.
Filippo hatte bald die ihm wohlbekannte Stube des Aufsehers erreicht. An der mit einem Fensterchen versehenen Tür blieb er stehen und versuchte durch den fadenscheinigen Vorhang ins Innere zu blicken. Sein scharfes Auge vermochte aber in dem nur schwach erleuchteten Raum nichts zu unterscheiden.
Was sollte er nun tun? Der Verwegene besann sich aber nicht lange. Leise klinkte er die unverschlossen gehaltene Tür auf und lugte durch die Öffnung ins Zimmer. Er sah den Aufseher auf seinem Strohsack liegen und hörte ihn schnarchen.
Katzenartig schlich sich Filippo an die Lagerstatt heran, zog einen Knebel aus der Tasche und förderte dann auch mehrere Stricke zutage, die er vorsorglich aus der Wachtstube mitgenommen hatte.
Plötzlich fiel er über den sorglos Schlafenden her und würgte ihn mit eiserner Faust.
Mit erstickten Lauten wälzte sich jetzt der Aufseher auf seinem Lager und suchte sich des Angreifers zu erwehren. Hochrot war sein Gesicht angeschwollen und die Augen traten ihm fast aus den Höhlen. Plötzlich erlahmte seine Kraft ... ein Röcheln, und er sank auf sein Lager zurück.
Filippo blieb vor seinem Opfer stehen und sah dem Überwältigten ins Gesicht. Dann blitzte es wie Triumph über seine Züge. Er hatte einen alten Feind wiedererkannt. Den Mann, der ihn einst gemaßregelt hatte, als er noch auf Lipari schmachtete.
Ha! wie süß empfand er nun die Rache.
Da das wehrlose Opfer aber wieder langsam zu Atem kam, hielt es Filippo für geraten, ihm den Knebel in den Mund zu stecken, um ihn am Schreien zu verhindern. Dann band er ihm noch Stricke um Hände und Füße, so daß jener auch nicht ein Glied zu rühren vermochte.
»So ... Satan! Dir tränke ich's ein. Totschlagen müßte ich Dich Hund eigentlich.«
Der Aufseher stierte Filippo mit einem entsetzten Blick an, er mochte wohl sein Visavis wiedererkannt haben.
Filippo kümmerte sich nun nicht weiter um den Gefesselten, sondern nahm von einem Wandhaken einen Schlüsselbund und suchte denjenigen Schlüssel heraus, der die Nummer 69 trug. Eiligst begab er sich dann auf den Korridor hinaus.
Filippo lauschte einen Moment. — — — Totenstille. ...
Mit einigen Sätzen gelangte er jetzt zu der Zelle, wo Wassilowitsch seine Nachtruhe hielt. — Er klopfte ... einmal — — — zweimal — — —
Dann knarrte der Schlüssel in der Tür und Filippo trat in die Zelle. Bei dem Scheine der Laterne, die er mitgenommen hatte, sah er, wie sich eine bucklige Gestalt von dem Strohsack halb aufrichtete und ihn überrascht ansah.
»Was gibt's — —« frug Wassilowitsch und rieb sich schlaftrunken die Augen.
»Pst! ... Sprecht leise — —« Mit diesen flüsternd gesprochenen Worten trat Filippo auf den Buckligen zu.
»Ihr seid doch Signor Wassilowitsch?«
»Aufseher, Ihr habt wohl einen über den Durst getrunken ...«
»Pst ... ich bin kein Aufseher ... ich bin gekommen, um Euch zu befreien.«
Wassilowitsch schnellte von seinem Lager empor.
»Ihr seid ...«
Der Andere unterbrach ihn. »Fort, wir haben keine Minute zu verlieren.«
»Ja — — aber ...«
»Seid Ihr Wassilowitsch oder nicht?«
»Ich bin's.«
»Soll ich Euch aus diesem Teufelsnest den Weg in die Freiheit zeigen?«
»Ihr als Poliziotto?«
»Zum Teufel, ich bin kein Poliziotto ... es ist nur eine Verkleidung.«
»Ah, so — —«
»Maladetto! Wollt Ihr mir folgen oder nicht?«
Der Bucklige nickte. »Vorerst, wer seid Ihr?«
»Fragt jetzt nicht ... ich habe Euretwegen zwei Poliziottos den Hals umgedreht ... Ihr werdet also begreifen, daß ich große Eile habe, hier fortzukommen ... schnell, sputet Euch!«
Filippo schritt leise aus der Zelle heraus. Der Bucklige schien noch einen Augenblick zu überlegen, dann aber kam er mit großer Hast ans seiner Zelle heraus.
»Wie könnt Ihr Euch nur so lange besinnen ... ein jeder Vogel im Käfig ist schneller als Ihr, wenn die offene Tür ihm den Weg zur Freiheit zeigt.« Mit diesen Worten verschloß Filippo die Zelle wieder und schlich den Korridor entlang.
Der Bucklige folgte.
»Seid Ihr sicher, daß uns niemand begegnet?« frug er mit halblauter Stimme.
»Pst ...«
Beide kamen jetzt an der Stube des Aufsehers vorbei. Filippo warf einen Blick hinein und kehrte befriedigt zurück. Der Gefesselte lag noch ebenso hilflos als vorher auf seiner Lagerstatt.
»Auf der verdammten Treppe nehmt Euch ein bißchen in acht. Die Stufen knarren ...« meinte der voranschreitende Maat.
Die Bemerkung war für Wassilowitsch unnötig. Er kannte die Treppe bereits zur Genüge. Sechs Wochen hindurch war er täglich viermal über dieselbe geschritten.
Unbehelligt erreichten beide nach kaum einer Minute den Hof und die Torwachtstube. Auch hier warf Filippo einen Blick hinein. Der betrunkene Poliziotto war inzwischen aus dem Bett gekollert und schlief auf dem Boden weiter. Der Absinth war ein Teufelszeug, aber doch hatte er dem Manne das Leben gerettet, denn Filippo hätte den Poliziotto getötet, sofern dieser in nüchternem Zustande gewesen wäre.
Nachdem alles soweit geglückt schien, verschloß Filippo das Gittertor hinter sich und dem Buckligen und schritt eilig vorauf.
»Wer schickt Euch, um mir zur Freiheit wieder zu verhelfen?« frug Wassilowitsch nach einer kleinen Weile in gedämpftem Ton.
»Die Camorra ...« gab Filippo leise zurück. »Seid ruhig ... fragt nicht weiter, wenn Euch Euer Leben lieb ist.«
Die Camorra. Filippo hat sich schlau herauszureden gewußt. Das wahre Gesicht durfte er dem Russen nicht zeigen, damit hätte er möglicherweise Fiasko mit seiner Befreiung erlitten.
Wassilowitsch hatte früher viel von dem Tun und Treiben jenes mächtigen Geheimbundes, der seinen Sitz in Neapel hat, gehört. Er wußte, daß die Camorra Verbrecher beschützt und sich zu ihrem Retter aufwirft. Es konnte darum nicht wunder nehmen, wenn der Bucklige keinen Augenblick an Filippos Antwort zweifelte.
Der Maat lachte sich im stillen aber ins Fäustchen, die zweitausend Pfund waren ihm jetzt so gut wie sicher. Mit eiligen Schritten lief er dem anderen vorauf, und bald hatten beide die Berghalde ereicht, wo die Lichter der Wachtstuben sichtbar wurden.
»Hier nehmt das Pistol. Es ist geladen ...« sagte Filippo, indem er stehen blieb und dem Buckligen seine Waffe reichte. »Es ist nicht ausgeschlossen, daß uns Poliziottos in den Weg laufen. — — Seht Ihr dort unten die Lichter der Wachen?«
Wassilowitsch bejahte.
»Dort müssen wir so behutsam als möglich vorbeischleichen ... verstanden?«
»An mir soll's nicht fehlen,« brummte Wassilowitsch vor sich hin.
»Kennt Ihr die Serpentine ... den Felspfad jenseits der Wachtstuben?«
»Nein ... in der Brigione sprach man zuweilen von der Serpentine,« antwortete Wassilowitsch. »Soll sehr steil und verdammt gefährlich sein.«
»Eine Tarantella könnt Ihr natürlich nicht darauf tanzen ... doch nun still.«
Beide Männer schlichen bald darauf an den Wachtstuben vorbei, ohne gesehen oder gehört worden zu sein. Pistol und Dolch kamen nicht zum Wort.
»Meine Gefährten erwarten uns dort am Ausgang einer Schlucht,« flüsterte Filippo seinem Begleiter ins Ohr, als dieser jetzt dicht an seiner Seite dahinschritt.
»Wieviel seid Ihr zusammen?« frug Wassilowitsch. »Alles Camorrianer?«
»Fünf ...«
Der Bucklige wollte soeben eine andere Frage stellen, als ein donnernder Schuß die tiefe Stille der Nacht jäh unterbrach und die beiden Männer erschreckte.
»Maladetto!« fluchte Filippo. »Die Kanone gibt das Notsignal ... wir sind verraten. Schnell, sputen wir uns. Es gilt unser Leben!«
Voranstürzend erreichte der Maat bald die Schlucht. Ein leiser Pfiff aus seinem Munde ertönte und wenige Sekunden später tauchten vier Gestalten vor Wassilowitsch auf. Es waren Filippos Kumpane.
»Fort! Die Insel ist alarmiert ... man wird uns bald auf den Fersen sein.«
Die sich fast überstürzenden Worte Filippos verfehlten ihre Wirkung auf seine Genossen nicht. Alle zogen sich in größter Eile rückwärts. Wieder übernahm der Maat die Führung durch die gefährliche Serpentine.
Trompetensignale wurden jetzt in der Ferne vernehmbar, und diese spornten die Flüchtlinge zu noch schärferem Laufe an. Noch waren sie den verhängnisvollen Felsenpfad nicht zu Ende gegangen, als einer von Filippos Genossen strauchelte und mit einem Schrei des Entsetzens in der Tiefe des Abgrundes verschwand.
Jeder blieb erschrocken stehen. Wer war der Unglückliche aus ihrer Mitte? Filippo suchte nach Wassilowitsch — — er war da. Das genügte ihm. Ohne sich um den Abgestürzten zu kümmern, spornte der Maat die andern zu immer größerer Eile an. Erst als alle am Strande standen, frug er hastig, wer von seinen Gefährten in die Schlucht gestürzt sei, und erfuhr, daß es jener war, der darüber gemurrt hatte, daß er seine Haut für zweitausend Pfund hier zu Markte tragen solle.
Es wurde jetzt die höchste Zeit, daß die Männer das Boot, welches sie zur Insel gebracht hatte, bestiegen und abfuhren, denn der Lärm, der aus der Ferne herüberdrang, ließ keinen Zweifel mehr übrig, daß ihnen bereits die Verfolger auf den Fersen waren.
Noch hatte das Boot sein Ziel nicht erreicht, als plötzlich das alarmierte Wachtschiff auftauchte und die Verfolgung aufnahm.
»Laßt sie erst dicht herankommen, dann brennen wir ihnen eins aufs Fell!« rief Filippo.
Unterdessen machte der »Duke of Edinburgh« Dampf auf und richtete seinen mächtigen Scheinwerfer auf das Wachtschiff.
Plötzlich stoppten nun auch die Insassen dieses Fahrzeuges. Sie gaben die Verfolgung als aussichtslos auf und versuchten nun anscheinend die Nationalität des gewaltigen Panzerkreuzers auf der Reede zu ermitteln. Aber keine Flagge, kein Wimpel wehte an den Masten, kein Name am Bug war sichtbar. O, die Engländer waren nicht so tölpelhaft, sich durch solche Dinge gleich zu verraten.
Die Schaluppe der Flüchtigen erreichte jetzt das Panzerschiff, und wenige Augenblicke später waren alle wohlbehalten an Bord. Wassilowitsch wurde von dem Kapitän und einem elegant gekleideten Herrn in Zivil sofort in Empfang genommen und in eine Kajüte hinuntergeführt.
Der Scheinwerfer verlöschte und die gewaltigen Turbinen des Maschinenraumes begannen zu arbeiten. Der Panzerkreuzer setzte sich in Bewegung, seinen Kurs westwärts nehmend.
Drüben am Strande sah Filippo die Menschen mit Laternen und Magnesiumfackeln hastig hin- und hereilen — — sie waren zu spät gekommen, die Vögel waren ihnen entschlüpft.
Filippo hatte seine zweitausend Pfund verdient.
Der »Duke of Edinburgh« dampfte bereits unter dem Schutze der Batterien von Gibraltar durch die Meerenge, als italienische Kreuzer ihn sichteten.
Viktor Emanuel hatte noch in derselben Nacht, in der die Entführung des Adepten vor sich ging, von Lipari Depeschen erhalten, worin der Gouverneur Brombin den Vorfall zur Mitteilung brachte und den Verdacht aussprach, daß es möglicherweise ein britisches Kriegsschiff gewesen sei, dem die verwegenen Befreier des Russen angehörten.
Monarch und Minister hatten gewütet beim Empfang der Schreckensnachricht. Der Gouverneur erhielt auf der Stelle seine Entlassung, und eine Anzahl Militärs und Beamte wurden ob des Vorfalls gemaßregelt. Eine königliche Order jagte sofort drei Kreuzer und ein Torpedoboot in See, um den Flüchtling lebend oder tot zurückzubringen.
War das Raubschiff ein englisches, dann spielte Viktor Emanuel va banque . Feuerten seine Kreuzer auf den »Duke of Edinburgh« und dieser mußte der Gewalt weichen oder wurde gar in den Grund gebohrt, dann wehe Italia, es würde durch einen einzigen Fußtritt John Bulls zerschmettert.
Trotzdem Viktor Emanuel nur zu gut wußte, daß ein solches Vergehen gegen Old England ihm Thron und Kopf kosten konnte, zog er es doch vor, seine Kreuzer dem Flüchtling mit schärfsten Befehlen nachzusenden. Bekam das britische Reich den gefährlichen Adepten in die Hände, so zögerten die Englishmen sicher nicht, Wassilowitschs Kunstgolde zu seinem Wert zu verhelfen, und dann war Italien erst recht dem Untergang geweiht. War die Nation doch schon seit langem für John Bull eine Null im politischen Konzert der Mächte.
Die italienische Flottille jagte also auf Befehl Viktor Emanuels hinter dem flaggenlosen Kriegsschiff her. Am Eingang der Meerenge von Gibraltar holten die Kreuzer, die unter höchster Inanspruchnahme ihrer Maschinen und Kessel mehr als 1400 Seemeilen in erstaunlich kurzer Zeit zurückgelegt hatten, den »Duke of Edinburgh« ein. Der Admiral der italienischen Flottille erblickte jetzt die von dem verfolgten Kriegsschiff mittlerweile gehißte britische blaurote Unionsflagge. Das mußte ihm einen heillosen Schreck einjagen, wenngleich er schon halb und halb darauf vorbereitet war. Doch dem Befehle seines Königs gehorchend ging der Admiral angreifend vor.
Ein Blindschuß des Kommandoschiffes kündete dem Engländer die Offensive in deutlicher Sprache an. Wenn der Italiener nun geglaubt hatte, der »Duke of Edinburgh« würde beidrehen, so hatte er sich sehr getäuscht.
Die Antwort war ebenfalls ein donnernder Schuß. Als der Admiral sah, daß der Gegner sich in die Defensive begab, wollte er seine Kanonen weiterhin reden lassen. Doch kamen die Batterien der verständigten Felsenfeste von Gibraltar eher zu Wort und nahmen das verfolgte Fahrzeug in Schutz.
Auf italienischer Seite war jetzt guter Rat teuer. Ging man weiter zum Angriff vor, so konnte es nur zu leicht passieren, daß die Flottille von den schweren Geschossen der englischen Festung, die noch durch die »Duke of Edinburgh« unterstützt wurden, in den Grund gebohrt wurde.
Der Admiral, dessen Flaggschiff mit funkentelegraphischen Apparaten ausgerüstet war, depeschierte in seiner Ratlosigkeit auf drahtlosem Wege nach Rom:
»VOR GIBRALTAR. FLÜCHTLING EINGEHOLT. ENGLISCHER PANZERKREUZER. UNSER FEUER WIRD SCHARF VON STRANDBATTERIEN ERWIDERT. FLOTTILLE IN GEFAHR BEI FORTGESETZTER OFFENSIVE. ERBITTE BEFEHLE. TORELLI.«
Die Entfernung zwischen den Italienern und Engländern mochte sich auf etwa drei Seemeilen bemessen. Die Schiffe lagen also im Aktionsradius der Geschoßbahnen. Bislang hatte noch jede Kugel hüben wie drüben ihr Ziel verfehlt. Der italienische Admiral stellte jetzt bei Absendung der Depesche das Feuern ein, und auch auf Feindesseite verstummten bald darauf die Geschütze.
Torelli, der Kommandant des Flaggschiffes, verharrte bis zur Ankunft der telegraphischen Order von Rom in Untätigkeit, während der »Duke of Edinburgh« seine Fahrt durch die Meerenge fortsetzte.
Die Entfernung dieses Fahrzeuges von der Flottille wurde schnell größer und größer, und die Italiener mußten zusehen, wie ihnen der Goldvogel entschlüpfte. Das waren für den Admiral und seine Offiziere qualvolle Augenblicke. Gingen sie unter Volldampf weiter vor, so war die Meerenge das nasse Grab ihrer Schiffe und auch ihr eigenes. Das stand außer Zweifel. Die mächtigen Batterien von Gibraltar hätten die Kreuzer trotz ihrer starken Panzerungen in den Grund gebohrt. Die Verfolgung aufnehmen, hieß also dem Löwen in den Rachen laufen.
3 Uhr 25 Minuten nachmittags — der »Duke of Edinburgh« war inzwischen außer Sehweite gekommen, und nur ein leichtes Rauchwölkchen am fernen Horizont verriet den eingeschlagenen Kurs — endlich setzte sich der Funkenapparat in der Navigationskajüte in Bewegung. Die Rückdepesche lief ein.
Sofort ließ sich der Admiral dieselbe vorlesen.
»UNVERZÜGLICH VERFOLGUNG WEITERAUFNEHMEN. SETZEN SIE IHREN WEG DURCH DIE MEERENGE FORT. MACHE SIE FÜR DAS ENTKOMMEN WASSILOWITSCHS VERANTWORTLICH. VIKTOR EMANUEL. GEZ. ZANELLI.«
Torelli zuckte bei Verlesung der Order ein wenig zusammen. Also auf Tod und Leben. Nun wohl, er wollte seinem König zeigen, daß er ein Mann und Held war.
»Volldampf voraus!« ertönte im nächsten Augenblick das Kommando aus seinem Munde.
Der Befehl wurde sofort von dem diensthabenden ersten Offizier nach dem Maschinenraum weitergegeben.
Volldampf voraus! — —
Der Kiel des Flaggschiffes durchschnitt gleich darauf die schaumige Flut. Der Kreuzer und seine Begleitschiffe dampften der verderbenbringenden Strandbatterie zu. Die Bedienungsmannschaft stand schußbereit an den Geschützen. Matrosen schafften auf Befehl des Kommandanten Munition aus den Kammern herbei und häuften diese neben den Kanonieren auf.
Außer den in geschützter Stellung stehenden Mannschaften durfte niemand auf Verdeck verweilen. Die gleiche Order war auch durch Flaggensignale an die Begleitschiffe ergangen.
In Gibraltar schien man das mutige Vorgehen der italienischen Flottille keinesfalls erwartet zu haben, denn es dauerte eine geraume Weile, ehe sich die furchtbaren Feuerschlünde der englischen Geschütze wieder öffneten.
Mitten in der Meerenge befand sich bereits Admiral Torelli, als der erste Schuß vom Strande her ertönte, und eine wohlgezielte Kugel seinem Flaggschiff einen der Schornsteine glatt wegriß.
Der »Duke of Edinburgh« nahm seinen Kurs hart an dem Gestade des afrikanischen Festlandes entlang, um möglichst weit aus dem Kugelbereich der Felsenfeste zu gelangen. Aber wie ein Geschoßhagel kam's von drüben herüber, und bald wiesen die Kreuzer starke Beschädigungen auf. Nun eröffneten auch sie ein heftiges Feuer, das aber den Festigungen von Gibraltar ebensowenig Schaden zufügte, wie eine Maus es durch Annagen bei einer Eisenplatte vermocht hätte.
Torelli erkannte das Nutzlose seines Artilleriefeuers auch bald und gab deshalb Befehl, es einzustellen. Sein Bestreben richtete sich nun ganz darauf, so schnell als möglich an dem Feind vorbeizukommen.
Die Schiffskörper stöhnten fast unter dem Druck der Maschinenleistungen. Die gewaltigen Turbinen arbeiteten, und Rauch und Dampf schnob aus den schwarzen Schlünden der Schornsteine, wie der heiße Atem und Schaum aus den Nüstern eines zu Tode gehetzten Pferdes.
Dann aber, als man schon der Gefahr entronnen zu sein glaubte, brach das Verhängnis über die Flottille herein. Eine Kugel bohrte das eine Begleitschiff Torellis in den Grund — — mit Mann und Maus sank es binnen wenigen Minuten, ohne daß ihm Hilfe gebracht werden konnte. Darauf folgte ein neuer Schlag. Der dritte Kreuzer ging plötzlich in Flammen auf. Noch aber trotzte das Flaggschiff dem Feinde.
Drüben in Gibraltar mochte man wohl jubeln über den erzielten Erfolg, aber er schien John Bull noch zu gering zu sein, denn das von ihm unterhaltene Geschützfeuer wurde zunehmend mörderischer. Donnernd sauste ein Geschoßhagel auf die unglücklichen Reste der kleinen Flottille Viktor Emanuels hernieder, und die Kugeln rasierten die Verdecke der Schiffe, schlugen und rissen Löcher in die Bordwände, so groß, daß das Wasser sich in Strömen in das Innere der Kreuzer ergoß.
Die Lage wurde für Torelli im höchsten Grade bedenklich. Jede Minute konnte den völligen Untergang für die Schiffe bringen. Unausgesetzt rollte der Donner der Batterien. Kugel um Kugel brachte neues Verderben, Noch aber war das Flaggschiff soweit intakt geblieben, daß es seine rasende Fahrt fortsetzen konnte. Das Torpedoboot hingegen war verloren. Ihm war anscheinend das Steuer weggerissen worden, denn das kleine Fahrzeug trieb hilflos auf den Wellen umher, und es stand wohl außer Zweifel, daß es sich nicht mehr lange über Wasser halten würde.
Der zweite Kreuzer war ebenfalls unrettbar verloren, schlugen doch gewaltige Flammen über Deck empor und züngelten an den Resten der stehengebliebenen, von den Geschossen verschonten Gefechtsmasten empor, einen grauenhaften, aber imposanten Anblick bietend.
Noch hatte das Flaggschiff die Meerenge nicht verlassen, als ein wohlgezielter Schuß es in den Grund bohrte.
Italiens Flagge versank in den Fluten des Meeres — John Bull triumphierte. — — — —
»Mr. Wassilowitsch werden gebeten, sich zur Kajüte des Kommandanten zu bemühen,« sagte ein Deckoffizier des »Duke of Edinburgh« zu dem in einer Kabine seinen Gedanken nachhängenden Adepten.
Der Bucklige erhob sich und leistete der Aufforderung Folge. Was man von ihm begehrte, das wußte er im voraus, war doch bereits eine Unterredung voraufgegangen, die ihn keineswegs über die Wünsche der englischen Nation im Zweifel ließ.
Der Kurs des englischen Panzerschiffes war nordwärts gerichtet, und die Fahrt ging eben durch den Biskayschen Meerbusen, als Wassilowitsch zu Mr. Sellery, dem Kommandanten, gerufen wurde.
Der Ordonnanzoffizier schritt vorauf.
Auf ein Klopfen des Diensttuenden an der Kajüttür ertönte von innen heraus ein sonores: »come in!«
»Mr. Wassilowitsch,« redete der englische Kommandant den eintretenden Russen an, während er mit der Hand dem Ordonnanzoffizier abwinkte.
Letzterer verließ die Kajüte, und der Bucklige sah sich mit Mr. Sellery und Mr. Hopkins, dem Staatssekretär des Foreign Office, allein.
Beide Männer waren große, überaus hagere Gestalten, der eine in Admiralsuniform, der andere in elegantem Zivil.
Mr. Sellery hatte in seiner Redeweise etwas Barsches, während der Minister ein gentlemanlikes Auftreten zeigte.
»Mr. Wassilowitsch, die Bedenkzeit, welche ich bewilligt habe, ist verstrichen. Wir wünschen jetzt weitere Aufklärungen von Ihnen, welche uns zweckdienlich sein können,« begann der Admiral.
»Ich hoffe, daß Sie uns jetzt nicht wieder mit allgemein gehaltenen Auskünften abspeisen werden,« fügte Mr. Hopkins mit öliger Stimme hinzu, während er sein Monocle ins Auge kniff und den Russen anblinzelte.
»Ich habe weder eine Bedenkzeit verlangt, noch fühle ich mich veranlaßt, Ihnen Geständnisse zu machen,« versetzte der Bucklige.
»Wollen Sie Ihren Befreiern keinen Dank zollen?« frug Hopkins.
»Ich werde nichts profitieren,« antwortete Wassilowitsch. »Ich wandere aus einer Gefangenschaft in die andere. Was Sie, meine Herren, als ein Befreiungswerk betrachten, sehe ich glattweg als einen raffinierten Menschenraub an.«
»Sie haben eine eigentümliche Auffassung der Sachlage,« entgegnete Sellery.
»Mag dem nun sein wie ihm will — — ich behalte meine Erfindung für mich. Und da mein Kunstgold doch nichts weiter ist als ein Falsifikat, so kann es niemandem groß danach gelüsten, das Rezept kennen zu lernen,« gab der Bucklige zur Antwort.
»Ihr Falsifikat, Mr. Wassilowitsch, ist ein so gemeingefährliches Produkt, daß jeder Staat einen Frevel beginge, würde er den Inhaber des Rezeptes nicht beständig im Auge behalten,« sagte der Staatssekretär. »Italien hat dies wohl erkannt, und Sie deshalb auf Lipari interniert; da wir aber die gemeingefährliche Person, als welche wir Sie halten müssen, nicht in dem Lande belassen dürfen, von dessen Regierung wir vermuten können, daß sie versuchen wird, durch Verbreitung des Falsifikates ihren zerrütteten Finanzen wieder aufzuhelfen, so sahen wir uns gezwungen, in unserem Interesse und in dem anderer Staaten, uns Ihrer zu versichern.
»Die Welt betrachtet mich also für eine gemeingefährliche Person — —« entgegnete Wassilowitsch.
»Das steht außer Zweifel,« erwiderte Sellery in seiner barschen Redeweise.
»Ich bin also, wie man zu sagen pflegt, allezeit vogelfrei?« Der Bucklige hatte die Worte in einer maßlosen Erbitterung hervorgestoßen.
»Wenn es Ihnen beliebt, sich so zu nennen,« hörte man wieder die ölige Stimme sprechen.«
»Was wird mit mir nun geschehen?«
Die Antwort hierauf war ein Achselzucken seitens Hopkins'.
»Ich kann mich also auf alles gefaßt machen?«
Wieder ein Achselzucken.
»Das hängt von Ihnen ab, Mr. Wassilowitsch, ob Sie uns zu Willen sind oder nicht,« versetzte dann mit gleichmütigem Ton Hopkins, und verriet mit keiner Miene, wie er selbst sich zu der Sache verhielt.
»Und wenn ich nun nicht gewillt bin?«
Über die dünnen Lippen des Staatsmannes glitt halblaut. »— — Newgate.«
»So möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken,« meinte der Admiral.
»Ich habe nichts zu verspielen, mein Herr,« antwortete gelassen Wassilowitsch.
»Man kann nicht wissen ...« murmelte Hopkins.
»Ich möchte sehen, wer mich dazu zwingen könnte, etwas zu tun, wozu ich keine Neigung verspüre,« entgegnete Wassilowitsch, und in seiner Stimme lag etwas wie Trotz.
»Wenn Sie auf dem Standpunkt verharren,« versetzte der Staatssekretär, »so machen sich jetzt weitere Unterhandlungen überflüssig. — — — Mr. Sellery,« sagte er dann zu dem Kommandanten gewendet, »der Mann kann sich wieder in seine Kajüte zurückbegeben, ich möchte aber darum bitten, daß er sorgfältig bewacht wird. — — — Es mag auch Obacht gegeben werden, daß sich nicht etwa eine Selbstentleibung ereignet.« Die letzten Worte hatte Hopkins mit Nachdruck gesprochen und sein Blick dabei den Russen gestreift.
Der Minister verließ jetzt die Kabine, und Mr. Sellery beorderte einen Deckoffizier, Wassilowitsch wieder in seine Kajüte zu geleiten. Dem Diensttuenden flüsterte der Kommandant noch einige Befehle ins Ohr, welche dieser durch ein Kopfnicken quittierte.
Wassilowitsch ging mit gemischten Gefühlen fort, aber mit dem festen Entschluß, den Bestrebungen der Englishmen Trotz entgegenzustellen. Ob er gut daran tat oder nicht, das war ihm in diesem Augenblicke ganz gleichgültig, Hopkins hatte ihn geradezu en canaille behandelt, und derartige Maßregelungen konnten seine Gesinnung am wenigsten umgestalten.
Da der Bucklige nichts Besseres zu tun hatte, legte er sich jetzt in die Hängematte, nicht jedoch, ohne erst noch einen Blick durch die Luke auf das Meer hinausgeworfen zu haben. Er sann dann darüber nach, weshalb seit einigen Stunden der Kanonendonner, den er nur zu deutlich vernommen hatte, verstummt und warum die italienische Flotille, die er durch die Luke zu Gesicht bekommen hatte, dem englischen Panzerschiff nicht auf den Fersen geblieben war. Daß erstere durch Gibraltars Batterien in den Grund gebohrt worden war, davon hatte er keine Ahnung, er nahm vielmehr an, daß die Italiener die Verfolgung als ergebnislos aufgegeben hatten. Dann dachte er darüber nach, was für Absichten man in London wohl hege, um in seiner Sache wieder einmal so recht im Trüben zu fischen.
Inmitten solcher Betrachtungen sank der geplagte Mann in Morpheus' Arme. — — — — Als er wieder erwachte, befand sich der »Duke of Edinburgh« bereits auf der Höhe von Antwerpen und nahm straks seinen Kurs nach dem Kanal hin, um in der folgenden Nacht gegen 1 Uhr in Southampton vor Anker zu gehen.
Während des Verlaufs der weiteren Fahrt bis hierher hatte man den Russen völlig ungestört gelassen. Er erhielt sein Essen in die Kabine gereicht, und zwei Seesoldaten bewachten ihn. Den Anordnungen Mr. Hopkins' war buchstäblich Folge geleistet worden.
In Southampton kamen mehrere höhere Militärs und Zivilpersonen an Bord, die mit Hopkins und Sellery sofort eine längere Beratung in der Staatskabine pflegten.
Eine knappe Stunde später wurde Wassilowitsch mit einem Matrosendetachement in einer Schaluppe zu Lande gebracht. Hier stand bereits ein Wagen, welcher den Russen mit einigen ihn begleitenden Offizieren aufnahm und nach dem Bahnhof beförderte. Im Gefolge des Wagens befand sich eine Dragonereskorte, welche eigens zu diesem Zwecke nach Southampton beordert worden war. Man sieht, die Englishmen waren gar vorsichtige Leute.
Ein nur aus wenigen Wagen bestehender Extrazug überführte Wassilowitsch nach London. Auch auf dem Bahntransport waren alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um ein Entweichen des Gefangenen zur Unmöglichkeit zu machen. Der Bucklige war in einem Wagenabteil untergebracht worden, in welchem sich gleichzeitig auch sechs Soldaten des Regiments The Royal Fuseliers befanden, die strengste Order erhalten hatten, ein scharfes Auge auf Wassilowitsch zu haben.
Daß sich der Held unserer Erzählung infolge des Schutzes, welchen ihm die englische Regierung zuteil werden ließ, nicht wohl fühlte, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung.
Während der ganzen Fahrt wurde kein Wort gewechselt. Wassilowitsch starrte auf die an den Fenstern vorbeifliegenden Landschaften und hing seinen trüben Gedanken nach. — — — —
Daß sein ferneres Leben nur noch ein einziges langes Drama sein werde, dessen Akte ihm sicher noch viel Ungemach und Leiden bringen würden, darüber war sich Wassilowitsch außer Zweifel. Er war und blieb eben ein gemeingefährliches Individuum für die menschliche Gesellschaft, für alle Völker und Staaten. Mochte er nun zu allem, was man von ihm verlangte, Ja und Amen sagen, mochte er seine Erfindung preisgeben oder das entgegengesetzte tun, seiner Ansicht nach blieb das alles gleich. Man hatte ihn in der einen wie in der anderen Weise zu fürchten. Wassilowitsch war darum auf dem besten Wege, Fatalist zu werden. Infolge dieser Erwägungen war er ganz unschlüssig, wie er sich fernerhin verhalten sollte, und er war auch dann noch zu keinem Resultat gekommen, als der Train auf der Liverpoolstation in der englischen Hauptstadt einlief. Nur das eine hatte er sich vorgenommen, seine Handlungsweise genau nach dem Benehmen und dem Vorgehen der Engländer zuschneiden zu wollen.
So geheim auch die Regierung bezüglich Wassilowitsch alles gehalten hatte, so schien es aber doch schon fast ganz London zu wissen. Jedenfalls hatte die Ankunft des »Duke of Edinburgh« die Stadt alarmiert. Die Straßen um die Liverpoolstation waren zu der Stunde, als der Expreß vom Süden einlief, schwarz voll Menschen.
Wie das Land und die Regierung, so wähnte sich auch jeder einzelne Sohn Albions in seiner Existenz mehr oder minder gefährdet, wenn der »Goldmacher« in einem nichtenglischen Lande sein Wesen trieb.
Die Policemen hatten alle Hände voll zu tun, um die sich stauende Menge vor dem Bahnhof zur Räson zu bringen. So sehr die Londoner auch die hohe Polizei respektieren, und die Policemen nur in dringlichsten Fällen einzuschreiten pflegten, so machte sich doch jetzt, bei dem Tumult um die Liverpoolstation ein energischer Eingriff der Behörde erforderlich. Es war ein wüstes Drängen und Stoßen unter den zahllosen Neugierigen, jeder wollte den phänomenalen Adepten sehen, und die langen Hälse der langen Gestalten wurden noch länger, als der Erwartete, umgeben von der Militäreskorte, einen bereitstehenden Wagen bestieg.
Die Fahrt sollte nach dem MansionHouse gehen, aber der Wagen vermochte sich durch die gewaltige Menschenmenge kaum hindurchzuwinden. Hinter ihm her zog wie eine ungeheure Schlange der Menschenstrom.
Kein Monarch, keine noch so große Berühmtheit konnte von der Menge neugieriger angegafft werden, wie Wassilowitsch, als er den Wagen verließ und die Stufen zum MansionHouse emporstieg. Auch als die bucklige Gestalt bereits in das Innere des Hauses getreten, starrten noch zahllose Augen nach der Tür hin, durch die sie verschwunden war.
Der leibhaftige Gott Mammon, hätte er Gelüste empfunden, sich unter den Menschen zu zeigen, würde nicht mehr Furore erregt haben, als der unglückliche Adept.
Im Mansion House, der Amtswohnung des Lord Mayors von London und dem Sitzungsgebäude des Stadtrates, waren bereits zahlreiche hochgestellte Personen versammelt. Man sah neben Ministern, Diplomaten, Offizieren, auch Aldermen und Stadtverordnete. Es war wirklich eine illustre Gesellschaft, welche hier in Gruppen verteilt, auf den Fliesen des Foyers ungeduldig der Ankunft des Adepten entgegensehend, auf und ab wandelte. Als sich endlich die Pforte öffnete, und der Langersehnte in ihrer Mitte stand, da blieb alles wie elektrisiert stehen und starrte den Ankömmling an.
Diese Mißgestalt vereinigt also alle Macht der Welt in sich. Der Mann, den die Mutter Natur körperlich so stiefmütterlich behandelt hatte, war reicher als alle Krösusse und Nabobs der Erde? Sein Hirn war die Quelle des Goldstromes, der sich in Kürze unaufhaltsam nach allen Richtungen der Windrose über die Zonen des Erdballes ergießen sollte? Es war wirklich eine Ironie, daß das unscheinbare Männlein das Schicksal der Menschheit repräsentierte.
Wassilowitsch hatte sich seit der letzten Unterredung mit Mr. Sellery ganz in Gleichmut gehüllt, aber in der letzten Stunde noch den Gedanken gefaßt, wonach er in Anbetracht dessen, daß sein Erfindungsprodukt doch nur ein Falsifikat war, bereit war, das Rezept desselben, wenn man ihm eine gute Summe Geld bot, seinen neuen Peinigern abzutreten. Nur um Ruhe zu bekommen und Schlimmerem zu begegnen.
In einem Sitzungssaale traten nun Englands Würdenträger im Beisein des Lord Mayors zu einer Aussprache zusammen. Den Vorsitz hatten der erste Lord des Schatzamtes Iddesleigh und der Civil Lord der Admiralität Churchill übernommen. Ihnen assistierte der Staatssekretär Mr. Hopkins und Lord Ripon, der Vizepräsident des Geheimrates. Die diese Würdenträger umgebende Elite setzte sich aus Admiralen und höheren Beamten des Reiches zusammen.
Sellery, welcher sich ebenfalls unter den Anwesenden befand, legte zunächst einen kurzen Bericht über die ihm übertragene Mission ab, die er zur Zufriedenheit erledigt hatte.
Hierauf ergriff Mr. Hopkins das Wort, wobei er seine gepflogenen Unterredungen mit Wassilowitsch zur Kenntnis der anderen brachte.
Lord Iddesleigh, ein schlauer Fuchs der hohen Diplomatie, ein mit allen Wassern gewaschener Staatsmann, ließ sich dann mit Wassilowitsch in ein kurzes Gespräch ein, in das von Zeit zu Zeit auch Lord Churchill und Mr. Hopkins Fragen einwarfen.
Da der Russe früher einige Jahre in London geweilt hatte, so beherrschte er die englische Sprache ausreichend, weshalb sich kein Dolmetscher bei den nun folgenden Unterhandlungen nötig machte.
»Mr. Wassilowitsch,« begann Iddesleigh, »Sie sind überzeugt, daß Ihr Goldprodukt ein Falsifikat ist?«
Der Gefragte bejahte. »Streng genommen muß ich daran zweifeln, daß das Problem von mir gelöst ist, denn man hat mir klipp und klar nachgewiesen, daß ich ein Pseudogold, eine trügerische Metallkomposition geschaffen habe.«
»Wir haben das Produkt Ihres Kunstgoldes in chemischer und physikalischer Hinsicht untersuchen lassen,« sagte Iddesleigh, »und sind ebenfalls zu dem Resultat gekommen, daß Ihre Komposition zwar kein echtes Gold ist, aber doch einen Ersatz dafür bietet, der in technischer Hinsicht ungemein wertvoll werden kann. Aus diesen Gründen und noch anderen ist es uns erwünscht, daß die Erfindung des Pseudogoldes nicht in falschen Händen verbleibe.«
»Eure Lordschaft werden sich sicherlich dabei verrechnet haben!« erwiderte Wassilowitsch.
»Wieso?«
»Wie nun, wenn das Geheimnis des Goldproblems bereits in anderen Händen wäre?«
Der Bucklige heftete seine Augen auf den edlen Lord, um die Wirkung seiner Worte zu ermessen.
Die Lordschaften schnellten wie Federn von ihren Sitzen in die Höhe, und unter den übrigen Anwesenden machte sich eine gewisse Unruhe bemerkbar.
»Kennt die italienische Regierung schon das Geheimnis?« begann Iddesleigh mit einer Hast, die von seinem gewöhnlichen englischen Phlegma, welches er besaß, abstach.
»Man wollte mir den Prozeß wegen Falschmünzerei machen, und ich bekannte Farbe,« antwortete Wassilowitsch.
»Soviel wir wissen, haben Sie dem Gerichtshof doch nur die Basis, auf welcher sie bezüglich der Lösung des Problems arbeiten, verraten,« ließ sich jetzt die ölige Stimme Hopkins' vernehmen.
»Ganz recht,« versetzte der Bucklige »noch sind die Substanzen mein Geheimnis, aus denen die Metallkomposition besteht.«
Bei diesen Worten atmeten die hohen Würdenträger sichtlich wieder auf, hatten sie doch schon geglaubt, das Geheimnis sei bereits Dritten bekannt.
»Wir haben Sie von Lipari befreit,« sagte Iddesleigh, »um Sie uns geneigt zu machen, und ich hoffe, daß wir Sie zu einer Verhandlung mit uns bereit finden. Die englische Regierung will Ihre Erfindung erwerben.«
»Ich weiß den Wert meines Pseudogoldes als Falsifikat absolut nicht zu schätzen,« erwiderte der Russe.
»Wenn wir Ihnen nun eine Abfindung von einer Million Pfund bieten?« versetzte Iddesleigh.
»Welche Garantie wird man mir aber geben, daß ich nach Abtretung meines Geheimnisses ein freier Mann sein und bleiben werde?« frug Wassilowitsch.
Die Lordschaften sahen sich untereinander an und wußten nicht gleich eine Antwort darauf zu geben.
»Innerhalb der englischen Grenzen müßten Sie natürlich Ihren Aufenthalt allezeit nehmen,« meinte Hopkins.
»Das heißt so viel, als ich stehe ewig unter englischer Polizeiaufsicht,« erwiderte Wassilowitsch.
»Nennen Sie es, wie Sie wollen,« sagte Iddesleigh. »Solange Sie in England weilen, garantiert Ihnen der Staat jedes freie Tun und Handeln.«
»Was könnte mich aber hindern, mein Geheimnis irgend einem anderen Staate auf postalischem Wege mitzuteilen? Das könnte mir doch wohl niemand verwehren? Und eine Zensur meiner Briefschaften ließe sich doch auf die Dauer kaum durchführen, selbst dann nicht, wenn sich fortgesetzt ein Policeman an meine Fersen heften würde.«
Der Fall Wassilowitsch war in allen Lagen verzwickt, das sahen sowohl die englischen Machthaber, als auch der unglückliche Adept ein. Die Sache konnte man drehen wie man wollte, immer kehrte sie eine verhängnisvolle Seite heraus.
»Mr. Wassilowitsch,« sagte Iddesleigh, »es ist für Sie völlig gleich, welcher Staat Sie in den Händen hat, denn keiner wird Sie beliebig schalten und walten lassen. Sie werden selbst ermessen können, welche Gefährlichkeit Ihr Falschgold besitzt. Wir haben diese Sache nach allen Seiten hin reiflich erwogen und sind zu dem Resultat gekommen, daß hier etwas Durchgreifendes geschehen muß. Die Italiener setzten Sie einfach auf Lipari fest, und alle Welt geriet dadurch in Gefahr, daß eine Ausnützung Ihres Falschmetallgeheimnisses seitens der italienischen Regierung oder seitens Privatpersonen, über kurz oder lang stattgefunden haben würde, das unterliegt für uns keinem Zweifel. Um dem vorzubeugen, hatte sich die englische Regierung entschlossen, sich mit Gewalt in den Besitz Ihrer Person zu bringen. Die Italiener hätten Sie sicher ewig auf Lipari festgehalten, wir aber werden Ihnen anders begegnen, sofern Sie sich unseren Wünschen fügen. Freilich können auch wir es nicht unterlassen, Ihre Freiheit bis zu einem gewissen Grade einzuschränken. Immerhin aber werden Sie unter dem Schutze der englischen Krone ein ruhiges, sorgenfreies Leben führen, — natürlich nur sofern Sie gewillt sind, uns das Rezept zu Ihrem Pseudogold anzuvertrauen. Weigern Sie sich aber hartnäckig, so haben Sie selbst den Schaden in jeder Hinsicht zu tragen. Welche Maßregeln wir dann gegen Sie ergreifen werden, das vermag ich vorläufig noch nicht zu sagen, aber ich betone im voraus, daß diese sicher in einem schroffen Gegensatz zu dem Verhalten stehen werden, welches wir bei Abtretung Ihres Geheimnisses an uns, gegen Sie wahren würden.«
Der, dem diese Ansprache des LordMinisters galt, hatte die Flut wohlerwogener Worte gelassen angehört und schien im Stillen mit einem Entschluß zu kämpfen.
»Es hängt von Ihnen ab, Mr. Wassilowitsch, ob Sie Ihren künftigen Aufenthalt in Newgate oder in einem Palast in der Piccadilly nehmen werden, ich hoffe aber, Sie ziehen das letztere vor. Im übrigen muß ich noch bemerken, daß ich von Sr. Majestät, unserm König, ermächtigt worden bin, die Angelegenheit mit Ihnen zum Abschluß zu bringen.«
»Sofort?« frug Wassilowitsch.
»Jedenfalls ist die Sache ebenso wichtig als dringend.«
»Ich muß Bedenkzeit fordern,« versetzte der Bucklige.
»Wir haben Ihnen eine solche schon auf dem Schiffe gewährt,« ließ sich die ölige Stimme Hopkins' vernehmen.
»Ich muß sie noch ein zweites Mal verlangen, versetzte Wassilowitsch. »Ich glaube aber, Ihnen voraus sagen zu können, daß ich mich mit Ihnen einigen werde.«
»Schön!« hörte man Iddesleigh rufen. »In vierundzwanzig Stunden werden Sie uns Ihren Entschluß mitteilen.«
Iddesleigh flüsterte seinem Kollegen Churchill etwas zu. Dieser nickte und gab dann mit der Hand einem bereitstehenden Polizeiinspektor ein Zeichen, worauf dieser sich Wassilowitsch näherte und ihn bat, ihm zu folgen.
Nach dem Fortgang des Russen berieten die englischen Machthaber mit den übrigen Notablen und Offizieren noch weiterhin, wie man in der Angelegenheit am schlauesten und praktischsten handele.
Da gab es nun erregte Debatten.
»Es ist fast als ein Wunder zu bezeichnen,« meinte Lord Ripon, »daß die italienischen Gelehrten dem physikalischen Schwindel Sforzas nicht inzwischen auf die Spur gekommen sind.«
»Wir können uns glücklich schätzen, daß der Trick, das echte Kunstgold als ein Falsifikat hinzustellen, gelungen ist,« sagte Churchill.
»Mr. Sellery hat auch das seinige dazu beigetragen, daß der Coup gelungen — — —« versetzte Hopkins.
»Se. Majestät wird Verdienste schon gebührend zu schätzen wissen,« sagte Lord Iddesleigh mit einem gönnerhaften Seitenblick auf den genannten Admiral, der sich in nächster Nähe unter den Anwesenden befand.
Die weiteren Verhandlungen gewährten so recht einen Einblick in die Umtriebe und Pläne der schlauen Englishmen, die wieder einmal mit Aufwand aller ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und unter größter Rücksichtslosigkeit im Trüben fischten. Den Italienern war das Heft aus der Hand genommen worden, und John Bull wußte es festzuhalten. Wenn es ihm nun noch gelang, einer anstürmenden Allianz sämtlicher Mächte standzuhalten, so hatte er den Herrschaftssieg über den Erdball davongetragen und konnte dann alle Völker zu seinen Füßen zwingen.
Die Projekte und Plänchen, welche sich die Briten bereits zurechtgelegt hatten, waren der ungeheuerlichsten Art und so zahlreich, daß ihre Verarbeitung und Verwirklichung die Kraft ganzer Männer und nicht zum wenigsten auch ein erkleckliches Stück Zeit in Anspruch nehmen mußte.
Was hatten sich die Engländer nicht alles auf die Liste gesetzt.
Annexion alles Landbesitzes der Erde, Suprematie über alle Nationen, Aufsaugung aller Flotten und Heere der Mächte, Konzentration der Industrie und des gesamten Handels der Erde, und noch vieles andere mehr, was geeignet war, die Welt, so wie sie bestand, aus den Angeln zu heben.
Ja, man konnte nicht sagen, daß Englands Passarillen die kleinsten waren, die es je im Kopfe gehabt hatte.
Aller Voraussicht nach mußte Wassilowitsch auch auf die Leimrute gehen, welche ihm die Engländer gelegt hatten.
Das Geheimnis mußte ihm entrissen werden, mochte es kosten was es wollte. Zunächst wartete man ihm mit einer verhältnismäßig bescheidenen Summe auf.
1 000 000 Pfund Sterling war doch gleich 20 000 000 Mark, 25 000 000 Frank, ebensoviel Lire oder 10 000 000 Rubel. Fürwahr eine Summe, mit der man einen Krieg führen konnte.
Mit dieser Lockspeise also wollten die Englishmen fischen. Der Köder schien ihrer Ansicht nach fett genug zu sein, um den Fisch anbeißen zu lassen.
Und die Engländer hatten soweit ganz richtig kalkuliert. Wassilowitsch gelangte während der Bedenkzeit zu dem Standpunkt, daß es sich in einem Palast besser sitze als im Newgate.
Aber in letzter Stunde noch besann er sich eines anderen.
Wassilowitsch war nach der Verhandlung im MansionHouse in einem geschlossenen Wagen nach dem Royal Courts of Justice gebracht worden, wo er zwei Zimmer im oberen Stockwerk zugewiesen erhielt.
Mit seiner Beaufsichtigung war ein Sergeant betraut worden, welcher Tag und Nacht in der Umgebung Wassilowitschs bleiben mußte, während draußen auf dem Vorflur zwei Soldaten Wache hielten.
Der Sergeant mochte wohl ein ganz tüchtiger Soldat sein, gehörte aber unter die Klasse Menschen, die die Welt als Schwätzer bezeichnet.
Nach gepflogener Nachtruhe empfing Wassilowitsch seinen Morgentee durch den graubärtigen Sergeanten, der es sich nicht nehmen ließ, wie am Tage zuvor, mit dem berühmten Manne, »der das Gold machen konnte«, zu plaudern. Dabei erfuhr Wassilowitsch nun so mancherlei, vor allem aber etwas, das ihn wieder in jenen Zustand versetzte, in dem er sich schon einmal befunden, als er die Probe aufs Exempel gemacht hatte, und damit das weltumkrempelnde Problem gelöst sah.
Green, der schwatzhafte Sergeant, ließ nämlich ohne Absicht fallen, daß man in London ganz genau wisse, daß sein, Wassilowitschs Gold, vollwertiges Gold in jeder Beziehung sei, und daß man den Italienern schlauerweise nur ein Schnippchen geschlagen habe.
Wassilowitsch faßte sich an die Stirn. Er glaubte zu träumen, als der Sergeant ihm solches mitteilte. — — — War es denn denkbar? Er, sowie die italienische Regierung waren einem englischen Schwindelmanöver zum Opfer gefallen?
Um sich vollends zu vergewissern, frug Wassilowitsch Green noch weiter aus. Seine hastigen Fragen erregten aber in dem Sergeanten gewisse Bedenken, so daß dieser etwas karger in seinem Gespräch wurde. Er mochte wohl instinktiv ahnen, daß er eine Dummheit begangen hatte. Welche, darüber konnte er sich selbst keine Rechenschaft ablegen.
Wassilowitsch hatte aber bereits genug erfahren, um seine Antwort für die Lordschaften danach zuzuschneiden.
Jetzt, wo er die Gewißheit hatte, daß er im Süden wie im Norden Lug und Trug begegnete, und daß er nur gehörig aufzutrumpfen brauchte, um die Vorteile aus seiner Erfindung zu ziehen, wollte er nunmehr von neuem auf seinem alten Standpunkt verharren. Alles oder nichts! Wahrscheinlich würde man versuchen, ihn durch Einsperrung in Newgate fügsamer und mürbe zu machen. Aber was verschlug ihm das. Die Herren Engländer würden ihm doch schließlich wieder Angebote machen, nur um in den Besitz des Geheimnisses zu kommen, mit dem sie dann schlankweg die Welt als ihr Eigentum betrachten konnten. Das ihm sonst nichts Schlimmeres passieren konnte, darüber war er beruhigt.
Also warum das kostbare Rezept für die Bagatelle von 1 000 000 Pfund weggeben? — — Nach Macht und Reichtum geizte er jetzt wie noch nie. Rollte auch kein Fürstenblut in seinen Adern, so begehrte er doch im stillen einen Thron. Krösus, Nabob, Milliardär wollte er zum mindesten werden.
Sergeant Green sah außerordentlich verwundert die plötzliche Veränderung des Russen. Auf seine Frage, was plötzlich in ihn gefahren sei, gab Wassilowitsch gar keine Antwort. Er befand sich wieder in einem Rausch, der ihn seine Umgebung ganz vergessen ließ. Erst eine zweite Frage des Sergeanten störte seinen traumhaften Gedankengang. Barsch fuhr er Green an, daß dieser vor Schreck die kleine Tonpfeife, welche er gerade mit frischem Tabak gefüllt, aus den Händen fallen ließ. Der Sergeant zog sich beleidigt zurück, und es folgte nun eine Zeit tiefsten Schweigens.
Punkt 10 Uhr traten zwei Offiziere ins Gemach und schreckten Wassilowitsch aus seinen Gedanken auf.
»Se. Lordschaft, Mr. Iddesleigh, läßt Ihnen sagen, daß Ihre Bedenkzeit abgelaufen ist und Sie uns zu erklären haben, ob Sie gewillt sind, den Wünschen eines hohen Ministeriums entgegenzukommen,« sagte der eine Offizier mit schnarrender Stimme, sich aber recht bemühend, ein dem Russen verständliches Englisch zu sprechen.
Der Begleiter des Sprechers stand mit einem Buch und einem Stift in den Händen erwartungsvoll da, um Wassilowitschs Antwort zu Papier zu bringen.
»Ich lasse Sr. Lordschaft ergebenst mitteilen,« erwiderte der Bucklige im Imperatorton, »daß ich es vorziehe, mein Geheimnis für mich zu behalten.«
»All right,« versetzte der eine Offizier, und »all right« klang es wie ein Echo aus dem Munde des anderen zurück.
Die Antwort wurde formell notiert, und wenige Augenblicke später schloß sich die Tür hinter den beiden Abgesandten Sr. Lordschaft.
Die Pall Mall im Themsebabel Englands gehört mit zu den Straßen, deren Bewohner den exklusivsten Kreisen Londons zugerechnet werden und deren Häuserreihen durchweg fashionable Gebäude mit architektonisch stolzen Fronten aufweisen. Diese vornehme Straße, sowie die ihr benachbarten, die NorthumberlandAvenue, St. JamesStreet und Piccadilly, sind die Wohnsitze von mit irdischen Glücksgütern gesegneten Söhnen Albions, die dort ein ebenso freies als behagliches Junggesellenleben führen.
Die Klubhäuser repräsentieren Paläste im vollsten Sinne des Wortes. Mit wahrhaft fürstlichem Luxus und exquisitestem Geschmack sind diese Heimstätten von Londons Westen ausgestattet. Vornehm sehen die Gebäude von außen aus, doch verraten sie keineswegs die Pracht in ihrem Inneren. Nur wessen Fuß die Stufen der Marmortreppen überschreitet, wer durch das Foyer wandelt und die mit kostbaren Persern und Smyrnateppichen belegten spiegelglatten Parketts der Zimmer betritt, wer die Gobelins, Ledertapeten und künstlerischen Holzverschalungen der Wände sieht, und last not least einen Blick auf die lukullischen Tafelgenüsse des Lunch und Dinner wirft, der bekommt von dem englischen Klubleben einen Begriff.
Kein Land der Welt besitzt solche Einrichtungen, wie sie sich die ledigen Englishmen geschaffen haben. Wer über eine jährliche Revenue von einigen tausend Pfund verfügt und den Kreisen der Notablen angehört, kann sich mit der genannten Summe in einen der Klubs einkaufen. Er ist dann aller Sorgen und Kleinlichkeiten und Unannehmlichkeiten des täglichen Lebens ein für allemal enthoben, lebt wie ein Fürst in den ihm angewiesenen Appartements des Klubhauses, hat seinen Bediensteten, seinen Groom, seine Reitpferde und was sonst noch alles zum Lebensbedarf eines fashionablen Menschen gehört. Nichts vermißt er in einem solchen Heim, es sei denn die Anwesenheit eines liebenden Wesens vom anderen Geschlecht, dem aber der Klubmann ja so wie so nicht sonderlich geneigt ist, denn sonst wäre er eben nicht Klubmann. Nichts fehlt im Hause, was man nicht auch in den Palästen der reichsten Fürsten antrifft. Die in den Foyers und Speisesälen plätschernden Fontänen, die geschliffenen Pfeilerspiegel, die kristallenen Lustres, die von erster Künstlerhand hergestellten Skulpturen, Decken- und Wandfriese, sie alle sind beredte Zeugen des gewähltesten Geschmackes und des herrschenden Luxus. Die Fluchten der Rauch, Spiel- und Speisesäle, die Lifts, und was sonst noch alles zum Komfort par excellence gehört, vervollkommnen den Eindruck, welchen der Besucher dieser Privatpaläste, solcher JunggesellenHotels, empfängt.
Zu den ersten Klubs Englands zählt auch der in der Pall Mall ansässige CarltonKlub, dessen Mitglieder durchweg einer bestimmten politischen Partei angehören.
Die englische Regierung hatte nun für Wassilowitschs Unterkunft im Hotel des genannten Klubs gesorgt. Das war nicht ohne ganz besondere Absichten und Interessenverfolgungen geschehen. Man wollte den hartköpfigen Russen nicht noch widerspenstiger machen, weshalb man ihn inmitten von Wohlleben und Luxus hineinsetzte, hoffend, daß er in solcher Sphäre zugänglicher sei. Dann waren auch Mitglieder des Klubs mit der Mission betraut worden, auf Wassilowitsch nach Möglichkeit ein Auge zu haben. Die Angehörigen des CarltonKlubs wußten den Wert des Goldes zu schätzen, trotzdem wohl keiner von ihnen dasselbe jemals durch seiner Hände Arbeit verdient hatte. Überhaupt haben die Engländer vor Gold und Goldeswert einen höheren Respekt, als jeder andere Sterbliche des Erdballes. Gott Mammon war jetzt in leibhaftiger Gestalt unter ihnen und wurde aus diesem Grunde, trotzdem er nicht zu den Notablen des Landes gehörte, sondern sogar von Haus aus dem, bei den englischen Gentlemen wenig Ansehen genießenden russischen Mittelstande entstammte, gesellschaftlich vollbürtig erachtet und mit ganz besonderer Delikatesse behandelt. Die Lakaien und Grooms nun gar erst, wie sie dienerten, ihr Rückgrat krümmten und nach den allerhöchsten Worten suchten, wenn der Adept ihrer bedurfte.
Wassilowitsch war jetzt einige Tage nach seiner Ankunft in London nicht mehr in dem Maße von dem Taumel ergriffen. der ihn anfänglich Stunden hindurch mit Polypenarmen umfangen gehalten hatte. Er fing an nüchterner die Konsequenzen seiner durch den Wert der Erfindung geschaffenen Lage zu ziehen. Im Vorgeschmack der Lebensgenüsse bereits stehend, gaukelten ihm seine Sinne zwar fortgesetzt noch exquisitere Daseinsfreuden vor, doch konzentrierten sich seine Gedanken bereits mehr und mehr auf eine wirklich rationelle Verwertung der Erfindung. Sehr schwer war es für ihn, hier das Richtige zu treffen. Wie ein schwankendes Rohr im Winde neigte er sich bald zu diesem Entschluß, bald zu jenem, bald wollte er sich den Engländern gefügig zeigen, sofern sie ihm ein entsprechendes Äquivalent versprachen, bald wieder seinen Landsleuten, den Russen. Letzteren, weil ihm ein Heimatsgefühl diktatorisch diesen Weg vorschrieb. Doch wieder war es die russische Knute, welche er vor seinem geistigen Auge auf seinen entblößten Rücken niedersausen sah, — — ein Schreckmittel der Erinnerung, welches das Zünglein seiner Entschließung dann wieder auf die Seite von Rußlands Erbfeind neigte.
Im Verkehr mit den Mitgliedern des Klubs legte sich Wassilowitsch möglichst Zurückhaltung auf, und den Annäherungsversuchen Einzelner schob er durch eine kühle Reserve einen Riegel vor. Immerhin konnte er es doch nicht vermeiden, daß er mit in längere Gespräche verwickelt wurde. Die Unterhaltung fand zumeist abends in den Spiel- oder Rauchsälen statt, welche auch Wassilowitsch zu seiner Zerstreuung benutzte.
Ein dem Adepten von der englischen Regierung zugestelltes Geheimschreiben hatte ihn mit den Verfügungen bekannt gemacht, nach welchen er das CarltonKlubhaus zu beziehen und freies Tun und Handeln hatte, aber angehalten war, bei seinen Ausgängen die Begleitung eines Mr. Dudleys und Mr. Sethmans zu dulden.
Während Wassilowitsch nun unter der strengsten unauffälligen Bewachung in dem Pall Mall hauste, gingen die Wogen der Erregung in aller Welt hoch. Hatte doch der Telegraph von allen Vorgängen, die hier geschildert worden sind, Kunde bis in die entferntesten Winkel der Erde getragen. Die geschickte Düpierung Italiens durch England, die Entführung des genialen Adepten und vor allem, daß das Goldproblem wirklich restlos gelöst war, hielt die ganze Kulturwelt in Atem. Die großen Zeitungen gaben so recht die Stimmung aller Nationen wieder. Ein Lamento und Zetern zog durch die gesamte Presse. Und bereits drohte die Welt England samt seinen Goldfabrikanten zu boykottieren. Italien, die betrogene Nation, gab in dem Konzert der Mächte diesmal den Ton an. Viktor Emanuel schwang den Taktstock, während die Erinnerung an die in den Grund gebohrte Flottille und seine eigene Ohnmacht die Hand des Monarchen vor Erregung und Schmerz zittern ließ.
Als die diplomatischen Stützen des englischen Thrones gewahr wurden, daß Wassilowitsch von ihrem Schwindelmanöver Italien gegenüber Kenntnis erhalten hatte, waren sie äußerst bestürzt, weil nun der Adept sicherlich viel Späne machen und die enormsten Forderungen stellen würde. Die Meinungen der am Staatssteuer Sitzenden gingen jetzt gewaltig auseinander. Die edlen Lordschaften lagen sich fast in den Haaren, wenn es galt, hinsichtlich Wassilowitsch Entschließungen zu treffen. Hopkins hielt Newgate als das geeignetste Mittel, den Starrköpfigen gefügig zu machen. Iddesleigh war ebenfalls nicht nur dafür, sondern er ließ auch durchblicken, daß das Mittelalter mit seiner Inquisition in der Regel die wirksamsten Erfolge zu verzeichnen gehabt hatte, sobald es galt, von jemandem wichtige Zugeständnisse zu erhalten. Ripon und Churchill dagegen nahmen die entgegengesetzte Stellung ein und wollten Wassilowitsch durch fabelhafte Geldsummen und höchste Ehren den Wünschen Englands geneigt machen.
Wie sich die Lordschaften in zwei Lager teilten, so teilten sich auch die politischen Fraktionen, die Finanzwelt, die Bürger Londons und sämtliche Untertanen Englands überhaupt in zwei sich extrem gegenüberstehende Parteien.
Des regierenden Königs Majestät schien im ganzen Lande der einzige Beteiligte zu sein, welcher in seiner Kopflosigkeit nicht wußte, ob er sich auf die eine oder auf die andere Seite stellen sollte. Wäre der englische Herrscher eine konsequent denkende Natur gewesen, so hätte er einen Entschluß gefaßt und durch sein Machtwort die Angelegenheit in die eine oder die andere Bahn gelenkt. Die hohe Majestät stand aber nicht über den Dingen, sondern zwischen ihnen. Selbst ein Spielball der am Staatssteuer Sitzenden, wurde er im Ministerrat fast als eine Null übergangen.
Wassilowitsch war bereits schon einige Tage im CarltonKlubhaus und noch hatte sich zu seiner eigensten Verwunderung niemand dazu verstanden, wegen der Erwerbung seiner Erfindung mit ihm endgültig Rücksprache zu nehmen. Da er auch durch die englische Presse nichts gewahr wurde — diese unterstand augenblicklich der schärfsten Zensur seitens der Regierung —, so wußte er nicht, was man mit ihm vorhatte. Wenn er im Lesezimmer des Klubhauses, wo er sich mit Vorliebe aufhielt, die ausländischen Zeitungen, vor allem aber die italienischen einer eingehenden Durchsicht unterzog, so las er nur vage Vermutungen darüber, wie England die Sache handhaben und auszubeuten gedachte. Bei solcher Lektüre mußte er oft über die grotesken Ansichten und Bemerkungen der ausländischen Journalisten lachen. Am meisten amüsierte er sich über das Zetergeschrei aller Welt. Dann aber erschien plötzlich das Wörtchen »Boykott« in den Tagesblättern. Dies jagte nicht nur den Engländern einen Schreckschuß in die Glieder, sondern auch unser Held empfand ein gewisses Grauen davor, war doch seiner Ansicht nach der Boykott das geeignetste Mittel, welches die Welt besaß, um dem Lande, dem er sich mit Haut und Haaren verschrieben hatte, so die Luft abzuschneiden, daß ihm der Atem ausgehen mußte. Eröffneten die Mächte den Feldzug der Verrufserklärung Englands, so wurde auch er mit seinem Kunstgold aufs Trockene gesetzt.
Der besagte Artikel, welchen Wassilowitsch in einer römischen Zeitung gelesen, hatte folgenden Wortlaut:
»Nachdem der freche Betrug Englands und dessen Menschenraub in der ganzen Welt bekannt ist, sehen sich alle Kulturstaaten veranlaßt, sich zusammenzuschließen und mit vereinten Kräften das drohende Gespenst englischer Weltherrschaft zu vernichten oder es zum mindesten unschädlich zu machen. Ein internationaler Boykott kann dies allein nur bewirken, und wird dieser nicht nur zu Englands, sondern auch zu Wassilowitschs Verderben gereichen. Bereits stehen schon alle Mächte der Erde miteinander in Verhandlung. Was dieser Zusammenschluß bedeutet, das wird man in der Downing-Street bald gewahr werden. Als Vorspiel können der Kurssturz aller englischen Effekten an sämtlichen Börsen der Erde, ferner die allerseits abgebrochenen Handelsbeziehungen und die völlige Ignorierung der englischen Gesandtschaften an allen Höfen Europas und des übrigen Auslandes gelten. Die den einzelnen Inhabern englischer Wertpapiere und der Großindustrie durch den Boykott entstehenden Schäden will der sich konstituierende Weltstaatenbund durch angemessene Entschädigungen decken. Der deutsche Kaiser hat sich der Angelegenheit sofort angenommen. England steht bereits isoliert und von aller Welt abgeschnitten da. Die abgebrochenen Handelsbeziehungen, die plötzliche Versiegung alles Export- und Importverkehrs in England wird letzterem schon binnen kurzem den Lebensnerv durchschneiden.«
Die französische, russische, deutsche und amerikanische Presse forderte zu einmütigem Vorgehen gegen England auf. Die Journalisten predigten in allen Tonarten, insgesamt aber bliesen sie in ein und dasselbe Horn.
Als John Bull den Ernst der Situation erkannte und bereits die Wirkung des Boykotts am Leibe verspürte, da suchte er nach einem Strohhalm, an den er sich klammern konnte. So gut Old England allezeit politisch und diplomatisch abgeschnitten hatte, so hatte es doch diesmal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das mußte ernüchternd auf die Söhne Albions wirken, und ernüchterte auch Wassilowitsch um ein Erkleckliches. Auf eines rechnete man aber in der DowningStreet noch. Und das war, daß die Internationalen nicht eine völlige Einigung unter sich erzielen würden, um die geplante Boykottierung in ihrem ganzen Umfange in Szene zu setzen. Es hatte auch fast den Anschein, als wenn es so kommen sollte, denn die Schlitzäugigen aus dem Reiche der Mitte, welche so ganz und in jedem von England abhängig waren, fürchteten insgeheim die nervige Faust ihres Protektors und begannen die internationale Kommission, welche den Weltstaatenbund zusammenschmiedete, mit allerlei Ausflüchten hinzuhalten. Trotzdem machte der Boykott doch recht fühlbare Fortschritte.
Immer dichter türmten sich dann aber die Wolken am politischen Himmel Englands auf. Dazu stockte auch schon seit einigen Tagen aller Handel und Wandel. In dem gesamten Staatswesen riß eine gewaltige Unordnung ein, wodurch die Verkehrsmittel in erster Linie zu leiden hatten. Post und Börse, Bahnen und Banken hatten große Betriebsstörungen zu verzeichnen. Die arbeitenden Klassen benutzten die Situation zu Massenstreiken, und die Seeleute weigerten sich, Ozeanreisen anzutreten, bevor nicht die Lage geklärt sei.
Sämtliche Kontore und Niederlagen blieben geschlossen, weil nicht nur alle Handelsbeziehungen unterbunden waren, sondern auch zahlreiche Clerks streikten. Auf der einen Seite waren die Leute durch den immer mehr Gestalt gewinnenden Boykott zur Untätigkeit verdammt, auf der anderen Seite wartete alles darauf, daß sich die Goldquelle öffne.
Englands Herrscher, Eduard IX., befand sich während dieser Vorgänge gerade außerhalb des Landes. Die Nachricht von der Lösung des Goldproblems und der damit von Italien her drohenden Gefahr, war ihm auf telegraphischem Wege nach Indien gemeldet worden. Nachdem er von dort seine Befehle erlassen hatte, trat er unverzüglich die Rückreise nach Europa an. Als die Majestät gerade den SuezKanal passierte, gelangte die kritische Situation, in der sich sein Land infolge des Boykotts befand, zu seiner Kenntnis. Mit höchster Eile suchte der Monarch nun auf dem kürzesten Wege nach London zu kommen, weshalb er sich in Marseille ausschiffte, um mit dem französischen SüdNordExpreß seine Reise fortzusetzen.
In Le Havre passierte ihm dann das Mißgeschick, daß ihn kein Schiff zu Englands Gestade hinübertragen wollte. Eduard IX. reiste nämlich, so lange er sich auf französischem Boden befand, in strengstem inkognito. Jetzt, als das Verhängnis es wollte, daß er und seine Begleiter am Hafen von Le Havre standen und sich keines Rats wußten, wie nach England zu kommen, erließ er sofort telegraphischen Befehl nach London zur Entsendung eines Dampfers, der ihn heimwärts befördern sollte.
Auf dem Telegraphenamt in Le Havre wurde es dadurch bekannt, daß der König von England in der Stadt weilte und mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Nachricht unter der Bevölkerung. Auch nach Paris wurde der Vorfall gemeldet.
Daß sich König Eduard in dem Lande der Franzosen augenblicklich nicht sonderlicher Zuneigung erfreute, bedarf wohl keiner Erwähnung. Es hätte nicht viel gefehlt, so hätten die Bewohner von Le Havre den Monarchen insultiert. Für letzteren war der unfreiwillige Aufenthalt in der Hafenstadt eine Qual. Während in seinem Land alles drunter und drüber ging, mußte er hier untätig sitzen und die gehässige Haltung der Franzosen gegen sich erdulden. Das größte Pech sollte dem König aber noch aufgespart bleiben. Als sein Fuß London betrat, war nämlich der Goldvogel, dessentwegen er eilends aus Indien zurückgekehrt, den Händen seiner Untertanen entschlüpft.
Wie ein Lauffeuer ging es am Tage der Ankunft des Königs durch London, daß Wassilowitsch von der Bildfläche verschwunden sei.
Ganz England knirschte vor Wut. Aber das änderte nichts an der Sache — Wassilowitsch war und blieb verschwunden und weder Mr. Dudley noch Mr. Sethman konnten über den Verbleib des Goldvogels Auskunft geben. Wäre die Sache zu Heinrichs VIII. Zeiten passiert, so hätten die Minister und sonstigen Beteiligten für ihre Köpfe fürchten können.
Die Londoner Polizei entfaltete nun unverzüglich eine fieberhafte Tätigkeit, um des Entwischten wieder habhaft zu werden.
Zehn Stunden nach der Entdeckung von Wassilowitschs Verschwinden meldete der Telegraph, daß in Newport ein amerikanischer Handelsdampfer vor Anker gegangen sei. Angesichts der internationalen Boykottierung erschien das der Regierung verdächtig genug, um eine Visitation des Schiffes und eine Beobachtung desselben anzuordnen. Doch ehe man dazu kam, dampfte der Amerikaner wieder aufs offne Meer hinaus und nahm seinen Kurs westwärts.
Das Hafenamt in Newport meldete der Regierung die Abfahrt des amerikanischen Dampfers und gab des ferneren auch noch an, daß dieser weder Ladung gelöscht, noch solche oder Kohlen an Bord genommen habe, wohingegen die Einschiffung einiger Passagiere beobachtet worden sei.
Nun stand es in London fest, wo man den entschlüpften Vogel zu suchen hatte. Zur selben Stunde wurde daher das gesamte Kanalgeschwader mobil gemacht, um die Verfolgung des Amerikaners aufzunehmen.
Die Kriegsfahrzeuge in Plymouth, Portsmouth, Chatham und Dover lichteten sofort die Anker und gingen unter Voraussendung einer Flottille Torpedoboote eilends in See.
Mr. Sellery war der Oberbefehl übertragen worden und dieser dampfte auf dem Flaggschiff »Duke of Edinburgh« dem Geschwader voraus.
9 Uhr 15 Minuten abends passierte nach mehrstündiger Parforcefahrt die Flotte bereits die Scillyinseln und noch konnte auch das schärfste Fernglas den Flüchtling nicht sichten. Mr. Sellery hatte sich selbst auf den gepanzerten Gefechtsmars, den Ausguck seines Schiffes begeben und suchte unausgesetzt den Horizont mit seinem TriëderBinocle ab. Da das Wetter stürmisch war, so pfiff ihm hier in luftiger Höhe die steife Brise gehörig um die Ohren.
»Geben Sie Befehl, daß der Scheinwerfer klar gemacht wird,« verständigte Mr. Sellery einen neben ihm stehenden Deckoffizier.
Letzterer leistete der an ihn ergangenen Order sofort Folge, indem er den Mars verließ.
Der Admiral warf jetzt einen Blick rückwärts, achteraus, wie der Seemann sagt. Im Kielwasser des Flaggschiffes sah er sein Geschwader folgen. 5 Battleships I. Klasse: die Turmschiffe »Irresistible«, »Albion«, »Vengeance«, »Goliath« und »Implacable«. Noch weiter achteraus dampften 2 Cruisers I. Klasse: die Panzerkreuzer »Shannon« und »Northampton«. Hinter diesen die geschützten Kreuzer »Argonaute«, »Highflyer« und »Pioneer«.
10 HochseeSchlachtschiffe, mit denen nicht zu spaßen war. Armiert vom Kielschwein bis zum Großtopp. Mit 125 000 Pferdekräften die glasgrünen, schaumgeköpften Wellenkämme durchschneidend, mit 391 Geschützen den Feind bedrohend.
Voraus dem Flaggschiff sah Sellery die Torpedoflottille. 6 Fahrzeuge, die dem Kommando des Kapitäns Mackintosh unterstanden. Letzterer hatte die Order erhalten, bei Sichtung des Amerikaners unverzüglich zum Flaggschiff zurückzukehren.
Die Turbinen des »Duke of Edinburgh« arbeiteten unter Volldampf. Die Maschinen stöhnten und ächzten bei der Parforceleistung, die ihnen auferlegt war. Dazu der donnernde Anprall der hochgehenden Wogen an die Bordwände und das Brausen des Windes. Die Heizer sättigten die Feuerschlünde ihrer Kessel unausgesetzt mit Kohlen und die Obermaschinisten verstiegen sich auf die höchste zulässige Dampfspannung.
So schoß denn der »Duke of Edinburgh« mit einer Geschwindigkeit von 30 Knoten in der Dunkelheit der Nacht dahin und ihm folgte in gleich forciertem Tempo das Geschwader.
Zu Sellery gesellte sich jetzt der Navigationsoffizier vom Dienst Mr. Holbroke, ein schneidiger, baumlanger Mann, dessen Alter man auf Ende Dreißig taxieren konnte. Holbroke kam eben mit der Meldung zum Mars, daß der Barometer im Fallen sei.
»Herr Admiral! Melde 740 Barometerstand. Es wird eine schwere See geben.«
»Desto besser — dann entwischt er uns nicht ... hat 'ne verdammt straffe Fahrt, der Amerikaner.«
»Wir müßten ihn doch eigentlich schon überholt haben,« meinte Holbroke und lugte scharf aus.
»Acht Stunden Vorsprung — — hundert Knoten Vorgabe, da müssen Kessel und Maschinen schon stramm herhalten, lieber Holbroke.«
»Vielleicht hat er den Kurs geändert?«
»Das bezweifle ich. Er wird zum mindesten erst die hohe See gesucht haben. Na — es müßte mit dem Teufel zugehen, wenn wir ihn nicht zu Gesicht bekämen.«
»Daß sie den Kerl in London haben entwischen lassen, ist mir unbegreiflich,« sagte der Navigationsoffizier.
»Mir auch ...« brummte Mr. Sellery.
»Die Yankees haben eine verdammt gute Nase, daß sie die Leimrute gleich gefunden haben, auf der unser Goldvogel saß.«
»Sie werden sich nicht lange über ihren Fang freuen,« meinte der Admiral.
Bei dem immer mehr anschwellenden Wogengang fing das Flaggschiff jetzt zu schlingern an. Schon verschiedene Male waren kleine Sturzseen über Backbord gekommen und hatten ihren schmutzigen Gischt auf den Tauenden und Ankerketten zurückgelassen.
»Wenn's ärger wird,« sagte Sellery zu Holbroke, »ehe wir den Amerikaner gesichtet haben, kann es uns doch noch einen Strich durch die Rechnung machen ... Halt! sehen Sie dort hinten auch ein Lichtpünktchen?« Mit diesen Worten zeigte der Admiral nach Westnordwest und fuhr hastig mit dem Fernglas ans Auge.
Der Navigationsoffizier sondierte schnell mit bloßem Auge die angedeutete Gegend und nahm ebenfalls ein Lichtpünktchen am fernen Horizont wahr, das sich von dem tiefschwarzen Himmel und dem sich auftürmenden Gewölk für ein scharfes Auge bemerkbar abhob.
»Wir haben ihn — —« rief Sellery aus. »Ich wundere mich nur, daß der Lichtschein im Glase ein so merkwürdiges Aussehen hat und so hoch auf Topp sitzt.«
Holbroke nahm jetzt das ihm von dem Admiral gereichte Fernglas und prüfte nun seinerseits den bewußten Lichtpunkt.
»Zweifellos wird es der Amerikaner sein,« sagte er. »Und das Licht so hoch auf Topp wird sicherlich Elmsfeuer sein.«
»Dann kann die Kiste aber nicht weit von uns schwimmen,« meinte Sellery und suchte mit Hilfe seines Glases aus der dichten Finsternis die Umrisse des Fahrzeuges herauszuschälen.
»Sollte Mr. Mackintosh das Licht noch nicht gesichtet haben?« meinte der Admiral nach einer kleinen Weile und richtete das Glas auf das Kommandoschiff der Torpedobootsflottille. »Aha! Mackintosh kommt zurück. Jetzt steht es außer Zweifel, daß wir ihn gefunden haben.«
Ehe noch das Torpedoboot das Flaggschiff erreicht hatte, gab man die Befehle des Admirals durch Lichtsignale an das Geschwader weiter. Die Ordre für die Kommandeure lautete dahin, daß der Amerikaner umzingelt werden sollte.
Doch was war das.
In weniger als einer Minute tauchten in der Umgebung des Amerikaners eine Anzahl Lichtpunkte auf.
»Zum Teufel.« rief der Admiral, wahrend er sein Glas bald hier, bald dorthin richtete. »Voraus wimmelt es ja von Schiffen!«
»Wenn die Amerikaner eine Schutzflotte bei sich hätten ...« warf hastig Holbroke ein, indem er mit leichtem Schrecken die Lichtpunkte sich mehren sah.
Sellery erließ sofort neue Befehle. Der »Duke of Edinburgh« mußte stoppen.
Der Admiral versammelte seine Offiziere um sich und beriet mit ihnen, weil man seiner Ansicht nach jetzt auf ein amerikanisches Geschwader stoßen würde. Die Aufregung an Bord war groß. Daß es zu einem offenen Kampf kommen mußte, stand außer Zweifel, und wer als Sieger hervorgehen würde, das vermochte noch niemand zu sagen. Auf alle Fälle war man gezwungen, jetzt die Offensive zu ergreifen. Inzwischen war das Torpedokanonenboot herangekommen und legte nun steuerbordseits an.
Sellery begab sich eilends auf das Fallreep, um von Mackintosh das Resultat seiner Beobachtungen zu erfahren.
Die Wogen des Meeres schossen mehr als einmal zum Fallreep hinauf, so daß der Admiral bis auf die Haut durchnäßt wurde und sich den schaumigen Gischt aus den Augen wischen mußte.
»Melde, daß wir sechs Kriegsschiffe gesichtet haben,« stattete Kapitän Mackintosh, am Backbordgeländer stehend, Rapport ab.
»Amerikaner ... nicht wahr?«
»Meiner Überzeugung nach müssen es Unionsschiffe sein.«
»Und meiner nach auch,« replizierte Sellery. »Das Geschwader deckt dem Handelsdampfer den Rücken ... wie?«
»Er scheint nach meiner Schätzung kaum einen Knoten weiter voraus zu sein.«
»Lassen Sie die Flottille umkehren und erwarten Sie meine weiteren Befehle.«
Mackintosh salutierte, und Sellery stieg die Fallreeptreppe eilig wieder hinauf.
Das Torpedoboot machte sodann wieder Dampf auf und fuhr westwärts. Inzwischen waren die Schiffe des englischen Geschwaders mit halber Geschwindigkeit in die Nähe ihres Flaggschiffes gekommen und stoppten nun sämtlich.
Die Amerikaner gaben unterdessen Fersengeld. Sie schienen nicht sonderlich Lust zu verspüren, sich mit den Engländern, die ihnen fast ums doppelte an Schiffen überlegen waren, einzulassen. Ihre Lichter verloren sich mehr und mehr in der Ferne.
Der Sturm hatte an Kraft zugenommen und peitschte jetzt das Meer, so daß die Sturzseen an Bord der Schiffe sich fortgesetzt mehrten und die Mannschaften manchmal in Gefahr brachten. Unbeachtet der schweren See blieben die Offiziere um ihren Admiral versammelt, das eiserne Kommandowort zwang sie, den entfesselten Elementen zu trotzen.
Für die Kommandeure der Geschwaderschiffe mochte die Beratungspause eine Zeit banger Erwartung sein, sie waren zu wenig orientiert darüber, was bevorstand.
»Volldampf voraus!« signalisierte plötzlich das Flaggschiff.
Pustend und stöhnend setzten sich die Maschinen wieder in Bewegung, die gewaltigen Schrauben fingen an zu arbeiten und die eisernen Kolosse nahmen die Fahrt im alten Kurse wieder auf. Die mächtigen Scheinwerfer traten in Aktion und erhellten die kochende See weithin.
Das Geschwader ging zum Angriff vor. Die in den Annalen der Marine ewig denkwürdig bleiben sollende »Jagd auf dem Ozean« nahm ihren Anfang.
»Jetzt geht die Geschichte los ....« hörte man Mr. Pemperton, den Kapitän des amerikanischen Handelsdampfers, zu seinem ersten Offizier sprechen, als vom englischen Geschwader herüber der erste Kanonenschuß vernehmbar wurde.
»Unsere Mariner werden es den verdammten Englishmen schon zeigen, daß die amerikanischen Schiffe nicht von Pappe sind und unsere Kanonen auch eindringlich zu reden verstehen,« gab der Angeredete zur Antwort und hob sein Fernglas an die Augen, um die Bewegungen des Feindes zu beobachten. »Sechs gegen zehn — — wenig Chancen, Kapitän.«
»Es ist jetzt die Hauptsache, daß wir uns schleunigst aus dem Staube machen. Solange wir unsere Flotte noch in Rückendeckung haben, brauchen wir nichts zu befürchten. Wir müssen unseren kostbaren Passagier nach Amerika hinüberbringen, mag es kosten was es wolle. Die Engländer werden es natürlich vor allem auf unseren wehrlosen Kasten abgesehen haben.«
»Ehe sie die Kette unseres Geschwaders durchbrechen, können wir schon einen so bedeutenden Vorsprung haben, daß sie uns nicht wieder einzuholen vermögen,« versetzte der Seeoffizier. »Admiral Seymour wird auch seinen Mann stellen. — — — Sehen Sie nur, Kapitän, wie unsere Panzer sich für die Defensive schnell formiert haben.«
Pemperton blickte durch sein Glas und nickte. Dann sagte er, indem er sich eiligst unter Deck begab: »Wir müssen mit der höchsten Dampfspannung fahren. Die Heizer sollen tüchtig auf die Roste schütten.«
Unten im Maschinenraum herrschte eine rege Tätigkeit. Die Türen der Feuerroste standen offen, und schaufelweise flogen die Kohlen in den unersättlichen Schlund, um darin eine immer größere Glut anzufachen. Der Ingenieur vom Dienst überwachte persönlich die außergewöhnliche Inanspruchnahme der Maschinen und Kessel, prüfte von Minute zu Minute den Manometerstand und ließ fortgesetzt durch die Kohlentrimmer neues Brennmaterial herbeischaffen. Die Heizer durften die Schaufel nicht aus den Händen legen.
»Wir werden mit Kohlen nicht schnell genug auf die Dampfspannung kommen, deren wir bedürfen,« sagte der Kapitän zu dem Ingenieur. »Lassen Sie aus der Vorratskammer allen Speck und Schinken, der vorhanden ist, herunterholen, und dann hinein damit auf die Roste. Auch alles Holz, was an Bord überflüssig ist, soll mit zum Feuern verwendet werden.«
Der Ingenieur eilte davon, um dem Befehl des Kommandanten nachzukommen.
Wenige Minuten später schon wanderten prächtige Speckseiten und lieblich duftende Schinken, vereint mit altem Holzwerk, geteerten Tauenden und anderen leicht brennbaren Stoffen, in die vier einen glühenden Atem ausstoßenden Feuerschlünde.
»Wann war die letzte Kesselrevision?« frug der Kapitän den Ingenieur.
»Vor acht Wochen, als wir im Dock lagen,« lautete die Antwort.
»Ist aller Kesselstein entfernt worden!«
»All right!«
»Sagten Sie nicht kürzlich, daß die Dampfleitung stellenweise einer Erneuerung bedarf?« frug der Kapitän weiter.
»Ja, es sind manche fehlerhafte Platten vorhanden. Trotzdem aber glaube ich, daß die Rohre einen vorübergehenden Überdruck schon aushalten werden.«
»Wie steht es mit den Sicherheitsventilen? Eine Federbelastung wurde mir gestern erst als defekt gemeldet.«
»Ist bereits repariert, Kapitän.«
»Wir müssen Kessel und Maschinen in höchsten Anspruch nehmen, und ich hoffe, daß wir der Gefahr einer Explosion entgehen.«
»Die übermäßige Dampfspannung ist an und für sich nicht gefährlich. Sie führt nur dann zu einer Explosion, wenn der Kessel gleichzeitig von innen und von außen Erschütterungen erfährt.«
»In dieser Hinsicht laufen wir aber gerade jetzt bei der hohen See Gefahr. Das Schlingern des Schiffes ist heute besonders stark.«
»Das fürchte ich weniger. Es könnte höchstens eine Korrosion der inneren Kesselwände Gefahr bringen.«
»Hat man bei der Revision solche Stellen entdeckt?« frug der Kapitän mit besorgter Stimme.
»Leider ja. Unsere ›Maryland‹ ist ein alter Kasten und ihre Maschinen haben schon manches Jährchen Arbeit getan, aber trotzdem sind die Defekte nicht so von Bedeutung, daß ich ein Zerreißen der Platten befürchte.«
Der Kapitän fühlte sich etwas beruhigt und begab sich nun wieder an Deck. — — —
In einer engen Kabine, unmittelbar neben der Offiziersmesse, stand eine bucklige Gestalt. Sich an der Wand festhaltend, lugte sie durch die verschlossene Luke aufs offene Meer hinaus.
Es war Wassilowitsch, welcher durch das heftige Schlingern des Schiffes und das heraufdringende Stampfen der Schiffsmaschinen in seiner Nachtruhe gestört worden war.
Ein Schuß krachte, es war das Zeichen des beginnenden Kampfes zwischen zwei Großmächten.
Der Bucklige lachte auf und murmelte vor sich hin. »Wie sie sich um mich in den Haaren liegen — —«
Wassilowitsch war dem freien Amerikanismus weit mehr geneigt als dem britischen Imperialismus. Aus diesem Grunde wünschte er auch, daß die Unionsflotte gegen das englische Geschwader siegreich bleibe. Drüben auf dem neuen Kontinent winkten ihm Reichtümer, Macht und Ehren, so wie er es sich gewünscht. Der amerikanische Gesandte hatte ihm alle Garantien dafür geboten und ihn so zur Flucht bei Nacht und Nebel bewogen. Mit Garantien, welche Regierungen zu geben vermögen, ist es aber immer so ein eigenes Ding, denn Volkswille ist wandelbar. Immerhin aber hatte Wassilowitsch zu den Republikanern über der »großen Pfütze« mehr Vertrauen als zu den Englishmen. Boten diese ihm einen indischen Thron an, so warteten ihm die Yankees mit dem Präsidentenstuhl auf.
Die Amerikaner hatten sich die Entführung Wassilowitschs aus London ein erkleckliches Sümmchen kosten lassen. Die Milliardäre des Riesenreiches, welche am meisten für ihre Existenz fürchteten, hatten nämlich der Regierung in Washington nicht weniger als zehn Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, damit der gefährliche Goldmacher den Händen der Engländer entrissen werden sollte.
Zehn Millionen Dollar, das war ein Sümmchen, welches auch die pflichttreuesten Menschen bestach. Über Nacht waren somit plötzlich eine kleine Zahl Männer, die berufenen Hüter Wassilowitschs in London, zu Millionären geworden. Der amerikanische Gesandte war bei der Entführung des Adepten mit klingender Münze nicht karg gewesen.
Daß durch die horrenden Bestechungen der Raubzug Amerikas gelingen mußte, stand für die Beteiligten außer Zweifel. Mr. Dudley und Mr. Sethman waren gegen drei Millionen auch nicht unempfindlich gewesen. Jeder von ihnen brauchte für dieses Sümmchen nur eine Nacht die Augen einmal fest zuzudrücken.
Wassilowitsch selbst für Amerika zu gewinnen, fiel dem Gesandten nicht schwer, und einen Weg zur Flucht für ihn zu finden bereitete auch keine allzugroßen Schwierigkeiten.
Der Portier des Carltonklubs schlief in jener Nacht besonders fest. Schuld daran waren zwanzigtausend Pfund in Banknoten.
So fischten die Amerikaner in Englands Wassern und angelten den Goldkarpfen, den John Bull um keinen Preis der Welt freiwillig hergegeben hätte. Von London bis Newport hatte der Gesandte des mächtigen Dollarstaates so viel Geld gestreut, daß man mit den Banknoten einen großen Palast hätte austapezieren können.
So geriet Wassilowitsch aus den Händen der Englishmen in die der Amerikaner.
Ein zweiter Kanonenschuß und gleich darauf ein dritter dröhnte soeben bis zu den Ohren des zukünftigen Herrschers von Amerika. Gern wäre Wassilowitsch zum Deck hinaufgegangen und hätte sich das nächtliche Schauspiel angesehen, aber er hatte dem Kapitän sein Ehrenwort gegeben, bis zur Ankunft in New York die Kabine nicht zu verlassen.
So oft er auch Blicke durch die Luke aufs offene Meer hinauswarf, vermochte er des hohen Seeganges wegen nichts von den Vorgängen draußen zu sehen. Er hatte Mühe, sich überhaupt festzuhalten, denn manchmal hatte es den Anschein, als wenn sich seine Kabine auf den Kopf stellen wollte. Mit lautem Klatschen schlugen die Wogen bis an das Lukenfenster hinauf, und der Sturm heulte in allen Tonarten. Bald tanzte die »Maryland« wie eine Nußschale auf dem schaumgekrönten Rückgrat eines Wellenkammes, bald sank sie in eine schlundartige Tiefe hinab, und mehrmals berührten die Mastspitzen das zornige Meer. Daß unter solchen Umständen ein Aufenthalt in der Kabine immer noch zu dem Erträglicheren gehörte, das verhehlte sich Wassilowitsch nicht, wenn er auch bald in die eine, bald in die andere Ecke geschleudert wurde.
Schon machten sich bei ihm die Zeichen der beginnen Seekrankheit bemerkbar, und es dauerte nicht lange, so war er so malade, daß er sich den Teufel um die Vorgänge draußen kümmerte.
Inzwischen vergrößerte sich die Entfernung der »Maryland« mehr und mehr von der Schutzflotte. Die Schinken und Speckseiten hatten eine Feuerlohe entfacht, die die Siederöhren der Kessel fast zum Schmelzen brachte.
Der Manometer zeigte bereits sieben Atmosphären Druck. Noch eine Ziffer weiter, und der kritische Punkt der Dampfspannung war erreicht. Der Punkt, welcher jeden Augenblick eine verderbenbringende Explosion herbeiführen konnte.
Kapitän und Ingenieur kamen von Viertelstunde zu Viertelstunde zusammen, um das Resultat der Fahrgeschwindigkeit zu besprechen.
»Wir laufen jetzt mit zweiundzwanzig Knoten,« meinte Pemperton.
»Die Roste werden durchbrennen,« versetzte der Ingenieur.
»Und wenn sie in tausend Stücke gehen,« sagte der Kapitän. »Wenn nur die Kessel und Rohre nicht platzen.«
Der Ingenieur zog die Stirne in Falten. Er schien doch wohl nicht so viel Vertrauen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der alten Kessel zu haben. Freilich war man noch eine Atmosphäre unter dem kritischen Punkt, aber die bereits erreichte hohe Spannung konnte immerhin schon gewisse Bedenken erregen.
»Haben wir die Höchstspannung erreicht?« frug der Kapitän.
»Wollen wir es bis auf die Spitze treiben?« frug der Ingenieur mit bedenklicher Miene zurück.
»Sie haben kein Vertrauen ... die Revision war aber doch befriedigend?«
»Für gewöhnliche Spannung ja, aber für eine Parforcetour wohl kaum.«
»Hm ...«
»Wir haben noch eine Atmosphäre zuzusetzen, dann ist aber Schluß.«
»Das hieße also soviel, wie unsere Seelen dem Teufel verschreiben — — — hm — hm ...«
»Die englischen Turbinen können jetzt noch immer einen Rekord mit uns aushalten.«
»Grund genug für uns, danach zu trachten, einen noch größeren Vorsprung zu gewinnen,« erwiderte Pemperton.
Der Donner der Geschütze drang eben wieder deutlich vernehmbar an die Ohren der beiden Männer. Aus der raschen Aufeinanderfolge der Schüsse konnten sie den Schluß ziehen, daß der Kampf in eine Phase besonderer Heftigkeit getreten war.
»Wenn es unseren Marinern gelingt, die Engländer noch zehn bis zwölf Stunden in Schach zu halten, so sind wir gerettet,« meinte der Kapitän.
»Notabene, wenn uns nicht inzwischen die Kessel an die Köpfe fliegen,« fügte der Ingenieur trocken hinzu. In seiner Stimme lag aber ein so tiefer Ernst, daß Mr. Pemperton erschrak.
»Steigern Sie den Überdruck nicht noch mehr,« sagte er zu dem Ingenieur. »Ich denke, daß wir auch mit der jetzigen Geschwindigkeit entwischen können.«
Der Kapitän begab sich nun wieder an Deck, während der Ingenieur in den Heizraum hinabstieg, um der tollen Feuerung ein wenig Einhalt zu tun.
Hier unten konnte es ängstlichen Gemütern, die einmal etwas von der verheerenden Wirkung platzender Dampfkessel gehört hatten, wirklich recht beklommen werden, denn aus allen Ecken vernahm man ein unheimliches Zischen und Brausen. Die Rohrleitungen, durch die der hochgespannte Dampf schoß, um zu den Zylindern der Expansionsmaschinen zu gelangen, knackten zuweilen so seltsam, daß man jeden Augenblick eine Katastrophe befürchtete. Dazu herrschte eine unerträgliche Hitze, denn die Feuerschlünde spieen, da sie fortgesetzt offen gehalten wurden, eine höllische Glut aus, gegen die die heißeste Saharatemperatur mild genannt werden mußte.
Die braunen Gestalten der Heizer standen mit völlig entblößtem Oberkörper in Schweiß gebadet auf ihren Posten, bald die Schaufel, bald den Schürhaken gebrauchend. Beim gespenstischen Schein der Feuer sahen die Männer wie Zyklopen aus. Verwundert schüttelten sie die Köpfe, weshalb eigentlich eine solche übermäßige Inanspruchnahme der Maschinen angeordnet war. Ihnen war die Mission, mit welcher ihr Kapitän betraut gewesen, nicht bekannt. Sie ahnten nicht, daß das Schiff, welches sie trug, einen Passagier an Bord hatte, der das Schicksal der gesamten Kulturwelt verkörperte. Wohl hatten auch sie von dem »Goldmacher« gehört, und auch davon, daß sich nun bald große soziale Umwälzungen und politische Machtverschiebungen abspielen würden.
Kapitän Pemperton war mit versiegelter Order in See gegangen, und erst vierundzwanzig Stunden nach ostwärts genommenem Kurs und scharfer Fahrt durfte er die Order öffnen, worin ihm der Auftrag zuteil wurde, unter dem Schutze des ihm unmittelbar folgenden Geschwaders Wassilowitsch in Newport von dem amerikanischen Gesandten in Empfang zu nehmen. Außer den Offizieren durfte es an Bord niemand wissen, wer der übernommene Passagier war. Als die Schiffsbesatzung aber die im Gefolge der »Maryland« dampfenden Panzerkreuzer sah und die heimlichen Vorbereitungen in Newport beobachtete, flüsterte man sich untereinander zu, daß etwas Außergewöhnliches los sei. Die Maats, Matrosen und anderen Mannschaften zerbrachen sich die Köpfe, was es mit dem an Bord genommenen Passagier eigentlich für eine Bewandtnis habe, aber keiner vermochte das Rätsel zu lösen. Die einen sahen in Wassilowitsch einen Hochstapler, die anderen einen verkappten Fürsten, wenngleich man, was letzteres anbetraf, nie etwas von einem buckligen Herzog oder Prinzen gehört hatte. Daß es eine bedeutende Person war, verhehlten sich die Leute der »Maryland« nicht, denn der seltsame Passagier war äußerst devot und höflich von dem Kapitän in Empfang genommen worden. Da nun Pemperton, wie ihnen bekannt war, keineswegs katzendienerisch veranlagt war, so maßen sie dem Fremdling Reichtum und Macht zu.
Die Fahrt der »Maryand« ging in einem schnellen Tempo vor sich. Da der Sturm stark abgeflaut war, hatte sich die See allmählich wieder beruhigt. Längst waren ostwärts die Lichter der Geschwader nicht mehr sichtbar, und nur von Zeit zu Zeit vernahm das scharfe Ohr des Kapitäns den schwach herübertönenden Donner der Geschütze. Aber auch dieser war nach Verlauf einer weiteren Stunde nicht mehr vernehmbar. Mit Morgengrauen befand sich die »Maryland« bereits auf dem 20. westlichen Längengrad und dem 47. Breitengrad von Greenwich aus gerechnet. Der Kurs wurde auch weiterhin auf Südwest eingehalten.
Als die ersten Sonnenstrahlen über dem Wasserspiegel spielten und Pemperton mit seinem Fernglas im gefahrbringenden Osten nichts Beunruhigendes wahrnehmen konnte, da wagte er es, nach einer langen, aufregenden Nachtwache sich einige Stunden dem Schlafe hinzugeben.
Der erste Offizier übernahm das Kommando und ließ, getreulich den Einschärfungen des Kapitäns, den Osthorizont nicht außer acht.
Wassilowitsch hatte für den Rest der Nacht wohl noch Schlummer gefunden, befand sich aber durch die Seekrankheit in einem ziemlich jämmerlichen Zustand. Wohl hatte die Technik längst den großen Ozeandampfern jene Schiffskreisel eingebaut, die die rollenden Bewegungen, durch welche zumeist die Seekrankheit entsteht, aufzuheben imstande sind. Aber die »Maryland« gehörte noch zum alten Typus, besaß sie doch nicht einmal Turbinen und behalf sich mit den veralteten, kraftspendenden Zylindermaschinen.
Nicht nur daß Wassilowitsch von der Seekrankheit so mitgenommen wurde, es gestaltete sich auch sonst die Fahrt über den Ozean für ihn äußerst langweilig, da er seine Kabine nicht verlassen, und niemand, auch der Kapitän nicht, Gespräche mit ihm pflegen durfte. Über das Glücken oder Nichtglücken der Flucht über das »Große Wasser« blieb er also völlig im Unklaren. Anscheinend mußte sie geraten, denn er sah die »Maryland« unbehelligt ihrem Ziele zudampfen. Daß das aber eine Täuschung war, das sollte Wassilowitsch bald erfahren.
Einige hundert Kilometer zurück spielte sich auf dem nassen Element ein verzweifelter Kampf ab. John Bull und Jonathan rangen mit verzweifelten Kräften um die Siegespalme.
Sechs Schlachtschiffe gegen Zehn!
Da gab es auf amerikanischer Seite genügend zersplitterte Gefechtsmasten, durchgeschlagene Panzerplatten und sonstige Verheerungen an den Schiffskörpern. Noch aber hatte es kein englisches Geschoß vermocht, dem einen oder anderen Panzerschiffe das Lebenslicht auszublasen. Noch bildeten diese die geschlossene Kette, welche die Engländer am Durchbrechen und an der Verfolgung der »Maryland« hinderte.
Drüben mochte Mr. Sellery wohl wettern und fluchen, aber der zähe Feind hielt stand, und dem Goldvogel mußte es darum gelingen unbehelligt Amerikas Gestade zu erreichen.
Der »Washington«, der »Grant«, der »Hudson«, und die »Florida« bildeten die amerikanische Schlachtlinie, die sich nur auf die Defensive beschränkte. Während der »Indianopolis« und die »Susquehana« seitlich stark ausgeschwärmt waren, um den Feind auch links und rechts zu beschäftigen.
So gingen Stunden des bittersten Kampfes dahin, und noch war für die Engländer keine Aussicht vorhanden, den Gegner zu schlagen und der kostbaren Beute nachzujagen.
Admiral Seymour war Stratege genug, um durch langsames Zurückweichen mit seinem Geschwader dieses vor großen Verlusten zu schützen. Vor allem aber kam es ihm darauf an, der »Maryland« hinreichend Zeit zu verschaffen, damit diese einen Vorsprung gewänne, der den Engländern einen dicken Strich durch die Rechnung machen mußte.
Gegen Mittag endlich erlitten die Amerikaner eine Schlappe. Der »Grant« verlor durch einen wohlgezielten Schuß das Steuer und trieb nun, Gefahr für die Schwesterschiffe des Geschwaders bringend, hilflos, ein Spielball der Wellen, auf dem Meere umher.
Nun hielt es Sellery an der Zeit Seymour so hart auf den Leib zu rücken, daß dieser mit seinen Schiffen schnell zu entrinnen sich genötigt sah.
Noch eine Schlappe erhielten die Yankees. Den »Indianopolis« traf ein Kernschuß unter der Wasserlinie, der einige Längs- und Querschotten mittschiffs durchschlug, so daß sich der stolze Panzer bedenklich auf die Seite legte und kampfunfähig wurde.
Jetzt ging Sellery mit Volldampf vor, der feindlichen Geschosse nicht achtend, die auch auf seinen Schiffen beträchtlichen Schaden anrichteten.
Zehn Minuten später fuhren die Engländer mit »Hurra« durch die gesprengte Schlachtlinie ihrer Feinde, und Seymours Geschwader räumte das Feld.
Die Amerikaner zogen es jetzt vor lieber Fersengeld zu geben, als daß sie ihre Schiffe sich kapern oder in den Grund bohren ließen.
Kurz darauf fand auf dem atlantischen Ozean eine Hetzjagd statt, wie sie die Geschichte noch nicht zu verzeichnen gehabt hat.
Englands Kanalgeschwader verfolgte geschlossen den Feind, und die Torpedoflottille mußte seitlich die amerikanischen Panzerschiffe überholen, um dem inzwischen entwischten Handelsdampfer nachzusetzen.
In den kleinen Torpedobooten wurde darum gehörig Dampf aufgemacht. Wie die Pfeile schossen sie durch die glasgrüne Flut dahin und hatten schon nach Verlauf einer Stunde die flüchtenden Amerikaner seitwärts überholt. Sobald sie sich außer Schußweite der letzteren fanden, schwärmten die Boote der Flottille auseinander.
Kurz darauf passierte es, daß eines der Boote durch Kesselexplosion aus der Reihe der Flottille ausschied.
Ein memento mori für die anderen!
Die »Maryland« hatte einen so großen Vorsprung gewonnen, daß ein Einholen seitens der flinken Torpedoboote erst angesichts des amerikanischen Gestades zur Möglichkeit wurde.
Der alte Kasten, wie Pemperton sein Schiff zu nennen pflegte, war doch nicht von der schlechtesten Sorte, denn sonst wäre er bei der wahnwitzigen Dampfspannung längst in die Luft geflogen.
So waren seit dem Nachtgefecht bereits vier Tage vergangen, und noch zeigte sich kein Rauchwölkchen am östlichen Horizont, das die Annäherung der Verfolger verriet.
»Ich setze hunderttausend Dollar gegen einen,« sagte der erste Offizier der »Maryland« zu dem Ingenieur, »daß England das Nachsehen haben wird.«
»Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben,« erwiderte der andere. »Wetten Sie nicht, wo Sie noch gar nicht wissen, welchen Possen unsere geflickten Kessel uns noch spielen können.«
»Na, wir fahren doch nun schon hundertfünfzig Stunden mit Volldampf. Glauben Sie wirklich immer noch, daß eine Katastrophe eintreten kann ?«
»Ich stehe für nichts,« versetzte der Ingenieur. »Ich kann nur soviel sagen, daß wir hier auf einem Pulverfaß sitzen.«
Der Ingenieur als Fachmann mußte es ja wissen, und darum nahm der Offizier die Antwort auch nicht auf die leichte Schulter.
In diesem Augenblick wurde dem wachthabenden Offizier durch den Steuermannsmaat gemeldet, daß vom Ausguck im Kielwasser des Schiffes ein Dampfboot gesichtet worden sei.
Hastig eilte der Offizier auf das Verdeck und nahm sein Fernglas zur Hand. Er erschrak nicht wenig, als er in dem Fahrzeug am fernen Horizont ein englisches Torpedoboot zu erkennen glaubte. Eine geraume Zeit hindurch beobachtete er den Kurs des gesichteten Schiffes und als er dann Klarheit bekommen hatte, ließ er sofort dem Kapitän Mitteilung machen.
Pemperton wurde durch die Ordonnanz im Schlafe gestört. Er kleidete sich rasch an, als er von der Botschaft des Wachthabenden Kenntnis genommen hatte.
Schon wenige Minuten später stand er an Deck und nahm den Verfolger im Osten mit seinem Binocle aufs Korn.
»Teufel! Sie haben recht. Es ist nur ein Glück, daß wir so nahe am Ziele sind. Wir müssen heute noch die Küste zu Gesicht bekommen.«
»Ich schätze, daß er uns in zwei bis drei Stunden eingeholt hat.«
»Wenn nicht er, so aber doch sein Torpedo.«
»Ich bezweifle,« wagte der Offizier einzuwerfen, »daß die Engländer uns mit einem Torpedo anschießen werden, dadurch könnten sie ja alle Chancen verlieren, Wassilowitsch wieder in ihre Hände zu bekommen.«
»Freilich, wenn die ›Maryland‹ in die Luft fliegt, so vermag sich keine Maus zu retten.«
»Sie werden uns drohen, aber sich hüten, ihre Torpedos loszulassen.«
»Den Drohungen können wir ja bequem spotten, und ein Entern ist einfach ein Nonsens.«
In Anbetracht dessen war also die nahende Gefahr gar nicht so von Bedeutung. Ja, wenn eines der Panzerschiffe ihnen jetzt auf den Leib gerückt wäre, da würde man den Kürzeren gezogen haben.
Pustend und fauchend kam das Torpedoboot nach Verlauf einer halben Stunde bis auf Rufweite an die »Maryland« heran.
Pemperton tat als wenn er sich um den Verfolger gar nicht kümmerte, so drohend derselbe auch manöverierte, indem der englische Kommandant eins der Lanzierrohre auf die »Maryland« richten und angesichts der Amerikaner dasselbe mit einem Torpedo laden ließ.
»Teufel! sie schießen doch,« rief Pemperton und verfolgte die Manipulationen des Feindes mit seinem Fernglas.
»Sie werden nicht schießen,« versetzte der erste Offizier, und die Bestimmtheit, mit der er dies aussprach, ließ darauf schließen, daß er das ganze für ein Scheinmanöver hielt.
»Und sie schießen doch,« wiederholte Pemperton und biß sich auf die Lippen.
»Meinen Kopf zum Pfande, daß sie es nicht wagen,« ließ sich wieder der Offizier vernehmen. »Ich wette, sie haben strengsten Befehl, unser Schiff zu schonen.«
Pemperton mochte wohl der Ansicht seines Offiziers wenig Wert beimessen, denn er eilte zum Steuermann, um diesem den Befehl zu erteilen, sofort einen Zickzackkurs einzuhalten. Dadurch glaubte er dem verderbenbringenden Torpedo aus dem Wege zu gehen.
In seiner Ansicht sollte aber der Offizier, zum Glück für die wehrlose »Maryland«, recht behalten; der Torpedo blieb unabgeschossen im Lauf des Lanzierrohres. Aber nun zeigte sich eine noch bedrohlichere Seite. Am Horizont verrieten gekräuselte Rauchwölkchen das Nahen weiterer Torpedoboote.
Jetzt wurde die Situation kritisch. Wenn sich nicht bald das heimische Gestade zeigte, dann konnte es passieren, daß man noch am Ziele Fiasko erlitt.
Die »Maryland« setzte ihre tolle Fahrt fort, und das Torpedoboot suchte ihr wiederholt den Weg abzuschneiden, fortgesetzt mit seinem tückischen Geschoß drohend. Die Engländer machten die verzweifeltesten Anstrengungen, die »Maryland« zu überholen. Und es gelang ihnen auch. Aber da nahte die Nemesis für sie in Gestalt einiger amerikanischer Küstenpanzerschiffe, die ausgesandt waren, um der »Maryland« entgegenzufahren.
Die Engländer mochte ein panischer Schrecken ergriffen haben, als sie die schwarzen Kolosse so unerwartet kommen sahen. Noch waren nur die mächtigen Schlote sichtbar, aber bald vermochte man auch den Rumpf der ersten Kriegsschiffe zu erkennen.
Bums! krachte ein Schuß. Ein Torpedo fuhr mit Pfeilesschnelle ins Wasser, seinen Kurs auf die »Maryland« zu nehmend. Der Donner eines zweiten und dritten Schusses erzitterte in schneller Aufeinanderfolge die Luft.
Auf der »Maryland« schien man den Kopf verloren zu haben, denn Pemperton ließ plötzlich stoppen.
Sekunden vergingen ...
Dann ertönte ein furchtbares Getöse. Die Wellen um die »Maryland« bäumten sich haushoch auf, Schiffstrümmer flogen in die Luft, und ein dichter Nebel hüllte alles bis zur Unkenntlichkeit ein.
Die »Maryland« fand ihr Grab in den Fluten der heimischen Gewässer ... die Torpedos hatten sie in Stücke gerissen.
In riesengroßen Lettern stand's auf den Affichen der Litfaßsäulen New Yorks:
»Mit Mann und Maus von englischen Torpedos in den Grund gebohrt ist heute der von der Regierung in geheimer Mission nach England entsandte Handelsdampfer ›Maryland‹ der Great American-Linie. Sicherem Vernehmen nach soll sich auf dem Schiffe Wassilowitsch, der russische Adept, befunden haben. Bestätigt sich dies, so ist die Welt wohl von dem Alb befreit, der seit der Lösung des Goldproblems mit ungeheurem Druck auf ihr lastete, denn zweifellos ist Wassilowitsch beim Untergang ertrunken. Englands Angriff´wird aber unsererseits nicht ungestraft bleiben. Es sind bereits die diplomatischen Beziehungen mit London abgebrochen, und der englische Gesandte Mr. Reed hat sich an Bord des vor wenigen Stunden in See gegangen Dampfers ›India‹ begeben. Es steht zu vermuten, daß unsere Regierung heute noch mobil macht. Eine offizielle Kriegserklärung an England werden alle Bürger der Vereinigten Staaten von Nord- und Südamerika gutheißen. Präsident Harrison hat den Kongreß zu einer Nachtsitzung sofort nach Bekanntwerden des englischen Angriffs einberufen. Weiteres bringen wir noch in der Abendausgabe.«
Diese Nachricht rief in New York eine Aufregung hervor, die Handel und Wandel sofort stocken machte. Auf den Hauptstraßen der Weltstadt pulsierte das Leben besonders stark. Schwarze Menschenfluten umlagerten die Offices der großen Tageszeitungen »New York Herald«, »Times«, »Tribune«, »World« und das Gebäude der »Western Union Telegraph Company«. Die Zeitungspaläste mußten vor dem gewaltigen Andrang ihre Pforten geschlossen halten. Ganz New York harrte mit fieberhafter Ungeduld auf weitere Nachrichten. In den Zeitungsofficien stand alles bereit, der millionenköpfigen Menge neueinlaufende Depeschen kundzugeben. Deshalb herrschte auch am Broadway, am Park Row, in City Hall bis zum Pulitzer Building und der 35. Straße das größte Gedränge. Stundenlang standen hier die Menschen wie lebende Mauern und mancher Unglücksfall ereignete sich. Noch immer kamen neue Scharen Menschen von Brooklyn, Hoboken und anderen Vororten New Yorks über die gewaltigen Brücken geströmt, um sich in das Innere der Stadt zu ergießen.
Eben eröffnete der »World« eine neue Depesche in gigantischen Lettern vor den Fenstern des ersten Stockwerkes seines turmgekrönten Zeitungspalastes im Pulitzer Building.
Die erregte Menge bekam folgendes zu lesen:
»Präsident Harrison wird noch heute mittels Kabeldepesche England den Krieg erklären. Die Mobilmachungsorder ist jeden Augenblick zu erwarten.«
Auch der »New York Herald« hatte den seine Office umlagernden Menschenmassen Neues zu berichten:
»Soeben sind von den 6 entsandten Panzerschiffen unserer Flotte 4 in der Bay eingelaufen, und zwar der ›Hudson‹, ›Washington‹, ›Susquehana‹ und die ›Florida‹, während der ›Grant‹ und der ›Indianapolis‹ als verloren gelten müssen. Admiral Seymour ist unverzüglich nach Washington mittels Expreßsonderzuges abgereist.«
Nun trat auch die Zeitung »Evening Post« am Broadway mit einer aufsehenerregenden Nachricht an die New Yorker heran. Diese Office hatte nämlich sofort nach Bekanntwerden des Unterganges der »Maryland« einen ganzen Stab Berichterstatter auf gecharterten Steamerbooten in die Gewässer entsandt, in welchen die beiden Küstenpanzerschiffe mit der Rettung der Mannschaften der »Maryland« beschäftigt waren. Mittels drahtlosen Funkenspruchs hatten die pflichteifrigen Reporter ihrer Office berichtet, daß die Besatzung der »Maryand« mitsamt Wassilowitsch nicht zu retten gewesen sei und daß viele Leichen mit der Strömung ans Land getrieben waren. Eins der Zeitungsdampfboote suche daher die Küste aufs eifrigste ab, um vor allem Gewißheit zu erlangen, ob sich unter den angeschwemmten Ertrunkenen Wassilowitsch befände. Bis jetzt sei aber noch keine Spur von dem Gesuchten gefunden worden.
Die letzten Abendstunden desselben Tages brachten den amerikanischen Bürgern das Erwartete, nämlich die offizielle Kriegserklärung an den Erbfeind jenseits des Wassers. In Washington hatten die Hüter der Union beschlossen, den Verlust von zwei der besten Panzerschiffe nicht so ohne weiteres hingehen zu lassen, sondern die Engländer dafür gebührend zu züchtigen.
Drüben in England mochte man wohl triumphieren, daß der gefürchtete Mann aus der Welt geschieden, dessen Tun und Treiben in Amerika das große britische Reich zweifelsohne in Trümmer gelegt hätte.
»Goddam!« fluchte eine Baßstimme vor dem Schenktisch einer Taverne am Hafenkai Brooklyns. »Hunderttausend Dollar haben und nicht haben, macht einen Unterschied von zweihunderttausend Dollar.«
Der Sprecher dieser, eine tiefe Logik verratenden Worte, goß ein Glas Whisky mit einem Zuge hinunter und ein blatternarbiges Gesicht nahm darauf einen Ausdruck an, der die Häßlichkeit der Visage nur noch mehr erhöhte. Dieser Mann hieß Benjamin Brown, er selbst nannte sich kurz Ben. Dem Äußeren nach gehörte er der Gesellschaftsklasse an, deren Mitglieder sich aus weltstädtischen Gaunern und Verbrechern zusammensetzt. In den Augen dieses Gesellen lag ein unsteter Blick, und die schäbige Eleganz, mit der er gekleidet war, vervollständigte den Eindruck, wonach man sich vor solchen Individuen in acht zu nehmen hat.
»Ihr wollt die Belohnung für die Auffindung des Goldmachers schnappen?« versetzte mit höhnischem Ton der Wirt der Taverne.
»Was wißt Ihr davon,« knurrte der Blatternarbige, »welche Spur ich gefunden habe — — — gebt mir noch 'nen Whisky.«
Der Wirt goß das geleerte Glas wieder voll und schob es Ben hin. Dieser warf dafür drei Cents auf den Ladentisch und verleibte auch die zweite Ration seinem Inneren mit einem Zuge ein.
»Na, denn man gut Glück!« meinte der Wirt. »Wenn Ihr die Dollars habt, so wißt Ihr ja, wo Ihr sie in Whisky umsetzen könnt.«
Benjamin Brown brummte etwas Unverständliches und schlenderte zur Taverne hinaus.
»Sieh da, Ben!« wurde Brown plötzlich von einem buckligen Menschen angeredet und er fühlte sich gleichzeitig am Arm zurückgehalten.
»Was soll's? Laß mich, ich habe keine Zeit zu verlieren,« erwiderte Ben unwillig über die Begegnung und wollte unbeirrt seinen Weg weiter verfolgen.
»Wieder was auf dem Korn, alter Knabe?« frug der andere weiter und schritt unaufgefordert neben Ben her.
»Was schert's dich!« Mit diesen Worten ging der Antwortende schneller.
»Na, Bruder Ben, warum heute so verschlossen, ist's ein Geheimnis?«
»Zum Teufel! Muß ich dir denn immer Rede stehen?«
»Brüderlich, wie sich's gehört — du hast dir schon manche Suppe eingebrockt, die ich gemeinsam mit dir ausgegessen habe. Wir haben doch immer Halbpart gemacht?«
»Das habe ich aber jetzt satt,« erwiderte Ben ärgerlichen Tones.«
»Mit einem Male? Du hast dich in der kurzen Zeit deiner Abwesenheit recht verändert; scheinst aber doch kein Tugendstrick geworden zu sein,« spottete der Bucklige, indem er seinen Begleiter fortwährend angrinste.
»Ebensowenig wie du je einer gewesen bist — weißt du, José, daß du von uns beiden der größte Hallunke bist?«
»Sehr verbunden für die Schmeichelei — Herr Benjamin Brown.«
»Ja, du bist der größte Schuft, den die Sonne bescheint — aber nun laß mich in drei Teufels Namen in Ruhe, siehst du denn nicht, daß ich große Eile habe?«
Ben schritt jetzt noch hastiger als vorher weiter.
»Na, Ben, nun erzähle mal, was dich so zur Eile treibt. Es ist doch lächerlich, deinem alten Genossen das vorzuenthalten — ich werde dir gern behilflich sein, du hast mich ja sonst immer brauchen können. Du weißt, alter Freund, ich bin viel gewandter als du. Wäre ich nicht gewesen, so hingst du schon längst am Galgen.«
Ben blieb plötzlich stehen, ihm schien ein Einfall gekommen zu sein. »Komm mit!« sagte er zu seinem Begleiter, der seinem Äußeren nach tatsächlich nicht um einen Schatten besser zu sein schien als er selbst.
Unterwegs hatten die beiden Kumpane ein längeres Gespräch, Benjamin Brown mußte wohl zu der Erkenntnis gekommen sein, daß er sicherer und besser fahre, wenn er in der von ihm verfolgten Angelegenheit einen Helfershelfer habe. Deshalb wurde José von dem Blatternarbigen in sein Geheimnis gezogen.
Als die beiden sich an der EastRiverBrücke trennten, war zwischen ihnen eine feste Vereinbarung getroffen.
Ben setzte in José kein sonderlich festes Vertrauen, José desgleichen nicht in Ben; sie kannten sich eben beide zur Genüge. — —
Einige Tage später finden wir Ben in der Kleidung eines Schiffers in Josés Wohnung wieder.
Wohnung konnte man Josés Schlafraum eigentlich nicht nennen, letzterer glich eher einem Stalle. Außer einer am Boden liegenden Strohmatte, nebst einem alten Stuhl und einem noch älteren, wackligen Tische, auf dem eine brennende Tranlampe stand, war nichts zu sehen, was in einer Wohnung sonst anzutreffen ist; Fenster waren ebenfalls nicht vorhanden. In diesem jammervollen Raum kampierte Bens Freund. Hier fanden öfters zwischen den beiden Kumpanen merkwürdige Zusammenkünfte statt, die wohlweislich das Licht des Tages zu scheuen hatten.
Diesmal sollte ein Hauptcoup gemacht werden, wie sich Ben ausdrückte.
José schmunzelte; seine Gedanken wanderten von einer gefüllten Banknotentasche zu dem Genèvrewirt am Hafenkai.
Ben frug den Freund, ob man ihn in seiner Verkleidung wohl wiedererkennen wurde.
José schwur, daß dies unmöglich sei, nur solle Ben seine Augen im Zaume halten und nicht solche Gaunerblicke umherwerfen, wie er dies aus Gewohnheit an sich hätte.
Ben versetzte ihm auf diese hämische Bemerkung einen gewaltigen Rippenstoß, so daß José auf die Strohmatte flog. Fluchend erhob er sich wieder und meinte, daß der Puff nicht gerade nötig gewesen sei. Ben war ein kräftiger Mensch, der es mit jedem aufnahm, dies wußte sein Freund José sehr wohl, aber er konnte es doch nicht unterlassen, seinen Freund hin und wieder zu kränken, auch auf die Gefahr hin, einen kleinen Hieb Bens dafür zu ernten. Das alles tat aber ihrer Verbrüderung und ihren gemeinsamen Plänen keinen Abbruch.
»Hier, nimm das Bündel. Und nun wollen wir uns auf den Weg machen.« Mit diesen Worten reichte Ben seinem Gesinnungsgenossen ein verschnürtes Paket, das er mitgebracht hatte.
»All right!« José schob das besagte Bündel unter den Arm, stülpte sich eine fettglänzende Mütze über den struppigen Kopf und folgte Ben, der bereits durch die Tür geschritten war.
»Hunderttausend Dollar ist ein hübscher Batzen Geld,« meinte unterwegs José.
»Spielst du deine Rolle so, daß man Lunte wittert, so zerbreche ich dir alle Knochen einzeln im Leibe — — einzeln, verstehst du?«
»Goddam! ich bin immer ordentlich bei der Stange geblieben ... José hat noch keine Sache verpfuscht,« antwortete der Bucklige und suchte mit Ben gleichen Schritt zu halten.
»Du erhältst zwanzigtausend Dollar, sobald wir über die kanadische Grenze gelangt sind.«
»Weißt du, das ist doch eigentlich ein sehr unsicherer Kram für mich,« sagte José. »Hast du mal erst das Geld in der Klaue, so habe ich so sicher als zweimal zwei vier ist und nicht fünf, das Nachsehen.«
Der Sprecher erntete wieder einen passablen Rippenstoß.
»Ich verpfände dir mein Ehrenwort ...« sagte Ben in knurrigem Ton.
Der andere lachte. Er schien für Bens Ehrenwort ebensowenig zu geben, wie für einen faulen Apfel.
»Du steckst die Belohnung ein und ich brumme dafür,« versetzte José.
»Papperlapapp! In Montreal händige ich dir deinen Anteil aus.«
Die beiden Gauner einigten sich schließlich derart, daß José zufriedengestellt schien. Ihr Weg führte sie zu dem Grand Zentralbahnhof, in dessen Rieseneinfahrtshalle sie mit ziemlicher Eile verschwanden.
Im County Essex des nordamerikanischen Staates Massachusetts, nordöstlich von Boston, liegt die Seestadt Gloucester, der wichtigste Hafen längs der atlantischen Küste.
Hier in der Stadt der Kabeljaus und Makrelen ereignete es sich inmitten des Trubels, den die Mobilmachung zur Folge gehabt hatte, daß in der Nähe der Anlegestelle der Fischdampfer ein kleines Boot mit zwei Insassen den Strand erreichte. Da die Brandung des Wassers infolge des Ostwindes höher als gewöhnlich ging, fanden sich unter den Fischern hilfsbereite Leute, welche das ihnen fremde Fahrzeug völlig zu Lande brachten.
Erstaunt sahen die wettergebräunten Männer von der Waterkant in dem Boot einen mit einem Rettungsgürtel versehenen, vollständig erschöpften Menschen von wenig vertrauenerweckendem Äußeren liegen, während ein Mann mit durch Blatternarben entstelltem Gesicht sich um den den Fluten Entrissenen bemühte.
»Helft mir, Leute. Der Unglückliche muß sogleich ins Hospital gebracht werden,« sagte der Blatternarbige, in welchem wir Freund Ben wiedererkennen.
»All right!« erwiderte ein stämmiger, alter Fischer. »Was ist denn passiert?«
»Ich bin mit meinem Boot von Boston herüberverschlagen worden und unterwegs fischte ich den Mann aus den Wellen,« antwortete Ben.
Die Fischer warfen jetzt einen Blick auf den Rettungsgürtel und schüttelten die Köpfe. Es fiel ihnen auf, daß derselbe keine Aufschrift trug, wie solches für gewöhnlich der Fall ist; dagegen bemerkten sie einen schwarzgeteerten Fleck, auf welchem vorher ein Name gestanden haben mochte.
Da der Verunglückte aber jetzt ihre Hilfe und Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nahm, so schenkten sie dem Gürtel bald keine Beachtung mehr, sondern trugen den Erschöpften in ein nahegelegenes Haus.
Schnell sprach es sich noch an demselben Morgen in Gloucester herum, daß ein unbekannter Mann, den die Natur stiefmütterlich mit einem Buckel bedacht hätte, von einem Bostoner Schiffsverfrachter gerettet und in das Hospital eingeliefert worden sei.
Der Vorfall hätte an und für sich kein großes Aufsehen erregt, denn es kam des öfteren vor, daß Gestrandete geborgen wurden. Aber der Verunglückte behauptete, mit der »Maryland« untergegangen zu sein. Er sprach ein gutes Englisch, mußte aber doch der Nation einer andern Sprache angehören. Im übrigen verweigerte er jede Auskunft über sich und den Unfall der »Maryland«. Das kam den guten Bürgern von Gloucester natürlich verdächtig vor, und bald hatte es einer heraus, daß der fremde Mann im Hospital zweifellos der berühmte Goldmacher sei. Sein geheimnisvolles Schweigen und mißgestalteter Rücken mußten begründeten Anlaß hierzu gegeben haben.
Wassilowitsch in Gloucester!
Der Telegraph trug die Nachricht unverzüglich nach Washington, und eine Stunde später wußte es ganz Amerika, von Norden bis zum Süden, von Osten bis zum Westen. Aber auch der Name seines Retters, Benjamin Brown, machte die Runde durch die ganze Neue Welt.
In Washington herrschte darob wieder eitel Freude. Der Präsident Harrison mit seinem militärischen und diplomatischen Stab begab sich ohne jedes Versäumnis nach Gloucester, um Wassilowitsch mit allen Ehren in Empfang zu nehmen.
Unterdessen ging's in der obskuren Fischerstadt bunt genug zu. Die BostonMaineBahn, welche Gloucester berührt, brachte von Stunde zu Stunde Scharen von Menschen, die herbeigeströmt waren, um den »Goldmacher« zu sehen. Wie ein Heuschreckenschwarm überfluteten sie den sonst ziemlich stillen Ort am Gestade des Atlantischen.
Die Behörde von Gloucester hatte die Hände voll zu tun, um die Ordnung überall aufrecht zu erhalten. Der Mayor verlor dabei völlig den Kopf, er kümmerte sich um die zahllosen Fremden und vergaß dabei die Hautperson.
Benjamin Brown spielte zu dieser Zeit eine große Rolle. Er hatte sich in dem ersten Hotel der Stadt für die kurze Dauer seines Aufenthalts in Gloucester in Pension gegeben und lebte in sicherer Erwartung der Belohnung von 100 000 Dollar in dulci jubilo.
Der Hauptcoup war ihm soweit gelungen. José spielte seine Rolle als Wassilowitsch vortrefflich und es müßte seiner Ansicht nach mit dem Teufel zugehen, wenn die Sache noch zum Schluß schief ging. Er kalkulierte ganz richtig, wenn er sich sagte, daß niemand den Adepten dem Äußeren nach kannte. Nur das hatten die Amerikaner in Erfahrung gebracht, daß er mißgestaltet und häßlich sei. Da nun beides auch bei José der Fall war, so zweifelte keiner daran, daß Wassilowitsch einem seltsamen Zufall zur Folge der einzige Überlebende der »Maryland« sei. Zwar gab es noch mehr Bucklige auf der Welt, aber die Umstände, unter denen José mit seinem vermeintlichen Retter und Kumpan aufgefunden worden war, und daß er sich auch in ein so geheimnisvolles Schweigen hüllte, ließen keine andere Deutung zu: es mußte Wassilowitsch sein.
Ben lachte sich nun ins Fäustchen, als er sah, wie alles sozusagen am Schnürchen ging. Nur die 100 000 Dollar Belohnung fehlten noch. Er hoffte sie aber nach Eintreffen des Präsidenten angewiesen zu erhalten, sobald sich José diesem gegenüber als Wassilowitsch bekannte. Einstweilen lebte er wie ein Fürst auf Pump. Der Hotelwirt borgte auf die seinem Gast sicher in Aussicht stehende Belohnung bis ins Aschgraue. José, der inzwischen das Hospital verlassen hatte, quartierte sich gleichfalls in demselben Hotel ein und schloß dem Scheine nach mit seinem Retter Freundschaft.
Nach Mitternacht desselben Tages, an welchem die Nachricht von der Auffindung Wassilowitschs nach Washington gedrungen war, trafen der Präsident und seine hohen Ratgeber in Gloucester ein und begaben sich unverzüglich in das Hotel, wo das geniale Gaunerpaar, dem es darum zu tun war, seine Landsleute einmal gründlich über den Löffel zu barbieren, in den Daunenbetten der besten Fremdenzimmer der Nachtruhe pflegten.
»Weshalb weckt Ihr mich?« fuhr José den Bediensteten, der ihn in seinem Schlummer gestört hatte, unwirsch an.
»Sir Wassilowitsch werden von dem Präsidenten Harrison um eine Unterredung gebeten,« antwortete der Domestik des Hotels.
»Ich komme,« antwortete brummend der Gauner hinter den Vorhängen seiner fashionablen Schlafstelle. »Wo erwartet man mich?«
»Ich werde Sir Wassilowitsch zu ihm geleiten.«
»Schickt mir zunächst Mr. Brown herüber, ich muß ihn sprechen,« befahl José alias Wassilowitsch, und die bucklige Gestalt glitt dabei aus dem Bett heraus.
Der Bedienstete verschwand. José machte so schnell als möglich Toilette. inzwischen stellte sich sein Kumpan bei ihm ein.
»Harrison ist da,« schnarrte ihm José entgegen. »Weiß schon — — mußte die Nacht ankommen.«
»Also ich heiße Wassilowitsch?«
Ben nickte. Er hatte sich am vergangenen Tage einige Nummern des »New York Herald« zu verschaffen gewußt, welche Näheres über die Persönlichkeit Wassilowitschs gebracht hatten. Die Blätter datierten aus der Zeit, in welcher der »Goldmacher« in Rom als Falschmünzer verurteilt wurde. Die Artikel gaben Anhaltspunkte genügend für José, um seine Rolle geschickt weiter spielen zu können.
»Du bist Russe und von Beruf Chemiker, verstehst Du?« sagte Ben.
»Goddam! ich kann kein einziges russisches Wort — —«
»Ist ganz gleich, du sprichst eben englisch.«
»Hm — —«
»Im übrigen bist du so wortkarg wie möglich und läßt dem Präsidenten gegenüber durchblicken, daß du das Geheimnis des Goldmachens erst dann bekanntgeben willst, sobald du es an der Zeit hältst.«
José nickte und schlüpfte in seine Kleider.
»Auf Fragen, welche dir unbequem sind und die du nicht beantworten kannst, ohne dich zu verraten, verweigerst du jede Auskunft. Je mehr du dich in Schweigen hüllst, desto glaubwürdiger sieht alles aus.«
»Na und dann? Wie komme ich aber über die Grenze?«
»Ich habe mir's überlegt,« antwortete Ben. »Sobald ich die Anweisung auf die hunderttausend Dollars in der Tasche habe, lasse ich mir das Geld auf der Staatsbank in New York auszahlen, dann hole ich dich hier ab und wir verschwinden beide bei Nacht und Nebel.«
So wie sich Ben den Plan zurechtgelegt hatte, mußte er glücken. Daß man ihm die Belohnung vorenthielt, war nicht anzunehmen, und daß José vorzeitig als Betrüger entlarvt wurde, stand auch nicht in Aussicht; er hätte sich denn geradezu tölpelhaft benehmen müssen.
José begab sich nunmehr in Begleitung Bens nach dem Zimmer, in dem der Präsident und die übrigen Machthaber der Republik in Ungeduld seiner harrten.
Harrison sowie die andern Anwesenden verbeugten sich vor dem Ankömmling in einer Weise, die bezeugte, daß man vor dem Goldfürsten, für den Wassilowitsch gehalten wurde, den größten Respekt hegte.
Die Herren Yankees wissen besonders den Wert des Goldes zu schätzen, für sie ist Gott Mammon der oberste Götze, den sie anbeten.
José, der sich in die Brust geworfen hatte, musterte mit frechen Blicken die erlauchte Schar aus Washington, während Ben dicht hinter ihm stand.
Jetzt trat ein langbärtiger Herr vor José hin und redete ihn russisch an.
Unbemerkt zupfte Ben seinen Genossen von hinten am Rock.
»Ich beherrsche die englische Sprache vollkommen,« antwortete José, der sich geschickt aus der Klemme zu helfen wußte. »Bitte, sprechen Sie nur englisch.«
Als der Dolmetscher die Worte Josés vernahm, sah er den Minister mit einem Blick an, der verriet, daß er von irgend etwas überrascht sei.
Und dem war auch so. Einem Russen, und ein solcher war der Dolmetscher, mußte es auffallen, daß Wassilowitsch das Englisch nicht mit einer solchen Akzentuierung sprach, wie er es von einem Landsmann erwartet hatte. Auch Harrison und alle Anwesenden waren über das perfekte Englisch Wassilowitschs erstaunt; in dieser Beziehung mußte man ihn eben für einen echten Yankee halten.
»Es ist mir eine Ehre,« sagte der Präsident zu José, indem er sich diesem einige Schritte näherte, »Mr. Wassilowitsch hier begrüßen zu können. Ein höheres Geschick hat es gewollt, daß Sie vom Tode verschont geblieben.«
»Mein Name ist Wassilowitsch und dies hier ist mein edler Retter,« begann José und faßte seinen Genossen am Arm.
Benjamin Brown sah jetzt den Augenblick gekommen, wo er reden durfte und auf sein Ziel lossteuern konnte.
Er schilderte in wohlüberlegten Worten, wie und wo er Wassilowitsch gerettet hatte. Dabei ließ er durchblicken, daß Amerika ihm eigentlich viel Dank schulde, denn ohne seine Hilfe wäre jener rettungslos verloren gewesen.
Bens Worte waren mehr als ein Wink mit dem Zaunpfahle, das verspürten die Herren aus Washington recht wohl. Harrison sah sich darum auch veranlaßt, dem wackeren Retter aus Todesnot die ausgesetzte Belohnung zuzusichern. Ja, er ging sogar so weit, sofort eine Anweisung über 100 000 Dollar auf die Bundesstaatskasse auszustellen.
Die beiden Gauner mochten wohl innerlich eine unbändige Freude empfinden, als sie den kostbaren Scheck in ihren Händen sahen. Ben hatte nicht gedacht, daß sich die Angelegenheit so schnell abwickeln würde und er konnte ein verräterisches Schmunzeln nur mit Mühe unterdrücken.
Als José den kostbaren Schein in der Tasche seines Kumpans verschwinden sah und einige Gaunerblicke desselben auffing, hielt er es an der Zeit, seinerseits die übernommene Rolle so weiterzuspielen, daß nicht der geringste Zweifel oder Mißtrauen in seine Person gesetzt wurde. Er offenbarte den Staatsmännern, daß es ihm tatsächlich gelungen sei, Gold auf künstlichem Wege herzustellen, daß er aber bis jetzt noch keinem Menschen sein Geheimnis verraten habe, und dies erst tun werde, sobald alle seine Forderungen seitens des Bundessenates und des Kongresses bewilligt seien. Alle Einzelheiten betreffende Fragen seitens Harrisons wich José aus, indem er betonte, daß hier nicht der Ort sei, über ein so wichtiges Geheimnis zu verhandeln. Er vertröstete die Herren auf später und gab denselben die Zusicherung, daß er die Sache schon in den nächsten Tagen zum Abschluß bringen würde. Bis dahin bäte er darum, ihm ungestört Zeit zu lassen, seine Forderungen zu formulieren.
Natürlich war man allseitig damit einverstanden, und die hohen Herren zogen sich katzbuckelnd zurück, um für den Rest der Nacht noch eine Geheimsitzung im Amtsgebäude des Mayors abzuhalten.
Die beiden Gauner begaben sich nun ebenfalls in ihre Appartements zurück, um hier über ihr geniales Schwindelmanöver, welches sie in jeder Beziehung geglückt sahen, weitere Beratungen zu pflegen.
»Bis jetzt bin ich mit dir zufrieden,« sagte Ben, als beide im Zimmer des letzteren ihre Gedanken austauschten.
»Das will ich meinen,« versetzte José. »Ich hätte nicht gedacht, daß mir mein Buckel noch mal so'n Batzen Dollars einbringen würde.«
»Mit dem ersten Expreßzug fahre ich jetzt nach New York,« sagte Ben, indem er behutsam den kostbaren Schein aus der Rocktasche zog und ihn von vorn und hinten schmunzelnd betrachtete. »Das Papierchen muß ich schnellstens versilbern, ehe man den Braten hier riecht.«
»Ich fahre mit ...« erwiderte José.
»Was fällt dir ein — — willst wohl den ganzen Kitsch verderben!« stieß Ben rauh hervor und ließ den Scheck wieder in seine Brusttasche verschwinden.
»Daß du mir durch die Lappen gehst ... ich habe dann das Nachsehen und brumme einige Jährchen dafür ab.«
»Mensch!« schrie Ben seinen Genossen an, mäßigte aber erschreckt seine Stimme wieder und fuhr im halblauten Ton fort. »Du kriegst dein Teil, so wahr ich Benjamin Brown heiße. In Montreal teilen wir. Übrigens hole ich dich nach meiner Rückkunft von hier wie verabredet ab.«
José blieb nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen und sich in die Anordnungen Bens in jeder Beziehung zu fügen.
Ben ging darauf fort, und kein Mensch sollte ihn in Gloucester jemals wiedersehn.
Wochen waren seit dem Untergang der »Maryland« ins Land gerauscht. Die kriegerischen Aktionen der beiden Großmächte waren bereits in ein sehr entwickeltes Stadium getreten. Die gegnerischen Flotten konzentrierten sich mehr und mehr an der britischamerikanischen Küste des Atlantischen Ozeans. Ein Landheer Yankees hatte eine Invasion in Kanada mit Erfolg ausgeführt und hielt Quebec, Montreal und Toronto besetzt.
Tag und Nacht wurde in den Waffenfabriken Philadelphias gearbeitet. Munition mußte in ausreichendster Weise und allerkürzester Zeit beschafft werden. 50 000 000 Patronen und 1 000 000 Geschoßkugeln größten Kalibers hatte der Kriegsminister des amerikanischen Staatenbundes den pennsylvanischen Fabrikanten in Auftrag gegeben. Die Geschwader und Landheere der süd- und zentralamerikanischen Staaten, die nach Norden entsendet wurden, bedurften gar vieler Munition.
Die drahtlose Telegraphie und die Luftschiffahrt feierten jetzt in der Praxis die größten Triumphe, sie leisteten beide in Hinsicht auf die Ermittlung der Stellung des Feindes Außerordentliches.
Handel und Industrie mitsamt ihrem Export aber erlitten, als unausbleibliche Folge eines im Kriegszustande befindlichen Landes, gewaltige Stockungen, denn die besten Arbeitskräfte waren zu den Fahnen einberufen worden.
Inmitten dieses Völkerringens auf dem Erdball ereignete sich auch nun die Wiederauferstehung eines Totgeglaubten.
Die Freude, welche die Yankees während der Vorgänge in Gloucester beseelt hatte, war nur von kurzer Dauer gewesen, denn der inszenierte Humbug Bens kam unerwartet schnell zur Entpuppung und wirkte auf die Düpierten wie ein kalter Wasserstrahl.
Während José ein Gemach hinter vergitterten Fenstern beziehen mnßte, erfreute sich der Urheber des Gaunerstreiches der Früchte, welche letzterer getragen hatte. Doch auch ihn sollte die Nemesis in Kanada erreichen. Der geniale Sohn Barnums wurde beim Einmarsch der UnionTruppen von einem Gloucester Bürger, welcher sich in die Landmiliz hatte einreihen lassen, in Montreal erkannt. Ben wurde entlarvt und die bei ihm noch vorgefundenen 70 000 Dollars wanderten wieder in die Bundeskasse zurück.
Zu eben dieser Zeit war es, als in New York in einem der monumentalen Marmorpaläste der 5. Avenue nahe des Broadway das Gespenst des Goldmachers wieder auftauchte.
Im ersten Stockwerk des dem MilliardärKlub gehörenden Hauses hielten eines Abends die amerikanischen Geldfürsten, die Finanz, Petroleum- und Eisenbahnkönige, eine anberaumte Extrasitzung ab.
In einem mit verschwenderischem Luxus ausgestatteten Saal, in den elektrische Lustres ein Meer von Licht ergossen, hatten sich etwa ein Dutzend Herren versammelt.
Wohin der Blick fiel, traf er einen der amerikanischen Krösusse. Da war zunächst der 3 Milliarden wiegende Nachkomme des ehemaligen Petroleumkönigs Rockefeller, neben ihm der etwas ärmere, nur 1 Milliarde schwere Finanzmann Vanderbilt. Weiter sah man die Sprossen des Stahlmagnaten Carnegie, des Bodenspekulanten Astor, des Eisenbahnkönigs Gould und den neugebackenen Milliardär Field, der durch sein Radiummonopol alle Aussicht hatte, der reichste Mann der Erde zu werden.
Diese Herren — der Volksmund nannte sie die wandelnden Geldsäcke — hatten sich in ihrem Konferenzhotel zu einer besonderen Sitzung zusammengefunden, um in Anbetracht des ausgebrochenen Krieges über die Finanzlage des Landes, über die starken Kursrückgänge an den Börsen und über die Maßnahmen einer Niederlage der amerikanischen Waffen zu beraten.
Diese Sitzung war die zweite, die innerhalb weniger Wochen außerhalb der gewöhnlichen Reihenfolge abgehalten wurde. Die erste Zusammenkunft hatte die Nachricht von der Lösung des Goldproblems veranlaßt. Damals stand das persönliche Vermögen der amerikanischen Nabobs auf dem Spiele. Diesmal nur das der UnionStaaten. Deshalb trug die zweite Sitzung bei weitem nicht den Stempel höchster Aufregung und Kopflosigkeit an sich. Die Herren berieten vielmehr mit einem Gleichmut, wie ihn nur Amerikaner in schwierigen Situationen zur Schau zu tragen vermögen.
Den Vorsitz der illustren Gesellschaft hatte der Radiumkönig übernommen.
Field war in Anbetracht der Schwere seines Geldsackes ein noch jugendlicher Mann. Abweichend von dem YankeeTypus, besaß er eine kurze gedrungene Gestalt, auf der ein fleischiger Hals und ein unförmiger Kopf saß. Die Gesichtszüge verrieten eigentlich nichts von der Intelligenz, die Field in kurzer Zeit an die erste Stelle der Geldpotentaten gesetzt hatte. Die wasserblauen, feuchten Augen Fields blinzelten unter buschigen Brauen unstet umher. Nach der gemachten Schilderung wird es dem Leser schwer fallen, sich Mr. Field als einen hübschen Mann vorzustellen. Noch dazu, wenn er erfährt, daß einige stattliche Warzen auf dessen linker Gesichtshälfte thronten und ein struppiger Schnauzbart seine dünnen, blutleeren Lippen beschattete.
Besagter Field hatte also für die Beratung den Vorsitz übernommen und war eben im Begriff die Finanzlage der Union einer scharfen Sezierung zu unterwerfen, wobei seine geradezu piepig klingende, häufig in Fisteltöne übergehende Kinderstimme, in dem angrenzenden, offenen Nebensaal ein geisterhaftes Echo weckte.
Der Radiumkönig hatte eine Mappe ausgebreitet vor sich liegen, der er von Zeit zu Zeit Schriftstücke entnahm und diese im Kreise der Herren zirkulieren ließ.
»Meine Herren,« begann die Fistelstimme, und die kleine Gestalt des Sprechers reckte sich dabei so, daß sie um einige Zoll höher erschien. »Meine Herren! Kaum ist das Gespenst des Goldmachers von der Bildfläche verschwunden, so haben sich für uns schon wieder neue Wolken aufgetürmt, da die Finanzen der Union nicht sonderlich bestellt sind, weil die Südstaaten leere Kassen haben und ein unmittelbarer Kriegsfond nicht vorhanden ist, wird der Bundesrat unsere Säckel zweifellos sehr in Anspruch nehmen. Wir werden ihm Geld zur Verfügung stellen müssen, denn es bleibt uns um unserer selbst willen nichts anderes übrig. Das große Risiko aber, das uns erwachsen kann, wenn wir einen unglücklichen Ausgang des Krieges ins Auge fassen, gebietet uns, den Zinsfuß nicht zu niedrig zu bemessen ...«
»Sehr richtig,« echote eine Stimme am anderen Ende der Tafel. Astor hatte seinen Beifall nicht unterdrücken können.
»Wir werden also zunächst schlüssig werden müssen,« fuhr Field fort, »ob eine Erhöhung von drei Prozent ...«
Wieder wurde der Sprecher unterbrochen.
»Vier Prozent schlage ich als Zinserhöhung vor!« rief die Baßstimme Rockefellers.
»Ich halte dreiundeindrittel schon für zu hoch,« sagte der Nachkomme des Eisenbahnkönigs Gould.
»Wir dürfen uns den Zinssatz nicht vom Patriotismus diktieren lassen,« meinte Astor.
»Wir Finanzgrößen stehen und fallen mit dem Schicksal unserer Nation. Darum ist es unsere erste Pflicht, dem Lande so zu dienen, daß das Kriegsglück auf unserer Seite bleibt,« versetzte Carnegie mit gehobener Stimme.
»Schön,« begann Field wieder. »Unsere Gelder stehen der Union in unbeschränkter Höhe zur Verfügung, das garantiert doch schon dafür, daß wir patriotisch gesinnt sind. — — — Ich hoffe, daß die Herren alle der gleichen Ansicht sein werden.«
Field sah sich im Kreise der Anwesenden um, er schien kaum auf einen Widerspruch zu rechnen.
»Meine Herren, betrachten wir die Angelegenheit nicht wie ein gewöhnliches Geldgeschäft. Hängen doch unsere vitalsten Interessen davon ab, wie wir es dem Staat erleichtern, den begonnenen Krieg mit dem ersehnten Erfolg zu beenden,« meinte Gould, der nicht ein so starrer Finanzmann war wie Rockefeller oder Astor.
»Lieber Gould, Sie stehen vereinzelt da mit Ihrer Ansicht. Patriotismus bis zu einer gewissen Grenze, ja — — dahinter muß aber das Geschäft beginnen,« ließ Field sich wieder vernehmen, und seine roten fleischigen Finger trommelten auf der Tischplatte herum.
»Meine Herren!« begann jetzt Vanderbilt mit einem seiner Redeweise eigenen nachlässigen Ton. »Ich möchte mich der Ansicht Mr. Goulds voll und ganz anschließen. Die Gefahren, welche ein Krieg für unseren Besitzstand mit sich bringen kann, sind nicht annähernd so groß, als wie die, welche kürzlich das Goldgespenst mit seinem Erscheinen heraufbeschwor. Wassilowitsch ...«
Es klopfte jetzt vernehmlich an die Tür des Saales.
Der Sprecher verstummte. Field öffnete die verschlossene Tür und sah erstaunt in das Gesicht eines wildfremden Menschen.
»Gestatten die Herren — — — Wassilowitsch ist meine Name. Darf ich ...«
Der Fremde vermochte nicht zu Ende zu sprechen. Wie von Taranteln gestochen fuhren die Geldfürsten von ihren Sitzen empor, und Field verlor wohl zum erstenmal in seinem Leben alle Geistesgegenwart.
Es schien, als wenn der Teufel die ganze Szene arrangiert gehabt hätte, um mit dem vom Tode aufgestandenen Schreckgespenst sich einen Ulk mit den höchsten Dienern des Mammons zu erlauben.
Es war tatsächlich auch für alle verblüffend, daß der Adept gerade in demselben Augenblick auf der Bildfläche erschien, als sein Name über die Lippen Vanderbilts glitt. Es wollte niemand seinen Augen trauen, den Totgeglaubten hier vor sich zu sehen. Der erste Schreck hatte den hohen Herren fast die Glieder gelähmt, dann aber, als der Bucklige mitten unter die Finanziers trat und sich als leibhaftiger Mansch den Blicken aller präsentierte, da legte sich das Entsetzen etwas.
»Ich bedauere unendlich, die Herren gestört zu haben,« begann Wassilowitsch.
Bei einigen der Geldfürsten schien plötzlich der Gedanke Wurzel zu fassen, daß wieder ein Betrüger die Rolle Wassilowitschs spielen wolle.
Wassilowitsch sah die ungläubigen Gesichter und mochte wohl ahnen, daß die hohen Herren an der Echtheit seiner Person zweifelten, denn er ließ jene gar nicht erst zu Wort kommen, sondern sagte: »Meine Herren, vor Ihnen steht der Mann, der gekommen ist, das Geheimnis seiner Erfindung zu verkaufen. Mein Kunstgold ...«
Hier wurde er durch Field unterbrochen.
»Sie — — — Sie wären Wassilowitsch?« stieß dieser hastig hervor.
»In höchsteigener Person,« antwortete der Gefragte.
»Ich will es Ihnen kurzweg heraussagen,« rief Astor dem Buckligen zu. »Sie sind ein Betrüger — — ein Hochstapler — — — es ist uns bekannt, daß die ›Maryland‹ mit Mann und Maus untergegangen ist. Wassilowitsch ist ertrunken, und wenn Sie es wagen, hier ein Schwindelmanöver zu vollführen, so haben Sie sich das richtige Publikum gerade herausgesucht!«
Wassilowitsch lächelte. Er griff in die Brusttasche und zog mehrere Papiere hervor. »Wollen die Herren die Freundlichkeit haben,« sagte er, indem er dem ihm zunächststehenden Field die Schriftstücke reichte.
Der Radiumkönig nahm mit Unruhe die Papiere in die Hand und überflog dieselben raschen Blickes.
»Ich glaube daß die Dokumente zu meiner Legitimation genügen,« meinte Wassilowitsch und streifte Astor mit einem spöttischen Blick.
Man sah deutlich, daß Field um eine Nuance blässer wurde.
Nun drängten sich auch die anderen Herren um den Radiumkönig und verschlangen Wassilowitschs Papiere mit den Augen.
Man erblickte Dokumente, die unmöglich gefälscht sein konnten, waren es doch Schriftstücke mit dem königlich italienischen Insiegel und Noten des englischen Ministerrates. Auch ein Handschreiben des Präsidenten Harrison befand sich darunter.
Man kann sich im Geiste vorstellen, wie die amerikanischen Nabobs bestürzt waren. Ein Karikaturenzeichner hätte sicher eine nette Summe Pfund Sterling geopfert, wenn er das Mienenspiel jedes einzelnen hätte zu Papier bringen dürfen.
»Mr. Wassilowitsch ......« stotterte in höchster Aufregung Gould und die Stimme versagte ihm.
»Ich bemerke, daß mein Erscheinen die Herren völlig außer Fassung bringt,« sagte Wassilowitsch und ließ sich unaufgefordert auf einen Stuhl nieder. »Sie gestatten doch? — — Ich weiß, Sie sehen in mir ein wahres Schreckgespenst. Nun, ich bin nicht so schlimm, wie man von mir denkt.«
»Aber — — —« begann Mr. Astor und heftete seine Pupillen starr auf Wassilowitsch. »Sie sind nicht ertrunken?«
Wieder lächelte der Angeredete. »Wie sie sehen, mein verehrter Herr, ist das nicht der Fall gewesen.«
»Ich kann es noch nicht fassen,« meinte Carnegie und fuhr sich mit der Hand über die Stirn, um sich zu vergewissern, ob er wach sei, oder träume.
»Er ist's — —« antwortete ihm Field, der sich schon im Geiste als armer Mann sah.
»Wollen sich die Herren nicht setzen? — — Dieser Stuhl hier ist doch wohl frei? — Oder — —«
»Ich bitte darum, uns zunächst anzugeben, was Sie so unverhofft in unsere Mitte führt,« erwiderte stockend Field. Er schien sich gar nicht beruhigen zu können.
»Aber, meine Herren ...... Pardon! ich befinde mich doch hier richtig? — Der Milliardärklub?«
»Mein Name ist Rockefeller,« antwortete der Erbe des Petroleumkönigs, der sich von seinen Kollegen am ehesten gefaßt und von der grenzenlosen Überraschung, die Wassilowitschs Erscheinen in dem Krösuszirkel hervorgerufen hatte, zuerst erholt zu haben schien.
»Dies hier ist Mr. Field — hier Mr. Astor — Mr. Vanderbilt — Mr. Carnegie — Mr. Gould ......«
»Danke, danke,« unterbrach Wassilowitsch mit einem gönnerhaften Ton Rockefeller. »Ich sehe, ich bin nicht fehlgegangen. — — — Meine Herren, was mich herführt, ist die Absicht mit Ihnen Hand in Hand zu arbeiten und Ihnen von den Früchten anzubieten, die meine Erfindung in überreichem Maße tragen dürfte.«
»Sie wollen — — Mr. Wassilowitsch — — —« rief Field aus und trat einen Schritt näher.
»Ich will,« versetzte der Bucklige. »Ich glaube nicht, daß es Ihnen besonders unangenehm sein wird, wenn wir jetzt ein Milliardengeschäft abschließen.«
Die Worte Wassilowitschs übten eine gewaltige Wirkung auf die Anwesenden aus. Die Gestalten der Multimillionäre richteten sich wie auf Kommando aus ihrer bisherigen nachlässigen Stellung auf. Wieder gab es ein verändertes Mienenspiel, und ein Dutzend Augenpaare verrieten ein seltsames Gemisch von Freude und Zweifel.
»Meine Herren,« fing Wassilowitsch wieder an, »nehmen Sie doch bitte Platz. Im Sitzen läßt es sich besser verhandeln.«
Die Geldfürsten kamen der Aufforderung nach. Es war seltsam, daß diese Herren, die sich doch sonst von keines Monarchen Zorn beirren ließen, vor einem unscheinbaren Mann ein so kopfloses Benehmen zur Schau trugen.
»Mr. Wassilowitsch,« sagte Field. »Sind sie wirklich gekommen, um uns Ihr Geheimnis anzubieten — — oder ist es nur ein schlechter Scherz, den Sie sich mit uns erlauben wollen?«
»Aber — —« versetzte der Gefragte. »Wie können Sie nur so etwas denken ... Natürlich kann ich begreifen, daß Sie sich darüber wundern, daß ich gerade mit Ihnen in Kontakt treten will, wo Sie doch wissen, daß Kaiser und Könige um meine Gunst buhlen.«
»Darf ich mir eine Frage erlauben?« warf Rockefeller ein. »Warum weiß man in Washington nichts von Ihrer Rettung, Mr. Wassilowitsch?«
Jetzt gewann auch die Neugier der anderen Milliardäre die Oberhand über ihre Aufregung.
»Warum leisten Sie auf den amerikanischen Präsidentenstuhl Verzicht, Mr. Wassilowitsch?« frug Gould.
»Meine Herren«, antwortete der von zwei Seiten mit Fragen bestürmte Russe, »niemand außer einem Manne weiß, daß ich jetzt lebend unter Ihnen weile. Das Meer hat außer mir und einem Matrosen die ganze Mannschaft der ›Maryland‹ verschlungen.«
»Es sind aber doch seitdem schon Wochen vergangen, und alle Welt ist davon überzeugt, daß auch Sie Ihr Grab in den Wellen gefunden haben,« versetzte Astor.
»Hm — — die Erfahrung hat mich witzig gemacht,« antwortete Wassilowitsch. »Wenn ich mich bisher verborgen hielt und alle glauben ließ, ich sei tot, so geschah dies ans triftigen Gründen. — — — Ich bin lange mit mir zurate gegangen, bis ich mich dazu entschlossen habe, mit Ihnen, meine Herren, gemeinsame Sache zu machen.«
Dieses Bekenntnis klang den Nabobs der »Neuen Welt« wie ein Evangelium in die Ohren. Ein Jauchzen und Frohlocken durchzog ihre Seelen. Und denen, die das Gold bislang fast als wertlos betrachtet hatten, weil sie im Übermaß davon besaßen, erschien dasselbe mit einem Male als das Alleinseligmachende auf der Welt.
»Es ist eine große Ehre für uns, Mr. Wassilowitsch, daß Sie gerade uns Ihres Vertrauens für würdig erachten,« sagte Vanderbilt.
»Bitte, keine Komplimente ... ich wünsche jetzt, Ihnen meine Pläne vorzutragen, meine Herren. — — — Wir sind hier ungestört, nicht wahr? Ich meine, es kommen keine unberufenen Ohren in die Nähe?«
Field erhob sich schnell, und mit ihm noch einige Herren, um die Türen zu verschließen.
»Zunächst habe ich ein Anliegen auszusprechen,« begann Wassilowitsch wieder. Er hatte sich von seinem Platze erhoben und richtete seine Worte an den Vorsitzenden. »Ist der Milliardärklub hier vollzählig versammelt?«
»Ja —« antwortete Field. »Wir haben eben über die Kriegslage beraten, und aus diesem Grunde durfte niemand fehlen.«
»Schön — — — nun die Frage. Wollen die Herren, will der Milliardärklub mit mir gemeinsame Sache machen? Ich meine damit, ob Sie mir meine Erfindung abkaufen wollen?« Wassilowitsch ließ bei diesen Worten seinen Blick im Kreise der Geldfürsten herumgleiten.
Von allen Seiten wurde die Frage eifrig bejaht.
»Dann, meine Herren, bin ich gezwungen, Sie samt und sonders schwören zu lassen, daß Sie, so lange ich es für gut befinde, darüber tiefstes Schweigen bewahren, daß ich noch existiere. Sie müssen ferner alle Welt in dem Glauben lassen, daß das Kunstgold, welches Sie herstellen und in den Handel bringen, echtes sei. Kommt man dann eines Tages dahinter, daß es mein Kunstprodukt ist, das Sie verausgaben, so sollen Sie der Welt verkünden, daß Sie mir mein Geheimnis schon abgekauft hätten, als ich in London im Carltonklub geweilt. — — — Sind Sie mit meinem Wunsch einverstanden, meine Herren?«
Wieder sah Wassilowitsch im Kreise herum.
»Wir schwören ...« riefen alle Milliardäre wie aus einem Munde.
»Ich will Ihnen Schwur und Ehrenwort erst abnehmen, sobald Sie sich auch bezüglich des Kaufpreises mit mir geeinigt haben. — Ich hege nämlich die Absicht, für eine hohe Summe in Naturgold das Geheimnis ganz in Ihre Hände zu legen. Ich will keine Beteiligung mit Ihnen. Nein ... Habe ich Ihnen das Rezept verkauft, so können Sie es ausbeuten nach Belieben, man soll mich aber in Ruhe lassen. Nach reiflichster Überlegung bin ich dazu gekommen, Ihnen einen solchen Vorschlag hier zu unterbreiten.«
»Wir sind mit allem einverstanden, Mr. Wassilowitsch ... und der Kaufpreis?« versetzte Field, dem Unruhe und Freude die Stimme erzittern machte.
»Der Kaufpreis ...« antwortete der Adept und schlug einen besonders gelassenen Ton an. »Der Kaufpreis ... hm — — Ihrer aller Vermögen.«
Der nun folgende Moment war grandios!
Hatte man recht gehört? — — Ihrer aller Vermögen ...
Das Mienenspiel der Finanzmänner trug den Stempel größter Verblüfftheit zur Schau — Das Vermögen ihrer aller — — —
Field überflog im Geiste die Riesensumme, die das Ergebnis einer flüchtigen Rechnung war. — 35 Milliarden Dollar!
Auch die anderen zogen schnell im Stillen ein Fazit. — 35 Milliarden! Und Wassilowitsch hatte sich nicht zu seinen ungunsten verrechnet gehabt, wenn er das Gesamtvermögen der amerikanischen Geldaristokratie auf über 30 Milliarden bewertete. Field sollte 2 Milliarden, Rockefeller 3, Carnegie 4, Astor 2, Vanderbilt 1, Gould 5 und die übrigen Mitglieder des Milliardärklubs zusammen über 13 Milliarden Dollar besitzen. Summa Summarum: die Kalkulation war richtig gewesen.
Wassilowitsch mußte eine kleine Weile warten, ehe er die gewünschte Antwort erhielt. Man war zu verblüfft, um sofort eine solche zu geben.
»Mr. Wassilowitsch, haben Sie sich auch schon einmal überlegt, welchen Kaufpreis Sie uns stellen wollen?« begann endlich Field.
..Etwa den zehnten Teil von der Summe, die Ihnen durch mein Goldrezept in die Taschen fließen wird,« erwiderte mit Ruhe und Gelassenheit der Gefragte.
»Sie meinen, daß wir ...«
Wassilowitsch unterbrach Field. »Ich meine, daß Sie alle ein brillantes Geschäft machen.«
»Und Sie verlangen diese ungeheuere Summe bar und in natürlichem Golde — — soviel gemünztes Gold gibt es ja auf der ganzen Erde nicht, geschweige in Amerika,« meinte Rockefeller.
»Es können auch gediegene Goldbarren sein,« versetzte Wassilowitsch.
»Unmöglich!« rief Astor aus.
»Warum verlangen Sie die Summe in natürlichem Gold? Mit Ihrem Kunstgold könnte sich die Regelung nach Ihrem Wunsch vielleicht durchführen lassen,« sagte Field.
»Wir werden Ihnen zum Teil amortisierbare Schuldscheine ausstellen, für die wir insgesamt haften,« ließ sich Carnegie vernehmen.
»Ich will weder mit meinem eigenen Kunstgold, noch mit Schuldscheinen oder Banknoten abgefunden werden,« beharrte der Bucklige auf seiner Forderung.
»Aber es ist unmöglich ...« rief Gould aus.
»Gut, so werde ich mich zum Teil mit gemünztem Gold, soweit solches vorhanden ist, und zum andern Teil mit Grundbesitz begnügen,« antwortete Wassilowitsch.
»Wir wollen einen Welttrust gründen und alle Fabrikation, alle Produktion, sowie alle Verkehrsmittel zu Wasser und zu Lande unter einen Hut bringen — — monopolisieren ...« sagte Field, der immer schnell mit Ratschlägen zur Hand war, wo es galt, Herr einer verzwickten Situation zu werden.
Die Milliardäre stimmten dem Vorschlag Fields zu.
»Sie werden als Leiter des internationalen Trustes entsprechend viele Geschäftsanteile neben barer Abfindung erhalten,« fuhr der Radiumkönig fort.
»Meine Herren!« versetzte Wassilowitsch, »lassen Sie mich bei allen Ihren Unternehmungen aus dem Spiele. Ich ziehe mich nach dem Abschluß des Geschäftes als Privatmann zurück, und nichts in der Welt wird mich dazu bewegen, mit meiner Erfindung irgendwelche Operationen zu unterstützen.«
Die Milliardäre waren über das Zurückweisen jeder Beteiligung gar nicht so verstimmt, es erfüllte sie im Gegenteil mit Freude, daß sie völlig freies Spiel haben sollten. Nur über eins wanderten sie sich, nämlich, daß Wassilowitsch auf Throne und Fürstentitel, die er haben konnte, völlig verzichtete. Doch grübelten sie über diesen Punkt nicht lange nach, sondern frohlockten über das große Entgegenkommen.
»Sie heißen die Idee des Welttrustes also gut?« frug Field.
»Unternehmen Sie, was Sie wollen, nur lassen Sie mich aus dem Spiel. Ich bin froh, wenn ich die Früchte meines Schaffens ungestört, fern von dem Getriebe der Welt, genießen kann,« lautete die bestimmte Antwort.
Die weiteren Verhandlungen zwischen Wassilowitsch und den Milliardären hatten als Endresultat, daß eine volle Einigung zustande kam. Die Geldfürsten waren in allen Punkten dem Adepten zu Willen gewesen, auch was den Kaufpreis von 30 Milliarden anbetraf. Wassilowitsch seinerseits hatte sich verpflichtet, weder einem Dritten das Rezept zu verraten, noch selbst Kunstgold im Geheimen herzustellen und es zu verwerten.
Als Wassilowitsch den Milliardärklub verließ, waren sowohl er, als auch die Geldfürsten höchlichst befriedigt. Schon am nächsten Tage sollte der eigentliche Geschäftsabschluß stattfinden.
Kaum war des Adepten Mißgestalt hinter dem Rahmen der Tür verschwunden, als unter den versammelten Herren ein frenetischer Jubel ausbrach. Sie wußten, daß sie ein Geschäft gemacht hatten, welches ihnen unermeßliche Reichtümer in den Schoß werfen mußte, wenn es gelang, das Heft immer in der Hand zu behalten.
»Welche Gründe mögen ihn bewogen haben, uns allein das Vertrauen zu schenken, das er Fürsten versagt hat,« meinte Field nachdenklich, als sich die Aufregung bei ihm und den anderen ein wenig gelegt hatte, und die kalte Überlegung wieder die Oberhand gewann.
»Er traut jedenfalls den Herrschern ihrer gewaltigen Macht wegen nicht,« erwiderte Vanderbilt.
»Der Grund könnte mir einleuchten,« versetzte Gould. »Er hat Furcht, noch weitere Tage hinter Gitterstäben zu verbringen, hinter die ihn ein Machtwort irgend eines Fürsten, in dessen Landesgrenzen er sich gerade befindet, plazieren könnte, sobald er jenem unbequem zu werden verspricht.«
»Da liegt der Hase im Pfeffer — — unser lieber Vanderbilt hat sicher den Nagel auf den Kopf getroffen,« rief Carnegie aus.
»Hm ...... wenn Wassilowitsch Bedenken solcher Art hegte, so hätte er uns sein Geheimnis schon angeboten als er sich noch in Europa in der gefährlichen Machtsphäre der Potentaten befand,« meinte hierzu Astor und zog die Stirn etwas kraus, was er gern und häufig tat, wenn er mit etwas nicht recht einverstanden war.
»Meine Herren, Wassilowitsch hat Erfahrungen gesammelt,« sagte Rockefeller und legte in seine Worte besonderen Nachdruck. »Er hat zur Genüge gesehen, daß er keine ruhige Stunde hat, solange er seine Erfindung niemand verrät und allein allen und jeden Nutzen daraus ziehen will. Immer steht er auf einem Vulkan, der ihm Verderben bringen kann — — Kaiser und Könige würden nicht ruhen, ihn unschädlich zu machen, wenn er wieder auf der Bildfläche erscheinen und sein Gold durch die Welt zu rollen beginnen würde. — — Ja, meine Herren, Mr. Vanderbilt und Mr. Gould haben recht mit dem, was sie soeben gesagt.«
»Geraten wir aber nicht in dieselbe Gefahr wie er, wenn wir im Besitz der Goldquelle sind?« meinte Mr. Hunt, ein südstaatlicher Kohlenkönig, der nur selten das Wort im Milliardärklub zu ergreifen pflegte, tat er es aber einmal, so konnte man fast darauf wetten, daß seine Bemerkungen späterhin zutrafen.
»Hm — — hm — — — — wir müssen darum einen genialen Feldzugsplan ersinnen, der uns allmählich zur Herrschaft der Welt gelangen läßt — — allmählich, ganz allmählich, meine Herren. Nur keine Überstürzung, sie würde alles sicher verderben, und wir sitzen dann eines Tages auf dem Trocknen,« versetzte Field und wiegte seinen häßlichen Kopf hin und her. »Um vorsichtig zu gehen, müssen wir anfänglich nur so viel von dem Kunstgold fabrizieren und in Kurs bringen, daß die Menge niemand unmittelbar auffällt. Nach und nach bringen wir alle Verkehrsmittel unter unsere Gewalt — — unauffällig natürlich. Ein Riesentrust, dessen Polypenarme die ganze Erde umspannt, muß unser Ziel sein.«
Nachdem die Fistelstimme Fields verklungen war, erhob sich das ärmste Mitglied des Milliardärklubs, Mr. Goodall aus Rio de Janeiro, der nur in Kaffee und Baumwolle machte und vor kurzem die letzte Million eingeheimst hatte, die ihn in die Reihe der Milliardäre stellte. »Meine Herren! — — — meine Herren! Erinnern wir uns des Boykotts — — — — wir haben vielleicht auch mit ihm einen Strauß auszufechten.«
Das Wort Boykott wirkte unter den Nabobs. Sie fanden dabei etwas wie Ohnmacht und Unbehaglichkeit. Ja, es war nicht so einfach, alle Welt mit dem Kunstgold zu erobern. Man durfte nicht die Rechnung ohne die mehr als 1000 Millionen Köpfe zählende übrige Menschheit außerhalb der amerikanischen Grenzpfähle machen, denn es konnte ihnen dann ergehen, wie es just eben John Bull ergangen war: der Boykott, das soziale Gespenst, sprach ein vernichtendes Machtwort!
Nun, die Männer, die Amerikas gesamten Handel und Industrie in den Händen hatten, warfen trotzdem noch lange nicht die Flinte ins Korn. Sie waren viel zu schlau, um nicht die nötigen Mittel und Wege zu finden, die ihren ungeheuerlichen Plänen dienlich waren.
Als der Milliardärklub seine so bedeutungsvoll gewordene Sitzung schloß, war es fast gegen 5 Uhr morgens. Der geplante Riesentrust hatte im Geiste der Herren bereits eine bestimmte Gestalt angenommen, und es sollte der Welt so quasi eine Überrumpelung bevorstehen, die in den Annalen der Weltgeschichte für alle kommende Geschlechter der Erde die grandioseste Aktion blieb, die ein Dutzend Männer jemals in Szene gesetzt hatten.
Vierundzwanzig Stunden später finden wir die Herren der hohen Finanz wiederum in ihren Klubräumen versammelt. Der große Moment, wo ein Geheimnis für 30 Milliarden Dollar verkauft werden sollte, war da.
Wassilowitsch stand bereit, nach Unterzeichnung des Vertrages, das Rezept seiner Kunst preiszugeben. Schon einige Stunden früher hatte er die Multimillionäre in seiner in der 3. Avenue liegenden Wohnung empfangen, dort vor ihren Augen Kunstgold hergestellt und ihnen Proben ausgehändigt, die von Field sofort verschiedenen Chemikern und Juwelieren zur Prüfung respektive Analyse übergeben wurden. Letzteres war so unauffällig als möglich geschehen. Das Resultat war, daß die Fachleute die Kunstgoldproben für echt befanden. Auch davon hatten sich die Nabobs überzeugt, daß sich in wenigen Wochen für viele Millionen Dollar Kunstgold herstellen ließ, ohne daß es eines großen Apparates von Personal, Maschinen und so weiter bedurfte. Freilich mußten Arbeiter für die Zurichtung des Rohmaterials und die Besorgung der Schmelzöfen angeworben werden. Die Hauptarbeit wollten die Milliardäre selbst verrichten. Die Männer, welche in ihrem Leben kaum etwas anderes in den Händen gehalten hatten, als gelegentlich einmal den Federhalter oder eine echte Henry Clayzigarre, wollten also selbst die gröbsten Arbeiten ausführen, Arbeiten, die in Schmelzhütten rußbedeckten und schlechtbezahlten Männern zufielen. Solche Angst hatten sie insgesamt, daß sie mit ihrer Sache durch Verrat Fiasko erleiden würden. Sie wußten, daß sie alle va banque spielten. Das sich bietende Geschäft erschien ihnen aber so ungeheuer verlockend, daß jedes Bedenken in den Hintergrund gedrängt wurde. Der Preis war ja die Alleinherrschaft über den Erdball. Ging das Unternehmen vorzeitig fehl, indem ihre Goldfabrikation bekannt und ihnen dieselbe vom Staat gewaltsam aus den Händen gerissen wurde, so waren sie eben mit einem Schlage arme Leute. Freilich hätten sie sich aus dieser schlimmen Lage wieder heraushelfen können, sofern sie nur ihr Rezept geheim gehalten hätten. Dies mochten die Multimillionäre wohl alles reiflich überlegt haben, denn sie leisteten sich untereinander den feierlichen Schwur, daß niemand das Rezept verraten dürfe. Auch war es keinem gestattet, dasselbe aufzuschreiben, weil man verhüten wollte, daß ein, eine derartige Aufzeichnung enthaltendes Papier in unbefugte Hände geraten könnte.
Die Geschäftsklugheit der amerikanischen Geldfürsten forderte aber auch von Wassilowitsch, daß er seinerseits den Schwur ablege, nach dem Verkauf seines Rezeptes dieses weder Dritten jemals zu verraten, noch selbst Gold zur heimlichen Verwertung anzufertigen. Auch wurde es dem Buckligen aufgegeben, sich für alle Zukunft einen anderen Namen beizulegen und alle Spuren zu verwischen, welche verraten konnten, daß er noch am Leben sei.
Der Augenblick der Eidesleistungen in den Räumen des Milliardärklubs war ein tiefernster. Bei einem mittelalterlichen Femgericht, bei den Geheimnissen der Camorra und der Mafia konnte es nicht mysteriöser und feierlicher zugehen als hier, wo jeder Eidbruch Todesstrafe zur Folge haben sollte. Auch Wassilowitsch mußte sich diesen Bedingungen fügen, wenn er wollte, daß die Sache zum Abschluß kam.
Nachdem also die Vorbereitungen getroffen, die Abtretungsurkunde von allen unterzeichnet war, und die vereinbarte Anzahlung von einer Milliarde Dollar in gemünztem echten Gold und Banknoten in 1000 umfangreichen Geldsäcken in dem geöffneten Nebensaal zur Ablieferung bereitstanden, erklärte Wassilowitsch nunmehr sein Rezept preiszugeben.
Zuvor jedoch überzeugten sich die Herren in den Fluren und angrenzenden Zimmern des ganzen Stockwerks, in welchem die Sitzung abgehalten wurde, daß niemand von den Bediensteten, entgegen einer strengen Order, in denselben weilte, um einen unliebsamen Lauscher abzugeben.
Hinter vorsichtig verschlossenen Türen umstanden jetzt die Männer, welche sich im Geiste schon als die zukünftigen Beherrscher der Welt betrachteten, die Mißgestalt des Adepten. Ein Gemisch von Freude und seelischer Erregung drückte allen Gesichtern seinen unverkennbaren Stempel auf.
In leisem Ton gab Wassilowitsch die Einzelheiten seines Verfahrens bekannt, nannte die dabei zur Verwendung kommenden Metallsubstanzen, die Art und Weise, wie diese vermischt, und welche Gewichtsteile von jedem Stoff erforderlich waren, damit das Ganze nach der Schmelze das Atomgewicht 197,2 auch haarscharf erreiche.
Während der Adept sprach, herrschte Totenstille im Sitzungszimmer. Es wagte fast niemand zu atmen, geschweige denn zu sprechen, aus Furcht, daß ihnen auch nur ein Wort aus dem Mund Wassilowitschs entgehen könne. Erst als letzterer eine kleine Pause im Sprechen machte, entschlüpfte dem einen oder anderen ein verwundertes Ah oder Oh!
»Sehen Sie, meine Herren, das was ich Ihnen in bezug auf mein Rezept zu verraten hatte, war an sich sehr wenig, aber für Leben und Wohlfahrt der Menschheit unendlich viel.«
Der letzten Worte hätte es wohl nicht bedurft, um die Anwesenden von der Bedeutung der Erfindung zu überzeugen.
Jetzt ergriff Field als der Vorsitzende des Klubs Gelegenheit, Wassilowitsch für das Vertrauen zu danken, das er mit der Bekanntgabe der Lösung des Goldproblems ihm und seinen Freunden gegenüber bewiesen habe.
Von allen Seiten wurde nun Wassilowitsch durch Händedruck gedankt. Dann übergab Carnegie ihm die im Nebensaal in Säcken aufbewahrte Anzahlung von 1000 Millionen in Gold und Kassenscheinen, sowie 29 Anweisungen zu je 1 Milliarde Dollar auf den Gesamtgrundbesitz der Nabobs und eine Befugniserteilung, den Grundbesitz jederzeit veräußern zu dürfen. Sämtliche schriftliche Abkommen lauteten auf den Namen Gregor Tomaszewsky aus Warschau. Das war das für Wassilowitsch erwählte und von diesem angenommene inkognito, dessen er sich für den Rest seines Lebens fürderhin zu bedienen hatte.
Als Wassilowitsch alias Tomaszewsky in den Nebensaal trat und hier die Schätze aufgehäuft sah, faßte ihn von neuem ein Taumel, fast wie damals als er die Lösung des Problems gefunden hatte. Er rieb sich die Stirn, um sich zu vergewissern, daß er wirklich nicht träume, daß es kein Gaukelspiel aus Tausendundeine Nacht war.
Die ehemaligen Besitzer dieser Reichtümer trennten sich zwar nur schwer von dem hier aufgestapelten Mammon, aber sie spielten sich nicht als Kleinigkeitskrämer auf. Zudem winkte ihnen in gar nicht so nebelhafter Ferne ein in die hundertste Potenz sich versteigender Verdienst und eine sinnberückende Machtfülle über alles Gut und Blut der Menschheit.
Draußen in der Welt aber regierten Fürsten nach gewohnter Weise weiter, nicht ahnend, daß soeben die Aktien ihrer Existenz auf das Nullniveau gesunken waren.
Am Ende einer der letzten Straßen der New Yorker Vorstadt Hoboken, unmittelbar am Kai des Hudson River gelegen, steht das mächtige Gebäude einer Eisengießerei, welche Carnegie erst kürzlich hatte errichten lassen. Allen Leuten der Nachbarschaft mußte es in den letzten Tagen aufgefallen sein, daß in der Fabrik Arbeitseinstellungen stattgefunden hatten. Wie verlautet war, wollte der Besitzer den Betrieb vorläufig einstellen. Durch die Tore des Fabrikgrundstückes, durch welche sonst kurz vor Beginn und nach Beendigung der Arbeitzeit große Scharen rußbedeckter Männer sich ergossen hatten, sah man jetzt zu derselben Zeit kaum dreißig Arbeiter ziehen. Um die Stillegung des Eisenwerks, welche doch sicher von der Presse eifrig besprochen wurde, nicht gänzlich unmotiviert zu lassen, hatte Carnegie ausgesprengt, daß er große bauliche Veränderungen innerhalb der Gießerei vorzunehmen beabsichtige. Darum wurde bald nicht mehr von der Sache geredet, auch die Nachbarschaft in Hoboken schenkte der Betriebseinschränkung keine weitere Beachtung.
Die umfangreiche Eisengießerei bestand aus etwa zehn Gebäuden. Diese lagen jetzt außer einem unbenutzt da. Keine Feuerslohe der Puddelöfen erhellte mehr mit ihrem gespenstischen Schein die hohen Räume, in denen sonst glutflüssiges Eisen in Gießpfannen und Konvertern brodelte. Kein dröhnendes Hämmern und Stampfen der Maschinen erfüllte wie ehedem die Luft. Über alles war Kirchhofsstille gebreitet. Nur in dem Hauptgebäude des großen Eisenwerkes schien noch Tätigkeit zu herrschen. Wie vordem entquollen seiner turmhohen Esse schwarze Rauchwolken.
Der größte Teil der Arbeiterschaft hatte keinen Zutritt zu der Gießhalle und zu den herumliegenden Räumen. Hier waren allein Männer unter der Oberaufsicht des Werkmeisters tätig. Mit diesem ausgewählten kleinen Trupp hatte es nun eine eigene Bewandtnis. Auffällig war es der übrigen Arbeiterschaft, daß die im »Innern« beschäftigten Leute ihnen sämtlich fremd waren, und einem näheren Verkehr ängstlich auswichen. Auch blieb es nicht ohne Beachtung, daß die 12 fremden Arbeiter tagtäglich Überschicht machten, ja man munkelte sogar davon, daß auch in nächtlicher Weile in der Gießerei gearbeitet würde. Das alles mußte verdächtig erscheinen, und mancher legte sich auf's spionieren, ohne aber etwas zu ergründen. Ertappte der Werkmeister jemanden dabei, so wurde dieser sofort entlassen. Ein mahnendes Beispiel für die anderen. Einige abergläubige Leute meinten, daß es im »Innern« nicht mit rechten Dingen zugehe, der Teufel braue sicher in den mächtigen Gießpfannen allerlei ungeheuerliche Tränkchen zusammen. Von nähergelegenen Häusern der Nachbarschaft wollte man beobachtet haben, wie hinter den rußbedeckten Fenstern der Gießhalle nachts von Zeit zu Zeit angefachte Feuerslohe aufflackerte.
Dies alles gab Gesprächsstoff in Hülle und Fülle.
Die Arbeiter, welche sich im Innern der Gießerei betätigten, waren, wie es hieß, von einem anderen Stahlwerk Carnegies aus Pennsylvanien herübergeholt worden und wohnten mit ihrem gestrengen Werkführer in einem auf dem Fabrikplatz gelegenen Häuschen, das für niemand, auch dem Portier nicht, zugänglich war.
Als sich mit dem seltsamen Treiben in der stillgelegten Gießerei schließlich auch weitere Kreise beschäftigten, und die Tagesblätter gar noch davon Notiz nahmen und ihrer Leserwelt sensationell zurechtgestutzte nähere Angaben aus »kompetenter Quelle« auftischten, da fand es Carnegie an der Zeit, solchen gefahrbringenden Gerüchten mit glaubwürdigeren Auskünften entgegenzutreten. Er ließ durchblicken, daß es sich um die Erprobung einer neuen Sorte Panzerplatten handele, welche Experimente geheimgehalten werden müßten, bis daß ihr Ergebnis ein zufriedenstellendes sein würde.
Das also war das große Geheimnis. Das die Nachtarbeit des Teufels in der Gießhalle. Carnegie hatte es glänzend verstanden, die Angelegenheit, welche die Leute beschäftigte und die fortgesetzt müßige Zungen in Bewegung setzte, geschickt zu bemänteln.
So gingen Wochen ins Land. Der Krieg zwischen Amerika und England war in ein Stadium gerückt, das jeden Tag eine Seeschlacht auf dem »Atlantischen« erwarten ließ. Die Landmiliz feierte unterdessen ihre Siege in BritischKanada. In Washington herrschte aber nicht gerade die große Zuversicht auf das Kriegsglück, welches das Volk beseelte, besonders darum nicht, weil die Staatssäckel sich zu leeren drohten und an Bargeld ein höchst auffallender Mangel im Lande vorhanden war.
Die fehlende, der Zirkulation der Banken entzogene Milliarde Dollar, welche Wassilowitsch in dem Keller seines bei New York gelegenen Landhauses aufbewahrte, machte sich bei den Anleiheversuchen der Regierung so fühlbar, daß die Herren im Kapitol bedenklich und unruhig wurden.
Als dann gar noch die Finanzgrößen, die Geldmänner der Union, Rockefeller, Field und Konsorten erklärten, mit Bargeld nicht dienen zu können, da wurde die Lage verzwickt. Schwarzseher krächzten nun in allen Tonarten, so daß jedermann im Norden und Süden himmelangst wurde.
Während man sich im Kapitol die Köpfe darüber zerbrach, weshalb die hohe Finanz aus eigenem Antrieb gar nichts tat, um einen sie am meisten treffenden unglücklichen Ausgang des Krieges nach Kräften zu verhüten, sahen diese selbst in ihrer Abgeschiedenheit die Lage in rosigerem Licht. Für sie war die Situation nicht so bedenklich, denn sie gedachten im eintretenden Notfall der Kriegsführung mit großen Mengen Kunstgoldes beizuspringen.
Noch donnerten die Geschütze Englands nicht am amerikanischen Gestade, bis dahin hatten die Retter ihres Vaterlandes Zeit ihrem geheimnisvollen Gewerbe nachzugehen.
Zwischen vier Wänden waren zwei Dutzend Hände ruhelos tätig, getrieben von dem Gedanken, sich zum bestimmenden Faktor über die Geschicke der Völker des Erdballes aufschwingen
In tiefstes Dunkel der Nacht gehüllt lag die Hobokener Gießerei da. Nur von Zeit zu Zeit flammte es hinter den berußten Scheiben des Hauptgebäudes im roten Lichtschein auf. Ein aufmerksamer Lauscher hätte auch vernehmen können, daß drinnen Cyklopen bei der Arbeit waren, wenn es ihm nicht schon der dicke, schwere Rauch des mächtigen Schornsteines im voraus verriet.
Die Glocke der Fabrikuhr schlug eben in dumpfen Tönen zwölf, als drinnen in der Gießhalle einige von Kohlenstaub geschwärzte Männer die Roste der zwei großen Puddelöfen mit neuem Brennmaterial beschickten, während vier andere den einen der Konverter in Bewegung setzten, dessen glutflüssigen Inhalt abzapften und in die vor ihm aufgestellten Coquillen laufen ließen.
Unter der sachkundigen Leitung des Werkmeisters vollzog sich der Gußprozeß in gewünschter Weise.
»An die Zahnstange, meine Herren!« dirigierte der Werkführer, in welchem wir Wassilowitsch erkennen.
Die Kippvorrichtung der Bessemer Birne setzte sich in Bewegung und ein breiter, rotgoldener Streifen, ein Glutstrom flüssigen Edelmetalls ergoß sich in die darunter stehende Pfanne.
Letztere entleerte wieder ihren kostbaren Inhalt in die zahlreichen Coquillen. Das brodelnde Hexengold erstarrte dann hierin zu gediegenen Barren.
»Die Schmelze ist gelungen. Die Herren verstehen ihr Handwerk, das muß ich sagen,« scherzte Wassilowitsch. »Ich denke, sie werden bald ohne mich fertig werden.«
Wenn vor wenigen Wochen noch jemand zu den Herren aus der Fifth Avenue gesagt haben würde, daß sie in Bälde rußgeschwärzten Gesichtes Zangen und Pfannen handhaben müßten, den hätten die Geldaristokraten als reif fürs Irrenhaus bezeichnet. Und nun war es so gekommen. Die Männer, die hier zum erstenmal in ihrem sorgenlosen Leben den Schweiß harter Arbeit über ihre Stirn rieseln sahen, hatten sich selbst zu Arbeitern degradiert. Freilich nur um den Preis der Weltherrschaft!
Rockefeller, Carnegie, Field und Gould bedienten eben den Konverter, und Wassilowitsch, der Werkmeister seiner aristokratischen Gesellen, gefiel sich dabei in der ihm übertragenen Oberleitung.
»Wieviel Barren haben wir bereits im Speicher?« frug Field seinen Arbeitsgenossen Rockefeller, welcher über die fertiggestellten Goldvorräte Buch zu führen hatte.
»Rund tausendzweihundert ...« lautete die Antwort.
Die Goldbarren, von den Yankees Boullion genannt, wurden in der Carnegieschen Goldschmelze durchweg zu einem Gewicht von 50 Kilo gegossen. Da die New Yorker und Londoner Börse für die Troyunze Standardgold ungemünzt 19 Dollar bzw. 78 Schillinge notierte, so präsentierte jeder der Boullions einen Nominalwert von über 22 000 Dollar oder fast 4700 Pfund Sterlinge. Die fertiggestellten Kunstgoldvorräte der mysteriösen Schmelze bewerteten sich insgesamt also erst auf lumpige 26 Millionen Dollar. Die Herren von der Fifth Avenue mußten also noch viermal solange in der Gießerei tätig sein, bis sie die an Wassilowitsch geleistete metallische Baranzahlung in Kunstgold wieder verfügbar hatten. Der Russe hatte nämlich 100 Millionen Dollar in gemünztem und in BarrenGold erhalten, den Rest der Zahlung hatten Kassenscheine, Banknoten und Schecks auf amerikanische Banken gebildet.
Dem Anschein nach befanden sich die hohen Herren ganz wohl bei ihrer schweren Arbeit, denn sie plauderten oft bei den alle Kräfte in Anspruch nehmenden Verrichtungen an den Schmelztiegeln und Kesselfeuerungen. Ein interessanter Anblick war es, einigen der überfetten Gestalten, die das Arbeiten bisher nur dem Namen nach kannten, zuzusehen, wie sie sich im Schweiße des Angesichts abmühten, ihrer ungewohnten Tätigkeit gerecht zu werden. Mr. Astor und Mr. Gould, die sich durch ein stattliches Embonpoint auszeichneten, wie abgehetzte Droschkengäule schnaufen zu hören, war ein Schauspiel für sich.
»Lassen Sie ja nicht den Manometer des dritten Kessels außer acht, Mr. Field!« rief Wassilowitsch dem Radiumkönig zu, als er für den Rest der Nacht sich aus der Gießhalle entfernen wollte. »Sie wissen, daß der Ingenieur nicht(*) intakte Stellen bei ihm vermutet. — — — Sechs Atmosphären ...«
(*) Anmerkung des Herausgebers: Im Original steht hier nur »intakte«. Hoffmann meinte aber offenbar das Gegenteil von »intakt«, was dafür spricht, dass hier beim Schriftsatz das Wort »nicht« ausgelassen worden ist oder im Manuskript statt »intakte« ein anderes Wort, z.B. »undichte«, stand.
»All right!« ließ sich die Fistelstimme des Milliardärs vernehmen.
Der Pseudowerkmeister verschwand, nachdem er den Herren der Nachtschicht ein »Good night!« gewünscht hatte und begab sich in das Häuschen, welches ihm und den Nabobs zur Wohnung diente.
Es mochte gegen ein Uhr sein. Aus der Gießerei klang verworren das Getöse herüber, welche die Dampfkräne verursachten, sobald sie in Bewegung gesetzt wurden. Periodisch aufflackernder, fahlrötlicher Lichtschein warf seinen Reflex von der Gießhalle hinüber auf die Fenster des Gemaches, in welchem Wassilowitsch alias Tomaszewsky soeben sein müdes Haupt in die Kissen drückte. — — — — —
Da! — — — was war das? Ein starkes Zischen und Brausen ertönte über den Hof weg. Wassilowitsch sprang von seinem Lager auf — — —
Ein folgendes Donnerkrachen. eine feurige Wolke, und über dem Buckligen brach die Decke des Zimmers ein ...
Draußen aber schossen Feuergarben haushoch aus der Gießhalle, um gleich wieder zu verlöschen — — — dann herrschte Totenstille ...
Unweit der im maurischen Stil gehaltenen Hauptsynagoge in der 5. Avenue zu New York liegt ein monumentales Palais, dessen Eckfronten vier hochaufstrebende, im gotischen Stil gehaltene Türme zieren. Die architektonisch schöne Fassade des freistehenden Gebäudes mußte jedem Passanten der Avenue auffallen, um so mehr, als das Portal mit dem prächtigen Spitzbogen seiner echten, aus dem Mittelalter stammenden Türen wegen berühmt war.
Lange Reihen spitzbogiger Fenster ließen auf zahlreiche Gemächer im Innern schließen. Die Hinterfront des Palais lag unmittelbar dem großen Zentralpark zu, einen herrlichen Ausblick über denselben gewährend.
Es war um die sechste Abendstunde, als sich dem Palais ein in einem weiten Havelock gehüllter kleiner Mann nahte. Er stand kaum vor dem Portal, als sich dasselbe auch schon öffnete. Der Ankömmling mußte offenbar erwartet worden sein, denn der Portier geleitete ihn sofort in ein Empfangszimmer des ersten Stockwerkes. Dem Besucher schien das Haus auch gar nicht so fremd zu sein. Er schritt mit einer gewissen Sicherheit und Ortskenntnis über die Marmorfliesen des Treppenhauses und die mit kostbaren Läufern bedeckten Stufen empor, dem Portier vorangehend.
Der Fremde, welcher eben die Schwelle des Gemaches überschritt, entpuppte sich, nachdem ihm ein hinzukommender Diener Mantel und Hut abgenommen hatte, als Wassilowitsch.
Dieser Mann, der den Mittelpunkt bildete, um den sich alles Glück und Unglück der Welt gruppierte, schien tatsächlich von einem höheren Geschick vor dem Untergange bewahrt zu bleiben. Einmal schon war er den Fluten des Meeres entrissen worden, und das zweite Mal, als die Kesselexplosion die Carnegiesche Gießhalle und ihre Umgebung in Trümmer gelegt, hatte wieder die Vorsehung die Hand im Spiele gehabt: er blieb der einzige Überlebende jener geheimnisvollen Goldschmelze in Hoboken.
Nur wenige Minuten waren es, welche Wassilowitsch, der neugebackene Milliardär, auf das Erscheinen der wegen ihrer orientalischen Schönheit berühmten Witwe des Radiumkönigs warten mußte. Er hatte sich eben auf einen der kostbaren Sessel, die aus der Empirezeit stammten, niedergelassen und sein Auge glitt gerade flüchtig über die farbenprächtigen Deckengemälde, als sich eine Seitentür öffnete und Mrs. Field in das Gemach rauschte.
Wassilowitsch fuhr wie elektrisiert von seinem Sessel auf.
»Ah, lieber Mr. Wassilowitsch, es freut mich, daß Sie meiner Einladung Folge geleistet haben. Sie sind übrigens von großer Pünktlichkeit,« sagte die Dame des Hauses, der man es nicht anmerkte, daß sie durch das kürzliche Ableben ihres Gatten sonderlich betrübt war. Sie heftete die Glutaugen mit einem ihrer bezauberndsten Blicke auf die vor ihr stehende Mißgestalt.
Wassilowitsch, der nie in seinem Leben Verkehr mit Frauen gepflegt hatte, noch dazu mit einer so üppigen Schönheit des Orients, bebte bei der huldvollen Ansprache und den berückenden Blicken wie ein Jüngling, der zum erstenmal die Freuden der Liebe kosten lernt. Schon einmal hatte er in Fields Hause geweilt und hier in bester Gesellschaft einen herrlichen Abend verlebt. Seitdem war ihm das satanisch schöne Weib des Milliardärs nicht wieder aus dem Sinn gekommen. Hatte sie doch schon damals es nicht versäumt, ihn mit kleinen Gunstbeweisen zu beglücken.
»Es ist zuviel Ehre für mich,« stotterte Wassilowitsch und küßte die ihm dargereichte schneeweiße Hand.
»Nehmen Sie bitte Platz, mein Lieber,« sagte Mrs. Field und ließ sich gleichfalls in einen der Fauteuils nieder. »Aber nein! Wir wollen nicht in dem kalten Empfangszimmer bleiben, Mr. Wassilowitsch. Ich werde Sie in meinen blauen Salon führen.« Bei diesen Worten erhob sie sich und setzte eine elektrische Klingel in Bewegung.
Unmittelbar darauf öffnete sich die Tür und ein Lakai frug nach den Befehlen von Mrs. Field. Die schöne Frau gab dem Diener einige Anweisungen, und dieser verschwand wieder.
»Ich nehme an,« begann die Circe, »daß Sie ein Abendessen in meiner Gesellschaft nicht ausschlagen werden.«
Solche Gunstbezeigungen überwältigten Wassilowitsch.
»Ich weiß nicht — — — Mrs. Field — —« stotterte er höchlichst verlegen, »wie ich zu der Ehre komme ...«
»Aber machen Sie doch keine Umstände. Ich würde glücklich sein, mit Ihnen einige Stunden plaudern zu können.« Dabei heftete das verführerische Weib die dunklen Augen auf Wassilowitsch und wieder umspielte ein Befriedigung ausdrückendes Lächeln ihre Mundwinkel.
Mrs. Field war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schönheit, aber, wie schon gesagt, kein abendländischer Typus. Ihr Gatte hatte sie auf einer Orientreise in Kairo auf dem Boulevard Mehemed gesehen und sich sofort sterblich in die Schöne verliebt. Daß es einem Manne, der über eine Milliarde verfügte, nicht schwer wurde, das Weib seiner Wahl zu bestimmen ihm zu folgen, das bedarf wohl kaum einer Erwähnung. Das Gold des Geldaristokraten übte auf die Zirkassierin, die ihrem Gatten Achmed Efendi in Konstantinopel entflohen war und sich seitdem in Kairo aufhielt, einen bezaubernden Einfluß aus. Besimé, wie sich die Tochter des Morgenlandes nannte, folgte Field als dessen Favoritin nach New York. Einige Wochen später machte sie der Radiumkönig zu seiner Frau. Mrs. Field hatte an die Welt in bezug auf ihr Herz keine Ansprüche. Ihr war die Person, der sie ihre Gunst schenkte, völlig gleichgültig, wenn sie nur in Freiheit und Luxus leben konnte. Es verwunderte daher nicht, wenn nach dem häßlichen Field der noch häßlichere und mißgestaltete Wassilowitsch, ein Mann mit unermeßlichen Reichtümern, als Günstling folgte.
Solange der Russe Besimé gegenüberstand, gab es für ihn kein vernünftiges Denken. In solchen Augenblicken wirbelten ihm die Sinne durcheinander und er sah nur das berückende Weib, das für den Mann, der das größte Geheimnis der Welt in seiner Brust barg, gefährlich werden konnte. Die ehemalige Odaliske mochte sich mit dem Gedanken tragen, Wassilowitsch ihrem Willen so gefügig zu machen, daß er wie weiches Wachs in ihren Händen zu jedem Bekenntnis bereit war.
Der Diener trat jetzt ein und teilte seiner Herrin mit, daß die gewünschten Anordnungen getroffen seien.
Besimé Field erhob sich und reichte ihrem Besucher den Arm.
»Kommen Sie, Mr. Wassilowitsch.«
Beide verließen das Empfangszimmer und begaben sich in den blauen Salon, welcher in demselben Stockwerk lag.
Das Gemach, welches seiner blauen Tapeten wegen diesen Namen trug, war ganz und gar orientalisch ausgestattet. Es war das Lieblingsboudoir der Zirkassierin. Hier war nichts von dem Meublement und den zahllosen Dingen, die umherstanden, was nicht aus der Türkei stammte. Alles war echt, von der Nargileh bis zur Sorbetschale, von den Smyrnateppichen bis zu dem rosafarbenen Tüllbaldachin, den Besimé als Andenken an Stambul nach New York importiert hatte.
Ein berauschender Wohlgeruch erfüllte das Gemach. Es kam Wassilowitsch in seinem Freudentaumel vor, als wenn er in einem Meer von Duft bade. In solcher berückender Atmosphäre mußte er vollends zu einem begehrenden, willenlosen Geschöpf werden.
Nachdem nun einige Worte über den stattgefundenen Unglücksfall in der Gießerei und darüber, wie er dem Tode entronnen war, gewechselt worden, kam Wassilowitsch darauf zu sprechen, daß man jetzt überall glaube, er sei noch am Leben, und daß die Regierung deshalb alle Hebel in Bewegung setzen würde, seiner habhaft zu werden.
»Mein Palais ist ein sicheres Versteck,« sagte die Circe mit dem ganzen Wohlklang ihrer glockenhellen Stimme. »Sie sind darin sicher geborgen. Keinem Menschen wird es in den Sinn kommen, Sie bei mir zu suchen.«
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll,« versetzte Wassilowitsch und wagte, die zarte, wohlgepflegte Hand seines bezaubernden Visavis an den Mund zu führen und einen Kuß darauf zu drücken.
Die Milliardärswitwe ließ ihn kokett gewähren.
Sinntrunken blickte der so beglückte Mann die satanisch schöne Orientalin an.
»Wer ewig diese Hand küssen dürfte ...« entrang es sich dann leise seinen Lippen, und ein folgender Seufzer schien zu verraten, daß er keine Hoffnung hegte, jemals mehr als eine solche Vergünstigung von Besimé zu erhalten.
»Sie seufzen, mein lieber Freund? In meiner Gegenwart — — und ich glaubte, Sie würden in meiner Nähe heiter gestimmt sein.«
Wassilowitsch blickte ihr ins Glutauge. Dann riß er ihre Hand ungestüm wie ein feuriger Jüngling an seinen Mund und bedeckte diese mit heißen Küssen der entflammten Leidenschaft.
Besimé triumphierte im stillen und ließ ihren Anbeter gewähren.
Die Szene wurde durch den soeben eintretenden Diener unterbrochen.
»Es ist serviert,« klang es mechanisch aus dem Munde des Domestiken.
»Es ist gut,« gab Mrs. Field zurück.
Der Diener verschwand, nicht ohne einen neugierigen Blick auf den seltsamen Besucher geworfen zu haben, der so leidenschaftlich die Hand der Hausherrin geküßt hatte.
Mrs. Field ließ sich von Wassilowitsch zu dem Speisesaal geleiten, wo ein Souper en deux eingenommen werden sollte.
Fast kaum nippte der Günstling der Circe von den auserlesenen Speisen, die Küche und Keller geliefert hatten. Dagegen sprach er dem feurigen Burgunder und dem französischen Sekt in einem bedenklichen Maße zu.
Besimé brauchte Wassilowitsch in dieser Hinsicht kaum einmal zu ermuntern.
Nach dem Dessert präsentierte ihm die Odaliske eigenhändig einen Tschibuk, während sie selbst die Nargileh benutzte.
Jetzt kam die eigentliche Plauderstunde. Während des Soupers hatte sich das Gespräch zumeist um äußerliche Dinge gedreht. Jetzt aber gab Besimé der Unterhaltung einen intimeren Anstrich.
Mit raffinierter Absicht ließ sie bald eine unvorsichtige Bemerkung fallen, die Wassilowitsch vollends in einen Liebestaumel versetzte.
Er stürzte vor dem angebeteten Weibe sinntrunken hin und barg seinen Kopf, der von Wein und Leidenschaft stärk gerötet war, in ihrem Schoß. Über Besimés Gesicht huschte in diesem Augenblick ein Strahl der Siegesfreude. Sie hatte erreicht, was sie gewollt — der Mann gehörte ihr.
Es war ein eigentümliches Bild. Dieser grundhäßliche und verwachsene Mann zu den Füßen einer der schönsten Frauen des Orients.
Aber Besimé wußte, was sie tat, wenn sie die Sinne Wassilowitschs berückte. Ihr Trachten stand danach, als die Gattin des vor ihr liegenden Milliardärs, der über ein Geheimnis, eine Kunst verfügte, die ihm Kaiser und Könige untertan machen konnte, diese Macht mit ihm zu teilen.
Mrs. Field konnte, wenn sie wollte, das bestrickendste und hingebendste Weib des ganzen Erdbodens sein, aber auch, wenn man es wagte, ihre Kreise und Pläne zu stören, den Satan in persona verkörpern.
Da nun Wassilowitsch ihr im Verlaufe des Abends in jeder Beziehung zu Willen war, so stand auch sie nicht an, dem häßlichen Manne alle Vergünstigungen zu gewähren, die ein raffiniertes Weib ihrem sinntrunkenen Anbeter zu geben vermag.
Als Wassilowitsch sich zur Nachtruhe begab, befand er sich in einem Taumel, in welchem er, wenn die Circe von ihm verlangt hätte, ihr sein Geheimnis bis in die Details verraten haben würde.
Besimé wollte sein Weib werden — — — sein Weib — — — — Der überglückliche, in den Netzen der Odaliske zappelnde Mann hätte in seinen kühnsten Träumen so etwas nicht zu hoffen gewagt. — Und nun war es so gekommen.
Wassilowitsch verbrachte eine schlaflose Nacht. Erst als sich die Morgendämmerung in sein fürstlich augestattetes Schlafgemach stahl, zollte er Gott Morpheus den schuldigen Tribut und versank in einen tiefen Schlummer — — — — —
Der Tod der Milliardäre und die Auffindung der aufgespeicherten Kunstgoldbarren brachten die ohnehin durch den Krieg schon in fortgesetzter Unruhe lebenden Bürger der nord- und südamerikanischen Staaten in noch höhere Erregung. Als dann gar die Vermutung laut wurde, daß Wassilowitsch möglicherweise noch am Leben sein könne, da überkam alle Welt ein panischer Schrecken. Riesengroß stand das Drohgespenst des Goldmachers wieder vor jedermanns Augen und hatte das zunächst zur Folge, daß England sofort den Krieg mit Amerika abbrach und seine Flotte nur Kanadas Küste verteidigen ließ. Aber es kam auch nicht einmal soweit, denn ein Kabeltelegramm von London nach Washington trug der Regierung im Kapitol vorläufigen Waffenstillstand an, der von den Yankees auch akzeptiert wurde.
Daß man eifrig nach Wassilowitschs Person fahndete, zeugt davon, daß alle mißgestalteten Menschen in ganz Amerika auf ihr Nationale hin von den Behörden in strengstes Verhör genommen wurden. Auch der bucklige José, der als Wassilowitsch eine zweitägige Rolle auf dem Welttheater gespielt hatte, und sein Kumpan Ben wurden nochmals von der Exekutivbehörde aufs peinlichste interviewt.
Mrs. Field hatte unmittelbar nach dem Unglück in der Carnegieschen Gießerei von Wassilowitsch ein Schreiben erhalten, worin dieser ihr insgeheim mitgeteilt, daß er der von der Welt gesuchte Adept sei und mit Mr. Field, ihrem Gatten, zusammen in Hoboken in der Goldschmelze tätig gewesen wäre. Da man ihm aber jetzt zweifelsohne auf der Spur sei, so bäte er um einstweilige Unterkunft in ihrem Palais, wo er sich allein sicher wähne.
Mrs. Field hatte kaum das Schreiben empfangen, als sie auch schon den Entschluß faßte, den Mann ganz in ihre Gewalt zu bringen. In liebenswürdiger Weise sandte sie ihm sofort die Nachricht, daß sie ihn am selbigen Abend zur sechsten Stunde erwarten werde. Wassilowitsch hatte sich, wie wir gesehen haben, prompt eingestellt und mit der schönen Witwe bald einen Pakt abgeschlossen, wonach er sich bis auf weiteres im Palais verborgen halten wollte.
Heimlich hatte dann Wassilowitsch seine eisernen Kisten mit den Geldsäcken und Banknoten bei Nacht und Nebel in das Palais bringen lassen, wo dieselben in einem seiner Appartements aufgestapelt wurden.
Während in ganz Amerika fieberhaft nach dem gefährlichen Adepten gesucht wurde, befand sich dieser an einem Orte, wo ihn niemand vermutete.
In so unmittelbarer Nähe von Mrs. Field, wurde sein Verhältnis zu dieser täglich intimer, so daß schon die Bediensteten die Köpfe zusammensteckten und sich allerlei zuflüsterten.
Wassilowitsch war im Hause unter dem Namen eines Mr. Doyle bekannt. Er ging nie aus und vermied es sorgfältig, mit jemand anders als mit Mrs. Field und Mr. Jefferson, dem Geheimsekretär des verstorbenen Radiumkönigs, zusammenzukommen. Dieser, der einzige Vertraute von Mrs. Field, war von derselben sozusagen zum persönlichen Dienst bei Wassilowitsch kommandiert worden. — — —
Etwa acht Tage nach Wassilowitschs geheimer Übersiedelung in das Palais waren in dem Park des letzteren eine Anzahl Arbeiter mit der Errichtung eines hölzernen Gebäudes, welches eine einzige Halle mit abnehmbarem Dach bilden sollte, beschäftigt. Nach Vollendung des Baues wurde zur großen Verwunderung der Dienerschaft in denselben allerlei seltsames Material geschafft. Unter anderem auch ein gewaltiges Aluminiumgestell, viel Tauwerk und ein umfangreicher, mannshoher Korb.
Vergeblich zerbrachen sich die Bediensteten im Fieldschen Palais die Köpfe, welche exzentrische Idee ihre Herrin wieder einmal haben könne. Denn daß diese exzentrisch war, das hatte sie schon oft bewiesen.
Wieder gingen Tage vorüber, und es sprach sich bereits im Hause herum, daß sich Mrs. Field ein lenkbares Luftschiff habe bauen lassen. Man schüttelte allseits die Köpfe, wußte aber nun, welchen Zwecken die errichtete Halle dienen sollte.
Eine weitere Woche floß ins Land, und die Dienerschaft von Mrs. Field hatte sich längst an die neue Marotte ihrer Herrin gewöhnt, die, wie man sich gegenseitig zuraunte, den äronautischen Sport pflegen wollte. Aber über eins wunderte man sich doch noch, nämlich darüber, daß es bisher noch nicht zu einem Probeaufstieg gekommen war. Stand doch das Luftschiff Tag und Nacht gasgefüllt zur Auffahrt bereit, und auch der Konstrukteur desselben war jede Minute zu Mrs. Fields Verfügung anwesend.
Als die Witwe des Radiumkönigs durch Jefferson erfuhr, daß die Dienerschaft allerlei munkele und sich wundere, daß noch kein Probeaufstieg mit dem Ballon erfolgt sei, da ließ sie durch ihren Vertrauten weiterkolportieren, daß sie nur auf einen Tag warte, an welchem ein günstiger Wind wehe, ein Wind, der, falls das Steuer aus irgend welchen Gründen versagen sollte, sie nicht auf den Ozean hinaustreiben würde.
Die Dienerschaft fand diese Ausstreuungen sehr glaubwürdig und zeigte darum vorläufig auch keine weitere Neugier oder Mißtrauen.
Mrs. Field wurde aber von Tag zu Tag nachdenklicher. Trotzdem sie sah, daß man auch nicht die geringste Spur von ihrem Schützling bisher aufgefunden hatte und daß die Regierung im Verein mit den Behörden die Fährte des mysteriösen Adepten nicht zu entdecken vermochte, verhehlte sie es sich nicht, daß der böse Zufall einmal einen Possen spielen und Wassilowitsch verraten könne. Sie hatte deshalb mit letzterem eine Flucht im Ballon geplant, sobald die Gefahr der Entdeckung nahe sei. Seine Milliarde Dollar wollte Wassilowitsch selbstverständlich nicht im Stich lassen, weshalb er auf den Gedanken gekommen war, die Geldsäcke an Stelle von Sandballast im Ballon mitzunehmen.
Das hatte Mrs. Fields vollste Billigung gefunden.
Insgeheim war darum zur Nachtzeit der riesenhafte Geldschatz in die Halle gebracht worden und lag dort für eine plötzliche Auffahrt parat. Hätten solche Erzgauner wie Ben und José davon Witterung bekommen, so wäre ihrerseits wohl bald für eine Verringerung dieses kostbaren Ballonballastes gesorgt worden. So aber hatte niemand eine Ahnung davon, daß die schlichte Halle so unermeßliche Reichtümer barg.
Alltäglich jagten sich in der Presse Sensationsnachrichten, nach denen Wassilowitsch bald in Chicago, bald in San Franzisko entdeckt worden sein sollte. Die Reporter erfanden die unglaublichsten Geschichten, in denen der Held des Tages eine Rolle spielte. Nebenher ergingen sich die Politiker und Finanzleute der ganzen Welt über die Gestaltung der Zukunft in den vagesten Kombinationen. Auch für sie war die Presse der Ausdruck ihrer täglich wechselnden Gefühle, das Sprachrohr ihrer Vielzüngigkeit und der Stapelplatz ihrer Gedanken. Zu alledem peinigte sie noch die Ungewißheit: lebt Wassilowitsch wirklich oder existiert er nur als Phantom im Kopfe erhitzter Gemüter? Wenn man den Millionenschatz in Kunstgold, der in der Carnegieschen Gießerei gefunden worden war, in Betracht zog, so mußte sich jeder der Annahme zuneigen, daß der gefährliche Adept insgeheim sein Wesen in Amerika trieb und mit den Herren der hohen Finanz unter einer Decke gesteckt hatte. Zog man aber andererseits wieder die Perspektive, daß Carnegie und Genossen vielleicht schon seit langem im Besitz des erkauften Geheimnisses waren, so durfte man wieder daran zweifeln, daß Wassilowitsch wirklich dem Tode in den Wellen entgangen war. Letztere Ansicht fand noch ihre Bestärkung darin, daß man bei der Aufräumung des Trümmerfeldes der Carnegieschen Schmelzerei wohl die Leichen der Milliardäre, aber nicht die Wassilowitschs gefunden hatte.
Außerhalb Amerikas Grenzen mochte man der Ansicht sein, daß Bruder Jonathan mit der übrigen Welt ein Versteckspiel treibe, um irrezuführen. Denn daran konnte und wollte keine Regierung und kein Volk glauben, daß Wassilowitsch unauffindbar sein sollte.
So nahm es denn nicht Wunder, wenn wiederum ein Weltboykott in aller Eile konstruiert würde, dessen Spitze sich diesmal gegen die Herren der »Neuen Welt« richtete. John Bull, der doch allen Grund hatte, wegen des noch nicht beendeten Krieges sich duck zu halten, tutete aber dabei am meisten ins Horn.
Die kritische Weltlage drückte dem amerikanischen Handel und Wandel ihren unverkennbaren Stempel auf. Am schwersten litten die Industrie mit ihrem Exportgeschäft und das gesamte Finanzwesen. Dies kam am ehesten auf den großen Börsen der Vereinigten Staaten, noch mehr aber auf denen im Ausland zum Ausdruck.
Ein grelles Schlaglicht warf in dieser Hinsicht die Londoner Effektenbörse, welche seit Jahrzehnten den Ruf an sich gerissen hatte, das Barometer zu sein, das mit großer Empfindlichkeit alle Wendungen der politischen, finanziellen und volkswirtschaftlichen Zeitumstände anzeigte. Wie diese, so handelten auch alle anderen Börsen der Welt vorläufig keine amerikanischen Wertpapiere. Was davon bisher im Kurse hoch über Pari notiert stand, war fast auf das Nullniveau der Wertigkeit gesunken. Wie die Effektenbörsen, so verhielten sich auch die Waren, Produkten- und sonstigen Spezialbörsen der Erde. Die New Yorker Hauptbörse war wider Willen gezwungen, darauf zu reagieren, indem der ausländische Effektenhandel bei ihr ebenfalls einen Niedergang zeigte. Aber auch die Bergwerks, die Petroleum- und die Nationale Baumwollbörse der amerikanischen Metropole verspürten den schweren Handstreich, den der wieder lebendig gewordene Boykott nach ihnen ausführte.
Im Kapitol zu Washington war die Kopflosigkeit so groß, daß keiner weder aus noch ein wußte. Ja, hätte man wenigstens Wassilowitsch oder sein Goldrezept in den Händen gehabt, so könnte man der Welt und ihren Angriffen zu trotzen versuchen. So aber war es rein zum Verzweifeln. Harrison und seine Berater hatten sicher schon eine Reihe schlafloser Nächte hinter sich. Sie wären am liebsten selbst als Detektivs durch ihr eigenes Land gezogen, um den Mann aufzustöbern, der ihnen so unendlich viel Sorge machte.
Als die Not am höchsten stieg und sämtliche Mächte der Erde mit einer vereinigten Flotte die Gestade Amerikas zu bombardieren drohten, da fügte es aber ein höheres Geschick, daß ein Wendepunkt eintrat.
Am 3. Oktober des Jahres, in dem unsere Erzählung spielt, durcheilte Amerika plötzlich die Kunde, daß Wassilowitsch in New York sich versteckt halte.
»Lieber Freund!« rief Mrs. Field Wassilowitsch erregt zu, als sie in der Abendnummer des »New York Herald« gelesen hatte, daß man ihrem Schützling auf der Spur sei. »Wir müssen uns jetzt auf eine Entdeckung unbedingt gefaßt machen.«
Besimé hatte dies in sich fast überstürzenden Worten ausgerufen.
Wassilowitsch riß ihr förmlich das Zeitungsblatt aus der Hand und warf einen Blick auf die Notiz, die ihm alles andere, aber nicht gleichgültig war.
»Wer mag davon Witterung bekommen haben?« frug er hastig. »Einer von Deinen Bediensteten, Besimé?«
Die Gefragte zuckte unruhig die Achseln.
»Auf einen habe ich Verdacht,« antwortete sie.
»Der entlassene Portier?«
Besimé nickte.
»Smith soll die Ballonhalle abdecken. Wir müssen alles zur Flucht bereit halten, denn ich will Harrisons Häschern nicht in die Hände fallen — — — Ach! warum muß ich der Unglückliche sein, den die Vorsehung dazu erwählt hatte, das Sorgenkind der ganzen Menschheit zu werden!« rief der Bucklige schmerzlich aus. »Ruhelos treibt man mich von einem Pol zum andern. Ich mag nun mein Geheimnis verraten oder es für mich behalten, es bleibt sich gleich, die Welt wird mich immerfort fürchten. Gelingt es mir nicht, unerkannt irgendwo mein Dasein zu verbringen, so wird, solange ich noch einen Atemzug tue, die Erde für mich zur Hölle werden.«
Der gequälte Mann hatte seinen langverhaltenen Schmerz in dem Augenblicke, wo wieder einmal ein Wendepunkt nahte, zum Ausdruck gebracht.
Besimé war fest entschlossen, mit Wassilowitsch, seinem Geheimnis und seinen Milliarden zu entfliehen. Sie gab im Stillen noch lange nicht das Spiel verloren, einstmals als die Gattin desjenigen Mannes zu glänzen, der die Geschicke der Welt leiten würde. Man sieht, es war nur und nur Ehrgeiz und Eigennutz, die die schöne Milliardärswitwe bestimmten, Wassilowitsch zu folgen.
Noch zur späten Abendstunde schlich der Adept in die Ballonhalle, um mit Mr. Smith, dem Konstrukteur und bewährten Luftschiffer, das Nötige für eine plötzliche Flucht zu verabreden.
Es war auf die Dauer nicht möglich gewesen, Mr. Smith über alles im Unklaren zu lassen. Eines Tages war er deshalb von Wassilowitsch mit Besimés Zustimmung ins Vertrauen gezogen und gegen eine Million Dollar in Banknoten zu tiefstem Schweigen verpflichtet worden.
Da jeder Augenblick die Entdeckung mit sich bringen konnte, so traf Mr. Smith eiligst alle Vorbereitungen, um jeden Moment zum Aufstieg bereit zu sein.
Die Ballonhülle wurde durch erneute Zufuhr von Wasserstoffgas straffer aufgebläht, der kleine elektrische Motor wiederholt auf seine richtige Funktion geprüft und der Goldballast sorgfältig in der Korbgondel verstaut.
Gegen Mitternacht war auch das Dach der Halle abgedeckt worden, und die silbernen Mondstrahlen glitten nun über das schwankende, braune Ungeheuer, welches gefesselt dalag.
Mrs. Field hatte noch in letzter Abendstunde ein in den Straßen verteiltes Extrablatt zu Händen bekommen, worin bekannt gemacht wurde, daß ein Mann dem Mayor von New York mitgeteilt habe, er sei bereit, gegen den doppelten Betrag der ausgesetzten Belohnung einige Anhaltspunkte zu geben, wo man Wassilowitsch suchen könne. Freilich hatte sich derselbe dabei vorbehalten, daß man ihn für eine möglicherweise nicht ausgeschlossene Irrung seinerseits nicht verantwortlich mache. Der Mayor hatte darauf sofort nach Washington telegraphiert, und jeden Augenblick konnte nun die entscheidende Antwort eintreffen.
Daß dieser Mann niemand anders als der entlassene Portier sein konnte, darüber war man sich im Fieldschen Palais klar. Deshalb trafen Besimé und Wassilowitsch unverzüglich ihre Vorkehrungen zur Flucht.
Mrs. Field wollte sich auf keinen Fall von ihren kostbaren Schmucksachen trennen, weshalb sie selbige in aller Eile verpackte. Die Handtasche, welche sie hierzu benutzte, war bald gefüllt und man überschätzte nicht, wenn man ihren kostbaren Inhalt auf über zehn Millionen bewertete.
Unterdessen hatte sich Wassilowitsch den Goldballast in der Ballongondel nochmals angesehen und mit fieberhafter Unruhe erwartete er nun Besimé.
Mr. Jefferson schlich währenddessen in den Gängen des Palais wie eine Katze herum, um fortgesetzt zu kontrollieren, ob von der Dienerschaft jemand etwas von den nächtlichen Vorbereitungen merke.
Mitternacht mochte verstrichen sein, als sich draußen auf der Avenue Lärm bemerkbar machte.
Erschreckt eilte Mrs. Field an das Fenster, um verstohlen einen Blick durch die Stores auf die Straße zu werfen. Sie sah, wie sich Leute vor dem Palais versammelten und auch Trupps von Militär und Policemen im Laufschritt auf ihr Haus zueilten.
Eben kam Mr. Jefferson unangemeldet in das Boudoir, um Mrs. Field auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen.
Diese aber rief ihm schon erregt zu: »Sie kommen! Jefferson — — — schnell, nehmen Sie diese Handtasche und schleichen Sie sich in die Ballonhalle. Ich und Wassilowitsch, wir müssen jetzt entschlüpfen! — — — Fort! Fort!«
Während Jefferson dem Auftrage seiner gestrengen Gebieterin so schnell als möglich Folge leistete, verschwand diese selbst und eilte in den Park hinab.
Wassilowitsch war das Getöse, welches von der Avenue bis in die stille Halle drang, nicht entgangen, und er zweifelte nicht, daß jetzt der Moment gekommen war, wo die Häscher ihn in ihre Gewalt bringen wollten. Er beauftragte darum Smith, Mrs. Field sofort zu benachrichtigen.
Dies war aber nicht nötig, denn die Genannte trat eben in die Halle.
»Allah il Allah und Mohammed ist sein Prophet! sie kommen — — — laßt uns fliehen!« rief in höchster Aufregung die Tochter des Moslems.
Smith machte sich sofort daran, die Taue, welche den Ballon gefesselt hielten, bis auf einige zu lösen. Wassilowitsch war ihm dabei behilflich. Indessen stieg die junge Frau in die Gondel und nahm Jefferson die mit kostbarem Inhalt gefüllte Handtasche ab.
Smith setzte nunmehr den elektrischen Motor in Gang, schraubte die Wasserstoffleitung ab und tat die sonst noch nötigen Vorbereitungen mit einer Schnelligkeit, die den geübten Praktiker verriet.
Immer stärker tönte der Lärm von der Avenue in die stille Halle herein. Jede Minute war jetzt kostbar. Die geringste Verzögerung konnte den ganzen Fluchtplan zu schanden machen.
»Mr. Smith! Ist alles fertig?« rief Mrs. Field ungeduldig dem Konstrukteur zu.
»All right!« versetzte dieser.
»Was haben wir für Wind?« frug Wassilowitsch und schwang sich mit einem Satz in die Gondel.
»Nordwest,« erwiderte Smith und brachte das Steuer des Ballons in Ordnung.
»Die Dienerschaft läuft schon mit Licht in der Villa herum!« rief Mrs. Field, deren Erregung immer mehr stieg. »Wahrscheinlich fordert man jetzt Einlaß. — Mit der bewaffneten Macht ist nicht zu spaßen ...«
Tatsächlich sah man durch die Zweige der Bäume des Parks Lichtschein vom Hause herüberdringen. Der wüste Lärm auf der Avenue mochte die Bediensteten aus dem Schlafe aufgeschreckt haben.
Zur Flucht in die Lüfte war jetzt alles bereit und Wassilowitsch wartete nur auf den Moment, wo die Leute in den Park stürzen mußten, um ihn dort zu suchen.
Und dieser Moment ließ denn auch gar nicht so lange auf sich warten. Smith hatte kaum das Steuer betriebsfertig am Ballon angeseilt, als in der Nähe plötzlich Stimmen laut wurden
»Fort!« schrie Wassilowitsch. »Schnell, Mr. Smith, machen Sie die Stahltrosse los und dann hinein in die Gondel ... verpassen Sie aber ...«
Hier wurden ihm die Worte durch das Schreien der heraneilenden Leute unterbrochen.
Smith löste die letzte, den Ballon noch haltende Trosse und wollte sich dann im selben Augenblick in die Gondel schwingen, als er dabei einen Fehltritt tat. Er fiel zu Boden und das braune Ungetüm schnellte führerlos in die Lüfte.
Die in den Park eingedrungenen Leute hatten gerade noch das Nachsehen, während man unten in allen Tonarten fluchte, klang von oben herab ein höhnisches Gelächter.
Der Ballon hatte bald in der Dunkelheit eine Höhe erreicht, die ihn den Augen Aller entzog.
Der Goldvogel war auf- und davongeflogen, und wieder einmal hatten die Yankees das Nachsehen.
Wie die Technik überhaupt, so waren insbesondere die Verkehrsmittel zur Zeit, in der unsere Erzählung spielt, derart fortgeschritten, daß man von einer vollständigen Lösung des Problems der Lenkbarkeit der Luftschiffe sprechen konnte. Im Frieden wie im Kriege waren die äronautischen Fahrzeuge bereits unentbehrlich geworden. Wie nun bei allen anderen Verkehrsmitteln Störungen und Unfälle nicht ausblieben, so stellten sich solche auch bei der modernen Luftschiffahrt hin und wieder ein. Meist war es die Steuerung, welche versagte, wenn der Winddruck eine übermäßige Stärke besaß. In solchen Fällen trat dann stets, trotz subtilster Konstruktion und trefflichsten Funktionierens der elektrischen Motoren, eine Hilflosigkeit ein, die auch durch die forcierteste Tätigkeit der Luftschrauben nicht beseitigt werden konnte. Die Äronauten konnten von solchen Schiffbrüchen in den Regionen des Luftozeans schon manches Liedchen singen.
Die Zahl der Fahrzeuge des amerikanischen Luftschifferkorps, welches bei Anbruch des Krieges gegen England mobil gemacht worden war, bemaß sich auf einige zwanzig Stück. In der Nacht von Wassilowitschs Flucht waren die Militäräronauten telegraphisch zur sofortigen Verfolgung des Fieldschen Ballons beordert worden.
Der Lufschifferpark der Armee befand sich teils in Worcester im Staate Massachusetts, teils in Alexandria, in der Nähe von Washington. Während des Waffenstillstandes hatten sich die beiden Abteilungen des Äronautenkorps in ihre Garnison zurückbegeben.
Als die telegraphische Order in Worcester und Alexandria eintraf, traten achtzehn Fahrzeuge trotz des herrschenden starken Nordwestwindes unverzüglich die Fahrt in der Richtung nach New York hin an. Die Luftschiffer der erstgenannten Garnison hatten etwa 200 Kilometer in der Luftlinie zurückzulegen, die von Alexandria fast 350, ehe sie New York erreichten. Die letztere Äronautenflotte gebrauchte zur Zurücklegung dieser Strecke etwa fünf bis sechs Stunden Zeit, während die Worcester Militärballons schon innerhalb zwei Stunden ihr Ziel zu erreichen vermochten.
Die Depeschen vom Kriegsdepartement in Washington besagten, daß Wassilowitsch mit seinem Fahrzeug einen nördlichen Kurs eingeschlagen habe. Das Worcester Luftschifferkorps hatte demnach die meiste Aussicht, dem Flüchtling auf halbem Wege zu begegnen.
Und so sollte es auch kommen. Wassilowitsch hatte nicht mit den Militäräronauten und den von ihnen mitgeführten Mitrailleusen gerechnet.
Der Fieldsche Ballon kämpfte mit seinen Luftschrauben verzweifelt gegen den starken Nordwestwind an. So kam es, daß der Kurs wider Willen seines Lenkers mehr und mehr nordöstlich wurde.
Es mochte gegen 3 Uhr morgens sein, als Wassilowitsch und Besimé den Long Islandsund übersegelt hatten und in einer Höhe von 552 Metern schwebten. Unter ihnen breitete sich am Gestade des Meeres eine größere Stadt aus.
»Es wird New Haven sein,« meinte Wassilowitsch, als er von Besimé über die Ortschaft befragt wurde.
»Ich habe Angst, daß uns der Wind auf den Ozean hinaus treibt,« hörte man Mrs. Field sagen, als soeben wieder einmal der Winddruck über Steuer und Schraube siegte.
»Beruhige dich, wir haben auf mehrere Wochen Lebensmittel bei uns, und Mr. Smith hat mir versichert, daß das Gas im Ballon ebensolang vorhält.«
»Wir schweben so niedrig über der Erde, daß ich besorge, man wird uns entdecken und verfolgen,« sagte Besimé und warf einen Blick auf das im Schatten der Nacht liegende Häusermeer unter ihr.
»Der Barograph zeigt jetzt 554 Meter, meine Liebe ...«
»Hundert Meter höher halte ich für sicherer,« versetzte Besimé.
»Die Dunkelheit schützt uns vor Entdeckung.«
»In wenigen Stunden wird es aber dämmern — — hu! wie mich friert!« rief Mrs. Field und verhüllte ihr Gesicht mit einem kostbaren indischen Shawl.
Eine Weile herrschte tiefes Schweigen.
»Daß Mr. Smith aber auch nicht vorsichtiger war — —« begann Besimé nach einigen Minuten wieder.
»Der Tolpatsch ...« antwortete Wassilowitsch und machte sich am Steuer zu schaffen. »Ein Glück für uns, daß ich mich von ihm in die Maschinerie des Ballons einweihen ließ.« — — — —
»Laß uns doch wenigstens bis über die Wolkendecke steigen. Dahinter wird man uns schwerlich entdecken können,« sagte Besimé, nachdem abermals eine Pause des Schweigens geherrscht hatte.
»Jeder Meter höher macht uns um hunderttausend Dollar ärmer,« antwortete Wassilowitsch.
»Was tuts — — ehe wir gesehen werden ......«
Die letzten Worte erstarben Besimé auf den Lippen. Ihre Augen starrten vorwärts. Sie sah mehrere Lichtpünktchen in einer etwas tieferen Luftschicht, die sich zusehends vergrößerten. »Allah il Allah und Mohammed ist sein Prophet! — — Lichter — — —«
Wassilowitsch drehte sich in der Richtung, nach der Besimé todeserschrocken hinzeigte, um und gewahrte ebenfalls die Lichtpunkte.
»Teufel!« brummte er zwischen den Zähnen und warf instinktiv das Steuer herum, so daß das Fahrzeug gleich darauf eine halbe Drehung nach rechts machte. »Es müssen Ballons sein, wenn ich nicht annehmen will, daß hier oben Glühwürmchen oder Irrwische herumschwirren — —«
»Höher! — — höher!« rief Besimé erregt aus, riß einen der in der Gondel aufgestapelten Geldsäcke empor und warf ihn kurzerhand über Bord.
»Besimé!« schrie Wassilowitsch.
Mrs. Field achtete nicht auf den Zuruf, sondern ergriff zwei weitere Beutel und ließ diese dem ersten folgen.
Die glücklichen Menschen unten, welche die Goldsäcke über die Köpfe entleert bekamen! — —
Die 3 Millionen Dollar, welche als Ballast geopfert waren, ließen den Ballon um einige fünfzig Meter höher steigen.
Inzwischen näherte sich ein siebenfacher Lichterschein. — Es waren die Worcester Militärballons.
»Sie sind uns wahrhaftig auf der Spur — — die Satans ...« sagte der Adept knirschend und drehte das Steuer noch weiter nach rechts.
»Aber was sollen wir nun tun?« frug Besimé geängstigt.
Soeben vernahmen sie Nebelhornsignale, jene auch ihnen wohlbekannten militärischen Verständigungsmittel in den Luftregionen.
»Militär ......« rief Wassilowitsch und seine Stimme hallte geisterhaft durch den leeren, totenstillen Raum.
Während der Fieldsche Ballon straks nach Osten fuhr, schossen nicht weit von ihm ab, kaum 80 Meter tiefer, die Fahrzeuge der Äronautenflotte heran, dann machten sie eine Schwenkung nach rechts und setzten dem Flüchtling nach.
Durch die tiefe Stille der Nacht drangen jetzt deutlich vernehmbar die Geräusche, welche die Motoren und Schrauben der Ballons verursachen, herüber.
»Sie werden uns vernichten!« rief Besimé jammernd und rang verzweifelt die Hände.
»Ich bezweifele, daß sie es wagen,« gab Wassilowitsch zur Antwort. »Aber sie werden vielleicht unser Fahrzeug zu kapern versuchen.«
Bereits schwebte der Fieldsche Ballon über dem Meeresspiegel. Und weiter ging es, weiter, ostwärts. Immer schneller, denn der steife Nordwest half redlich dabei mit.
Aber auch die Verfolger blieben nicht zurück. Dem Flüchtling hart auf den Fersen, fuhren sie jetzt in derselben Höhenlage wie dieser.
Unten auf der dunklen Meeresfläche mußten wohl Kriegsschiffe kreuzen, denn die farbigen Lichtpunkte ließen keine andere Deutung zu.
Ob man versuchen wollte, den Ballon auch vom Ozean aus zu beschießen?
»Höher! höher!« beschwor Besimé Wassilowitsch. Sie ergriff dann in ihrer Angst wieder mehrere Geldsäcke und schleuderte die Millionen hinab, die für alle Ewigkeit in der Tiefe des Meeres verschwinden sollten.
Auch Wassilowisch opferte nun eine Reihe Säcke, da er sah, daß ein Entrinnen in der Höhe noch einige Aussicht bot.
Der Ballon schnellte 700 — — 900 — — — 1000 — — 1250 Meter empor. Mit Pfeilesschnelle durchschoß er die dichte Wolkendecke und verschwand für die Verfolger im Nebelmeer.
Die Militäräronauten fingen jetzt auch an, Ballast auszuwerfen. Ihre Ballons erklommen immer höher liegende Regionen, durchquerten ebenfalls die Wolkendecke, und bald hatte man den Flüchtling wieder gesichtet.
Da ertönte durch die Stille des Raumes ein Geknatter, und gleichzeitig blitzte ein Feuerschein in einer der armierten Aluminiumgondeln auf. Eine Mitrailleuse versuchte den Flüchtling aus der Höhe herunterzuholen.
»Sie schießen!« schrie Besimé.
Wassilowitsch verlor seine Ruhe nicht. Er warf mehr und mehr von dem kostbaren Ballast aus. Der Ballon stieg rapid höher.
Da verfiel der Russe auf einen seltsamen Gedanken, um seine Verfolger von sich abzuschütteln.
Er lanzierte seinen Ballon so, daß er senkrecht über dem ihm nächstfolgenden stand, dann band er an einen der Geldsäcke ein frischgeteertes Tauende, entzündete dasselbe und ließ den Millionenballast so in die Tiefe hinabgleiten.
Der brennende Sack schlug, wie es Wassilowitsch vorausberechnet hatte, auf die Ballonhülle des nächsten Verfolgers.
Mit einem donnernden Knall zerbarst das feindliche Luftschiff. Eine einzige, mächtige Feuergarbe schoß leckend bis zu Wassilowitsch hinauf, und eine Gondel mit mehr als einem halben Dutzend Menschen sank mit Blitzesschnelle in die Tiefe, im Meere ihr Grab findend.
Jetzt ertönte erneutes Geknatter. Den Läufen von sechs Mitrailleusen entquoll Feuerschein und Rauch.
Unmittelbar darauf hörten die Äronauten eine gellende Frauenstimme aus der Höhe zu ihren Ohren dringen. Dann sahen sie Wassilowitschs Ballon langsam sinken.
Im fernen Osten brach die Dämmerung herein. Das nahende Tagesgestirn sandte seine Lichtboten bereits hinauf zu dem Kampfplatz, wo man sich um schnöden Goldes wegen einander zu vernichten drohte.
Zum erstenmal in diesem Erdendasein hatte sich im Luftmeer ein Kampf abgespielt. Und als die Sonne blutrot über den Horizont stieg, da sah man einen Ballon die Wolkendecke durchbrechen und langsam sinken.
Es war das Fieldsche Fahrzeug. Seine beiden Insassen waren von den Kugeln der Mitrailleusen leicht getroffen worden und kleine Löcher in der Hülle des schwebenden Ungetüms verrieten nur zu deutlich, daß die feindlichen Geschosse ihr Ziel nicht verfehlt hatten.
»Besimé! Besimé!« rief Wassilowitsch und hob das junge, von einer Ohnmacht umfangene Weib empor.
Eine Weile starrte er ihr ins Gesicht, dann aber, als die Lebensgeister wieder in ihr erwachten und sie die Augen plötzlich aufschlug, fragend: »Wo bin ich?« glitt ein Strahl von Freude über das häßliche Gesicht, welches sich besorgt über die Orientalin gebeugt hatte.
»Besimé — — bist Du bereit zu sterben?« Dumpf kam dies über Wassilowitschs Lippen.
Besimé starrte ihm ins Auge und fuhr sich mit der Hand langsam über die Stirn.
»Du sagst sterben — — ja, sind wir denn wirklich verloren?« Mit diesen in verzweifeltem Tone ausgesprochenen Worten nahm sie ihre ganze Kraft zusammen und richtete sich auf.
»Unser Grab wird das Meer sein, liebe Besimé,« sagte Wassilowitsch und man merkte, wie seine Stimme dabei zitterte.
»Sterben — — so jung — — —« stieß sie hervor und ihr Blick fiel hinab auf die nahe, unter ihr liegende See, deren Wogenkämme sie erschaudern machten.
In diesem Augenblick sanken auch die Fahrzeuge der Militäräronauten hernieder. Fünf — — zwei waren längst von dem Ozean verschlungen worden.
Wieder drohte nun von oben für Wassilowitsch Gefahr. Aber auch von unten sah er solche nahen. Kriegsschiffe kreuzten hin und her, den Moment erfassend, wo der verfolgte Ballon mit seinen Insassen den Meeresspiegel erreichen würde.
Was half noch alle Verteidigung gegen solche Übermacht? Wenn ihn vielleicht noch etwas retten konnte, so war es nochmaliges Entrinnen in hohe Regionen.
»Opfern wir den Rest unserer Schätze,« sagte Wassilowitsch mit düsterer Stimme. »Noch einen letzten Versuch wollen wir machen, Besimé. Mißlingt er, dann ist's aus — aus für immer.«
Den Augen des schönen Weibes entquollen jetzt heiße Tränen. Sie konnte es nicht fassen, daß sie ihr junges Leben lassen sollte. Plötzlich aber raffte sie sich auf.
Ohne ein Wort zu sagen, griff sie mit vollen Händen in den kostbaren Ballast.
Wassilowitsch tat ein gleiches, und die letzten hundert Säcke des einstmaligen Riesenvermögens sanken in die Tiefe, klatschend auf die Meeresfläche aufschlagend.
Um eine große Last erleichtert, schoß nun der gasgeschwächte Ballon wieder in die Höhe.
Hochaufgerichtet standen Wassilowitsch und Besimé in der Gondel ihres Fahrzeuges und ein letzter Hoffnungsschimmer mochte ihre Seelen erfüllen.
Sechshundert Meter — — siebenhundert Meter stieg der Ballon.
Da — — eine erneute Mitrailleusensalve, ein ohrenbetäubendes Geknatter, und von vielen Kugeln getroffen, platzte die zerfetzte Hülle des Fieldschen Ballons auseinander.
Ein jäher Aufschrei einer weiblichen Stimme — — und mit rasender Schnelligkeit stürzte die Gondel mit Wassilowitsch und Besimé in die schauerliche Tiefe.
Noch einige Sekunden und die Fluten des Ozeans schlossen sich über einem Menschenpaar.
Der »dominateur de la terre« hatte aufgehört zu leben. Von dem Goldgespenst, das wie ein Alb auf der Menschheit Brust gelegen hatte, war die Welt nun auf immer befreit, denn Wassilowitsch nahm das Geheimnis seiner Kunst mit ins nasse Grab.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.