
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
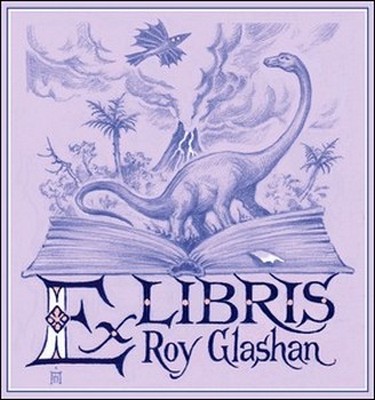
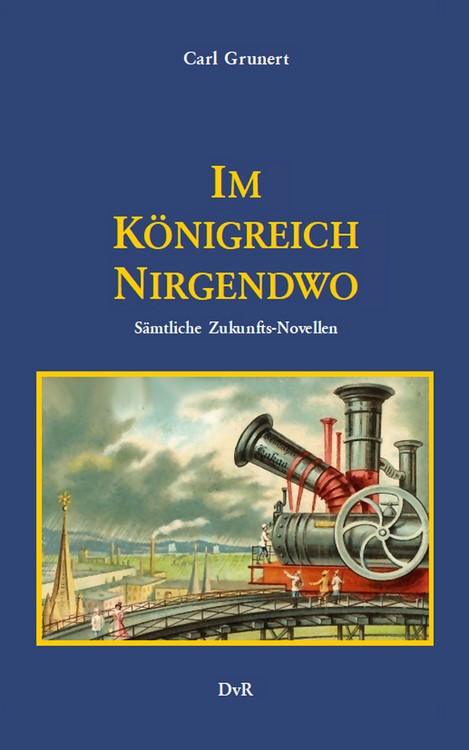
"Im Königreich Nirgendwom," DvR-Ausgabe
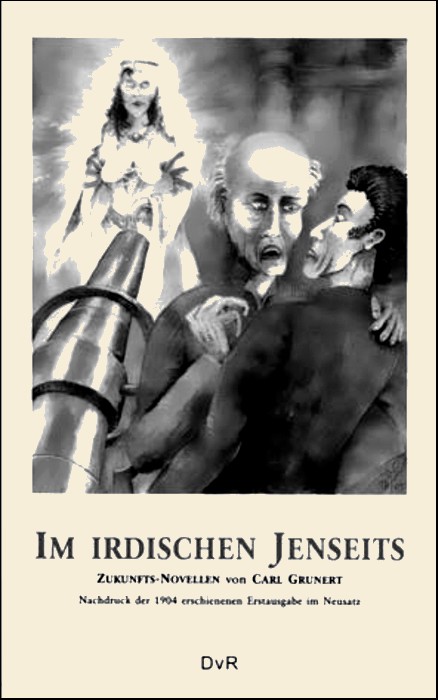
"Im irdischen Jenseits"
DvR-Nachdruck der Erstausgabe
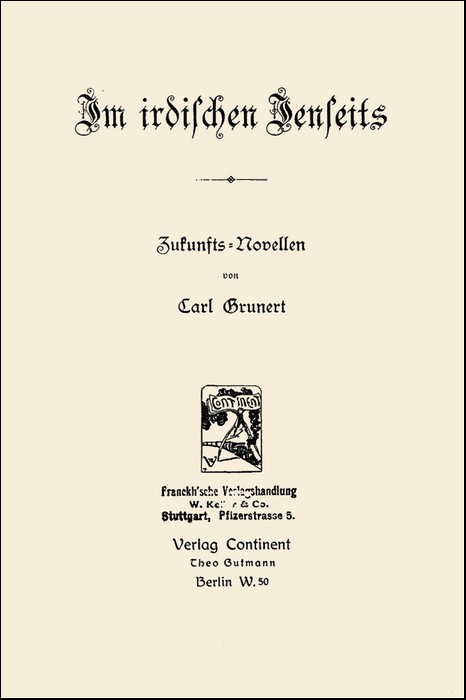
"Im irdischen Jenseits"
Verlag Continent, Berlin, o.J.(1904)
Aus schwerer Krankheit neu erwacht zum Lichte,
Las ich zum ersten Mal Dein reifstes Werk,
Den Welt- und Menschheitstraum: »Auf zwei Planeten.«
Und wie ein Trost aus einer andern Welt, —
Ein Evangelium der Ideale —
Durchdrang es mich und nahm mich ganz gefangen.
Noch abgeschlossen von dem Lärm des Tages,
Gefesselt noch von fliehender Krankheit Bann,
Ward mir Dein holder Traum zur Wirklichkeit:
Auch an m e i n Lager trat der weise Nume,
Wie H i l, der Arzt, an G r u n t h e s Lager trat;
Durch meine Träume ging die schöne S e,
Und alle meine Liebe schenkt' ich L a!
Aus Schmerz und Not, aus dieser Erde Fesseln
Trug mich das goldne F l ü g e l s c h i f f der »L a«
Mit S a l t n e r in das Götterland des «N u«...
So las ich und so lebt' ich Deine Dichtung! —
Und damals schon gelobt ich: wenn die Schickung
Es mir vergönnte, dankbar mich zu zeigen...
Dann las ich Deine Märchen »Seifenblasen»:
Mit O n k e l W e n d e l braucht' ich »Mikrogen»;
»Apoikis«, »Stäubchen« und »Prinzessin Jaja«,
»Aladdins Lampe«, »Tröpfchen« — doch, was zähl' ich
Sie einzeln auf, die zart und rein, wie Perlen
Gereiht zu einer Schnur, einander gleich
An Schmelz und Schönheit und an innerm Werte? —
Dem lichten Bilde Deines hohen Schaffens
Verlieh ihr Schimmer einen neuen Zauber,
Und tiefer fühlt' ich meines Dankes Schuld!
Nun auf den Weihnachtstisch des vor'gen Jahres
Da legte mir der Freund Dein neues Werk,
Die reiche Sammlung duft'ger Traumkrystalle,
Die »N i e u n d I m m e r« treffend Du genannt.
»N i e« wird ihr Inhalt Wahrheit sein dem Toren,
Der nur das eine kennt: Realität! —
Und »i m m e r« wahr sind sie dem Glücklichen,
Der h ö h ' r e Wahrheit weiß, als Maß und Zahl,
Der einen Hauch des Geistes in sich spürt,
Den Dir der Muse Götterkuß geschenkt! —
Mir aber brachten diese neuen Märchen
Die Form, in der ich meinen Dank an Dich,
verehrter Meister, zu gestalten wagte:
Durch D e i n e r Dichtung Zauber angeregt,
Dankbaren Herzens schrieb ich diese Skizzen;
Bescheiden leg' ich sie zu Füßen Dir!
Ich fühl's, sie sind von ihrem Vorbild noch
Soweit entfernt, als wie die Nacht vom Tag —
Du aber wirst, so hoff' ich, nicht verschmähen,
Was herzliche Verehrung Dir geweiht!
Was Deine Worte durften in mir säen,
Das ist erblüht, gereift in stiller Zeit:
O, wenn doch unter meines Feldes Aehren
Auch einige voll g o l d ' n e r Körner wären!
Ungefähr in der Mitte zwischen Europa und Amerika, unter 520° 2' n. Br. und 330° 18' w. L. befindet sich dreihundert Meter unter dem Wasserspiegel auf dem Grunde des atlantischen Oceans ein wunderbares Bauwerk: d a s V e r m i t t l u n g s - A m t f ü r d e n t r a n s a t l a n t i s c h e n T e l e p h o n - V e r k e h r. —
Es war das Verdienst Deutschlands beim Beginn des dritten Jahrtausends gewesen, den telephonischen Verkehr zwischen den beiden Erdteilen eingeführt zu haben, seitdem der Amerikaner Pupin schon vor hundert Jahren die Möglichkeit des telephonischen Gesprächs auf tausende von Meilen durch Einschaltung feiner Drosselspulen nachgewiesen hatte.
Bis dahin hatte sich nämlich bei Benutzung der Unterseekabel zum Telephonieren ein großes Hindernis herausgestellt: die Ladung des Kabels und damit die Verzögerung der telephonischen Laute, die eine klare, deutlich artikulierte Wiedergabe des gesprochenen Wortes unmöglich machte.
Jedes Kabel besitzt wegen seiner großen Länge eine ziemlich bedeutende Kapazität, einen Fassungsraum, der erst völlig den elektrischen Zustand überall angenommen haben muß, ehe die Kupferader im Stande ist, das an einem Ende erhaltene Zeichen am entgegengesetzten wieder abzugeben — wie ja, um einen rohen Vergleich zu brauchen, ein Wasserleitungsrohr auch erst völlig gefüllt sein muß, ehe das auf der einen Seite einfließende Wasser auf der andern erscheint.
Die Pupin'schen Drosselspulen arbeiten nach dem Prinzip der Selbstinduktion in ihrer Wirkung der Kapazität geradezu entgegen, drücken das Ladungsvermögen herab durch Erzeugung von sekundären Strömen bis zur völligen Vernichtung des primären oder Arbeitsstromes — sodaß durch geeignete Abmessung der in die Kabelleitung eingeschalteten Drosselspulen die Ladung der Kabel auf einen so kleinen Betrag herabgedrückt werden kann, daß die Stromstöße des Telephons praktisch nicht mehr davon beeinflußt werden.
Amerika und Deutschland hatten in diesem Falle Hand in Hand gearbeitet, sehr zum Ärger Englands und seiner Kabel-Kompagnieen, die auch nichts versäumt hatten, durch tendenziöse Entstellungen wissenschaftlicher oder politischer Herkunft den Untersee-Telephon-Verkehr zum Besten ihrer anderthalb Jahrhunderte bestehenden Kabeltelegraphie zu diskreditieren.
Das Bessere war allezeit der Feind des Guten, und so funktionierte die submarine Telephon-Anlage schon mehrere Jahrzehnte zwischen den Haupthäfen der beiden Erdteile tadellos...
Im Laufe der Zeit machte sich aber doch ein Übelstand geltend, der mit dem ins Riesenhafte gestiegenen Handelverkehr um so fühlbarer wurde, je länger er dauerte — die geringe Zahl der Verbindungskabel zwischen beiden Ländern und damit das zeitraubende Nacheinander des Betriebes, statt des schnelleren Nebeneinander.
Es bestand beispielsweise eine Sprechlinie Bremen-Newyork. Wollte aber ein Interessent in Bremen mit Rio de Janeiro verbunden sein, so war dies nur auf dem Umwege über Newyork möglich, da zwischen Bremen und Rio de Janeiro keine eigene Sprechader lag. Durch diesen Umweg aber wurde die durchsprochene Entfernung ungeheuer vergrößert, die Übertragung trotz eingeschalteter Drosselspulen undeutlicher und vor allem der interoceanische Telephon-Verkehr dadurch abhängig von dem an Zahl ihn bedeutend übertreffenden in Amerika selbst. Dadurch aber war die Möglichkeit sofortigen Anschlusses, der Lebensnerv und die treibende Ursache internationalen Telephon-Verkehrs, sehr in Frage gestellt — und die Klagen, viel zu spät oder überhaupt nicht Anschluß bekommen zu können, häuften sich in Europa wie in Amerika von Tag zu Tag...
Zur Beseitigung aller dieser Übelstände hatte man im Jahre 1997, also am Ausgange des zweiten Jahrtausends, den genialen Plan gefaßt, zwischen den beiden Weltteilen ein Vermittlungsamt im atlantischen Ocean einzurichten. Anfangs hatte man gedacht, eine künstliche Insel aus schwimmenden Stahlkästen herzustellen; aber die Gefahr des Losreißens bei den Herbst- und Frühjahrsstürmen und namentlich die unsichere Anheftung der Telephon-Kabel an solch ein Riesenfloß hatten das Unpraktische dieser Einrichtung dargetan.
So war man auf den Grund des Meeres hinabgestiegen, um hier — vorläufig als Versuchsanlage — ein Verbindungsamt einzurichten, ein Unternehmen, das seit der Einführung von Unterseeboten — ein Verdienst Frankreichs — nichts Unmögliches mehr hatte.
Kolossale Schwierigkeiten waren allerdings zu überwinden gewesen, ehe man die ersten Vorarbeiten zu dem genialen Bau, einem Meisterwerk deutsch-amerikanischer Ingenieurkunst, in Angriff nehmen konnte...
Das mit dem Beginn des dritten Jahrtausends, im Frühjahr des Jahres 2001 in Betrieb genommene Bauwerk hätte sich einem Taucher von außen als ein aus zahlreichen eisernen Ringen von ungefähr 5 Meter Durchmesser zusammengefügtes Rohr präsentiert von fast 20 Metern Länge — also eine liegende Walze, ähnlich dem Tunnelrohr einer Untergrundbahn. Mächtige Stirnplatten von Eisen schlossen den inneren Hohlraum vom Eindringen des Wassers ab; in diese Platten mündeten auch von außen die wasserdicht eingeführten Kabel, westlich die Linien Amerikas, östlich die unseres Erdteils, die wie ungeheure Seeschlangen das Untersee-Amt umringelten.
An der europäischen Seite hatte die Verschlußscheibe am oberen Rande noch eine kleinere Verschlußplatte, die von innen und außen zu lösen war: durch diese Öffnung — eine riesige Stopfbüchse von fast einem Meter Durchmesser — erfolgte die Vermittlung mit der Außenwelt mit Hilfe der Unterseeboote.
Allwöchentlich einmal kam der Dampfer »Telephon« von Bremen hierher — die Stelle war durch eine auf dem Grunde fest verankerte Boje schnell auffindbar —, um durch Vermittlung eines kleinen Unterseebootes den Beamten der Unterseetelephonstation die nötigen Vorräte an Lebensmitteln und vor allem an Luft zu überbringen, gleichzeitig auch die Akkumulatoren zum Licht- und Kraftbetrieb gegen neugeladene umzutauschen. — Heute hatte er auch noch eine lebende Fracht mit Hilfe des Unterseebootes in das Untersee-Amt befördert, einen Ober-Praktikanten, einen neueintretenden Beamten, Namens Emdner. — Es war strenge Vorschrift für jeden Neuling, zur schnellen Überwindung der mancherlei Strapazen des Transportes, namentlich im Unterseeboot, gleich nach seiner Ankunft die Schlafkabine aufzusuchen. Während des Schlafes paßte sich — nach aller Erfahrung, die man bereits gemacht hatte — der menschliche Organismus leichter den total veränderten Existenzbedingungen hier unten an...
»Verehrter Herr Kollege«, sagte am anderen Morgen, — wenn von dieser Tageszeit hier die Rede sein konnte —, der Angekommene zu seinem Partner, nachdem die ersten gegenseitigen Bekanntmachungsformalitäten vorüber waren, »das Frühstück schmeckt mir hier dreihundert Meter unter dem Spiegel des Oceans ebenso famos, als sonst. —«
»Warum auch nicht«, entgegnete dieser, ein prächtiger Ostpreuße, Namens Donath — »ich bitte Sie, wir haben hier unten die nahrhaftesten Speisen, teils in frischem Zustande, teils als Konserven. —«
»Und die Küche ist elektrisch, nicht?«
»Selbstverständlich. Die elektrischen Koch- und Heizapparate benutzen wir ja bereits seit hundert Jahren. Alles ohne Flamme, ohne Rauch, ohne Geruch, ohne schwarze Finger beim Anfassen der Kochtöpfe, nicht wahr, Schmorchen?«
Die letzte Frage galt dem eifrig am Herde hantierenden Unterbeamten, der durch Absolvierung eines Küchen-Kursus sich das Recht erworben hatte, im submarinen Amt als Koch neben sonstigen Diensten fungieren zu dürfen.
Schmorchen buk gerade einen Eierkuchen und warf durch einen geschickten Schwung der Pfanne ihn eben von der gebackenen Seite auf die andere, dann bestätigte er:
»Allens elektrisch — und schmeckt wie bei Muttern!«
»Ja, Schmorchen, da stimme ich bei«, sagte Donath lachend, »aber das ist Ihr Verdienst, Sie großes Küchengenie!« —
»Die schwierigste Frage«, begann Emdner nach einer Weile, »scheint mir bei der Einrichtung der Station die Versorgung mit der nötigen Lebensluft gewesen zu sein. —«
»Allerdings. Zwar hatte man hierfür ja die Erfahrungen beim Gebrauch der Unterseeboote — aber letztere bleiben ja immer nur vorübergehend und nur verhältnismäßig kurze Zeit unter Wasser, während wir uns permanent darin befinden.«
»Ich habe natürlich, ehe ich mich zum Dienst hier unten meldete, mich durch die amtlichen Berichte über das Unterseetelephon-Amt informiert und weiß im allgemeinen, daß zur Lufterneuerung komprimierte Luft verwandt wird. —«
»Ja, Herr Kollege. — Wenn Sie Ihren leiblichen Menschen hinreichend gestärkt haben, möchte ich Ihnen einmal den inneren Bau des ganzen Werkes zeigen.«
»Ich bin bereit, Kollege Donath«, sagte Emdner.
Donath öffnete die Tür. »So kommen Sie!«
Sie traten beide in das Nebengemach, das eigentliche Dienstzimmer des Unterseetelephonamtes. — Blendende Helligkeit durchflutete den die Form eines länglichen Zimmers habenden Raum. Die an der Decke befindlichen elektrischen Glühlampen beleuchteten die an beiden Längswänden angebrachten Schaltapparate mit ihren zahlreichen Klappen und Kontaktstöpseln.
»Sie sehen — alles wie droben auf der Erde!«
Emdner lachte und begrüßte die beiden Kollegen, die aus einer Nummer des »Kladderadatsch«, eines schon über hundert Jahre bestehenden, noch immer gern gelesenen Witzblattes, gestiegen zu sein schienen, der eine lang und spindeldürr, der andere kurz und dick. Zu allem Überfluß hießen sie auch noch — Müller und Schulze.
Dann durchschritten sie die gegenüberliegende Tür und traten in den Maschinenraum.
»Sie sehen hier die großen, aus Stahl gezogenen Zylinder. Sie sind unter einem Druck von vierhundert Atmosphären mit gereinigter, komprimierter Luft gefüllt. Automatisch wirkende Reduzierventile regulieren den Luftstrom, der von hier aus allen Räumen zugeführt wird. — Der Dampfer ›Telephon‹, der auch Sie ja hierhergebracht hat, ersetzt die geleerten Luftzylinder durch frischgefüllte —
»Und könnte nicht durch Zufall einmal der Austausch verzögert werden — daß Luftmangel eintreten könnte?«
»Der Umtausch ist so reguliert, daß immer noch ein auf mehrere Tage den Luftbedarf deckender Reservezylinder nicht in Anspruch genommen wird, sodaß für diesen von Ihnen befürchteten Zufall, der allerdings für uns alle hier unten verderblich werden könnte, immer noch ein Vorrat an Atmungsluft vorhanden bleibt. Trotz des jahrelangen Betriebes hat sich bis heute keine Veranlassung geboten, den Reservezylinder in Gebrauch zu nehmen.«
»Die Verwendung reinen Sauerstoffs in komprimierter Form hätte vielleicht kleinere Zylinder — statt dieser riesigen — ermöglicht?«, warf Emdner ein.
»Davon mußte abgesehen werden, da sich, nach den Berichten der Luftschiffer über ihre Fahrten in große Höhen, beim Einatmen desselben sehr unangenehme Nebenwirkungen einzustellen pflegen. —«
»Und flüssige Luft, nach dem Verfahren von Professor Linde —?«
»Auch sie ließ sich hier unten auf dem Meeresgrunde nicht gut verwenden, eben wegen solcher unerwünschten Begleiterscheinungen, wie Herabsetzung der Temperatur, zu großer Sauerstoffgehalt, schlecht regulierbarer Verbrauch. —«
»Und die ausgeatmete Kohlensäure? — Meines Wissens atmet ein Erwachsener in vierundzwanzig Stunden 500 Liter dieses schädlichen Gases aus. —«
»Dazu dienen die großen rotierenden Trommeln, die Sie übermalt an den Wänden und an der Decke der einzelnen Räume erblicken, lieber Kollege. Sie sind, wie Sie sehen, in Form der bekannten elektrischen Ventilatoren gebaut. Zwischen den beiden siebartig durchlöcherten Böden befindet sich feinverteiltes, getrocknetes Ätzkali — wie Sie ja wissen, das energischste Absorptionsmittel für Kohlensäure. Die durch Rotation angesaugte Luft streicht durch die lockere Ätzkalifüllung hindurch und giebt hier die durch unsere Ausatmung entstehende Kohlensäure ab.«
»Diese Luftprüfer« — Emdner deutete auf einen barometerähnlich konstruierten Apparat — »arbeiten auch automatisch, nicht wahr?«
»Gewiß! Wie Sie bemerken, haben wir es dabei mit einem Doppel-Instrument zu tun: die unten angebrachte Vorrichtung ist ein gewöhnliches AneroidBarometer zum Messen des herrschenden Luftdruckes, die darüber befindliche, mit einer graduierten Röhre versehene ist ein Kohlensäuremesser, der durch einen elektrisch betriebenen Aspirator bedient wird. Der ganze Apparat regelt selbsttätig die Steuerung der Reduzierventile am Lufterneuerungszylinder.«
Emdner las die Instrumente ab: »760 mm Barometerstand — 0,1 Prozent Kohlensäuregehalt!« Er wandte sich lächelnd an seinen Begleiter: »Das ist ja normaler als manchmal auf der Erdoberfläche!«
»Ja, nicht wahr? Wir sind hier unten die reinen Wettermacher. Und was mir seit einigen Tagen besonders auffällig erscheint, wir haben selten eine so reine, kohlensäurearme Atmosphäre hier gehabt, als jetzt. Die Ätzkalifüllung in den Ventilatoren ist erneuert und scheint jetzt energischer als sonst das Kohlendioxyd der Luft zu entreißen. —«
»Wissen Sie Genaueres über den Aufbau dieses großartigen unterirdischen Werkes? Daß die Wandung der riesigen Tunnelröhre den bekannten Konstruktionen der Unterseebahnen ähnlich ist, weiß ich; aber die Einzelheiten, die Dimensionen, die innere Auskleidung des mächtigen Eisenzylinders sind mir nicht bekannt. —«
»Die Wandung der äußeren Eisenringe besitzt einen Durchmesser von reichlich einem halben Meter. So stark mußte sie sein wegen des Wasserdruckes. —«
»Ungefähr 30 Kilogramm auf den Quadratzentimeter, schätze ich«, warf Emdner ein.
»Ungefähr — ja. Daran schließt sich nach innen eine ebenfalls einen halben Meter dicke Schicht eines lockeren Materials als Wärmeschutzmantel, um den Ausgleich mit der uns umgebenden Meerestemperatur auf ein Minimum zu reduzieren. Dieser Schutzmantel wird von dichtaneinander gefügten Ringen aus hydraulisch zusammengedrücktem und geformtem Papier getragen. —«
»Wie steht es eigentlich mit der Dichtigkeit des ganzen Baues gegenüber dem Eindringen des Seewassers, Herr Kollege? Ich sollte meinen, der kolossale Überdruck von 30 Atmosphären, dem die Konstruktion ununterbrochen ausgesetzt ist —«
»— hat sich auch in den ersten Zeiten übel bemerkbar gemacht, lieber Kollege. Als unmerkbar feiner Tau hat sich das Wasser im Laufe der Zeit an der Innenwand gezeigt. Gegen diese Kalamität, welche wegen des Durchsickerns und Weiterkriechens salzhaltiger Feuchtigkeit bis zu den feinen telephonischen Apparaten für das ganze Unternehmen verhängnisvoll zu werden drohte, hat sich nur ein Mittel als völlig ausreichend erwiesen, allerdings ein sehr teures Mittel, welches die Herstellung dieses modernen Weltwunders um Millionen verteuert hat — das kostbare Platin. —«
»Wie, Sie meinen, der gesammte Innenraum —«
»— ist mit aneinander genieteten Platten von Platinblech ausgekleidet.«
»Donnerwetter — das ist ja ein Kapital, Kollege Donath?«
»Es war aber das einzige Mittel — und so hat der Staat in den sauren Apfel beißen müssen. —«
»Die Platinschicht ist dann jedenfalls von einer zweiten Papierschicht bedeckt?«
»Gewiß, derselben, welche die Wände unserer Zimmer bildet und auch zur Befestigung unserer Apparate dient, stahlhart gepreßtes Papier von mehreren Zentimetern Dicke!« —
Ein schrilles Klingelzeichen ertönte.
»Kommen Sie, Herr Kollege — Ihre ersten drei Stunden Dienst im ›schwarzen Walfisch‹ — Sie kennen ja wohl auch schon den Spitznamen unseres Untersee-Amtes — beginnen jetzt. Ein herzliches ›Glückauf!‹ wie der Bergmann drunten im Schacht zum andern sagt!«
Treuherzig schüttelte Donath Emdner die Hand und beide schritten zurück in den Dienstraum.
Wie man sieht, stellte der Dienst im oceanischen Vermittlungsamt hohe Anforderungen an die Beamten. Trotzdem war der Zudrang der Bewerber zum Unterseedienst ziemlich groß; denn außer der bedeutenden Funktionszulage erhielten sie durch ihre Tätigkeit im transatlantischen Telephon-Verkehr die sicherste Anwartschaft auf eine glänzende Karriere.
Dies war auch der Grund gewesen, weshalb Emdner sich zum submarinen Dienst gemeldet hatte. — Der Direktor des Untersee-Telephon-Verkehrs Pool hätte bei den guten Zeugnissen des fünfundzwanzigjährigen jungen Mannes und seiner sonstigen körperlichen und geistigen Tüchtigkeit nicht anders gekonnt, als ihn für die eben freiwerdende Stellung des vierten Beamten zu empfehlen.
Und so arbeitete Emdner heute schon den dritten Tag hier unten, fern von allem, was ihm lieb und teuer war...
Den letzten Grund, der den jungen Beamten bewogen hatte, den schweren Dienst auf dem Grunde des Meeres anzunehmen, hatte Direktor Pool allerdings bei der Empfehlung des tüchtigen Praktikanten nicht mit angeführt; denn er wußte ihn nicht — wohl aber wußte ihn sein Töchterchen. Ein Ziel lockte den ernst arbeitenden, verschlossenen jungen Mann, zu dessen Erreichung er gern noch viel Härteres auf sich genommen hätte — und dieses Ziel hatte braunlockiges Haar und helle Schelmen-Augen, und die Tochter des Direktors konnte es allezeit in ihrem Spiegel schauen. —
Ein gutes Teil leichter wurde Emdner der Eintritt in die vom Leben der übrigen Menschen so völlig verschiedenen Verhältnisse durch die treuherzige Art, mit der sein spezieller Dienstkollege Donath ihn vom ersten Augenblicke an begegnete...
»Es freut mich, Kollege«, sagte Donath, als sie am andern Tage wieder zusammen am Telephon-Schalter arbeiteten, »daß Sie sich nicht gleich in die Hochflut des Verkehrs hineinzustürzen brauchen! Solch ein Börsen-Ultimo, wissen Sie, hat durchaus nichts Bestechendes für unsereinen hier ›im schwarzen Walfisch!‹«
»Ich bin nicht ungehalten darüber, Kollege Donath. — Sagen Sie, haben Sie auch in den ersten Tagen Ihres Hierseins öfter das Gefühl gehabt, nicht frei atmen zu können? In der gestrigen Nacht habe ich sogar geträumt, ich sei in eine riesige Kiste geklettert, und der Deckel sei unvermutet zugeschlagen und ins Schloß geschnappt. —«
Donath lachte. »Das ist die Raumangst. Die bekommt hier unten jeder! Ich habe in der ersten Zeit immer geträumt, ich wäre in eine große Kanone gekrochen, und man setzte von vorn einen ordentlich festen Pfropfen auf. Immer fühlte ich im Schlaf, wie der Kanonier den Pfropfen mir bis an die Zehen stieß, immer schrie ich fürchterlich auf — und immer wurde ich von meinen Kollegen in der Schlafkabine ausgelacht...«
— Aus dem nebenan liegenden Erholungsraum hörte man plötzlich lauten Wortwechsel, der selbst durch die dickgepolsterte, schalldämpfende Tür klang.
»Da, hören Sie wieder einmal unsere beiden Schachmeister«, sagte Donath. »Nach einigen Stunden endet regelmäßig ihre Partie mit gegenseitigen Vorwürfen und Beleidigungen, und ebenso regelmäßig setzen sie sich beim Beginn ihrer Erholungsstunden wieder in trautester Einigkeit am geliebten Schachbrett nieder.«
»Ich glaube, daß die Langeweile hier unten oft recht fühlbar werden kann: das Rauchen ist verboten wegen der Feuersgefahr, alkoholische Getränke sind auch nicht ›an Bord‹ — bleibt also nur das Spiel. —«
»Und das gemütliche Geplauder«, fügte Donath hinzu, »das unter gleichgestimmten Naturen auch ohne die sonstigen Vehicula der Unterhaltung, als da sind Trinken und Rauchen, doch seine stillen Vorzüge hat!«
Die Uhr über der Verbindungstür gab jetzt drei helle, durchdringende Schläge —
»Unser Ablösungssignal für heute —«, sagte Donath, den Fernhörer vom Ohr abnehmend.
Gleichzeitig öffnete sich auch schon von außen die Tür und die beiden auf einander erzürnten Schachspieler, Müller und Schulze, traten ein, um für die nächsten drei Stunden den Dienst zu übernehmen.
Lachend ging Donath auf die beiden erhitzten Gegner zu.
»Bei euch Beiden ist die Sache umgekehrt als bei andern Menschen«, meinte er, dem erregtesten von beiden, dem langen Müller, auf die Schulter klopfend — »andere zanken sich im Dienst und vertragen sich beim Spiel; ihr macht‹s umgekehrt. —«
»Ach«, polterte nun der dicke Schulze heraus — »das ist immer bloß der lange Müller mit seinem sogenannten geistvollen Spiel. —«
»Erlaube, Müller, du bist jedesmal das Karnickel, das anfängt. —«
»Erlaube gefälligst du! Hättest du nicht den Springer —«
»Ach was, hättest du nicht mit deinem Bauern mich —«
Das Herabfallen einer Klappe und der damit einsetzende schrille Laut des Fernweckers schnitt ihren Streit ab, der sonst vielleicht noch heftiger geworden wäre...
Lächelnd schritten Emdner und Donath hinaus, dem strengen Dienst der nächsten Stunden es überlassend, die beiden Hitzköpfe abzukühlen.
Die nächsten Freistunden benutzte der junge Praktikant, um sich über den elektrischen Betrieb des Untersee-Amtes zu informieren. — Überhaupt fand sein auf die Naturwissenschaften schon seit der Kindheit gerichtetes Interesse in der neuen Umgebung reiche Nahrung.
Die Abgabe des elektrischen Stromes, der zum eigentlichen telephonischen Betrieb des Amtes selbst, zur Erleuchtung der einzelnen Räume, zum Kochen und Heizen und zum Betrieb der Absorptionstrommeln die nötige Energie liefern mußte, erfolgte durch eine Anzahl großer Akkumulatoren, deren Bedienung einem sechsten Beamten übertragen war.
Emdner fand ihn gerade beschäftigt, den Säuregehalt und die Isolation der Batteriezellen zu kontrollieren, und war bald mit ihm in ein fachwissenschaftliches Gespräch vertieft.
So traf Donath den neugewonnenen Freund.
»Denken Sie sich, was eben der Alte« — mit diesem wohl allgemein gültigen Spitznamen meinte er den Direktor des Unterseebetriebes in Bremen — »an uns telephoniert: ›Wegen stattgehabter Havarie im Kanal kommt der Dampfer »Telephon« erst am nächsten Donnerstag‹, also volle drei Tage später als sonst. — Komisch, nicht, wenn Sie sich dabei an unser letztes Gespräch erinnern! Zum ersten Male, solange das Amt hier unten besteht, werden wir also wahrscheinlich den Reserveluftvorrat in Anspruch nehmen müssen. Ordentlich spaßhaft, daß Sie ein paar Tage nach Ihrer Ankunft im ›schwarzen Walfisch‹ gleich etwas Außergewöhnliches erleben, nicht?« —
Dann wandte er sich an den Maschinisten. »Sommer, Sie haben wohl gehört, daß der Dampfer später kommt, — schalten Sie also immer schon den großen Reservezylinder an die Luftleitung.« —
Die beiden Kollegen kehrten in die »Klause« zurück, wie der gemeinschaftliche Schlaf- und Erholungsraum genannt wurde; Emdner wollte einen langen Brief an einen Kollegen über seine bisherigen Erlebnisse schreiben — und Donath setzte sich mit einem Bändchen Gedichte seines humoristischen Landsmannes Robert Johannes gemütlich in eine Ecke. Ein Weilchen später trat der Maschinist Sommer ein.
»Ach, Herr Donath, vielleicht helfen Sie mir ein wenig! Das Manometer am Reservezylinder scheint nicht zu funktionieren — der Zeiger bewegt sich nicht.«
»Das werden wir bald haben, lieber Sommer! Kommen Sie!« Donath und der Maschinist schritten in den Maschinenraum.
Donath versuchte zunächst, wie vorher der Maschinist, durch Schütteln und vorsichtiges Klopfen den Zeiger des Manometers, der beim Öffnen des Verbindungshahnes den im Stahlzylinder herrschenden Druck von vierhundert Atmosphären hätte anzeigen müssen, in Gang zu setzen. Vielleicht war die Achse desselben ein wenig eingerostet.
Es gelang nicht.
»Schrauben Sie doch einmal das Manometer von dem jetzt noch in Betrieb befindlichen Zylinder ab, Sommer!«
Sommer tat, wie ihm geheißen.
»So — nun wollen wir dies richtig funktionierende an Stelle des wahrscheinlich unbrauchbar gewordenen auf den Vorratszylinder aufschrauben!«
Auch dies war schnell ausgeführt, und Donath öffnete abermals den Hahn des Verbindungsrohres zwischen Manometer und Zylinder — mit unverwandtem Blick den Zeiger betrachtend —
Der Zeiger rührte sich nicht!
Alles Klopfen und Erschüttern des Apparates war vergebens. —
»Schrauben Sie das Manometer noch einmal ab — wir wollen einmal den vollen Strahl des komprimierten Gases auf das Verbindungsstück wirken lassen — vielleicht ist es im Laufe der Zeit zugerostet, verstopft. —«
Alles umsonst! Selbst bei voll geöffnetem Verschluß entströmte nicht ein Hauch komprimierter Luft dem Zylinder.
Da hörte Donath hinter sich eine Stimme sagen: »Ich fürchte, der ganze Reservezylinder ist leer!«
Es war Emdner, der leise hinzugetreten war.
Donath wandte sich zu ihm um — bleich, mit entstelltem Gesicht —
»Um Gotteswillen, Kollege — das kann ja nicht möglich sein, das wäre ja entsetzlich —«
»Prüfen wir noch einmal genau, systematisch, Manometer und Zylinder, Kollege Donath. —«
Und aufs neue untersuchten sie Manometer und Verbindungsrohr.
Sie zeigten kein Hindernis für den Luftdurchlaß.
»Wir wollen das Ansatzstück des Zylinders ganz abschrauben«, riet nun Donath — »oder fast ganz, die ausströmende Luft muß uns ja schon beim Aufdrehen der letzten Gänge der Schraubenwindung entgegenströmen. —«
»Wir wollen es hoffen!«, sprach Emdner ernst.
Vorsichtig begann der Maschinist den Verschlußteil des riesigen Stahlzylinders abzuschrauben. —
Atemlos standen die Männer, angespannt auf das noch immer nicht eintretende Zischen des entströmenden Gases lauschend. —
Ein großer Teil der Windungen war schon herausgeschraubt — es nahten die letzten Umgänge der Schraube — kein Geräusch war zu hören...
Der Maschinist hielt den ganz herausgeschraubten Verschlußteil in der Hand — die große, nun ganz freie Öffnung des Vorratszylinders gähnte ihnen schwarz entgegen — kein Atom aufgespeicherter Luft war darin vorhanden.
»Wahrhaftig, er ist leer!«, rief Donath entsetzt. »Aber das kann ja gar nicht möglich sein! — Herr Gott, was fangen wir nun an?«
»Wie lange haben wir noch Luftvorrat in dem jetzt arbeitenden Zylinder?«, fragte Emdner den Maschinisten.
»Vierundzwanzig Stunden!«
»Also muß in vierundzwanzig Stunden auf irgend eine Art für Luftzufuhr gesorgt werden, Kollege Donath, sonst sind wir wahrscheinlich übermorgen alle nicht mehr am Leben. —«
»Wir müssen augenblicklich telephonieren an den Chef. —«
»Aber der Dampfer fährt von Bremen hierher drei Tage«, sagte Emdner.
»Mein Gott, mein Gott, was fangen wir nur an, Kollege?«
Emdner gab keine Antwort. —
Donath stürzte ins Dienstzimmer. Er stellte die Verbindung mit dem Hauptamt in Bremen her und rief an. Er erhielt keine Antwort. In fieberhafter Aufregung gab er Signal auf Signal zum Anruf — vergebens!
»Was ist denn los, Donath! — Mensch, Sie sind ja ganz aufgeregt?«
»Ach, lassen Sie mich, Schulze — mir ist nicht wohl!...«
Wieder und wieder rief er das Amt an — vergebens! Die Leitung, die noch ganz kurz vorher funktioniert hatte, mußte durch irgendeinen plötzlich eingetretenen Zwischenfall gestört worden sein.
Es war entsetzlich! Zu all dem Furchtbaren auch das noch! Wie sollte das enden?
Zwanzig Stunden später — die vier Beamten der Unterseestation waren im Dienstzimmer anwesend, — fiel die Klappe, auf welcher die Bezeichnung Bremen—Hauptamt stand, herab und der elektrische Wecker ertönte —
Alle Vier hatten sie fallen sehen und eilten an die Fernhörer —
»Meine Herren —«, hörten sie nun die Stimme ihres höchsten Chefs, — »durch ein im Kanal gestern gesunkenes englisches Schiff ist unsere Sprechlinie Bremen-Unterseeamt auf zwanzig Stunden gestört gewesen. Haben Sie über London meine Benachrichtigung erhalten?«
Man hatte nichts erhalten.
»Herr Direktor, haben Sie über London unsere Mitteilung erhalten, daß wir in Gefahr sind, zu ersticken?«
»Nein«, klang es aus der Muschel des Fernhörers.
In fliegender Eile schilderte nun Donath ihm die fürchterliche Entdeckung des leeren Luftzylinders und fragte im Namen seiner Kollegen an, wann frühestens der Dampfer »Telephon« mit dem neuen Luftvorrat hier sein könne. —
Man hörte in dem lautstarken Apparat, wie der Direktor Aufträge an seine höheren Beamten erteilte, sofort im Arbeitszimmer zu erscheinen.
»Ich rufe Sie gleich wieder an, Herr Donath«, sprach der Direktor noch. Dann blieb es eine Weile still...
Dann hörte man Türen klappen, Stühle rücken — die Beamten in Bremen setzten sich zu einer Konferenz zusammen. Man hörte deutlich die Stimme des Direktors, der ihnen die verzweifelte Lage im Untersee-Amt auseinandersetzte. Es galt den heute früh aus Bremerhaven abgefahrenen Dampfer »Telephon« auf offener See zu benachrichtigen, um ihm die doppelte Fahrgeschwindigkeit zur Pflicht zu machen.
Der Direktor beschloß, die Marconistation an der irischen Küste anzurufen, die dem schon auf dem freien Ocean schwimmenden Dampfer durch Telegraphie ohne Draht die Nachricht zusenden sollte. —
»Herr Donath!«
»Herr Direktor!«
»Eben läuft das Telegramm an die Marconistation an der irischen Küste ab, das unserm Dampfer ›Telephon‹ die größte Eile zur Pflicht machen soll. Im günstigsten Falle kann also der Dampfer bei verdoppelter Geschwindigkeit in achtundvierzig Stunden beim Untersee-Amt sein. —«
»Achtundvierzig Stunden? — Herr Direktor, wir haben nur noch für v i e r Stunden frischen Luftvorrat. —«
»Verzweifeln Sie nicht, meine Herren! Was von meiner Seite geschehen kann, Sie alle zu retten, wird sicher geschehen. Geben Sie von Stunde zu Stunde Nachricht über Ihr Befinden dort! Gott wird mit Ihnen sein!« — — —
Die Stunden schlichen langsam, entsetzlich langsam.
Vier Stunden später stand der Zeiger des Manometers an dem Zylinder, der bis jetzt die Luftzufuhr besorgt hatte, auf Null. Der Maschinist hatte richtig taxiert.— Von diesem Augenblicke an lebten sie von dem in den Räumen des Untersee-Amtes noch vorhandenen Luftsauerstoff. Da ein Mensch in einer Stunde zum Atmen fast fünfzig* Kubikmeter Luft verbraucht, so ließ sich das Leben, das den sechs Menschen in dem hermetisch abgeschlossenen Raume noch beschieden war, auf Minuten genau berechnen. — — —
* Das Ruheatmungsvolumen liegt laut »Wikipedia« bei nur ca. 0,5—1,0 m³/h je Person.
Die vier Beamten hatten trotzdem beschlossen, den regelmäßigen Telephon-Verkehr zwischen Europa und Amerika aufrecht zu erhalten — und zwar auf Donaths Rat, der mit Recht anführte, daß die gewohnte strenge Beschäftigung in solch verzweifelter Lage eine wahre Wohltat und Ablenkung für den gemarterten Geist bedeute.
»Wir stehen hier, wie Soldaten auf einem verlorenen Posten, meine lieben Kollegen. So lassen Sie uns in alter deutscher Treue aushalten bis ans Ende!«
Sie drückten sich die Hände — und in gewohnter Weise nahmen sie ihr Tagewerk auf, als ob nichts geschehen sei...
Emdner beobachtete den automatischen Luftprüfer. Es waren ungefähr sechs Stunden seit der letzten Zufuhr frischer Luft verflossen. Die außerordentlich prompt arbeitenden Absorptionstrommeln nahmen in gewohntem Maße die abgeschiedene Kohlensäure auf; kaum eine leise Neigung zeigte das Instrument, über den normalen Stand des Kohlensäuregehalts hinauszugehen.
Aber noch standen sie im Anfange ihrer Leidenszeit — noch war kaum ein Achtel der Stunden dahin, nach deren Verlaufe eine frische Luftzufuhr möglich wurde.
Die Beamten des Ressorts, denen die Leitung des Untersee-Telephon-Betriebes in Bremen anvertraut war, waren mit dem Direktor vollzählig, trotz der mitternächtigen Stunde, im Dienstzimmer versammelt.
Man wartete auf eine Nachricht der Marconistation — ob es ihr noch gelungen sei, dem Dampfer »Telephon« rechtzeitig von der Notwendigkeit möglichst beschleunigter Fahrt Depesche zu geben.
Alle wußten, daß auf dem frühzeitigen Eintreffen des Schiffes die einzige Hoffnung beruhte, die armen Kollegen weit, weit von hier, dreihundert Meter tief auf denn Grunde des Oceans, vom Tode des Erstickens zu retten. Keiner dachte an sich selbst, an sein Haus, an die weit vorgeschrittene Zeit — die Verzweiflungslage ihrer Kollegen ließ keinen andern Gedanken aufkommen...
Endlich ein schrilles Klingelsignal — der Wecker der Marconistation. »Gott sei Dank«, sagte der Direktor und eilte an den Apparat.
Die Beamten beobachteten ihren Chef, um aus seinen Zügen schon die erhoffte Nachricht lesen zu können. —
Die hohe, straffe Gestalt des Direktors, die sonst in ihrer Haltung den früheren Militär nicht verleugnete, begann zu wanken vor Aufregung — die Beamten eilten hinzu.
»Ach, meine Herren — ach, es ist furchtbar —«
»Der Dampfer hat das Signal nicht mehr erhalten?«, fragte ein Inspektor —
»Ja — er hat es erhalten — kann aber dem Befehl nicht Folge leisten — die linke Schraubenwelle ist gebrochen — er vermag überhaupt nur mit der Hälfte seiner gewöhnlichen Geschwindigkeit zu fahren. — Ach, es ist zum Verzweifeln —«
Die Beamten umstanden erschüttert ihren Direktor. Keiner sprach ein Wort.
»Wie oft habe ich der Behörde die Notwendigkeit eines immer zum Auslauf fertigen Reservedampfers nahegelegt — umsonst! Erst ein entsetzliches Unglück — der Tod aller unserer braven Kameraden da unten auf dem Grunde des Meeres — muß meine Gesuche unterstützen. Meine Herren Kollegen — kann einer von ihnen einen Ausweg finden in dieser furchtbaren Situation?«
Sie schwiegen alle.
»Zu denken —«, sprach der Direktor bewegt, »daß wir hier alle fröhlich und frei atmen dürfen im frischen Hauche unbegrenzter Gottesluft — und die Ärmsten ringen um Atem, um Leben. —«
Eine Klappe des Unterseetelephonschalters fiel mit kurzem Anschlag herab. — Aller Augen wandten sich nach dem Schaltapparat.
»Das Unterseeamt!«, sagte einer der Anwesenden.
»Was werden wir hören müssen, meine Herren! Aber nicht wahr, wir wollen den Kollegen noch nichts von dem Unfall des Dampfers mitteilen?«
»Nein — nein, Herr Direktor!«, riefen mehrere Stimmen
Der Direktor hatte schon den Fernhörer ans Ohr gelegt. —
»Herr Direktor —«, hörte der Chef nun die klare Stimme Donaths sagen, — »wir haben hier einmütig beschlossen, den vorschriftsmäßigen Dienst zwischen Europa und Amerika wie gewöhnlich zu tun — bis ans Ende!«
»Bravo, meine tapferen Kameraden!«, rief der Direktor ins Telephon.
»Wir hoffen alle, daß der Dampfer uns übermorgen noch am Leben findet.«
»Gott schütze Sie, und auf Wiedersehen!«, sagte der Direktor erschüttert.
»Schluß!«
»Schluß!« —
Mit Tränen in den Augen teilte Direktor Pool seinen Beamten die Worte des Kollegen Donnath mit.
»Wer hätte wohl jetzt den Mut«, sagte er, »den braven Helden da unten die Wahrheit über den Dampfer ›Telephon‹ zu sagen? — Ach, es ist furchtbar!«
Vierundzwanzig Stunden später.
Im Untersee-Amt hatte sich nichts geändert — scheinbar.
Der Dienst wurde wie sonst getan. — Müller und Schulze hatten sogar, wie sonst, ihre Partie Schach gespielt, und sich, wie sonst, gestritten. —
Emdner und Donath standen vor dem Luftprüfer, der den Kohlensäuregehalt der Luft in gewohnter Regelmäßigkeit registrierte...
»Mich wundert immer noch, daß der Prozentgehalt der Kohlensäure in unseren Räumen nicht höher steigt!«, sagte Donath.
»Ja, es ist kaum gegen sonst ein Unterschied zu merken. Aber, solange unsere Ätzkalitrommeln funktionieren, kann ja auch kein höherer Kohlensäuregehalt eintreten, mein' ich.«
»Aber dann werden wir auch nicht an Kohlendioxydvergiftung zu Grunde gehen? —«
»Nein, solange wir genug Ätzkali im Vorrat haben, um das sich bildende Kaliumkarbonat durch frisches Kaliumhydroxyd ersetzen zu können, nicht. —«
»Dann ist unsere Lage am Ende nicht ganz so verzweifelt, lieber Kollege?«
»Wie man's nimmt, Kollege Donath! Wir werden eben nicht an Vergiftung durch Kohlensäure, sondern durch Sauerstoffmangel sterben, falls nicht rechtzeitig Hilfe kommt. Vielleicht haben wir länger zu leiden, weil der übrigbleibende Stickstoff unserer Atmosphäre keine eigentliche Giftwirkung für unsere Lungen besitzt — wir quälen uns um so länger, fürcht' ich, weil die in solchem Falle wohltätige Betäubung durch Kohlendioxydatmung fortfällt.«
»Wissen Sie, lieber Kollege Emdner, daß ich mich an Ihrer Ruhe und Sicherheit wieder aufgerichtet habe! Ich war schon gestern nacht ganz verzweifelt! — Woher nehmen Sie nur diesen Mut, bester Freund?«
»Lieber Kollege Donath, ich habe eine schwere, um nicht zu sagen, harte Jugend hinter mir, ich habe frühzeitig lernen müssen, dem vollen Ernst des Daseins ins Gesicht zu sehen — habe lernen müssen, nichts für mich zu hoffen — was sollte ich da noch für mich fürchten?? Ich bin einsam durchs Leben gegangen — sollte uns allen hier unten ein Lebendigbegrabenwerden beschieden sein — weint niemand um mich. —«
»Niemand, lieber Kollege?«
»Meine guten Eltern sind lange tot — niemand!« Er sagte es so bestimmt, konnte es aber nicht hindern, daß bei den letzten Worte eine tiefe Röte sein Gesicht überflog.
Donath bemerkte es — und ein Schimmer des Verständnisses ging ihm auf.
»Vielleicht würde doch jemand um Sie trauern! — Man hat oft Freunde, ohne es zu wissen! Aber wir wollen uns damit noch nicht das Herz schwer machen — noch habe ich Hoffnung — und Gott wird unseren Untergang nicht beschlossen haben.«
In der darauffolgenden Nacht zeigten sich bei den meisten die ersten Anzeichen des Luftmangels. Die Atmung war beschleunigt, der Pulsschlag erhöht. Ein Bestreben, den fehlenden Sauerstoff durch vermehrte Atemzüge den Lungen zuzuführen, führte nach und nach zu einer fieberhaften Aufregung, die den allen so nötigen Schlaf unmöglich machte. Aber die Hoffnung, bald Hilfe zu erhalten, hielt sie aufrecht.
Am meisten hatte »Schmorchen« unter den veränderten Existenzbedingungen zu leiden, der von Hause aus schon etwas asthmatisch veranlagt war. — —
Noch vierundzwanzig Stunden! —
Mit eiserner Willenskraft zwangen sich Donath und Emdner zur Einhaltung der vorschriftsmäßigen Dienststunden; aber sie fühlten, daß es mit ihrer Energie zu Ende gehe.
Müller und Schulze lagen teilnahmlos, das Haupt auf dem Tische — zwischen ihnen stand das geliebte Schachspiel — es reizte sie nicht mehr.
Furchtbare Kopfschmerzen, verbunden mit Flimmern und Schwarzwerden vor den Augen, stellte sich ein.
Das Essen blieb unberührt. Die Kräfte aller hier Eingeschlossenen nahmen sichtlich ab.
»Wir erleben die Ankunft des Dampfers nicht mehr«, sagte Donath am andern Morgen zu Emdner, als er einen Augenblick mit ihm allein war.
»Ich fürchte es auch, lieber Freund!«
»Dieser unglückselige Vorratszylinder! Wie war es nur möglich, daß er leer sein konnte?«
»Ich habe in dieser schlaflosen Nacht eine Erklärung dafür gefunden«, sagte Emdner. »Erinnern Sie sich an unser Gespräch am ersten Morgen nach meiner Ankunft? Sie wunderten sich über die Reinheit der Luft hier unten, über ihren geringen Kohlensäureprozentsatz! Nun — der heimliche Lieferant der frischen Luft war eben — der nun leere Reservezylinder, der neben dem angeschalteten durch die Manometer kontrollierten Luftzylinder unbemerkt seinen Vorrat abgab. —«
»Aber wie wäre das möglich? Die Verschlüsse waren ja sämtlich dicht, noch dazu plombiert?«
»Aber ein noch so feiner Riß im Stahlmantel reichte hin, um im Laufe einiger Wochen oder Monate ihn seines Inhalts zu entleeren, Kollege Donath.«
»Sie können recht haben, lieber Kollege! Aber nützen tut uns diese Erkenntnis nun auch nichts mehr. Sehen Sie nur den Zustand ›Schmorchens‹. Und auch Müller beginnt zu phantasieren — und auch wir andern werden bald eben so weit sein — ach, es ist fürchterlich! Ich habe mich schon nachts in der Verzweiflung auf dem Gedanken ertappt, die Kohlensäureabsorption durch Anhalten der Kalitrommeln aufzuheben, um schneller ein Ende mit uns allen zu machen. —«
»Das ist es eben, was ich für uns alle fürchte, den Zustand des Deliriums, der uns schließlich unfähig machen wird, die Vorgänge um uns her mit klarem Sinnen zu verfolgen. —«
»Und zu denken, daß immer noch ein voller Tag verstreichen muß, ehe die Hilfe hier sein kann — ach, es ist nicht auszudenken!« Wieder sind zehn Stunden vergangen. Entsetzlich klar ist es allen geworden, daß sie die Ankunft des Dampfers nicht mehr erleben werden. — Und die Unglücklichen in ihrem unterseeischen Gefängnis ahnen ja nicht, daß dem Dampfer ein Unfall passiert ist, daß eine seiner Schrauben gebrochen und er mit verminderter Schnelligkeit fährt. —
Direktor Pool hat als letztes Mittel noch versucht, mit Hilfe der Marconistation einzelne Schiffe aufzufordern, den Dampfer »Telephon« aufzusuchen und ins Schlepptau zu nehmen, um eine größere Fahrgeschwindigkeit zu erzielen — ein letzter aussichtsloser Versuch...
Der Direktor stand am Apparat — als sich die Türe seines Zimmers öffnete. Seine Tochter Annemarie trat ein.
»Entschuldige, lieber Papa — aber Mama schickt mich her, du möchtest doch endlich zu Tisch kommen. —«
»Liebes Kind, das ist sehr lieb von Mama — aber du weißt, um was es sich in diesen Tagen handelt, nicht wahr, und begreifst, daß man da wenig Zeit hat, an Essen und Trinken zu denken!«
»Das habe ich mir auch gedacht, Papa, und habe dir hier« — sie brachte ein zierliches Körbchen zum Vorschein — »eine kleine Herzstärkung mitgebracht. Ich weiß ja, daß dies ein amtlicher Verstoß ist; aber es sieht es ja niemand — und ich will gern so lange am Telephon bleiben, als du ißt. Komm, setz dich her, Väterchen!«
Er küßte sie gerührt. »Gutes Mädchen!« Und er begann schnell zu essen.
Die Klappe des Unterseeamtes fiel herab. —
»Herr Direktor«, klang die Stimme Donaths. —
»Schnell, Papa — man ruft dich!«
Direktor Pool nahm den zweiten Fernhörer vom Haken, indes sein Töchterchen am andern lauschte.
»Herr Donath wie geht es? Ist es noch zu ertragen?«
»Lieber Herr Direktor! Wir sind gerettet — wir werden nicht ersticken. Kollege Emdner hat uns alle gerettet! — Auch falls unser Dampfer einen Tag oder zwei später kommt, haben wir Luft zum Atmen genug. —«
»Aber, lieber Kollege — ich begreife nicht — ist Herr Emdner auch am Telephon dort?«
»Jawohl, Herr Direktor, hier Emdner!«
»Aber, liebster, bester Freund, erklären Sie mir doch — wie Sie dies Wunder vollbracht haben. —«
»Durch Elektrolyse, Herr Direktor. Ich gewinne den uns nötigen Sauerstoff aus dem Wasser, das ich mit Hilfe des elektrischen Stromes in seine beiden Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlege. —«
»Und Sie werden nicht ersticken, hoffen Sie?«
»Nein, Herr Direktor — ich habe genau die uns zur Verfügung stehende Elektrizität und den uns nötigen Sauerstoff berechnet. Es reicht gerade, auch wenn der Dampfer zwei Tage später kommt, als angesetzt, —«
»Gott sei Dank! Das soll Ihnen unvergessen sein, lieber Herr Emdner. — So darf ich Ihnen wohl auch sagen, daß die von ihnen angenommene Möglichkeit leider eintreten wird: der Dampfer wird einen oder zwei Tage später kommen. Verlieren Sie den Mut nicht, meine Herren! Meinen innigsten Gruß und Dank an Sie alle!«
»Dank für Ihre Teilnahme an uns, Herr Direktor. —«
»Herrn OberPraktikant Emdner bitte ich, wenn möglich, bis zum Eintreffen des Dampfers eine schriftliche Darlegung seines Verfahrens, durch welches er dem gesamten Vaterlande einen so großen Dienst geleistet hat, fertigzustellen und an mich einzureichen.«
»Schluß!«
»Schluß!«
»Nein, Herr Emdner; noch nicht Schluß! Ich bin hier bei Papa am Telephon, ich, Annemarie. —«
»Fräulein Annemarie! —«
»Ja, ich bin's! Ich habe alles mitangehört! Ach, wie freue ich mich, Herr Emdner, daß Sie nun doch noch gerettet werden! Glauben Sie mir, ich habe all die Tage kaum recht zu atmen gewagt, weil ich wußte, in welcher Gefahr Sie schwebten —«
»Liebes Fräulein Annemarie — wie danke ich Ihnen!«
»Danken Sie nicht, lieber Herr Emdner — sondern kommen Sie recht bald gesund wieder hierher zu uns, hören Sie!«
»Wir wollen das Beste hoffen, Fräulein Annemarie. —«
»Kommen Sie nur, sobald es der Dienst erlaubt — Ich weiß etwas Schönes für Sie. —«
»Auf Wiedersehen denn, Fräulein Annemarie, und Gott segne Sie für Ihr gutes Herz!«
»Das ist gar nicht so gut! — Auf Wiedersehen — bald!« — —
— Mit einem Schlage, blitzschnell, war dem jungen Oberpraktikanten Emdner die Erleuchtung gekommen. —
Elektrolytisch den Sauerstoff des Wassers gewinnen — wenn das gelänge, wäre ihnen allen geholfen!
»Kommen Sie, Kollege Donath«, rüttelte er den schon im Fieber der Ermattung liegenden Freund auf — vielleicht können wir uns selbst noch retten — kommen Sie, schnell!«
Und sie eilten nach dem Maschinenraum.
»Wieviel Strom haben wir insgesamt zur Verfügung?«, fragte er den Maschinisten Sommer, der von ihnen allen noch der kräftigste schien.
»Unsere Batterie besteht aus 50 Zellen, jede zu 1000 Ampèrestunden, Herr Emdner. —«
Der junge Mann warf rasch einige Zahlen auf Papier. —
»Sehen Sie her, Kollege Donath! Fassen Sie Mut, Freund! — Der Strom von einem Ampère liefert in einer Stunde 200 Kubikcentimeter oder ein fünftel Liter Sauerstoff. Ein erwachsener Mensch braucht, wie Sie wohl aus Professor Lüpkes Unterricht auch noch wissen werden, pro Stunde ungefähr zwanzig Liter reinen Sauerstoff, wir alle sechs hier im »schwarzen Walfisch« also pro Stunde hundertundzwanzig Liter. Dazu brauchen wir eine Stromstärke von ca. sechshundert Ampères pro Stunde. Die können wir durch geeignete Schaltung unserer Batterie auf reichlich sechzig Stunden entnehmen und behalten dabei immer noch einige Akkumulatoren für die übrigen Betriebe frei — meinen Sie nicht auch, Sommer?«
Der Maschinist nickte. »Zehn Reservezellen sind noch völlig geladen«, sagte er.
»Um so besser.«
»Aber zur elektrischen Zersetzung des Wassers brauchen wir —«
»Wasser in erster Linie«, sagte Emdner lächelnd zu Donath. »Das gibts um uns im Meere genug, und wir haben ja nur nötig, den Hahn zu drehen, der die Verbindung mit dem Wasser draußen herstellt. —«
Donath lächelte nun auch. »Das wird uns nicht fehlen! Aber wir brauchen Zersetzungsgefäße. —«
»Wir haben zehn Reservegefäße für undicht werdende Batteriezellen hier —«, warf der Maschinist ein und deutete auf eine Reihe langer und hoher Tröge aus Hartgummi.
»Famos — das war meine größte Sorge!«, rief Emdner erfreut.
»Die meinige ist — das Material, aus welchem die beiden Elektroden bestehen, zwischen denen das Wasser zersetzt werden soll — das Platin, das einzige Metall, welches den bei der Zersetzung freiwerdenden Sauerstoff nicht oxydiert. —«
»Lieber Kollege Donath — wir haben viele, viele Quadratmeter dieses edlen Metalles hier unten. —«
Donath sah seinen Kollegen bestürzt an — hatte er infolge der Aufregung den Verstand verloren?
Emdner legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. —
»Ich weiß, was ich rede, lieber Freund — und Sie werden es auch gleich wissen! Ich meine die Platin-Auskleidung an den inneren Wänden unseres ganzen Tunnelbaues hier unten. —«
Donath schlug sich vor die Stirn. »Daran hätte ich nicht gedacht!«, rief er überrascht aus.
»Kommen Sie nur schnell, Kollege! Alle sollen mithelfen, so gut es geht — und ›Schmorchen‹ muß uns etwas Feines zum Diner — ober ist es schon Souperstunde? — bereiten; das wird ihm auch wieder Mut machen.« — —
Ein paar Stunden später.
Zehn lange und hohe Zersetzungszellen hat Emdner mit Assistenz seiner Kollegen zusammengebaut. Das Schwierigste war die Gewinnung der Platinbleche gewesen; denn man mußte zu ihrer Erlangung die fast stahlharten Papierwände des Maschinenzimmers durchbrechen.
Aber die Not — und die Hoffnung gab allen die verloren geglaubten Kräfte zurück — und ein komischer Zufall wollte es, daß der dicke Schulze zuerst auf das blanke, silberglänzende Metall stieß.
»Ach, wenn ich doch im Leben auch mal so zuerst auf edles Metall käme! —«, seufzte er, und alle mußten lachen...
Nach Emdners Anleitung ging es dann an die Zerschneidung der abgetrennten Platinbleche.
Mitten in seiner Arbeit hielt Donath plötzlich inne —
»Aber — Kollege Emdner — wir erhalten ja bei der Elektrolyse des Wassers nicht bloß Sauerstoff am positiven Pol, sondern auch am negativen — Wasserstoff?«
»Was schadet das?«, fragte Emdner gleichmütig. »Wasserstoff ist kein Gift für unsere Lungen, und mit dem ausreichenden Quantum Sauerstoff gemischt, wie hier, läßt er sich ohne Nachteil einatmen. —«
»Aber wir leben doch in einer Knallgasatmosphäre, bester Freund! Jeder Funke kann das unsere Räume erfüllende Gasgemisch von Wasserstoff und Sauerstoff zur Explosion bringen.«
»Es darf also kein Funke entstehen, und die einzige Möglichkeit, wo ein Funke oder ein Glühendwerden eines Drahtes auftreten könnte, ist die elektrische Küche. Darum soll eben ›Schmorchen‹ vorher etwas Warmes braten oder schmoren; morgen und übermorgen essen wir — k a l t e Küche!«
Zwei Tage später legte der Dampfer »Telephon« an der Boje über dem Unterseeamt auf 52° 2' nördl. Breite und 33° 18' westl. Länge an. Die Maschine stoppte — das Unterseeboot ging eiligst unter Wasser. Unter den Insassen des Bootes befand sich der Schiffsarzt mit seinen Assistenten...
Was würde man zu sehen bekommen? Würde noch ein einziger der Unglücklichen am Leben sein? Seit dem Telegramm der Marconistation waren vier volle Tage verflossen!
Von der geschickten Hand seines Ingenieurs gesteuert, legt das Boot jetzt an der Verschlußscheibe des Unterseebauwerkes an. Schnell sind die FlanschVerschraubungen hergestellt und damit die Verbindung mit dem Innenraum des Amtes möglich.
Als erster läßt sich der Doktor, als zweiter sein Assistent mit dem Medizinkasten durch das Verbindungsrohr bugsieren. —
Er eilt an die hermetisch schließende Tür, welche das Innere noch einmal absperrt, und reißt sie auf. — —
Im Maschinenraum, welcher der Tür am nächsten liegt, befindet sich niemand. Die beiden stürzen weiter, öffnen die Tür nach dem eigentlichen Dienstzimmer — auch dies ist leer, aber die elektrischen Glühlampen an der Decke leuchten wie sonst, und auf dem Arbeitstische unter der grünbeschirmten Lampe liegen einige beschriebene Bogen. —
Noch einige Schritte, und der Arzt hat die gegenüberliegende Tür zum Speise, Schlaf- und Erholungsraum geöffnet — —
Da sitzen sie alle sechs am Tische und probieren mit wichtiger Miene einen kalt eingerührten Flammerie von ›Schmorchens‹ Erfindung!«
»So«, — sagte der junge Oberpostpraktikant Fritz Heinrich, die Feder aus der Hand legend und sich behaglich in dem Stuhl zurücklehnend — »meine Kollegen werden allerdings sagen, die Geschichte klingt etwas stark nach Jules Verne; aber für die Jubiläumsfeier meines lieben, verehrten Direktors wird sie sich doch verwenden lassen! Er selbst wird diese novellistische Anrempelung wohl nicht übel nehmen und sein Töchterchen hoff‹ ich, auch nicht!«
— Und bei dem Gedanken an das Töchterchen mit dem braungelockten Haar und den schelmischen Augen griff er noch einmal zur Feder und fügte dem obigen Manuskript einen Schlußsatz hinzu:
»Als wenige Tage später die sechs Beamten der UnterseeTelephonStation einen außergewöhnlichen Urlaub erhielten, eilte Emdner nach Bremen, um seinem obersten Chef noch einmal persönlich über all das Erlebte Bericht erstatten. Er las seinem Direktor die Freude vom Gesicht, als er ihm noch am Abend seiner Ankunft seine Aufwartung machte — und hinter der hohen militärischen Gestalt des Vaters tauchte eine schlanke Mädchenfigur auf im braunen Lockenhaar, und in den zwei sonst so neckisch lachenden Schelmenaugen schimmerte es heute feucht — wie der Märchenglanz eines künftigen Glückes.«
Und nun, liebste Elisabeth, noch eins Ihrer kleinen Lieder!« Damit führte Frau Geheimrat Frenken mit fast mütterlichem Stolze eine schlanke junge Blondine an den Flügel —
Mehrere junge Damen und Herren machten höflich Platz.
»Erlauben Sie, Herr Assessor, noch einen Augenblick, Sie sollen gleich tanzen dürfen; Fräulein Linden singt nur noch ein Liedchen! — So, liebes Kind — — Bemühen Sie sich nicht, Herr Doktor, Fräulein Elisabeth singt nach eigner Komposition, lassen Sie also die Notenmappe ruhen! — Bitte, Liebste!«...
Zwanglos hatte sich das blonde Mädchen der Aufforderung der Dame des Hauses gefügt; zwanglos, ohne gemachte Effekthascherei, schlug sie präludierend ein paar Accorde an, und ebenso frei und zwanglos gab sie ihren Gesang:
»Das ist das Schönste auf der Welt,
Daß heimlich du in Treuen mein,
Daß unterm weiten Himmelszelt
Kein anderer weiß, wie sehr ich dein!
Daß nur die Wolken und der Wind
Als unserer Liebe Boten geh'n —
Daß nur des Mondes Auge lind
All unser heimlich Glück geseh'n...
Daß heimlich du in Treuen mein,
Daß unterm weiten Himmelszelt
Kein anderer weiß, wie ganz ich dein —
Das ist das Schönste auf der Welt!«...
Die zahlreich versammelte Gesellschaft applaudierte. Die jungen Damen drängten sich heran, die Sängerin zu beglückwünschen. Lachend nahm sie die Lobeserhebungen und Schmeicheleien der Umstehenden an — ihr sympathisches Gesicht behielt seinen sonnigheiteren Ausdruck; wie Sonnenschein leuchtete es auch aus den großen, graublauen Augen, die gleichmütig in das gesellige Treiben ringsumher blickten und nur einen Moment sich schlossen, als die Frau Geheimrat die schöne, reine Stirn der Sängerin küßte.
»Sagen Sie, bester Doktor«, wandte sich Assessor Gosta an seinen Nachbar, »wer ist die Dame?«
»Die Tochter des Professors Linden, einziges Kind überdies, führt dem alten, etwas eigensinnigen Vater seit dem Tode der Mutter die Wirtschaft — übrigens famose Stimme, nicht wahr?«
»Famos — und eigene Komposition?«
»Ja, die junge Dame ist vielseitig begabt: sie spielt geradezu phänomenal klassische Meister, singt wie eine Konzertsängerin, komponiert, dichtet, hilft dem Vater bei der Fertigstellung seiner Manuskripte — der Alte ist hervorragender Chemiker — und kocht auch vorzüglich!«
»Alle Hochachtung, Doktor — so etwas findet man selten heutzutage! — Na — und in puncto: Liebe? Versagt, wie?«
Der junge Doktor zuckte die Achseln. »Man weiß nichts Gewisses —«
»Aber das Lied von vorhin? ›Daß heimlich du in Treuen mein‹— ist das nicht verdächtig?«
»Lieber Freund, Sie sind zu neugierig! Fragen Sie sie doch selbst!« Der Assessor lachte, und drehte seinen hübschen blonden Schnurrbart.
»Guter Rat, Doktorchen, wollen sehen, was sich tun läßt!« Damit schüttelte er dem Doktor die Hand und mischte sich unter das junge Volk, das sich eben zur Quadrille ordnete...
Am Eingange des Saales lehnte noch immer ein spät gekommener Gast des Hauses, der Privatdozent Dr. Heinz Sucher, der sich erst vor kurzem an der hiesigen Universität habilitiert hatte und von dem Hausherrn als Sohn seines verstorbenen Studienfreundes heute zum erstenmale hier zu Gast geladen war.
Dieser Abend wurde sein Schicksal — das fühlte er.
Der scharfsinnige Gelehrte, der kritischprüfende Chemiker in ihm war verstummt; sein Herz, sein dreißigjähriges Herz pochte wie in seliger Sekundanerzeit, pochte die uralte Melodie: »Diese oder keine sonst auf Erden!«...
»Gnädige Frau, ich bitte um die Ehre, mich der jungen Künstlerin am Flügel vorzustellen —«
»Ach, so sind Sie doch noch gekommen, liebster Herr Doktor! Das ist recht — wir fürchteten schon, die Vorarbeiten zum Chemiker-Kongreß würden Sie abhalten. — Gern mach' ich Sie mit unserer Elisabeth bekannt! Kommen Sie — «
Die beiden jungen Menschenkinder standen einander gegenüber, Auge in Auge —
»Liebe Elisabeth, ein Fachgenosse deines Vaters möchte deine Bekanntschaft machen — Herr Privatdozent Dr. Sucher — Fräulein Elisabeth Linden. — Mit unserer lieben Hausnachtigall können Sie sich ein wenig anregender unterhalten als mit unseren übrigen jungen Damen von heute; Elisabeth ist ihres Vaters rechte Hand — auch bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten —«
»Liebe Tante, — bitte —«
»Aber es ist doch wahr, Kindchen — und ich bin stolz auf dich.« Sie strich dem jungen Mädchen über die Wange. »Auf Wiedersehen also. —« Freundlich den beiden zunickend, entfernte sie sich...
Und am Webstuhl der Zeit saß wieder einmal Amor und spann aus heiterem Geplauder und sonnigen Blicken, aus gesprochenen und geschwiegenen Fragen sein Zaubernetz um die Herzen zweier Menschen. —
Der ChemikerKongreß hatte alles verschuldet. — —
Nach jener ersten Begegnung mit Elisabeth hatte Heinz Sucher öfter Veranlassung gefunden, sich der Geliebten zu nähern. Dazu hatte ihn der bevorstehende Kongreß deutscher Chemiker auch mit dem etwas griesgrämigen Vater Elisabeths zusammengeführt, sodaß Heinz für die Zukunft und das Schicksal seiner Liebe die frohesten Hoffnungen hegte...
Wenige Tage vor der Eröffnung des Kongresses hatte der junge Gelehrte auf einem Spaziergange im nahe gelegenen Stadtpark Elisabeth mit einer Freundin rein zufällig getroffen.
»Darf ich Sie mit meiner Freundin bekannt machen, Herr Doktor? — »Herr Dr. Sucher — Fräulein Anny Pohl!«
»Sehr angenehm. — Vielleicht gestatten die Damen, daß ich mich Ihnen ein wenig anschließe?«
»Aber gern —« und die drei schritten durch die hohen Laubengänge des Parkes, die im zarten Blätterschmuck des ersten Frühlings prangten. Das Gespräch kam nach den ersten einleitenden Wendungen bald auf interessante Gebiete wissenschaftlicher Natur, um so mehr, als sich Anny Pohl dem Studium der Orthopädie und der Heilgymnastik gewidmet und eben Gelegenheit gehabt hatte, eine neue Form elektrischer Vibrationsmassage bei einer Patientin auf ihren Wert prüfen zu können. — So wandelten sie dahin unter den hohen Bäumen des Waldes, und über ihnen in dem jungen Laube jubilierte und klagte und lockte es und zu ihren Füßen blühte und duftete es von verschwiegener Liebe!
Nur manchmal, mitten im ernsthaften Fachgespräch, wenn Heinz im Vorwärtsschreiten wie zufällig Elisabeths Hand streifte, wachte aus alter wissenschaftlicher Verhüllung der Mensch in ihm auf; sein Herz pochte schneller, und auch Elisabeth sprach eifriger...
Und nun waren sie an einer sehr dichten, lauschigen Stelle des Parkes angelangt. Weich schritt der Fuß dahin auf dem lebendigen Teppich des Mooses —
»Wie schön ist es hier! —«, sagte auf einmal Elisabeth, mitten in eine lange Rede unseres Heinz hinein und ihm den Denkfaden plötzlich entzwei schneidend —
»Köstlich — und so lauschig und einsam!«
»Wie in einer anderen Welt —«, sagte Elisabeth leise.
»Und hier —« damit sprang Anny an ein Plätzchen, über dem das Laubdach der Zweige nicht so dicht war, und auf dem goldig die Sonnenstrahlen spielten — »hier, ach, die ersten Veilchen! Sieh einmal, Elisabeth! —«
Und Elisabeth eilte hinzu und bückte sich hernieder und pflückte — und der Privatdozent Dr. Heinz Sucher bückte sich auch und pflückte auch.
Zwei lachende und fröhliche Kinder...
Am Abend dieses schönen Tages sandte Heinz der Geliebten ein paar Verse, wie sie ihm das heutige Erlebnis eingegeben hatte. —
»Ich möchte dich finden auf einsamen Pfaden,
Wo die lauten Stimmen des Tages verweh'n,
Wo verschwiegenes Moos zur Ruhe will laden,
Wo des Waldes Bäume am dichtesten steh'n!
Da möcht' ich dich finden, wo nickend grüßen
Süßduftende Blumen die Schwester schön —
Da möcht' ich dir leise sinken zu Füßen
Mit heimlicher Frage, mit schüchternem Fleh'n...
Und gehst du vorüber im bitterem Schweigen,
Dann wird es Winter und Nacht bricht herein;
Doch hebst du mich auf im zärtlichen Reigen:
Dann halt' ich den Lenz und den Sonnenschein! —«
Zwei Tage darauf begann der Kongreß deutscher Chemiker.
Unter den vielen hochinteressanten Punkten der Tagesordnung war auch die Streitfrage: Welche Stellung im periodischen System der Elemente nehmen die Elemente der Gadolinitgruppe ein?
Bekanntlich hat der russische Forscher Mendelejeff die chemischen Grundstoffe nach ihrem steigenden Atomgewicht und ihrer gegenseitigen Verwandtschaft in ein bestimmtes System gebracht, das zwar noch manche Lücken aufweist, für die Entdeckung neuer Elemente aber schon öfter von großer Wichtigkeit gewesen ist, indem man an der Hand des Systems eigentlich schon über die Eigenschaften eines Urstoffes Voraussagungen machen konnte, noch ehe er selbst entdeckt und rein dargestellt worden war.
Über die Stellung des einen oder andern Elementes, namentlich, wenn es ungeheuer selten ist, existieren natürlich verschiedene Meinungen. Zu diesen »problematischen« Existenzen gehören auch die Metalle des Gadolinits, eines norwegischen Minerals, das neben dem Monazit und Thorit seit der Erfindung der Auer'schen Glühstrümpfe als Ausgangsmaterial für das dabei zur Verwendung kommende Thoriurnoxyd eine praktische Bedeutung erlangt hat.
Im Gadolinit Norwegens also finden sich außer dem Thor und Cer, den beiden Metallen der Glühstrumpftechnik, noch äußerst geringfügige Mengen von vier Stoffen, die man als Gadolinium, Terbium, Erbium und Thulium oder mit ihren chemischen Zeichen als Gd, Th, Er und Tu bezeichnet hat.
Es war nun in Fachkreisen die Frage aufgeworfen worden, ob die schon seit einer Reihe von Jahren vorliegende Analyse des Gadolinits heute noch stichhaltig sei, und ob bei der Bestimmung und Gruppierung dieser vier Elemente kein Irrtum vorliege, der bei den winzig kleinen Mengen dieser Grundstoffe, die den früheren Forschern zur Verfügung gestanden hatten, immerhin möglich schien.
Vor allem war es Professor Linden, der mit äußerst scharfen Gegenbeweisen namentlich die Stellung des letzten der vier Elemente, des Thuliums, als unhaltbar nachwies, ja, zum Schlusse seiner geistvollen Ausführungen sogar die Behauptung aufstellte, das Thulium sei gar kein einfacher Körper, sondern eine Verbindung von zwei Elementen, dem Thulium mit dem Atomgewicht von 167,9 und dem Element X mit dem Atomgewicht 170,9. — Es war unserem Heinz ungeheuer schmerzlich, im Dienste seiner Wissenschaft gegen den Vater seiner Elisabeth auftreten zu müssen; aber er hatte in seiner früheren Stellung am Staatslaboratorium zu Hamburg Gelegenheit gehabt, größere Mengen des fraglichen Gadolinits analysieren zu können und war zur Überzeugung gelangt, daß die Bestimmung gerade des Thuliums sehr genau feststehe.
Eine heftige, wenn auch sehr interessante Debatte entspann sich — der größte Teil der anwesenden Chemiker stellte sich dabei auf Doktor Suchers Seite. Professor Linden verließ schließlich die Sitzung, nachdem er noch in einem Schlußwort seinen Gegnern das Wort zugerufen:
»Das Morgen ist der Feind vom Heute!«
Seit jenem Tage mied Elisabeth den Freund...
Heinz hatte anfangs versucht, brieflich die Geliebte von der Notwendigkeit seiner Stellungnahme gegen den Vater zu überzeugen, hatte sie um eine Unterredung gebeten, hatte sie angefleht, in ihrer Liebe gegen den Vater nicht ungerecht gegen den Freund zu sein — alles vergebens.
Da hatte auch e r seinen Stolz aufgerufen und männlich all seine Hoffnungen und Träume begraben.
So vergingen die Wochen des Frühjahrs — der Beruf des Privatdozenten und mehrere Arbeiten fachwissenschaftlicher Art halfen dem Enttäuschten über die schwere Zeit hinweg.
In der ersten Woche des August begannen die Universitätsferien, und Heinz eilte nach Hamburg, um mit seinem früheren Fachkollegen und Freunde, dem etwas älteren Professor Hintze, eine Reise nach dem Nordkap zu unternehmen.
Als er mit dem Freunde den Dampfer der Reisegesellschaft betrat, fiel sein Blick auf zwei junge Damen, die am Stern des Vorderdecks standen und mit Ferngläsern den malerisch bunten Verkehr im Hafen betrachteten.
Heinz' Fuß stockte — er hielt den Freund zurück und sagte rauh: »Am liebsten kehrt' ich wieder um!«
Professor Hintze sah erschrocken dem Freunde ins Gesicht. »Ich bitte, Sie, weshalb?«
»Ich sehe da eben auf dem Vorderdeck des Dampfers ein paar Bekannte, denen ich am liebsten aus dem Wege ginge, und das geht auf einem Dampfer nicht gerade leicht, wo man tagelang auf dieselbe Gesellschaft angewiesen ist!«
Kollege Hintze folgte der Richtung seiner Blicke mit den Augen — »da vorn, die beiden?«
»Ja doch — kommen Sie! Jacta est alea!«
Und nun mischten sie sich unter die Passagiere des Dampfers, der eben mit einem letzten Signal seine Abfahrt nach Norwegen, dem Lande der Mitternachtssonne, verkündigte.
Heinz bekundete in den nächsten Stunden der Fahrt ein überaus großes Interesse an den inneren Einrichtungen des Schnelldampfers. Er mied das Verdeck mit seiner Promenade, sehr zur Verwunderung seines Kollegen.
Als es etwas leerer oben geworden war, mußte er schließlich doch dem Drängen seines Freundes nachgeben, und die beiden Freunde schritten zusammen über das Verdeck nach dem Vorderteil des Schiffes...
Und da stand sie, die Einzige, und ihr Blondhaar schimmerte im Strahl der Abendsonne wie gesponnenes Gold —
Heinz schritt auf sie zu und grüßte mit tiefer Verbeugung.
Sie erwiderte den Gruß, höflich — wie man Fremde grüßt.
Er stellte seinen Freund vor — man begann von gleichgültigen Dingen zu reden. Später gesellte sich auch Anny zur Freundin, und die herzliche Form, in der sie den Bekannten aus der Heimat begrüßte, tat Heinz sichtlich wohl und brachte auch in das allgemeine Gespräch der andern eine wärmere Tonart...
Am Morgen des dritten Tages legte der Dampfer am Eingange eines tief einschneidenden Fjords an. Die Reisegesellschaft wollte von hier aus mit einem kleinen Fjorddampfer tief hinein in die zerklüfteten Einschnitte der Küste fahren; dann sollte im Innern des Fjords gelandet, ein daselbst liegendes Bergwerk besucht und hierauf eine Wagenpartie nach mehreren malerisch gelegenen Punkten der Umgebung gemacht werden. — —
Schon am Tage vorher hatte Heinz bemerkt, daß Elisabeth mit ihrer Freundin bald der Mittelpunkt des Interesses für die anwesenden Herren der Gesellschaft wurde. Namentlich erschöpfte sich ein junger Hamburger, der Sohn eines reichen Großkaufmanns, in Aufmerksamkeit gegen sie, ein frischer, immer heiterer, liebenswürdiger Schwerenöter —
Pfeilschnell schoß der kleine Dampfer zwischen den zerbröckelten Felsen der Einfahrt hindurch, unter den himmelhohen, überhängenden Felswänden hinweg, mit zierlicher Wendung all den launischen Windungen und Krümmungen der Bucht folgend.
Man hatte das Innere des Fjords erreicht; die Schraube des Dampfers drehte sich langsamer, jetzt gab der Maschinist Contredampf — der Dampfer legte an, und die Gesellschaft schickte sich an, auszusteigen.
Es war wohl nur zufällig, daß Elisabeth an der Seite des jungen Hamburgers ans Land schritt — aber Heinz gab es doch einen Stich ins Herz.
Anny empfand, was in seiner Seele vorging; sie nahm beim Aussteigen seine Hand und drückte sie lange und herzlich...
Dicht am Fjord lag das Bergwerk. Lachend und plaudernd zwängte man sich durch den schmalen Einfahrtsstollen.
»Sagen Sie, Herr Pfadfinder«, wandte sich der junge Kaufmann an den Führer der Reisegesellschaft, »was wird hier für ein kostbares Mineral gefunden?«
»Monazit und Thorit«, antwortete dieser, die ulkige Titelatur seiner Person mit einem Lächeln quittierend — »zwei seltene Erden, die für die Einführung des Auer'schen Gasglühlichtes von hoher Bedeutung geworden sind. Das Material enthält die beiden Grundstoffe, aus denen das Aschengewebe der Glühstrümpfe besteht, Thor und Cer . Die fein gemahlenen Rohstoffe, wie sie hier gebrochen werden, werden mit Schwefelsäure nach einem besonderen Verfahren behandelt, zur Trockne calciniert, in kleinen Portionen in Eiswasser eingetragen, durch Natriumverbindungen ausgefällt, das so entstandene Thorhydroxyd wird in kalte Salpetersäure eingetragen und bildet als Thor resp. Cernitrat das Salz, mit dessen Lösung die bekannten Baumwollgewebe der Auer'schen Erfindung getränkt werden, die nach ihrer Veraschung als sogenannte ›Glühstrümpfe‹ in den Handel kommen.«
»Danke verbindlichst, Herr Geheimrat«, sagte der Hamburger mit übertriebener Höflichkeit — habe alles verstanden!«
Die Umstehenden lachten, auch über Elisabeths Antlitz ging ein Lächeln. Im Innern des Schachtes war eine kleine Bohrmaschine an der Arbeit. Ein Bohrloch für eine Sprengung war schon fertiggestellt; ein zweites, im Winkel zum ersten, wurde eben begonnen.
»Also, meine hochverehrten Herrschaften, hier bohrt man die Löcher für die Auerstrümpfe«, witzelte Elisabeths Begleiter, und die Gesellschaft belohnte auch diesen faden Scherz mit dankbarem Gelächter. —
Die Beleuchtung mit künstlichem Licht ließ alle Teile der Anlage genau erkennen, und die Besucher zerstreuten sich, bald hier, bald da neugierig stehen bleibend...
Auf dem Felsboden, gerade unter dem ersten Bohrloch, lag die von dem Bohrer herausbeförderte Substanz, ein feiner weißer Staub von der Leichtigkeit des Pudermehls.
Heinz hatte eine Probe davon aufgenommen und ließ es durch die Finger gleiten.
Auch der junge Hamburger trat hinzu und nahm eine Handvoll —
»Sehen Sie, gnädiges Fräulein, der feinste Reispuder, den man sich nur wünschen kann — gestatten Gnädigste, daß ich Ihr schönes Haar ein wenig pudere —«
Und übermütig stäubte er Elisabeth, die den Hut hier unten in der angenehmen Kühle abgelegt hatte, den feinen Mineralstaub auf den blonden Scheitel...
Heinz stand wortlos daneben — und stand noch, als der größte Teil der Besucher wieder ans Tageslicht gestiegen war.
Professor Hintze nahm seinen Arm. — »Kommen Sie, lieber Freund, machen Sie ein heiteres Gesicht! Die plumpen Späße des jungen Mannes können einem allerdings auf die Nerven fallen. —«
Als die Letzten verließen Professor Hintze und Heinz Sucher das Bergwerk.
»Wir hätten doch eine oder einige Proben des Gesteins mitnehmen sollen —«, sagte der Professor nach einer Weile, als schon die Wagen in Sicht kamen, welche die Reisegesellschaft weiter befördern sollten.
»Ich bedaure es jetzt auch«, sagte Heinz, »ich vermute gerade hier Gadolinitvorkommnisse und hätte gerne ein paar neue Untersuchungen angestellt!«
»Kann mir's denken, daß Sie die alte Streitfrage des Kongresses nicht recht zur Ruhe kommen läßt. — Aber kommen Sie, sonst bekommen mir beide überhaupt keinen Platz im Wagen mehr! —«
Lustig lachend und scherzend war man auf den sommerlichschönen Matten der Bergabhänge herumgewandelt, lustig lachend und scherzend kehrte man heim. Es dunkelte, als die Gesellschaft die letzte halbe Stunde bis zum Wirtshause, wo man Nachtquartier zu nehmen gedachte, zurücklegte.
Heinz hatte immer noch gehofft, das leidige Mißverständnis zwischen Elisabeth und ihm durch eine offene Aussprache beseitigen zu können und hatte auch ihre Freundin Anny um ihre Meinung gebeten.
Anny wußte eigentlich nicht mehr als er selbst — daß Elisabeths Vater, tief verstimmt über Heinz' Parteinahme gegen ihn, seiner Tochter in heftigen Ausdrücken jeden Verkehr mit dem jungen Gelehrten untersagt habe; daß zwar Elisabeth ein viel zu selbstständiges Mädchen sei, um sich von ihrem sehr eigenwilligen Vater Vorschriften über ihr Tun und Lassen machen zu lassen — daß sie aber vielleicht den Konflikt zwischen sich und dem über alles geliebten Vater scheue und darum so handle, wie sie jetzt tue. —
Heinz mußte sich sagen, daß Elisabeths Benehmen gegen ihn nirgends die Linie höflicher Korrektheit verlassen habe; sie war auch heute beim Ausflug ein Weilchen neben ihm hergegangen, höflich und korrekt hatte er sich nach ihrem und des Vaters Befinden erkundigt, höflich und korrekt war die Antwort gewesen — und doch!...
Die Erinnerung an jenen Spaziergang im Stadtwäldchen stieg greifbar deutlich in ihm auf, als sie heute so an seiner Seite schritt: sie hatte den breitkrempigen Sommerhut in der Hand, und die Sonne küßte ihre irdische Schwester und übergoß das schöne Menschenkind mit ihrem schimmernden Zauber —
Was hätte Heinz darum gegeben, die Tage von einst mit ihren Hoffnungen und Träumen unter dieser reinen Mädchenstirn wieder lebendig machen zu dürfen! — Aber sie wich jeder Anknüpfung an das Vergangene mit einer freundlichen Gleichgültigkeit aus.
Und doch —— wie liebte er sie! Wie gern hätte er sie sein Eigen genannt für alle Zeit!...
Der letzte Teil des Heimweges führte unter dichtbelaubten Bäumen dahin, deren weitauslangende Äste tief über den Weg hingen
Es war nun ganz dunkel geworden.
Elisabeth schritt mit Anny an der einen, dem unzertrennlichen Hamburger an der anderen Seite; hinter ihnen gingen Professor Hintze und Heinz.
Da — ein Aufschrei Elisabeths!
Ein besonders tief herabhängender Zweig hatte ihr den Hut vom Kopfe gestreift.
Anny und der dienstbereite junge Kaufmann griffen rasch zu und hatten dem Zweige seinen Raub schnell wieder abgenommen — —
Heinz stand, wie gebannt, und deutete mit der Hand auf Elisabeths Haar —
Professor Hintze sah nun auch, was der Freund meinte. Das Haar des jungen Mädchens, namentlich der Scheitel, war von Milliarden leuchtender Punkte besäet.
Ehe die beiden noch ein Wort zu äußern vermochten, hatte Elisabeth ihren Hut wieder aufgesetzt, wobei der Hamburger mit einem Wachsstreichholz und einem Taschenspiegel Toilettendienste leistete... .
Am andern Morgen brach die Gesellschaft wieder auf — ohne unsern Heinz. Während der schlaflos verbrachten Nacht war er zu einem Entschluß gekommen, mit dem er seinen Freund morgens überraschte.
»Sie wollen hier bleiben, Heinz? Aber welche Gründe können einen solchen Entschluß —«
»Lieber, teurer Freund, ich bin Ihnen zunächst einige Aufklärungen schuldig, wenn Sie nicht selbst die betreffenden Umstände erraten haben. — Fräulein Linden ist nicht nur die Tochter unseres Fachkollegen Linden, sie war auch das Ziel meiner Sehnsucht —«
»Und ist es noch, lieber Heinz, nicht wahr?« Professor Hintze legte dem jungen Manne vertraulich die Hand auf die Schulter.
»Ja — wie könnt' ich es leugnen, was mich so namenlos elend macht, seit ich weiß, daß die junge Dame meine Bewerbungen zurückweist! —«
»Aber wie erklären Sie sich den plötzlichen Umschwung ihrer Gefühle?«
»Sie hat einen sehr eigensinnigen Vater, der mir wahrscheinlich heute noch nachträgt, daß ich damals seine Hypothese über die Gadolinitmetalle und besonders über das Thulium nicht acceptiert habe —«
»Und hoffen Sie nicht mehr, das junge Mädchen umzustimmen? Fräulein Linden scheint doch sonst sehr selbständiger Natur zu sein.«
»Ich hoffe es nicht mehr — seit gestern!«
»Aus den Augen — aus dem Sinn! Wollen Sie dem ewig liebenswürdigen Hamburger Kaufmann das Terrain ganz allein überlassen, Heinz?«
»Ich bin es meiner Herzensruhe schuldig; ich vermag dies Getändel nicht mehr mitanzusehen!«
»Ich glaube es Ihnen, liebster Freund! Aber ich — was soll ich nun anfangen, ohne Sie?«
»Sie führen Ihr Reiseprogramm planmäßig zu Ende, lieber, verehrter Kollege, ich bitte Sie darum! Ich möchte nur noch von Ihrer Freundschaft für mich die Zusage Ihrerseits haben, ein wenig die beiden jungen Damen im Auge zu behalten, vor allzugroßer Zudringlichkeit zu schützen —«
»Lieber Heinz, wer sich selbst nicht zu schützen weiß —«
»Freilich, freilich! Aber es können doch Momente kommen wo ein Manneswort entschiedener klingt —«
»Da haben S i e wieder recht, lieber Freund! Na, ich will sehen, was sich tun läßt; das verspreche ich Ihnen«
»Ich danke Ihnen von Herzen, Herr Professor! — Ich möchte Ihnen noch sagen, daß ich die so für mich gewonnene Zeit benutzen werde, hier in der nächsten Nähe des gestern besichtigten Bergwerks eine Wohnung zu mieten, um Untersuchungen über das hier gefundene Gestein anzustellen. Ich habe schon brieflich Schulte in Hamburg beauftragt, mir eiligst die allernötigsten Apparate und Chemikalien für diesen Zweck zu senden. In zwei Tagen können die Sachen hier sein. Bis dahin verschaffe ich mir einen größeren Vorrat des gestrigen Materials, namentlich des eigentümlichen Gesteinsmehles, das ich gestern an dem einen Bohrloch bemerkte —«
»Des Reispuders, um mit dem kalauernden Hamburger zu reden —«
»Ich habe auch eine Erklärung für das Leuchtphänomen von gestern Abend, lieber Herr Professor — Sie erinnern sich doch?«
»So, — haben Sie — und darf ich wissen? —«
»Beim Besuch des Bergwerkes streute, wie Sie vielleicht auch bemerkt haben werden, der — Begleiter von Fräulein Linden ihr den Mineralstaub als Puder ins Haar —«
»Richtig, das habe ich gesehen — aber wie wollen Sie daraus einen Zusammenhang mit dem Leuchten am Abend konstruieren?«
»Sie kennen ja, so gut wie ich, die Phosphorescenz der Sulfide des Calciums, Baryums und Strontiums nach vorhergehender Belichtung —«
»Die Balmin'schen Leuchtfarben — selbstverständlich! Ach — wahrhaftig, Heinz, die Sache ist mir jetzt auch klar: während des nachfolgenden. Spaziergangs hat die Dame gewiß ab und zu den Hut abgelegt — die Sonne hat den noch im Haar haftenden Mineralstaub chemisch beeinflußt — und die Folge davon war die Luminescenz im Dunkel der Sommernacht! Heinz — Sie haben wieder einmal richtig kombiniert, bravo!«
Herzlich erfreut schüttelte Professor Hintze seinem jungen Kollegen die Hand.
»Natürlich ist der Vergleich mit der Balmin'schen Leuchtfarbe nur rein äußerlich«, setzte Heinz hinzu — »wir haben es hier entschieden mit keinem Sulfid zu tun, auch war der Glanz der kleinen Lichtpünktchen, so viel ich in den wenigen Augenblicken bemerken konnte, ungeheuer intensiv, als ob es winzige, mikroskopisch kleine Sonnen wären —«
»Wäre nicht ein Selbstleuchten der fraglichen Substanz denkbar, ohne notwendige vorherige Bestrahlung?«
»Sie meinen eine Radioaktivität, wie beim Radium und Polonium? Auch daran habe ich gedacht, Herr Professor — aber daß sich diese radioaktive Substanz hier in Norwegen in solchen Mengen finden sollte, die in der Pechblende von Joachimsthal so spärlich vorhanden ist, daß zu einem Milligramm strahlender Substanz eine Wagenladung von zwanzig Zentnern Erz erforderlich ist, ist kaum anzunehmen, nicht wahr?«
»Kaum, lieber Heinz! — Aber wir hätten eigentlich Fräulein Linden gestern Abend bitten sollen, uns im Interesse der Wissenschaft eine Untersuchung ihres phosphoreszierenden Haares zu gestatten, meinen Sie nicht, lieber Freund?«
»Ich hatte die Bitte an Elisabeth — an die Dame auf den Lippen — aber ich schwieg — ich —«
»Ja, lieber Heinz, ich verstehe, — die Dame war während des ganzen gestrigen Ausflugs sehr kühl gegen Sie. — So bleiben Sie hier; ich weiß, daß die nächsten Wochen mit ihrer Arbeit Sie auch über diesen Schmerz hinwegbringen werden. — Gott gebe Ihnen ein frohes Gelingen bei Ihrem Werke, mein teurer Freund! Sie verdienen es wahrlich, bald einmal eine recht große Freude zu erfahren. — Vielleicht mache ich nach einigen Tagen noch einmal einen Abstecher und komme auf ein paar Stunden hierher zu Ihnen zurück! Und nun leben Sie wohl — meine herzlichsten Wünsche für Ihre Arbeit — und auf gesundes Wiedersehen!« — —
Als letzter bestieg Professor Hintze den kleinen Fjorddampfer, der die Gesellschaft wieder hinaustragen sollte zu dem großen Schnelldampfer draußen auf dem Ocean...
Heinz aber stieg hinab ins Bergwerk, um seine Forschungen über das eigenartige Gesteinsmehl von gestern mit dem Rüstzeug der Wissenschaft zu beginnen. —
Die Verwaltung des Monazitbruchs war entgegenkommender, als Dr. Sucher gehofft, nachdem er ihr über seine Person und seinen Plan Mitteilung gemacht hatte.
Zunächst suchte er sich eine größere Quantität des fraglichen Gesteinsmehls zu verschaffen. Merkwürdigerweise fand es sich nur in der Nähe des einen Bohrlochs, und alle Bohrungen an anderer Stelle blieben erfolglos. So mußte Heinz vorläufig mit dem immerhin spärlichen Material, das noch von der ersten Bohrung vorhanden war, seine Analysen beginnen.
Nach einigen Tagen glich das Zimmer, das er von einem norwegischen Bauern gemietet, der dicht am Eingangsstollen des Bruches sein Hüttchen hatte, einem Laboratorium.
Die Analyse des weißen Pulvers ergab als Hauptbestandteil einen — Gadolinit von seltener Güte und in ihm die bekannten Elemente Gadolinium, Terbium, Erbium und Thulium. Aber, und das war für Heinz eine gewaltige Überraschung! — gerade das Thulium zeigte bei den Reaktionen, die er nach seinen früheren Erfahrungen im Hamburger Staatslaboratorium anstellte, ein Verhalten, das zweifellos auf einen mit ihm verbundenen n e u e n Stoff schließen ließ...
Fieberhaft arbeitete der junge Chemiker — sehr zur Verwunderung seines treuherzigen Wirtes, der aus dem wunderlichen Gaste und seinen seltsamen Gläsern und Apparaten nicht klug zu werden vermochte.
Das Endresultat der tagelangen angestrengten Arbeiten enthielt das Telegramm, das er eines Abends an — Professor Linden richtete:
NEUE ANALYSE DES THULIUMS, VORGENOMMEN AN GRÖßEREM QUANTUM GADOLINIT, ERGAB AUßER DEM ELEMENT THULIUM NOCH EINEN ZWEITEN STOFF, DEN ICH WEGEN SEINER EIGENSCHAFTEN APOLLONIUM NENNE; ZEICHEN AP, ATOMGEWICHT SCHWERER ALS 170. BEEILE MICH, DEN DAMALS IN GUTEM GLAUBEN BEHAUPTETEN IRRTUM NACH BESSERER ÜBERZEUGUNG ABZULEGEN. MIT KOLLEGIALEM GRUßE.
DR. HEINZ SUCHER.
Heinz hatte den im Gadolinit entdeckten fünften Stoff Apollonium genannt. Aus welchem Grunde?
Als es ihm gelungen war, aus dem Thulium den von Professor Linden in seinen Ausführungen auf dem ChemikerKongreß behaupteten neuen Stoff abzuscheiden, hatte er die diesem Elemente eigene Fähigkeit des Nachleuchtens wieder bemerkt, die er schon bei dem Ausgangsmaterial, dem öfter erwähnten Steinmehl, zuerst in Elisabeths Haar, beobachtet hatte.
Kleinere Proben des pulverisierten Gadolinits der Sonne ausgesetzt, zeigten sich in der Dunkelheit mit leuchtenden Punkten besäet — als er aber ein kleines Quantum, wenige Milligramm, des neuen Elementes daraus hergestellt hatte und dem Sonnenschein aussetzte, da strahlte es in der Nacht ein Licht aus, das dem Sonnenlichte an Glanz nahekam.
Die während der Mittagsstunden stattfindende Belichtung des Stoffes reichte hin, ihn vom Eintritt der Dunkelheit bis zum anderen Morgen selbstleuchtend zu machen, selbstleuchtend von einer Helligkeit, daß das kleine Laboratorium mitten in finsterer Nacht wie von mildem Tageslicht durchflutet schien...
Das köstliche Gefühl eines auf dem Felde der Wissenschaft glücklich errungenen Sieges erfüllte Heinz, als er spät in der Nacht sein Lager aufsuchte — — und heute, zum ersten Male nach vielen Tagen, trat das süße Bild der Geliebten wieder vor seine Seele, und er konnte heute ohne Groll an die Verlorene denken. — Das Schicksal nimmt mit einer Hand, um mit der andern zu geben: Elisabeth hatte das Geschick ihm versagt, aber ihm dafür eine Entdeckung in den Schoß geworfen, die für die Menschheit von unendlichem Segen sein mußte.
Das Problem ungezählter Jahrtausende, die Aufspeicherung des Sonnenlichtes auf direktem Wege, der Ersatz aller künstlichen Lichtquellen durch das Licht der Sonne selbst, das von den Atomen des neuen Elementes Apollonium aufgesogen, jederzeit von ihm wieder abgegeben werden konnte, schien gelöst! —
Traumlos glücklich schlummerte Heinz am andern Tage bis weit in den Vormittag hinein und wurde erst munter, als eine wohlbekannte männliche Stimme ihm »Guten Morgen!« bot —
Professor Hintze stand vor seinem Bett.
»Entschuldigen Sie, lieber Doktor, daß ich Sie gestört habe —«
»Ich bitte sie, bester Herr Professor, — Sie wissen, ich bin sonst wahrlich kein Langschläfer, aber, um mit Wallenstein zu reden, ›dieser letzten Tage Qual war groß‹ —«
»Und da haben Sie »einen langen Schlaf getan?«
»Freilich! Aber nun, um so kürzer soll meine Morgentoilette werden. Wenn ich Sie bitten darf, einen Augenblick mich zu entschuldigen — Sie finden in dem Zimmerchen nebenan mein Laboratorium —«
Der Professor Hintze begab sich aus dem Schlafkämmerchen ins anstoßende größere Zimmer.
Das Auge des Fachgenossen fand sich in dem Durcheinander von Apparaten bald zurecht — und ebenso entdeckte der Freund schließlich auch die auf einer Glasplatte ausgebreitete metallisch schimmernde Substanz, das Apollonium, das Dr. Sucher aus dem Gadolinitmehl abgeschieden hatte.
Heinz trat ins Zimmer, und nachdem er den Freund nochmals lächelnd begrüßt hatte, machte er ihn mit dem Gang seiner Untersuchungen bekannt.
Je weiter er kam, desto unruhiger ward der Professor, und als er ihm schließlich die Substanz zeigte, welche die wunderbare Eigenschaft des Leuchtens nach vorhergehender Besonnung annahm, sprang er auf und rief begeistert:
»Heinz, Glückskind — wissen Sie denn auch, was Sie damit gefunden haben? — Sie haben für uns Menschenkinder den Sonnenschein eingefangen, das Licht des Himmels an einen Stoff der Erde gefesselt —«
»Ich weiß es«, erwiderte Heinz einfach.
»Eine neue Ära künstlicher Beleuchtung wird durch diese Entdeckung ins Dasein treten. Auf allen Gebieten wird ihr Segen zu merken sein. Eins unserer größten wissenschaftlichen Probleme, die Aufspeicherung der SonnenEnergie, wenigstens soweit sie als Lichtemission auf unsere Erde gelangt, ist gelöst —«
»Wenn es gelingt, hinreichende Mengen des kostbaren Apolloninums — ich habe es nach dem Sonnengotte PhöbusApollon genannt — auf der Erde zu finden. Bis jetzt hat sich nur eine einzige Stelle des Bergwerks als ertragreich erwiesen. Alle anderen Bohrungen waren bis heute fruchtlos.«
»Wo sich etwas gefunden hat, wird sich im Laufe der Zeit mehr finden, glauben Sie mir. Noch immer hat die Geschichte der Technik bestätigt, daß mit dem Bedarf auch die Suche und mit der Suche auch das Auffinden seltener Stoffe wächst; ich erinnere Sie nur an das Thorium und Cerium der Auer'schen Erfindung, lieber Heinz —«
»Gewiß — und ich hoffe es ja auch zum Besten der Wissenschaft und der Menschheit. Zum Glück macht sich in dem vorhandenen Material das neue Element Apollonium nicht so selten als das aktive Radium und Polonium; aus einem Kilogramm des Rohmaterials habe ich doch einige Milligramm der Substanz gewinnen können.«
»Haben Sie eine Theorie, nach welcher Sie sich den Vorgang des Leuchtendwerdens beim Appollonium erklären?«
Heinz gab dem Freunde das auf der Glasplatte ausgebreitete Präparat und eine Lupe.
»Betrachten Sie einmal die Form des neuen Elementes!«
»Sechsseitige Plättchen, wie das Thormetall —«
»Ja, richtig!« Heinz sah nach seiner Uhr. »Jetzt haben wir ungefähr zehn Uhr vormittags; das Präparat hat bedeckt gestanden und nur erst wenig Sonnenlicht empfangen. Wir wollen es jetzt dem vollen Strahl der Sonne aussetzen — nur wenige Minuten!«
»So! —« Heinz stellte die Glasplatte schräg auf dem hellbeschienenen Fensterbrett auf. »Unterdessen erzählen Sie mir, wie Sie so schnell wieder hierhergekommen sind, lieber Herr Professor.«
»Sehr einfach — es existiert ja nach diesem Monazitbruch eine ganz famose Sekundärbahn, und da die Reisegesellschaft heute und morgen an demselben Orte bleibt, um die Umgebung abzugrasen, zog ich es vor, Sie hier zu überraschen, und wahrhaftig, Heinz, ich bereue es nicht.«
Er drückte ihm kräftig die Hand.
»Und — wie geht es Fräulein Linden, Herr Professor?«
»Lieber Heinz, offen gestanden, habe ich mich in all den Tagen seit unserer Trennung wenig um die Dame gekümmert. Ihre Begleiterin, Fräulein Pohl, fragte mich am ersten Tage unserer Weiterreise von hier, wo Sie geblieben seien, und hat Ihre Abwesenheit sehr bedauert. Im übrigen habe ich mich sehr neutral gehalten — der unverwüstliche Hamburger Witzbold ist mir ein Greuel, und leider ist Fräulein Linden fast immer in seiner Gesellschaft —«
»So glauben Sie, daß sie an dem faden Schwätzer Gefallen findet, Elisabeth, dieses geistig hervorragende, künstlerisch genial veranlagte Geschöpf?«
»Lieber Heinz, kostbare Steine brauchen eine goldene Fassung — ich will damit Ihre Angebetete durchaus keiner unedlen Gesinnung zeihen. Von dem Verehrer aber weiß ich, daß er die Frage einer Verbindung fürs Leben bereits ernstlich ins Auge faßt —«
Heinz sprang auf —
»Mit Elisabeth? —«
»Ja — hören Sie zu, bester Freund. Wenige Tage nach meiner Abreise von hier wußte es der junge Kaufmann so einzurichten, daß er für ein längeres Stück des Weges an meine Seite kam. Er war äußerst höflich und liebenswürdig, fragte nach meinen Befinden, spielte auf unseren gemeinsamen Wohnort Hamburg an, erkundigte sich, warum Sie sich so plötzlich von der Gesellschaft getrennt hätten — Fräulein Linden hat ihm offenbar von einer früheren Bekanntschaft mit Ihnen nichts verraten, dazu sprach er von Ihnen viel zu unbefangen und gleichgültig — und kam schließlich auch, auf dem Umwege über die Wissenschaft, auf den Vater der Dame zu sprechen. Er fragte, ob er mir persönlich bekannt sei, welche Stellung er im Reiche der Wissenschaft einnehme, welchen Charakter er habe, ob er wohl in eine Verbindung seiner Tochter mit einem Kaufmannshause Hamburgs willigen werde — Sie sehen, lieber Freund, die Sache wird ernst, und wenn Sie noch Absichten auf Fräulein Elisabeth haben —«
Heinz ging erregt in dem kleinen Raume auf und nieder. Er kämpfte sichtlich mit sich selbst — dann aber blieb er vor Professor Hintze stehen und sagte bewegt:
»Herr Professor, mein lieber treuer Freund, sagen Sie, bitte, Elisabeth, daß neue Untersuchungen mir es zur Pflicht gemacht hätten, dem Urteil ihres Vaters zuzustimmen, daß ich in diesem Sinne bereits vor einigen Tagen an ihn ein Telegramm abgesandt hätte — daß ich sie um Verzeihung bitte, wenn sie um meinetwillen böse Stunden und Tage bei ihren Vater daheim durchmachen mußte — und daß ich ihr von Herzen Glück wünsche für ihr ferneres Leben!«
Professor Hintze reichte ihm stumm die Hand...
»Und nun, Herr Professor, zurück zu unserm Apollonium! —«
Heinz nahm vom Fensterbrett die bisher hell vom Sonnenstrahl beleuchtete Glasplatte mit dem Präparat.
»Nehmen Sie, bitte, jetzt noch einmal die Lupe und untersuchen Sie!«
Einen Blick nur warf der Professor auf die Substanz —
»Die sechsseitigen Täfelchen sind ja fast verschwunden!", rief er höchst verwundert aus.
»Ja, lieber Herr Kollege, fast — und nach längerer Sonnenbestrahlung würden sie ganz verschwunden sein. An die Stelle der sechsseitigen Plättchen tritt durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen eine andere unregelmäßige Kristallform des Apolloniums —«
»Also eine allotrope Modifikation, wie wir sie beim Phosphor, beim Schwefel und manchen andern Stoffen der Chemie schon lange kennen —«
»Gewiß — und die Rückbildung dieser neuen Krystallform in die alte, ursprüngliche, hexagonale ist nach meiner Auffassung die Ursache des Leuchtens, wie man ja, wenn auch in unvergleichlich schwächerer Art, die unter Aufleuchten vor sich gehende Krystallisation der arsenigen Säure oder des Kaliumsulfats in der Chemie schon kennt.«
»Mit dem Unterschiede, daß bei den genannten Stoffen das Phänomen der l e u c h t e n d e n Krystallisation nur beim e r s t m a l i g e n Auskrystallisieren, dann nicht mehr stattfindet — Ihr neues Präparat aber sich doch immer wieder zu neuer Lichtemission regeneriert —«
»Wenigstens habe ich bis jetzt keine Abnahme der Absorption sowohl als der Emission des Sonnenlichtes bemerken können, obwohl die Substanz schon oft hintereinander belichtet und zur Lichtabgabe gezwungen wurde —«
»Eine herrliche, überwältigende Entdeckung, bester Heinz! Ich gratuliere Ihnen nochmals dazu von ganzem Herzen! —«
»Ich danke Ihnen! — Die nächste Frage wäre nun für mich die Heranschaffung einer reichlicheren Menge des Rohmaterials, um ein größeres Quantum Apollonium daraus rein darstellen und vergleichende photometrische Messungen mit andern künstlichen Lichtquellen daran vornehmen zu können. Ich möchte Ihnen noch gern die Leuchtkraft des neuen Stoffes zeigen, obwohl hier im Zimmer, — auch wenn ich die Fenster verhänge —, noch ziemlich viel Tageslicht herrscht. — Ich hab's! — Mein alter, biederer Hauswirt hat mir gleich am ersten Tage erzählt, er habe im Keller auch eine ganz finstere Kammer, in der schon im vorigen Jahr ein Photograph gearbeitet habe — kommen Sie, Herr Professor!«
Heinz nahm das Apolloniumpräparat und stieg mit seinem Freunde hinab in den kleinen Keller des Häuschens.
Und hier, eng aneinandergedrängt in dem kleinen, lichtlosen Verschlag, standen die beiden Gelehrten und sahen mit erstaunten Augen auf das taghell leuchtende, geheimnisvolle neue Element.
»Haben Sie schon das Spektrum des neuen Lichtes untersucht?«, fragte Professor Hintze nach einer langen Zeit stiller Bewunderung.
»Ich hätte es gern getan — besitze aber leider hier kein Spektroskop. Ich versuchte, mir aus Glasstückchen ein Wasserprisma herzurichten aber die Dispersion ist zu gering —«
»Und ich bin glücklich, Ihnen mit meinem Taschenspektroskop dienen zu können! Einen Augenblick, lieber Heinz!«
Damit tappte der Professor die dunkle Kellertreppe hinan und eilte in das Zimmer, wo er seine Handtasche abgelegt hatte.
In wenigen Sekunden war er wieder unten.
»Ich nahm das kleine Ding mit, um vielleicht den ›grünen Strahl‹, der ja beim SonnenUntergange auf dem Meere öfter sichtbar werden soll, spektroskopisch zu untersuchen — nun findet es hier eine bessere Verwendung. Da, nehmen Sie!«
Heinz brachte das kleine Instrument, ein Spektroskop mit gerader Durchsicht à la Browning vors Auge und richtete den Spalt auf die strahlende Platte.
»Das normale Sonnenspektrum!« — Damit reichte er dem Professor den Apparat.
»Wahrhaftig«, — rief dieser nun überrascht aus — »als ob man den Strahl eines Heliostaten auf das Spektroskop gelenkt hätte! Nur die Fraunhofer'schen Linien fehlen im Spektrum; aber das ist ja selbstverständlich.«
»Das meine ich auch«, sagte Heinz, »denn wir sehen ja nicht direktes oder gespiegeltes Sonnenlicht, sondern durch einen physikalischen Prozeß erzeugtes Licht, die von enormer Lichtentwicklung begleitete Rückbildung des Apolloniumkrystalls. Unerklärlich aber bleibt mir immer noch die Resonanz, mit der die Schwingungen der Atome und Moleküle des neuen Elementes in die Schwingungen des Sonnenlichtes einstimmen!«
»Ja — in der Tat, ein wunderbares Phänomen! Aber auch dafür wird die Zeit eine Erklärung bringen.«
Professor Hintze stand noch eine Weile in stiller Bewunderung vor der Entdeckung des Freundes — dann stiegen sie beide hinauf ins Laboratorium. Der Professor nahm seine Handtasche und reichte Dr. Sucher die Rechte.
»Ich bin glücklich, Heinz, daß ich den kleinen Abstecher hierher gemacht habe —«
»Und ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Anteilnahme, Herr Professor!«
»Im übrigen, lieber Freund — grämen Sie sich nicht zu sehr! Überlassen Sie es dem Schicksal, für Sie und — Fräulein Elisabeth die beste Entscheidung zu treffen. Ihren Auftrag richte ich gern aus!«
»Herzlichen Dank! Meinen Gruß, bitte, auch an Fräulein Pohl!«
»Auf Wiedersehen dann, lieber Doktor!«
»Auf frohes Wiedersehen, Herr Professor!«
Am andern Tage bohrte man im Bruch an einer Stelle, die dicht über dem Niveau des die äußere Felswand umflutenden Fjordwassers lag.
Und hier fand Heinz zum ersten Male wieder Spuren des gesuchten Gadolinits.
Ein noch tiefer unter den Wasserspiegel getriebenes Bohrloch lieferte einen noch reicherem Ertrag — und so schien es, als ob der Erlangung größerer Mengen des kostbaren Rohmaterials nichts mehr im Wege stände, wenn es gelang, von den neu zu errichtenden Schächten das Wasser abzuhalten.
Dies war nach der Aussage der Fachmänner nicht allzu schwierig. In einigen Tagen wollte man damit beginnen; bis dahin aber ließ die Verwaltung des Bruches an verschiedenen Stellen des Werkes Bohrungen vornehmen, teilweise hoch am Gipfel der Felswand, um durch Sprengungen größere Mengen Thorit und Monazit für die Glühstrumpfindustrie zu gewinnen.
Heinz hatte die durch die beiden neuen Bohrungen erhaltenen Vorräte inzwischen in gleicher Weise der chemischen Analyse unterworfen, wie die ersten, und seine Voraussetzungen bestätigt gefunden — auch diese Gadolinitproben enthielten die vermutete Menge Apollonium. Der Gesamtreichtum des jungen Forschers an Apollonium stieg dadurch wieder um einige Milligramm sodaß er eine größere Glasscheibe damit bedecken konnte, wodurch die Lichtabgabe mehr als verdreifacht wurde. —
Am Morgen des Tages, an dem die Sprengungen nach Thorit vorgenommen werden sollten, unternahm Heinz mit seinem Hauswirt einen Ausflug in die malerischen Täler und Schluchten seiner Umgebung, um seinen Nerven die sehr nötige Abwechselung und seinen Muskeln die eben so wohltätige Bewegung zu verschaffen.
Ein paar Dutzend Meilen weiter nördlich stiegen am Morgen desselben Tages die Mitglieder der uns bekannten Reisegesellschaft eine schön bewaldete Anhöhe hinan.
Professor Hintze hatte es so einzurichten gewußt, daß er neben Elisabeth Linden herschritt — Fräulein Anny hatte auf seine Bitte liebenswürdig, aber entschieden den Hamburger Kavalier mit Beschlag belegt und wußte bald durch ihre heitere, drollige Art den Ärger des jungen Mannes über seine jetzige Deplazierung zu verscheuchen.
»Wissen Sie etwas über das Element Thulium?«, fragte auf einmal unvermittelt nach den ersten formellen Redefloskeln Professor Hintze seine Begleiterin.
Elisabeth schrak leise zusammen, faßte sich aber schnell und sagte lächelnd:
»Sie meinen, die Tochter eines Chemikers müßte in dem Metier ihres Vaters auch Bescheid wissen, Herr Professor?«
»Im allgemeinen setze ich das nicht voraus, verehrtes Fräulein, aber bei Ihnen, weiß ich, darf man eine solche Frage wohl stellen — also, bitte.«
Mit einem freundlichschalkhaften Lächeln in den mit goldner Brille bewaffneten Augen sah er sie an.
»Das Thulium gehört zu einer nur wenig erforschten Gruppe von Elementen«, — begann nun Elisabeth, auf des Professors scherzhafte Art eingehend, »welche sich sämtlich in einer Gesteinsart, dem Gadolinit, wie er hier in Norwegen gebrochen wird, vorfinden.«
»Bravo, liebes Fräulein! Und wissen Sie auch, daß das Thulium gerade für Sie, als die Tochter Ihres Herrn Vaters, eine besondere Bedeutung hat?«
Elisabeth schloß einen Augenblick errötend die schönen Augen.
»Ich weiß, daß Papa mit seiner Anschauung über das seltene Element auf dem letzten Chemikertage alleinstand«, — sagte sie leise.
»Mein liebes, verehrtes Fräulein — legen wir beide die bisher vorgehaltenen Masken ab! Ich weiß, daß Sie meine scherzhafte Examenfrage über das Thulium tief ins Herz getroffen hat — ich weiß, daß dies unselige Element die äußerliche Veranlassung dazu gegeben hat, Sie und meinen jungen Freund Heinz Sucher zu entzweien —«
Elisabeth machte eine Bewegung —
»Ich weiß aus meines Freundes Munde, daß Sie zu groß denken, um meine Worte in Abrede zu stellen. Gestatten Sie mir darum, verehrtes Fräulein, Ihnen im Auftrage Dr. Suchers die Ergebnisse der neuesten Forschungen mitzuteilen, welche er seit Ihrer Trennung über das fragliche Element angestellt hat, und über die er Ihren Herrn Vater vor einigen Tagen telegraphisch berichtet hat. Die Hypothese Ihres Vaters ist von Heinz als eine Wahrheit festgestellt worden: Das Thulium ist kein einfaches Element, sondern enthält noch einen zweiten Grundstoff, den Ihr Herr Vater wegen seiner Unerforschtheit mit dem Zeichen X bezeichnete, der von Dr. Sucher rein dargestellt und wegen seiner wunderbaren Eigenschaften Apollonium, das ›Sonnenhafte‹ genannt worden ist!«
Elisabeth hatte in tiefer Erregung des Professors Hand erfaßt.
»Ist dies Wahrheit — oder träum' ich? O Gott! So hätte Papa keinen Grund mehr, mir zu zürnen wegen — wegen Heinz? — Papa ist herzensgut, aber in der Wissenschaft von einer Unduldsamkeit, daß ich seiner Gemütsruhe halber ihm jenes Versprechen geben mußte, Heinz zu meiden —«
»Aber nun — was werden Sie nun beginnen, seit Sie dies von mir erfahren haben?«
»Ich suche Heinz auf — ich bin es jetzt ihm schuldig. Mag man es unweiblich nennen, ich gehe zu ihm; ich werde Anny bitten, mich zu begleiten —«
»Das ist schön und groß gedacht, liebes Fräulein! Aber was wird Ihr getreuer Hamburger Verehrer sagen?«
»Sie haben ein Recht dazu, mich darüber zu tadeln, Herr Professor — aber ich habe ihn als Abwehr gegen Heinz gebraucht, um mich vor meinem eigenen Herzen schützen zu können, das den treuen Freund aus der Heimat nie vergessen konnte!«
»Aber macht sich der Herr nicht Hoffnungen auf Ihre Hand — und hat er nach Ihrem zwanglosen Benehmen gegen ihn während der ganzen Reise nicht ein Recht dazu?«
»Ich fürchte es auch, habe ihn aber mit keiner Silbe, keinem Blick dazu ermutigt. Ich habe öfter seine Anekdoten belacht — weil ich in meinem stillen Gram über mein Geschick nichts Besseres, Gleichgültigeres zu tun wußte, als unter soviel leichtlebigen, fröhlichen und heiteren Menschen es auch ein wenig zu sein.«
»Und meinen Sie nicht, daß das Benehmen Ihres Verehrers Heinz bitter weh getan hat, liebes Fräulein?«
»Heinz kannte mich besser; er weiß, daß ein solcher Mensch wie der oberflächliche junge Kaufherr mir nie gefährlich werden konnte — aber ich habe trotzdem ein gefährliches Spiel gespielt — und Heinz soll nicht lange mehr falsch von mir denken! — Haben Sie Dank, tausendfachen Dank, lieber, verehrter Herr Professor und leben Sie wohl — ich will Anny bitten, mitzukommen — er wohnt in der Nähe des Monazitbruchs — nicht wahr?«
»Ja, in einem Bauernhause rechts vom Einfahrtstollen —«
»Auf Wiedersehen denn, Herr Professor —«
»Ich komme mit; ich begleite Sie — ich muß doch Heinz fragen, ob ich seinen Auftrag richtig ausgeführt habe — vielleicht will er Sie gar nicht mehr, liebes Fräulein?«
»Vielleicht —« Sie sah mit glückstrahlenden Augen ins Weite. »Aber Bescheid muß ich ihm trotzdem sagen über all das Vergangene, Herr Professor —«
»Dann kommen Sie — und unterwegs erzähle ich Ihnen, welche wunderbare Entdeckung Heinz unterdessen gemacht hat bei der Suche nach dem unglückseligen Thulium.«
»Eine wunderbare Entdeckung? —«
»Ja — ja — kommen Sie nur: Er hat den Sonnenschein eingefangen! Hören Sie — hören Sie! —«
Und eifrig auf Elisabeth einredend, wandte sich Professor Hintze, um den Rückweg anzutreten.
Als der Zug am Spätnachmittag in die Station einfuhr, auf der die Sekundärbahn nach dem Monazitbruch ihren Anfang nahm, war die kleine Bahnhofsanlage von Menschen überfüllt, die alle irgend ein Vorkommnis zu diskutieren schienen. Ein Ausdruck großer Bestürzung lag auf den meisten Gesichtern.
Professor Hintze mit den beiden Damen entstieg dem Coupé des Eilzuges, um von hier die Reise nach dem Bergwerk fortzusetzen. Vorher aber nahm er Gelegenheit, den Vorsteher der Station, der zum Glück mehr Deutsch als er selbst Norwegisch verstand, über den Grund der Menschenansammlung zu fragen.
»Es ist im Monazitbruch heute Nachmittag ein Unglück passiert — wir wissen noch nichts Genaues. Durch häufige Sprengungen in der letzten Zeit scheint sich das Gefüge des Berges gelockert zu haben. Ein gewaltiger Bergrutsch hat stattgefunden, der größte Teil des Monazitwerkes und eine Anzahl Hütten am Fuße des Abhangs soll vernichtet worden sein —«
»Um Gotteswillen — meine Damen! —«
Ein Blick auf die neben ihm stehende Elisabeth verriet ihm, daß sie jedes Wort des Vorstehers verstanden hatte. Leichenblaß und zitternd stand sie — keines Wortes mächtig — endlich stieß sie hervor:
»Wann — wann geht der nächste Zug?«
»In fünf Minuten, gnädiges Fräulein.«
»Und wann können wir da sein?«
»In drei Stunden!«
»Drei Stunden — mein Gott — mein Gott!«
»Können wir nicht telephonisch oder telegraphisch Nachricht —«
»Die Verbindung mit dem Monazitwerk ist durch den Bergsturz leider gestört. Wir hätten sonst selbst nähere Auskunft eingezogen, mein Herr!«
»Kommen Sie, meine Damen, schnell!«
Er bot Elisabeth den Arm.
»Wenn ich zu spät käme — o barmherziger Gott! Wenn er nun verunglückt wäre, ach, bester Herr Professor —«
Sie schluchzte fassungslos. Vergebens suchte Anny die Freundin zur beruhigen...
Endlich — endlich fuhr der Zug ab. Man hatte verschiedene Wagen anhängen müssen, da all die Hunderte von Neugierigen oder Teilnehmenden mitfahren wollten.
Niemand von unsern drei Reisenden sprach ein Wort.
Nur Elisabeth weinte leise...
Ab und zu ein Pfiff der Lokomotive, ein kurzes Halten — und weiter rollte der Zug — immer weiter, dem dunklen Ziele entgegen.
Drei Stunden oder drei Jahre — — keiner von den Dreien hätte sagen können, wie lange die Fahrt eigentlich gedauert.
Es war schon am späten Abend, als der Zug in der Nähe des Monazitbruchs hielt. Bis heran an das Werk konnte nicht mehr gefahren werden.
Auf freier Strecke stieg man aus.
Getrieben von tödlicher Angst, stürzte Elisabeth, der die Verzweiflung Riesenkräfte verlieh, in der vom Professor bezeichneten Richtung vorwärts, sodaß die beiden andern kaum zu folgen vermochten...
Die Unglücksstätte war schwarz von Menschen. Einzelne Fackeln erleuchteten die grausige Scene.
Die gesamte Umgebung schien in wenigen Sekunden geändert — der Professor fand sich nicht mehr zurecht und fragte einen der Umstehenden, ob Leute im Werk verunglückt und ob das kleine Häuschen am Stolleneingang mit hinweggerissen worden sei.
»Alles liegt auf dem Grunde des Fjords; es sind hunderttausende von Kubikmetern Erde und Geröll herniedergegangen, die ganze vordere Spitze des Berges hat sich abgelöst —«
Ein trostloser Bescheid! Zum Glück hatten ihn die Damen nicht gehört.
Elisabeth war, wie von einer unsichtbaren Hand geführt, weiter geeilt, bis dicht an den Rand des Fjords.
Und hier — am dunkel flutenden Wasser — stand ein einsamer Mann und starrte hinein...
Ein Aufschrei, wie aus einer von Todesqualen erlösten Seele —
»Heinz!«
»Elisabeth! — Du hier an diesem Ort — zu dieser Stunde?«
Sie wäre hingesunken, wenn er sie nicht in seinen Armen aufgefangen hätte. Und nun liegt sie an seiner Brust, weinend vor namenlosen Glück und Weh.
»Du bist nicht verunglückt — mein Gott, wie danke ich dir! Wie bin ich glücklich — ach!«
Er küßte zärtlich ihre Augen.
»Gott hat mich sichtbar beschützt«, sagte er bewegt. »Während hier all das Fürchterliche geschah, war ich mit meinem Wirte, einem Bauern, unterwegs auf einem Ausfluge. —«
Sie hatte sich seiner Umarmung entwunden und stand nun vor ihm, Tränen in den schönen Augen, erglühend in holder Scham —
»Verzeihung, mein Freund! Das Unglück hat dir verraten, was tief in meinem Herzen bisher geruht hat, meine Liebe zu dir — verzeihe mir —«
»Was soll ich dir verzeihen, süßes Lieb — daß du mir mein Glück gebracht hast? — Mit meinem Leben will ich es dir danken!«
Sie hielten sich selig umschlungen, als Professor Hintze und Fräulein Anny hinzutraten.
»Heinz, mein teurer Freund!«
Er zog tief erschüttert den jungen Mann an seine Brust. Dann wandte er sich zu Elisabeth »Gott ist mit Ihnen gewesen!«
Sie reichte ihm glückselig lächelnd die Hand und umarmte die Freundin.
»Bester Herr Professor, da unten auf dem Grunde des Fjords liegt meine Entdeckung —«
»Lieber Heinz, ›kommt Zeit — kommt Rat!‹ Beklagen Sie sich nicht: Ihre Forschungen können Sie später gewiß wieder aufnehmen — und mich haben Sie ja für alle Fälle als einwandfreien Zeugen!«
»Habe ich mich denn überhaupt zu beklagen, lieber Herr Professor? Habe ich nicht dennoch mir den Sonnenschein eingefangen?«
Und glücklich lächelnd küßte er die Geliebte.
Es war am 10. August 1950. Der Schnelldampfer »Freya«, der gestern Abend auf der Reede von Saßnitz anlegte, hatte unter seinen zahlreichen Passagieren auch zwei Damen, Mutter und Tochter, gehabt, die von einem jungen Manne am Strande, dessen Kleidung den Künstler vermuten ließ, mit sonniger Heiterkeit begrüßt wurden.
Der junge Künstler, ein gefeierter Landschaftsmaler, Namens Erwin Lenz, war eben von einer Studienreise zurückgekehrt, die ihn nach Spitzbergen geführt hatte. Die beiden Damen waren seine Mutter und seine Schwester Eveline, die hier mit Erwin noch einige Tage auf der schönen Insel Rügen zu verleben gedachten, um ihrem Sommer-Aufenthalt an der Ostsee einen Abschluß zu geben. —
Der heutige Morgen sah die drei schon sehr früh auf einer Fußwanderung nach den bekannten Kreidefelsen von Stubbenkammer.
»Den Geburtstagswein heute beim Mittagessen werde ich euch spendieren, mein Schwesterchen, aus Freude darüber, daß ich seit drei Jahren das erste Mal wieder zu deinem Geburtstage mit dir und Mutti zusammen sein darf —«
»Das ist sehr lieb von dir, Erwin — aber du wirst wohl erlauben, daß wir aus demselben freudigen Grunde es u n s zur Ehre anrechnen, d i c h zu bewirten. —«
»Sehr nett — auf diese Weise — weil sich keiner das Vergnügen des Spendierens nehmen lassen will, haben wir also Aussicht, mehr als e i n e Flasche auf dich, Geburtstagskind, leeren zu dürfen; denn Mutti wird dieser zwingenden Notwendigkeit im Interesse geschwisterlicher Eintracht sich wohl nicht entziehen wollen — nicht wahr, Mutti?«
Und ein frischer Kuß auf die Stirn der alten Dame, die dem Sohne die dunklen und doch sonnigen Augen vererbt hatte, unterstützte diesen Antrag auf Überschreitung des sonstigen Tischbugdets. —
Im fröhlichen Geplauder schritten sie weiter. Ab und zu bot sich durch die tief herabhängenden Zweige der dichtbelaubten Bäume ein Ausblick auf die See — endlich näherte man sich dem höchsten aller Kreidefelsen, dem »Königsstuhl«,
Plötzlich entfuhr ein Ausruf der Überraschung Erwins Lippen —
»Wißt ihr, wen ich zu unserem improvisierten Geburtstagsmahl heut mittag einlade? —«
Die beiden Damen blieben stehen —
»Nun — wen?«
»Das heißt, Schwesterchen, wenn dir ein Fremder bei der Feier deines Geburtstages nicht die Freude stört —«
»Er ist ja doch wohl dir kein Fremder, lieber Bruder? —«
»Nein, im Gegenteil, ein lieber Freund noch aus der Zeit, als ich einmal Chemie studieren wollte, ihr wißt ja. — Er ist ein paar Semester älter als ich und heißt Hans Gurtner —«
»Aber, woher weißt du denn, daß er sich hier, in unserer nächsten Nähe befindet?«
»Da, seht hin — dort! Seht ihr den mächtigen Turm dicht an dem Abhang der Kreidefelsen — dort haust er!«
»In einem Aussichtsturm, lieber Erwin?«, fragte Eveline mit einem lustigen Spottlächeln um die schönen Lippen.
»Liebes Schwesterchen — Sei froh, daß kein Fremder deine Äußerung gehört hat! Ein Aussichtsturm! Ha, ha, ha! Aber lest ihr denn keine Zeitung? Besucht ihr nicht ab und zu einmal die phonographisch-kinematographischen Informationsinstitute, die unser deutscher Staat seit zehn Jahren eingerichtet hat?«
»Zu unserer Schande müssen wir gestehen, daß wir unsere wissenschaftliche Weiterbildung in letzter Zeit arg vernachlässigt haben. — Soviel weiß ich allerdings, daß sich hier auf Rügen, wie an vielen anderen Orten unseres Vaterlandes eine Marconistation befindet — aber dieses seltsame Bauwerk —«
»Ist eben die Marconistation — und Hans Gurtner ist ihr Direktor, liebe Eveline!«, setzte Erwin hinzu.
»Das also ist das Fern-Amt!«, rief nun Eveline. »Hast Du gehört, Mutti?«
»Ja — ja, das Fern-Amt! Da wird also wohl auch Herr Frank in den nächsten Tagen dort sein Domizil aufschlagen müssen —«
»Herr Frank?«, sagte Erwin etwas befremdet, »wer ist das?«
»Ein uns bekannter Herr aus Berlin, der im vorigen Winter öfter in Gesellschaften Eveline's Tänzer war.« —
»Ach so«, — sagte Erwin trocken.
»Herr Frank hat mir erzählt, daß er Mitte August hier auf Rügen ins Fernschreib-Amt eintreten werde«, sagte nun Eveline mit einem leichten Erröten auf den zarten Wangen. —
»Ja, ja«, meinte Erwin, »nun stürzen sich alle jungen Leute wieder auf die Wellentelegraphie, um schnell Karriere zu machen —«
»Herr Frank ist ein sehr tüchtiger und begabter, wissenschaftlich gebildeter Mann«, fügte die Mutter hinzu.
»Meinetwegen, Mutti! — Aber nun kommt. Der kleine Abstecher nach der Behausung meines alten Freundes Gurtner ist schnell gemacht. Ihr werdet den kleinen Umweg nicht bereuen. Hans ist zwar kein besonders guter Tänzer, aber ein famoser Mensch — und unsere gesamte moderne Wellentelegraphie ohne Draht mit ihren Ober- und Unterbeamten wäre wahrscheinlich immer noch im Versuchsstadium, wie zu den Zeiten Marconis, wenn nicht mein Freund Hans zur Fern-Übertragung seine Ä t h e r w i r b e l erzeugt hätte! Aber das muß er euch selber erzählen — komm', Mutti! Komm', Eveline!«
Und die drei wanderten auf das merkwürdige turmförmige Bauwerk zu. —
Direktor Gurtner saß in seiner Privatwohnung, die im Mittelgeschoß der Turm-Station sich befand.
Ein Mann in der Mitte der dreißiger Jahre — ein kluges Gesicht, vom dunklen Barte umrahmt, dunkle, sinnende Augen, die immer wie auf ein fernes Ziel gerichtet schienen, das Haar an den Schläfen leicht ergraut. — Vor ihm stand ein seltsamer Apparat, dem äußeren Aussehen nach ein eigenartig gebautes Mikrophon, wie es zur telephonischen Übertragung schon seit mehr als fünfzig Jahren benutzt wurde.
Er sprach ein paar Worte in das Mundstück des Apparates und lauschte dann an einer muschelartigen Hörkapsel, die er mit der Linken ans Ohr hielt, indes die rechte Hand einen der weißen Druckknöpfe auf einer Platte vor ihm niederdrückte. —
Das Gehörte schien ihn nicht recht zu befriedigen; denn enttäuscht ließ er die Hörkapsel fallen und stand auf...
Da ertönte ein kräftiges Klopfen an der Tür...
Gurtner schritt hinzu und öffnete.
Im Rahmen der Tür erschien ein Herr mit zwei Damen...
»Verzeihung, Herr Direktor«, sagte nun Erwin Lenz, »wenn wir Sie hier mitten im Dienst stören; aber im Vertrauen auf unsere frühere Bekanntschaft wagte ich es — mein Name ist Lenz« —
»Erwin Lenz!«, rief der Direktor mit einem plötzlichen Aufblitzen der Erinnerung — »lieber Erwin, willkommen! Solch lieber Freund stört mich niemals —«
»Herr Direktor — gestatten Sie —«
»Lieber alter Freund, was soll der Titel ›Direktor‹ zwischen uns? Hatten wir nicht das brüderliche ›Du‹ miteinander getauscht? —«
»Wenn ich wieder den alten vertraulichen Ton anschlagen darf —«
»Du betrübst mich, wenn du es nicht tust. — Aber — wir sind unhöflich, Erwin, die Damen werden keinen guten Begriff von uns bekommen —«
»Ach, verzeihe — also, mein alter Freund, Herr Direktor Gurtner — meine Mutter und meine Schwester Eveline!«
»Seien Sie im Heim des Junggesellen willkommen, meine Damen — und lassen Sie Ihre kritischen Frauenblicke nicht so sehr hier umherschweifen. Diese Räume sind zwar meine Privatwohnung — aber für mich doch nur eigentlich ein Privatlaboratorium.«
Die beiden Damen nahmen auf einem Diwan am Fenster Platz, indes Erwin mit dem Direktor an seinem Arbeitstische stehen blieb.
Erwin erzählte dem Freunde, daß er von einer Studienreise aus dem Norden komme und hier mit Mutter und Schwester zusammengetroffen sei, um auf Rügen noch einige Tage sich dem dolce far niente hinzugeben.
»Unser erster Ausflug heute Morgen führte uns hierher nach Stubbenkammer — dabei fiel mir dieser Turmbau in die Augen und damit die Erinnerung an Dich, lieber Hans! Aus den Zeitungen wußte ich schon seit längerer Zeit, daß Du, wie an vielen anderen Punkten des Landes, auch hier eine Fernmeldestation nach deinem System im Auftrage des Staates angelegt hast — und wollte mir doch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dich wiederzusehen und vor allem dich zu Deiner phänomenalen Entdeckung zu beglückwünschen!«
»Der Gedanke lag in der Luft, lieber Erwin, wie so häufig bei unsern modernen Errungenschaften. Die Arbeiten aller meiner Vorgänger waren nötig, mich den letzten Schritt zum Ziel tun zu lassen. In der Theorie war mein System der Ätherwirbel schon lange bekannt; die praktische Anwendung allein ist mein Werk. Aber wir sind wieder unhöflich und langweilen mit all den trockenen Erörterungen deine Damen! Verzeihen Sie, gnädige Frau, gnädiges Fräulein —«
»Nein — nein, lieber Hans, nicht so! Ich will dir nur gestehen, daß ich Mutter und Schwester hauptsächlich mit hierhergelotst habe, damit sie aus deinem Munde etwas Authentisches über deine berühmte Entdeckung hören sollten — deine liebenswürdige Bereitwilligkeit vorausgesetzt! Meine Damen kannten nicht einmal die Existenz dieses Wunderwerkes — wenn du auch mit den Augen zwinkerst, Eveline, wahr ist es doch! — noch viel weniger seine Bedeutung.« —
»Wenn es den Damen interessant genug erscheint, bin ich gern bereit, in unserm Fern-Amt ein wenig den Cicerone zu machen«, sagte Direktor Gurtner höflich. Er schritt zur Tür — »Wenn ich also bitten darf, mir zu folgen.«
»Eine Frage noch, lieber Hans — was ist dies für ein merkwürdiger Apparat, der hier auf deinem Schreibtisch steht?«
»Ein Wellentelephon, lieber Erwin, ein Apparat, um mit Hilfe von Ätherwellen, d.h. ohne die bisher noch immer notwendige Drahtleitung zwischen den einzelnen Stationen telephonieren zu können —«
»Auch deine Erfindung, du Tausendkünstler?«
»Sie ist noch keine Erfindung, sie soll es erst werden. Sie funktioniert immer noch nicht zur Zufriedenheit und auch nur erst auf kurze Entfernungen.«
»Ach, das mußt du uns auch zeigen, lieber Hans, wir bitten alle drei auch recht schön!« Hans lächelte und lächelte noch freundlicher, als ein Blick aus Evelines silberhellen Augen ihn traf.
»Freilich, freilich, recht gern, alter Freund, wenn du schweigen kannst! Ich kenne ja deine alte Schwärmerei für die Naturwissenschaften. Also, bitte — zuerst nach unserer Fernstation!«
Er schritt den anderen voran eine Treppe hinauf und noch eine. — Sie traten in einen kreisrunden Raum, der ungefähr in Augenhöhe eine Anzahl nicht ganz symmetrisch verteilter runder Fenster von ungefähr einem halben Meter Durchmesser zeigte.
»Schießscharten!«, rief Erwin unwillkürlich bei ihrem Anblick aus.
»Jawohl, Erwin, Schießscharten — und da hast du auch die Geschütze dazu!« Damit deutete Direktor Gurtner auf eigentümliche Apparate, die alle in einen Kanonenlauf zu endigen schienen.
»Das sind also deine«, — begann Erwin.
»Ätherwirbelsender! Ganz recht!«, vollendete der Direktor.
»Ach, hier an diesem Apparat steht: ›Berlin‹!«, rief Eveline plötzlich aus.
»Ja, gnädiges Fräulein, — das bedeutet, daß dieser Apparat die drahtlose Verbindung mit dem Fern-Amt Berlin vermittelt. Sie finden an dem daneben stehenden, der vor einer mehr westlich liegenden Maueröffnung angebracht ist, z.B. den Namen ›Hamburg‹, hier, östlich davon, den Namen ›Danzig‹ u.s.w.«
Ein eigentümliches Surren ertönte, eine bunte Glühlampe flammte an einem der aufgestellten Apparate auf. Der Beamte, der beim Eintritt seinen Chef mit einer stummen Verbeugung begrüßt, im übrigen wenig Notiz von den Besuchern genommen hatte, eilte an den angerufenen Apparat.
»Zufällig werden Sie Zeugen, meine Herrschaften, von der drahtlosen Vermittlung eines Telegramms, welches eben die Schneekoppe an die Station Rügen absendet — hören Sie, wie der Morseschreiber arbeitet?
Das bekannte Klappen des Schreibankers ertönte — der Beamte ließ den bedruckten Streifen durch die Finger gleiten —
»Etwas Besonderes? —«, fragte der Direktor.
»Die Station ›Großglockner‹ meldet an die Station Schneekoppe, daß heute früh eine Anfrage von ihr an die Endstation Kilimandscharo nicht beantwortet wurde —«
»So — so.« Der Direktor trat selbst herzu und las das Telegramm.
»Geben Sie Depesche, Herr Huth, daß in dem bekannten Turnus von zwanzig zu zwanzig Minuten Kilimandscharo angerufen wird! Lassen Sie auch auf allen Stationen dieser Route die Erdschlußgalvanometer kontrollieren. Auf alle Fälle bitte ich wieder um Bericht.«
Er wandte sich wieder an seine Gäste. »Verzeihung, meine Herrschaften, — aber der Kilimandscharo hat uns schon viel zu schaffen gemacht — da müssen wir auf der Hut sein! Das Intermezzo hat aber gleichzeitig den Vorteil, daß Sie auch die Absendung eines »drahtlosen Telegramms«, wenn ich mich so ausdrücken darf, hier mit erleben. Vielleicht treten Sie, bitte, etwas näher an den Sender heran. Die Erklärungen dazu werde ich Ihnen nachher geben.«
Erwin und seine Damen sahen nun, wie der Beamte einen mächtigen Schalthebel auf dem Tische niederdrückte — ein Wechselstrom von vielen hunderttausenden Volt Spannung pulsierte damit in den Primärspulen des SenderApparates. Durch einen Transformator wurde seine Spannung und Frequenz nochmals um den hunderttausendfachen Betrag gesteigert und diese kolossale elektrische Energie schließlich durch einen rotierenden Kondensator entladen, der durch eigenartig angeordnete Funkenstrecken, die bei der ungeheuer schnellen Drehung wie ein einziger blitzender Zylinder erschienen, eben in jenem »Kanonenrohr« die Ätherwirbel erzeugte.
Der Transformatorstromkreis ließ sich durch einen einfachen, aber sehr gut isolierten Morsetaster längere oder kürzere Zeit schließen und gab so die langen und kurze Stöße des Morsealphabets in Form scharfknatternder Funken.
»Gnädiges Fräulein, wollen Sie zur Depesche das Schlußzeichen geben?«, fragte Direktor Gurtner seine schöne Nachbarin.
»Wenn ich nicht zu ungeschickt bin, Herr Direktor«, sagte Eveline lächelnd.
»Fünf kurze Punktzeichen — fünfmaliges kurzes Niederdrücken dieser weißen Taste, gnädiges Fräulein —«
Schüchtern und zaghaft legte sie die schlanke weiße Hand auf den Morsetaster und begann ihn niederzudrücken...
Es war wohl nur Vorsorge und Dienstrücksicht, daß Hans dabei seine Hand auf die der jungen Dame legte. —
Als man wieder hinab in die Privatwohnung des Direktors gestiegen war, bat Erwin ihn nochmals um einige Aufklärungen über »die Ätherwirbel« —
»Die Telegraphie ohne Draht, die vor reichlich fünfzig Jahren von Marconi aufgrund der epochemachenden Entdeckung der Hertz'schen Wellen in die Praxis eingeführt worden war —«, begann Direktor Gurtner seine Ausführungen vor seinem kleinen Auditorium — »bestand bekanntlich darin, daß mit Hilfe kräftiger Induktionsfunken oscillatorische, d.h. hin- und herpendelnde Entladungen hochgespannter Elektricität erzeugt wurden, welche, in ihrer Ausbreitung und Abstimmung durch Sendedrähte an hohen Masten unterstützt, den umgebenden Weltäther in Transversalschwingungen versetzten, ähnlich so, wie ein ins Wasser fallender Stein auf dessen Oberfläche Wellen erzeugt, die sich in konzentrischen Kreisen ausbreiten —«
»Mutti —«, unterbrach hier Erwin den Vortragenden — »unter diesem plausiblen Bilde wirst du dir wohl die Äther-Oscillationen und ihre Ausbreitung durch den Raum auch denken können, nicht wahr?«
Die »Mutti« lächelte und nickte.
»Verzeihe, bester Freund — ich will nicht wieder unterbrechen!«
»Marconi hat mit dieser Form der Wellentelegraphie Großes erreicht; Sie wissen, daß es ihm in Jahre 1903 gelang, mit seinem Verfahren den atlantischen Ocean zu überbrücken, sehr zum Ärger der englischamerikanischen Kabelgesellschaften. — Trotzdem litt die Erfindung des genialen jungen Italieners und seiner ersten Nachahmer an einem großen Übelstand — sie arbeitete nicht ökonomisch genug! Der ins Wasser fallende Stein erzeugt eben nach allen Seiten seine Wellen, gleichviel, ob sie nur nach einer bestimmten Richtung beabsichtigt sind oder nicht — ohne Bild gesprochen: die Ätherschwingungen, welche die telegraphische Vermittlung besorgen, gehen bei dem System Marconis nach allen Seiten des Sender-Apparates, nicht nach einer einzigen, ganz bestimmten! Das bedeutet aber, daß die zur Verfügung stehende elektrische Energie sich nutzlos nach allen Richtungen der Windrose zerstreut, also doch nach der einen Station, wohin man sie senden will, nur einen verschwindend kleinen Bruchteil der Gesamtspannung schickt. Diese nutzlose Kraftverschwendung hat aber naturgemäß zur Folge, daß trotz der Größe der aufgewandten Mittel die Leistungen des Systems in bezug auf Sicherheit und Raumdurchdringung immer zu wünschen übrig ließen. —«
»Und nun zu deinem System, lieber Hans —«
»Diese Erwägungen führten mich dazu«, fuhr Gurtner einfach fort, »mit dem bisherigen Verfahren der Wellenerzeugung im Äther zu brechen. — Wir wissen wohl noch aus der Schulzeit, daß man nach dem Verhalten der Körper gegen die Wirkungen der Elektricität Leiter und Nichtleiter unterscheidet; alle Metalle gehören zu jenen, die Luft, die Harze, Glas, Seide u.s.w. zu diesen. Faraday hat zuerst nachgewiesen, daß dies verschiedene Verhalten von der Struktur des Weltäthers in den Molekülen dieser Körper abhängig ist, ja, daß die sogenannten Nichtleiter der Elektricität die eigentlichen Träger der elektrischen Kraft, die Leiter aber nur die Lenker und Führer sind. Wenn also ein elektrischer Strom durch einen Kupferdraht fließt, so haben wir uns dies so zu denken, daß die eigentliche Elektricität in der den Draht umhüllenden Luft vorhanden und tätig ist, der Draht in seinem Verlaufe also nur die Richtung für die Kraft bestimmt —«
Eveline stützte das Köpfchen in die Hand.
»Eine etwas schwierige und abstrakte Sache, gnädiges Fräulein — aber ein wenig Veranschaulichung wird sie uns leichter machen. —« Er griff hinter sich auf den Schreibtisch und nahm ein Blatt Papier auf, das er zu einer Rolle zusammendrehte und am Wiederaufrollen durch ein paar ringförmige Gummibändchen hinderte.
Er hielt die Papierrolle seinen Zuhörern hin —
»Diese Rolle Papier soll ein Stück des stromdurchflossenen Kupferdrahtes vorstellen. Die alte Anschauung früherer Jahrzehnte dachte sich nun die Elektricität wie eine Flüssigkeit den Leiter durchfließend, wie Wasser ein Leitungsrohr. Aber, meine verehrten Herrschaften, die Elektricität sitzt hier oben auf —« er deutete auf die umspannenden Gummiringe. »Wollen Sie sich, bitte, unter diesen Gummibändchen, welche unsern Stromleiter ringförmig umspannen, unsichtbare Ätherringe denken, welche Träger der elektrischen Kraft sind, und welche auf dem sogenannten Leiter dahingleiten —« er schob mit der Hand den einen Gummiring ein Stück vorwärts — »indem Sie dabei — wie dieser Gummiring! in eine wirbelförmige Drehung geraten. —«
Mit leuchtenden Augen sah ihn Eveline an. »Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden«, rief sie aus — »als ob die Ätherwirbel Rauchkringel wären, wie sie Bruder Erwin so schön mit dem Munde blasen kann —«
»Ganz recht, gnädiges Fräulein«, fiel Hans erfreut ein — »dies Bild trifft völlig zu — und, um es weiter zu benutzen, wollen wir uns einen Augenblick denken, Erwin bliese seine kunstvollen Rauchwirbel nicht frei in die Luft, sondern so, daß sie sich alle auf einen Stab aufreihen, dann giebt uns der Stab wohl die Richtung an, die eigentliche Kraft oder Bewegung aber liegt in den auf ihm gleitenden Ringen.«
»Nun — und deine Ätherwirbel? —«, fragte Erwin ungeduldig.
»Denke dir den Stab weg, auf den du — in unserm Gleichnis — deine Rauchwirbel aufreihtest — dann hast du sie!«
»Aber, du sagtest doch eben, der Draht sei nötig, um den Ätherwirbeln eine Richtung und Führung zu geben, lieber Hans? —«
»Wenn du einen Ring aus Zigarrenrauch bläst mit wenig Rauchvorrat und wenig Atem im Munde, so wird das so erzeugte luftige Gebilde schnell in der umgebenden Luft zerflattern; formst du ihn aber mit viel Rauch und viel Kraft, so wird er seine Form und Richtung lange behalten.«
»Da hast du recht, lieber Freund«, sagte Erwin zustimmend.
»Selbstverständlich läßt sich dies Gleichnis nicht völlig auf die Sache selbst anwenden, wie ja jedes Gleichnis hinkt. Die oscillierende Funkenentladung, die auch ich bei meinem rotierenden Transformator zur Erregung des umgebenden Weltäthers verwende, ist verschieden von der gewöhnlichen sogenannten ›fließenden‹ Elektricität —«, setzte Direktor Gurtner ergänzend hinzu. »Eben die schon von Faraday vermutete ›Seitenwirkung‹ der elektrischen Kraft habe ich mit meinen Apparaten auszunutzen verstanden. Durch eine besondere Anordnung der erregenden Funkenstrecken in der metallnen Schirmröhre habe ich ein spiralförmig weiterschreitendes Schwingen oder Rotieren des Äthers und zwar nur nach e i n e r ganz bestimmten Richtung ermöglicht — oder, um wieder mit einem Vergleich, diesmal aus der Ballistik, zu schließen, die Ätherwirbel verlassen den Richtzylinder des Senderapparates wie das Geschoß den gezogenen Lauf eines Geschützes! Du siehst, das Geheimnis ist nicht allzugroß dabei, lieber Erwin«, schloß er lächelnd seine Ausführungen, »und ich will nur im Interesse deiner Damen hoffen, daß ich sie mit der für sie immerhin uninteressanten und abstrakten Auseinandersetzung nicht allzusehr gelangweilt habe.«
Er verbeugte sich lächelnd vor den Damen.
Eveline reichte ihm herzlich dankend die Hand; Erwin aber sagte burschikos:
»Wir möchten uns für die erhaltene Belehrung auch gern erkenntlich zeigen, lieber Hans — und bitten dich daher, falls dein Dienst es erlaubt, heute Mittag unser Gast zu sein —«
Direktor Gurtner ging auf den scherzhaften Ton ein und sagte lachend: »Ganz habe ich das Diner durch meine den Herrschaften erteilte Lektion ja wohl nicht verdient, aber — ich bin so frei, es anzunehmen!«
»Wir trinken nämlich heut zum Diner eine Flasche Wein mehr als sonst, lieber Freund —«
Eveline hielt dem Bruder errötend den Mund zu —
»Laß mich doch reden, Schwesterchen — ein Glückwunsch m e h r zu deinem Geburtstage wird dir gewiß nicht unangenehm sein — noch dazu von meinem lieben, so lange schmerzlich vermißten Studienfreunde Hans —«
Hans Gurtner ergriff schnell die Hand des jungen Mädchens und führte sie an die Lippen.
»Ich darf Ihnen von ganzem Herzen gratulieren, gnädiges Fräulein — ich selbst aber gratuliere mir zu dieser heutigen Begegnung; ich hoffe, sie soll auch mir eine glückbringende sein!«
Er trat mit tiefer Verbeugung von Eveline zurück, deren liebliches Antlitz sich durch ein reizendes Erröten verschönt hatte.
»Und nun, meine Herrschaften«, rief Erwin fröhlich aus, »haben wir nur noch wenige Minuten zum Hotel ›Stubbenkammer‹; wir wollen einmal nach so langer Zeit der Trennung von ganzem Herzen fröhlich sein!«
Und er bot seiner »Mutti« den Arm und stieg mit ihr die Treppe hinab ins Freie.
Eveline nahm den Arm des Direktors — und so folgten die beiden dem voranschreitenden Paar. — —
Das improvisierte Geburtstagsmahl verlief sehr heiter. —
Auf den Vorschlag des Direktors Gurtner machte man nach aufgehobener Tafel einen kleinen Spaziergang nach einem kleinen turmartigen Holzbau, etwa drei Kilometer weit von hier entfernt...
Lachend und scherzend erreichte man den »andern« Aussichtsturm, wie Erwin lustig spottend den Bau taufte.
Eveline fragte Hans nach dem besonderen Zweck dieses Turmes — Gurtner lächelte und sagte:
»Meine Herrschaften — dieser Turm repräsentiert hier auf Rügen meinen Privatbesitz; ich habe ihn aus eigenen Mitteln zu meinen wissenschaftlichen Studien hier erbauen lassen — kommen Sie, das Sehenswerte an ihm ist nicht sein Äußeres, sondern —«
»Sein Inneres, wie bei jeder wissenschaftlichen Größe!«, vollendete Erwin scherzend.
»Du sollst Recht haben, lieber Erwin!«
Der Direktor stieg die steile Holzstiege voran, die andern folgten, auch »Mutti« gelangte unter Erwins Beistand glücklich oben an.
Man betrat ein kleines rundes Gemach. An dem einen Fenster befand sich ein Apparat.
»Genau solcher Apparat stand heute Vormittag auf deinem Arbeitstische, lieber Hans«, rief Erwin, nähertretend.
»Ein Wellentelephon, ganz recht — und ich möchte mir gestatten, den Damen eine Probe seiner Leistungsfähigkeit zu geben.
Die Damen traten wißbegierig heran.
Hans drückte auf einen Knopf und reichte der Mutter und der Tochter eine Hörmuschel —
»Ach«, rief Eveline überrascht — das ist ja Bruder Erwins Stimme, Herr Direktor?«
»Erwins Begrüßungsrede von heute Vormittag auf Station Stubbenkammer — ja, gnädiges Fräulein!«
Erwin hielt sein Ohr auch mit an die Muschel des Telephons —
»Unser erster Ausflug führte uns hierher nach Stubbenkammer —«, hörte er nun sich selbst reden.
»Du hattest also bei unserer Ankunft einen Phonographen zufällig zur Gesprächsaufnahme zurecht gestellt, der unser Gespräch fixiert hat, nicht wahr?«
»Ja — so ungefähr! Wie ich wohl schon sagte, beschäftige ich mich in dienstfreier Zeit augenblicklich mit diesem Wellentelephon, das die Drahtleitung beim Telephon-Verkehr entbehrlich machen soll. Die Worte, die Sie eben vernommen haben, sind von Stubbenkammer hierhergetragen worden auf den Schwingen des Weltäthers in Form äußerst fein differenzierter Ätherwirbel.«
»Ein wenig leise klangen manchmal Erwins Worte«, sagte Evelines Mutter.
»Ganz recht, gnädige Frau«, fiel Hans ein, »das ist eben noch der Fehler der Erfindung: zu große Lautschwäche trotz der kurzen Entfernung von drei Kilometern. — Aber man darf die Hoffnung und die Geduld nicht verlieren. Etwas trägt ja auch die Schuld an der leiseren Übermittlung der Umweg der Laute über die Walze des Phonographen; aber ich bin bei diesen Versuchen nur auf mich angewiesen, kann meine Beamten nicht zu meinen Privatversuchen heranziehen, will auch nicht, ehe das Wellentelephon die Kinderkrankheiten hinter sich hat, andere damit bekannt machen. So blieb mir nur übrig, auf jeder der beiden Stationen noch einen Phonographen aufzustellen, welcher die Worte, die ich hier beispielsweise hineinspreche, fixiert und sie dann, nach elektrischer Auslösung des Phonographen, nach Stubbenkammer durch das Wellentelephon überträgt.«
Die drei betrachteten staunend den komplizierten und scheinbar doch so einfachen Bau des kleinen Wunderwerkes...
»Gnädiges Fräulein — ich wage es im Interesse meiner Arbeit, sie zu bitten, ein paar Worte in den Phonographen des Senders hineinzusprechen — ich bitte darum als um eine Geburtstagsgnade —«
»Sing ein Lied hinein, Eveline!«, schlug der Bruder vor.
»O, ja — das ist noch viel besser und mehr, als ich zu hoffen wagte«, rief Hans Gurtner voller Freude aus — »ich selbst bin in dieser Kunst von Mutter Natur sehr stiefmütterlich bedacht worden —«
Eveline errötete ein wenig, stellte sich aber doch vor den Apparat.
»Im Augenblick, wo Sie beginnen wollen, liebes gnädiges Fräulein«, instruierte Hans, »drehen Sie, bitte, diesen kleinen Hebel nach rechts. Dadurch schaltet sich eine neue Walze ein!«
Und Eveline tat, wie ihr geheißen, und sang mit einer köstlich reinen Stimme und mit neckischer Schalkhaftigkeit ein altes bayrisches Volkslied aus dem vorigen Jahrhundert »von der Muhme!«
»Meine Muhme sagt mir immer,
Die Männer sei'n so schlecht —
Und daß ich nie im Leben
Einen Schatz nehmen möcht! —
Und recht brav sollt‹ ich bleiben,
Jedem Mann bieten Trutz;
Denn von allen im Dorfe
sei keiner etwas nutz!
Denn zuerst sei'n sie freundlich —
Doch später sei's vorbei
Und verflogen die Liebe
Und gar bitter die Reu'...
Ja, der Muhme, ja, der glaub' ich,
Der guten alten Frau —
Doch mit meinem Schatz ist's ganz anders
Das weiß ich genau!«
Hans und Erwin klatschten Beifall; ersterer reichte Eveline herzlich dankend die Hand — dann sagte er: »Sie werden nun gern auch hören wollen, wie Ihr reizendes Liedchen klingt, wenn es von dem seelenlosen Phonographen vorgetragen wird? Allerdings haben wir mit der Anpassung seiner Membran an die jeweilige Art der Tonwiedergabe inbezug auf Feinheit und Klangfarbe schon viel erreicht — aber auf solch kunstvolle Kehle ist und wird er so leicht nicht abzustimmen sein! doch — hören sie selbst!«
Und er legte die Hand an den Einschalter.
Ein Hörer aus dem Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts würde entzückt gewesen sein über die Klangwahrheit, mit welcher der mechanische Apparat die Reize der schönen Frauenstimme wiedergab; trotzdem sagte Erwin lächelnd, als der letzte Ton aus dem Phonographen erklungen war: »Die e r s t e Sängerin hat wohl noch ein wenig besser gesungen, nicht wahr, Eveline?«
»Und doch soll mir dies Lied bei meinen weiteren Versuchen wie Sphärenmusik klingen! setzte der Direktor leise hinzu.
Einige Stunden später finden wir unsere kleine Gesellschaft vollzählig im Walde wieder — unter den hohen Buchen der schönen Insel.
Hier — im Angesicht der freien Natur — fand Hans Gurtner gegen das junge Mädchen auch leichter den Ton harmloser Freude, und eine heitere, ungezwungene Vertraulichkeit war bald zwischen den beiden vorhanden, die von Erwin mit stiller Genugtuung bemerkt wurde...!
Plötzlich jubelte Eveline auf und bückte sich schnell zur Erde nieder —
»Walderdbeeren — ach, und so köstlich rot!« Alle kamen herzu und pflückten.
Hans reichte dem jungen Mädchen ein schnell gepflücktes Sträußchen der duftigen Beeren.
Sie dankte und pflückte mit den frischen roten Lippen Beere für Beere von dem dargebotenen Sträußchen. —
Die Gesellschaft hatte sich ein wenig zerstreut, um mit mehr Erfolg die Suche nach Walderdbeeren betreiben zu können.
»Mich wundert«, sagte Evelines Mutter, »daß es hier im Anfang des August noch so viel Walderdbeeren giebt?«
»Ja, gnädige Frau, wir leben ja hier auf Rügen ein paar Grad nördlicher als in Mitteldeutschland — hier beginnt im August wohl erst die rechte Erdbeersaison!« —
Sie pflückten und aßen — und pflückten und aßen immer wieder, so köstlich mundeten die selbstgesuchten Beeren.
Hans Gurtner hatte dabei so recht Gelegenheit, die natürliche Anmut und Lieblichkeit des jungen Menschenkindes bewundern — und lieben zu lernen.
Seit heute morgen, das fühlte er, war er an einen Wendepunkt seines Lebens gelangt. —
Eveline würde er nicht vergessen, wie er, von Arbeiten und Studien schon früh in Anspruch genommen, so manches weibliche Wesen schnell vergessen hatte. —
Eben schritt sie durch das Gewirr der Waldpflanzen auf ihn zu, mit einem Sträußchen sehr schöner, saftigroter Beeren.
Sie bot es ihm an, und als er dankend abwehren wollte, hielt sie es ihm gebieterisch an die Lippen. Er mußte essen, und er aß von dem Sträußchen in ihrer Hand bis auf die letzte Beere — dann aber haschte er nach der Hand, die so lange geduldig gehalten, und drückte einen heißen Kuß darauf — — —
»Fräulein Eveline — liebe Eveline«, flüsterte er.
Als man sich am Abend trennte, verabredete Erwin für den andern Tag eine zweite gemeinsame Partie. Der Direktor konnte leider dazu noch keine bestimmte Zusage machen.
»Es hängt alles vom Kilimandscharo ab, meine hochverehrten Herrschaften!«, sagte er. »Sind die Störungen von heute beseitigt, so habe ich die Ehre, zur verabredeten Zeit Sie in Stöwers Hotel in Saßnitz abholen zu dürfen — andernfalls —«
»Andernfalls«, fiel Erwin ein, »komm‹ ich im Laufe des Nachmittags, um dir bei der Strahlenexpedition gegen den Kilimandscharo zu sekundieren, lieber Hans, d. h. wenn ich dich nicht störe —«
»Du störst nicht — aber wir wollen für unsere gemeinsame Partie das Beste hoffen, nicht wahr, Fräulein Eveline?« Und er suchte mit leuchtenden Augen den Blick der ihren zum Abschiede zu erhaschen...
»Weißt du, Erwin«, sagte nach der Ankunft im Hotel zu Saßnitz die Mutter zu Erwin, als Eveline briefschreibend im Logierzimmer saß, indes die beiden noch ein Weilchen draußen auf der Veranda plauderten, »weißt du, ich glaube, dein Freund interessiert sich für Eveline?«
»Ich glaube es auch«, stimmte Erwin ein, »und ich freue mich darüber. Hans ist ein prächtiger, hervorragender Mensch, und Eveline paßt für ihn, sollt‹ ich meinen!«
»Das soll alles schön und gut sein, lieber Sohn — und ich hätte gegen die Sache auch nicht viel einzuwenden; aber Eveline ist so gut wie verlobt!«
»Verlobt?«, rief Erwin, »und davon erfahre ich nichts, der einzige Sohn und Bruder!«
»Beruhige dich, die beiden jungen Leute hätten es dir zuerst mitgeteilt, noch ehe sie es der Öffentlichkeit bekannt geben. Herr Frank wollte aber zuerst seine Versetzung zur Fernstation Rügen abwarten —«
»Also doch der Herr Frank, der Courschneider vom vorigen Winter —«
»Sei nicht ungerecht, lieber Erwin! Du wirst ihn kennen lernen, und er wird dir sicher gefallen. Kannst du ihn verantwortlich dafür machen, daß Eveline deinen Studienfreund nicht eher kennen lernte? Sei nicht ungerecht! Du wirst auch zugeben müssen, daß Herr Direktor Gurtner für Eveline mit ihren dreiundzwanzig Jahren doch etwas zu alt wäre als Bräutigam —«
»Erlaube, liebe Mutti, Papa war reichlich zehn Jahre älter als du und viel größer ist der Altersunterschied zwischen Hans und Eveline auch nicht.«
»Wenn schon — die Sache zwischen den beiden ist entschieden — und ich möchte dich darum herzlich bitten, deinen Freund in irgend einer ihn nicht kränkenden Form damit bekannt zu machen, lieber Erwin! Es wird in aller Interesse sein, wenn der Herr Direktor den Namen von Evelines Bräutigam nicht erfährt! Du verstehst die Gründe dafür, nicht wahr, lieber Sohn — Direktor Gurtner ist nach Franks Versetzung hierher sein erster Vorgesetzter! — Und nun gute Nacht, lieber Junge! Du rauchst wohl noch hier unten deine Zigarre zu Ende — ich aber bin müde vom Erdbeerpflücken!« — — —
Der Kilimandscharo vereitelte am andern Morgen die Teilnahme des Direktors an der Partie. — Alle Versuche, eine Verbindung mit dieser Endstation in DeutschOstafrika herzustellen, waren seit gestern vergeblich gewesen. Fieberhaft arbeitete man auf Rügen sowohl, als auf der Schneekoppe und dem Großglockner — die Störung ließ sich nicht beseitigen. Sie lag also wohl in Afrika selbst.
Schon einmal hatte der Kilimandscharo tagelang auf alle drahtlosen Depeschen geschwiegen. Schon damals hatte Direktor Gurtner einen bestimmten Verdacht gehabt und ihn der Staatsregierung mitgeteilt — auch jetzt schien die Ursache die gleiche zu sein...
Auf dem Arbeitstische des Direktors lag eine Karte vom Kilimandscharo und seiner Umgebung. Die Lage der dortigen Station war genau eingezeichnet, auch die Bahn der Ätherwirbel, die am Großglockner auf dem 31. Meridian östlich von Ferro einsetzte, NordAfrika etwa unter dem 40. Grad erreichte und innerhalb dieses Erdteils fast 15 Meridiane kreuzte, um geradlinig den 6000 m hohen Gipfel des Riesenberges zu erreichen.
Direktor Gurtner hatte an der Grenze von Abessynien und Nubien einen blauen Strich gemacht. Hier lag nach seiner Ansicht die Ursache der Störung. Hier hatte man den Ätherwellen künstlich ein Hindernis in den Weg gestellt — nach der Meinung des Direktors und seiner Mitarbeiter befand sich hier eine heimlich erbaute elektrische Anlage der internationalen Kabelgesellschaft, welche von hohen Masten aus elektrische Wellen quer zur Richtung der KilimandscharoRoute schleuderte, um die Übermittlung der Zeichen zu stören und so den ganzen drahtlosen Verkehr mit Kolonialgebieten zu diskreditieren.
Immer in unregelmäßigen Zwischenräumen versagte der Verkehr mit dem Kilimandscharo, während alle übrigen, in Europa liegenden Stationen störungsfrei arbeiteten. Vergebens hatte die deutsche Regierung eine Durchforschung der ganzen Route innerhalb Afrikas bei der englischen Kolonialverwaltung beantragt, um das Hindernis aufzusuchen; aus politischen Rücksichten könne eine derartige monatelange Bereisung englischer Tributärstaaten nicht gestattet werden. Durch alle diese Umstände wurde Direktor Gurtner in seinem Verdachte nur bestärkt. — Seit der letzten Störung im Frühling des Jahres hatte er darum auf eine Abhülfe in anderer Form gesonnen, auch die nötigen Vorarbeiten dazu auf der Station Großglockner ausführen lassen. Merkwürdigerweise funktionierte gleich darauf die Verbindung Großglockner Kilimandscharo in der alten Weise mit tadelloser Sicherheit, sodaß man von einer Indienststellung der neuen Einrichtung immer wieder abgesehen hatte, weil sie kolossale Energiemengen elektrischer Kraft nötig machte.
Aber nun blieb kein anderer Ausweg übrig, der Versuch mit der Neuerung mußte gemacht werden.
Gurtners Vermutungen waren dabei folgende. Trotz der Höhenlage der Großglocknerstation (3800 m) strichen die Ätherwirbel auf afrikanischem Gebiet infolge der Erdkrümmung ziemlich dicht auf dem Erdboden hin, und wenn auch Wälder und Erhöhungen den rasend schnellen Ätherschwingungen kein nennenswertes Hindernis in den Weg stellten, so lag doch die Sache bei elektrischen Störungen anders. Hierbei genügten in geringer Höhe erfolgende wellenförmige Entladungen quer zur beabsichtigten Richtung, um eine sichere Zeichenübermittlung unmöglich zu machen. Und die Abtrennung des Kilimandscharo von den europäischen Wellenstationen bewies, daß die internationalen Störenfriede richtig kombiniert hatten. — Direktor Gurtner hoffte nun, durch Reflexion das Hindernis überbrücken zu können. —
Er hatte seit dem frühen Morgen angestrengt gearbeitet und sich kaum einmal auf sich selbst besonnen, und doch durchströmte ihn trotz der vermehrten Arbeit ein Glücksgefühl; sein Leben hatte seit gestern Sonnenschein, sein Herz eine süße Hoffnung: Eveline!...
Ganz überrascht war er, als Erwin Lenz bei ihm eintrat.
»Deine Damen haben mich entschuldigt, nicht wahr? — Der Kilimandscharo —«
»Ja, wir haben es uns nach deinen gestrigen Befürchtungen gedacht, lieber Freund! Nun — und — noch immer kein Anschluß?«
»Noch nicht, Erwin; aber du kommst gerade recht, unsern Versuchen beizuwohnen. Komm, ich war eben im Begriff, mich ins Dienstzimmer zu begeben.«
Und sie stiegen die Treppe hinauf zum Obergeschoß.
Hier hatte sich seit gestern einiges geändert. Eine Öffnung in dem kuppelartigen Deckenraum war freigelegt worden, und ein mächtiges Metallrohr ragte gleich dem Refraktor einer Sternwarte daraus hervor.
»Nun«, wandte sich der eintretende Direktor an den diensttuenden Beamten, »hat der Großglockner gemeldet, daß der Reflektor hochgebracht worden ist?«
»Eben, Herr Direktor, ist die Nachricht eingegangen!«
»So können wir also beginnen! Die Schneekoppe ist benachrichtigt, daß sie für heute den Fernverkehr für unsere Station übernimmt?«
»Sehr wohl, Herr Direktor!«
»Du kennst aus deiner Schulzeit das Reflexionsgesetz noch, lieber Erwin?
»Der Reflexionswinkel ist gleich dem Einfallswinkel, nicht wahr?«
»Jawohl! Dies Gesetz gilt bekanntlich für Schall, Licht und Wärme und auch für die Bewegung elastischer Körper in gleicher Weise. Darauf habe ich meine jetzige Methode gegründet; denn auch die Ätherwirbel gehorchen diesem von Heron von Alexandrien gefundenen Satze. Wir haben nämlich eine Störung auf unserer direkten Linie GroßglocknerKilimandscharo —«
Und in kurzen Worten teilte Hans dem Freunde seine Vermutungen und Befürchtungen inbezug auf die internationale Kabelgesellschaft mit.
»Ich habe nun die Station Großglockner mit einem riesigen MetallReflektor versehen lassen, der unter bestimmter Neigung durch mehrere Fesselballons in ca. 10 000 m Höhe gehalten wird. Durch genaue astronomische Beobachtungen haben wir den Winkel bestimmt, unter welchem von Rügen aus die Ätherwirbel auf diesen Reflexionsspiegel fallen müssen, wenn sie, von ihm unter demselben Winkel zurückgeworfen, gerade den Empfänger des Kilimandscharo von oben her erreichen sollen. Du siehst an der Lage des Senderohrs, das oben aus der Kuppel herausragt, daß wir einen ziemlich großen Winkel benutzen müssen, um die störende Zwischenzone an der Grenze Oberägyptens umgehen zu können. — Und nun wollen wir einen ersten Versuch machen, Herr Huth!«, wandte er sich an den Beamten. »Schalten Sie ein, bitte, und auf maximale Stärke!«
Der Beamte legte einen der großen Schalthebel um und drehte eine Kurbel. Ein betäubendes Knattern elektrischer Entladungen erfolgte.
Der Direktor begann nun — nach dem Zeichen des Anrufes — mit der Übersendung des Telegrammes, welches die Telegraphenbeamten auf dem Kilimandscharo mit der veränderten Zeichenübermittlung bekannt machen sollte. Es hatte folgenden Wortlaut:
Waren seit vierundzwanzig Stunden ohne Verbindung mit Kilimandscharo. Haben seit heute früh Reflektorverfahren über Station Großglockner in Betrieb gesetzt. Fragen an, ob Sie unsere Zeichen klar empfangen. Stellung des Senders muß nach Angabe vom 30. März korrigiert werden. Bitten, zur sicheren Einstellung auf unsere folgenden kurzen Signale ebenso zu antworten.
Fern-Amt Rügen.
Die verabredeten Signale bestanden in drei kurzen Zeichen.
Nach einer kleinen Pause gab er zum ersten Male die drei Anrufe, in der Annahme, daß die Station Kilimandscharo bis dahin die Einstellung des Senders auf die Reflektorplatte des Großglockners vorgenommen habe —
Gespannt blickten die Männer auf den Lichtzeiger des Empfängers — er blieb auf dem Nullpunkt der Skala stehen.
Wieder und wieder sandte Hans Gurtner das Zeichen in die Fernen des Weltäthers, unermüdlich. Eine Stunde verging, eine zweite, eine dritte — ohne jeden Erfolg.
Nochmals nahm der Direktor eine Korrektur am Sender vor.
Und abermals und unermüdlich schickte er das Signal aus dem Sender. Das Metallrohr des Apparates wurde rotglühend unter dem Anprall der elektrischen Wirbel —
Da schrie Erwin auf.
»Ein Zeichen!«
Sie beugten sich vor; starr hafteten die Blicke auf der feinen Lichtlinie des Galvanometers — ruhig stand der Zeiger wieder auf Null. Es war doch wohl eine Täuschung gewesen...
Zeichen auf Zeichen flog in den Äther... Würde nicht alle aufgewendete Mühe vergeblich bleiben? Zu groß war vielleicht der zu durchdringende Raum, zu schwach die zur Verfügung stehende Energie! Einen Augenblick drohte Hans mutlos zu werden — da dachte er an Eveline. »Sei du mir nahe mit deinem Segen, Geliebte!«, ging es wie ein stilles Gebet durch seine Seele...
Und jetzt — jetzt war es keine Täuschung mehr! Mit sichtbarem Ruck flog der Zeiger auf die Seite, energisch beantwortete er die kurzen Signale der Station Rügen — der Kilimandscharo war gefunden! Sein Anschluß an die Station erreicht! Die Wissenschaft hatte über die Machenschaften internationaler Krämerseelen triumphiert.
Direktor Gurtner durfte seinen vielen Erfolgen auf wissenschaftlichem Gebiete einen neuen hinzufügen. —
Erwin gratulierte dem Freunde von ganzem Herzen.
»Und nun, lieber Erwin«, sagte Hans, nachdem er seinem Beamten noch einige Instruktionen gegeben hatte, »nun wollen wir frühstücken!«
»Frühstücken — jetzt? Aber, liebster Freund, es ist Spätnachmittag!«
»Für mich aber das erste Frühstück heute! Komm, mein alter Junge, wir wollen den Kilimandscharo leben lassen — und noch jemand, der für mich noch viel höher in den Äther hineinragt — komm! Unterwegs erzählst du mir, wie deinen Damen der gestrige Ausflug bekommen ist, und was ihr sonst noch für heute beschlossen habt!«
Und er nahm den Arm des Freundes, und sie stiegen die Treppe hinab.
Erwin hatte dem Freunde Evelines heimliche Verlobung berichtet. Er hatte das grausame Wort immer und immer wieder hinausgeschoben, als er seine Hoffnungsfreudigkeit sah. Aber schließlich mußte es doch sein, und er half sich damit, daß er von seiner eignen Überraschung erzählte, die ihn gestern Abend noch von der Mutter beschert worden war. Den Namen des Bräutigams nannte er nicht.
Hans hatte die Eröffnung stumm hingenommen — nur die lieben, offnen Augen hatten sich einen Augenblick verschleiert. Stumm war er auch geblieben bei den gutgemeinten Trostreden Erwins. — Das »Frühstück« am späten Nachmittage, das so heiter begonnen, endete unter ernstem Schweigen.
Beim Abschiede hielt Erwin seine Hand fester. »So dürfen wir dich also heute Abend zur Dampferfahrt um die erleuchteten Kreidefelsen nicht erwarten, bester Hans?«
»Ich — will versuchen, zu kommen, Erwin! Empfiehl mich deiner verehrten Frau Mutter und Fräulein Eveline bis dahin! Wir beide bleiben auf jeden Fall dieselben, nicht wahr? Auf Wiedersehen!«
Bei seiner Rückkehr in das Fern-Amt fand Hans eine Anfrage des Ministeriums vor, die sich mit der Störung des drahtlosen Verkehrs nach dem Kilimandscharo beschäftigte. Gerade jetzt war es der Regierung des Deutschen Reiches doppelt unangenehm, weil wichtige koloniale Interessen, die Erweiterung des ostafrikanischen Hinterlandes betreffend, auf dem Spiele standen. Hans antwortete sofort, gab einen eingehenden Bericht seiner Untersuchungen und Vermutungen über absichtlich herbeigeführte Störungen aus niederen Interessen und teilte mit, wie es ihm diesmal gelungen sei, den Betrieb durch seine neue Methode der Reflexionsstrahlung wieder aufzunehmen. Gleichzeitig aber fügte er hinzu, daß dieser Ausweg nur ein provisorischer und für den Notfall geltender sein dürfe, da die verbrauchte Strahlungsenergie in keinem ökonomischen Verhältnisse zu den Leistungen stehe. Vielmehr schlage er vor, sofort einen der tüchtigsten Oberbeamten des Reichsfern-Amts nach dem Kilimandscharo zu senden, der an Ort und Stelle Untersuchungen und Experimente über einen dauernd gesicherten Betrieb, am einfachsten wohl durch Erhöhung der Sendestation erreichbar, anstellen solle.
Dann war er hinab in sein Zimmer gegangen, hatte die elektrische Lampe angedreht und bei dem milden Schein des grünumschirmten Lichtes noch einmal den Tag überdacht, an dem er soviel erreicht — und soviel verloren!
»Eveline!«, schluchzte er auf. Aber er war gewohnt, sein Herz in fester Gewalt zu haben — er ward wieder ruhig. Niemand konnte dafür, daß alles so gekommen war, und er dankte seinem Schicksal, das ihm zeitig genug die Augen geöffnet. Aber auskosten wollte er doch noch die wenigen Stunden des Beisammenseins mit ihr, wenn auch nicht mehr mit der Hoffnung auf ihren Besitz — im Sonnenschein ihrer Nähe wollte er weilen, solange es ihm noch vom Geschick vergönnt war. Das Recht des andern war ihm heilig und unantastbar — aber sein Herz wußte sich frei von selbstischen Interessen, wenn er ihr heute abend wieder gegenübertrat.
Wissen sollte sie aber, die Liebe, Einzige, Zuspätgesehene, Allzufrühverlorene, wie es in ihm aussah — und schnell hatte er es in schlichten Versen niedergeschrieben:
»Still mit dem Blick dich zu umfangen,
Ist alles, was mein Herz begehrt!
Ach, jedes heißere Verlangen
Hat mir ein herb' Geschick verwehrt.
Wie meine Augen küssend grüßen
Der Züge Reiz, der Wangen Rot!
Am Munde hängen sie, dem süßen,
Der nie sich mir zum Kusse bot.
Verbirg mir nicht die schönen Sterne,
Die lieben Augen laß mich seh'n —
Mir ewig nah und ewig ferne,
Wie jene, die am Himmel steh'n!
Ach, ungestillt bleibt mein Verlangen!
Nie wirst du mein, geliebtes Lieb! —
Still mit dem Blick dich zu umfangen,
Ist alles, alles, was mir blieb.« —
Er barg das kleine Blättchen in seiner Brieftasche und machte sich auf zum Landungsplatze des Dampfers. — —
Da stand sie auf der Landungsbrücke — ihre Silhouette hob sich lieblich ab von dem abendlich glühenden Himmel. Sie hatte ihn kommen sehen und schritt ihm entgegen.
»Herzlichen Glückwunsch zum Kilimandscharo!«, sagte sie freundlich.
Er sah sie wieder vor sich, die silberhellen Augen, aus deren Schimmer er noch gestern eine süße Hoffnung für sich gelesen — und er fühlte, wie schwer es ihm werden würde, sie zu verlieren. Aber er fühlte auch, daß in dieser Mädchenseele kein Falsch war, keine Berechnung, kein Doppelspiel, und daß es schon ein Glück sei, in ihrer Nähe sein zu dürfen — auch o h n e Hoffnung!
Er führte die schlanke weiße Hand an die Lippen und dankte ihr.
»Bruder Erwin hat uns viel von Ihnen erzählt, Herr Direktor!«
»Bruder Erwin hat mir auch von Ihnen heut viel erzählt, Fräulein Eveline!«, wiederholte er leise.
Sie errötete. Sie wußte, was er meinte; denn »die Mutti« hatte dafür gesorgt.
»Lassen Sie mich die wenigen Augenblicke unseres Alleinseins benutzen«, sprach er weiter, »Ihnen zu danken für alle Freude, allen Sonnenschein, den sie mir durch Ihre Bekanntschaft geschenkt haben, Fräulein Eveline!«
Er drückte ihr das zusammengefaltete Blättchen mit den Versen in die Hand.
»Es ist nichts, nichts weiter, nur eine Bitte, die der Mund sich auszusprechen scheut«, sagte er, als sie ihn verwundert ansah —
Eben trat Erwin mit der Mutter hinzu.
Er nahm des Freundes beide Hände, sie herzlich drückend.
»Das ist lieb, das ist schön, daß du doch gekommen bist, Hans!«
Sie schritten zum Dampfer, dessen Scheinwerfer schon mit bunten Lichtgarben die Ufer bestrahlte. — —
Am andern Tage fand die gestern durch den Kilimandscharo gestörte Partie statt, nur daß »die Mutti« vorgezogen hatte, zu Hause zu bleiben. Es würden doch wieder Erdbeeren gepflückt, und dazu sei sie zu alt und fühle noch die Schmerzen vom Bücken und Pflücken vom Tage vorher in den Gliedern.
Wie drei fröhliche Geschwister zogen die Ausflügler in den Wald.
Eine weiche, milde Stimmung war über sie alle drei gekommen. Sie fühlten, daß diese wenigen Stunden für sie unvergeßlich sein würden — und jeder suchte dem andern etwas zu lieb zu tun.
So vergingen die Stunden. Am Spätnachmittage gelangten sie wieder an die See. Das Meer brandete in leisem Rauschen am Fuße der Kreidefelsen — wie das Atmen der Ewigkeit klang es ihnen! —
Groß und flammend stand die Abendsonne am westlichen Himmel — groß und flammend wie der Gedanke der Trennung in ihrer Seele.
Die frohen Gespräche waren verstummt; still trat man den Heimweg an. Auf dem Wege zur Dampferstation kam man am Turm des Fern-Amtes vorüber. Erwin wollte der Schwester noch den RiesenFernsender zeigen, der die Übermittlung der Telegramme nach dem Kilimandscharo besorgte, und so stiegen die Geschwister mit dem Direktor noch einmal die Treppe zum Apparatenzimmer hinan.
Während Hans den beiden noch einmal kurz die Wirkungsweise des unter so veränderten Bedingungen arbeitenden Ätherwirbelsenders erläuterte, trat ein Beamter auf ihn zu.
»Was giebt‹s?«, fragte der Direktor.
»Herr Direktor, ein als dringend aus dem Central-Amt Berlin aufgegebenen Telegramm, das seit heute Mittag hier lagert, muß noch beantwortet werden.«
Und er reichte dem Direktor die Depesche.
Der Direktor las:
»Wir haben beschlossen, zur Untersuchung und Abänderung der Übelstände der Station Kilimandscharo — Ihre Zustimmung vorausgesetzt — den ersten Assistenten des Fern-Amts R., Namens Frank, nach Deutsch-Ostafrika zu senden, in der Erwartung, daß Sie ihn von der zu Mitte diesem Monats fälligen Versetzung in das Fern-Amt Rügen entbinden. Ober-Assistent Frank soll binnen drei Tagen von Brindisi nach Dar es Salaam abreisen; wir ersuchen daher um umgehende Zustimmung, eventuell um besondere Instruktionen für seine Tätigkeit. Sein Aufenthalt dort ist vorläufig auf drei Jahre angenommen.
Das Reichs-Central-Fern-Amt.«
»Da hat die Behörde einmal den rechten Mann für die rechte Stelle gefaßt!«, rief Direktor Gurtner erfreut aus.
»Was giebt es?«, fragten die Geschwister.
»Ich erzählte Ihnen doch, daß ich der Regierung den völligen Umbau der Kilimandscharostation vorgeschlagen habe. Die Regierung willigt ein und hat einen unserer tüchtigsten Beamten damit betraut. Da — lesen Sie, meine Herrschaften!
Und er reichte ihnen das Telegramm.
Erwin las es halblaut vor, indes Eveline ihm über die Schulter sah.
Plötzlich schrie sie auf.
»Frank — nach Afrika! Allmächtiger Gott!«
Totenbleich stand sie, mit weitaufgerissenen Augen, einer Ohnmacht nahe.
Der Direktor sprang hinzu und stützte sie.
»Um Gotteswillen, liebes Fräulein Eveline — was haben Sie?«
»Frank — ist — mein Verlobter!«, stieß sie schweratmend hervor.
»Ach — und er soll nach dem fremden Erdteile — und ich darf ihn nicht einmal mehr vor seiner Abreise sehen — ach, mein Gott!«
Ergriffen standen die beiden Männer.
Leise nahm nun Hans die wie leblos herabhängende Hand Evelines in die seine und sagte:
»Hoffen Sie das Beste, teure Eveline — vielleicht läßt sich die Berufung Ihres Herrn Verlobten auf die eine oder andere Art noch rückgängig machen —«
Eveline schlug die schönen Augen zu ihm auf. Er sah hinein wie in ein Meer voll Weh; die letzten irdischen Schlacken seiner Liebe zu ihr versanken vor diesem Blick. Seine Seele ward rein und wunschlos, und ein heiliger Opfermut für die Geliebte erfüllte ihn.
»Schenken Sie mir Ihr Vertrauen in dieser ernsten Stunde, teures Mädchen! Was ich tun kann, Herrn Frank in Deutschland zu halten, soll gewiß geschehen, heute noch! Glauben Sie mir, vertrauen Sie mir, Eveline!
Und er strich mit weicher Hand tröstend über die Stirn der Fassungslosen —
Vom Landungssteg klang die Pfeife des Dampfers.
»Sie müssen gehen — der Dampfer fährt sonst ohne Sie beide nach Saßnitz zurück! — Mit Gott, Eveline!« Er reichte ihr beide Hände und sah ihr noch einmal in die lieben Augen. »Morgen mittag spätestens haben Sie brieflich Nachricht von mir! Vergessen Sie nicht, daß hier ein Freund für Ihre Liebe wacht — und leben Sie wohl, jetzt und immer!«
Erwin drückte ihm stumm die Hand und führte Eveline hinab.
Im letzten Augenblick gelang es ihnen noch, den Dampfer zu erreichen. —
Am andern Morgen empfing Eveline einen Brief. Er lautete:
Gnädiges Fräulein!
Eine noch gestern eingelaufene Verfügung des Central-Fern-Amtes bestimmt, daß Herr Ober-Assistent Frank — wie zuerst angeordnet — seine Stellung hier im Fern-Amt Rügen übermorgen antreten soll. Für den Umbau der Kilimandscharo-Station habe ich mich der Reichsregierung zur Verfügung gestellt. Heute Abend reise ich nach Brindisi ab, habe noch mancherlei bis dahin hier zu ordnen — und kann und — darf Sie nicht mehr sehen!
Empfehlen Sie mich Ihren Lieben! Leben Sie wohl, und mögen Sie so glücklich werden, als Sie es verdienen zu sein!
Ich bin zufrieden, daß ich Ihnen diesen Beweis meiner Liebe — so darf ich wohl in letzter Stunde offen sagen! — habe geben dürfen.
Gedenken Sie auch später noch einmal
Ihres
Sie treu verehrenden Freundes
Hans Gurtner.
Die letzten Stunden seines Aufenthaltes hier kamen heran; Direktor Gurtner saß einsam in seinem Privatzimmer vor dem Wellentelephon. Einige Koffer standen umher, teils schon gepackt, teils noch geöffnet — »Das Wellentelephon muß ich auch noch einpacken —«, dachte Hans. Er hatte es sich bis zuletzt aufgespart, es tat ihm immer noch leid, den Apparat zu demontieren. Noch einmal wollte er den Phonographen im kleinen Holzturm spielen lassen — noch einmal die süße Mädchenstimme hören, auf den Schwingen des Weltäthers hierhergetragen in sein stilles Heim —
Er drückte auf den Knopf, dessen Kontakt den Elektromotor des Phonographen auf der drei Kilometer weit entfernten Kabine im Holzturm in Betrieb setzte, und lauschte dem neckischen, ach, ihm schon so vertraut klingenden Liede von »der Muhme« — — — —
Nun war es zu Ende, und Hans behielt die Hörmuschel am Ohr, um die selbsttätige Ausschaltung des Phonographen telephonisch zu überwachen — — da! — was war das? — Der Phonograph schnurrte nicht ab, wie sonst beim Schluß, sondern begann von neuem —
Aufs höchste überrascht, war Hans aufgesprungen und lauschte mit angehaltenem Atem —
Evelines Stimme! Und sie sprach die folgenden Verse:
»So klage nicht das Schicksal an,
Das dir verlangt dein volles Lieben! —
O, glaube mir, du teurer Mann,
Gar vieles noch ist dir geblieben.
Und wenn zu spät und nur zum Schmerz
Das Leben erst mich zu dir lenkte —
Und wenn ich Mund und Hand und Herz
In Treuen schon dem andern schenkte —
O, grolle nicht! Sei gut, sei mild —
Die Sonne strahlt auch deinem Leben!
>Mich aber laß, wie Traumgebild,
>Nur leis durch dein Erinnern schweben!
Und wenn der Wandrer wiederkehrt
Dereinst zu froher Feierstunde —
Dann sei dem Freunde nicht verwehrt
Ein Gruß und Kuß vom Schwestermunde!«
Hans war auf den Stuhl zurückgesunken. Er stützte den Kopf in die Hand, und seine Augen schimmerten feucht. Das gute, liebe Mädchen! So hatte sie doch noch ein Abschiedswort für ihn gefunden. Gewiß war sie heute während des Vormittags nach dem Holzturm gegangen und hatte die Strophen dort in den Phonographen gesprochen, in der Hoffnung, daß er vor seiner Abreise doch wohl noch einmal mit dem Wellentelephon einen Versuch anstellen werde.
Und wie deutlich war diesmal die Übertragung durch die Wellen des Äthers gewesen! Vielleicht war die kürzlich eingeschaltete Form des neuen MikrophonInterruptors doch ein großer Schritt weiter zum Ziele.
Er saß und — sann und — — träumte! — Eine wohltätige Ermattung nach all den Aufregungen der letzten Tage kam über ihn — das köstliche Gefühl eines über sich selbst errungenen Sieges und einer damit verbundenen Freundestat erfüllte ihn — »Eveline!«, kam es noch einmal über seine Lippen — — er sank in Schlummer...
Wie lange er geträumt, geschlummert — er wußte es nicht.
Plötzlich fuhr er auf aus dem Schlafe —
»Eveline!«, rief er — bestürzt und glücklich zugleich.
Sie war es. Leise war sie hereingekommen in der Erwartung, sein Privatzimmer leer zu finden, da er wahrscheinlich doch die letzten Stunden benutzen würde, seine Beamten wegen seiner plötzlichen Abreise zu instruieren — —
Da fand sie ihn schlummernd am Schreibtisch. Leise schlich sie herzu, mit hochklopfendem Herzen — leise legte sie das frischgepflückte Sträußchen auf den Tisch —
Eine Sekunde sah sie dem Schlummernden ins Antlitz — sie sah die tiefen Falten, die jahrelanges vergebliches Ringen, Anstrengung und Enttäuschung in diese edle Stirne gegraben, sah das graue Haar an den klopfenden Schläfen —
Und heute noch ging er hinaus in die Ferne, in ein Land des Fiebers, tausende von Meilen entfernt von allem, was ihm lieb und teuer hier geworden — und niemand vermochte zu sagen, ob er jemals wiederkehren würde — —
Und um ihretwillen ging er — sie wußte es.
Da kam es über sie wie eine Naturgewalt, wie ein Frühlingssturm, der die stolzen Bäume des Waldes beugt — sie wollte ihm danken einmal im Leben für all seine Liebe! Und sie neigte sich hernieder und küßte die Stirn des Freundes und küßte seinen Mund — —
Da wachte er auf.
»Eveline!«, rief er, sie wie im Traum umfangend.
Sanft entwand sie sich seinen Armen und eilte zur Tür.
»Leben Sie wohl, lieber, teurer Freund — und Gott segne Sie!« — —
Ein flüchtiger Schritt die Treppe hinab — sie war verschwunden.
Da fiel sein Auge auf daß Sträußchen... .
Ihr letzter Gruß!
Walderdbeeren!
Frisch und rosig und duftig — wie Evelines Lippen.
Der junge Telegraphenbeamte Fritz Oldenburger saß im Dienstzimmer des Telegraphen-Amtes Emden, vor sich den Doppeltaster des Siphon-Recorders der Linie Emden-Vigo-Amerika.
Es waren heiße Tage der Arbeit gewesen, diese letzten Tage vor Weihnachten. Der Konflikt Venezuelas mit dem Deutschen Reiche hatte eine unerwartete Ausdehnung gewonnen; in letzter Stunde hatte Amerika interveniert, weil es die Monroe-Doktrin von Deutschland verletzt glaubte. Es hatte durch mächtige Panzerschiffe die Bai von La Guayra mit den daselbst vor Anker liegenden deutschen und englischen Kriegsschiffen blockieren lassen, und der Weltbrand mit seinem schwarzen Gefolge: Tod und Verderben hing wie ein finsteres Gewitter tagelang über den friedlichen Fluren unseres Vaterlandes.
Die Kniffe und Schliche amerikanischer und europäischer Diplomatie, all die Winkelzüge und Scheinmanöver der höfischen Verstellungskunst hatten ihr Möglichstes getan, die Fäden zu verwirren — und all das Hinüber und Herüber der chiffrierten Kabeldepeschen mit ihren ungeheuren Ansprüchen an die Energie des Geistes und Körpers waren zum größten Teile unserm Fritz Oldenburger im wahrsten Sinne des Wortes »durch die Finger« gegangen.
Da hatte, wie so manchmal, ein offenes Wort unseres ritterlichen Kaisers allen Verdächtigungen die Spitze abgebrochen — die schon geladenen Panzergeschütze der Gegner mußten ihre verschluckten Rationen höllischer Kraftnahrung wieder von sich geben — glücklicherweise ohne den damit beabsichtigten Knalleffekt. Friedlich, wie die sonnengeküßten, tiefblauen Fluten der Bai von La Guayra an der Küste Venezuelas glätteten sich die Wolken am politischen Horizont, die Falten auf den Stirnen der Staatenlenker — Fritz Oldenburger konnte den Doppeltaster des Überseeapparates ein Weilchen in Ruhe lassen, auch e r hatte seinen Frieden mit Amerika gemacht.
Träumerisch sahen die sonst so scharfen und sicheren Augen des jungen Beamten in die Weite. Ja, es waren schwere Wochen, bittere Tage eiserner Anstrengung für ihn gewesen; aber es war doch auch ein erhebendes Bewußtsein, daß man ihm, dem jüngeren, den wichtigen Depeschendienst übertragen hatte vor soviel älteren Kollegen.
Und ein noch viel süßeres Bewußtsein für unsern Fritz, zu wissen, daß er nun doch nicht aus Dienstrücksichten seine eigene, persönliche Angelegenheit aufzuschieben brauchte — seine Vermählung mit Grete Schönthal.
Gretel! — Die Züge des jungen Mannes wurden weich, und über die Augen ging es wie ein Leuchten... Sein Gretel — nun bald sein Weib! —
Wie treu hatten sie zu einander gehalten, all die Jahre hindurch, und es waren nicht lauter Maientage für sie gewesen! — wie wenig war es ihnen vergönnt gewesen, was andere Liebesleute als selbstverständlich betrachten, sich oft zu sehen, oft zu sprechen!
Aber nun, nun bald...
Fritzens Hand faßte, wie in vertrauter Gewohnheit, nach einer Berlocke an seiner Uhrkette — einer Haselnuß in Silber gefaßt — und die schlichten Verse eines treuen Freundes gingen ihm durch den Sinn:
»Getrost! Wie nun am Haselstrauch
Die Nüsse all gedeihen,
So schenkt dereinst der Himmel auch
Das reife Glück euch Zweien!«
Ja, sein Glück war endlich reif geworden im Sonnenschein der Liebe; der Sturmhauch der Herbst- und Wintertage hatte ihm nichts anzutun vermögen — und der erste Januar des neuen Jahres sollte auch der erste Tag im neuen Heim werden, in dem er nicht mehr einsam vor seiner Kaffeemaschine zu sitzen brauchte, in dem eine weiche, geschickte Hand ihm die Tasse füllen würde, ihn halten und hegen würde, traulich und fraulich, die Hand seiner Grete.
... Da ertönt der telegraphische Wecker vom Hughes-Apparat, der die Verbindung mit Berlin vermittelt — Fritz schrickt zusammen, mechanisch schaltet er den Empfänger ein und läßt den bedruckten Telegrammstreifen durch die Finger gleiten. Er muß sich zusammennehmen; er fühlt, die Ermattung kommt nun erst nach, mühsam bringt er die übermüdeten Augen zum Lesen...
Um des Himmelswillen — was soll das heißen?
»Vom 1. Januar kommenden Jahres tritt überall das Gesetz der Fern-Ehe in Kraft, mit dem Zusatz, daß vom heutigen Tage bis zum Tage des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen keine Ehe nach dem alten Modus mehr geschlossen werden darf.
§ 1 des Gesetzes über die Fern-Ehe bestimmt, daß die beiden Ehegatten einander nur geistig angehören dürfen. Jeder Versuch, einer Umgehung dieser Vorschrift fällt unter die weiter unten folgenden Strafbestimmungen.
»§ 2 bestimmt, daß zur sicheren Erreichung des im vorigen Paragraphen genannten Zweckes zwei Ehegatten nie an demselben Orte zusammen Wohnung nehmen dürfen — —«
— Fritz ist wie wahnsinnig aufgesprungen — mechanisch klappert der HughesApparat weiter, mechanisch setzt das Typenrad Buchstaben an Buchstaben, wie eine Schlange häuft sich das Papierband auf dem Fußboden an — Fritz achtet nicht mehr darauf. Er hat den fiebernden Kopf an die Wand des Zimmers gelehnt: vergebens sucht er die Tränen zurückzuhalten...
Da fühlt er eine feste Hand auf seiner Schulter. Er dreht sich um — sein Freund und Kollege Mohwecke steht vor ihm.
»Nun mein alter Junge, die Arbeit ist dir doch wohl zuviel geworden —« Damit führt ihn der Freund zu einem Stuhle und rückt sich selbst den zweiten heran, dabei vorsichtig den endlosen Knäuel des noch immer aus dem klappernden Apparate abrollenden Papierstreifens aus dem Wege schiebend —
»Laß das Zeug liegen, bis nachher, Fritz! Wir wissen ja doch, um was es sich handelt!«
»Ich bitte dich, Mohwecke — du siehst mich in fürchterlicher Aufregung über dies neue Ehegesetz —«
»Ja, ja, ich glaube es dir, du warest immer ein solch begeisterter Anhänger der Einrichtungen verflossener Jahrhunderte.«
»Erlaube mal —«
»Ich weiß, was du sagen willst: Gewiß ist auch in unserm Zeitalter noch nicht alles vollkommen; aber die Fern-Ehe ist entschieden ein großer Fortschritt auf kulturellem Gebiete, der sich unsern sonstigen Errungenschaften wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Art würdig zur Seite stellt.«
»Unsere sonstigen Errungenschaften —«
»Ich denke doch, das Jahr 2403, in dem endlich die Fern-Ehe zur Einführung gelangt, wird unverlöschlich bleiben in den Annalen der Menschheit! —«
»Ach Mohwecke, scherze nicht! 2403 — das ist ja Unsinn!
»Lieber Freund, ich gebe dir, wie so oft schon, sehr ernstlich den Rat, deine Kulturstudien über das verflossene Jahrtausend einzustellen! Wahrscheinlich hast du, bei aller Anspannung deiner Nerven im Telegraphendienst, wieder deine wenigen Freistunden deinem Steckenpferd, der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts gewidmet und verwechselst gar schon die Gegenwart mit der Vergangenheit! — Ich warne dich, mein lieber Fritz! — Gleich nachher gehe ich mit dir in das physiologische Laboratorium, um deine Gehirnzellen mit kondensiertem Äther durchströmen zu lassen! Du bist es deiner Braut schuldig, dich gesund zu erhalten —«
»Ach woran erinnerst du mich? — Meine Braut« —
»Lieber Fritz, sei in deiner Vorliebe für mittelalterliche Gebräuche nicht ungerecht gegen deine Zeit! Die Fern-Ehe erhebt einfach die Anschauung zum Gesetz, die schon von den fortgeschrittenen Geistern der verflossenen Epoche als allein der Menschheit würdig erkannt und in ihren Kreisen eingeführt worden war —«
»Mohwecke, lieber Freund, wenn du wüßtest, wie es in meinem leeren Herzen aussieht! — Hilf mir ein wenig mich zurecht finden —«
»Gern, mein alter Junge! — Du weißt so gut, wie ich, daß vom zwanzigsten Jahrhundert an durch Einführung verkehrter Methoden die BacillenSeuchen die Menschen stark dezimiert hatten —«
»Ich weiß es nicht, aber du sollst recht haben!«
»Schon in jener Zeit erhoben sich Stimmen, welche in den veralteten, vielfach animalischniederen Umgangsformen der Menschen eine immerwährende Gefahr für die Gesunderhaltung unserer Gattung erblickten; erinnere dich, daß beispielsweise sich in jenen Tagen in Amerika ein nach Tausenden zählender Verein von Frauen und Jungfrauen bildete, der seinen Mitgliedern aus sanitären Rücksichten das Küssen verbot —«
»Ja, ich erinnere mich —«
»Dazu kam in den folgenden Jahrhunderten die völlige Emanzipation der Frau, die Gleichstellung der Geschlechter auf jedem wissenschaftlichen und sozialen Gebiete, welches das männliche Geschlecht bis dahin als seine Domäne gepachtet hatte. Der mittelalterliche Zweck, oder besser gesagt, Nebenzweck der Ehe für das weibliche Geschlecht fiel also völlig weg, die Versorgung, das ›Unter die Haube bringen‹, wie ja wohl der altertümliche Ausdruck dafür lautete. — Die häßlichen Nebenerscheinungen zur Erreichung jenes Zieles, die auf die Spitze getriebene Gefallsucht der jungen Mädchen, die Extravaganzen in Toilette und Allure — der Männerfang — fielen damit fort: das Weib — auf sich selbst gestellt, sich selbst genug im reichgestaltigen Dasein, zufrieden und beglückt in der hingebenden Erfüllung seiner Pflichten im Dienste des Staates und der Wissenschaften, das Jahrtausende hindurch dem männlichen Egoismus in seinen brutalsten Formen preisgegebene Weib — war endlich frei geworden!«
»Aber, lieber Mohwecke, ich meine doch, — die Erhaltung unserer Gattung, — die Elternfrage — verzeihe die altfränkische Anwandlung aus dem zwanzigsten Jahrhundert! — die edelste Blüte menschlichen Gefühls, die Liebe zum eignen Kinde, die Liebe des eignen Kindes — die Begriffe: Vater und Mutter, mit ihrem ganzen Königreich an Gemüt —«
»Lieber Fritz, du berührst damit die Punkte, die der Einführung der Fern-Ehe lange Jahrzehnte hindurch im Wege gestanden haben; aber zum Glück hat auch hier die Wissenschaft Wandel geschaffen —«
»Die Wissenschaft? Ich verstehe dich nicht!«
»Ja, die Wissenschaft! Ihr verdanken unsere Urgroßeltern die synthetische Darstellung der Nährstoffe des Tier- und Pflanzenreiches im Laboratorium; ihr verdankt unsere Zeit den homo chemiae, den chemisch-erzeugten Menschen!«
»Chemisch-erzeugte Menschen, lieber Mohwecke?«
»Ja — oder kennst du etwa nicht unser Staatslaboratorium, unsere anthropologischchemische Anstalt, wie sie in jeder größeren Stadt sich findet? Kennst du nicht unsere staatlichen Säuglingsheime mit ihren großartigen hygienischen Einrichtungen? In der Pflege und Erziehung all der jungen Menschenkinder finden auch alle die Männer und Frauen Beschäftigung, die in sich den Beruf des Menschen-Erziehers fühlen und staatlich darin ausgebildet worden sind!
Wieviele Mißgriffe und Torheiten in der Kindererziehung werden durch diese Staatserziehung seitens privilegierter Väter und Mütter — ich brauche die Ausdrücke in unserm modernen Sinne, nicht im animalischen — zum Segen der Kinder vermieden! Die Schulen des Altertums und des Mittelalters waren ja ein erster Versuch zu unsern jetzigen Einrichtungen; aber sie gingen eben nicht auf den Grund der Sache.«
»Weißt du etwas über die Herstellung des homo chemiae?«
»Das ist Staatsgeheimnis! Aber nun diese Anstalten bestehen, erkennen wir erst den wahren Segen, der in der genialen Erfindung unseres Doktor Pieseke, des Oberleiters sämtlicher anthropologisch-chemischen Institute, verborgen ist. Wir haben es jetzt in der Hand, die Bevölkerungszahl dem jeweiligen Bedürfnis und dem Staatsinteresse anzupassen; der Fluch der Überbevölkerung, mit dem das Staatswesen früherer Jahrhunderte belastet war, ist uns nur noch aus der Geschichte bekannt. Und auch für den Einzelnen, für das menschliche Individuum selbst ist die Erfindung Piesekes eine Wohltat geworden: Das Gespenst der erblichen Belastung, das früher ganze Generationen vergiftete, die Vererbung der Sünden der Väter auf ihre schuldlosen Kinder ist für alle Zeiten aus der Menschheitsgeschichte verbannt! Normale Menschen erzeugen unsere Staatslaboratorien aus den edelsten chemischreinen Urstoffen der Eiweißkörper, hochprozentig an potentieller Energie, mit feinkonstruierten Gehirnen von höchstem Phosphorgehalt — gesetzlich n o r m a l mit einem Worte!«
»Aber lieber Freund, — ich bitte nochmals um Entschuldigung für meine altmodischdumme Frage — aber die Sympathie zwischen Mann und Weib, all die tausend Regungen des Gemüts, das Miteinanderleben, Zueinanderfinden, Aneinanderhalten, auch mit einem Worte: die L i e b e — wo bleibt sie in eurer Fern-Ehe?«
»Nun — haben wir dazu nicht unsern T e l e p a t h e n , die großartige Erfindung des durch sein konstruktives Genie weltberühmten Ingenieurs Paulmüller — jedes Kind in Europa kennt den Mann — der in e i n e m Apparat den Fernsprecher oder das Telephon deines zwanzigsten Jahrhunderts mit dem Fernseher des zweiundzwanzigsten und dem eigentlichen Fernfühler des fünfundzwanzigsten Jahrhunderts vereinigt? — Wie das Telephon deines so geliebten zwanzigsten Jahrhunderts jedes Wort des Sprechenden, ja die Klangfarbe, die Tonmodulierung jedes Lautes wiedergab, so überträgt der elektrische F e r n s e h e r jeden Zug seines Antlitzes, jedes noch so schnelle Spiel seiner Mienen, den ganzen persönlichen Eindruck seiner Gestalt auf tausende von Kilometern; so giebt der F e r n f ü h l e r Paulmüllers jede Nuance unseres Gefühls, vom freundschaftlichen derben Händedruck bis zum zarten Anhauch der Geliebten, die brüderliche Umarmung wie den süßen Kuß der Braut getreulich und vor allem, hygienisch einwandfrei: aseptisch und bacillenlos! dir zurück — —.«
Ganz niedergeschmettert von den Ausführungen seines Kollegen saß Fritz da. Wo waren seine Hoffnungen, seine goldenen Träume geblieben vom eignen Heim, von seinem herzigen Frauchen?...
»Dazu ist es dem Erfinder neuerdings gelungen«, hob Mohwecke wieder an, »mit seinem T e l e p a t h e n eine K o n s e r v a t o r t r o m m e l zu verbinden, die, ähnlich, wie der Phonograph früherer Jahrhunderte, gestattet, Sprache, Bild und Gefühl zu fixieren, um sie jederzeit wieder rekonstruieren zu können.
Wie unsere Ur-Urahnen sich ergötzten an kinematographisch-phonographischen Vorführungen, so vermögen wir heute in vollkommener Treue zu jeder Stunde uns die Erinnerung an eine uns teure Person mit dem ganzen Reiz und Zauber des ersten Eindrucks auf Gesicht, Gehör und Gefühl durch den Konservator Paulmüllers zurückzurufen. Leben wir nicht in einer herrlichen Zeit, lieber Fritz?«
»In einer herrlichen Zeit«, rief Fritz gequält aus, »aber ich, ich Unglücklicher, passe nicht mehr hinein! Sage mir, Mohwecke, was erreicht ihr denn mit eurer gepriesenen Fern-Ehe in ihrer Verbindung mit dem wunderbaren Telepathen, was wird aus der Ehe?«
»Ein ewiger Brautstand, lieber Freund, also eine Zeit dauernder Glückseligkeit — eine ideale, rein geistige Gemeinschaft der Geschlechter —«
»Aber, lieber Kollege Mohwecke, meinen letzten Einwand wirst du mit deinen neumodischen Errungenschaften doch nicht widerlegen können: Bist du selbst nicht nach a l t e m Stil verheiratet, und bist du nicht von Herzen glücklich mit deiner Frau?...«
«... Gewiß, mein alter Junge — was sprichst du da für sonderbare Dinge?«
— Freundschaftlich schlug Mohwecke, der eben ins Zimmer getreten war, um seinen Kollegen Oldenburger abzulösen, dem aus tiefem Schlummer der Ermattung auffahrenden Freunde auf die Schulter — »Gewiß, ich bin von Herzen glücklich mit ihr und wünsche dir zum Weihnachtsfeste das Gleiche —«
»Mohwecke, Freund — wann bist du gekommen«, rief Fritz aufspringend dem Kollegen zu.
»Jetzt eben — und fand dich in tiefem Schlafe, dabei kurioses Zeug schwatzend —«
»— Also alles nur ein Traum, ach, alles ein verwünschter Traum — Keine Fern-Ehe! Hurra, keine Fern-Ehe! — Keinen leblosen Telepathen — keine elektrische Konservatortrommel —«
Wie ein übermütiger Knabe umfaßte Fritz seinen verdutzt dreinschauenden Freund und tanzte mit ihm im Zimmer umher, daß die schon vorher verwirrte Schlange aus Depeschenband zu einem schier unlöslichen Knäuel zusammengedreht wurde —
»Keine Fern-Ehe — keine Fern-Ehe! Ach, Mohwecke, was bin ich glücklich, glücklich!«
Kaum vermochte sich Mohwecke der stürmischen Umarmung unseres Fritz zu entwinden — mit einem plötzlichen Ruck riß er sich aber los —
»Mann, der Hughes arbeitet ja noch immer! Ist denn das immer noch Telegramm, oder läuft bloß der leere Papierstreifen ab?«
Mohwecke sprang an den Apparat und ließ den Streifen durch die Finger gleiten — er war noch immer bedruckt!
»Himmel, was ist denn da in Berlin passiert — ›Schlußsitzung zur Zolltarifvorlage —‹ Heiliger Stephan! das kann ja nett werden! — Sei froh, Fritz, daß du Urlaub zur Hochzeit hast! — Reise nur gleich ab, mein Alter! Ich wünsch' euch fröhliche Weihnachten! — Und dann — mit Gott ins neue Jahr, ins neue Heim und ins neue Leben — und grüß' mir die Gretel!« —
Ein schöner Name für eine häßliche Sache; denn Scarlatina ist die medizinische Bezeichnung für das Scharlachfieber... Klein-Carly hatte die böse Krankheit zuerst erfaßt. Wie brannten seine kleinen Bäckchen, dunkelglühende Rosen!
Nirgends fand der kleine Mann Ruhe; immer und immer wieder, stundenlang schrie er nach seiner Mama, die doch ihn noch gestern unermüdlich auf dem Arme getragen und das schöne Lied gesungen: »Su, su, sei-chen kocht dem Kind ein Ei-chen« —
Denn die Scarlatina hatte ja auch seine liebe, süße Mama überfallen, als diese, sich selbst vergessend, ihrem Liebling einen Kuß auf die fieberheißen Lippen gedrückt. — Nun lag sie — fern von ihm — im Bett, und immer und immer wieder verlangte Klein-Carly nach ihr und nach seinem Schlummerliedchen — bis die Tante Martha an seinem Bettchen erschien. Die hatte keine schwarze Haube und schwarze Kleider, wie die fremden Frauen, die seit gestern immer an seinem fiebernden Blick vorübergegangen waren, die kannte er schon seit seinen ersten Lebenstagen, die spielte immer so schön mit ihm und konnte fast ebensoschön, wie die Mama, das Zauberlied singen: »Su, su, sei-chen«...
— O, du goldene Tante Martha! Ein Engel der Liebe bist du allezeit gewesen — und warest es dreifach in der schweren Zeit! O, daß du wiederkämest, wiederkommen könntest!...
Acht Tage nach der Erkrankung seines schlanken, blonden Frauchens mußte sich auch der Hausherr ins Bett legen, der sich in all den schweren Stunden und Tagen immer noch aufrecht gehalten hatte.
Dr. Steidler kam und warf nur einen Blick auf seinen neuen Patienten —
»Scarlatina!«, sagte er. »Aber behalten Sie Mut, lieber Freund! Ihr Anfall scheint leichter Natur — und Sie werden schnell damit durch sein! Ihr Frauchen macht mir größere Sorge —«
»Wie denkt sich die medizinische Wissenschaft eigentlich den KrankheitsProzeß beim Scharlachfieber, Herr Doktor?«
»Es herrschen darüber immer noch geteilte Meinungen. Am verbreitetsten ist gegenwärtig wohl die Annahme, daß die Scarlatina bacillärer Natur ist. Man glaubt auch den Krankheitserreger gefunden zu haben, der betreffende Spaltpilz heißt Streptokokkus« —
»Und wie denkt man sich den Vorgang der Genesung? Kann ihn die Wissenschaft unterstützen oder beschleunigen?«
Der Doktor zuckte ein wenig mit den Schultern —
»Die Genesung besorgt dabei die Natur allein. Wir können nur die äußerlichen Begleiterscheinungen, z.B. das hohe Fieber, etwas herabdrücken. Die Theorie nimmt bekanntlich an, daß, veranlaßt durch die Tätigkeit der Streptokokken, im menschlichen Blute Gegengifte entstehen, sogenannte AntiKörper, welche der weiteren verheerenden Tätigkeit und Vermehrung der Bacillen die Nahrung und damit den Boden ihrer Existenz entziehen und so den Heilungsprozeß einleiten! — Aber damit zerbrechen Sie sich, um Himmelswillen, jetzt den Kopf nicht — und, wie ich schon sagte, machen Sie sich nicht allzugroße Sorge und unnütze Gedanken! Mit Gottes Hilfe sind Sie heute über vier Wochen alle drei wieder frisch und gesund! Adieu für heute und — Kopf hoch!«
Der allzeit bereite, unermüdliche junge Arzt, der treue Freund des Hauses, reichte ihm die Hand und ging ins Nebenzimmer, um noch einige Anordnungen wegen seines dritten Patienten zu treffen...
Am andern Tage fand der Arzt den Hausherrn zwar fiebernd, aber die Krankheitssymptome im übrigen normal.
»Wenn doch Ihr Frauchen mir auch so wenig zu sorgen gäbe. Aber — so tapfer und brav sie sonst ist — so mutlos und verzagt ist sie jetzt, und schon seit einer Woche! Wenn ich komme und sie mit gutgemeinter Ungeduld ein wenig aufrüttele, versucht sie ja, wie sonst zu lächeln aber bei meinem Herausgehen sehe ich dies bange, mutlose Gesichtchen immer wieder! — Wenn Sie ihr doch Mut zusprechen könnten —«
»Vielleicht könnte mein Bett in ihr Zimmer —«
»Das möchte ich nicht gern, Ihretwegen. Sie würden sich viel zu sehr aufregen, lieber Freund, und es der Schwester Johanna, die Ihr Frauchen mit einer Liebe und Aufopferung pflegt, wie sie sich selbst bei einer Diakonissin nicht häufig findet, noch schwerer machen —«
»Wenn ich meinem Lottchen ein paar Zeilen schriebe —«
»Das würde sie gewiß ein wenig aufmuntern!«
»Vielleicht ein paar Verse —«
»Aber nicht den Kopf dabei zu sehr anstrengen! Sie haben ohnedies heute mehr Fieber als gestern, hören Sie!«
»Nein — nein, Onkel Doktor, ich verspreche es Ihnen. — Und — wie geht es ›Klein-Carly?‹«
»Den Umständen nach — leidlich. Um den sorgen Sie sich nicht mehr so sehr — der ist bei seiner Tante Martha im Hinterzimmer sehr gut aufgehoben.«
Schwester Johanna hatte das Briefchen, das der kranke Hausherr ihr für sein armes, verzagtes Frauchen in die Hand gedrückt hatte, der lieben Patientin überbracht.
Und die armen, entzündeten Augen — sie wollte es selbst lesen, sagte sie der Schwester — lasen die Strophen:
Meinem kranken Lottchen!
Mein Weggenoß, nun noch nicht frisch und heiter?
Noch immer drückt der harte Sturm Dich nieder?
Wann regst Du deine schlanken Glieder wieder?
Auf, reiß' Dich los! Wir müssen aufwärts, weiter!
Wie? — Da es schwer und qualvoll war zu steigen,
Wie bist du jung und kühn mir vorgegangen —
Wie hat mein Aug' mein junges Glück umfangen! — —
Und nun soll all' dein tapferes Hoffen schweigen?
Rasch — raff' Dich auf! Dem Mutigen die Preise!
Kein Zaudern mehr — gieb mir die Hand, die liebe —
Denn ohne dies Juwel mir n i c h t s verbliebe!
Und nun empor zur s c h ö n e r n Lebensreise!«
Am andern Tage lag der Hausherr in hohem Fieber. Bedenklich schüttelte Doktor Steidler den Kopf beim Ablesen des Maximalthermometers —
»Über vierzig Grad«
Er sprach leise mit der Schwester.
»Er phantasiert öfter«, sagte sie.
Der Arzt rief den Patienten an. Auf Augenblicke wurde seine Besinnung wieder klar, er erkannte an seinem Bett das gütige, jetzt sorgenvoll aussehende Gesicht des Doktors und die treue Schwester Johanna. Er versuchte, den beiden zuzulächeln — aber im nächsten Augenblick legte sich wieder ein Schleier über seine Augen, der die Außenwelt seiner Wahrnehmung entzog.
Aber eine innere Welt, ein Mikrokosmos in vollem Sinne des Wortes, war ihm dafür aufgegangen...
»Wenn man doch in sich hineinschauen könnte!«, dachte er, »wenn man die Vorgänge in seinem eignen Organismus selbst beobachten könnte! Ob das überhaupt nicht möglich ist? Es hat es freilich wohl bis jetzt noch niemand versucht. Aber wie man allerlei Geräusche im Inneren des Körpers vernehmen kann, das Knirschen der Zähne z.B., die garnicht von außen auf das Trommelfell wirken, so könnte man vielleicht auch den Sehnerv durch innerhalb des Kopfes liegende Objekte zur Wahrnehmung zwingen — —«
Wieder lag er eine Weile, und das Blut hämmerte in seinen Schläfen, und vor seinen Ohren brauste es wie das Rauschen eines Wasserfalles.
»Ob ich's nicht einmal versuche? Wenn ich recht intensiv mein geistiges Auge auf mein Inneres, vielleicht einmal auf das Innere des Gehirns selbst sich zu richten zwänge?«
Und er raffte alle seine Energie zusammen — und nun?
Seltsam geformte, labyrinthisch verschlungene Höhlenbildungen sah er vor sich von eigentümlich graurötlicher Farbe — wie einen seltsam verzweigten, unterirdischen Tunnelbau —
Wunderlich gekrümmte Bahnlinien durchzogen das seltsame Werk; aber diese Bahnen bildeten nicht Schienen, sondern elastische Röhren und ruckweise wurden die darin befindlichen Lasten weiterbewegt. Die Röhrenbahnen durchschnitten einander, verzweigten sich, den launischen Windungen der Tunnelbildung folgend.
Das Ganze war außerdem durchzogen von einem Gewirr weißer Telegraphendrähte, die alle nach einem bestimmten Centrum in der Tunnelhöhle zu laufen schienen —
Endlich wurde es ihm klar, was das seltsame Bauwerk sein könnte, das vor ihm lag — er sah die dem Sehzentrum zunächst liegenden Windungen seines Vordergehirns. Allerdings in mehrtausendfacher Vergrößerung — aber dies hatte seinen Grund wohl darin, daß diese Dinge nicht durch den optischen Apparat des Auges, sondern direkt auf den Sehnerv einen Reiz ausübten. Aber über das Wie dieses wunderbaren Vorgangs machte er sich jetzt keine Gedanken! Wenn ihm das gelungen war, vielleicht kam er dann durch Autosuggestion auch weiter — vielleicht gelang es ihm auch, seiner Krankheit auf die Spur zu kommen!
Woran war sein menschliches Bewußtsein gebunden? An eine bestimmte Stelle in der Nervensubstanz des Vordergehirns. Ob es möglich war, das seelische Empfinden von dieser lokalen Bindung abzulösen? Allerdings hatte es noch niemand versucht; — aber der erste Schritt zur Selbstbeobachtung war ihm ja auch gelungen!...
Wenn er sein seelisches Bewußtsein an ein Blutkörperchen z.B. heften könnte! Wenn der philosophische Satz wahr ist, daß jedes Wesen das Maß der Dinge aus sich selbst nimmt, dann würden sich seine Vorstellungen von Raum und Zeit allerdings millionenfach vergrößern; denn in einem Blutströpfchen schwimmen ungefähr vier Millionen solcher Körperchen und jedes von ihnen glaubt gewiß, es bewege sich frei im großen Weltmeer!
Was er durch diese Metamorphose gewönne? Er würde dadurch ein Wesen von der Größenordnung jener verwünschten Scharlachbacillen, der Streptokokken, aber ein beseeltes Wesen, das vielleicht durch seinen Intellekt einen Einblick erhielte in das Leben und Treiben jener Krankheitserreger — —
Also noch einmal seine gesamte Willenskraft zu konzentrieren galt es — einen einzigen Gedanken galt es festzuhalten mit ganzer seelischer Energie: Ich will mein Bewußtsein auf ein Blutkörperchen übertragen, ein Blutkörperchen sein! — — — — —
Und nun ein Augenblick haltlosen Schwebens im Unendlichen, ein quälendes Gefühl des Verlorenseins im Raum, ein Schwanken aller Begriffe und Vorstellungen — — und dann ein Auftauchen aus einem Nebelmeer — ein Wiedererwachen des Bewußtseins!
Er schwamm in einem unendlich breiten Strome, dessen Wasser eine etwas gelbliche Färbung zeigte. Einige Meter von ihm entfernt schwamm ein ebensolches Wesen und er konnte es wie sein Spiegelbild betrachten: eine flache kreisrunde Scheibe, blutrot gefärbt, mit einer kraterförmigen Vertiefung in der Mitte, das ganze Gebilde schön symmetrisch gebaut. Und wie herrlich war dies Schweben im uferlosen Meere! Immer in langen Zeiträumen erfaßte ihn ein eigentümlicher rhythmischer Wellenschlag und hob ihn eine gewaltige Strecke vorwärts.
Zufällig berührte er dabei einmal eine neben ihm schwimmende Scheibe.
»Ich will sie anreden«, dachte er — und sagte laut:
»Verzeihe, lieber Nachbar, daß ich dich angestoßen habe!«
Die rote Scheibe drehte sich ein paarmal um sich selbst und schwamm gleichgültig weiter.
Er versuchte mit einer andern ein Gespräch anzuknüpfen, ebenso erfolglos. Das gleiche Schicksal hatte er bei der dritten.
Sie schienen stumm zu sein wie die Fische!
Und nur er allein unter den vielen, vielen Tausenden, die an ihm vorbeischwammen, hatte ein Bewußtsein und eine Sprache; denn — nun wußte er's! auch der zweite Versuch der Autosuggestion war ihm gelungen: er bewohnte ein rotes Blutkörperchen und beseelte es mit seinem menschlichen Empfinden, er war billionenmal kleiner geworden an seiner äußeren Gestalt — aber sein geistiges Ichbewußtsein war ihm unverkürzt geblieben. Nur das Maß der äußeren Eindrücke war nach seiner jetzigen Größe geändert. Er schwamm als vereinzeltes Körperchen im Strome einer der Pulsadern, die seinen Körper durchzogen...
Lange Zeit war er so mit den andern Hämoglobinkörperchen dahingetrieben worden — das ewige Einerlei seiner stummen, teilnahmslosen Nachbarn begann ihn zu ermüden. Er hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, etwas Neues zu erleben —
Da tauchte dicht vor ihm eine neue Erscheinung auf: Eine Reihe glänzender Körper, in Form und Aussehen großen Glasstäben ähnlich, die quer zur Längsachse mit zahlreichen Einschnürungen versehen waren, kam dem Strome der Blutkügelchen entgegen. Sie hielten sich mit feinen Haftfäden dicht aneinander geschlossen, wie eine Phalanx: die Blutkörperchen mußten, vom Pulsschlag getrieben, zwischen ihnen hindurch.
Nun waren sie ihnen ganz nahe, und er hörte eine wispernde Stimme sagen:
»Achtung, ihr Kinder des großen Streptokox! Da ist der Feind! Klammert euch fest mit den Fangarmen an die Bluträderchen! In der Vertiefung haben sie ihre schwächste Stelle« —
Die glänzende Stäbchenphalanx senkte die mit Haftfäden bewehrten Spitzen gegen die heranschwimmenden Blutkörperchen.
Da rief dieselbe Stimme wieder: »Nicht an diese hellrote wagt euch!«
»Warum nicht, Streptokokkus major?«, fragte einer der Vordersten aus der Schar.
»Weil ihre Zellmembran noch zu fest und zu kräftig ist, als daß ihr eure Haftfäden hindurchbohren könntet! Die dunkelroten nehmt zum Ziel: sie sind alt und schwach!«
Dem Befehle gehorsam, ließen die Streptokokken, — denn sie waren es, die heimtückischen Träger des Scharlachfiebers! — von dem beseelten Blutkörperchen ab, das sie einen Augenblick schon mit einem dichten Netz ihrer Fäden umschlungen hatten, und suchten sich andere Beute...
»Streptokokkus minor!«, rief der vorige Anführer einen der kleinsten und beweglichsten Bacillen zu sich heran. »Ich übertrage dir hiermit die Aufsicht über diese Kolonie. Ihr werdet in dieser Blutströmung noch eine lange Zeit Nahrung finden. Ermahne die Genossen immer wieder, daß sie nur die dunkelroten Bluträder überfallen, nicht die andern, hörst du!«
»Ich höre, Meister!«, sagte der Streptokokkus minor.
»Wenn ich wieder hierherkomme, werdet ihr eure Legionen wohl schon verzehnfacht haben! Ich eile weiter, um nach dem Befehle unseres Urvaters, des Streptokox Maximus, noch an anderen Stellen dieses NährOrganismus Kolonien zu organisieren. — Wenn ich wiederkomme, lieber Streptokokkus minor, will ich dir auch sagen, welches der geheime und wahre Grund ist, weshalb der Angriff auf einen hellroten Blutkörper von unserm Oberhaupte allen seinen Sprößlingen und Untertanen verboten ist! Gehab dich wohl! Wachse und gedeihe!«
Damit entschwand der Anführer der Beobachtung des beseelten Blutkörperchens, das den Intellekt des kranken Hausherrn trug. — Rings um sich aber sah er mit Grausen das Werk der Zerstörung, das die Streptokokken an den Blutkörperchen vollführten. — Sie alle, die vor kurzer Zeit noch voll und straff und rund neben ihm hergeschwommen waren, schrumpften unter dem Angriff der Stäbchen zusammen, die sich mit ihren Haftfäden in ihre Vertiefungen einnisteten. Mit Entsetzen bemerkte er, daß die Angreifer auf Kosten ihrer Opfer an Länge und Stärke zusehends wuchsen — er sah, wie eine der langen, durchsichtigen Walzen, deren Querschnürungen besonders tief ausgebildet waren, mit einem Male in lauter kleine Walzen zerfiel, die — vollständig ausgebildet und lebensfähig — ihre schnell hervorschießenden Haftarme an neu herankommende Blutkörperchen anklammerten.
Obwohl der Streptokokkus major die Kolonie verlassen hatte, schien unter der Leitung seines Stellvertreters doch alles seinen bisherigen Gang weiter zu gehen. — Nach und nach aber erhob sich doch ein Murmeln und Raunen unter den Zurückgebliebenen. Die Zufuhr neuer dunkelroter Blutkörperchen reichte für die kolossale Vermehrung der Streptokokken durch Spaltung in Einzelwesen kaum noch aus. Zwischen den ausgesogenen, formlos gewordenen Blutkörperchen schwammen jetzt die hellroten, unberührten doppelt verlockend einher.
»Warum dürfen wir nicht die schönen, wohlgenährten, hellroten Scheiben angreifen?«, fragten einige.
»Ihr habt's ja gehört«, wiederholte der Streptokokkus minor, »weil unsere Haftfäden an ihren festen Membranen zuviel Widerstand finden!«
»Wer's glaubt!«, munkelten andere dazwischen. Und immer lauter wurde das Raunen und Murren, und immer unzufriedener die Schar!
»Wißt ihr was, Genossen?«, rief nun plötzlich einer der Bacillen, ein riesiger Geselle, dessen Körperenden mit dicken, knolligen Wülsten versehen waren und der deshalb Streptokokkus bulbosus genannt wurde, —»ich glaube nicht an den ganzen Schwindel mit der Unverletzlichkeit der hellroten Bluträder! Vielleicht will der Streptokokkus major sie nur als feineren und fetteren Bissen für sich und seine Sippe aufsparen! Wer wagt's mit mir, sie anzugreifen? Vorwärts, Kameraden! ›Hellrot‹ sei unser Panier!«
Vergebens suchte der pflichteifrige Streptokokkus minor die Verwegenen von ihrem tollen Vorsatz abzubringen — er wurde bei Seite geschoben, und die ganze hungrige Schar mit wenigen Ausnahmen stürzte unter der Anführung des Streptokokkus bulbosus auf die hellroten Hämoglobinkörper los...
Auch das Blutkörperchen, das vom Bewußtsein des Menschen beseelt war, wurde angegriffen.
Mit Grausen dachte es an das Schicksal, das seiner wartete, wenn es den Nährboden für seine Eindringlinge abgeben müßte, die ihm all seiner Kräfte und Säfte berauben würden.
Lange Zeit mühten sich die Streptokokken vergebens ab, mit ihren Haftarmen die straffe, elastische Membran seiner Zellwände zu durchdringen — lange Zeit vergebens! Schon ließen einige der eifrigsten ab, weil ihre Kräfte erschöpft waren, endlich aber gelang es doch dem einen von ihnen, sich in die Zellwand einzubohren
Da fühlte das mit Bewußtsein begabte Blutkörperchen, wie es von einer heftigen Bewegung ergriffen wurde. Kräfte wurden in ihm lebendig, die es nie in sich vermutet hatte. Es begann sich zusammenzuziehen, und auszudehnen, um die Moleküle seines Körpers in Aktion treten zu lassen, und geriet dabei in heftige Rotation...
Dabei stieg die ihm innenwohnende Blutwärme ganz bedeutend. Die von ihm befürchtete Schrumpfung und Erschlaffung, die es an all den dunkelroten Körperchen seiner Umgebung bemerkt hatte, trat nicht ein — wohl aber ein Wachstum seines Zelleninhalts! Und endlich bemerkte es an all den Stellen, wo die Haftfäden der Streptokokken die Membram durchbohrt hatten, eine Bildung von kleinen, gelblichen Zellen, die zusehends an Größe zunahmen, indessen die anhaftenden Streptokokken schlaff und gestaltlos zu werden begannen...
»Wer seid ihr, ihr kleinen, niedlichen Dingerchen?«, fragte das Blutkörperehen die neugebildeten Lebensformen.
»Wir sind die Antistreptonen!«, riefen sie — »wir vergiften die Streptokokken mit unserm Serum!«
»O, so seid gesegnet, dreimal gesegnet für euer Erscheinen! Aber werdet ihr auch nicht zu spät kommen? Unzählbar sind die Scharen der Bacillen in diesem Blutstrome!«
»Wir wachsen schneller und vermehren uns schneller! Sieh hinter dich! Siehst du die Milliarden helfender und heilender Antistreptonen! Jedes hellrote, junge und kräftige Blutkörperchen vermag Hunderte zu erzeugen! Zweifelst du noch daran, daß wir die heimtückischen Streptokokken besiegen werden?« —
— Nur eine kleine Gruppe lebensfähiger Streptokokken war von der großen Kolonie von vorhin noch vorhanden — die ungezählten andern schwammen als formlose, tote Materie dahin — — —
Da erschien der Begründer dieser einst so stolzen Kolonie wieder, der Streptokokkus major.
»Beim großen Streptokox!«, schrie er entsetzt, »was ist hier geschehen?«
»Erhabener Streptokokkus major«, sagte zaghaft und demütig der Streptokokkus minor, »all die verblendeten Genossen hörten nicht auf meine Warnung und griffen nach deiner Entfernung die hellroten Bluträder an — und das ist das Ende!«
»O die Unsinnigen! Sie mußten alle verderben! Das, lieber, treuer Streptokokkus minor, war das Geheimnis der hellroten Blutkörperchen, das ich dir in Gegenwart der andern nicht sagen wollte —«
»Sie hätten es doch nicht geglaubt!«, seufzte Streptokokkus minor — »sie dachten, du wolltest die frischen Blutkörper für dich selbst zur Nahrung behalten —«
»O, die Toren, die Selbstsüchtigen, verblendeten Toren! —«
»Teurer Streptokokkus major, was sind das für gelbe, rundliche Körper, die aus all den hellroten Bluträdern herauskamen? — dort kommen einige auf uns zu —«
»Schnell, hinweg von ihnen! Das sind unsere Erbfeinde, das sind die giftigen Antistreptonen! Wo sie die Überzahl gewinnen, ist unser Geschlecht verloren! — Komm mit mir, wir wollen den großen Streptokox im Herzen dieses Nährorganismus benachrichtigen, daß wir bereits eine große Zahl Antistreptonen gesehen haben — vielleicht weiß er, der unser aller Urvater und Herrscher ist, noch einen Ausweg für seine treuen Scharen!«...
Sie kamen zu spät, die beiden! Denn als sie im Kreislaufe des Blutes dem Herzen zugetrieben wurden, fanden sie ihn, den Streptokox maximus, als formlose Masse unter den Leichen seiner Getreuen...
Aber sie hatten keine Zeit mehr, die Totenklage über ihn und sein Geschlecht anzustimmen: eben nahte sich ihnen ein weißes Blutkörperchen, saugte den Major und Minor an sich, stülpte seine Membran gleich einem Sacke über sie und — verschlang sie.
Die Antistreptonen waren auf der ganzen Linie Sieger geblieben! — —
An andern Morgen erwachte der kranke Hausherr, fieberfrei mit klaren Augen —
An seinen Bette stand, freundlich lächelnd der treue Arzt, Dr. Steidler. »Nun«, — fragte er den Patienten »heute geht es doch bedeutend besser, nicht wahr?«
»Ja, ich danke, lieber Herr Doktor — aber — wie geht es meiner kleinen Frau?«
»Auch ihr geht es besser heute — die Antistreptonen beginnen die Übermacht über die Streptokokken auch bei ihr zu gewinnen —«
»Die Antistreptonen, Herr Doktor?« —
»Ja, lieber Freund — Sie haben mir ja selbst von ihnen in dieser Nacht erzählt!« —
»Ach, haben Sie gehört, was ich für Phantasien in Fieber gehabt habe?« —
»Zum Teil, ja! Sie haben ja einen förmlichen BacillenRoman zusammenphantasiert! Ihr armer Kopf! — Aber nun, hoff' ich, sind wir über den Berg!«
»Und wie — wie geht es unserm kleinen Carly, Herr Doktor?«
»Dem hat die Großmama, die gestern noch zur Pflege hier angekommen ist, heute früh schon die Rute zeigen müssen! Der wilde kleine Schelm war aus seinem Bettchen geklettert und saß im Hemdchen vergnügt und munter auf dem Schaukelpferd! — Der alte Gott hat allen Dreien geholfen — und so möge es immer bleiben!«
Telegramm an Herrn Professor William Ramsay, London.
»Anläßlich einer neu aufgenommenen Analyse der atmosphärischen Luft fand sich außer den Grundbestandteilen Sauerstoff und Stickstoff und den von Ihnen und Lord Rayleigh entdeckten Edelgasen Argon, Helium, Krypton, Xenon und Neon ein neuer Stoff, dessen Spektrum drei Linien im Violett aufweist. Bitte um Nachprüfung!
Erstes chemisches Institut der Universitat Berlin.
Dr. Kolbe.«
Acht Tage später fand im großen Hörsaal des chemischen Instituts der Berliner Universität eine Versammlung der bekanntesten Chemiker und sonstiger Männer der Wissenschaft statt, denen die Entdeckung des neuen Stoffes experimentell vorgeführt werden sollte.
Auf dem langen Experimentiertisch bemerkte man ein Gasometer, das mit reiner, kohlensäure- und wasserdampffreier Luft aus der Atmosphäre gefüllt war. In langsamem Strome passierte die aus dem Apparate strömende Luft zunächst ein Rohr mit glühenden Kupferspänen, hierauf ein solches mit glühendem Magnesium. Durch diese Metalle wurde der Sauerstoff und Stickstoff der Atmosphäre absorbiert. Den Gasrückstand reinigte man von dem aus dem Magnesium mitgerissenen Wasserstoff und Kohlenoxyd durch Verpuffung mit Sauerstoff im Eudiometer. Das sich hierbei bildende Wasser und die Kohlensäure wurde durch Passieren von Trocken- und Ätzkaliröhren beseitigt. Der nun chemisch reine Gasrest, der das Gemisch der fünf Edelgase Argon, Helium, Krypton, Xenon und Neon enthielt, wurde in flüssigem Wasserstoff zum Erstarren gebracht und behufs Trennung der einzelnen Elemente der fraktionierten Verdampfung im Vakuum unterworfen.
Der junge Privatdozent Dr. Kolbe, dem die Entdeckung des neuen fraglichen Elementes in unserer Atmosphäre geglückt war, hatte der illustren Gesellschaft die vorbereiteten Arbeiten bis zu diesem Punkte vorgeführt. Bei seinen Experimenten wurde er von einer äußerst geschickten Assistentin unterstützt, deren schlanke, weiße Hände gewandt die verwickelten und schwierigen Manipulationen der Analyse, das Abfangen der Gase über Quecksilber, die Verpuffung im Eudiometer usw. vornahmen.
Wohlgefällig hafteten die Blicke der anwesenden Gelehrten auf der Erscheinung des jungen Mädchens, dessen edles, etwas blasses Gesicht von dunkelbraunem, schlicht gescheiteltem Haar umrahmt wurde, das sich im Nacken zum einfachen Knoten schloß.
»Wie heißt die junge Dame?«, fragte einer der Herren, der seine Augen außer der Brille auch noch mit einem Kneifer bewaffnet hatte, seinen Nachbar.
»Wie sie heißt, weiß ich nicht; sie ist seit kurzer Zeit hier am Institut erste Assistentin —«, sagte der Nachbar zur Linken.
Nun wandten sich die bebrillten Augen an den Nachbar zur Rechten mit derselben Frage.
»Fräulein — Fräulein — warten Sie, Herr Kollege, es wird mir wahrscheinlich noch einfallen«, antwortete dieser...
Es kam nun der eigentliche Moment, der das neuentdeckte Gas den Zuhörern vorführen sollte. Bei so verschwindend kleinen Mengen, in denen die genannten Edelgase in der Atmosphäre vorkommen, ist die sicherste und charakteristischste die Untersuchung in den sogenannten Geißler'schen Röhren. Man schließt das zu prüfende Gas in eine solche Röhre ein, verdünnt es durch Auspumpen und läßt eine hochgespannte elektrische Entladung hindurchgehen.
Die von Professor Ramsay in Verbindung mit Lord Rayleigh gefundenen Edelgase der Atmosphäre Argon, Helium, Neon, Xenon und Krypton zeigten je nach ihrer Verschiedenheit ein verschiedenfarbiges Leuchten: die mit Argon gefüllte Geißler-Röhre leuchtete kornblumenblau, Helium sonnengelb, Neon prachtvoll rot, Xenon blau und Krypton hellblau. Alle diese Erscheinungen waren der Mehrzahl der hier versammelten Besucher seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bereits bekannt. Die nun an die Quecksilberluftpumpe angeschlossene sechste Röhre sollte endlich den neuen Stoff ihnen zum ersten Male zeigen, das Gas X...
Der junge Privatdozent machte eine kleine Pause in seinem Vortrage, um der Assistentin bei den etwas umständlicheren Vorbereitungen für das letzte Experiment selbst behülflich zu sein. War es die immerhin erklärliche Aufregung — es schien ihm, als ob ihre sonst so sicher arbeitende Hand zitterte, als sie die Verbindung mit der Luftpumpe herstellte. —
Er trat dichter an sie heran. »Es ist doch alles in Ordnung?«, fragte er leise. »Ich denke, Herr Doktor — nur scheint mir der Gasrest, der den neuen Stoff enthält, sehr gering —— Sehen Sie doch!«
Dr. Kolbe sah nach dem Eudiometerrohr, aus welchem das über Quecksilber abgesperrte Gas in die luftleer gemachte Geißler'sche Röhre eintreten sollte. —
»Mein Gott — das sieht ja aus, als hätten wir überhaupt keinen Gasrückstand mehr im Rohr! Was ist das?«
Die Pause dauerte länger, als man gedacht. Die Herren Professoren wurden unruhig — Stühle wurden gerückt — die Neugierigsten traten an den Experimentiertisch heran. — —
Die junge Assistentin hatte den Verbindungshahn zur Geißler-Röhre geöffnet. Nach der Voraussetzung des Entdeckers des neuen Gases X hätte die Röhre nun tiefveilchenblau aufleuchten müssen aber — sie blieb dunkel.
Leichenblaß stand der junge Gelehrte einen Augenblick, dann schoß eine dunkle Röte ihm ins Antlitz. —
Seine Assistentin sah das sonst so sonnige, männlich-schöne Gesicht entstellt von grausamer Enttäuschung, sie sah auch die neugierigen Gesichter im Saal, die Verwunderung, Anteil, Schadenfreude und Spott, je nach dem Charakter ihrer Besitzer, ausdrückten — und sie sagte mit leiser, aber fester Stimme:
»Die hochverehrten Anwesenden mögen gütigst entschuldigen: durch einen Fehlgriff meinerseits ist die Verbindung mit der Luftpumpe undicht geworden und die kleine Menge des neuen Gases in die Atmosphäre entwichen. Hier aber ist eine der vom Entdecker vor ungefähr acht Tagen hergestellten, mit dem neuen Gas gefüllten GeißlerRöhren, die ich mir erlauben werde, Ihnen anstatt der jetzt erst herzustellenden zu zeigen.«
Damit schaltete sie die Röhre in den Funkenstrom des Induktoriums ein. —
Auch diese Röhre blieb dunkel, ebenso eine zweite, eine dritte! Aus einer Ecke des Saales ertönte Gelächter, Rufe des Ärgers, des Unwillens wurden laut. Der Saal begann sich zu leeren.
Da drängte sich der Institutsdiener durch die Reihen der Anwesenden. »Ein Telegramm aus London, Herr Doktor!«, rief er schon von der Saaltür her.
Die Aufregung der gelehrten Versammlung legte sich einen Augenblick. Doktor Kolbe warf einen Blick nach der Unterschrift der Depesche.
»Von Herrn Professor Ramsay«, rief er aus und begann zu lesen. Die Umstehenden sahen, wie er bleicher und bleicher wurde — nun schlug er die Hände vor die die Stirn und eilte hinaus.
Einer der Zunächststehenden ergriff das Telegramm, noch ehe die junge Assistentin es in Sicherheit bringen konnte —
»Vorlesen!«, rief man von allen Seiten.
Der so Aufgeforderte las:
»Herrn Privatdozent Dr. Kolbe, Berlin,
erstes chemisches Institut.
Nachprüfungen haben keinerlei Anhalt für einen neuen Stoff außer den bisher bekannten in der Atmosphäre ergeben. Vielleicht Verwechselung mit Xenon vorliegend.
Professor William Ramsay.«
»Die ganze Geschichte scheint eine kolossale Selbsttäuschung zu sein, meine Herren«, sagte einer der Chemiker.
»Oder eine Mystifikation —«, warf ein anderer dazwischen.
»Das wäre ja beispiellos in der Geschichte der Wissenschaft!«, rief ein Dritter empört.
»Unerhört, unerhört!«, riefen die meisten.
»Man muß die Sache vor das Forum der Öffentlichkeit bringen!«, zeterte ein langer, hagerer Besucher mit scharfgeschnittenen Zügen.
»Ein wissenschaftlicher Skandal!«, schrie sein Nachbar. — —
In wenigen Sekunden war das Auditorium leer. Als die letzten gingen der doppeltbebrillte Herr Professor mit seinem Nachbar zur Rechten aus der Tür.
»Nun habe ich nicht einmal den Namen der hübschen Assistentin erfahren, Herr Kollege?«
»Kommen Sie nur — er wird mir unterwegs schon noch einfallen — kommen Sie nur. Aber Protest müssen wir einlegen gegen diesen Herren, energischen Protest — meinen Sie nicht auch, Kollege?« —
— — —
In dem leeren Riesensaal des Auditoriums stand einsam die junge Assistentin.
Wie ein Verfemter war der junge Forscher aus dem Institut hinaus gestürzt, durch die menschenerfüllten Straßen, weiter und immer weiter, stundenlang. — Immer noch war es ihm, als höre er das hämische Geflüster und Gelächter seiner Kollegen hinter sich — und immer wieder setzte er den müden Fuß vorwärts.
Bis in einen der Vororte der Weltstadt war er so planlos gewandert. Der Fluß kreuzte seinen Weg und zwang ihn, ein Weilchen zu rasten...
Konnte man ihm einen begründeten Vorwurf machen? Hatte er es an der wissenschaftlichen Gründlichkeit bei seiner Untersuchung fehlen lassen? Hatte er nicht vor acht Tagen unter Assistenz seiner Mitarbeiterin den fraglichen neuen Stoff aus der Atmosphäre abgeschieden? Hatten sie nicht mehrere Proberöhren mit dem Gase X gefüllt?
Ein Unstern hatte über der heutigen wissenschaftlichen Sitzung gestanden Alle ihm Übelwollenden — und er hatte viele Gegner! — mußten ja annehmen, daß er in eitler Entdeckerwut unfertige oder unrichtige Ergebnisse der Öffentlichkeit unterbreitet habe.
Wie ein Lichtstrahl hob sich aus all dem Dunkel der Verwirrung in seiner Seele die Gestalt der jungen Assistentin ab, die um seinet- und seiner Entdeckung willen die Schuld am Mißlingen auf sich genommen. —
Das würde er Fräulein Erika auf ewig danken!
Der Erfolg des Tages wäre durch ihr opfermütiges Eintreten noch gewonnen worden, wenn die einige Tage früher hergestellten Proberöhren nicht ebenfalls — unerklärlicherweise — unbrauchbar geworden wären.
Hier stand er in seinen Gedanken vor einem unlöslichen Rätsel. Wenn es ihm schon durch irgend einen unerklärlichen Zwischenfall nicht gelungen war, während der Sitzung der gelehrten Gesellschaft das neue Gas aus der Atmosphäre abzuscheiden — die Geißler-Röhren hätten doch eine Probe desselben enthalten müssen. So grübelnd stand er am Ufer des träge fließenden Wassers, als es ihm auf einmal war, als drehe eine unsichtbare Gewalt seinen Kopf zur Seite — wie der Magnet den willenlosen Anker!
Drei Schritte von ihm entfernt, stand eine Gestalt, vollbeschienen vom magischen Lichte des Mondes.
Ein Greisengesicht — aber mit einem Blick der dunklen Augen, der in seinem rätselhaften Glanz an die Phosphorescenz der Augen nächtlicher Raubtiere erinnerte! Ein eisgrauer langer Bart, — das mächtige Haupt bedeckt mit einem tief in die Stirn gedrückten Schlapphut.
»Guten Abend, verehrtester Herr Doktor!«, sprach der Fremde den jungen Gelehrten an, den Schlapphut lüftend.
»Guten Abend!«, antwortete Doktor Kolbe mechanisch.
»Sie kennen mich nicht, Herr Doktor — ich hatte Gelegenheit, heute nachmittag Ihrem Vortrage über die Entdeckung des Gases X in der Atmosphäre beizuwohnen.
»Es tut mir leid, verehrter Herr — Herr — ich weiß allerdings nicht, mit wem ich die Ehre habe?« Der Privatdozent machte eine Pause, in der Erwartung, daß der seltsame Mann sich ihm vorstellen werde.
»Nennen Sie mich Professor Kraft — der Name tut ja nichts zur Sache, Herr Doktor!«
»Wie gesagt, es tut mir recht leid, Herr Professor, daß Sie und alle meine verehrten Zuhörer und Kollegen nicht auf die — Kosten gekommen sind! Sie werden es mir wahrscheinlich auch jetzt nicht glauben, daß ich vor ungefähr acht Tagen in unserem Laboratorium das fragliche Gas entdeckt und Proben davon zur Beobachtung in Geißler'sche Röhren gebracht habe, die ja heute leider auch nicht mehr brauchbar zu sein schienen. —«
»O doch, Herr Doktor — ich glaube Ihnen jedes Ihrer Worte! Ich war vielleicht der einzige unter allen Ihren Zuhörern, der Ihnen voll und ganz glauben mußte —«
»Inwiefern — glauben mußte?«, fragte Dr. Kolbe in höchster Verwunderung.
»Weil i c h s e l b s t P r o b e n I h r e s n e u e n t d e c k t e n G a s e s in meinem Laboratorium seit Jahren besitze!«, sagte Professor Kraft mit erhobener Stimme.
Dr. Kolbe stürzte auf ihn zu.
»Sie selbst besitzen Proben davon?«, rief er, in der Erregung seinen Arm umklammernd.
»Gewiß, Herr Doktor — und es steht nur bei Ihnen, ob Sie sich dieselben einmal in meinem Laboratorium ansehen wollen!«
»Heute noch?«
»Heute noch — mein Wort darauf!«
»Und wo befindet sich Ihr —«
»Kommen Sie, in wenigen Minuten sind wir an Ort und Stelle!«
Der sonderbare Fremde schritt voran, Dr. Kolbe folgte — willenlos, wie ein Träumender. Unmöglich war es ihm, sich dem rätselhaften Einfluß zu entziehen, den der Professor Kraft auf ihn ausübte. Er kam gar nicht dazu, sich in seinem Innern Rechenschaft über das seltsame Begebnis abzulegen; die Vorstellung, heute noch das von ihm entdeckte und wieder verlorene Gas wiederzufinden und unter so wunderbaren Umständen, beherrschte ihn, wie eine fixe Idee, und er wäre zur Erreichung dieses Zieles seinem Führer auch in — die Hölle gefolgt. —
Eine Viertelstunde später stand er mit seinem Begleiter im Erdgeschoß eines kleinen, einsam stehenden Hauses am Ufer des Flusses. Vor ihm auf einem Experimentiertisch stand ein Rahmengestell, in welches einige Geißler-Röhren gespannt waren. Der Professor dämpfte die Beleuchtung des Raumes, der sich bei ihrem Eintritt automatisch erhellt hatte, und berührte einen Knopf. —
Da — ein Freudenschrei kam von den Lippen des jungen Privatdozenten, wie ein Kind klatschte er in die Hände — »Da ist es, da leuchtet es, das Gas X!«
Prachtvoll dunkelviolett, leuchtendveilchenfarben strahlten die Geißler-Röhren unter dem Funkenstrom einer mächtigen elektrischen Entladung.
— — —
Wie von einem Märchenzauber verwandelt, stand Doktor Kolbe neben seinem seltsamen Wirte und sah das Phänomen.
»Da — nehmen Sie dies Taschenspektroskop, Herr Doktor, und beobachten Sie das Spektrum des neuen Gases!«
Der junge Gelehrte tat es und sagte bestätigend:
»Drei Linien im äußersten Violett, wie ich festgestellt hatte. —«
»Sind Sie nun überzeugt?«
»Völlig, Herr Professor — wenn ich mich in meinen Gedanken auch immer noch nicht zurecht zu finden vermag. Können Sie mir aber erklären — Sie waren ja heute Augenzeuge davon — warum die von mir hergestellten Proberöhren unbrauchbar geworden waren?«
»Aus dem einfachen Grunde, weil die Platindrähte, die zur Einführung des Funkenstromes in die Geißler'schen Röhren dienten, das neue Gas verschluckten, etwa wie Palladium den Wasserstoff. —«
»Also deshalb —« der junge Forscher schlug sich vor die Stirn. »Dann waren also meine Geißler-Röhren völlig leer geworden in den acht Tagen ihrer Aufbewahrung?«
»Wahrscheinlich, lieber Herr Doktor.«
»Und vermögen Sie mir endlich zu erklären, warum ich heute das neue Gas aus der Atmosphäre nicht abzuscheiden vermochte? Auch Professor Ramsay bestreitet, wie mir noch am Schlusse der Sitzung sein Telegramm mitteilte —«
»Ich habe es gehört«, bekräftigte der Professor — »und habe auch die Äußerungen Ihrer Herren Kollegen dazu gehört!«
»Ja — also auch er bestreitet das Vorhandensein eines neuen Gases in der Luft unseres Planeten! Vermögen Sie auch dieses Rätsel zu lösen, dessen Dunkelheit mich noch immer foltert?«
»Ich vermag es und will es Ihnen lösen, Herr Doktor! —- Aber erst wollen wir ein wenig zu Abend essen. Ich darf Sie bitten, mein Gast zu sein — geben Sie mir Ihre Hand, bitte, und stellen Sie sich mit mir auf diese Eisenplatte hier in der Wandnische — so!«
Der Professor drückte auf einen Knopf, und der Fahrstuhl, — denn ein solcher war unter der quadratischen Bodenplatte verborgen, — brachte die beiden im Nu aufwärts in ein behaglich und geschmackvoll eingerichtetes Speisezimmer, wo ein gedeckter Tisch ihrer wartete.
Sie standen wieder im Laboratorium des Professors.
Auch dem jungen Fachmann und Spezialkollegen erschien hier das Meiste neu und unerklärlich. Diese Apparate waren in keinem der europäischen Institute vorhanden.
Professor Kraft bemerkte das Staunen und die Wißbegier seines Begleiters. —
»Es erscheint Ihnen hier vieles ungewöhnlich?« —
»Allerdings, Herr Professor — und jedem meiner Kollegen würde es vermutlich nicht anders ergehen. —«
»Das glaube ich wohl«, sagte der Professor mit einem sarkastischen Lächeln — »die Zunft meiner Herren Fachkollegen, die mich vor Jahrzehnten wegen meiner Hypothesen für verrückt erklärte, würde auch heute vermutlich mit einen ähnlichen Verdikt über meine Maschinen und Apparate zur Tagesordnung, d. h. zu ihrem engbegrenzten Wissensgebiet übergehen — aber, mein lieber junger Freund«, — hier faßte der seltsame Mann den Arm des Doktors, — »was Sie hier sehen und sehen werden, wird die Zunft der Modegelehrten erst in drei Jahrhunderten vielleicht erfaßt und erforscht haben — das können Sie mir sicher glauben!«
Doktor Kolbe sah ihm ins Auge —- da war nichts von dem flackernden Blick des Irrsinns, nichts von dem Größenwahn des Phantasten, der klare, stahlharte Blick des besonnenen Forschers drang ihm in die Seele...
Vor einem der aufgestellten Apparate stehen bleibend, sagte dann der Professor etwas unvermittelt:
»Ihre Kollegen haben augenblicklich als den neuesten Fortschritt die Theorie der Elektronen aufgestellt, und man denkt sich darunter materielle Teilchen, deren Größe mehrere tausendmal kleiner ist als ein Wasserstoffatom, und von denen ein jedes mit einer ganz bestimmten elektrischen Ladung durch den Raum geschleudert wird. —«
»Allerdings — die Forschungen sind freilich noch nicht abgeschlossen —«
»Nun, Ihre Herren Kollegen haben ja Zeit. —« Wieder ein spöttisches Lächeln — dann faßte der Professor den kurbelartigen Griff des Apparates, einer teleskopförmig gebauten Maschine, deren Tubus nach dem Hintergrund des Zimmers gerichtet war, warf mit der Linken ein Geldstück — ein silbernes Fünfmarkstück — in einen Schlitz des Apparates und drehte die Kurbel...
Ein leises Surren ertönte, wie von einem summenden Insekt. Gleichzeitig zeichnete sich auf der Hinterwand des Zimmers ein heller Kreis ab.
»Bitte, Herr Doktor, treten Sie ein wenig näher an den Kreis dort an der Wand heran!«
Doktor Kolbe tat es. Anfangs bemerkte er nichts als die hellerleuchtete Fläche, die er mit seiner Hand zu bedecken vermochte aber sie wurde zusehends heller und strahlender und glänzte endlich wie ein Spiegel —
»Nehmen Sie die Scheibe ab von der Wand, Herr Doktor, bitte!« Und wie aus dem Boden eines Schmelztiegels genommen, strahlte und glänzte die flache Silberscheibe, die Doktor Kolbe vorsichtig von der Wand gelöst hatte.
Stumm vor staunender Bewunderung hielt er das Produkt der durch den Raum geschleuderten Silberteilchen in der Hand. —
»Ein Transport von Elektronen — weiter nichts, Herr Doktor! Sagen Sie Ihren Fachkollegen, sie seien so ziemlich auf dem rechten Wege. —«
»Aber, verehrter Herr Professor, verzeihen Sie einen Einwand. Soviel ich sah, warfen Sie ein deutsches Fünfmarkstück in den Apparat zur elektrischen Zerstäubung — wo ist das Kupfer geblieben, das dem Münzsilber zugesetzt wird?«
»Die Elektronen des Kupfers haben einen anderen Ladungsbetrag als die des Silbers — wollen Sie, bitte, sich noch einmal an die Zimmerwand bemühen, Herr Doktor?«
Das Surren begann von neuem, nachdem der Professor die Stellung der Kurbel geändert hatte.
Wie vorhin erschien der hellleuchtende Kreis; aber er glänzte jetzt rötlich, und nach kurzer Zeit bildete sich eine dünne Scheibe rosenroten Kupfers an der bestrahlten Fläche. —
Von neuem staunend — sprachlos vor Verwunderung — stand der junge Gelehrte, in der einen Hand die Scheibe von Silber, in der andern die kupferne.
»Wollen Sie die Gewichte nachprüfen, Herr Doktor, bitte, hier steht eine kleine Wage, — das Silber der deutschen Münzen verhält sich im Gewicht zum zugesetzten Kupfer wie 9:1.«
Eine schnell vorgenommene Wägung ergab für die Gewichte der beiden Scheiben dasselbe Verhältnis. —
»Sie müssen kolossale Energiemengen zur Verfügung haben, Herr Professor«, begann nach kurzer Pause Doktor Kolbe, — »soviel wissen wir bereits, daß zur Zerlegung der Stoffe in ihre Elektronen riesige elektrische Kräfte nötig sind!«
Professor Kraft bejahte durch ein stummes Kopfnicken.
»Und tritt die Auflösung in die allerkleinsten Teilchen auch bei organischen Stoffen ein, bei pflanzlichen und tierischen Körpern?«
»Selbstverständlich, wenn auch da die Vorgänge sehr viel komplizierter sind — wollen Sie einmal — diese Broschüre — sie enthält die neuesten Ergebnisse eines Ihrer bedeutendsten Forscher auf dem Gebiete der Elektronenlehre — in den Strahlenkegel meines Apparates halten, bitte!«
Der junge Privatdozent sah, wie das Buch zuerst an den Ecken abzubröckeln begann, wie von einer sehr heißen, aber unsichtbaren Flamme verzehrt. Immer kleiner wurde die formlose Masse der gedruckten Blätter —
Mit einem plötzlichen Ruck schaltete der Professor den Hebel des Apparates auf den Nullpunkt zurück. —
»Ihre Finger möchte ich doch nicht mitverflüchtigen, verehrtester Herr Doktor!«, sagte er in eigentümlichem Tone. — —
Vor einem mächtigen Blocke eines seltsamen Minerals von graphitähnlichem Glanze blieb Doktor Kolbe bei seinem Gange durch das Laboratorium wieder stehen.
»Wenn ich mich nicht täusche, Herr Professor, ist dieser Block kosmischen Ursprungs?« —
»Ja, es ist ein Meteorstein, der für mich noch die persönliche Bedeutung hat, daß ich Zeuge seines Sturzes aus dem Weltäther herab in unsere irdische Atmosphäre geworden bin —«
»O, sehr interessant!«, pflichtete der Doktor bei.
»Ja sehr interessant — auch für Sie, bester Herr Doktor!«
»Für mich — wie meinen Sie das ?«
»Dieser Himmelsbote enthält in seinen Poren das Gas, das Sie heute Ihrem illustren Auditorium zu zeigen versprochen haben — und nicht zu zeigen vermochten! —«
Auf Doktor Kolbes Gesicht wechselte die Farbe.
»Sprechen Sie die Wahrheit, bester Herr Professor? O, geben Sie mir näheren Aufschluß darüber — ich bitte Sie!«
»Ich weiß nicht, wann Sie die Analyse unserer Atmosphäre vorgenommen haben; wahrscheinlich aber sind Bruchstücke desselben Meteoriten, von dem ich das vorliegende vor einigen Jahren erhielt, vor kurzen abermals in dieser Gegend durch das Luftmeer geschleudert worden und haben dabei größere Mengen des fraglichen Gases entbunden, die Sie dann bei Ihrer Analyse aufgefunden haben —«
»Wie erklärt sich aber dann die Erfolglosigkeit meiner heutigen Experimente im Auditorium, bester Herr Professor?«
»Das Gas X ist äußerst leicht; sein spezifisches Gewicht beträgt nur wenige Zehntel von dem des Wasserstoffs — es wird also infolge seines Auftriebs schnell wieder an die äußersten Grenzen unserer Atmosphäre geschleudert, und die von Ihnen neulich bei der Entdeckung gefundenen Spuren sind längst der Analyse hier auf der Erdoberfläche entrückt. Da Sie nun bei Ihrem heutigen Versuch von keinem neuen Meteoritenfall aus diesem Mineral unterstützt wurden, blieb das Ergebnis negativ!«
»Aber den Beweis?«
»Den Beweis haben Sie eigentlich schon darin, daß ich im Besitz der mit dem Gase X gefüllten Geißler'schen Röhren bin — wie ich Ihnen beim Eintritt in mein Laboratorium zeigen konnte; — aber, um Ihre Zweifel ganz zu beseitigen, sollen Sie nachher eine Probe des Minerals erhitzen und das entweichende Gas im Vakuum spektroskopisch prüfen, lieber junger Freund —«
»Herr Professor, Sie beschämen mich durch Ihre Güte! Mir einem Unbekannten, den Sie vor wenig Stunden zum ersten Male nur gesehen, gönnen Sie einen Einblick in Ihr geheimnisvolles Schaffen! Wie soll ich Ihnen dafür danken? Für heute aber — es muß spät in der Nacht sein! — will ich Sie keinen Augenblick länger belästigen — und da ich immerhin noch einen weiten Weg bis in mein Junggesellenheim zurückzulegen habe, bitte ich, mich zu verabschieden. Ich verspreche Ihre gütige Erlaubnis vorausgesetzt, mich recht bald wieder bei Ihnen einzufinden!«
Damit hielt er dem Professor die Rechte hin — Professor Kraft faßte sie, und seine Augen bohrten sich tief und mit einer magischen Gewalt in die des jungen Mannes.
»Sie werden bei mir bleiben«, sagte er nach einer kleinen Pause mit eigentümlich monotoner Stimme, »Sie werden nicht wieder zurüchkehren in die Welt der Klique und des Strebertums da oben!«
Wie ein Alp legte es sich bei den Worten und Blicken des Professors auf die Seele des Privatdozenten: eine unerklärliche Willenlosigkeit drohte sich seiner zu bemächtigen — er wollte entgegnen, aber er vermochte es nicht...
Noch immer hielt der geheimnisvolle Sonderling seine Hand fest, noch immer war er im Bann seiner stahlgrauen, faszinierenden Augen.
»Ich werde alt«, — hörte er sein Gegenüber weiter sprechen — »mancherlei Mahnungen meines Körpers künden mir ein nicht allzu fernes Ende, und ich will nicht mein Wissen, meine Forschungen und Erfindungen mit mir untergehen lassen. Das Schicksal hat mir den Sohn versagt, seien Sie mein Sohn und Nachfolger! Und wenn die Wissenschaft, meine vollkommene Wissenschaft allein Sie nicht hier unten, fern von der Welt, festzuhalten vermag — vielleicht vermag sie es mit d e r dort im Bunde!«
Und der Forscher deutete mit der Linken auf eine Frauengestalt, üppig und schön und verlockend, wie ein Märchenbild aus »Tausend und eine Nacht«, die, wie aus dem Nichts hervorgezaubert, plötzlich in dem halbdunklen Raume stand, die Augen verheißungsvoll auf den jungen Fremdling richtend.
»Tritt näher, meine Tochter, nimm seine Linke! Vereint wollen wir ihn bitten, bei uns zu bleiben!«
Und das schöne Weib schritt auf Doktor Kolbe zu — — — Da sah er vor sich im Geiste das reine, seelenvolle Antlitz seiner Assistentin vom Institut, Erikas Antlitz — und die Erinnerung an sie löste ihn mit einem Male aus dem Bann, mit dem der unheimliche Sonderling ihn zu fesseln gedachte!
»Ich kann nicht hierbleiben!«, stieß er hervor, fast angstvoll. »Ich muß zurück — haben Sie Dank!«
Damit riß er mit wiederkehrender Entschlossenheit seine Hand aus der des Professors. Doch weiche, schöne Frauenarme legten sich plötzlich umschlingend um seinen Nacken.
»Halt' ihn zurück, Isis!«, rief der Professor, während er selbst nach dem elektrischen Zerstäubungsapparat eilte. — Aber schon hatte Doktor Kolbe sich von ihr befreit — Schon war er fast an der Tür des Laboratoriums.
»Keinen Schritt weiter!«, schrie da der fürchterliche Mann mit drohender Stimme.
Das Rohr des Apparates war jetzt wie ein Geschützlauf auf den jungen Dozenten gerichtet.
»Denken Sie, junger Tor, ich werde Sie gutmütig wieder auf die Erde, in den Kreis Ihrer Kollegen zurückkehren lassen, nachdem ich Ihnen das Geheimnis meines Aufenthalts und meiner Arbeiten entdeckt habe? Keinen Schritt weiter! Entweder Sie schwören mir, mein Gefährte und Mitarbeiter zu werden — und ich verspreche, Ihnen a l l e meine Geheimnisse zu enthüllen — — oder ich vernichte Sie!«
Wie ein Dämon der Unterwelt stand der Wütende an dem verderbendrohenden Apparat, dessen unheimliches Summen das Arbeiten seiner gewaltigen Kräfte verriet...
Hochaufgerichtet stand Doktor Kolbe — alle Unentschiedenheit war aus seinem Wesen verschwunden. Furchtlos begegnete sein Auge dem lodernden Blicke des Gegners.
»Ich kann nicht hier bleiben — da oben ist meine Zukunft und meine Liebe!«, sagte er ruhig und fest.
»Entscheide dich anders — oder —«
Der Professor faßte den Hebel des Einschalters —
»Töten Sie mich, wenn Sie können!«, war die Antwort des jungen Gelehrten.
Ein Lichtkegel von unterträglicher Helligkeit entströmte plötzlich dem Apparat, und seine Strahlen hüllten den jungen Doktor ein...
Da kehrt ihm die Besinnung zurück. Professor Kraft und all sein Zauberspuk ist verschwunden. Er sitzt in seinem Laboratorium im ersten chemischen Institut der Universität Berlin und vor ihm steht — die junge Assistentin Erika. —
Sie ist um ihn beschäftigt; mit einer belebenden Essenz reibt sie ihm Stirn und Schläfen —
»Was ist denn mit mir geschehen? — Was war denn?«, fragt er — immer noch ohne alles Verständnis.
»Sie wissen doch, Herr Doktor, daß Sie mit einer Arbeit über das Stickoxydul und ähnliche anästhetisierende Mittel beschäftigt waren —«
»Allerdings — allerdings —«
»Als ich vorhin hier eintrat, um eine Frage an Sie zu stellen, lagen Sie bewußtlos auf der Erde. Ich riß schnell alle Fenster auf — vermutlich ist eines der Gasometer, in denen Sie die Probegase bereit hielten, undicht geworden — ich weiß es nicht — ich sorgte mich nur um Sie! Gott sei Dank, daß ich nicht zu spät kam —«
Tränen glänzten in den Augen der Assistentin. Privatdozent Doktor Kolbe faßte ihre beiden Hände.
Klar steht jetzt alles vor seinem Geiste.
Ein Phantasiespiel seines in der Betäubung weiter arbeitenden Gehirns war alles gewesen: die fragliche Entdeckung des Gases X, das Telegramm an Professor Ramsay, die Sitzung im chemischen Institut mit ihren Enttäuschungen, — seine Flucht in die Einsamkeit und — alle seine Erlebnisse bei Professor Kraft! Traumgebilde — keine Wirklichkeit!
Und doch — in der tollen Hetzjagd seiner Phantasieen war eine Wahrheit vor seine Seele getreten, die in der nüchternen Wirklichkeit noch nie so überwältigend ihm zum Bewußtsein gekommen war...
Und leise sagt er nun:
»Ja — Gott sei Dank, daß Sie nicht zu spät gekommen sind, Fräulein Erika! — Wunderbares habe ich in diesem Betäubungszustand erlebt, durch Enttäuschung, Mißgunst, Verspottung und Kollegenhaß bin ich geschritten, dämonisches Wissen und dämonische Mächte haben meinen Weg gekreuzt, dem Tode sah ich ins Auge — aber e i n e Lichtgestalt ist mit mir durch Not und Tod gegangen — i h r Bild ist mir Schutz und Trost gewesen — D e i n Bild, Erika!«
Errötend und wieder erblassend entzog sie ihm die Hände —
»Denken Sie deshalb nicht gering von meiner Liebe, Erika, weil ich Ihnen bis heute nie etwas davon in meinen Worten verraten habe — mein Herz gehört Ihnen schon lange! Traum und Wirklichkeit haben mir gezeigt, daß Sie der gute Engel meines Lebens sind — Erika.—«
Er faßte von neuem ihre Hände und zog die liebe Gestalt an sich...
Sie wehrte ihm nicht mehr — sie duldete seinen Kuß, und Tränen des Glückes glänzten in ihren schönen Augen. — —
Zur Vermählung schenkte Doktor Kolbe seiner Gattin obiges Manuskript.
Das Gas X ist noch immer zu entdecken!
Ostern! Wie ein Jauchzen hat dies Wort allezeit geklungen, wie der Jubelschrei eines Gefangenen, der aus den Ketten der Knechtschaft endlich, endlich befreit wird — ganze Völker haben erlösten Herzens diesen Gruß als einen Freiheitsruf nach der Gefangenschaft des Leibes und der Seele ausgestoßen — wer hätte es darum dem soeben »fertig gewordenen« jungen Lehrer Hans Ehrlich verargen wollen, wenn er das diesmalige Ostern anno 1886 besonders freudig begrüßte! Die Jahre ernster, strenger — manchmal nach jugendlicher Weisheit harter! — Lehrzeit waren ja mit diesem Ostern überstanden; vor einer Stunde hatte der gestrenge Herr Rat die Liste der neu ernannten »Schulamtskandidaten« — wie der geschmackvolle Titel heißt — in der Aula des Seminars verlesen, und Hans Ehrlich hatte klopfenden Herzens gelauscht, ob auch sein Name von den Lippen des Gestrengen fiel. Nur die Heiligkeit des Raumes, in der er sich befand, und die Augen seiner Lehrer, die wie ebensoviele Miniaturkanonen auf die »Schar der Sieger« gerichtet waren, hielten unseren Hans ab, bei Nennung seines eigenen werten Namens einen Freudensprung zu vollführen, der ihm auch in den Augen der wildesten Wilden ein Lob eingebracht hätte. — Ja, es war etwas von dem Freudentaumel entsprungener sibirischer Verbannter in dem jubelnden Lachen und Scherzen und Frag- und Antwortgeben, mit dem sich die »dreißig Geprüften« — als sie außer Seh- und Hörweite sämtlicher Pädagogen der Vor- und Jetztzeit gelangt waren, untereinander beglückwünschten: Freundschaftsbündnisse wurden neu besiegelt, ewige Feindschaften innerhalb fünf Minuten für die gleiche Ewigkeit in ebenso heftige Freundschaften umgewandelt, den jüngeren Jahrgängen, die halb staunend, halb neidisch dem tollen Treiben der sonst so gesetzten und vernünftigen »Alten« zuschauten, wurden im Überschwang der Gefühle wahre alexandrinische Bibliotheken von alten Schmökern, verbotenen Hilfsbüchern, kostbaren Ausarbeitungen vermacht — — wie wohl dort oben am Nordostende Kamtschatkas die befreiten russischen Verbannten im Anblicke des Rettung verheißenden ewigen Oceans ihren dickschädeligen, kamtschadalen Wegweisern und Helfershelfern allerlei sonst sorgsam gehegte Nichtigkeiten, Tabaksbeutel, Rasierspiegel, Schnupftabaksdosen u.s.w. in die braunen Hände drücken!
Fieberhaft schnell, zum Schaden manches einsamen Strumpfes, der durch die Hast seines Eigentümers sich auf ewig dazu verdammt sah, hinfort als einbeiniger Sonderling zu vegetieren — wurden die wenigen Habseligkeiten zusammengeschnürt — dann ging's zum Bahnhofe, der Heimat, den Armen alter und junger Liebe zu!
Auch Hans Ehrlich saß mit einem Teil der Kollegen im Zuge, der ihn durch die Berge Thüringens dahinführte. Seine Reisetour war die weiteste von allen. Er mußte sogar »umsteigen!« — Aber er hatte die sechs Jahre hindurch Geduld gelernt, Gott vertraut und die Zähne zusammengebissen, wenn's einmal gar zu trüb in seinem Leben und in seinem Innern aussah — sodaß er auch jetzt frohen, geduldigen Herzens bei den andern Klassengenossen sitzen — ja, es neidlosen Sinnes mit ansehen konnte, wenn bei der Ankunft des Zuges an den Zwischenstationen das Ungetüm von einem Eisenbahnwaggon IV. Klasse immer wieder seinen Schlund öffnete, um einen oder einige seiner Reisebegleiter auszuspeien, die am Ziele waren — während er — weiter fahren mußte.
Auf der vorletzten Zwischenstation stieg der letzte der Klassenbrüder aus — und Hans Ehrlich war nach einem herzlichen Abschied von diesem seinem besten Freunde, der all die sechs Jahre hindurch ihm wie ein lieber, treuer Bruder gewesen war und so manches kleine und große Leid mit ihm geteilt hatte — allein! wenn auch dieses »Alleinsein« nur insofern seine Wahrheit erhielt, als er unter sechs Marktweibern, einem Leiermanne und zwei blinden Harmonikavirtuosen, einem Dutzend Bauern und andern verständnislosen Mitreisenden — der einzig fertiggewordene, den jahrelangen Banden entronnene Schulamtskandidat — also »unter Larven die einzige fühlende Brust« war.
Du guter, treuherziger Hans Ehrlich! Welcher Gedanke läßt dir auf einmal die klaren blauen Augen überfließen mit Tränen der Wehmut? Daß dich daheim nicht der liebe ernstfreundliche Vater erwartet, um dir in frohem Stolze die Hand zu drücken — nicht die herzensgute Mutter deiner harrt, deiner mehr harrt, deinen Lieblingskuchen gebacken hat und für dich noch einmal frischen Kaffee braut — wie sonst, wie noch vor einem Jahre! — Weine immer unverborgen deine Tränen, guter Freund! Wenn es ein Band giebt zwischen hier und dort, zwischen Zeitlichem und Ewigem, so wissen die verewigten Eltern, daß du weitergeschritten bist auf dem Wege, den sie dich geleitet, da ihre sorgenden Herzen noch schlugen in warmer, lebendiger Liebe für dich; sie wissen es, daß du brav geworden — und sie freuen sich mit dir!
Immer weiter ins Land hinein rollt der sausende Zug, durch grünende Saaten, durch jungbelaubte Wälder — schon tauchen am Horizonte die rauchenden Schornsteine der Hauptstation auf — das vorhin schon lebendige Coupé wird auf einmal zum kribbelnden Ameisenhaufen — der Leierkastenmann spielt in rechter Benutzung des Moments zum Schlusse seines viernummerigen Programms deshalb zum zwölften Male: »Es kann ja nicht immer so bleiben« etc. und die beiden Blinden begleiten ihn auf der Harmonika und auf ihren Stimmbändern. Sie haben es nämlich im Laufe der Fahrt entschieden besser gefunden, mit dem Drehorganisten sich über die Repertoirnummern und über die Vorzeichen zu einigen, um auch beim Einsammeln des Obolus mit ihm ein Kompagniegeschäft machen zu können — als immer gerade die »Arie aus dem Freischütz« zu fingern, wenn er den Walzer von der »schönen blauen Donau« dreht. Auch für die Ohren und den Geschmack der Mitfahrenden war diese stille — oder laute — Übereinkunft entschieden besser, wie aus den zahlreicher gespendeten »Nickeln« sich schließen ließ.
Das dampf- und funkenschnaubende stählerne Ungeheuer, zu »deutsch« Lokomotive genannt, atmet langsamer mit weniger asthmatischem Stöhnen, und immer langsamer, träger, schwerfälliger drehen sich die Räder auf ihrer glatten Spur — ein Pfiff, noch ein paar ruckweis sich von Waggon zu Waggon fortpflanzende Bremsbewegungen — der Zug steht — und alles steigt aus.
Bei seinen sonstigen Ferienreisen hatte sich Hans Ehrlich nun hier ein neues Billett gelöst und war auf dem wundersamen Vehikulum einer Sekundärbahn weitergeschlichen; — heute hatte er einen andern Plan, der ihn, glücklich lächelnd und rüstig die Füße hebend, seinen Weg hinein in die im Abendsonnenglanze schimmernde Landschaft nehmen hieß.
Wartet niemand seiner — daheim im trauten Dörfchen? Ist's die Hoffnung, heut Abend noch seinen kuriosen Onkel und Vormund zu begrüßen, der immer dagegen gewesen ist, daß einer aus dem Stamm der Ehrliche ein »Schulmeister« werde? — Wir glauben dir das nicht, Hans Ehrlich! — und wenn du in Wahrheit »Ehrlich« sein willst, so mußt du, wenn auch mit erglühenden Wangen und mit etwas rascher pochendem Herzen bekennen, daß es —
Hans blieb auf seinem Wege stehen — sah sich erst vorsichtig nach allen Seiten um, ob auch kein Menschenauge ihn beobachte, dann schnürte er rasch sein kleines Reisebündel auf und brachte, mit der vorsichtig tiefer und tiefer tastenden Hand das Labyrinth eines Seminaristeninventariums durchforschend, endlich ein kleines Schächtelchen aus weißem Glanzkarton hervor, wie sie der Goldschmied zugiebt, wenn man bei ihm z.B. Fingerringe kauft.
Deshalb hat also die Reisekasse nicht erlaubt, daß du dir wie sonst, noch eine zweite Fahrkarte zu der Sekundärbahnbenutzung gekauft hast, du gutherziger Hans! Freilich: dies Ringlein mit dem Granaten und den zwei weißen kleinen Perlen ist mit dem nichtgezahlten Preis des Billetts und den drei Stunden tüchtigen Marschierens im Abendsonnenscheine nicht zu teuer bezahlt! Verbirg es wieder, wie vorhin, sorgfältig in den unergründlichen Tiefen deines Reisebündels, Hans Ehrlich, und bekenne endlich, was wir vorhin schon halb erraten haben — daß du heut Abend noch, wenn dir ein guter Geist gnädig ist, Else Liebreich, die schlanke, braunlockige Else, deinen dunkeläugigen Schatz, zu sehen und zu sprechen und — zu beschenken hoffst!
»Meine herzensgute Else!«, unbewußt hatten Hans Ehrlichs Lippen diese drei Wörtchen geformt, als ob es ihnen eine oft gesprochene und darum leicht zu bildende Formel sei. — Erschrick nicht, erschrick nicht mehr, sieh dich nicht mehr scheu um, als ob Späheraugen und Verräterohren, wie im alten Klosterneste dort hinten, auf Schritt und Tritt zu fürchten seien! — Hans Ehrlich, werde fester, mutiger, männlicher; lerne begreifen, daß es kein Verbrechen für einen braven Jüngling deiner Art ist, ein herziges, liebes, reines, treues Mädchen gern zu haben! — —
Nun sank die Sonne, und die weiche Frühlingsdämmerung umkleidete rings das weite All mit einem wundersamen Märchenschleier. Immer weiter schritt Hans leichtbeschwingten Trittes; wie die Pforten zum Palast des Glückes lag dort unten am Horizont ein breiter Streifen des leuchtenden Abendrotes vor seinen durstigen Blicken: war er nicht selbst am Ende ein rechter Märchenheld, der wahre »Hans im Glücke?«, der Hans im Glück, der nacheinander alle Kostbarkeiten verschleudert, um nach Haus zu eilen und dort das kostbarste Gut zu finden: köstliche Zufriedenheit im Arme der treuesten Liebe? Die Goldklumpen der Weisheit, die er in den letzten Tagen stöhnend mit sich herumgeschleppt, wie gern hatte er sie vertauscht gegen die »milchende Kuh« der neuen Schulamtswürde, und wie schnell hatte er auch diese Errungenschaft vergessen über dem einen Gefühl der Liebe zu der Einen, Herzigen, Unvergleichlichen — wie sehnte er sich, ihr heute noch die Hand zu drücken und ihr ins gute, treue Braunauge zu schauen — — —
Nun ward es dunkler und dunkler — hier auf den irdischen Fluren, doch droben in den ewigen Gefilden flammten die lieblichen Lichter auf. Die Nacht kam, und ein kühler Lufthauch strich wie die weiche Hand der Liebsten dem jungen, träumerisch in sich versunkenen Wanderer über die erhitzte Wange.
Die Heimat kam näher und näher. Dort hinten, noch eben sichtbar, erhob sich der Kirchturm seines Heimatdorfes, und dicht vor ihm tauchte jetzt die letzte Zwischenstation seiner Nachtwanderung, das freundliche Nachbardörfchen auf.
Als Hans hier in die breite Dorfstraße einbog, war es ihm, als sei er mit einem Male in das laute Gewühl einer großen Stadt versetzt worden: Männer, Frauen und Kinder waren trotz der späten Abendstunde noch in großer Zahl auf den Beinen, und um den Eingang zur »Linde«, dem größten Gasthofe des Ortes, drängte sich die Menge, wie die Bienen um das Flugloch ihres Stockes.
Hans trat an einen der Umstehenden heran, um zu erfahren, weshalb es hier heute noch so lebendig sei —
»Es ist ein Missionsprediger hier; heute nachmittag ist Missionsfest abgehalten worden, und es soll nun heute abend die übliche Nachfeier im Saale der »Linde« stattfinden!«
Das eben angezündete Licht in der Gasthofslaterne zeigte unserm Hans nun auch das Programm des heutigen Festes, wie es an dem einen Türflügel mit all seinen Gesangbuchversen, Predigttexten samt ihren beredten Auslegern und der schlußbildenden Nachfeier mit all ihren Requisiten beweiskräftiger Echtheit — Waffen, Flechtarbeiten, Gerätschaften etc. — angeklebt worden war.
»Mission unter den Papuas!« — Das waren die letzten Worte, die Hans von dem Zettel bei dem flackernden Laternenlichte herunterbuchstabieren konnte — dann schritt er, sich durch die immer noch zahlreich herbeiströmenden Menschen hindurchwindend, eilend dem andern Ausgange des Dorfes zu.
Kaum hatte er einige Schritte zurückgelegt, da entfuhr ihm ein halbunterdrückter Ruf der Überraschung — es hatte jemand im Vorbeieilen seine Schulter gestreift, und Hans hatte in ihm den Vater seiner Else erkannt, das freundliche, väterlichmilde Gesicht, das Hans so oft schon durch die Erzählung seiner Seminarschnurren aufgeheitert hatte.
Vater Liebreich schritt, ohne ihn erkannt zu haben, schnell weiter, der »Linde« zu.
Also Vater Liebreich wollte auch die »Mission unter den Papuas« unterstützen, — da stand Hansens Mission bei seiner Tochter nichts im Wege! — Sie war allein daheim und hütete das Haus, die kleine Hausfrau! Denn die Mutter war tot, und das war der einzige Punkt, den weder Hans noch Else im Gespräch mit dem Alten berühren durften.
— »Unter den Papuas!« Hans hatte niemals so sehr die Vorstellung gehabt, wie weit, wie entsetzlich weit und groß die Erde sei als in diesem Augenblick! Der Liebsten so nahe, fast auf Rufweite nahe, überfiel ihn plötzlich der schauderhafte Gedanke: wenn e r nun jetzt unter den Papuas auf NeuGuinea, weit, weit da draußen auf der Insel des Weltmeeres als Missionar säße, indes seine Else hier auf ihn warten müßte, entsetzlich, entsetzlich!
Der Gedanke peinigte ihn so, daß er die letzte halbe Stunde fast im Eilschritt zurücklegte, immer in der kindischen Angst, es könne die Mutter Erde plötzlich aus übermütiger Laune ihre Pole verändern, ihre Rinde verschieben, ihre Länder und Meere versetzen und ihn doch noch »zu den Papuas« befördern, noch ehe er die rettende Hand des treuen Mädchens fassen konnte.
Gott sei Dank! — da steht der Grenzstein seiner Heimatflur, da biegt die liebe, altbekannte Dorfstraße um die kleine Anhöhe, da schimmern durch die immer stärker dunkelnde Nacht die hell erleuchteten Fensterchen der Dorfhäuser.
Noch ein paar Dutzend Schritte — —
Ein inbrünstiges Gebet drängt sich unserm armen Hans auf die Lippen, ein Gebet, daß er die Heißgeliebte so wiederfinde, wie er sie verlassen, daß er sie in unsagbarem Glücke ans Herz schließen könne.
Nun steht er an ihrem Hause. Es ist ein neuerbautes, in städtischen Formen gehaltenes; denn der alte Liebreich hat jahrzehntelang in der Stadt gewohnt und sich auch hier inmitten der dörflichen Schlichtheit doch ein einigermaßen städtisches Heim geschaffen.
Die Fensterjalousieen sind herabgelassen — aber die Fenster dahinter sind dunkel...
Wie ein unheimliches Etwas voll Schreck und Schauder überfällt's den jungen Wanderer, als er die lichtlosen Fenster mitten zwischen den freundlich erleuchteten der Nachbarhäuser erblickt, wie die Ahnung eines herankriechenden Unheils.
Aber er kämpft die unerklärliche Empfindung nieder, schiebt die nur angelehnte Haustür auf und geht leisen, unhörbaren Schrittes über den dunklen Hausflur. Else muß zu Hause sein, sonst wäre das Haus verschlossen.
Nun steht er an der Thür des Wohnzimmers. Nur ein zollstarkes Brett trennt ihn noch von der Geliebten. Wie sind die Meilen, die Stunden, die Schritte zusammengeschrumpft bis auf diese winzige Schranke! Das Herz schlägt ihm bis zum Halse herauf, und er muß erst eine Weile nach Atem ringen. Nun hebt er die Finger, um anzuklopfen.
Da hört er halbunterdrückte Stimmen sprechen da drinnen, hört seine Else sprechen, hört nun eine andere Stimme dazwischen — eine M ä n n e rstimme!
»Gott sei gelobt, daß ich dich endlich, endlich wieder habe, mein lieber, lieber Gustav«, — sagt s i e .
»Wie gut du bist, daß du mir trotz allem, was gewesen, doch die Treue gehalten hast, mein Elschen!«, — sagt e r...
Der da mit weit aufgerissenen Augen draußen an der Zimmertür lehnt, streckt mit einem Male die Hände entsetzt vor sich hin, als sei eben durch das nächtliche Dunkel ein Blitzstrahl herniedergefahren, der ihn geblendet.
Ja, der Blitzstrahl, der das Gebäude seiner Hoffnungen, seiner Glückes- und Liebesträume jäh zerschmetterte! Else, seine Else mit einem Manne allein um diese Stunde — allein hinter dunklen Fenstern — —
»Meine herzensgute Else!« Wie der halberstickte Schrei eines Wahnsinnigen kamen diese Worte stoßweise über die Lippen des armen Hans — dann stürzte er aus ihrem Hause in die Nacht hinaus.
Wohin? — etwa zum Hause seines hochmütigen, kaltherzigen Vormundes — mit dieser Hölle im Herzen?
Nein, nur fort von hier, von ihr, weiter, weiter, und sei es bis ans Ende der Welt, nur wandern, rastlos, ziellos wandern!
Wie schlau sie es angefangen hatte, die Falsche, Ungetreue! Wie klug sie die Abwesenheit ihres braven Vaters benutzt hatte, um sich mit ihrem geliebten Gustav ein Stelldichein zu geben!
Darum also dunkle Fenster hinter den Jalousieen, damit kein Vorübergehender die Beiden beobachten konnte! — O Weibertreue, o Mädchenunschuld! — —
Allmächtiger Gott, konnte es denn sein? Es ergriff ihn wie ein Schwindel, und seine Gedanken begannen zu kreisen!
Mechanisch setzte er einen Fuß vor den andern, und heiße Tropfen rannen ihm über die Wangen.
»Else, hab' ich das um dich verdient? O Gott, konnten diese Augen lügen, diese treuen, herzensguten, freundlichen Augen? Konnte sie so ihn verraten an den ersten besten, sie, die sein altes Mütterchen geehrt und geliebt und in ihrer Krankheit gepflegt wie eine leibliche Tochter, sie, die bis zum letzten Tage bemüht war, der Leidenden Freude und Linderung zu bringen — seine treue, herzensgute Else?«
Aber die letzte Viertelstunde hatte ihm ja gezeigt, daß sie ihn vergessen, daß er sie für ewig verloren hatte.
Erst nun ging er langsamer, als er wieder in die Gemarkung des Nachbardorfes gekommen war. Nun war seine Straße leer, nur ein paar alte Mütterchen standen dort an der Hausecke, und drüben am Brunnen schäkerten die Dirnen — der größte Teil seiner Einwohner war wohl jetzt um den Missionar versammelt, um sich etwas von den Papuas erzählen zu lassen.
Noch ein kleines Gasthaus »zum Bären« lag am anderen Ende des Dorfes, und zu ihm lenkte nun der arme Heimatlose seine Schritte: Er mußte einen Bissen Brot zu sich nehmen, wenn er nicht ohnmächtig vor Erschöpfung und Aufregung am Wege liegen bleiben wollte.
Nun saß er einsam in dem kleinen Gastzimmerchen, und der gutmütige alte Wirt, ein rechter Dorfphilosoph — brachte ihm den verlangten Imbiß. Aber er vermochte kaum einen Bissen hinunterzuwürgen; das innere, grenzenlose Weh schnürte ihm die Kehle zu — und nur der frische Trunk des schäumenden Bieres ging über die brennenden Lippen. Dann bat er um Papier und Feder und schrieb beim Schein der trübe brennenden Hängelampe seiner Else den Abschiedsbrief:
»Else —
An Deiner Türe stand ich vor einer Stunde und hörte, daß Du mit einem Manne im Finstern saßest, um mit ihm zu kosen. Habe Dank für all das Gute und Herzliche, das Du meinem Mütterchen und mir erwiesen, und lebe wohl für ewig!
Hans Ehrlich.«
Dann kouvertierte er den Brief, adressierte ihn und rief den Wirt. Er bezahlte die kleine Zeche, gab dem Wirt das Schreiben mit der Bitte, es morgen ganz früh an die Adresse durch einen ehrlichen Boten zu bestellen — und schickte sich an zum Weiterwandern.
Vergebens nötigte ihn der Wirt zum Bleiben; vergebens suchte er den seltsamen jungen Gast dafür zu interessieren, daß drüben in der »Linde« ein Missionar von den »Paprikas« oder »so ähnlich« heißenden Menschenkindern erzähle — Hans ging!
Ging wie ein Träumender, Sinnloser, Taumelnder. Er sah nicht zurück, um nicht sein Herz auf's neue bluten zu machen, Sah also auch nicht, daß der alte Wirt ihm besorgt nachschaute, um die Richtung seines Weges zu beobachten, und dann kopfschüttelnd ins Gastzimmer zurückging, bedächtig die plumpe Stahlbrille aus dem Holzfutteral langte, sie mit dem roten Sacktuche fein säuberlich unter öfterem Anhauchen putzte — und dann den Brief ganz dicht an die Lampe heran und die Brille recht weit von den Augen abhielt, um die Adresse zu entziffern.
Sein wunderlicher Spätgast war unterdessen weiter und weiter geschritten und lenkte nun in den nahen Buchenwald ein. Die schlanken Stämme sahen kopfschüttelnd hernieder auf das einsame Menschenkind, das da wie ein Nachtwandler durch die rauschende, wispernde und flüsternde Waldnacht dahintappte. Wie lange Hans so gewandert, er wußte es nicht; — als die Füße unter ihm zusammenbrachen vor Erschöpfung und Müdigkeit, hatte er noch soviel Besinnung, daß er sich einen abgehauenem Baumstumpf dicht am Wege zur Stütze seines fiebernden, brennenden Hauptes aussuchte, dann sank er in tiefen Schlummer.
Nun waren zehn Jahre verflossen seit jenem schweren Abschiede von seiner Heimat und seiner Jugendliebe — zehn lange, mühevolle, gefahrenreiche Jahre! Wie in jener Abschiedsnacht die deutschen Buchen, so rauschten jetzt die Eukalyptusbäume NeuGuineas über seinem Haupte, und das hellfunkelnde Sternbild des Südlichen Kreuzes strahlte durch ihr zartes Geäst vom Himmel hernieder.
»Unter den Papuas« war er nun schon fast zehn Jahre! Wie ein Fingerzeig waren ihm in jener Nacht, als er neugestärkt aufgewacht, diese drei Worte erschienen! War auch sein Leben zerbrochen, so reichten doch vielleicht die Trümmer seiner Seele noch hin, um den armen Heiden zu dienen. Wie er dann weiter gewandert, wie er am andern Tage bis zur Hauptstadt gekommen, um sich dem »Komitee für die Mission unter den Papuas« vorzustellen und seine Zeugnisse einzureichen — wie er dann, nachdem er noch einen Kursus in der Malaiensprache absolviert, auf einem Schnelldampfer der Linie Hamburg—Singapore endlich an seinem Bestimmungsorte eingetroffen war — das alles lag heute hinter ihm wie ein wirrer, fremder Traum.
Heut war er zufrieden mit seinem Schicksal, das ihn hierhergeführt, heut dachte er auch ohne Groll an die zurück, die ihn einst so schnöd verraten; sein Herz war heut mild und dankbar gestimmt; denn nach tausendfach vergeblichen Mühen, nach fast zehnjährigem Arbeiten an den büschelhaarigen Heiden war es ihm heute gelungen, den jungen Sohn des Häuptlings — Ulubagubalua — zu taufen, den ersten Bekenner der neuen Lehre, die erste Frucht seiner Mühe als Missionar.
Ulubagubalua war der präsumtive Thronerbe des alten Stammeshäuptlings. Es hatte ja mehr Arbeit gekostet als die Arbeiten des Sisyphus und der Danaiden zusammengenommen, dem jungen Manne die Vorliebe für Menschenfleisch abzugewöhnen — aber es war doch gelungen, dank der reichlichen Geschenke des Missionskomitees für den jungen Wilden — heute nachmittag war Ulubagubalua getauft worden und mit ihm zehn seiner Stammesgenossen.
Seines endlichen Erfolges froh, streckte sich Hans Ehrlich darum zufrieden auf seiner Palmenmatte aus.
Seltsam war es doch, daß er heute Abend soviel an die Verlorene denken mußte! Was sie wohl damals gefühlt, als sie seinen Brief empfangen? Wie sie wohl lebte? Ob sie wohl glücklich geworden war mit ihrem Gustav?...
Er war nach und nach in Halbschlummer gesunken— plötzlich schreckte er auf: der Mattenvorhang seiner Hütte hatte sich bewegt; sein Diener Kän— Gu—Ruh stand vor ihm, atemlos, an allen Gliedern bebend.
»Herr, guter Herr, fliehen, Feinde kommen, wollen guten Herrn fressen!« — Damit stürzte Kän—Gu—Ruh hinaus und floh.
Hans sprang auf. Fliehen, heute, wo er festen Fuß gefaßt unter den Papuas? — Er trat an den Mattenvorhang und spähte hinaus. In einer Entfernung von fünfhundert Schritten bewegte sich ein wüster Haufe von Eingeborenen. — Die mitgebrachten Feuerbrände warfen gespenstische Streiflichter auf die Höllenbrut mit ihren scheußlich bemalten Gesichtern. An ihrer Spitze schritt seine Todfeindin, die glutäugige Prinzessin »Tulimulihuli«, das Schnabeltier zu Deutsch, die in ihrer Jugend mit dem heute getauften Ulubagubalua verlobt worden, von ihm jedoch seit einiger Zeit verabscheut worden war, weil sie eine unausrottbare Leidenschaft für die Ohren kleiner Kinder, in Palmöl gesotten, an den Tag legte.
Hans war verloren, wenn es ihm nicht gelang, die Küste zu erreichen. Durch die Nacht klang bis her zu ihm das Rauschen der Wogen, die sich an den steilen Uferfelsen brachen. Noch schienen ihn die Kannibalen nicht gemerkt zu haben. Er kroch unter einem der Zeltvorhänge hindurch ins Freie und eilte, so schnell es ihm die dunkle Tropennacht gestattete, seewärts. —
Wohl eine Viertelstunde mochte er so unbehelligt weiter gekommen sein, als ein Gebrüll dicht hinter ihm verriet, daß die Kannibalen seine leere Hütte entdeckt, seine Spur gefunden hatten und ihm dicht auf den Fersen waren. Vergebens verdoppelte Hans seine Schritte, vergebens suchte er durch Kreuz- und Quersprünge seine Verfolger irre zu leiten — immer näher klang ihr gellendes Heulen, immer heller leuchteten hinter ihm die Feuerbrände seiner Feinde.
Da lief ein breiter, ziemlich tiefer Bodenspalt, wohl das Bett eines jetzt in der trockenen Jahreszeit versiegten Baches, quer über seinen Weg. Hans mußte hinüber; vielleicht gelang es nur wenigen seiner Verfolger, ihm nachzufolgen.
Eine Sekunde lang stand er still, um Atem zu schöpfen — dann nahm er einen Anlauf, und wie ein Pfeil sauste sein schlanker Körper über die Tiefe hinweg und erreichte glücklich das andere Ufer.
Doch, o Schrecken! als er sich erheben wollte, um weiter zu eilen, indes seine teuflischen Verfolger am jenseitigen Rande des Spalts angekommen waren und ihre Pfeile ihn umschwirrten — da sank er mit einem Schmerzensschrei wieder nieder: bei dem kühnen Sprunge hatte er sich das Gelenk des einen Fußes verstaucht und vermochte nicht aufzutreten.
Wohl versuchte er noch einmal, sich wie ein gehetztes Wild auf allen Vieren fortzuschleppen, doch nach ein paar ohnmächtigen Anstrengungen sank er zusammen, Gott seine Seele befehlend. — — —
Da fühlte er sich am Arme ergriffen, trotz seiner verzweifelten Gegenwehr festgehalten und aufgerichtet.
»Hans, mein herzensguter, armer Hans!«, klang es ihm wie die Stimme eines himmlischen Engels ins Ohr.
Er öffnete die Augen und sah das Antlitz über sich geneigt, das ihm lieb war, wie keines in der weiten Welt — seiner treuen Else Antlitz!
»Else, meine Else — Du hier bei mir? Aber die Papuas — sie werden kommen die Menschenfresser!«
»Die Papuas, Hans, Du redest im Fieber.«
»Nein, nicht im Fieber«, sagt Hans nun, sich den letzten Schlaf aus den Augen reibend, »nicht im Fieber — aber im Traum!« Und ein glückliches Lächeln der befreiten Seele ging wie ein Sonnenstrahl über sein Gesicht.
»Doch du, Else, wie kommst du hierher, und wer ist der Herr, der mit dir gekommen?«
Plötzlich entfärbt sich sein Antlitz wieder; die Erlebnisse des gestrigen Tages fallen ihm ein. — —
»Fräulein Liebreich, gestatten Sie mir, wenn auch zur ungelegenen Zeit und an einem so wunderbaren Orte, als es immer ein abgehauener Buchenstamm mitten im Walde sein mag, Ihnen zu Ihrer Verlobung mit Herrn Gustav — Gustav —«
Hans blickt den mit einem sonnig ernsten Lächeln dreinschauenden Begleiter Else's an, in der Erwartung, daß dieser sich ihm vorstellen werde.
»Gustav Liebreich«, — sagt der nun mit einer Verbeugung.
»Else, wer ist das, ist das — aber nein — der starb ja als Achtzehnjähriger, wie du sagtest — wer ist das, Else?
»Mein Bruder Gustav, du armer lieber Hans, den ich dir fälschlich für tot erklärt, weil Vater ihm zürnte und sich von ihm losgesagt hatte, der aber gestern abend heimgekehrt ist und sich mit Vater versöhnt hat.«
»Dein Bruder!« Mit einem Jubelschrei preßte er nun Gustav an sein Herz. Nicht wahr, du weißt alles, weißt, wie es zwischen Else und mir steht, Gustav? Nimm mich als Schwager an!
Und ein herzlicher Kuß besiegelt die neue Brüderschaft.
»Erkennst du nun deinen unseligen Irrtum, mein Hans?«, fragt Else und nimmt zärtlich sein Haupt zwischen ihre Hände.
Hans sagt nichts; er umfaßt sie stumm und weint an ihrer Brust Tränen des Glückes.
»Aber«, fragt Hans nach einer kleinen Weile — »wie kommt ihr hierher?«
»Als ich heute morgen deinen Brief erhielt, machten Gustav und ich uns gleich auf den Weg, deine Spur zu verfolgen. Zum Glück konnte uns der alte Wirt zum »Bären« sagen, welchen Weg du eingeschlagen. Zum Glück warest du bald müde geworden und lagest dicht am Wege, wo wir dich fanden — da hast du die Erklärung lieber, guter Hans!«
Hans drückt beiden selig lächelnd die Hand.
»Also war ich nicht unter den Papuas?«
»Was hast du nur mit den Papuas?«, fragt Else ängstlich.
»Ich habe einen Umweg gemacht diese Nacht«, sagt Hans geheimnisvoll, »ich war zu den Papuas gegangen, weil ich mich von dir verraten glaubte, kleine Else, zu den Papuas als Missionar zehn Jahre lang.«
»Gott sei Dank, Hans, daß es nur im Traum war, daß ich dich noch ereilt habe, ehe du vielleicht in Wirklichkeit diesen Schritt getan hättest, du lieber, du Guter«, flüstert Else und küßt ihm die heiterstrahlenden Augen.
»Ein Irr- und Umweg zu den Papuas war nötig, um mich wieder zu dir zurückzuführen, Else! Wer weiß, wo ich jetzt in meiner Verzweiflung um dich schon wäre, wenn ich nicht im Traum derweil bei den Papuas auf NeuGuinea mich aufgehalten hätte.« —
»Aber ich, Schwager Hans, war in Wirklichkeit bei ihnen«, sagt nun Gustav — »ja, ja, Schwesterchen, in einer Faktorei auf NeuGuinea, drei Jahre.« —
»O, sagte Else, was mußt du alles erlitten haben mein lieber, lieber Gustav!« Damit zieht sie den schlankgewachsenen jungen Mann zu sich herab und küßt ihn, dann sagt sie zu Hans:
»Heut kannst du es hören, Hans, und Gustav kann es auch hören ohne Reue. Gustav ging als junger Sausewind von achtzehn Jahren heimlich in die Fremde, als Schiffsjunge, und ließ uns drei, Mutter, Vater und mich, jahrelang ohne Nachricht. Mutter starb darüber und Vater sagte sich los von ihm; wir wußten ja nicht, daß sein Schiff gestrandet und er jahrelang mit dreien seiner Gefährten allein auf einer Insel gewesen war. Als ihn dann ein englisches Schiff aufnahm und er Nachrichten über sein Schicksal hierhersandte, da war die liebe Mutter schon heimgegangen. —
Dann hat Gustav in der Fremde fleißig gelernt, hat in Sydney sein Ingenieurexamen bestanden und ist nun heimgekehrt, um hier eine Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen nach australischem Muster anzulegen. Da hast du die Lebensgeschichte des lieben, bösen Bruders, Schatz!«
— »Also in Wahrheit ›unter den Papuas‹ bist du gewesen, Gustav?«, — fragt Hans.
Gustav nickt, ernst lächelnd.
»Und hast du vielleicht meinen Freund Ulubagubalua kennen gelernt?«, fragt Hans heiter.
»Ulu — Ulugu — Uluba — u.s.w.? — Nein, hatte nicht die Ehre«, sagt Gustav verwundert.
»Auch nicht die liebenswürdige Schöne Tulimulihuli, lieber Schwager?«, neckt Hans weiter den verdutzt Dreinschauenden.
»Auch diese schöne Unaussprechliche leider nicht, du übermütiger Hans!«
»Aber«, ruft da Else, die sprachlos ob dieser Vokabulierkünste ihres Liebsten stehen geblieben und nun erst Worte gefunden hat — »aber wo giebt es denn diese entsetzlichen Namen, Hans?«
»Unter den Papuas!«, sagt er im Übermut seines Herzens, und Arm in Arm schreiten die drei nun vorwärts, heiter lächelnd, der Heimat und dem Glücke entgegen.
Nun hast mein Buch zu Ende Du gelesen,
Legst es zufrieden, hoff' ich, aus der Hand;
»Im ird'schen Jenseits« bist Du ja gewesen,
Im Reich des Traum's, der Phantasieen Land: —
Frei waltet dort der schaffende Gedanke,
Und das Gesetz nur zeichnet ihm die Bahn;
H i e r baut die Wirklichkeit ihm Schrank' um Schranke,
D o r t sind ihm a l l e Kräfte untertan!
D o r t ist vollendet, was wir h i e r begonnen,
Dort steh'n die Grenzen nicht von Zeit und Raum,
Dort strahlen hell der Zukunft große Sonnen,
D o r t ist erreicht, was h i e r ein schöner Traum!
— Und bist Du gern durch dieses Reich gezogen,
Und willst Du wieder mein Begleiter sein —
Und bleibt der Herr Verleger uns gewogen —
So lad' ich Dich zur n ä c h s t e n Reise ein!
Laß uns die Hände ineinander legen:
« A u f W i e d e r s e h ' n ! « sei unser Abschiedssegen.
— Carl Grunert.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.