
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
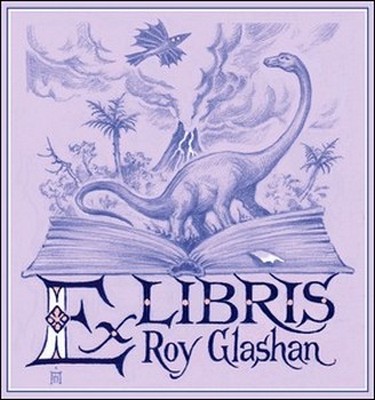
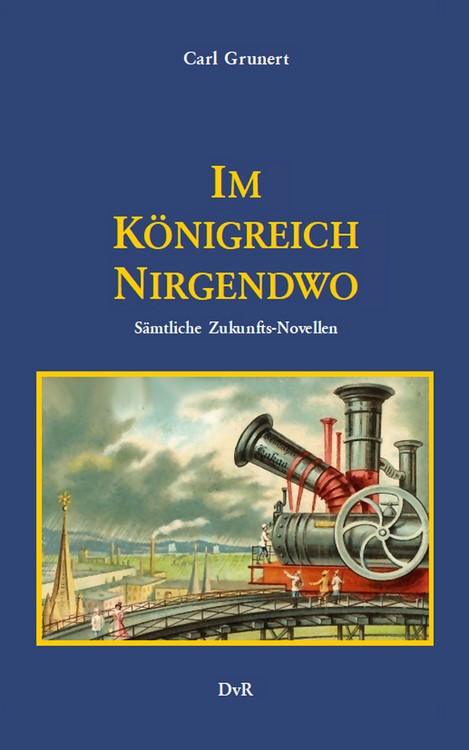
"Im Königreich Nirgendwom," DvR-Ausgabe

"Feinde im Weltall? und andere Novellen"
(Kosmos-Novellen). Stuttgart: Franckh'sche
Verlagshandlung (W. Keller & Co.), o.J. [1907]. 80 S.
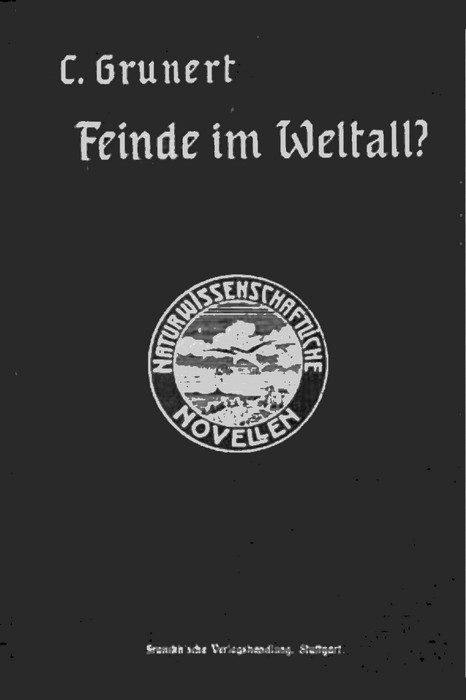
"Feinde im Weltall? und andere Novellen"
(Kosmos-Novellen). Stuttgart: Franckh'sche
Verlagshandlung (W. Keller & Co.), o.J. [1907]. 4. Aufl.
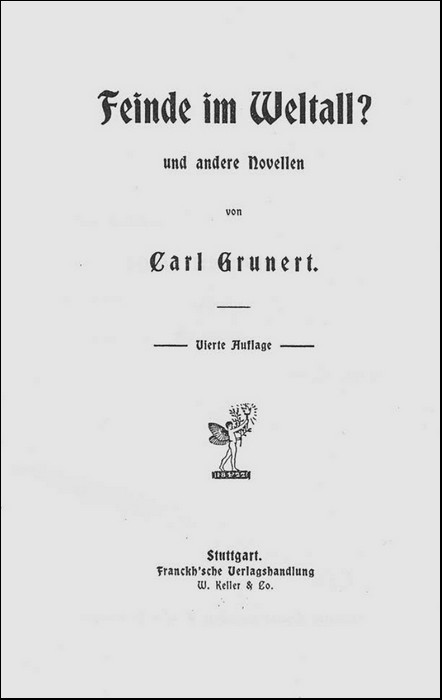
Carl Grunert: "Feinde im Weltall? und andere
Novellen". — Stuttgart: Franckh'sche
Verlagshandlung (W. Keller & Co), 4. Aufl. o.J.
[1907/08], Titelseite (S. III, unpaginiert)
Er sank auf den Stuhl am Fenster und stützte den Kopf in die Hand. — Wieder einmal war er am Ende seiner Hoffnungen, und die Arbeit langer Monate schien vergebens zu sein. Gerade heut am Todestage seiner Schwester traf ihn die Enttäuschung doppelt hart. Wie sehnte er sich in dieser Stunde nach ihrem tröstenden Zuspruch, nach ihrer treuen, liebreichen Hand: Er schloß die Augen, um sich die Frühverlorene deutlicher in die Erinnerung zurückzurufen; er dachte an so manches gute Wort aus ihrem Munde, an all die Zeichen schwesterlicher Liebe für ihn bis zur letzten Stunde. —
Aber er muß heute allein Herr seines Kummers werden; keine Brücke schlägt sich von hier nach dort, keine Hand faßt mehr die seine...
Justus blickte auf. Dicht vor seinem Fenster stieg die kahle graue Giebelwand des Nachbarhauses empor. Wie so oft schon erschien sie ihm als ein Bild seiner Zukunft, so leer, so steinern, so verschlossen. Aber es war etwas in diesem jungen Grübler, das härter war als die Steinwand da draußen, etwas, das ihn immer und immer wieder antrieb. In diesem schlichten, unscheinbaren Körper herrschte eine diamantene Seele. — Jedem andern wäre dieses Arbeitszimmer, fast fünf Treppen hoch im Hinterhause einer Mietskaserne an der Peripherie der Weltstadt, mit seinem grauen Einerlei draußen und drinnen, zum Kerker geworden, der alles Leben und Streben ertötet; Justus Starck empfand auch das alte Einerlei, aber er fühlte zugleich in sich die Kraft, diese engen Schranken durch die Arbeit seines Geistes zu durchbrechen. Und so endete seine Gedankenreihe, nun sie wieder einmal an der Steinwand gegenüber zuerst angeprallt war, mit einer innerlichen Selbstbefreiung.
Justus Starck war armer Leute Kind, besaß keinerlei Protektion oder Konnexion und hatte sich durch eigene Arbeit und Weiterbildung den Posten eines Konstruktionszeichners an einem großen Elektrizitätswerke errungen. — War das eine Freude gewesen, als die beiden frühverwaisten Geschwister, die wenige Jahre ältere Schwester, die Kunststickerin war, und er seine Anstellung bei der berühmten Weltfirma gefeiert hatten! Nun konnte er doch auch regelmäßig sein Teil zum Lebensunterhalt beitragen. Und wie glücklich lebten Beate und er miteinander! In den drei Jahren war es Frühling in ihm geworden. Manche gute Idee hatte er gehabt bei seinen Arbeiten, mancher große Plan keimte in seinem Geiste.
— — Dann starb die Schwester. Justus verlor in ihr zum zweitenmale eine Mutter. Er mußte seinen Weg durchs Leben allein suchen. Er mietete eine kleine Wohnung, und der Zufall führte ihn hierher, wo er jetzt hauste. Nach dem Tode der Schwester arbeitete Justus eifriger als je. Nicht allein die Facharbeit in seinem Bureau beschäftigte ihn, angestrengter und intensiver war seine Tätigkeit im Erfinden und Konstruieren. Manche Verbesserung an diesem und jenem Apparate des Elektrizitätswerkes rührte von dem einfachen Konstruktionszeichner her; aber seine Ideen gingen höher, weiter...
Seit vielen Monden sann er über einen verbesserten Empfänger nach für die Telegraphie mit Hertz'schen Wellen — die drahtlose Telegraphie, die durch die Arbeiten eines Marconi, Slaby und Arco, Braun etc. lebensfähig geworden und ihre ungeheure Wichtigkeit z.B. im russisch-japanischen Kriege erwiesen hatte. Aber der Aktionsradius der verwendeten Systeme blieb immer noch verhältnismäßig klein, trotz der dabei benutzten hohen elektrischen Spannungen. Die einzige Möglichkeit einer Telegraphie ohne Draht auf sehr weite Entfernungen lag nur in einer Steigerung der Empfindlichkeit des Empfangsapparates, des Kohärers oder Fritters. Dies ist ein aus Metallfeilspänen hergestellter elektrischer Widerstand, der unter dem Anprall der Hertz'schen Oszillationen gut leitend wird und dadurch einen Telegraphierstromkreis so lange betätigt, als die elektrischen Wellen am Sender erzeugt werden.
Und an diesem kleinen Apparate, der eigentlich nichts weiter ist, als eine fingerlange, enge Glasröhre mit zwei Silberkölbchen, die zwischen sich einen millimeterbreiten, durch Metallfeilicht ausgefüllten Spalt lassen, setzte das erfinderische Genie des jungen Mannes ein. — Es ist noch immer unbekannt, wodurch er die Empfindlichkeit seines Empfängers so ungeheuer steigern konnte, — ob durch eine neue oder besonders präparierte Art der Feilspäne, ob durch Konstruktion eines magnetischen Detektors, ob durch einen Kohärer aus organischer Materie — jedenfalls setzte die ungeheuer große Empfindlichkeit des Apparates die Fachleute der Gesellschaft »Fernfunke«, die ihn soeben geprüft hatten, in grenzenloses Erstaunen.
Und warum hatte man den jungen Erfinder abgewiesen, trotzdem abgewiesen? Er wußte es selbst nicht. Vielleicht spielten persönliche Einflüsse dabei eine Rolle, vielleicht war die Gesellschaft mißtrauisch gegen die Erfindung eines »Nichtzünftigen« — offiziell teilte man ihm mit, daß sein Empfänger wegen übergroßer Empfindlichkeit für die Apparate des Systems »Fernfunke« leider nicht passe.
Justus war aufgestanden und hielt den kleinen Apparat nachdenklich in der Rechten. Niemand als der Erfinder wußte, welche Summe von Gehirnarbeit in dem unscheinbaren Kästchen steckte. Und für ihn hatte die Erfindung und ihre Annahme oder Ablehnung noch eine höhere als nur materielle Bedeutung: sie sollte ihm die Möglichkeit schaffen, durch ein regelrechtes Studium die in harter Selbstbildung geschmiedeten Waffen seines Geistes schärfer und glänzender zu schleifen, als es ihm bisher möglich gewesen.
Ganz in der Ferne, hinter seinen Studienplänen, stand noch ein anderes Bild der Zukunft. Und es trat jetzt, da es auf immer für ihn verloren schien, mit unsagbar süßer Lockung vor seine Seele. Wie durch einen Nebel sah er es vor sich, das stolze, schöne Mädchenbild, das seit Jahr und Tag in seines Herzens Herzen wohnte — Gabriele.
Gewiß dachte die vornehme junge Dame kaum einmal des einfachen Mannes, dessen flüchtige Bekanntschaft sie in den Bureaux der Elektrizitätswerke gemacht hatte, zu deren Direktoren ihr Vater gehörte; — um so tiefer war dieser Eindruck auf Justus gewesen, und seine Liebe war so stark, weil sie so hoffnungslos war.
— Aber das schöne Traumbild verschwand wieder vor seinem inneren Auge. Der alte Kampfesmut regte sich in ihm. »Sie sollen mich kennen lernen!« Mit diesen laut hervorgestoßenen Worten setzte er den kunstvollen Apparat auf seinen Arbeitstisch zurück und schaltete ihn in den Empfangsstromkreis ein, den er für seine Versuche aufgebaut hatte.
Nicht zuletzt hatte Justus bei der Wahl seiner Behausung hier oben im fünften Stock am Ende der Weltstadt der Gedanke geleitet, sich einen bequemen Zugang zum Dach des Hauses zu sichern; denn da oben stand der sinnreich aus einem System von Stangen und Drähten aufgebaute Auffangeapparat, der auf die feinsten elektrischen Wellen abgestimmt und durch eine leitende Drahtschlinge mit dem kleinen Kohärer auf Justus' Arbeitstische verbunden war...
Es war kurz vor Mitternacht, als Justus wieder in sein Zimmer trat. Der Mond schien hell hinein, und die auf dem Tische aufgestellten Apparate glänzten geheimnisvoll in seinem magischen Lichte. Der junge Erfinder hatte nach seinem schnell eingenommenen Abendessen eine lange Fußwanderung unternommen. Auf diesen einsamen Wegen hielt er am liebsten stille Zwiesprache mit seinem Genius, und alles Gute und Große wurde in diesen Stunden in ihm wach. Körperlich müde, aber geistig munter und wieder frei von der schweren Last des Unmutes über die erlittene Enttäuschung, setzte er sich noch einen Augenblick an seinen Schreibtisch.
Und dieser Moment wurde entscheidend für seine Zukunft: Justus saß mit geschlossenen Augen, aber völlig wach. Da vernahm er plötzlich ein feines Klappern vom Apparat her, so leise, daß er anfangs an eine Sinnestäuschung glaubte. Mit weitgeöffneten Augen starrte er auf den Empfänger. Jetzt hörte er wieder und s a h im vollen Scheine des Mondlichts den Schreibstift des Morseapparates sich bewegen. Instinktiv setzte er das Uhrwerk in Gang, das den Papierstreifen abrollte. Dann erst machte er Licht im Zimmer.
Das Rasseln des ablaufenden Uhrwerks übertönte zwar das feine Klopfen des Schreibstifts, aber mit der Lupe erkannte Justus auf dem sich abrollenden Depeschenbande feine Punkte und Striche, die auch dem bloßen Auge deutlich sichtbar wurden, als er den Strom der Arbeitsbatterie verstärkte.
Nach einigen Sekunden hörte die geheimnisvolle Tätigkeit des Empfangsapparates auf. Justus aber fand auf dem abgelaufenen Papierstreifen folgende Zeilen in Morseschrift:
· · · · · · · · — · · — · — · · · · · —
— · · · · · · · — · — — · · — ·
— · · · — — — — — — · · · · — ·
· — — · · · · — · · · — — ·
— — · · · · · · · · — — · ·
— · · · — — — · · — · · — · ·
— — · — — · — — — — — · · — —
· · — · · — · · · · · — ·
· · · · · — · — · · — — — · · — —
In die Buchstaben des gewöhnlichen Alphabets übertragen, heißt dies:
Hesternev dei ingendemoni enemi elangis? Nugae rempo! Inedef henna!
Und diese rätselhaften Worte wiederholten sich auf dem Papierstreifen verschiedene Male.
Justus ließ das Depeschenband immer und immer wieder durch seine Finger gleiten. Was bedeuteten diese seltsamen Laute? Sie stammten offenbar aus keiner der bekannten lebenden Sprachen. Einige Anklänge fanden sich allerdings, so an das lateinische in »dei«, »nugae»; »enemi« konnte durch einen Schreibfehler aus dem französischen »ennemi« entstanden sein; aber all die anderen: »hesternev«, »elangis«, »rempo«, »inedef«, »henna« und namentlich das merkwürdige »ingendemoni« blieben völlige Hieroglyphen.
Wie oft mochte die geheimnisvolle Botschaft schon aus unbekannter Ferne erklungen sein! Wie oft schon in dunkler Nacht der Schreibstift an dem Empfangsapparate die mystischen Laute geschrieben haben! Da aber niemand den Papierstreifen unter ihm abrollen ließ, flossen alle Zeichen zu einem einzigen Punkte zusammen. Jetzt erinnerte sich Justus, schon manchmal einen solchen auf dem Papier gefunden zu haben. Er hatte dabei aber nur an eine zufällige Erschütterung des Schreibankers gedacht und ihn nicht weiter beachtet.
Der ernste, kühldenkende Justus geriet in um so größere Aufregung, je länger er über die Deutung der seltsamen Worte nachsann. Endlich aber — es war schon drei Uhr nach Mitternacht, suchte er doch sein Lager auf. Vorher hatte er noch das Uhrwerk des Empfangsapparates in Betrieb gesetzt. Und trotz der fieberhaften Erregung schlief er bei dem monotonen Geräusch des langsam abrollenden Papierstreifens doch schließlich ein.
Als er früh erwachte, fiel sein erster Blick auf die rätselhaften Worte, sein zweiter auf die große Menge abgerollten Depeschenbandes vor seinem Arbeitstische.
Mit einem Satze fuhr er vom Lager auf.
Ein großer Teil des abgelaufenen Papierstreifens war mit Morsezeichen bedeckt, und überall lasen seine erstaunten Blicke dasselbe — immer dasselbe in hundertfacher Wiederholung — nur die Worte »Hesternev dei ingendemoni enemi elangis? Nugae rempo! Inedef henna!«
Seine erste Sorge war, irgendein Dechiffrierbureau der Weltstadt ausfindig zu machen und ihm die Rätselworte zur Entzifferung vorzulegen. Natürlich verschwieg er dabei ihre Herkunft.
Er selbst auch mühte sich ab in hundertfachen Kombinationen, Sinn in die Hieroglyphen zu bringen. — Was er still gefürchtet, traf ein. Das Dechiffrierbureau erklärte, daß die fraglichen Worte nach keinem der bekannten Dechiffriersysteme gebildet seien und wahrscheinlich willkürliche Lautzusammenwürfelungen darstellten. Ein zweites und drittes Bureau antworteten ähnlich.
Nun begann er mißtrauisch gegen die richtige Übertragung der Zeichen zu werden. Allerdings hatte er die unter den Völkern des Weltverkehrs gültigen Zeichen der Morseschrift in die entsprechenden Buchstaben übertragen; aber entsprachen die geheimnisvollen Zeichen auch diesen Lauten? Wenn z. B. gleich das erste Zeichen · · · · nicht den Buchstaben »h«, sondern einen beliebigen andern bedeutete, wie sollte da jemals eine Entzifferung möglich sein?
Aber welchen Zweck konnte dann die ganze mysteriöse Wellendepesche haben? Was verfolgte der unbekannte Absender dann für einen Zweck mit der hundertfachen Wiederholung der gleichen Worte? War vielleicht doch das Ganze nicht nur ein Spiel des Zufalls? Eine Influenzwirkung der atmosphärischen Elektrizität oder sonstiger elektrischer Störungen in der Erdrinde? Aber die hundertfachen Wiederholungen? Ließen sich diese auf hundertmal g l e i c h auftretende elektrische Phänomene zurückführen? Nein — es war und blieb eine geheimnisvolle Botschaft; aber wer und wo war ihr Sender?
Auch bei der internationalen Gesellschaft für drahtlose Telegraphie »Fernfunke« hatte er angefragt, ob die Gesellschaft dieses rätselhafte Telegramm, das ihm sein Empfänger übermittelt, nach irgendeinem Orte der Welt aufgegeben habe. Man tat dem vor kurzem abgewiesenen Erfinder den Gefallen, in den Sendestationen der über die ganze Welt verbreiteten Gesellschaft anzufragen. Die Antwort lautete: »Nein«, Diese Antwort hatte sich Justus schon selbst gegeben; denn sein ungeheuer empfindlicher Kohärer war durch Einschaltung eigenartig angeordneter Abstimmspulen gegen jede Störung dieser Art gesichert.
So saß er eines Nachmittags, nach Beendigung seiner Bureaustunden, wieder vor seinem Apparat. Vor ihm lag die Abschrift der unglückseligen Depesche, die ihm seit vielen Tagen die Ruhe raubte. Von neuem zermarterte er sein Gehirn, um eine Deutung zu finden. In den blanken Messingteilen des Instruments spiegelten sich die rätselhaften Worte und da —
— Da sprang er auf! Er hatte in den gespiegelten Schriftzeichen plötzlich ein Wort entziffern können, ein klar verständliches, inhaltsschweres Wort, das letzte Wort des ersten Satzes — es hieß, rückwärts gelesen: »Signale«,
Wie ein Blitzstrahl durchzuckte ihn diese Entdeckung! Das erste Licht in so viel Dunkelheit! R ü c k w ä r t s mußte man also die Zeichen lesen! Sofort versuchte er dieses einfache Mittel beim ersten Wort: »hesternev«, Das ergab aber leider so gelesen keinen Sinn. Er versuchte es bei all den übrigen und mußte einsehen, daß diese Methode bei allen versagte!
« S i g n a l e « — das blieb bis jetzt der einzige Sinn in dem Sinnlosen. Aber eine unumstößliche Gewißheit erwuchs ihm aus diesem einzigen Wort, daß die geheimnisvolle Botschaft die eines vernünftigen Wesens sei, nicht ein Zufallsspiel bunt zusammengewürfelter Laute.
Und nun suchte er Schritt für Schritt in das Verständnis der Depesche einzudringen. Er erinnerte sich der Anagramme und ähnlicher Buchstabenkunststücke seiner Jugendzeit und fing nun an, e i n e n Buchstaben mit jedem andern desselben Wortes zu verbinden, um zu sprachrichtigen Silben und Wörtern zu gelangen. Zuerst gelang ihm das, wider Erwarten, bei dem neunlautigen ersten Wort: »hesternev»: das deutsche Wort: « v e r s t e h e n «, bestand aus derselben Zahl und den gleichen Buchstaben. Das Wort »dei« lieferte beim Umstellen seiner Buchstaben das einfache Wörtchen »die«, So ergab das scheinbar französische »enemi« das Wort »meine«, »Nugae rempo!« entpuppte sich als « A u g e n e m p o r ! « — »Inedef henna!« lieferte die Worte « F e i n d e n a h e n ! « —
Damit hatte Justus achtneuntel des geheimnisvollen Telegramms entziffert und die Worte erhalten:
« V e r s t e h e n d i e... m e i n e S i g n a l e ? A u g e n e m p o r ! F e i n d e n a h e n ! «
Nur das einzige, geheimnisvolle »ingendemoni« trotzte allen seinen Deutungsversuchen. Unzählige Varianten hatte er schon von den rätselhaften elf Lauten aufs Papier geworfen — vergebens! Er dachte an die große Zahl von Lautbildern, die durch das Umstellen von nur wenigen Lauten möglich werden — liefert doch z. B. ein nur vierlautiges Wort fast ein viertelhundert Varianten, und diese Möglichkeit der Umsetzung wächst mit der Lautzahl unheimlich, nach den Regeln der Permutationsrechnung.
Die Stunden flogen, Justus merkte es nicht. Er vergaß Essen und Trinken. Sein Kopf glühte! Dies e i n e Wort enthielt den Sinn der ganzen mysteriösen Depesche! Sollte er noch im Hafen scheitern? — Endlich, endlich — die Augen hatten zuletzt fast ihren Dienst versagt — brachte eine letzte Kombination die Lösung, und um Mitternacht hielt Justus das völlig entzifferte Telegramm in der Hand, das ihm die Schwingungen des Weltäthers herübergetragen hatten aus unbekannten Fernen des Weltraumes, und es lautete:
« V e r s t e h e n d i e E i n m o n d i g e n m e i n e
S i g n a l e ? A u g e n e m p o r ! F e i n d e n a h e n ! «
Am nächsten Tage hatte Justus eine Audienz beim Reichskanzler. Er legte ihm das seltsame Telegramm und seine hundertfachen Wiederholungen auf dem Depeschenband vor und gab die von ihm gefundene Deutung. Der Reichskanzler versprach, der geheimnisvollen Angelegenheit sofort näher zu treten.
Zunächst berief er eine Konferenz von Sachverständigen auf den Gebieten der Elektrizität, Astronomie, Meteorologie und Telegraphie, denen Justus eine eingehende Darlegung seiner Entdeckung gab. Der kleine unscheinbare Empfangsapparat stand dabei vor ihm auf dem Tische des Sitzungszimmers, genau in der Anordnung montiert, in der er, von unsichtbaren Kräften beseelt, das geheimnisvolle Telegramm aufgezeichnet hatte.
Von dem einen Ende des Kohärers lief ein feiner Kupferdraht hinauf nach der Zimmerdecke und von da nach dem System von Auffangedrähten auf dem Dache des ReichskanzlerPalais; denn Justus hatte, um den eingeladenen Sachverständigen eine völlig einwandfreie Prüfung der geheimnisvollen Sachlage zu ermöglichen, genau die gleiche Anordnung im Aufbau seiner Apparate getroffen, wie sie daheim in seiner Dachwohnung bei der Aufnahme des mysteriösen Telegramms vorhanden war.
Leider vermochte der junge Erfinder nur wenige der anwesenden wissenschaftlichen Größen von seiner Auffassung der Sache zu überzeugen, daß die Depesche einen außerirdischen, interplanetarischen Charakter habe und von den Bewohnern irgendeines unserer Nachbarplaneten — etwa des Mars oder der Venus — herrühren dürfte.
Die meisten der Sachverständigen hielten das Ganze für eine Mystifikation oder für eine aus Selbsttäuschungen und unbekannten elektrischen Störungen entstandene Zufälligkeit.
»Kann uns der Herr Entdecker sagen«, ließ sich z. B. einer der Herren Elektriker vernehmen, »wo sein himmlischer Absender die deutsche Sprache und das MorseAlphabet gelernt hat?«
Ein spöttisches Lächeln begleitete diese Frage, und ein ebensolches zeigte sich auf den Gesichtern der meisten Anwesenden.
Justus blieb ruhig und ernst.
»Und wenn wir einmal einen Moment diese vom Herrn Vorredner erwähnten zwei Unmöglichkeiten als möglich gelten lassen«, sagte ein anderer, »kann der Herr — Herr — Starck einen Sinn damit verbinden, daß der extramundane Telegraphist seine Warnungsbotschaft so hinter Wortspielereien versteckt hat, daß es, wie ich anerkennen muß, eines nicht gewöhnlichen Scharfsinnes erst bedurfte, um sie überhaupt enträtseln zu können?«
»— vorausgesetzt, Herr Kollege«, fiel ein dritter ein, »daß Herrn Starck die Deutung überhaupt richtig gelungen ist! Vielleicht würde ein Engländer oder Franzose oder Russe usw. mit ähnlicher Kombinationsgabe eine Reihe ganz anderer Wörter in seiner Sprache und damit auch einen ganz anderen Sinn herauslesen!«
»Ich möchte unserem jungen Freunde insofern zu Hilfe kommen«, äußerte hierauf der Leiter der Sternwarte der Hauptstadt, — ein weißhaariger Herr mit einem gütigen, klugen Gelehrtenantlitz, — »als nach meiner Auffassung der Ausdruck › d i e E i n m o n d i g e n ‹ die Bewohner u n s e r e s Planeten ungemein prägnant und charakteristisch bezeichnet, und daß eben diese Bezeichnung einen Schluß auf den unbekannten Absender insofern zu ziehen erlaubt, als nur ein a u ß e r i r d i s c h e r Beobachter, also vielleicht der Bewohner eines Nachbarplaneten mit k e i n e m oder mehr als e i n e m Monde, sich so ausdrücken würde.«
»Ich muß sagen«, meinte einer der TelegraphenSachverständigen, »daß ich das fatale Gefühl habe, einer JulesVerniade beizuwohnen, die auch durch diese außergewöhnliche Konferenz für mich um nichts wissenschaftlicher oder glaubwürdiger wird. Man kennt ja die Phantastereien dieser Zukunftsromane, die auf irgendeiner von der Wissenschaft zugestandenen Möglichkeit ihre bunten schwankenden Luftschlösser erbauen, und besonders der Verkehr mit unsern hypothetischen Nachbarn im Sonnensystem ist seit Keplers ›Traum vom Monde‹ ein oft behandeltes und immer dankbares Thema dieser Herren; — aber daß derartige romantische Schrullen uns hier ernsthaft beschäftigen sollen —«
»Erlauben Sie, Herr Geheimrat«, fiel ihm da plötzlich der Reichskanzler ins Wort, — »ich muß Sie unterbrechen! Um eine Phantasterei handelt es sich, nach meinem Dafürhalten, und soweit ich die Tatsachen überblicke, wahrscheinlich nicht!«
Er rief durch einen Druck auf eine vor ihm stehende Tischklingel einen Diener herein und gab ihm mit halber Stimme einen Auftrag. Nach wenigen Augenblicken erschien der Diener wieder mit einer Mappe. Der Reichskanzler nahm sie ihm ab, öffnete sie mit einem Schlüssel und fuhr fort: »Was ich den Herren jetzt mitzuteilen habe, bleibt vertraulich! Vor ungefähr drei Monaten wurde in der Nähe der Missionsstation Ylinde in DeutschSüdostAfrika von den Eingeborenen ein fallendes Meteor beobachtet, das mit heftigem Geräusch zur Mittagszeit aus völlig heiterem Himmel herniederstürzte. Die entsetzten Neger liefen in ihrer Angst zu unserem Missionar. Dieser begab sich eilig nach dem Orte, wo das Meteor niedergefallen war, und fand in der noch rauchenden Erde, halb versunken, ein großes, halbgeschmolzenes Bruchstück, das er natürlich für Meteoreisen hielt.«
Der Reichskanzler entnahm der Mappe einige Kartons. »Hier sind die Photographien, meine Herren, die Missionar Rechhuber an Ort und Stelle davon aufgenommen hat.« Er reichte mehrere der Blätter herum.
»Aber« — hier hob der Sprecher seine Stimme — »das Meteor war diesmal kein ehrliches Meteor, kein harmloser Himmelsbote! E s w a r d a s W e r k i n t e l l i g e n t e r W e s e n j e n s e i t s u n s e r e s L u f t m e e r e s , meine Herren; denn als der Missionar das Bruchstück ausgraben ließ, zeigte es an der einen Stelle eine Fabrikmarke —«
Die Anwesenden fuhren von ihren Plätzen auf.
»Ja, meine Herren, eine Fabrikmarke, ein Kennzeichen, wie wir sie auf unseren irdischen Betriebsstätten an Geschützen, Gußteilen etc. anzubringen pflegen.«
Er nahm ein neues Blatt aus der Mappe, betrachtete es einen Augenblick, dann reichte er es dem Nächsten.
»Diese Fabrikmarke zeigt in der Mitte einen Kreis, neben dem sich rechts eine Mondsichel befindet; umgeben ist dieser Kreis von einer Anzahl eliptischer kleiner Figuren, die alle vorn eine blitzartig gezackte Spitze tragen. Sämtliche Spitzen richten sich, wie zum Angriff, gegen den Kreis mit der Sichel.«
Allgemeines Staunen begleitete die Erklärungen des Reichskanzlers, und, ihre Würde vergessend, drängten sich die Herren um das geheimnisvolle Bild.
»Ich muß gestehen«, fuhr der Redner fort, »daß das mysteriöse Symbol mir ein Rätsel geblieben ist, bis mir gestern Herr Starck seine Wellendepesche brachte. Der Ausdruck: › d i e E i n m o n d i g e n ‹ erinnerte mich sofort an dieses Bild.«
»Herr Reichskanzler, ich erbitte das Wort!«, sagte hierauf der Vorsteher der meteorologischen Station, ein noch junger, schlanker Gelehrter. Und auf ein Zeichen des Kanzlers fuhr er fort:
»Auch die Akten unserer Station enthalten eine ähnliche Rätselhaftigkeit, meine Herren! — Vor ca. drei Jahren ließen wir in Verabredung mit anderen Stationen Europas einen unbemannten Ballon steigen, der zur Erreichung möglichst bedeutender Höhen besonders ausgerüstet war. Er besaß ungeheure Steigkraft und war mit einem selbsttätig arbeitenden Registrierapparat versehen. Er sollte am bestimmten Tage morgens sechs Uhr vom Terrain der Luftschifferabteilung aufsteigen und war in der Nacht vorher zum Aufstieg vorbereitet und gefüllt worden. Als wir aber zur bestimmten Stunde an Ort und Stelle erschienen, fanden wir die Haltetaue gelöst und den Ballon verschwunden. Wir glaubten zunächst an einen Zufall und freuten uns, als wir acht Tage später den Ballon mit seinem Registrierapparat heil wieder zugesandt erhielten — aus Südungarn. — Als wir aber das Beobachtungspapier des Registrierapparats, lichtempfindliches, photographisches Papier, entwickelten, entdeckten wir außer den meteorologischen Daten an der Stelle, wo der Barometrograph die höchsterreichte Höhe von 25 000 Metern notiert hatte, — entdeckten wir Schriftzüge, hastig, undeutlich, wie mit einer Nadel eingekritzelt, und sie enthielten die kaum lesbaren deutschen Worte:
› S c h w a r z e L u f t s c h i f f e , w i e F i s c h e g e f o r m t , m a c h e n J a g d a u f d e n B a l l o n u n d — ‹
Damit brach die Schrift ab. — Hinzusetzen muß ich, daß einer unserer jüngsten Assistenten, nebenbei bemerkt, einer unserer begabtesten und eifrigsten Mitarbeiter, Dr. Valens, seit diesem Tage verschwunden war — und es auch geblieben ist, trotz aller Nachforschungen! So wurde gar bald der Verdacht laut, daß der junge Wagehals heimlich mit dem Registrierballon aufgestiegen und auf irgendeine Weise verunglückt sei; aber jetzt möchte ich beinahe glauben, selbst auf die Gefahr hin, mich Jules-Verne'scher Übertreibungen schuldig zu machen, daß er geraubt, entführt worden ist von jenen »schwarzen Luftschiffen«, die er in 25 000 Metern Höhe angetroffen hat. Etwas rein Unerklärliches blieb uns ja, auch wenn der junge Assistent nicht durch den Ballon, sondern auf andere Weise verschwunden wäre, diese Eintragung von hastiger Menschenhand. Die Plomben am Registrierapparat waren sämtlich unverletzt, und die erwähnte Notiz konnte eben nur zu derselben Zeit gemacht werden, als der Barometrograph gerade diese Stelle des lichtempfindlichen Papiers frei aufgerollt hatte, weder früher noch später. — Ich bin bereit, das erwähnte merkwürdige Dokument dem Herrn Reichskanzler auszuhändigen. Wir haben bis jetzt geschwiegen, weil wir trotz alledem immer noch an eine Mystifikation durch irgendeinen kundigen ›Thebaner‹ geglaubt haben, der den Registrierballon gefunden hat.«
»Den Ausführungen meines Herrn Kollegen möchte ich hinzufügen, daß die Zahl der völlig spurlos verschwundenen Ballons sich in den letzten zwei Jahren gegen alle statistischen Vorausberechnungen unerklärlich gehäuft hat«, sagte hierauf der Vorsteher der Luftschifferabteilung, »und namentlich betrifft dies solche Ballons, die durch besondere Ausrüstung bedeutendere Höhen zu erreichen imstande waren. Gerade das spurlose Verschwinden dieser Luftschiffe von teilweise ganz bedeutenden Dimensionen ist dabei so rätselhaft, wenn auch das Weltmeer oder der Urwald oder die Eiskappen der Pole wohl manches Geheimnis dieser Art enthüllen könnten, manche Überreste verschollener Luftballons bergen mögen.«
»Hat der Herr Entdecker der rätselhaften Depesche eine Idee, ob und wie sich die von den verschiedenen Herren Vorrednern hier gemachten Angaben mit seinem Wellentelegramm in Zusammenhang und Einklang bringen lassen?«, fragte der Direktor der Gesellschaft »Fernfunke«, der ebenfalls der Sitzung beiwohnte.
Justus stand auf und sagte in seiner einfachen Weise, manchmal zögernd, dann wieder sich überstürzend, wie ihm die Gedanken zuflossen, etwa folgendes:
»Die vom Herrn Reichskanzler und einigen anderen der geehrten Herren Vorredner gemachten Angaben sprechen doch wohl zunächst nicht g e g e n meine Hypothese außerirdischer Intelligenzen. Die Übermittlung der Depesche in deutscher Sprache und in Morseschrift denke ich mir dabei so, daß die Bewohner eines anderen Planeten, uns an geistiger Höhe überragend, Mittel gefunden haben, die trennenden Ätherräume bis zu uns, den ›Einmondigen‹, mit ihren Fahrzeugen zu überbrücken, daß sie beim Befahren unseres irdischen Luftmeeres einen oder einige Ballons samt Insassen gekapert und letztere gezwungen haben, ihnen über die geistigen und sonstigen Errungenschaften unserer Erde Aufschluß zu erteilen. — Das in Ylinde aufgefundene Bruchstück eines ›unechten‹ Meteors mag ein Überrest eines der ›schwarzen Luftschiffe‹ gewesen sein, das durch irgendeine Ursache, Kollision oder Explosion, an den äußersten Grenzen unserer Atmosphäre zertrümmert wurde.«
»Aber die wohlgemeinte Warnung Ihrer Depesche, Herr Starck«, rief einer der Herren dazwischen, »wie läßt sich die in Einklang bringen mit unsern fernen Feinden?«
»Insofern nur«, fuhr Justus unbeirrt fort, »besteht eine Schwierigkeit, als die eben angeführten Punkte nur f e i n d l i c h e Motive gegen die Erdbewohner voraussetzen, während das durch meinen Kohärer übermittelte Telegramm eine f r e u n d s c h a f t l i c h e Warnung für uns enthält. So sehr der Inhalt der Botschaft die Hypothese außerirdischer Feinde für die Menschen bekräftigt, so unerklärlich scheint die rätselhafte Freundesstimme aus dem Reiche der Planeten. Aber vielleicht liefert ein Blick auf irdische Verhältnisse erklärende Analogien! Es ist anzunehmen, daß ein Planet nicht eher Expansionspolitik treibt, bis er kann und muß. Er kann sie treiben, wenn die Entwicklung seiner Bewohner, ihre Wissenschaft und Technik, ihm die Mittel dafür zu liefern vermag; er muß es, wenn er es kann, und wenn seine Bevölkerung durch wirtschaftliche Verhältnisse gezwungen wird, die Grenzen ihrer Existenzmöglichkeit weiter zu setzen, hinaus ins Weltall. — Wahrscheinlich wird das nicht in Einmütigkeit geschehen. Es werden politische Heißsporne, aber auch Zauderer, ja wirkliche Gegner dieser extraplanetaren Politik vorhanden sein. Von der Majorität der ersteren wurden die schwarzen Luftschiffe gebaut; einer der letzteren sandte nach meiner Überzeugung das seltsame Telegramm!«
»Und die Geheimnistuerei der umgestellten Buchstaben, diese wunderlichen Anagramme, wo doch alles darauf ankam, eine an sich unglaubliche, rätselhafte Botschaft für die Empfänger nicht noch rätselhafter zu machen?«, — sagte da einer der Herren.
»Auch sie kann ich erklären! Ich brauche nicht daran zu denken, daß einer unserer verschollenen und geraubten Ballonfahrer der in diesen Hieroglyphen sich versteckende Absender der Warnung sein könnte, der einmal heimlich Gelegenheit gefunden hat, eine Funkenstation auf dem Nachbarplaneten in Tätigkeit zu setzen. Auch ein Eingeborener, falls er nicht die Eroberungspolitik seiner Mitbewohner teilt, wird besser tun, seine für die Erde bestimmten Warnungen möglichst zu verbergen, um nicht als Volksfeind zu erscheinen. Und es ist anzunehmen, daß die Planetenregierung ein mit allen Mitteln der Wissenschaft ausgerüstetes Überwachungssystem für unsicher erscheinende Mitbürger eingerichtet hat, so daß die größte Vorsicht nötig war bei der Absendung des Warnungstelegramms, das die hochgespannten Ätherschwingungen hinaus in den Weltraum — ins Ungewisse — tragen sollten. Vielleicht oder sogar wahrscheinlich nahmen auch die auf dem feindlichen Planeten arbeitenden Empfangs- oder Kontrollapparate die für die ›Einmondigen‹, bestimmte Funkendepesche auf. Ihre Entzifferung aber kostete eine gewisse Zeit, und der solange rätselhafte Wortlaut sicherte dem Sender die ungehinderte und vollständige Übermittlung seiner Warnung. Vielleicht sind die geheimnisvollen Worte nun auch dort schon entziffert worden; aber auch die Bewohner der Erde haben sie entziffert, und der unbekannte, geheimnisvolle Absender hat hier wie dort sein schützendes Inkognito bewahrt — und, so lassen Sie mich hoffen, seinen edlen Zweck erreicht!«
Justus hatte geendet. Der Reichskanzler nickte ihm beifällig zu, und der greise Astronom drückte ihm über den Tisch hinweg die Hand.
Es blieb eine geraume Zeit still in der Gesellschaft der Sachverständigen. Aus den Gesichtern ließ sich erkennen, daß nur wenige der Konferenzteilnehmer geneigt waren, den Ausführungen des jungen Erfinders zuzustimmen. Als daher der Reichskanzler die Anwesenden zu einer Beschlußfassung veranlaßte, war die Majorität entschieden gegen Justus und gegen irgendwelche außerordentlichen Maßnahmen oder Schutzvorkehrungen...
Da trat ein Ereignis ein, das die Situation mit einem Schlage veränderte!
Ein leises Klappern wurde hörbar. Instinktiv wandten sich aller Augen nach dem auf dem Tische stehenden Empfangsapparate.
Justus löste den Sperrhaken des Uhrwerks, und das Depeschenband rollte ab...
Trotz allseitiger Aufregung wurde es totenstill in dem großen Sitzungszimmer. Und geheimnisvoll, wie von Geisterhand bewegt, schrieb der Morseapparat Zeichen um Zeichen...
Von allen der Ruhigste blieb Justus. Er ließ den Papierstreifen des Apparates durch die Finger gleiten.
»Es ist Deutsch, klares, verständliches Deutsch, meine Herren, was diesmal der unbekannte Sender im fernen Weltraume uns depeschiert! Hören Sie, bitte!«
Eine tiefe Ergriffenheit vibrierte nun doch in seiner Stimme, als er die Morsezeichen ins Deutsche übertrug. Sie lauteten:
»Furchtbare Gefahr droht den Bewohnern der Erde! Ich, Dr. Valens vom Meteorologischen Institut in Berlin, wurde vor drei Jahren aus einem Luftballon geraubt.
Seit drei Jahren ersehne ich diesen Augenblick, um — mein Vaterland und die Menschheit zu warnen! Meine Entführer sind die Beherrscher der Naturkräfte und die Herren des Weltraumes! Mit Lebensgefahr drang ich soeben bei Nacht in die Sendestation für Funkentelegramme. Ich sende diese Zeichen in Morseschrift, mit einer Stromspannung von hundert Millionen Volt, der Maximalspannung der Station. Der Himmel gebe, daß dies mit Blitzen geschriebene Telegramm die Erde erreicht und dort irgendwo verstanden wird! Bewacht die Atmosphäre, schützt die Erde vor den kommenden Feinden! Sie haben Luftfahrzeuge, die...
Man pocht gegen die Pforte des Gebäudes — ich bin entdeckt — die verschlossene Tür wird gesprengt — Menschen, hütet euch vor den Bewohnern des Planet...«
Der Apparat schwieg mitten im Wort.
In furchtbarer Erregung starrten alle auf Justus, dessen Lippen fest zusammengepreßt blieben.
Mit eintönigem Summen lief das Papierband des Morseapparates ab — es blieb leer.
Die Gesichter aller Anwesenden zeigten den gleichen Ausdruck namenloser Spannung. Wie unter einer Massensuggestion starrten aller Augen mit einem Blick des Grauens ins Weite — als sähen sie da irgendwo im Weltraum das Entsetzliche, das diese Minute des Schweigens bedeckte: auf einem Nachbarplaneten den mutigen jungen Deutschen im Kampfe mit einer Schar eindringender Geschöpfe, uns Menschen ähnlich vielleicht, doch nicht unseresgleichen. Sie sehen greifbar deutlich, wie Dr. Valens mit letzter Kraft den Hebel des Wellensenders umklammert, um seine Botschaft zu beenden und die Erde zu warnen — wie die furchtbaren Gegner seiner Herr werden, wie sie ihn zum Schweigen bringen — für ewig...
Eine Minute verging, fünf Minuten — zehn Minuten — alles Warten blieb vergebens.
»Meine verehrten Herren«, nahm endlich nach langem, bangem Schweigen der Reichskanzler erschüttert das Wort — »ich glaube, wir sind soeben Zeugen geworden von der Opfertat eines der Unsern für seine Mitmenschen, einer Heldentat fern von hier auf einem unbekannten Weltkörper. Der Brave hat seine Menschen- und Vaterlandsliebe aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Leben bezahlt. Aber er hat erreicht, was er erstrebt: er hat die Bewohner der Erde gewarnt vor den unheimlichen fernen Feinden im Planetenraum. Ehre dem Andenken des Herrn Dr. Valens jetzt und immer!«
Noch am Abend lief ein chiffriertes Telegramm über die ganze seltsame Affäre an alle Kabinette der Erde. — Justus hatte einen Käufer für seine Erfindung gefunden: es war der Deutsche Staat. Die Bahn war frei für ihn zum lichten Ziel!
Als Justus nach der denkwürdigen Sitzung das ReichskanzlerPalais verließ, schritt an seiner Seite der Mitdirektor der ElektrizitätsGesellschaft, der Vater Gabrieles.
Vor dem Portal hielt ein zierliches Elektromobil. Im Fond des eleganten Gefährts saß eine junge Dame.
Justus zog den Hut.
»Ah — da ist ja mein Töchterchen!«, rief der Direktor in froher Überraschung.
»Ich wollte dich abholen, Papa —«
»Gestatten Sie —« er wandte sich an Justus —
»Ich hatte bereits die Ehre, dem gnädigen Fräulein vorgestellt zu werden —«
»O — um so besser! Gib Herrn Starck die Hand, Gabriele, und gratuliere ihm: so sieht der Mann aus, der heute seinem Vaterland, ja der ganzen Menschheit mit seiner Erfindung einen Dienst geleistet hat —«
Gabriele legte mit einer anmutigen Bewegung ihre schmale Hand in Justus' Rechte, während ihre dunklen Augen unter dem goldblonden Lockenhaar mit einem halb überraschten, halb bewundernden Ausdruck hervorleuchteten.
»Wissen Sie was, lieber Herr Starck?«, rief der Direktor — kommen Sie mit uns zum Diner« —
»Ihre Güte ehrt mich, Herr Direktor — aber heute — heute möchte ich a l l e i n sein!«
»Aber dann auf morgen, nicht wahr?«
»Wenn Sie gestatten — auf morgen!«, sagte Justus, sich verabschiedend.
»Auf morgen!«, sagte Gabriele nochmals, sich aus dem Fond des Wagens neigend — — —
Überall beginnen die Rüstungen gegen die geheimnisvollen Piraten des Weltraums.
Die Zeit wird lehren, ob die Menschen gewappnet sind zum Kampf mit den höher entwickelten, mächtigeren Wesen jenseits des Erdballs, zum Kampf mit unsern rätselhaften
F e i n d e n i m W e l t a l l .
Der junge Ägyptologe Gerbert Munz saß wieder einmal an einem Spätnachmittage des August auf seinem Lieblingsplätzchen im ägyptischen Museum zu Berlin. —
Es war Montag und das Museum für gewöhnliche Sterbliche verschlossen. Um diese Tageszeit waren auch diejenigen Besucher nicht mehr anwesend, die ihr Fachstudium an diesem Tage in die stillen Räume geführt hatte.
Dr. Munz saß in einem der Nebensäle. Die geschlossenen Fenstervorhänge hielten Licht und Wärme der strahlenden Augustsonne zurück; ein mildes, weiches Dämmerlicht flutete durch die kühlen Gemächer und nahm den Dingen ringsumher etwas von ihrer harten Gegenständlichkeit. Der junge Forscher lehnte den Kopf an die kühle Steinplatte eines riesigen Sarkophags. Auf seinen Knien lag aufgeschlagen die uralte Spruchsammlung des P t a h h o t e p , deren Original sich auf einem Papyrus in der Pariser Bibliothek befindet, jenes Buch der Weisheit, das ein Alter von fünf Jahrtausenden besitzt.
Altvertraute, liebe Worte waren dem jungen Manne die goldenen Sprüche des ägyptischen Königssohnes, so vertraut, daß sie ihm oft unbewußt, wie jetzt, in der Stunde weltvergessenen Träumens, über die Lippen gingen:
»Achte die Weisheit höher als die Edelsteine, denn diese werden auch am Arme der Sklavin getroffen.« —
»Nicht zu bereuen brauchen, ist ein Zeichen von Weisheit.«
»Bilde dir nicht ein, daß du Solches leistest, dessen auch künftige Tage sich erinnern werden. Siehe, das Krokodil taucht auf und wieder unter — und schon ist seine Erscheinung verwischt.«
»Die Menschenliebe ist höher zu achten als der Opferkuchen.«
»Laß fröhlich leuchten dein Antlitz, solange du lebst! Verließ je ein Mensch den Sarg wieder, wenn er einmal hineingebettet war?« —
Halblaut hatte er die letzten Worte vor sich hin gesprochen — wie im Traum, und seine Blicke nahmen dabei den Weg, den sie in diesen Monaten so oft genommen. —
Dem Sitzenden schräg gegenüber, fast in der Mitte der einen Längswand des Saales lag in einer Vitrine von Glas die Mumie einer jungen Ägypterin, die im Frühjahr dieses Jahres von Dr. Munz in einem der Felsengräber der Totenstadt Thebens aufgefunden und hierher transportiert worden war.
Wunderbar war der zarte Frauenleib in seinem Felsengrabe durch die Jahrtausende erhalten geblieben! Auf Anraten des jungen Forschers hatte man die Mumie in ihrer ursprünglichen Umhüllung gelassen; der ganze Körper war mit einem gelblichweißen, dicht anliegenden Gewebe bekleidet. Plastisch zeichneten sich in dieser Hülle die Umrisse der Mumie ab, das zierliche Eirund des Köpfchens, die sanfte Wölbung der Brust, die feingegliederten Arme, der schlanke Leib und die kleinen schmalen Füßchen. »Wie eine verhüllte Marmorstatue«, hatte Professor X. gesagt beim Anblick der Mumie. Es war bei ihm ein Zeichen höchster Bewunderung, wenn er einen Gegenstand der Natur mit einem Kunstwerke gleichstellte.
»Verließ je ein Mensch den Sarg wieder, wenn er einmal hineingebettet war?« Mechanisch wiederholten die Lippen des Gelehrten den uralten Satz.
« N i t a k e r t «, hieß die Mumie nach der Aufschrift des Felsengrabes. Als zarte Jungfrau starb sie einst im Jahre 522 v. Chr. »Königlich war ihr Stamm, kurz und rein ihr Leben, lieblich das Lächeln ihrer Stirne, sonnig der Blick ihrer Augen, holdselig der Gruß ihrer Lippen — geheimnisvoll ihr früher Tod!«, lautete ihre Grabinschrift. — Im anderen Sinne, als Prinz Ptahhotep einst geschrieben, hatte die schöne Nitakert ihren Sarg verlassen, verlassen müssen: gelehrter Forschersinn hatte die geheimnisvolle Schläferin aus ihrem stillen Felsenkämmerchen gehoben und meilenweit über Länder und Meere entführt bis in diesen gläsernen Schaukasten!
»Lieblich das Lächeln ihrer Stirne, sonnig der Blick ihrer Augen, holdselig der Gruß ihrer Lippen« — wie oft hatte Dr. Munz die Worte der Grabschrift wiederholt, wenn er das verhüllte Gesicht der Mumie betrachtete. Ach, all das war dahin — seit mehr als zwei Jahrtausenden! Die Kunst der Einbalsamierung hatte wohl die äußere Lieblichkeit der Körperformen der Zeit zum Trotz erhalten können — aber unter der verhüllenden Leinwand barg sich dennoch die mumifizierte Leiche, ein bräunlichgelber, vom Erdpech durchdrungener im Laufe der Zeit steinhart gewordener Körper.
Um die holde Täuschung des Lebens festzuhalten, hatte sich ja auch der junge Forscher gegen die Auswicklung der Mumie gewehrt. Ein Etwas in seiner Seele lehnte sich auf gegen die grausame Zerstörung des schönen Scheines...
Wie oft hatte er in diesen Wochen schon vor der Mumie Nitakerts gesessen! Liebliche Phantasien schwebten dann durch seine Gedanken; er glaubte sich zurückversetzt in die Tage, da noch die lebendige Nitakert in ihren zierlichen, goldgestickten Sandalen im alten K e m i an den Ufern des heiligen J a r o wandelte, als die Leute der Stadt einander erzählten von der schönen Jungfrau, wie »lieblich das Lächeln ihrer Stirne — wie sonnig der Blick ihrer Augen —«
In dem unbestimmten Dämmerlicht war es ihm mehr als einmal gewesen, als höbe sich unter der verhüllenden Leinwand die Brust der jungen Ägypterin in regelmäßigem Rhythmus, als sei in diesem zarten Mädchenbusen noch lebendiger Odem — schlafendes Leben...
— Die Schwüle des Augusttages hatte es verschuldet, daß Dr. Munz doch endlich eingeschlummert war.
Das mußte um die Zeit gewesen sein, als der Diener des Museums die Runde durch die Säle machte, um etwa noch vorhandene Besucher auf die Schließung aufmerksam zu machen. Für den Beamten bedeutete dieser vorgeschriebene Rundgang nur eine Formalität: um diese späte Tagesstunde war kein Studierender mehr im Museum.
So hatte er auch bei seinem flüchtigen Umblick den schlafenden Gelehrten nicht bemerkt, der hinter dem mächtigen Steinsarge versteckt saß.
Als Dr. Munz erwachte und — verwundert über sich selbst — nach der Uhr sah, zeigte sie auf zehn. Schnell stand er auf, durchschritt den Saal und wandte sich zum Ausgang des Museums — die Tür war verschlossen!
Dr. Munz mußte wider Willen lachen. »Die Maus in der Falle«, — sagte er dann. »Gut, machen wir gute Miene zum bösen Spiel — es ist nicht die erste Nacht, die ich außer dem Bett verbringe, und mehr Komfort hatte ich in Thebens Felsengräbern auch nicht!«
Er ging in den Saal zurück und zog die Vorhänge von den Fenstern. Der helle Sommerabend lugte durch die Scheiben. Der Ägyptologe schritt langsam zu der Mumie Nitakerts. Lange stand er in träumerischem Sinnen vor ihr, und immer wieder schien es ihm, als atme sie. So groß war die Täuschung heute abend, daß er den Glaskasten abhob und seine Hand auf Stirne und Brust der Verhüllten legte.
»Träumer!«, schalt er sich selbst. »Was würden deine Herren Kollegen sagen, wenn sie deine närrischen Gedanken ahnten!« Und über sich selbst lächelnd rief er, zur Mumie gewendet:
»Schönste Nitakert — ich sah dich nie, nie das liebliche Lächeln deiner Stirne, nie den sonnigen Blick deiner Augen, nie vernahm ich den holdseligen Gruß deiner Lippen — aber m i r lebst du durch die Jahrtausende hindurch in ewiger Jugend, in ewiger Schönheit — mer — a — nebt nofert — Nitakert!«
Lächelnd hatte er seine Anrede begonnen — ernst, fast feierlich fielen die letzten Worte von seinen Lippen. In diesem Augenblick weltferner Einsamkeit kam es ihm zum erstenmale ins Bewußtsein, wie tief seine Seele von diesem Bilde seiner Träume erfüllt sei. —
»Mer — a, nebt nofert, Nitakert!« In uraltem Ägyptisch hatte er's gerufen: Ich liebe dich, Nitakert, schönste Herrin!
Ein Weilchen blickte er noch auf die zarte Gestalt — dann wandte er sich nach seinem alten Plätzchen, um mit Hilfe einiger Stühle sich ein Lager für die Nacht zurecht zu bauen — — —
Hell schien der Mond in den Saal. Vom nahen Dome kam der Schlag der Glocke. Der junge Forscher wurde munter, reckte sich, und sah nach der Uhr.
»Fast Mitternacht«, sagte er. Er wandte sich nach der andern Seite, um weiter zu schlafen — da — was war das? —
Ein seltsamer Ton zitterte durch den stillen Raum — ein geisterhafter Hauch, wie von einer Äolsharfe.
Dr. Munz richtete sich auf und lauschte mit verhaltenem Atem. —
Und wieder klag es — wie aus weiter Ferne — wie ein verwehter Seufzer aus Menschenbrust. — —
Entsetzt sprang der junge Mann auf —
Und zum drittenmale, diesmal deutlicher noch, ertönte der geheimnisvolle Laut. — — —
Der Strahl des Mondes glitt über die Fläche der gegenüberliegenden Wand —
Allmächtiger Gott! Ein Aufschrei entrang sich Gerberts Lippen — Nitakerts Mumie regte sich! Deutlich sah er die Bewegungen des verhüllten Hauptes. —
Noch zitterte der junge Mann an allen Gliedern. — Und da richtete sich die Verhüllte auf, ihre Arme befreiten sich aus den leinenen Binden, und von dem Haupte fiel der hüllende Schleier...
Ein Mädchenantlitz tauchte hervor, wundersam strahlend im magischen Schimmer des Mondes. —
Und nun schob sich die Gestalt herab von ihrem Lager, im silberweißen Byssusgewand stand sie aufrecht. —
Von ihren Lippen aber klang es in uralten Lauten: »Tennu uona? Kerh — kerh — kamt! A nuterit Nebthi — tennu uona?«
Ein wundersames Gefühl durchzuckte den jungen Forscher, als er diese Worte im reinsten Altägyptisch vernahm — von Nitakerts Lippen vernahm!
»Wo bin ich?«, — hießen diese Laute — »Es ist Nacht, tiefe Nacht! O Nebthi, hohe Göttin — wo bin ich?«
Dr. Munz machte eine Bewegung. Seine anfängliche Scheu war gewichen. Eine Mumie, die sich bewegt und spricht, ist eben keine Mumie.
Durch das Poltern eines Stuhles wurden die Blicke der geheimnisvollen Erscheinung nach der Richtung gelenkt, wo der Gelehrte stand. —
Und jetzt schien sie ihn bemerkt zu haben. In ihren bleichen Zügen malte sich Erschrecken. Mit einer unsagbar rührenden Geberde erhob sie beide Arme gegen den jungen Mann, und wieder klang es in bittendem Flehen von ihren Lippen in der klangreichen Sprache, die vor Jahrtausenden im alten Kemi gesprochen wurde:
»Wo bin ich? — Es ist Nacht, tiefe Nacht! Wer du auch seiest, habe Mitleid mit mir! Schweres haben die Götter über mich verhängt! Das Grab war die einzige Zuflucht, wohin ich mich retten konnte vor der Macht des grausamen K a m b a t e t ! «
Unnennbares Mitgefühl ergriff Dr. Munz. Vor dem persischen Wüterich Kambyses (ägyptisch Kambatet) hatte sich dies süße Geschöpf einst in den Tod geflüchtet — vor zweieinhalb Jahrtausenden. —
»Fürchte nichts«, sagte er tröstend in ihrer Sprache. »Woher du auch kommst, du bist sicher vor dem grausamen Kambatet!«
— »Wie kam ich hierher, o Fremdling? In die stille Grabkammer in der kühlen Totenstadt bettete mich C h u e n - P h r a , der Freund meiner Seele. Seine Liebe rettete mich vor Kambatet, seine ärztliche Kunst bannte mich in einen Schlaf, der mich ähnlich machte den ewigen Schläfern im Felsengrabe — und nun bin ich erwacht, und meine Seele verlangt nach dem Geliebten!«
— Ihre Worte lösten mit einem Schlage das Rätsel ihrer Erscheinung! Nicht eine vom Tode erstandene Mumie stand vor ihm — eine aus hypnotischem Schlafe Erwachte war dieses wunderbare Wesen. Sie war ein redender Beweis für die große ärztliche Kunst der alten Ägypter, die, wie die Inder, schon vor Jahrtausenden die Hypnose meisterhaft anzuwenden verstanden. — Wohl erzählt man auch noch heute Beispiele indischer Fakire, die sich durch Selbsthypnose in einen totenähnlichen Zustand zu setzen vermögen, sich wie wirklich Gestorbene in die Erde senken lassen, um nach einiger Zeit wieder aufzuleben — aber das am besten beglaubigte Exempel dieser Art hat immer nur wenige Monate im Schlafzustande verbracht. —
Hier aber hatte der hypnotische Schlaf, hervorgerufen durch uns verloren gegangene, tiefere Kenntnisse der alten Magier von der Beherrschung der Seelenkräfte, Jahrtausende angehalten, begünstigt durch das fast unveränderliche Klima und die ungestörte Abgeschlossenheit in einer der Grabkammern im unzugänglichsten Teile der alten Totenstadt!
Arme Nitakert, dachte der junge Forscher, warum bist du nicht geblieben, wozu der Schein dich machte? Wohl ist dein Peiniger und Verfolger längst zu Staub verweht — aber auch der, den du liebst, ist dahin, in den bitteren Tod gejagt durch die Willkür desselben Tyrannen!
Sie stand vor ihm in all ihrer geisterhaften Schönheit. Die Zauberkunst des Geliebten war stärker gewesen als Tod und Verwesung — die versunkenen Jahrtausende, die aus der Heimat Nitakerts eine Wüste sandverwehter Trümmer gemacht haben — an diesem zarten Menschenbilde waren sie spurlos vorübergegangen, wie der Schatten, der über die Sonnenuhr dahingleitet.
Sie rührte in stummer Bitte leise seine Hand. Er nahm die weiche kühle Hand Nitakerts in seine beiden Hände.
»Fürchte nichts — vertraue mir, o Nitakert! Wunderbares wirst du hören! Großes muß ich dir verkünden — aber auch Schweres! Fasse Mut!«
Wie eine weiße Lotosblüte senkte sie ihr Köpfchen mit den dunklen Flechten. »Ich vertraue dir, teurer Fremdling! Sage mir alles, wo ich bin, und wie ich in diese Halle komme! Alles ist mir fremd, auch deine Tracht und Gestalt — nur das weiße Antlitz N a h s dort oben strahlt wie sonst!«
Und sie deutete mit der Hand nach dem schimmernden Monde, der in vollem Glanze am nächtlichen Himmel stand.
»Alles will ich dir sagen, Nitakert — soviel ich es vermag! Doch — nicht hier — komm mit mir!«
Er faßte ihre Hand und wandte sich zum Gehen; sie aber vermochte in dem enganschließenden Byssusgewande nur schwer, ihm zwischen all den Steinsärgen und Schränken zu folgen. —
Schnell bückte er sich und umfing sie mit starkem Arme.
Wie ein Lächeln ging es da zum erstenmale über ihr Antlitz. »Lieblich war das Lächeln ihrer Stirne«, — hatte die alte Grabschrift gelautet — ein wunderbares Geschick erlaubte ihm, nun doch zu schauen, wonach er sich so oft still gesehnt!
Leicht schritt er dahin mit seiner köstlichen Bürde in den vertrauten Gängen, durch den hinteren Ausgang des Saales — in die weite, hohe Halle, welche die Nachbildung der Vorhalle des Tempels von Karnak bildet und einem jeden Besucher des Berliner ägyptischen Museums wohl bekannt ist.
Hier — im Angesichte ihrer uralten Götter und der geheimnisvollen Herrlichkeit ihrer uralten Heimat — ließ er sie sanft aus seinen Armen gleiten auf einen Ruhesitz.
Vertrauend wie ein gläubiges Kind, hatte sie an seiner Brust geruht, mit geschlossenen Augen, deren lange, weiche Wimpern dunkel auf den elfenbeinweißen Wangen lagen; vertrauend ließ sie auch jetzt ihre Hand in der seinen. Ein Weilchen saß der Doktor stumm neben Nitakert; seine Seele wogte unter dem Sturm des gewaltigen Eindrucks der letzten Minuten — wie sollte er der Auferstandenen begreiflich machen, daß mehr als zwei Jahrtausende zwischen ihrem Entschlummern und Erwachen lagen! Wie ihr den Wandel menschlicher Geschicke in diesen vierundzwanzig Jahrhunderten erklären! Und endlich — das Schwerste ihr künden — den Tod des Geliebten?
Wie würde sie seine furchtbaren Worte fassen? Er sah ihr sorgend in das blasse Antlitz, dessen große, dunkle Augen erwartungsvoll ihm entgegenblickten. —
»Ist dir auch wohl, Nitakert?«
»Sorge dich nicht, o Fremdling — nur einen Schluck Wasser —«
»Ich bringe ihn dir — einen Augenblick!«
Er stand schnell auf. Am Eingange des Nebensaales stand eine Karaffe mit Wasser. Rasch hatte er ein Glas gefüllt und kehrte zurück.
Eine wunderliche Empfindung überkam ihn — daß er das alles nur träume, daß alles ein Spiel seiner Phantasie, und daß der holde Spuk verschwunden sei, wenn er die Stätte des Tempels wieder betrete. —
Aber — da saß sie noch, die Wunderbare, und dankbar lächelnd, nahm sie seinen Trunk.
Sie sog in langen, durstigen Zügen. Plötzlich setzte sie das Glas von den Lippen —
»Du gabest mir kein Wasser vom Nil, Fremdling? Es schmeckt nicht so süß, wie jenes!«
»O, schöne Nitakert — der heilige Nil fließt weit von hier!«
»Wo bin ich also — o sag' es mir!«
»Ich versprach dir's und halte Wort. Aber ich bitte dich, Teure, mir erst d e i n e Geschichte zu erzählen. Dann kann ich dir vielleicht besser sagen, was du zu wissen begehrst!«
Und sie erzählte:
»Nitakert ist mein Name — du nanntest ihn schon, o Fremdling! — Meine Mutter stammt aus königlichem Geschlecht, das Blut des großen Ramessu fließt auch in meinen Adern! Still lebte ich im Hause der Mutter; C h u e n - P h r a , der Schriftgelehrte und Arzt, liebte mich, und fleißig spann und webte ich mit den Gespielinnen, um mein künftiges Heim zu schmücken mit allerlei kunstvoller Arbeit.
Da kam das Unglück des Vaterlandes: P s a m t i k , der Sohn der Sonne, wurde geschlagen und gefangen genommen von dem grausamen Kambatet. — Vergebens versuchten die Edelsten im Lande, den jungen König zu befreien, vergebens war die Verschwörung vieler Tausende: Kambatet entdeckte den Plan und vergiftete Psamtik und seinen Sohn. — Siebenmal ist seitdem die Flut des heiligen J a r o gewachsen: die großen Götter haben ihr Antlitz verhüllt gegen mein liebes K e m i ; Kambatet wütet im Lande, schändet das Allerheiligste unserer Tempel, entweiht die Totenkammern unserer heiligen Könige, verbrennt ihre Mumien, tötet die Tapfersten und Vornehmsten im Volk der R u t u und raubt die Jungfrauen der edelsten Geschlechter — und auch mich —«
Sie zitterte wie vor einem unsichtbaren Feinde. Der junge Gelehrte legte wie zum Schutze den Arm um ihre Schulter.
»Fürchte dich nicht mehr, süße Nitakert — der Tyrann lebt nicht mehr. Die Götter deines Landes schickten ihm und seinen Tausenden den Tod!«
»O, gepriesen sei Nebthi, die hohe Mutter, die Schützerin der Familie, die Helferin der Liebenden, gepriesen dafür in Ewigkeit!«, jauchzte sie, betend die Hände zum Himmel hebend.
Nach einer Weile fuhr sie fort:
»Auch mich spürten die schändlichen Diener seiner Lust auf, da ich mit den Gespielinnen zum heiligen Flusse wandelte, rissen mich aus dem Schutze der lieben Mutter und schleppten mich in den Palast des Schrecklichen. Umsonst war mein Bitten und Flehen; man schmückte mich bräutlich, und die Dienerinnen führten mich in ein Gemach, wo ich den Tyrannen erwarten sollte. Da stand ich — alles hatte man mir genommen, nicht eine Nadel mehr hatte man mir im Haar gelassen, mit der ich mir den Tod geben konnte. —
›O Nebthi, große Mutter‹, flehte ich im Innersten meines Herzens, ›hilf mir in meiner bitteren Not, schütze mich und meine Liebe zu C h u - e n P h r a vor dem bösen Feinde!‹ —
Plötzlich rauschte es hinter mir. Der Vorhang bewegte sich — ein kleiner Knabe glitt schnell wie eine Schlange herein.
›Verschlucke das, Nitakert; dein Freund wird dich retten!‹
Wie ein Hauch klang mir sein Flüstern ins Ohr — und schon war er wieder verschwunden!
Ich aber gehorchte dem Befehle des liebenden Freundes und verschluckte schnell die kleine schwarze Kugel, die er mir gesandt. — Dann erlischt mein Bewußtsein — wie im Traum hörte ich noch die fürchterliche Stimme des schrecklichen Feindes, der seine Diener herbeirief und schrie:
›Wer hat es gewagt, mir eine Besessene hereinzusenden? Seht ihr nicht den Schaum vor ihren Lippen, nicht den Krampf ihrer Glieder? Hinweg mit dieser!‹ —
In der Nacht trug man mich als eine Tote aus dem Palaste des Grausamen. Vertraute brachten mich in das Haus meiner Mutter. Und im fest verschlossenen Kämmerlein bei der Mutter weckte mich der Geliebte aus dem künstlichen Starrkrampf — und er küßte mir die bleichen Lippen und klagte:
›O Nitakert, o Rosenwange, unserer Liebe droht noch immer Gefahr von dem schändlichen Kambatet! — Seine Häscher umstehen das Haus der Mutter. Der Tyrann ist mißtrauisch geworden gegen deine plötzliche Krankheit. Nur eine Rettung gibt es für dich und unsere Liebe — nur ein Mittel — ein allerletztes — aber es fordert Mut bis zum Tode, süße Nitakert, und Vertrauen zu mir, als ob ich ein Abgesandter der Götter sei — Todesmut und Vertrauen!‹
›Ich habe beides, Geliebter!‹, flüsterte ich in seinen Armen.
›So höre, Geliebte‹, sagte er leise. ›Du weißt, daß ich in Memphis jahrelang mit einem weisen Indier verkehrte, daß wir zusammen die heiligen Rollen der Weisheit lasen. — Von ihm lernte ich die große, geheime Kunst, einen Menschen einzuschläfern, daß er wird wie ein Toter, kalt und gefühllos, jahrelang, bis derselbe Zauber ihn wieder erweckt und er wird, wie er war, frisch und lebendig. Verstehst du mich, du Liebe, du Teure, die mir süßer ist als Nilwasser?‹
›Ich verstehe und — ich will, du Teurer!‹, rief ich entschlossen.
Die Mutter weinte. Chuen-Phra aber gab mir den letzten, heiligen Kuß der Liebe, die da stärker ist als der Tod, und begann seine Vorbereitungen, um mich in den Zauberschlaf zu senken. Die Mutter kniete mir zu Häupten, Chuen-Phra aber hielt meine beiden Hände. Ich sah nichts mehr — wie aus weiter Ferne hörte ich noch einmal die teure Stimme des Geliebten:
›Mut, Geliebte! Bald weck' ich dich wieder, und alles Leid hat ein Ende!« Einmal fühlte ich noch seinen Kuß auf meinen Lippen — dann nichts mehr —.«
Sie hatte geendet und sah den jungen Gelehrten fragend an.
»Und heute erst bist du erwacht aus deinem Zauberschlafe, arme Nitakert!«
»Warum nennst du die Nitakert arm, edler Fremdling? Sie lebt und liebt — und nun du ihr gesagt, daß ihr grausamer Feind Kambatet tot ist, wird nichts mehr sie von dem Freunde ihres Herzens reißen —«
Unbewußt seufzte der junge Ägyptologe auf. Sollte er den Hoffnungstraum des lieblichen Geschöpfes jäh zerstören mit dem furchtbaren Lichte der Wahrheit? Gleich einem Blitzstrahl würde es sie treffen und zerschmettern! Nein — er wollte und konnte ihr nicht alles sagen, und tausend Gedanken durchkreuzten sein Hirn, als er so neben ihr saß und nach einem rettenden Ausweg suchte.
Chuen-Phra war einer der acht Wegweiser, die Kambyses unter furchtbaren Drohungen gezwungen hatte, seinen 80 000 Persern den Weg zu zeigen zur Eroberung der heiligen Oase des Amun oder Jupiter Ammon, die 100 Stunden weit von Memphis in der libyschen Wüste lag, und deren Schätze die Habgier des Großkönigs gereizt hatten. — Aber in der letzten Nacht vor dem Aufbruche gaben sich die acht Tapferen das Wort im Angesichte ihrer ewigen Götter, das Heiligtum des Vaterlandes nicht den räuberischen Persern zu verraten, sondern das gewaltige Heer des Feindes irre zu führen. Und so geschah's: tagelang wanderten die Scharen des Kambyses unter der Führung der Acht in der entsetzlichen Sandwüste umher, entkräftet von der verzehrenden Sonnenglut, gepeitscht vom Sandsturm — ohne Rast, ohne Labung, bis die Leiber all der Tausende und Abertausende und ihrer Führer dahinsanken in das glühende Meer! — Keiner kam ans Ziel — keiner kehrte zurück, nicht einer! — —
Die dankbaren Bewohner der geretteten Oase aber meißelten die Namen der acht Helden, die sich selbst dem Vaterlande zum Opfer brachten, zum ewigen Gedächtnis in Stein — und unter ihnen steht auch C h u - e n P h r a , d e r S c h r i f t g e l e h r t e ! Unter dem Verzeichnis der Braven stehen die schlichten Worte:
« J e d e r m a n n i n K e m i w i r d i h r e r g e d e n k e n .
I h r G e d ä c h t n i s w i r d e w i g s e i n i m L a n d e ! «
Diese Erinnerung ging Dr. Munz durch den Sinn, als er von Nitakerts Lippen wieder und wieder den Namen des Geliebten vernahm. Sollte er Nitakert nicht doch von dem Heldenmute und Opfertode ihres Bräutigams erzählen? Würde sie nicht einen Trost, wenn auch nur einen armen und geringen, darin finden, daß noch heute sein Name glänzte im Buche der Geschichte!
Da riß ihn ihre Frage aus seinen Zweifeln:
»Und nun sage mir, o Fremdling, wo ich bin — und wie lange ich geschlafen habe?«
»Du bist nicht mehr in der Totenstadt Theben —«
»Warum hat man mich nicht ruhen lassen in dem stillen Kämmerlein, da mich der Geliebte in der Verkleidung der Mumie schützend geborgen, bis die Gefahr vorüber sein würde?«
»Weil ein anderes fremdes Volk einbrach in dein Land, das die Stadt der Gräber durchwühlte nach den Kostbarkeiten, die dein Volk den Toten mitgegeben — und weil man die Mumien retten wollte vor solcher Habgier —«
»Aber wo bin ich nun? Und wird Chuen-Phra mich auch finden, nun ich nicht mehr da ruhe, wo er mich ins kühle Felsengrab gebettet?«
»Chuen-Phra sucht dich nicht mehr dort, o Jungfrau!«
»Hast du mich hierhergebracht, teurer Fremdling?«
»Ich tat es, schöne Nitakert. —«
»So muß ich dir danken. So hast du auch wohl Botschaft an die Meinen gesandt, daß sie mich hier wiederfinden?«
Der junge Mann schwieg einen Augenblick. Bis jetzt hatte er der armen Nitakert noch keine Lüge gesagt; der Doppelsinn seiner Antworten war dem vertrauenden Geschöpf einer naiven KulturEpoche völlig verborgen geblieben — aber jetzt mußte er eine Ausrede erfinden.
Und so sagte er:
»Noch sandte ich ihnen keine Nachricht, o Jungfrau! Bedenke doch, daß ich dich für eine wirkliche Mumie halten mußte — bis heute —«
»Du hast recht, Fremdling — noch sagtest du mir nicht einmal deinen Namen!«
Sie sah ihn mit einem fragenden Lächeln an. —
»Nenne mich Gerbert!«
»Ger-Bert«, — sie sprach die Silben deutlich getrennt aus — »Ger-Bert — nun sage mir, wie ich ihn wiederfinde, der mir fern ist! Wird er den Weg zu mir finden?«
Und abermals mußte er eine Ausrede wagen:
»Nun — wenn er nicht den Weg findet zu dir — was hindert dich dann, ihn aufzusuchen, nun du selbst wieder zum Leben erwachtest?«
»Abermals hast du recht, Ger-Bert. Und nun noch eins, Lieber: Habe ich sehr lange geschlummert im Zauberschlafe?«
»Wie lange meinst du geschlafen zu haben, teure Nitakert?«
»Bis der heilige Nil wieder wuchs? Oder länger? Länger — als ein Jahr?«
»Viel länger, Nitakert! Aber warum sorgst du dich darum? Du lebst — und alles wird gut werden!«
Sie nahm seine Hand und drückte sie leise. »Habe Dank, Ger-Bert. Und nun sage mir, wie du zur Nachtzeit hierherkamst zur Mumie Nitakerts?«
Einen Augenblick schlug die Flut des Verlangens über ihm zusammen. Er wollte sich zu Füßen des märchenhaften Wesens werfen — das brennende Haupt in ihrem weichen Schoße bergen und ihr alles gestehen — alles: daß sie übriggeblieben aus dem Gräbermeer der Jahrtausende als eine lebendige Wunderblume der Menschheit, daß er sie gerettet — für sich, und daß er sie liebe, namenlos, — daß er zum Träumer geworden sei in der krankhaften Sehnsucht nach »dem Lächeln ihrer Stirne, nach dem sonnigen Blick ihrer Augen, nach dem holdseligen Gruß ihrer Lippen —« daß sie ihren Mund ihm zum Kusse reichen möge — einmal nur — wie dem Verschmachtenden den Becher mit Wasser vom heiligen Nil. —
Aber — er besiegte den Sturm seiner Seele — nur — daß er sich herniederbeugte und die schmale, kühle Hand des Märchengeschöpfes an seine Lippen zog zu langem Kusse.
Dann richtete er sich wieder auf und wollte eben eine Antwort auf Nitakerts Frage geben — als ein Blick auf das Antlitz der Jungfrau ihm das Wort auf der Zunge sterben ließ. —
Es war starr — wie aus Stein — die dunklen Augen aber blickten in unaussprechlichem Grame ins Leere. —
»Nitakert — was ist dir? Nitakert, süßes Mädchen — sprich doch! Was blickst du so verzweifelt?
Sie blieb stumm; immer mehr zeigten ihre Züge den Ausdruck namenlosen Schmerzes.
Und nun sah der junge Mann in ihrer Linken ein kleines Täfelchen, wie man es den Toten als Amulett mitzugeben pflegte. Der Mond schien hell genug, um zu erkennen, daß der glitzernde Metallstreifen mit eingegrabenen Hieroglyphen bedeckt war. Und Nitakerts Finger bewegten sich über die Schriftzüge, wie die einer Blinden — lesend.
Was mochte die unglückselige Tafel enthalten? Wahrscheinlich hatte man sie ihr an einem Kettchen umgehängt und Nitakert hatte sie erst jetzt bei sich entdeckt.
»Nitakert«, flehte er, ihr zu Füßen sinkend, »hast du keinen Blick, kein Wort mehr für mich, deinen Erretter?«
»Mein Erretter — habe Dank!«, hauchte sie und strich leise über seine Stirne. Dann aber sagte sie:
»Dies Täfelchen hat mir mein Mütterchen mitgegeben. Höre, was sie mir kündet:
»Nitakert, Licht meines Lebens, Trost meines Alters! Heute, am neunzigsten Geburtstage meines Lebens, da du nun fast fünfzig Jahre schlummerst in dem Kämmerlein, das der teure Chuen-Phra dir bereitet, habe ich noch einmal die Kunst der Ärzte an dir versuchen lassen, um dich aufzuwecken aus deinem Zauberschlafe. Aber es war vergebens — nur e i n e r hätte es vermocht — und der liegt begraben im Sande der großen Wüste, gefallen als Opfer der Befreiung unseres heiligenKemi von der Macht des Kambatet. Ich wollte nicht ins Totenreich hinabgehen ohne diesen letzten Gruß! — Der Oberpriester sagt, du wachest n i e mehr auf. —
Ich habe deinen bleichen Mund geküßt, um dir den letzten Kuß von Chuen-Phra zu bringen, den er mir gab für dich in der Nacht, da der grausame Kambatet ihn zwang, mit sieben Gefährten Wegweiser zu werden dem heidnischen Heere zur Oase Amun. Alle liegen dort, verweht vom Chamsin. — Schweres verhängten über mich die ewigen Götter. Bald werde ich ruh'n in der kühlen Kammer. Neben dich wird man mich betten. Lebe wohl!
Deine Mutter.«
— — Sprachlos hatte der junge Gelehrte Nitakerts feierlichen Worten gelauscht — erschüttert und stumm saß er neben ihr.
Sie aber faßte seine Hand:
»Du wolltest meine Seele bewahren vor böser Botschaft, o Fremdling — verschweigen wolltest du mir das Bitterste von allem« — Tränen perlten über ihre weißen Wangen — »ich muß dir danken! Aber die Mutter hat es besser gemacht. Denn nun weiß ich, wo ich den Geliebten finden werde, und will gehen, ihn zu suchen! Vielleicht habe ich viel — länger verzaubert geschlafen, als ein halbes Jahrhundert — — um so mehr muß ich eilen —«
Sie zog von der Linken einen Ring — es war ein roter Karneol, von einer goldenen Schlange umwunden — und steckte ihn dem jungen Manne an den Finger. —
»Zu Nitakerts Gedenken«, klang es leise von ihrem zuckenden Munde.
Dann sank ihr Haupt kraftlos herab, wie eine fallende Blüte, schwer legte sie ihren Arm um seine Schulter und flüsterte:
»Trage mich wieder in den Schrein, da ich lag, ich — fühle — wie — mein Herz — stockt — die Götter rufen — sie sind — gnädig — zur — armen — Nitakert —«
Wie ein Hauch kamen die letzten Worte über ihre bleichen Lippen.
Mit namenlosem Weh trug der junge Gelehrte das sterbende Mädchen zurück in den Saal, wo ihr Sarg stand. — Sanft bettete er sie dort auf das Lager. —
Als er sie aus den Armen ließ, schlug sie noch einmal die großen Augen strahlend zu ihm auf. Ein seliges Leuchten war darin. —
»Chuen-Phra — kommt — mit der Mutter! — Sie winken — beide —« —
— Die Augen schlossen sich.
Ein Schluchzen rang sich aus der Brust des Doktors. Heiße Tränen fielen auf die Hand der Scheidenden.
Ihre Lippen bewegten sich — wie aus weiter Ferne klang es an sein Ohr:
»Küsse mich — Ger-Bert! — Habe — Dank! Lebe — wohl!« — — —
Weinend hüllte der junge Ägyptologe das Leichentuch um die tote Nitakert — — —
»Ein T r a u m , lieber Ger-Bert«, sagte ein paar Wochen später sein Studienfreund Ralphs, als Dr. Munz ihm einige Andeutungen von seinem wunderbaren nächtlichen Erlebnis gemacht hatte — »der Traum eines verliebten Ägyptologen«,
Dr. Munz lächelte.
»Sagtest du nicht selbst, an der früheren Umhüllung der Mumie sei nichts geändert —«
Der Gelehrte nickte sinnend. —
»Es kann also gar nichts weiter sein, Ger-Bert!«
»Es kann gar nichts weiter sein —«, wiederholte der junge Forscher — »und doch —«
Seine Blicke ruhten träumerischzärtlich auf einem uralten Ringe an seiner Linken — es war ein Karneol, den eine goldene Schlange umwand. — — —
D i e s Rätsel würde für ihn ewig u n g e l ö s t bleiben!
Darf der Erzähler seinen Lesern eine Geschichte auftischen, für deren Seltsamkeit und Rätselhaftigkeit er schlechterdings keine plausible Erklärung zu geben vermag?
Was nützt dem Autor die Versicherung, daß alle hier aufgeführten Begebenheiten tatsächliche Geschehnisse sind, für deren Wahrheit sich die Mitglieder der »Abendschule« persönlich verbürgen können, jener kleinen Vereinigung, die der und jener meiner Leser vielleicht schon kennt und deren Teilnehmer dafür bekannt sind, daß ihnen nichts ferner liegt, als Karnevals- oder Aprilscherze oder gar Aufschneidereien à la Münchhausen! —
Vielleicht tue ich am besten, die hier folgenden Tatsachen — es ist unnötig das Wort nochmals zu betonen — meinen Lesern gegenüber nur als physiologische oder psychologische Probleme hinzustellen, deren Lösung ich ihnen selbst überlassen muß...
Um nichts Geringeres handelt es sich nämlich in dieser Erzählung, als um d a s W i e d e r e r s c h e i n e n e i n e s M e n s c h e n a u s f e r n e r V e r g a n g e n h e i t m i t t e n i n u n s e r e r Z e i t ! — Ich weiß, daß dieser Satz, so wie er dasteht, eine Unmöglichkeit einschließt — für den sogenannten »gesunden Menschenverstand»; aber, lieber Leser, der »gesunde Menschenverstand« ist doch ein sehr fragwürdiger Geselle bei dergleichen rätselhaften Erscheinungen! Dieser gesunde Menschenverstand hat vor kaum hundert Jahren »schwarz auf weiß« bewiesen, daß es — beispielsweise — keine Meteorsteine geben könne — bis sie schließlich den betreffenden Herren Gelehrten von der Pariser Sorbonne beinahe auf die Köpfe fielen; derselbe gesunde Menschenverstand würde noch vor fünfzig Jahren das Telephon, die »wandernde Stimme«, — noch vor zehn Jahren die Durchleuchtung eines lebendigen Menschen mit Röntgenstrahlen oder die Telegraphie ohne Draht nach Hertz und Marconi für unmöglich erklärt haben — vielleicht für ebenso unmöglich als das Phänomen, das uns hier beschäftigen wird!
Trotzdem verlange ich von meinen Lesern keine Captatio mentalis, auch keinen Salto mortale in das Gebiet des Spiritismus und anderer ismen; ich bin zufrieden, wenn wir uns auf dem freien Boden des wissenschaftlichen Problems, der Hypothese zusammenfinden.
Lieber Leser, du kennst aus deiner Schulzeit das Kapitel von den logischen Schlüssen, z. B. 1. alle Menschen sind sterblich; Cajus ist ein Mensch: 3. folglich ist Cajus sterblich. Logisch gewiß unanfechtbar! Aber kann dir jemand faktisch beweisen, daß auch du sterben wirst? Haben wir nicht auch den tröstenden Satz: nulla regula sine exceptione — Keine Regel ohne Ausnahme? Und stehen solche Ausnahmen nicht auch wissenschaftlich fest? Nur wenige Beispiele: Alle Trabanten der Planeten sind einmal durch Abschleuderung von Ringen in der Äquatorzone ihrer Hauptkörper entstanden; folglich liegen ihre Bahnen ziemlich genau in der Ebene des Äquators und sie drehen sich, wie die Planeten, von West nach Ost. Der Satz ist eine oder die Hauptstütze des KantLaplace'schen Weltsystems. Aber die Monde des Uranus, deren Bahnen um mehr als einen rechten Winkel gegen die sämtlicher Planeten und Nebenplaneten »gekippt« sind, und von denen zwei sogar völlig verkehrt, von Ost nach West, herumlaufen? —
Energie kann nicht neu erzeugt werden; sie läßt sich nur verwandeln: mechanische Kraft in Wärme, Wärme in Licht, Licht in chemische Spannkraft, chemische Spannkraft in Elektrizität. (Gesetz von der Erhaltung der Energie). Kein Stoff kann neu erzeugt werden. (Gesetz von der Erhaltung der Materie).
U n d d a s R a d i u m? Das Radium, das unaufhörlich Wärme, Licht und Elektrizität aus sich heraus produziert? Das Radium, das unausgesetzt ein Gas entwickelt, das sich schließlich als H e l i u m offenbart? — Zugegeben also: Ausnahmen sind möglich von jedem Gesetz. Und ich will in dieser Erzählung ja nicht feststellen, daß irgendein Mensch unsterblich sei! Das allein soll der Leser mir zugestehen, daß der normale menschliche Lebenslauf, der hier auf Erden in 70—80 Jahren seinen Kreis beschreibt, doch einmal durch eine Ausnahme von der Regel so abweichen könne, daß der Ablauf der Lebensmaschinerie langsamer erfolgt. Anläufe zu dieser Ausnahme sind ja alle die »Hundertjährigen«, von denen unsere Tageszeitungen beinahe in jeder Woche einen Fall verzeichnen.
Schon im kleinen Kreise unserer Bekannten finden wir große Verschiedenheit im Älterwerden. Wie ungleich ticken die Lebensuhren! Mancher »wird gar nicht älter!« Sein Lebensrad rollt nicht weiter, sondern dreht sich scheinbar Jahre, Jahrzehnte hindurch auf derselben Stelle um sich selbst! Mit siebzig Jahren sieht er aus wie ein rüstiger Fünfziger, vielleicht noch jünger. Gehen wir von dieser Tatsache aus noch einen Schritt weiter! Ist es nicht denkbar, daß die launische Natur nun einmal eine noch größere Ausnahme macht? Daß sie — unter besonderen Verhältnissen — einmal das Altern eines Menschen auf Jahrhunderte verteilt? — Die medizinische Wissenschaft berichtet z. B. von einem Apotheker, der im mittleren Lebensalter statt der gewöhnlichen Zahl der Pulsschläge (70—80) nur ca. 28 gehabt, dessen Lebensfunktionen alle sehr langsam vonstatten gegangen, und der — sehr alt geworden sei. Aber vielleicht sind so auffällige Abweichungen im Körperbau gar nicht einmal nötig. Vielleicht wirken dabei psychologische Momente viel mehr! Es ist denkbar, daß die betreffende Person mit ihren Zeit- und Altersgenossen in gleichem Rhythmus lebt und altert — bis zu einem gewissen Augenblick, wo das eintritt, was wir vorhin im Bilde ausdrückten:
»Das Rad läuft nicht weiter, es dreht sich nur auf derselben Stelle!«
Vor einiger Zeit lief durch die Tagesblätter der Reichshauptstadt folgende Notiz:
»Ein großer Menschenauflauf bildete sich gestern nachmittag in der Gegend des Oranienburger Tores. Durch die Chausseestraße kam eine seltsam gekleidete Person, ein hochgewachsener Mann, vielleicht 30—40 Jahre alt. Das Auffälligste an ihm war seine Tracht: er erschien wie ein Zeitgenosse Friedrichs des Großen und sah aus, als ob er soeben aus einem Kupferstich des berühmten Chodowiecki he rausgestiegen sei. Auch der Zopf fehlte nicht. — Ein hinzugekommener Schutzmann brachte den wunderlichen Spaziergänger nach dem nächsten Polizeirevier.
Wahrscheinlich handelt es sich um einen verspäteten Karnevalsulk oder um einen harmlosen Narren, dem es ein besonderes Vergnügen macht, in der Tracht unserer Urgroßväter umherzustolzieren.« —
Acht Tage später berichtete dieselbe Zeitung:
»Der Sonderling, von dem wir in voriger Woche berichteten, daß er in der Tracht von 1760 am Oranienburger Tor aufgegriffen worden sei, beschäftigt unsere Behörden noch immer. Der Unbekannte war im Besitze einer größeren Geldsumme — aber sämtliche Geldmünzen stammten aus fridericianischer Zeit! Eine bei ihm gefundene Zeitung war eine Nummer der ›Vossischen Zeitung‹ vom September 1770. Die rätselhafte Person behauptet, ein Preuße und geborener Berliner zu sein, und nennt als seinen Geburtstag den 5. März 1735. Wenn man es nicht mit einem Abenteurer zu tun hat, der in dieser historischen Maske irgendwelche eigennützigen Zwecke verfolgt, so liegt hier vielleicht ein seltener psychopathischer Fall vor, der voraussichtlich noch unsere medizinischen Autoritäten beschäftigen wird. Der rätselhafte Hundertsiebzigjährige sieht aus wie Mitte der Dreißig und macht den Eindruck eines hochgebildeten Mannes. Interessant ist für den Fall einer psychischen Abnormität die Erscheinung, daß sein Gedächtnis völlig den Zusammenhang mit der Gegenwart verloren zu haben scheint; alle seine Erinnerungen gehen nicht weiter als bis zum Jahre 1770. Vom Frieden zu Hubertusburg, von dem Einzug der heimkehrenden Grenadiere des alten Fritz erzählt er mit der Ausführlichkeit und Anschaulichkeit eines Augenzeugen. — Wir werden auf dieses ›zeitgeschichtliche Rätsel‹ noch zurückkommen.« —
Dieselbe Zeitung — vierzehn Tage später:
»Nach Aussage der medizinischen Sachverständigen handelt es sich bei dem ›in Gedanken stehengebliebenen Zeitgenossen Friedrichs des Großen‹, wie ihn kürzlich eins unserer Witzblätter getauft hat, um eine äußerst seltene Form einer Monomanie. Die Psychiater erklären den rätselhaften Fall so, daß sie annehmen, der geistreiche Sonderling habe bei seiner ausgeprägten Vorliebe für geschichtliche Studien, namentlich für die fridericianische Epoche, durch eine bestimmte Art geistigen Defekts den Zusammenhang mit unserer Gegenwart verloren, und seine ›Erinnerungen‹ aus dem vorigen Jahrhundert seien subjektive Phantasien, die er nach außen projiziere. Diese Monomanie geht bei ihm bis zu kleinen Äußerlichkeiten: seine Redewendungen haben häufig altertümliche Färbung; sogar seine Schriftzüge zeigen ganz den Duktus, wie wir ihn an Manuskripten aus jener Zeit vorfinden. — Wie schon erwähnt, sind ihm die Eindrücke der Gegenwart völlig entschwunden. Auf einem Plane von Berlin aus unsern Tagen findet er sich nicht mehr zurecht; dagegen sind ihm die alten Kupferstichkarten unserer Hauptstadt von 1750—1770 verständlich. Er erscheint als ein friedlicher, harmloser Mensch.
Er nennt sich A d a m P e r e n n i u s. — Wir werden die Aufmerksamkeit unserer Leser wohl noch öfter auf dieses Menschenrätsel zu lenken Gelegenheit haben.«
Drei Tage später folgte noch die kurze Notiz in der Morgenausgabe:
»Der rätselhafte ›Urberliner‹, der unsere wissenschaftlichen Kreise seit einiger Zeit beschäftigte — Adam Perennius — ist seit gestern abend aus der Charité, wo man ihn bisher verpflegt und beobachtet hat, verschwunden.«
Am Spätnachmittage dieses Tages befand ich mich im Tegeler Park, den ich oft und gern besuche...
Und hier, an einem meiner Lieblingsplätzchen, traf ich den rätselhaften Fremden.
Schon beim ersten Blick glaubte ich, daß er es sei. Verschiedene illustrierte Blätter hatten ja sein Bild gebracht. Aber ich meine, auch ohne dieses Hilfsmittel der Erinnerung hätte ich ihn erkannt. Zwar trug er einen weiten Sommermantel, der seine Urvätertracht fast ganz verhüllte — aber der seltsame Zopf und der altmodische Hut, der neben ihm lag, lenkten mich schnell auf die richtige Spur. Allein auch ohne diese äußeren Kennzeichen war sein ausdrucksvolles, völlig bartloses Gesicht für einen modernen Menschen sehr auffallend.
Ich trat grüßend näher. Ich hatte die Zeitungsnotiz von heute morgen gelesen und fürchtete, er werde aufspringen und die Flucht ergreifen. Aber er erwiderte höflich meinen Gruß und blieb sitzen.
Das eigentümlich unsichere Gefühl, das wohl einen jeden beschleicht, der mit einer geistig nicht intakten Persönlichkeit zusammentrifft, überkam mich. —
Da blickte er mich an! Sein wunderschönes blaues Auge zeigte hohen Seelenadel. Nicht ein leiser Schimmer einer geistigen Verwirrung war in ihm zu merken. Zwar war ich kein Psychiater und konnte mich täuschen; aber auch ein Psychiater kann sich täuschen.
Das anfängliche Gefühl der Scheu in mir machte unter seinem Blick dem der ehrlichen Teilnahme Platz — und wie ein Blitz durchzuckte mich plötzlich der erschütternde Gedanke: Wenn dieser rätselhafte Mann von unsern Ärzten falsch beurteilt würde! Wenn er doch recht hätte, mit seiner unerhörten Behauptung, aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts zu kommen! Wenn er in Wahrheit durch irgendein wunderbares Naturgeschehen aufgespart geblieben wäre für unsere Zeit! Wenn er, wie ein Geschöpf im Winterschlafe, mehr als ein Jahrhundert im Leibes- und Seelenschlaf zugebracht und jetzt erst erwacht wäre!
Diese Gedankenreihe durchkreuzte mein Gehirn so rasch und unvermittelt, daß ich voller Verwirrung vor ihm stehen blieb und ihm nur immer starr ins Gesicht sah.
»Aus ihrer Verwunderung glaube ich entnehmen zu dürfen, mein Herr«, sagte er nun mit einer festen, wohltuenden Stimme, »daß Sie mich als die Person erkannt haben, von der Ihre heutigen Gazetten und Journale kürzlich allerlei Seltsames berichtet haben?«
»Ja — in der Tat —«, stotterte ich.
»Ich muß zugeben«, fuhr er fort, »daß mein Curriculum vitae wunderlich und absonderlich genug erscheint, am mehresten für mich selbst, das glauben Sie mir, mein Herr! Aber — ich kann ja doch nichts dafür und kann doch auch nur sagen, was ich von mir weiß, so unerhört und sinnlos dieses auch klingen mag. Ich bin wirklich der, für den ich mich ausgebe —«
»Sie sind seit gestern aus der Charité ent—«
»Entflohen — ja, d.h. ich habe den dortigen Doctores gesagt, daß die inquisitiones und examina mir nachgerade zu viel würden. Ich wäre mir keiner Schuld bewußt, und soviel ich wüßte, hätte auch mein König Friedrich selbst das Wort respektieret: Il y a des juges à Berlin! — So bin ich einfach gegangen, und man hat mich nicht sonderlich aufgehalten oder molestieret. — Den Weg hierher suchte ich, in alte Erinnerungen versunken, und habe ihn nach mancherlei Irrfahrten auch glücklich gefunden.«
»Ach«, seufzte er nach einer Weile, wo wir beide geschwiegen hatten, »wenn mich doch jemand verstände, wenn ich doch einer fühlenden Seele klagen könnte, wie mir zu Gemüte ist! Mit was für unsagbar schweren Gedanken durchwanderte ich Ihr heutiges Berlin! Ungefähr wie jemand, der als Greis seine Heimat wiedersieht, die er dereinstens als Knabe verließ. Aber mir fehlt das Bewußtsein der dazwischen liegenden Jahrzehnte! Denken Sie sich doch einen Moment in meine Lage! Meine Erinnerung schloß mit den Eindrücken aus dem Jahre 1770 — und nun soll ich plötzlich unvermittelt anknüpfen, wie ein aus dem Grabe Erstandener, ein revenant, an das Jahr 1905! O, ich sage Ihnen, dieser Kontrast ist furchtbar, ist fast unerträglich für mein Gemüt!« —
Ich hatte mich längst neben ihn gesetzt und leise meine Hand auf auf seinen Arm gelegt.
»Fassen Sie Vertrauen zu mir«, bat ich ihn, indem ich meinen Namen nannte. »Vielleicht vermögen Sie dies eher, wenn ich Ihnen versichere, daß ich Ihnen in allem glaube, was Sie über Ihr seltsames Schicksal berichten, Herr Perennius. Und nun kommen Sie mit mir! Denken Sie, dies alles sei ein wunderlicher Traum! Schauen Sie die alten treuen Bäume über uns. Sie standen schon zu Ihrer Zeit an diesem Platze. Die Natur bleibt treu! An ihrem Busen werden auch Sie Genesung finden in Ihrem leidvollen Schicksal, das seinesgleichen nicht hatte bis heute — kommen Sie!«
Und er nahm meinen Arm.
Wohin ich den rätselhaften Menschen führte, als das Dunkel des hereinbrechenden Abends uns überfiel?
»In die Abendschule!« In jene schon erwähnte kleine Vereinigung gleichgesinnter Menschen, die allwöchentlich einmal in einem Erholungslokal im Norden Berlins sich zusammenfand und deren Teilnehmer mancher meiner Leser wohl auch dem Namen nach noch kennt: den alten Herrn Oberlehrer und seine beiden Töchter, von denen die eine allerdings seitdem Frau Dr. Mathieu geworden ist, Dr. Mathieu, Großhändler Ludwig Deckers, Rentier Fennmüller und — meine Wenigkeit.
Hierher, wo alle Fachsimpelei und aller Alltagsklatsch verbannt war, brachte ich Adam Perennius. Auf meinen Rat wartete er einen Augenblick vor der Tür, indes ich eintrat, um sein Erscheinen ein wenig vorzubereiten.
Die Abendschule war vollzählig, bis auf Großhändler Deckers, der durch den Besuch seiner verheirateten Tochter noch ein Weilchen verhindert war, aber sein und ihr Erscheinen durch einen Boten hatte melden lassen.
»Guten Abend, meine hochverehrten Herrschaften«, sagte ich, die Anwesenden der Reihe nach begrüßend.
»Nanu«, rief Fennmüller launig wie immer, »Sie machen ja heute ein solches Extra-Gesicht! Haben Sie gut soupiert? Haben Sie Maikäfersuppe gegessen?«
»— Nein, nein, Herr Fennmüller! Sie wissen ja, der kulinarische Feinschmecker von uns sind Sie. — Aber ein ›ExtraGesicht‹ darf ich wohl machen. Wissen Sie, wen ich gesehen und gesprochen habe?«
»Einen Marsbewohner vielleicht?«, neckte die junge Frau Dr. Mathieu, die meine Schwärmerei für diesen rätselhaften Planeten kannte.
»Nein, noch nicht — vielleicht erscheint mir der auch einmal! Aber den geheimnisvollen Menschen habe ich getroffen, der aus dem vorvorigen Jahrhundert übrig geblieben ist als ein Zeitgenosse Friedrichs des Großen —«
»Sind Sie auch schon von ihm angesteckt, daß Sie seine Phantasieen für bare Münze nehmen?«, sagte Fennmüller halb lachend, halb ärgerlich. »Was man nicht alles erlebt, selbst an seinen Bekannten — wenn man alt genug wird!« —
»Welchen Eindruck hat der Unglückliche auf Sie gemacht?«, fragte der Herr Oberlehrer. »Halten Sie ihn, wie unsere Ärzte, für eine geistige Abnormität?«
»Herr Oberlehrer, ich bin kein Psychiater — aber nach meinem Dafürhalten ist der Mann geistig völlig gesund —«
»Dann bleibt also nur die zweite Annahme übrig, ihn für einen vollendeten Komödianten zu halten«, flocht Fennmüller ein, »der seine Rolle in der Maske von ›Anno dazumal‹ recht geschickt spielt —«
»Ja, Herr Fennmüller«, entgegnete ich, »recht geschickt, so geschickt, daß er sie nicht s p i e l t , sondern l e b t ! «
»Wie meinen Sie das?«
»Ich meine — und nun wappnen Sie Ihr Herz gegen Überraschung! — der Mann i s t das, was er scheint! Er ist ein Beispiel einer Lebenskraft, die anderthalb Jahrhunderte ungeschwächt überdauert hat —«
Die Anwesenden sahen mich mit sprachlosem Erstaunen an — Fennmüller hatte sich erhoben —
Nur Dr. Mathieu sagte ruhig:
»Ich glaube Ihnen!«
Dann sich zu den übrigen wendend:
»Meine Herrschaften, ebensoviel Wunderglauben er von Ihnen verlangt, verlangen auch die wissenschaftlichen Kapazitäten, die ein derartiges psychophysiologisches Rätsel Ihnen einfach als einen besonderen Fall einer bloßen Monomanie zu erklären versuchen.«
»Warum haben Sie uns den rätselhaften Menschen nicht mit in die ›Abendschule‹ gebracht?«, fragte der Herr Oberlehrer ein wenig schalkhaft. »Ich meine, die ›Abendschüler‹ samt ihrem ›Lehrer‹ sind sämtlich Menschen, die eine Ausnahme von der landläufigen Spezies Homo sapiens machen. Vielleicht hätte er sich in unserm immer hellen, immer heitern Kreise, fern von dem hastenden Gebtriebe der Weltstadt, wohl gefühlt —«
»Ich danke Ihnen für dies gute Wort, Herr Oberlehrer«, sagte ich hierauf und — öffnete die Tür. —
Und so trat er ein in unsere Mitte!
Aller Augen richteten sich einen Moment starr auf den Erschienenen. —
Aber dann geschah alles, wie ich es gehofft und gewünscht: man nahm den Armen, Einsamen, Rätselhaften freundlich auf; namentlich der Herr Oberlehrer, der älteste von uns, begrüßte ihn sehr herzlich und lud ihn ein, neben ihm Platz zu nehmen.
Und nun saß er unter uns. Hätte er nicht seine altmodische Kleidung getragen und den steifen Zopf, so hätte sein frisches, kluges Gesicht vortrefflich in unsern Kreis hineingepaßt; er schien wie ein junger Mann in der Mitte der Dreißig und man mußte sich immer erst wieder besinnen, daß ein Mensch von reichlich anderthalb Jahrhunderten einem gegenüber saß.
Das Gespräch, das anfangs gestockt hatte, setzte wieder ein, aber ich sah den Gesichtern, namentlich der Damen, an, daß das Interesse an gleichgültigen Dingen in diesen Minuten überwältigt wurde von der großen seelischen Spannung, mit der wir alle die Erscheinung unseres Gastes aufnahmen. Trotzdem scheute sich ein jeder von uns, ihn durch neugierige Fragen zu belästigen.
Wie dankbar überrascht waren wir daher, als der rätselhafte Fremde plötzlich sagte:
»Darf ich den verehrten Anwesenden ein Weniges aus meinem Leben erzählen, so gut ich es vermag? — Ich fühle, daß ich hier unter teilnehmenden Herzen weile, die kein Gelüst der bloßen Neugier treibt, die ein leidvolles Menschengeschick in edler Sympathie zu verstehen suchen werden —«
»Wir wagten nicht, Sie darum zu bitten«, sagte der Herr Oberlehrer verbindlich — »aber das darf ich Ihnen im Namen unserer kleinen Tafelrunde versichern, daß wir Ihnen aufrichtige, herzliche, Ihrer würdige Teilnahme entgegenbringen.«
Und seine Tochter setzte hinzu:
»Wird es Sie auch nicht zu sehr aufregen, unsertwegen die Vergangenheit wieder zurückzurufen?«
»Nein, Demoiselle«, sagte er freundlich lächelnd, »ich hoffe vielmehr, daß ich durch meine Erzählung mir für mein eigenes Wesen ein weniges von der Klarheit und Ruhe zurückgewinne, die mir in diesen Tagen der Verwirrung fast gänzlich verloren ging — nach dem bewährten receptum unseres alten Königsberger Poeten Simon Dach:
»Die Red' ist uns gegeben,
Damit wir nicht allein
Für uns nur sollen leben
Und fern von Menschen sein —
— — — — — — —
Der kann sein Leid vergessen,
Der es von Herzen sagt;
Der muß sicht selbst auffressen,
Der insgeheim sich nagt.«
Und er begann:
»Ich möchte Ihnen den letzten Tag meines früheren Daseins schildern!
Am 16. September 1770 war ich in einer Gesellschaft tüchtiger Männer und liebenswürdiger Frauen. Wir hatten miteinander einen kleinen Ausflug im Landauer unternommen in die Environs des Tegeler Sees. Ich könnte Ihnen ja all die Namen der Teilnehmer nennen — aber was sollen Ihnen die leeren Namen? Ach, soviel hat mir der gezwungene Aufenthalt unter ärztlicher Bewachung doch genützt, daß ich weiß mit trauriger Sicherheit, daß ich der einzige bin, der von ihnen allen noch lebt, der aus meiner Zeit noch lebt, körperlich zwar jung und rüstig, wie dereinstens, aber doch ein Vergessener, Übriggebliebener, vom harten Schicksal Verbannter, ein Schemen, der keine Ruhe gefunden hat —«
Er kämpfte einen Augenblick mit seiner Bewegung, dann fuhr er leiser fort:
»Und — auch s i e ist nicht mehr — s i e , um derentwillen ich an jenem Landausfluge teilnahm — Demoiselle Justine! — O, daß dieser süße Mund verstummt, diese himmlischen Augen sich auf ewig für mich geschlossen haben — glauben Sie mir, das ist das Schwerste, Unbegreiflichste unter all den Rätseln, die mich jetzt umgeben.«
Er zog eine altmodische, dickleibige Brieftasche hervor und entnahm ihr ein kleines ovales Emaillebildnis. Wehmütig versenkte er sich ein Weilchen in die geliebten Züge — dann reichte er es der Tochter des Herrn Oberlehrers. Diese betrachtete das Miniaturporträt und wollte es ihm dann dankend zurückgeben; durch eine Handbewegung aber bat er sie, es weiter zu reichen.
Und so sahen wir das liebliche Mädchenbild, das vor mehr als dreizehn Jahrzehnten seine Hoffnung und sein Glück verkörpert hatte. Die Farben des Bildchens waren noch so frisch und leuchtend, als sei es eben erst aus der Hand des Künstlers hervorgegangen: Das hochaufgetürmte lichtbraune Haar, die schöne, hohe, elfenbeinweiße Stirn, die feingeschwungenen Brauen über den strahlenden dunklen Augen, das zierliche Näschen und die roten Lippen, schön geformt, »wie Amors Bogen«, das Grübchen im Kinn und den schlanken Hals, der sich schlank und weiß wie eine Lilie aus dem bunten, faltigen Gewande erhob.
»Wie schön sie ist!«, rief die junge Frau Dr. Mathieu impulsiv aus, hingerissen von dem Liebreiz des Bildes.
»Ja«, sagte er mit einem glücklichen Aufleuchten seiner sprechenden Augen; — »aber ihr Herz war noch schöner, und mir gehörte dies Juwel, um das mich alle beneideten! Meinetwegen ertrug sie die fortgesetzten Drangsalierungen eines wunderlichen, alten Oheims, in dessen Hause sie als elternlose Waise leben mußte. Monsieur Scholvius besaß keine Sympathieen bei denen, die ihn näher kannten; sein Renommee war nicht tadellos. Ich wußte, daß er mit dem Plane umging, Justina an einen Abenteurer zu verkuppeln, von dessen Einfluß er sich wohl allerlei pekuniäre Vorteile für sein Quincailleriegeschäft versprach, an einen jener französischen Glücksritter, die hier bei Hofe aus- und eingingen. —«
»À la Ricaut de la Marlinière«, warf Dr. Mathieu dazwischen.
»Ja — o meine verehrten Herrschaften«, fiel der Erzähler — sich selbst unterbrechend — schnell wieder ein, »wenn Sie ahnen könnten, wie des jungen Magister Lessing Lustspiel hier in manchen Kreisen gezündet hat! Wie bin ich dem Zufall obligiert, der mir durch meinen Verkehr im Hause des Buchhändlers Voß einst die günstige occasion verschaffte, den gefürchteten Kritikus persönlich kennen zu lernen! Sein Lustspiel ›Minna von Barnhelm‹ — mit Chodowieckis Kupfern — empfing ich von ihm selbst mit eigenhändiger Dedikation. —«
Er zog aus seiner Brieftasche das kleine Buch im Duodezformat hervor, schlug es auf und reichte es dem Herrn Oberlehrer. Dieser las die handschriftliche Eintragung auf der Innenseite des Deckels:
»›Mein eigenes Unglück schlug mich nieder, machte mich ärgerlich, kurzsichtig, schüchtern, lässig; i h r Unglück hebt mich empor; ich sehe wieder frey um mich und fühle mich willig und stark, alles für s i e zu unternehmen.‹
(5. Aufzug, 2. Auftritt.)
Möchten Tellheims Worte auch für Sie Beide zur Wahrheit werden!
Berlin, den 5. März 1766.
Ihr Gotthold Ephraim Lessing.«
»Der vortreffliche Mann!«, begann der Erzähler von neuem. »Er kannte meinen Schmerz und meine Sorge, er kannte auch sie, meine Justina! — Doch hören Sie weiter! An jenem Tage, von dem ich erzähle, war Justina von ihren Freundinnen zum Ausfluge nach Tegel invitieret worden. Ach, es war seit fast fünf Monden der erste Augenblick, da ich die Geliebte wiedersehen durfte! — Lassen Sie mich schweigen von diesen seligen Empfindungen! Aber noch itzt packt mich der Grimm bei dem Gedanken an alles, was sie in diesem Zeitraum erdulden müssen, nicht an leiblicher, aber an seelischer Not! Ich sah unter sothanen Umständen nirgends mehr eine Rettung, als s c h n e l l e s Handeln. Aus Justinas Munde wußte ich, daß Monsieur Scholvius niemals zu ihrer Verbindung mit mir seine Einwilligung geben wollte. Alle meine Freundinnen und Freunde, die unser Schicksal beklagten und ihre Tränen mit den unseren mischten, waren ratlos! Justina war minorenn und in rechtlicher Gewalt ihres Oheims. Ach, wie gern hätte ich alle Brücken hinter uns zerbrochen und wäre ins Ausland geflohen! Ich besitze — besaß Konnexionen in Wien und London, zufolge meiner Arbeiten — ich habe mich, Kaufmann von Beruf, lange mit der Vervollkommnung der Seidenweberei und färberei beschäftigt — wie gern hätte ich an einem dieser fremden Orte mein Glück geborgen! Aber Justina wollte nicht heimlich ihr Glück sich stehlen; sie wollte in Ehren hier in Berlin mit mir leben, und sie bat mich abermals, Geduld zu haben. Aber ich wußte aus sicherer Quelle, daß Monsieur Scholvius seit einigen Tagen eifriger als je seinen dunklen Plan verfolgte; vielleicht hatte er ihr nur darum heute Urlaub bewilligt, um sie sicher zu machen! — Und ich hatte am Morgen dieses Tages eine gute geschäftliche Nachricht von meinem Korrespondenten aus Wien empfangen: auf meine Erfindung der verbesserten Seidenfärberei war mir ein kaiserliches Privileg erteilet worden, das mir das alleinige Fabrikationsrecht im Reiche sicherte. — So sagte ich Justina, daß ich am nächsten Tage noch einmal den Versuch machen wolle, ihren Oheim um ihre Hand zu bitten. Sie aber gelobte mir, wenn auch diese letzte Visite erfolglos für uns sein würde, daß sie mit mir gehen wolle, wohin es auch sei. So schieden wir — mit einem Kusse und mit der Hoffnung baldigen Wiedersehens —«
Er hielt inne und bedeckte die Augen mit der Hand.
»Vor der Stadt trennten wir uns. Justina fuhr mit den Übrigen nach Hause; ich ging zu Fuß weiter. Und da geschah das Rätselhafte, Unerklärliche —«
Wieder schwieg er einen Moment. Wir hingen wie gebannt an seinen Lippen.
»Ich kann selbst nur weniges darüber berichten. Aber soweit meine Erinnerungen davon reichen, will ich erzählen. Ich weiß, daß ich langsam fürbaß schritt, der Stadt zu, die im Lichte des Spätnachmittags vor mir lag. Und da —«
Ein Schauer durchrieselte ihn —
»— da senkte sich plötzlich eine große, schwere weiße Wolke auf meinen Weg herab, so dicht und scharf umgrenzt, als sei sie von anderer Materie gebildet als sonst Nebel und Wolken gemeiniglich sind.
Sie ruhte auf meinem Pfade wie ein in Schleier gehülltes Geheimnis.
Ein Grauen überfiel mich, als wollte mich eine innere Stimme vor ihr warnen!
Aber ich schüttelte die wunderliche Empfindung ab und schritt auf sie zu: itzt hatte ich sie erreicht — itzt trat ich hinein in ihre weißen Massen!
Und plötzlich sah ich nichts mehr — ein undurchsichtiges, unabsehbares Nebelmeer umwogte mich. —
Aber ich hatte die Empfindung, als ob ich trotzdem weiter schritte, weiter, immer weiter, schneller, immer schneller, rastlos, endlos... .
Und endlich, mit einem letzten Schritt, gelangte ich heraus aus der verhüllenden Wolke. — —
Da lag vor mir eine Riesenstadt, wie sie mein Auge nie geschauet. Eine ungeheure Zahl himmelhoher Schornsteine stieg vor mir in die Lüfte. Riesige Häusermassen umgaben mich in langer Reihe. Betäubt schritt ich dahin —
Dann führte man mich unter fremde Menschen einer fremden Zeit —
Das Weitere wissen Sie...«
— Wir saßen eine Weile unter dem Eindrucke seiner Erzählung stumm da. Vielleicht mangelt ihrer schriftlichen Wiedergabe gerade das, wodurch sie für uns so überzeugend und packend wurde: die ernste, edle Gestalt des Sprechenden, sein offenes, kluges, ehrliches Antlitz, sein jetzt im Feuer leidenschaftlicher Erregung flammendes, jetzt in ruhiger Fassung blickendes, aber immer klares, sicheres Auge, seine bald ruhig fließende, bald vor Aufregung stockende Sprechweise — das alles aber durchweht von einem geheimnisvollen Etwas, das sich nicht definieren ließ, aber dafür auf das Gemüt des Hörers nur um so überzeugender wirkte, das beispielsweise an seinen oft altertümlich gefärbten Redewendungen hing wie der Lavendelduft aus den alten Kleidertruhen der Urväterzeit. — Der da neben uns saß an demselben runden Tische unserer »Abendschule«, keine handbreit von uns entfernt, war doch seinem innersten Wesen nach von uns getrennt, nicht räumlich, aber zeitlich! Und mochte man die Augen schließen, um nicht seine altertümliche Tracht zu sehen — sein geistiges ich gehörte nicht mehr hinein in unsere Zeit! Sein seelisches Kleid trug den Schnitt von 1770, selbst wenn er sich nach unserer neuesten Mode gekleidet hätte. — Aber dies alles kann ich nicht so wiedergeben, wie es sich damals meinem Gefühl aufdrängte.
— Fennmüller saß mir gegenüber. Ich sah ihn an — ich kannte dieses schalkhafte Gesicht und die Wetterzeichen darin, die seine Stimmung verkündeten. Es zuckte bedenklich um seine Mundwinkel. —
Der Herr Oberlehrer aber sagte: »So haben Sie gar keine Erinnerung davon behalten, Herr Perennius, wo Sie so lange Zeit zugebracht haben?«
»Nein, Herr Oberlehrer«, entgegnete Adam Perennius bestimmt. »Nicht den Schatten irgend einer Erinnerung, daß ich auf meinem Wege vielleicht krank geworden und irgendwo Aufenthalt gehabt oder Unterkommen gesucht habe — nichts!«
»Das Rätselhafteste«, meinte Dr. Mathieu, »scheint mir nicht die subjektive Seite des Phänomens zu bilden, das Bewußtsein oder die Vorstellung, die Sie von dem ganzen Geschehnis nach so langer Zeit noch haben, sondern die objektive Erklärung des Phänomens, das Zustandekommen und Bestehen einer solchen Organismusstarre bei der ungestörten Fortdauer aller Lebensfunktionen — volle fünf Menschenalter hindurch. —«
»Und damals gab es noch nicht einmal Ihre ›Radiumbremse‹, Herr Doktor!«, sagte Fennmüller lachend.
Ehe Dr. Mathieu noch etwas erwidern konnte, ging die Tür des Lokals auf.
Frau Ellida, die jungverheiratete Tochter des Großhändlers Deckers, trat ein, am Arme ihres Gatten.
Wir waren eben im Begriff, die Ankommenden zu begrüßen, als Adam Perennius mit einem Schrei des Entsetzens auffuhr. —
Wie von einer Erscheinung gebannt, starrte er auf die junge Frau. Auf seinem Antlitz wechselte die Blässe des Todes mit fieberhaftem Rot.
»Justina«, — rang es sich dann aus seiner Brust hervor, indes er ihr einen Schritt näher trat. »Justina! Du — Du lebst noch? Du auch! So sind wir beide —«
Da erst schien ihm die Besinnung wiederzukommen. Sein Blick fiel auf die Gestalt ihres Begleiters. Er stammelte ein paar undeutliche Worte und stürzte aus dem Zimmer...
»Was hatte der wunderliche Herr?«, fragte Frau Ellida erstaunt. — Ja, was hatte er? Nach einer Weile sahen wir es auch.
Im Halbdunkel der Tür hatte Frau Ellida eine überraschende Ähnlichkeit mit — Demoiselle Justina, deren Miniaturbild wir vorhin betrachtet. So frappierend war diese Übereinstimmung, daß selbst Fennmüller ausrief:
»Mein Kompliment, Frau Ellida, Sie sehen noch genau so aus wie vor hundertfünfunddreißig Jahren!«
Woher stammte diese wunderbare Ähnlichkeit? Die Fragen und Wechselreden gingen herüber und hinüber.
— Ich aber benutzte diesen Augenblick, um nach dem Verschwundenen zu suchen. Ich benachrichtigte unsern allzeit aufmerksamen Wirt, Herrn Sandter. Gemeinschaftlich durchforschten wir das Lokal, den Garten. —
Nirgends eine Spur. Aber noch konnte er nicht weit gekommen sein! Schnell trat ich durch das Gartentor auf die Landstraße hinaus, die im hellen Mondscheine vor mir lag. Sie war nach beiden Richtungen leer.
So schnell mich meine Füße trugen, lief ich in der Richtung vorwärts, aus der ich heute abend mit dem seltsamen Fremden gekommen war. Laut rief ich seinen Namen, wieder und wieder. —
Aber ich erhielt keine Antwort und sah auch niemand.
Wohin konnte er so schnell verschwinden?
Und wieder lief ich weiter, immer weiter — — —
Da — vor mir auf dem Wege!
Wie von Geisterhand gesponnen, senkt sich's herab mit nebeligem Schleier —
Eine weiße Wolke, hell vom blendenden Mondlicht überflutet!
Und vor ihr — nicht mehr von der Biegung des Weges verdeckt, — Adam Perennius!
Laut rief ich seinen Namen, auf ihn zueilend.
Fast hatte ich ihn erreicht — da wandte er sich um und sah mich an — Unendlich gramvoll sind seine Züge, und es ist, als blicke ein uraltes, todmüdes Menschenantlitz mir entgegen, von unsagbarem Weh plötzlich gealtert!
Noch einmal kommt sein Name über meine Lippen —
Er aber winkt mit der Rechten ein Lebewohl!
Dann schreitet er hinein in das weiße Geheimnis!
Einen Augenblick lang sehe ich noch seine hohe Gestalt — dann zerfließt sie wie ein wesenloser Schatten.
Nicht, als ob ein Nebel sie verhüllte —
Nein, als ob sein scharf umgrenzter Körper sich auflöse in dem rätselhaften Medium der Wolke —
Nun ist er zerronnen — in nichts!
Noch einmal rufe ich angstvoll seinen Namen —
Keine Antwort!
Und da überfällt mich plötzlich namenloses Grauen...
Ich denke an seine Erzählung von der gespenstischen Verwandlung in der verhängnisvollen weißen Wolke. Ich will nicht auch so für meine Zeit und für die Meinen verloren gehen, wie Adam Perennius!
Fort — zurück — zu Menschen, zu meinesgleichen!
Und ich stürzte zurück. Die Gedanken jagten sich in meinem Hirn. Die ruhige Überlegung wurde überwältigt von den außerordentlichen Eindrücken der letzten Stunden. Was war Schein — was Wirklichkeit? Heute abend schien ihre feste Grenzmauer zu wanken. Gab es ein geheimnisvolles Zwischenreich zwischen Himmel und Erde, erfüllt von geheimnisvollen übermenschlichen Mächten?...
Vor dem Gartentor des Lokals hielt ich inne im Laufen. Ich klammerte mich am Gitter fest, um mein empörtes Herz zur Ruhe kommen zu lassen. —
Von der Stadt her kam in ruhigem, sicherem Schritt eine Gestalt im leichten Sommermantel.
Großhändler Deckers!
Mit einem befreienden Aufatmen eilte ich auf ihn zu und begrüßte ihn.
Er war verwundert über die Erregung, mit der ich seine treue, feste Hand ergriff.
Er ahnte ja nicht, daß ich mich an ihr zurückrettete aus dem Labyrinth irrender und verwirrender Gedanken in die befreiende, klare Wirklichkeit!
»Sehen Sie doch«, sagte er, auf den Weg deutend, den ich vor wenigen Sekunden verlassen, »wie der Nebel schon zieht. Ja, es wird Herbst!«
— Und jetzt, wieder ruhig geworden, sah ich auch nur eine harmlose Nebelwand und konnte meine grundlose Angst von vorhin nicht begreifen.
Mit ihm zusammen trat ich wieder ein in den Kreis der »Abendschule«,
— Ich berichtete über mein letztes Erlebnis,
In kurzen Worten erfuhr Großhändler Deckers das wunderbare Ereignis des heutigen Abends.
»Vielleicht kehr er doch zurück, wenn er sich beruhigt hat«, meinte der Großhändler.
»Wenn er zurückkehren w i l l ! «, sagte Fennmüller mit vielsagendem Lächeln.
»Wenn er zurückkehren k a n n ! «, änderte ich, noch einmal an die sonderbare Wolke denkend, die mich so erschreckt. —
— A b e r e r k e h r t e n i c h t w i e d e r ! —
Vor uns auf dem Tische lag als unanfechtbares Beweisstück noch immer das Exemplar der »Minna von Barnhelm« mit Lessings Widmung.
»Haben Sie irgendeine Erklärung für diesen Fall?«, fragte der Herr Oberlehrer unsern Dr. Mathieu.
»Nein, Herr Oberlehrer«, sagte dieser. »Ich war anfangs versucht, das rätselhafte Phänomen auf eine Art Starrkrampf, einen kataleptischen Zustand von außergewöhnlich schwerer Form zurückzuführen, wobei die subjektiven Erscheinungen, z. B. die einhüllende seltsame Wolke, von der er sprach, auf Störungen in der Funktion des Sehnerven hindeuten, wie wir ja bei eintretender Ohnmacht das Schwarzwerden vor den Augen wohl alle kennen; aber bei längerer Überlegung muß man diese Annahme doch wieder fallen lassen —«
»Und eine Art Hypnose, vielleicht hervorgerufen durch Autosuggestion!«, — warf ich dazwischen.
»Auch diese Möglichkeit ist mir eingefallen«, sagte Dr. Mathieu fortfahrend — »aber eine Hypnose von so langer Dauer?«
»Freilich, freilich — unmöglich!«
— »Und m e i n e Erklärung wollen die Herrschaften nicht gelten lassen?«, fragte Fennmüller spöttisch.
»Du hälst die ganze Sache für Schwindel, nicht wahr?«, erwiderte der Herr Oberlehrer — »aber Du bist doch sonst ein so guter Menschenkenner, Paule! Hast Du die Augen dieses Mannes beobachtet? Waren sie nicht rein und klar wie Kristall! Willst Du solche Zeugnisse nicht auch gelten lassen? Von dem überzeugenden Eindruck seiner altertümlichen Persönlichkeit will ich dabei gar nicht reden.«
»Also ein menschliches Rätsel!« Damit faßte Großhändler Deckers das allgemeine Urteil über Adam Perennius noch einmal zusammen — »ein menschliches Rätsel, ein Phänomen, an dem die Natur in Schöpferlaune einmal das vollbracht hat, was die Abenteurer früherer Jahrhunderte, ein Graf von St. Germain, Cagliostro u. a. ihren gläubigen Anhängern gegenüber zu sein behaupteten, Menschen mit ewiger Jugend!« —
»Papa«, sagte Frau Ellida im Laufe des weiteren Gesprächs, »Du hattest doch sonst immer in Deiner Brieftasche auch ein derartiges Miniaturbild, wie es Frau Dr. Mathieu mir eben beschrieben hat, und von dem ich noch aus meinen Kinderjahren weiß, daß es aus der Zeit unserer Urgroßeltern stammt. — Vielleicht interessiert das am heutigen Abend, der so ganz der Vergangenheit gewidmet ist, die ›Abendschule‹ besonders. —«
»Ja, richtig«, sagte Deckers, seine Brieftasche hervorziehend. »Das kleine Ding, nicht viel größer als ein Pfennig, in Email auf Gold gemalt, scheint einmal in der Familie meiner seligen Frau eine Rolle gespielt zu haben. Sie selbst kannte die Geschichte der kleinen Reliquie nicht mehr genau; nur soviel wußte sie, daß es von einer Urahne ihrer Familie stamme, die in ihrer Jugend eine unglückliche Liebe gehabt, lange Jahre in Schwermut gelebt und erst sehr spät sich verheiratet habe. Das kleine Miniaturbild fand man bei ihrem Tode an einem Kettchen auf ihrer Brust. —«
Er öffnete eine Klappe seiner Brieftasche.
»Hier ist es!«
Einen Blick warfen wir alle auf das zierliche Bildnis.
»Sollen denn die Rätsel und Wunder heute abend gar nicht aufhören?«, rief Fennmüller in großer Überraschung.
»Das Porträt unseres geheimnisvollen Gastes!«, rief Frau Dr. Mathieu — und wir alle mußten das bestätigen, sprachlos vor neuer Verwunderung.
— Ihr Gatte aber erbat sich das kleine Bildchen und besichtigte es eine Weile sehr genau, namentlich den Rand, wo das Email auf der Goldplatte auflag.
»Wissen Sie auch, daß es sich aufklappen läßt, wie ein Medaillon unserer heutigen Art?«, fragte er den Großhändler.
»Nein«, — rief Deckers überrascht.
»Da — sehen Sie!« Mit dem Fingernagel eine Stelle des Randes berührend, hob er das Bild von der Unterlage ab. —
Ein kleines, vergilbtes, zusammengefaltetes Papier fiel heraus.
Deckers ergriff es und faltete es vorsichtig auseinander.
Es löste noch eins der vielen Rätsel von heute abend; denn es enthielt die Worte:
»Meiner geliebten Justina.
Berlin, im Jänner 1770.
Adam Perennius.«
— Darunter in zierlicher Mädchenhand:
»Ich verlor Dich durch ein Geheimnis — aber einst finde ich Dich gewiß!
Am 10. Jahrestage unseres letzten Wiedersehens, den 16. September 1780.
Deine Justina.«
Das ist die seltsame Geschichte, die ich erzählen wollte und die ich dem Urteil des freundlichen Lesers hier übergebe.
Der Nachtschnellzug Berlin—München sauste durch die stürmische Herbstnacht. Ich saß allein in meinem Coupé, im Halbschlafe hin und wieder einen Blick durch die vom Hauche getrübten Fensterscheiben werfend. — Wie schnell man sich doch an den elektrischen Schnellverkehr der Staatsbahnen gewöhnt hatte! Kaum einige Jahrzehnte waren seit den ersten größeren Versuchen auf der Militärbahn Berlin—Zossen vergangen — und heute fahren wir auf allen Hauptlinien schon mit zweihundert Kilometer Geschwindigkeit pro Stunde dahin, so leicht und sicher, als ob es schon immer so gewesen und des Bewunderns gar nicht wert sei. Aber so sind wir Menschen: »Der Weg zum Ziel ist uns alles, das Ziel nichts!«... —
Ein dumpfes Glockensignal ertönte — ein Zeichen, daß wir uns einer Haltestation näherten — bei der kolossalen Schnelligkeit der Fahrt wurde mehrere Kilometer vorher der Strom ausgeschaltet — die Geschwindigkeit der Motoren verlangsamte sich, die magnetischen Bremsen klammerten ihre Preßbacken gegen Räder und Schienen: der Zug stand.
Der Stationszeiger an der gegenüberliegenden Wand meines Wagens wurde hell, hinter der erleuchteten Scheibe erschien das Wort B i t t e r f e l d und die Zeitangabe: eine Minute.
Zehn Sekunden vor Ablauf dieser Minute zeigte ein abermaliges schrilles Glockenzeichen die nahe Weiterfahrt an. Ich klappte die Zwischenlehne meines Sitzes hoch und streckte mich zum Schlummer aus; ich blieb also für die nächste Strecke noch Alleinbeherrscher dieses Raumes.
Da — eine Sekunde vor der Abfahrt — stieg noch ein Reisender in mein Coupé; eine hohe Männergestalt, fest in den Mantel gehüllt, den Hut tief in die Stirn gedrückt. Einen eigentümlich aussehenden Reisekoffer, von bedeutend größerer Dimension als gewöhnlich für Handgepäck üblich, stellte er über sich ins Gepäcknetz, drückte sich in die mir diagonal gegenüberliegende Wagenecke — und wir fuhren weiter.
Ich war von meinem Lager aufgefahren, hatte die stummgrüßende Verneigung meines Mitinsassen ebenso erwidert, hatte im stillen meine Glossen gemacht über dieses Monstrum eines Koffers und darüber, daß der Reisende ihn nicht im Gepäckwagen befördern ließ — und saß nun, wie mein Gegenüber, still in meiner Ecke, anfangs meine Blicke zwischen der dunklen Herbstnacht draußen vor meinem Fenster und dem noch im letzten Augenblick erschienenen sonderbaren Fahrgaste wechselnd — bis schließlich meine Müdigkeit über meine Neugier den Sieg errang und ich in ruhigen, wenn auch nur leichten Schlummer sank. — —
Ich mochte eine geraume Zeit geschlafen haben: ein blendender Lichtschein von unerträglicher Helle erweckte mich.
Mein Reisegefährte hatte seinen Koffer herabgenommen, aus einem Fach des geöffneten Gepäckstückes strahlte der sonnenhelle Glanz, der mich aus dem Schlafe gerissen hatte.
Neugierig richtete ich mich empor und näherte mich dem seltsamen Gegenstande und seinem Besitzer.
Er schien mich gar nicht zu bemerken, der eigentümliche Reisende; er war in die Untersuchung seines Koffers vertieft und wandte mir den Rücken zu, mir den Ausblick und Einblick in seine sonderbare Maschine — denn eine solche schien der Koffer zu enthalten oder zu sein — ziemlich erschwerend. Das dumpfe Glockensignal ertönte wieder. —
Der Fremde klappte seinen Koffer zu, ließ ihn aber neben sich auf der Bank stehen.
Wir fuhren in den Bahnhof von H a l l e ein. —
Für mein naturwissenschaftliches und technisches Interesse gab es hier ungemein viel zu schauen, trotz der nächtlichen Stunde — ein Lichtmeer von blendendhellen Strahlen, größtenteils von den seit ungefähr einem Jahre eingeführten BallonApolloniumLampen, System SucherHintze sich ergießend, ließ die gewaltige Bahnhofsanlage mit ihren Gleisdreiecken, Über- und Unterführungen deutlich erkennen. Ich konnte mich nicht sattsehen und war im stillen stolz auf meine Zeitgenossen, die dieses technische Wunderwerk geschaffen. Neugierig betrachtete ich mein Gegenüber, um zu erfahren, welchen Eindruck dieser Riesenbahnhof auf ihn mache — gleichgültig schaute er vor sich hin, mit halbgeschlossenen Augen, als interessiere ihn seine Umgebung gar nicht. — —
Was war das für ein seltsamer Mensch? Er war fürwahr der erste, der diesen Bau nicht bewunderte. Alle Zeitschriften hatten seit Jahren begeisterte Artikel über die KnotenPunkte der Schnellbahnen mit ihren großartigen Schienenkonstruktionen gebracht, namentlich H a l l e war in dieser Hinsicht berühmt. — und dieser stumpfsinnige Reisende blieb vor und in diesen Wundern menschlichen Geistes träge in seiner Ecke sitzen. — —
Vielleicht fuhr er öfter auf dieser Strecke — aber ich für mein Teil würde diesen Anblick und Ausblick, vollends bei Nacht, dieses märchenhafte Durcheinander mit seinen tausenden von bunten Lichtern und Signalen immer wieder bewundern, und wenn ich jeden Tag hier vorbeiführe!
So denkend, öffnete ich ostentativ das Fenster, um ihm mit dieser stummen Symbolik die Mahnung zu geben, die Fenster seines Ichs vor soviel Schauens- und Staunenswertem nicht verschlossen zu halten, und schaute hinaus.
An allen Coupéfenstern meiner Nachbarschaft zeigten sich die Köpfe von Mitreisenden, die gleich mir das unvergleichliche Nachtbild bewunderten. Fünf Minuten hatte der Fernzug hier Aufenthalt — und mir schienen sie ebensoviel Sekunden gewesen zu sein, als das schrille Signal zur Abfahrt ertönte. Ich zog meinen Kopf wieder herein in den Wagen, schloß das Fenster und sah mich nach meinem Gegenüber um.
Neben ihm saß plötzlich eine dritte Person, eine tiefverschleierte Dame, die eben erst eingestiegen zu sein schien, denn sie war sehr erregt und atemlos, und ihre Brust wogte stürmisch.
Nach und nach beruhigte sie sich ein wenig, ihr todblasses Antlitz, das unter dem schwarzen Schleier noch bleicher erschienen war, rötete sich etwas, das stoßweise, schwere Atmen wurde gleichmäßiger und sanfter — und endlich ging ein schüchternes Lächeln über ihre Züge, und sie sagte zu meinem seltsamen Coupégenossen, den Schleier zurückschlagend: »Herzlichen Dank, mein Herr, für Ihre liebenswürdige Hilfe! Ohne Sie hätte ich in meiner Aufregung die Coupétür nicht mehr zu öffnen vermocht — das Abfahrtssignal war bereits gegeben — ich hoffte nicht mehr, zur Zeit zu kommen — aber ich mußte diesen Zug erreichen und wenn es mein Leben gekostet hätte! Haben Sie Dank!«
Er verneigte sich und lüftete seinen Hut: »Es war meine Schuldigkeit, gnädige Frau«, sagte er einfach, mit einem etwas fremden Klang in der Stimme.
Diese Bemerkung machte ich aber nur nebenbei, am meisten interessierte mich die Dame, seit ich ihre angstvoll hervorgestoßenen Worte vernommen hatte. —
Diese Stimme — welche Erinnerungen erweckte sie in meiner Seele! Diese dunkle und doch klangvolle Stimme hatte nur eine auf dieser Erde, jene, die ich einst geliebt, Helene! —
Aber das war ja nicht möglich — das wäre ja ein schlechter, völlig verbrauchter Roman- oder Theatereffekt, wie ihn das nüchterne Schicksal mit seinen Alltagskünsten niemals ausführt! In e i n e n Raum mit mir sollte es mir Helene senden, um die ich einst, als ich sie verlor, fast zum Narren geworden! (1) In dieser Stunde sollte ich sie wieder sehen, jetzt, wo ich nach zwölf Jahren zum ersten Male meine Heimat wieder aufsuchen wollte, — jetzt, mitten in der Nacht im elektrischen Fernzug Berlin—München? Es war einfach nicht möglich! Eine Ähnlichkeit höchstens — allerdings eine ganz frappante! — konnte hier vorliegen, nichts weiter. Wie käme sie auch um diese Zeit an diesen Ort — und aufgeregt, wie auf einer Flucht — sie, die begüterte Gattin eines wohlsituierten Großkaufmanns? — Nonsens!
(1) Enthalten im Gedichtzyklus »Helene« in der Sammlung Schlichte Gedichte.
Energisch richtete ich mich aus meiner zusammengedrückten träumerischen Haltung auf, um dadurch auch mein Inneres zurechtzurücken — mit einer Handbewegung scheuchte ich die Gedanken von meiner Stirn.
Dadurch wurde die Fremde erst auf mich aufmerksam; voll wandte sie mir ihr Gesicht zu:
S i e w a r e s , t r o t z a l l e d e m !
»Helene!«, stieß ich hervor — willenlos — besinnungslos — —
Sie hatte auch mich sofort erkannt und nannte leise meinen Namen. — —
»Was für ein Wiedersehen!«, sagte sie traurig, mir die kleine Hand reichend: Dann setzte sie leise hinzu:
»Ach, mein lieber Freund, wenn Sie wüßten, was ich erlitten in all den Jahren, Sie würden mir nicht mehr grollen«,
»Ich grolle Ihnen nicht mehr, Frau Helene. Aber nun erzählen Sie mir, was Sie veranlaßt hat, zu dieser Stunde diese Reise zu machen. Sie kamen so atemlos hier herein, wie ein gehetztes Reh —«
»Ja, Sie treffen das Richtige, ich ward gehetzt, gejagt —«
»Gehetzt? Von wem, ich bitte Sie!«
»Von der Sorge um Guido —« Ich sah sie bestürzt an.
»O, mein Freund«, sagte sie in aufwallender Empfindung, »Sie wissen ja nicht —« Sie verstummte plötzlich, wie von einer schmerzlichen Erinnerung überwältigt, und bedeckte die Augen mit der Hand...
Der Fremde war aufmerksam geworden und sah zu uns herüber. Zum ersten Male erblickte ich seine Augen; sie waren groß und dunkel und von einem ungewöhnlichen Glanze. Helene hatte sich gefaßt und sprach leise:
»Sie wissen wohl nicht, daß ich seit drei Jahren von meinem Manne getrennt lebe —«
»Nicht möglich!«
»Aber es ist so — war besser so. Unser Glück kam und schwand wie ein Traum. Eines Tages fühlte ich, daß ich meinem Manne eine Last geworden war — und da unsere Ehe kinderlos blieb, fehlte auch das letzte Band, das in tausenden solcher Ehen, wie der unseren, ein weiteres Zusammenleben erklärlich erscheinen läßt.«
Sie las wohl auf meinem Gesichte die schmerzliche Teilnahme an ihrem Geschick; sie fürchtete wohl auch, in meiner Seele ein falsches Urteil über sich wachzurufen; feuchten Auges reichte sie mir die Hand noch einmal und sagte:
»Gott ist mein Zeuge, daß ich alles versucht habe, die Trennung zu vermeiden, Sie selbst, mein Freund, hätten mir geraten, so zu handeln, wie ich es getan!«
Ich drückte die schmale Frauenhand an die Lippen und sagte dann: »Wie soll ich aber dazu Ihre ersten Worte verstehen, daß die Sorge um Ihren Gatten Sie heute nacht in diesen Fernzug getrieben, Frau Helene?«
Statt aller Antwort öffnete sie das kleine Reisetäschchen, das sie bei sich führte, und reichte mir ein Telegramm.
Ich las:
TELEGRAMM AUS SOLNHOFEN (ALTMÜHL) 1. OKTOBER 19..
DIREKTOR MÄRTENS IM SCHIEFERBRUCH VERUNGLÜCKT, WÜNSCHT SIE ZU SPRECHEN.
DR. KÜHLING.
Schweigend faltete ich das inhaltsschwere Papier wieder zusammen. »Begreifen Sie, daß mir alles daran lag, diesen Nachtschnellzug zu erreichen? Das Telegramm ist erst auf Umwegen in meine Hände gelangt, so daß mehrere kostbare Stunden für mich verloren gingen. Und daß ich hinreisen mußte, ist doch begreiflich! Ich bin es seiner und meiner Ruhe und unserer Vergangenheit schuldig — ich fühlte, daß ich zu einem hoffnungslos Verunglückten reise — und Guido hat es wohl auch gefühlt —«
Sie schluchzte leise. Ich warf einen Blick auf den dritten Fahrgast. Er betrachtete die junge Frau mit innigem Mitleid; es schien, als ob er ihr ein Wort des Trostes sagen wollte — da ertönte plötzlich ein schrilles, nervenerschütterndes Signal, überall im Innern des Zuges flammten elektrische Lampen auf, ebensolche Notlichter erschienen draußen auf der Strecke zu beiden Seiten des Bahnsteiges. Die Bremsen setzten ein, mit einem gewaltigen Ruck hielt der Zug — mitten auf freiem Felde.
Ich war aufgesprungen, Frau Helene klammerte sich zitternd an meinen Arm.
»O Gott«, rief sie verzweifelt, »nur kein Bahnunglück, das mich aufhält!« —
Der Fremde deutete mit der Rechten auf den elektrisch betriebenen Stationszeiger, der sich uns gegenüber im Coupé befand, statt eines Stationsnamens erschien auf der erleuchteten Scheibe folgende Notiz:
»Durch plötzlich niedergegangenen Bergrutsch bei Station Kösen Geleise gesperrt. Schlußstation Naumburg. Voraussichtliche Dauer der Störung wegen fortwährend noch nachstürzender Erdmassen zur Zeit nicht zu bestimmen.«
»Ach, mein armer Mann«, rief Helene, — dann sank sie aufschluchzend auf ihren Sitz zurück, das Antlitz in den Händen verbergend.
Wir saßen schweigend — nach einer Weile begannen die Motoren des Zuges wieder zu arbeiten, Station Naumburg kam in unseren Gesichtskreis, Frau Helenes einstige Heimat und auch die meine.
Der Zug hielt. Die Coupétüren wurden geöffnet. »Alles aussteigen!«, riefen die diensttuenden Schaffner.
Mit hundert anderen standen auch wir auf dem Perron des Bahnhofes.
»Könnte man nicht mittelst eines Wagens oder Automobils von hier aus nach einer Station südlich von der verschütteten Strecke gelangen?«, hörte ich in meiner Nähe einen Reisenden den Bahnhofsinspektor fragen.
»Das Maschinenhaus bei Kösen, das den Drehstrom für die Strecken südlich von Kösen und Großheringen liefert, ist ja vom Bergrutsch zerstört — Sie müßten dann schon noch weiter — bis Jena vielleicht im Wagen fahren, jetzt mitten in der Nacht ein aussichtsloses Unternehmen, mein Herr! Das ratsamste ist, hier zu übernachten. Naumburg hat ja Hotels genug — und morgen früh weiter zu fahren. Um diese Zeit hoffen wir den Betrieb, wenn auch mit geringerer Geschwindigkeit wieder aufnehmen zu können.«
Frau Helene hatte, gleich mir, jedes Wort des Beamten mit angehört. Ihr erneutes Schluchzen verriet mir ihre Seelenqual. O, wer kennt ihn nicht, diesen Kampf des tapferen Menschenherzens gegen tückische Zufallsgewalten, die wie grinsende Dämonen sich ihm in den Weg stellen — wer hätte ihn nicht auch schon durchgekämpft in ohnmächtigem Trotz gegen das Unabänderliche! —
Nach und nach verlief sich die Menge der Reisenden. Man hörte die Droschken zur Stadt rollen. Nur die Zugbeamten waren noch in voller Tätigkeit — für morgen.
Noch immer standen Helene und ich ratlos auf dem Perron. Da sprach plötzlich hinter uns eine Stimme:
»Wollen Sie sich m i r anvertrauen, gnädige Frau? I c h b r i n g e S i e n o c h h e u t e n a c h t n a c h M ü n c h e n.«
Als ob ein Blitzstrahl vor uns niedergefahren, trafen uns diese Worte. Wir wandten uns um — unser dritter Coupégenosse hatte sie gesprochen.
Er stand hellbeleuchtet von den Bahnhoflampen vor uns.
Das Haupt hatte er bei seiner Anrede entblößt; es zeigte schönes welliges Haar von weißer Farbe. Dazu standen seine Augen in vollem Gegensatz — sie erschienen fast nachtschwarz.
Ängstlich forschte ich in seinen Zügen nach den Zeichen des Irrsinns, und auch Helene griff unwillkürlich nach meinem Arm.
»Mein Name ist —« er nannte einen kurzen, einsilbigklingenden Namen, den ich nicht verstand —. »Ich bitte Sie nochmals, sich mir anzuvertrauen; ich verpflichte mich, Sie in wenigen Stunden nach München zu transportieren. Ich war vorhin im Coupé Zeuge Ihres Gespräches und weiß also, daß Sie an das Lager Ihres verunglückten Herrn Gemahls eilen wollten.«
Helene ergriff seine Hand.
»Ich vertraue Ihnen«, sagte sie leise, aber zuversichtlich und mit einer rührenden Innigkeit, »ich weiß zwar, daß Ihr hilfreiches Anerbieten einem Wunder gleicht — aber nur ein solches vermag mir in meiner Not zu helfen! Mein Reiseziel ist nicht München, sondern der Kalkschieferbruch Solnhofen an der Altmühl — ich hätte den Zug also nur bis Regensburg benutzt.«
»Ich helfe Ihnen!«, sagte er noch einmal, »Sie werden sogleich sehen, daß ich die Macht dazu besitze« — dann wandte er sich an mich: »Darf ich Sie wohl bitten, mir ein wenig behilflich zu sein? Ich möchte zunächst für die Vorbereitungen zur Fahrt eine freie Fläche aufsuchen, vielleicht ist hier in der Nähe eine Wiese.«
»Verfügen Sie ganz über mich!«, entgegnete ich, meinen Namen nennend, »Naumburg ist meine Heimat, und ich weiß hier Bescheid. Gleich jenseits des Bahndammes finden Sie einen geeigneten Platz, mein Herr!«
In wenigen Minuten waren wir auf dem freien Felde angelangt. Der Fremde setzte seinen Koffer, den er bisher in der Hand behalten, auf dem Erdboden nieder und schloß ihn auf. Dann klappte er ihn auseinander, und ich sah, daß das umfangreiche Gepäckstück aus zwei gleichgearbeiteten Hälften bestand. Trotz der uns umgebenden Dunkelheit vermochte ich jede Einzelheit des seltsamen Apparates wahrzunehmen, denn beim Öffnen hatte sich gleichzeitig ein Licht entwickelt, dessen Glanz ich kaum ertrug und das ich heute schon einmal im Coupé wahrgenommen hatte. Die beiden Kofferhälften ließen sich durch harmonikaartige Auszüge bedeutend verlängern und wurden durch übergreifende Riegel aus Metall zu einem festen Ganzen verbunden. Durch Bewegung zweier Spindeln wurden die metallenen Schutzplatten der Vorder- und Rückwand parabolisch gekrümmt. Das ganze sah nun aus wie ein kurzes Boot, das durch eine Querwand in der Mitte geteilt war. Eine aus der Mitte aufragende Stange, durch Auseinanderziehen teleskopartig angeordneter Metallröhren entstanden, vergrößerte noch diese Ähnlichkeit.
Als der Fremde sein Fahrzeug soweit vorgerichtet hatte, trat er wieder zu Helene heran, die trotz ihres Kummers mit Erstaunen dem Aufbau gefolgt war.
»Darf ich Sie nun bitten, Platz zu nehmen, gnädige Frau!«
Helene stieg über den Rand des Koffers und stand in der einen Hälfte.
»Bitte, setzen Sie sich, diese Querwand enthält eine luftkissenartige Polsterung —«
Sie folgte seiner Weisung.
»Sitzen Sie auch nicht zu niedrig — nicht zu unbequem?«, fragte er.
»Nein — sehr gut — ich danke!«
Ich trat an sie heran, Sie reichte mir die Hand.
»Leben Sie wohl — Gott geleite Sie!«, sagte ich, die kleine Hand an die Lippen ziehend.
»Wollen Sie nicht mitfahren?«, fragte der Fremde. »Wenn Sie sonst über Ihre Zeit frei verfügen können —«
»Ich wagte nicht, Sie darum zu bitten, mein Herr — und außerdem ist eine dreifache Belastung wohl für Ihr Fahrzeug zu schwer?«
»Es ist für vier Personen im Notfall bestimmt, mein Herr. Wenn Sie also die gnädige Frau zu begleiten wünschen —«
»Kommen Sie mit, lieber Freund!«, sagte nun Helene, mir ihre Hand entgegenstreckend.
Ich stieg ein und setzte mich neben sie.
Aus einer Tasche der einen Wand nahm der Fremde nun drei Schutzkappen für das Gesicht, wie sie in ähnlicher Form für die Automobilfahrer gebräuchlich sind, und wir legten sie an.
Dann setzte er sich, Rücken gegen Rücken, zu uns.
»Bitte, meine Herrschaften, die wasserdichte Umkleidung, die am Rande des Fahrzeugs festgemacht ist, aufzurollen und an Ihre Schutzmasken zu knöpfen!«
Er hatte es bereits getan, und wir folgten seinem Beispiel. Wir sahen fast aus, wie Eskimos im Kajak. Die dem Kautschuk ähnliche Hülle umgab uns überall, nur unsere Köpfe sahen heraus —... —
Plötzlich erlosch das Licht. Ein Gefühl, als ob ich in einem Fahrstuhl säße, der sich plötzlich in Bewegung setzt, überkam mich.
Wir erhoben uns von der Erdoberfläche — wir schwebten! Schon befand sich mein Auge in gleicher Höhe mit den Wipfeln der Bäume, die unsere Wiese eingesäumt hatten.
Was war das für ein wunderbares Fahrzeug?
War es nicht wie ein Märchen? Und Andersens Märchen vom »fliegenden Koffer«, kam mir in den Sinn.
Wer war der seltsame Fremde?
In merkwürdiger Ideenverbindung dachte ich an Doktor Faust und an seinen Zaubermantel, der ihn einst durch die Lüfte getragen...
Über uns erglänzte plötzlich ein Lichtschein. Von der Spitze des Mastes sandte ein Scheinwerfer einen mächtigen Kegel von Lichtstrahlen aus.
Ich wandte mein Gesicht meiner Nachbarin zu.
Ein Lächeln sah ich trotz der Vermummung auf ihrem lieben Gesichte, als sie mich anblickte.
Wir stiegen noch immer senkrecht empor. Ich schätzte unsere Höhe auf ungefähr dreihundert Meter.
Der Fremde hinter meinem Rücken sagte nun:
»Ich bitte, die Trägerstange fest mit einem Arme zu umklammern, meine Herrschaften; unsere Schnellfahrt beginnt!«
Wir taten nach seinem Geheiß. Er beugte sich vor und faßte den Griff eines Hebels, der an der Seitenwand hervorragte...
Die elektrischen Signallichter und Lampen des Naumburger Bahnhofs, die noch immer in unserm Gesichtskreis gelegen hatten, verwandelten sich plötzlich in leuchtende Streifen.
Wir sausten durch die Luft, wie ein Geschoß.
Unser Führer hielt den Kurs nach der Richtung des Schienenweges zu unseren Füßen...
»Kösen!«, sagte er nach einigen Sekunden der Fahrt. Von dem hier erfolgten Bergrutsch, der Ursache unserer unterbrochenen Eisenbahnfahrt, war fast nichts zu bemerken; eine Lücke in den Reihen der zu beiden Seiten des Bahnkörpers leuchtenden Signallaternen schien allein darauf hinzudeuten.
Wie schnell wir fuhren — vermöchte ich schwer in Zahlen anzugeben. Das völlig Ungewohnte, Überraschende, Wundersame dieser nächtlichen Reise unter der Führung eines Unbekannten, an der Seite meiner verlorenen Jugendgeliebten umfing mich wie ein Märchen und verschleierte mein Denken!
Wohl wußte ich, daß ein Versagen des geheimnisvollen Fahrzeugs unsern Sturz und damit unsern Tod unrettbar zur Folge haben mußte; aber ich dachte an keine Gefahr. Eine wundersame Ruhe war über mich gekommen.
Obwohl die Schutzmaske mein Gesicht, ja den größten Teil des Kopfes bedeckte, fühlte ich doch an der Kühle des Luftstromes, der uns entgegensauste, daß unsere Bewegung ungeheuer schnell sein mußte.
G r o ß h e r i n g e n — — J e n a waren an unserem Horizonte aufgetaucht und ebensoschnell wieder im Dunkel der Nacht versunken.
»Wie fühlen Sie sich, gnädige Frau?«, hörte ich unsern Führer fragen.
Helene dankte.
»Nochmals — vertrauen Sie mir, seien Sie ohne Furcht! Unsere Fahrt führt Sie sicher zum Ziele!«
Nun wußte ich auch, warum dem Besitzer dieser wunderbaren Maschine unsere großartigen neuen Verkehrsmittel nicht besonders imponieren konnten — wer so sich zum Herrn des Luftmeeres machen konnte, der lächelte über die noch auf der Erde dahinkriechenden Geschöpfe!
Ich versuchte mit dem wundersamen Manne ein Gespräch anzuknüpfen — ich bat ihn um Aufklärung über sein geheimnisvolles Fahrzeug. Er entschuldigte sich, daß er meiner Bitte nicht willfahren könne, da die Steuerung seines Luftschiffes seine volle Aufmerksamkeit erfordere — er riet mir auch, so wenig als möglich zu sprechen, da der Anprall des Luftstromes zu heftig für den Kehlkopf sei. So schwieg ich denn. — Helene saß neben mir. Ihr Arm berührte den meinen, und ich fühlte die Wärme ihres Körpers — aber nicht ein Funke des Verlangens glühte in meiner Seele auf: Sie war das Weib des Nächsten und — war unglücklich!
Der Himmel war sternenklar geworden, die letzten Wolkenfetzen zerflattert. Eine völlig neue, unsagbare Stimmung kam über mich; etwas Unirdisches, Körperloses, Weltfernes und doch Weltenweites wachte in mir auf; Zeit und Raum versanken vor meiner Seele — meine Jugend und meine Liebe, die ich längst verloren geglaubt, fuhren mit mir hinein in die sternenbesäte Unendlichkeit; nie war mir der Begriff einer zeitlosen Existenz so greifbar klar gewesen, als in dieser Stunde! Wie eine Heimfahrt war's — aber nicht in eine irdische Heimat!...
H e i m a t ! hatte ich das Wort gesagt oder gedacht? Es regte eine neue Gedankenreihe in meinem Geiste an; des Tages dacht' ich, da ich zum ersten Male nach Jahren der Abwesenheit heimgekehrt nach Naumburg, nach dem Tode meiner guten Mutter! Wie elend und einsam war ich da durch die Straßen meiner Jugend gewandert! Die Verse, die ich damals traurig in mein Notizbuch geschrieben, gingen mir nun wieder durch die Erinnerung:
»Nun bist zurück zur Heimat du gekehrt
Nach langem, friedelosem Wandergang,
Die müde Brust von stillem Gram verzehrt —
Von ferne tönt der Abendglocken Klang,
Und da du steigst ins Heimattal hernieder,
Empfängt dich trauter, lieblicher Gesang:
Und horch! — es sind die alten Weisen wieder,
Und bis ins Herz dringt dir ihr Sehnsuchtsklang —
O Heimatzauber süßer Jugendlieder!
Zum alten Friedhof ist dein erster Gang;
Da liegt ein schmucklos Grab an düstrer Mauer,
Der Mutter Grab! — Dir wird so trüb, so bang.
Der Stunde denkst du noch voll bittrer Trauer,
da einst die Mutter dich hat ziehen lassen: —
Sie fühlte schon des ewigen Abschieds Schauer! —
Dann gehst du weiter durch die dunklen Gassen,
Doch kein befreundet Antlitz schaut heraus.
So einsam bist du, bist so ganz verlassen.
Hier stockt dein Schritt: das ist dein Vaterhaus,
Da du der Kindheit Paradies gefunden,
Da froh der Knabe stürmte ein und aus.
O, sel'ge Zeit — wohin bis du entschwunden! —
Und weiter geht dein Schritt — vor eine Tür,
Da du gestanden oft in sel'gen Stunden.
Wie einst verzaubert, stehst du heute hier —
Und nach dem Fenster mußt du wieder schauen,
Wie einst, als sie herabgelächelt dir!
Noch siehst du sie, die lieblichste der Frauen,
H e l e n e n siehst du, die dein Herz besaß,
Mit ihren Märchenaugen, ihren blauen... .
Und die um j e n e n a n d e r n dich vergaß!«
Und bei dem Gedanken an jenen »andern« raffte ich mich auf aus meinen Träumen. Jener andere lag, zum Tode verunglückt, fern unter fremden Menschen, und sein Weib eilte zu ihm auf dem geheimnisvollen Fahrzeug des Unbekannten, und sie hatte mich, den Jugendgeliebten, gebeten, in diesen schweren Stunden bei ihr zu bleiben.
Wundersam war unsere Fahrt hier im wolkenlosen Äther — unsere Lebensfahrt war fast noch wundersamer.
Am südlichen Horizonte stieg eine dunkle Wand auf, die zusehends an Höhe wuchs: Der Frankenwald.
Unser Führer mäßigte die Schnelligkeit unserer Vorwärtsbewegung und ließ dafür das Fahrzeug höher steigen. Die Bergkette wurde überflogen.
»Wie hoch sind wir?«, erlaubte ich mir zu fragen:
»Fast an tausend Meter und wollen eine Zeitlang diese Höhe behaupten«, war die Antwort, dann sich an Helene wendend, setzte er hinzu:
»Noch eine gute Stunde, gnädige Frau!«
Nach kurzer Fahrt über die dunkeln, waldbedeckten Höhen des Frankenwaldes stiegen wir noch etwas höher.
»Das Fichtelgebirge mit seinen sieben Kuppen von durchschnittlich tausend Meter Höhe zwingt uns dazu«, sagte er. Schnell war es überflogen, und wir senkten uns wieder tiefer. Es wurde heller am Himmel. — Plötzlich hörte ich ein kurzes, klappendes Geräusch an der Außenwand des Fahrzeugs.
»Ein Schuß!«, rief ich unwillkürlich aus.
Helene faßte angstvoll meinen Arm.
»Ja — ein Schuß schien es zu sein«, sprach unser Führer in ruhigem Tone — »aber unser Vogel hat ein kugelsicheres Gefieder, liebe gnädige Frau! Fürchten Sie nichts.«
Noch einmal ein scharf abgesetztes Klappen! Der Schütze da unten hatte wahrscheinlich die beiden Läufe seiner Büchse schnell hintereinander entladen; trotzdem traf die zweite Kugel das Fahrzeug wegen der dazwischen erfolgten Weiterbewegung schon mehr seitlich — wir fingen die Kugel nach ihrem Anprall auf — sie war völlig deformiert und glühend heiß.
Wir waren längst aus dem Bereiche des Jägers, als Helene, wieder ruhig geworden, uns fragte:
»Weshalb mag man auf uns geschossen haben?«
»Für einen Raubvogel wird uns der Schütze kaum gehalten haben!«, setzte ich hinzu — »und das Schießen nach einem Luftballon ist im ganzen deutschen Reiche streng verboten.«
»Vielleicht hat er unser Luftfahrzeug für einen sogenannten unbemannten Ballon gehalten oder für einen Drachenflieger und sucht sich die Prämie des Finders durch sein abgekürztes Verfahren zu sichern — vielleicht war es auch nur ein Versuch der Neugier, den geheimnisvollen Nachtfalter näher zu untersuchen«, meinte der Fremde.
Eben erschien am westlichen Horizonte ein breiter silberner Streifen.
»Der Main!«, rief ich aus — aber schon war er hinter dichten Waldmassen verschwunden. Nach einem Weilchen ließ der Führer das Fahrzeug sich senken — am Rande des südwestlichen Nachthimmels zeichnete sich eine malerische Silhouette ab: Kirchtürme, Zinnen und Giebel — N ü r n b e r g . —
Schnell wechselte die Szenerie — wir überschritten die westlichen Ausläufer des fränkischen Jura, seine waldbedeckten Höhen erschienen in wunderlich verstreuten, dunklen Riesenflecken zu unsern Füßen.
Plötzlich hörte ich unsern Führer fragen:
»In welcher Gegend von Solnhofen liegt der Schieferbruch?« Wahrhaftig, das Ziel unserer Reise war fast erreicht — das silberne Flußband mit seinen zierlichen, launisch wechselnden Krümmungen war die Altmühl, und die Anhäufung von Häusern, die eben am Horizonte emporstieg, mußte die Stadt des berühmten Lithographenschiefers sein.
Helene wußte keine nähere Ortsbestimmung zu geben. »Dann wollen wir auf ca. hundert Meter hinabsteigen und uns orientieren —« und schon schwebten wir in Kirchturmhöhe über dem nächtlich stillen, nächtlich dunklen Orte.
Eben fuhren wir über eine Falte des Terrains. Unser Führer durchforschte mit einem Nachtfernrohr — einem Relieffernrohr, das die Objekte in stereoskopischer Deutlichkeit und stark vergrößert zeigte — die Gegend.
Da sagte er:
»Ein Fabrikgebäude dicht am Berghange — drei Fenster im Erdgeschoß erleuchtet?«
Er gab Helene das Glas.
»Ja — ja — da ist es — ich erkenne das Gebäude wieder nach einer Photographie!«, rief sie — O schnell, schnell! Lassen Sie uns hinabsteigen«...
Wenige Minuten später senkte sich unser Fahrzeug leise und sanft auf einem ebenen Platze dicht am Eingang zur Fabrik nieder — wir stiegen aus.
Helene zitterte; ihre Hände suchten vergebens, die Haken und Knöpfe des Schutzmantels zu lösen.
»Fassen Sie Mut, Frau Helene!«, sagte ich, sie aus der Umhüllung befreiend. — »Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden.«
Sie sah mich an — wie hoffnungslos blickten diese armen Augen!
Dann schritt sie, stürzte sie nach dem Eingange.
Draußen standen der Fremde und ich.
Er untersuchte das wundersame Fahrzeug — welche Fülle von Apparaten war in dessen Fächern und Abteilungen verborgen!
Zu jeder anderen Stunde hätte mich dieses Meisterwerk der Technik zu heller Bewunderung hingerissen — in diesem Augenblicke dachte ich nur an die Jugendgeliebte.
Ein Aufschrei klang zu uns heraus.
Helenes Stimme in fassungsloser Verzweiflung!
Ich stürzte durch die Tür, der Fremde folgte mir. Wir standen im dunklen Hausflur. Da öffnete sich eine Zimmertür — ein alter Diener trat heraus.
Er sah uns beide an, sein gutes, altes Gesicht zeigte tiefen Schmerz.
»Wie geht es dem Herrn Direktor?«, fragte ich hastig. »Er ist« — er vollendete den Satz nicht; aber das hoffnungslose Schluchzen, das aus dem Zimmer drang, sagte uns alles...
Die Tür öffnete sich von neuem, ein noch junger Herr erschien in ihrem Rahmen und flüsterte mit dem Diener.
»Herr Dr. Kühling?«, fragte ich leise.
»Dr. Kühling«, sagte er bestätigend.
Ich nannte meinen Namen, stellte uns als Begleiter der Frau Direktor Märtens vor und bat um nähere Auskunft.
Dr. Kühling erzählte, daß Herr Direktor Märtens vormittags durch den Einsturz einer Maschinerie im Schieferbruch von einem herniedersausenden eisernen Träger im Nacken getroffen und zu Boden geschlagen worden sei, — daß seltsamerweise, von einer Hautverletzung abgesehen, keinerlei schwerere Verwundungen zu bemerken gewesen seien, daß aber das Zentralnervensystem doch wohl eine tiefgehende innere Veränderung durch den furchtbaren Schlag erlitten haben müsse; denn die Herztätigkeit sei völlig unzureichend geworden; kurz nach dem Unfall sei er noch einmal zum Bewußtsein gelangt — und habe nach seiner Frau verlangt — dann sei eine immer größer werdende Schwäche und Bewußtlosigkeit eingetreten — vor wenigen Minuten habe, trotz aller angewandten Reizmittel, das Herz zu schlagen aufgehört.
Das alles hatte der junge Arzt flüsternd, in abgerissenen Sätzen mitgeteilt und wandte sich wieder ins Zimmer zurück.
»Dürfte ich den Patienten sehen?«, fragte der Fremde.
Dr. Kühling mochte glauben, daß unsere Anwesenheit der fassungslosen jungen Frau einige Augenblicke der Ablenkung geben würde — er ließ uns eintreten.
Der Fremde schritt voran — schon stand er am Bett des Verunglückten.
Er winkte mir mit den Augen, auf Helene deutend, die zusammengesunken vor dem Bette kniete.
Ich verstand ihn, ich umfaßte die liebe, bebende Gestalt und richtete sie empor.
Schnell trat der Fremde nun an das Lager und beugte sich über den Liegenden.
Er führte seine Hände in eigentümlichen Bewegungen über den Oberkörper des Verunglückten — ich sah das halb verwunderte, halb erzürnte Gesicht des jungen Arztes bei dieser sonderbaren Manipulation des Unbekannten — so vergingen einige bange Minuten seltsamer Stille und Beklommenheit. —
Nun winkte der seltsame Mann dem Diener und gab ihm einen Schlüssel mit dem Auftrage, aus dem Mittelfach des vor der Türe stehenden aufgeklappten Koffers einen kapselförmigen Apparat zu holen.
Als der Diener wieder erschien, traten wir alle, zuerst der Arzt, an das Lager heran.
Der Fremde nahm den Apparat und befestigte ihn auf der linken Brustseite des Leblosen.
»Verzeihen Sie gütigst, Herr Doktor, daß ich mir anmaße, Sie mit meiner Wissenschaft zu unterstützen.«
Der Doktor verbeugte sich.
»Es ist dies ein eigentümlich konstruierter Wechselstromerzeuger, dessen Stromstärke und phase dem Rhythmus des Herzens völlig angepaßt werden kann, und dessen elektrische Impulse das Herznervensystem synchron reizen — wieviel betrug die Frequenz des Pulses bei dem Patienten?«
»Zu Anfang meiner Untersuchung 80 Schläge.«
Der Fremde drückte ein metallenes Knöpfchen.
Der Apparat begann zu arbeiten — ein feines summendes Geräusch ließ sich hören, das von einem taktmäßigen Rhythmus begleitet war... Wiederum vergingen die Minuten, bang und schwer.
Wer einen Blick in dieses Zimmer hätte werfen können! —
Still auf seinem Lager dort der verunglückte Mann, niedergesunken am Fußende die schlanke, schwarzgekleidete, weinende Frau, vor dem Kranken der seltsame Fremdling, zu seiner Seite der Arzt, ich und der alte Diener — und auf den Gesichtern der wechselnde Ausdruck der Erwartung, des hingebenden Vertrauens, des ungläubigen Zweifels, der Verwunderung — das alles beleuchtet von flackerndem Kerzenlicht — ein wunderbares Bild, eines Rembrandt würdig! —
Der Fremde, der sich herniedergebeugt und den Daliegenden aufmerksam untersucht hatte, richtete sich plötzlich auf — seine Augen strahlten in einem reinen, überirdischen Feuer!
»Er lebt wieder!«, sagte er leise.
Dr. Kühling, der den Puls des Patienten untersucht hatte, sah dem Fremden eine Weile sprachlos vor Überraschung und Verwunderung ins Gesicht, dann fragte er, mühsam seine Aufregung beherrschend:
»Und wird das Herz weiter schlagen, auch ohne Ihren wunderbaren Apparat, mein Herr?«
»Es wird weiterschlagen — ich glaube nicht, daß eine Verletzung des verlängerten Markes durch den Schlag erfolgt ist, sondern nur eine nervöse Störung, allerdings der allerschwersten Form, vorliegt — doch, unser Patient erwacht.«
Ja — er erwachte, und auf Helene fiel der erste Blick seines neugeschenkten Lebens, seines zurückkehrenden Bewußtseins!
Er richtete sich auf.
»Helene!«, rief er leise — wie ungläubig.
»Guido, Du lebst.« Sie bedeckte seine Hand mit Küssen.
Er suchte sie an seine Brust zu ziehen. Da erst bemerkte er uns, den Arzt, die Fremden, und sah verwundert um sich.
Der Fremde winkte dem Arzte und mir. Leise versuchten wir das Zimmer zu verlassen.
Aber Frau Helene hatte es in all ihrem Glücke doch gemerkt. Sanft entwand sie sich Guidos Armen und schritt auf die hohe Gestalt des Fremdlings zu. Sie wäre ihm zu Füßen gesunken, wenn er es nicht verhindert hätte.
»Herr — Herr Hil, wie kann ich jemals« —
Sie wollte ihm danken — sie vermochte es nicht, Tränen des Glückes — der grenzenlosen Dankbarkeit erstickten ihre Worte.
Er nahm in herzgewinnender Freundlichkeit ihre Hand und legte sie in die des wiedergeschenkten Gatten.
So stand er einen Augenblick noch vor den beiden, denen er heute nacht Beweise seiner geheimnisvollen Herrschaft über die Kräfte der Natur gegeben, denen seine wunderbare Macht ein neues Leben — im wörtlichen und übertragenen Sinne — geschaffen hatte — und wir alle waren im Banne seiner übermenschlichen Persönlichkeit! Wer war der Fremdling? Kein Erdgeborener besaß jemals solches Wissen, keiner unseresgleichen diese Gewalt!
So — nach meinem Empfinden — mußte das Erscheinen unsterblicher Götter einst auf die Menschenkinder gewirkt haben! Kein Wort wurde gesprochen — keine Frage wurde laut...
Nun winkte er den Arzt zu sich und sprach leise mit ihm: ich verstand aber doch aus seinen Worten, daß er den Apparat dem Patienten zur Kräftigung einige Tage hier lassen wollte; dann sollte man das Instrument an Herrn Josef Saltner, Villa »La« bei Bozen, übersenden. Beim Klange dieses Namens fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen.
Wo hatte ich nur die ganze Zeit über meine Gedanken gehabt? Die schönste Überraschung in dieser Nacht der Wunder wurde mir zuletzt beschert!
« H i l «, das war ja der berühmte Arzt der Nume, der Marsbewohner, und Josef Saltner einer der drei Menschen, die den Mars, unsern Nachbarplaneten, besucht hatten. La, Saltners Gemahlin, war eine Martierin!
Nun war mir alles klar: Das wundersame Fahrzeug war ein Miniaturluftschiff der Martier, die das Problem des lenkbaren Luftschiffs schon längst gelöst und in dem Rob einen Stoff erfunden hatten, der sich für die Schwerkraftstrahlen durchlässig, diabarisch, d. h. schwerelos machen ließ; seine Bewegung durch den Raum aber erfolgte durch plötzliche oder allmähliche Entspannung des Repulsit, des kondensierten Weltäthers — wie ich dies alles in einem wunderbaren Buche jüngst gelesen, das den Titel: « A u f z w e i P l a n e t e n « trug. —
Daß ihnen auch die Herrschaft über die geheimnisvollen Kräfte des Lebens zu Gebote stand, hatte mir das eben Erlebte bewiesen...
Die große Sehnsucht meines Lebens hatte sich erfüllt: ich hatte einen Nume von Angesicht zu Angesicht gesehen. Eine freudige Begeisterung ergriff mich — —
Hil schritt aus der Tür; schnell folgte ich ihm, um ihm noch einmal zu danken und mir Gewißheit über meine Vermutungen zu verschaffen.
Er hörte mich ruhig an; sein wunderbar ausdrucksvolles Antlitz verriet keinerlei Überraschung, als ich ihm meine so spät gefundene Entdeckung über ihn und sein geheimnisvolles Fahrzeug in begreiflicher Aufregung mitteilte. — Er saß schon wieder in dem diabarischen Luftschiff, als er, mir die Hand reichend, entgegnete:
»Ich kann Sie leider nicht einladen, mit mir Herrn Josef Saltner und Frau La zu besuchen, um Ihnen Gewißheit über all das Erlebte von heute zu verschaffen.«
»O großer Meister Hil, nur das eine sagen Sie mir —«
Er unterbrach mich: »Ich weiß, was Sie wissen wollen: ob die Erzählung von Laßwitz: ›Auf zwei Planeten‹ mehr ist als ein schönes Märchen?«
Ich nickte.
»Wie sagt doch Ihr großer Goethe, der nun auch bei uns heimisch geworden ist:
›Susulei, e lirami,<
Lyramusi mo veri‹
oder in Ihrem Deutsch:
›Märchen, noch so wunderbar,
Dichterkünste machen's wahr!‹ —
Mehr darf und kann ich Ihnen nicht sagen.«
Und schon stieg das schwerelose Fahrzeug empor.
»Sila Nu!»*) rief ich, den Hut schwenkend, ihm zum Abschied nach.
»Sila Ba!»**) klang es freundlich von seinen Lippen, und den Kurs südwärts nehmend, sauste das wunderbare Luftschiff wie ein Pfeil mit seinem rätselhaften Insassen hinein in die aufdämmernde Ferne.
*) »Es lebe der Mars!« **) »Es lebe die Erde!«
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.