
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
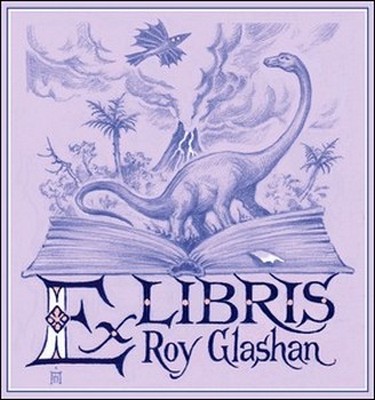
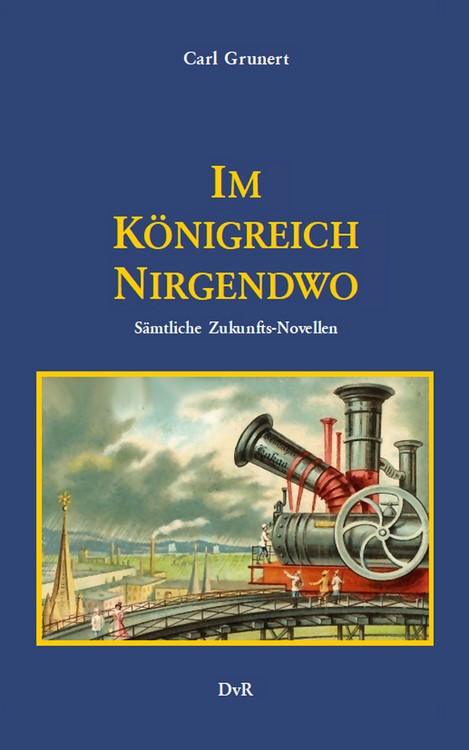
"Im Königreich Nirgendwom," DvR-Ausgabe

Der Marsspion und andere Novellen (Die Bücher des
deutschen Houses. Hrsg. von Rudolf Presber. Berlin.
Erste Reihe, 13. Band). o.J. [ab ca 1908].
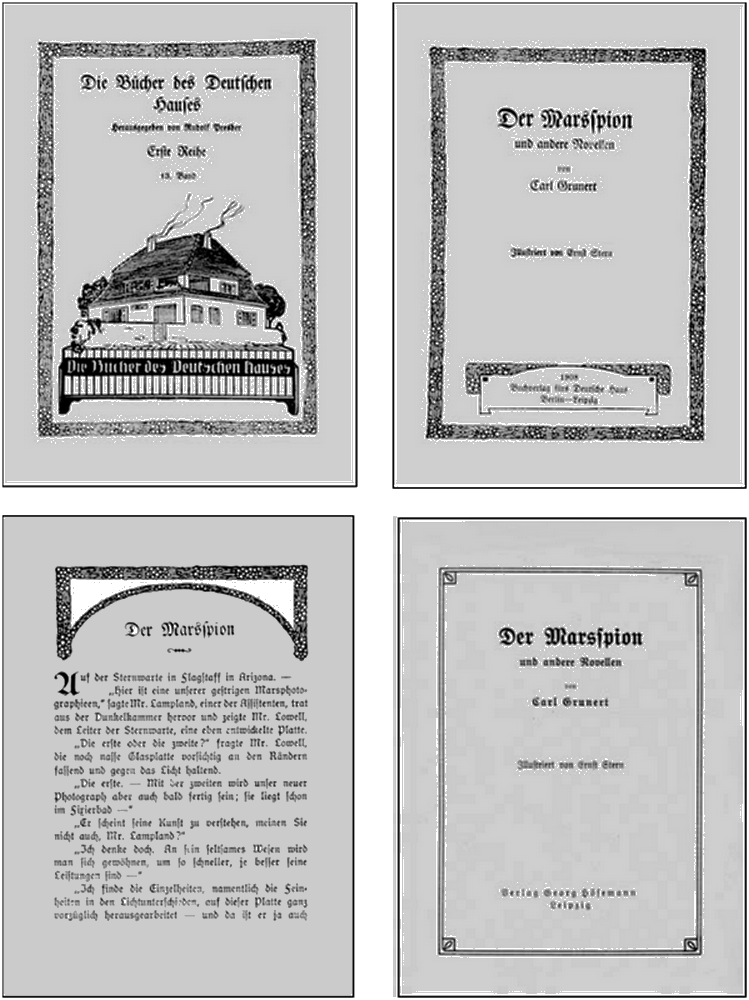
Carl Grunert: Der Marsspion und andere Novellen (Die
Bücher des deutschen Hauses. Hrsg. von Rudolf Presber.
Erste Reihe, 13. Band). — Berlin und Leipzig:
Buchverlag fürs Deutsche Haus, 1908. — Abb. oben:
S. 2 und 3 (unpaginiert). — Abb. unten links: S. 13
(unpaginiert) mit dem Beginn der Erzählung Der Marsspion.
— Abb. unten rechts: Titelseite (unpaginiert) der
ab ca. 1921 vom Verlag Georg Hösemann, Leipzig, vertriebenen
neu eingebundenen Ausgabe, wahrscheinlich aus
Restbeständen der 1908 erschienenen Erstausgabe.

Der Marsspion und andere Novellen.
Norderstedt: Books on Demand (DvR-Buchreihe), 204 S.
Nachdruck der 1908 erschienenen Erstausgabe [? 1908.2].
»Wenn auch Bücher nicht gut oder schlecht machen,
besser oder schlechter machen sie doch!«
(Jean Paul)
Auf der Sternwarte in Flagstaff in Arizona. — »Hier ist eine unserer gestrigen Marsphotographieen«, sagte Mr. Lampland, einer der Assistenten, trat aus der Dunkelkammer hervor und zeigte Mr. Lowell, dem Leiter der Sternwarte, eine eben entwickelte Platte.
»Die erste oder die zweite?«, fragte Mr. Lowell, die noch nasse Glasplatte vorsichtig an den Rändern fassend und gegen das Licht haltend.
»Die erste. — Mit der zweiten wird unser neuer Photograph aber auch bald fertig sein; sie liegt schon im Fixierbad —«
»Er scheint seine Kunst zu verstehen, meinen Sie nicht auch, Mr. Lampland?«
»Ich denke doch. An sein seltsames Wesen wird man sich gewöhnen, um so schneller, je besser seine Leistungen sind —«
»Ich finde die Einzelheiten, namentlich die Feinheiten in den Lichtunterschieden, auf dieser Platte ganz vorzüglich herausgearbeitet — und da ist er ja auch wieder und schärfer und klarer, dächt' ich, als auf unsern früheren Platten —«
»Sie meinen den wandernden Fleck, Mr. Lowell?«, fragte der Assistent, der nun auch näher herantrat und die Marsaufnahme betrachtete.
»Ja, Mr. Lampland — der rätselhafte wandernde Fleck auf der Marsoberfläche, der seine Lage zum Südpol fortwährend zu ändern scheint; denn jede unserer bisherigen Aufnahmen zeigt ihn an einer andern Stelle —«
»Ich hoffe, unsere nächsten Aufnahmen sollen uns in den Stand setzen, dies wandernde Rätsel zu lösen, das mir vorläufig noch verschleierter erscheint als die Frage der vielumstrittenen Kanäle —«, entgegnete Lampland.
»Man hat sie abgeleugnet bis heute; nach unseren Photographieen der beiden Kanäle Thot und Astaboras aber wird man sie nun wohl nicht länger anzweifeln. Das menschliche Auge kann sich täuschen, die phantasielose photographische Platte nicht!«
Er reichte dem Assistenten die Platte zurück, der sie sorgfältig auf einem Trockengestell unterbrachte, indessen Mr. Lowell an den riesigen Refraktor trat. —
»Ist die Verbesserung am Objektiv schon angebracht, Mr. Lampland?«
»Gewiß, Mr. Lowell — und ich denke, unsere nächsten Aufnahmen sollen beweisen, daß die Einschaltung dieser Lichtfilter für Strahlen bestimmter Wellenlänge zur Erzielung größerer Schärfe und feinerer Einzelheiten von ungeheurem Werte ist —«
»Hoffentlich helfen sie uns auch bei der Enträtselung des wandernden Flecks!«, vollendete Lowell.
Der Assistent kehrte in die Dunkelkammer zurück. Hier arbeitete beim schwachen Scheine des roten Lichts der seit gestern neuangestellte Photograph, Mr. Ferrum.
Es war eine ungemein zierliche, fast knabenhafte Gestalt. Jetzt, im roten Dämmerlicht, erschien sein Gesicht seltsam alt, die Haut pergamentartig und wie durchscheinend, so daß man das Netz der Adern unter ihr deutlich zu sehen meinte. Eine breite, schwarze Binde, die den oberen Teil der Stirn bedeckte, vollendete den abstoßenden Eindruck des Mannes.
Aber seine Kunst schien er meisterhaft zu verstehen. Der Assistent Lampland nahm die zweite, nun ausfixierte Platte aus dem Bad und schaltete einen Augenblick weißes Licht ein, um sie zu betrachten. Wie wunderbar klar hob sich die Eiskappe des Südpols von dem unbestimmten Grau der Umgebung ab! Deutlicher noch als auf der ersten Platte markierten sich die gradlinigen Streifen der Kanäle, und da war auch wieder der rätselhafte »wandernde Fleck«, Eben wollte Mr. Lampland die Platte etwas näher an die Lampe heranbringen, um genauer sehen zu können, als das Licht plötzlich erlosch! »Was ist das?«, rief der Assistent, »haben Sie versehentlich ausgeschaltet, Mr. Ferrum?«
Mr. Ferrum antwortete nicht, sondern deutete mit allen Zeichen des Erschreckens auf einen bläulichweißen Funkenstrom, der sich an einer Stelle der Wand plötzlich unter knatterndem Geräusch gebildet hatte.
»Ein Kurzschluß! Schnell! Zum Hauptschalter!«
Beide Männer wandten sich instinktiv zum Ausgang. Dabei stieß Mr. Ferrum im Dunkel an Mr. Lampland, der noch immer die eben fertig gewordene Platte hielt —
Ein Klirren und Knirschen.
»Goddam! Die Platte!«, rief der Assistent. — Aber schon schlug züngelnd eine Flamme aus der gefährdeten Wand der Dunkelkammer, und beide eilten hinaus, um den Wechselstrom auszuschalten und den entstandenen Brand im Keime zu ersticken...
Am nächsten Tage war der Schaden wieder gut gemacht, und auch die zerbrochene Platte war durch mehrere in der Nacht gewonnene Aufnahmen ersetzt, die eben jetzt in der Dunkelkammer entwickelt wurden. Gleich die erste der neuen Aufnahmen zeigte überraschende Einzelheiten. Mr. Lowell hatte die Entwicklung der Platte persönlich überwacht und prüfte sie gerade mit der Lupe. Auch der »wandernde Fleck« war wieder da, und an ihm entdeckte Mr. Lowell zum ersten Mal eine Abweichung im Vergleich zu früheren Aufnahmen. Abgesehen davon, daß seine Lage abermals geändert und dem Südpole des Mars noch näher gerückt erschien, zeigte der rätselhafte Fleck deutlich einen ihn begleitenden, dem Sonnenstande entsprechenden Schatten, der sich in der verzerrten Form und in der weniger dunklen Färbung bestimmt von dem Flecke selbst trennen ließ. Eine Hypothese, den wandernden Fleck als einen dritten kleinen, von der Kugelgestalt abweichenden Marsmond zu erklären, schien nach Lage der Dinge völlig unangebracht, und so sah Mr. Lowell mit begreiflicher Spannung der Entwicklung der weiteren Aufnahmen entgegen, mit der Mr. Ferrum und Mr. Lampland noch beschäftigt waren.
Mr. Ferrum zeigte heute eine gewisse nervöse Unruhe, die auch dem Assistenten auffiel, als er die nächste der fertigen Platten ihm aus der Hand nahm, um sie Mr. Lowell vorzulegen.
»Was haben Sie heute, Mr. Ferrum?«, fragte er ihn — ist Ihnen der gestrige kleine Kurzschluß in die Finger gefahren? Sie zittern —«
Mr. Ferrum sagte nichts, sondern klappte den Rahmen der nächsten Plattenkassette auf, um ihr die belichtete Platte zu entnehmen. Mitten in dieser Manipulation hielt er inne, durch einen Ausruf des Assistenten veranlaßt.
»Ah — jetzt endlich scheint sich das Rätsel zu lösen!«, rief Mr. Lampland, die kostbare Platte aus dem Dunkelzimmer zu dem Leiter der Sternwarte tragend.
Mr. Ferrum war einen Augenblick allein. Blitzschnell vertauschte er die Platte mit einer unbelichteten, indes er die belichtete, die letzte der heutigen Aufnahmen, mit einem Diamanten in kleine Stücke schnitt, die er bei sich verbarg.
Mr. Lowell betrachtete unterdessen mit seinem Assistenten die neugewonnene Platte. Auch ihm entfuhr unwillkürlich ein Aufschrei der Verwunderung.
»Das ist ja mehr, als wir ahnen konnten, Mr. Lampland! sagte er dann, die Aufnahme einer genauen Prüfung unterwerfend — »das sieht ja aus, als gehöre der ›wandernde Fleck‹ gar nicht zur Marsoberfläche, als schwebe er frei in der Atmosphäre des Planeten? Aber was kann das sein, da seine Form und die Art seiner ganz willkürlichen Ortsveränderung es völlig ausschließt, ihn etwa als einen neuen Trabanten des Planeten anzusprechen?«
»Nun, Mr. Lowell«, entgegnete der Assistent, »was hindert uns anzunehmen, daß der wandernde Fleck das Werk intelligenter Wesen ist? Haben wir durch unsere diesjährigen Marsphotographieen doch einwandfrei bewiesen, daß die ›Marskanäle‹ wirklich existieren, wenn wir sie auch weniger als Wasseradern, wie als Vegetationszonen bezeichnen müssen. Die Regelmäßigkeit ihrer Anlage, die praktische Ausgestaltung des Kanalnetzes spricht jedenfalls für ihre künstliche Entstehung durch denkende Geschöpfe —«
»Nun, und —«, unterbrach ihn Mr. Lowell.
»Nun —«, fuhr der Assistent lebhaft fort, »sind diese Riesenkanäle das Werk menschenähnlicher Geschöpfe vom Mars, warum kann der seltsam vagabundierende Fleck nicht irgendeine in der Atmosphäre des Mars schwebende Vorrichtung sein, beispielsweise eine nach Art unserer Fesselballons verankerte meteorologische Station?«
»Die müßte allerdings eine gewaltige Ausdehnung haben, um in unserem Fernrohr als ein Fleck von dieser Größe sichtbar zu werden! Im übrigen glaube ich zu bemerken, daß der Fleck auf den Photographieen immer größer wird, als ob er sich in großer Geschwindigkeit vom Mars entferne —«
»Zugegeben! Ein in der Marsatmosphäre schwebendes, sich bewegendes Etwas muß es sein, das lehrt diese Aufnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit, Mr. Lowell. Ich hoffe, die letzte Photographie, die Mr. Ferrum eben entwickelt, wird meine Hypothese noch mehr unterstützen.«
Damit wandte sich Mr. Lampland, um in die Dunkelkammer zurückzukehren.
»Nun, Mr. Ferrum«, sagte er beim Eintreten, »ist die letzte Aufnahme entwickelt?«
»Ich bin dabei«, erwiderte der Angeredete mit eigentümlich abgestimmtem Tonfall — »aber — ich weiß nicht — ist diese Platte nicht zu kurz belichtet worden? Der Entwickler, den ich bei allen übrigen Aufnahmen verwendet habe, bleibt bei ihr wirkungslos! Bitte, überzeugen Sie sich —«
Damit reichte er dem Assistenten die Entwicklerschale, in der die Platte lag.
Mr. Lampland kippte die Schale, so daß die Entwicklungsflüssigkeit von der Platte abfloß —
»Noch keine Spur eines Bildes«, sagte er verwundert, aber wie ist denn das möglich? Wir haben doch so lange wie sonst exponiert? Haben Sie schon den Entwickler erneuert, Mr. Ferrum? Vielleicht, daß daran die Verzögerung liegt!«
»Habe ich; ich will noch einen Zusatz von Ammoniak machen —«
»Tun Sie das, Mr. Ferrum; es liegt uns sehr viel gerade an dieser Aufnahme«, rief der Assistent; dann, einen Blick auf die Hände des Photographen werfend, setzte er hinzu: »Arbeiten Sie immer mit Gummihandschuhen, Mr. Ferrum? Ich wollte Sie schon gestern deshalb fragen —«
»Immer, Mr. Lampland. Ein langwieriges Fingerleiden, das ich mir in meinem Berufe zugezogen, zwingt mich dazu —«
»So. — Nun — tun Sie Ihr möglichstes, die Platte zu retten, wir sind einer neuen Entdeckung in der Marsatmosphäre auf der Spur, und gerade diese letzte Aufnahme verspricht uns wichtige Aufschlüsse!« — — —
Es war leider nicht gelungen, auf der fraglichen Platte die Spur eines Bildes zu entwickeln. Mit diesem Bescheid trat nach einiger Zeit Mr. Lampland wieder bei dem Leiter der Sternwarte ein. So unangenehm der Mißerfolg war, für den weder Mr. Lowell noch der Assistent vorläufig die zureichende Erklärung fanden, so hatte er doch, wie Mr. Lampland rühmend hervorhob, die wissenschaftlichen Kenntnisse und technischen Fähigkeiten des neuen Photographen in hellem Lichte gezeigt. Wohl ein Dutzend Versuche und Kunstgriffe hatte er angewandt, das latente Bild der »unterbelichteten« Platte hervorzurufen.
Die Sonne näherte sich dem Untergang, und Mr. Lowell ließ alles zu einer Reihe neuer Marsaufnahmen vorbereiten.
Der »wandernde Fleck« war in diesen späten Abendstunden infolge der auf dem Mars herrschenden Lichtverteilung weniger gut sichtbar; doch versprach in Hinsicht auf die früheren photographischen Aufnahmen dieses fraglichen Objekts die Klarheit der Marsatmosphäre für heute nacht die wichtigsten Aufschlüsse.
Mr. Lowell hatte das Observatorium ein Weilchen verlassen; Mr. Lampland war allein und beobachtete durch ein kleineres Fernrohr das Firmament, um einige Ablesungen zu machen.
Es war ganz still und dunkel in der großen Kuppelhalle; nur die Sekundenuhr tickte mit leisem Schlage. Mr. Lampland richtete sich aus seiner beobachtenden Stellung am Fernrohr auf. Es war ihm, als habe er ein Geräusch gehört. Er blickte scharf ins Dunkel und strengte sein Gehör an; aber es war doch wohl nur Täuschung gewesen. Zur Sicherheit ließ es einen Moment die kleine elektrische Notlampe aufleuchten — er vermochte nichts zu entdecken.
Seltsamerweise glaubte er nach einigen Minuten an einer bestimmten Stelle des dunklen Raumes einen mattleuchtenden Punkt zu sehen, wie das phosphoreszierende Auge eines nächtlichen Raubtieres. Aber als er die Erscheinung fest ins Auge fassen wollte, war sie verschwunden. Ärgerlich über sich selbst, schalt er sich eine Beute seiner aufgeregten Nerven und wandte sich dem großen Refraktor zu, um ihn für die neuen photographischen Aufnahmen des Mars einzustellen.
Er brachte sein Auge an das Okular des riesigen Instruments — ein nebeliger Schleier verhüllte das Gesichtsfeld!
Eben trat Mr. Lowell ein.
»Nun — eingestellt?«, fragte er.
»Nein — sehen Sie doch, Mr. Lowell! Das Gesichtsfeld des Refraktors ist völlig verschleiert — die Atmosphäre ist doch völlig klar?«
Mr. Lowell blickte zuerst durch das Okular des großen Refraktors, dann durch das auf demselben Gestell montierte kleinere Sucherfernrohr. Das Gesichtsfeld des letzteren war völlig klar!
»Sollte durch irgendeine Ursache das Objektiv plötzlich getrübt worden sein — irgendein Niederschlag oder Staub von außen die Lichtdurchlässigkeit hindern?«, fragte der Assistent.
Mr. Lowell antwortete nicht. Ein seltsamer, scharf säuerlicher Geruch machte sich mit einem Male in der Nähe des Refraktors bemerklich. —
Und eben wollte Mr. Lampland sein Gesicht aufs neue dem Okularende des riesigen Fernrohrs nähern, als ein furchtbarer Knall die beiden Männer zu Boden warf.
In dem Flammenblitz der gewaltigen Explosion aber erschien einen Moment das fleischlose, fahle, jetzt von einem triumphierenden Lachen verzerrte Gesicht — Mr. Ferrums!
Und dieses Gesicht zeigte, von keiner schwarzen Stirnbinde mehr bedeckt, ein auf Erden nie geschautes Phänomen: es besaß — drei Augen, zwei, wie andere Menschenaugen, und das dritte, ein Scheitelauge, mitten auf der Stirn! Und jetzt, da tiefes Dunkel wieder den großen Raum erfüllte, leuchtete das dritte Auge in grünem Phosphoreszenzlichte.
Was war das für ein grauenhafträtselvolles Wesen?
Mr. Lowell war der erste, der die Besinnung wiedererlangte. Er sprang auf und tatstete nach dem elektrischen Lichtschalter, — da hörte er hinter sich ein Geräusch: auch sein Assistent war nur betäubt worden und richtete sich auf. In demselben Moment aber stürzte er nach einer Ecke des Raumes, aus der ein mattleuchtender Punkt schimmerte.
Mr. Lowell vernahm ein heftiges Ringen und Stöhnen. — Endlich hatte er den Einschalter gefunden und legte den Hebel um — die Beleuchtung versagte!
»Zu Hilfe!«, rief Mr. Lampland heiser.
Mr. Lowell eilte nach der Stelle, woher der Ruf kam.
»Hierher — Mr. Lowell, hierher — ich hab' ihn!«
Mr. Lowell packte zu: er faßte einen mit aalglatter Gewandtheit sich drehenden Körper. Ehe er aber mit sicherem Griff zupacken konnte, schrie Mr. Lampland heftig auf —
In demselben Augenblick entschlüpfte ihnen die erhaschte Beute.
Jetzt erinnerte sich Mr. Lowell an das kleine, von einem Akkumulator gespeiste Notlicht zur Eintragung der astronomischen Ablesungen.
Mit zwei Schritten war er dort und schaltete es ein. Er war mit seinem Assistenten allein; Mr. Lampland hielt sich die Rechte, die ihm der nächtliche Störenfried aus dem Gelenk gedreht hatte.
Beider Blicke fielen zuerst auf den großen Refraktor. Eine Explosion hatte das untere Ende, den Okularteil, glatt fortgerissen. Zum Glück schien die kostbare Objektivlinse am oberen Ende unbeschädigt geblieben zu sein!
»Wer war der Eindringling? Und wie hat eine Explosion im Innern des Reflektors (1) stattfinden können?«, rief Mr. Lowell einmal über das andere.
(1) Wahrscheinlich muss es hier richtig »Refraktors« statt »Reflektors« heißen.
Nun kamen auch einige Diener, die der Lärm herbeigerufen.
»Bringt Licht!«, befahl Mr. Lowell.
»Und ruft Mr. Ferrum!«, setzte Mr. Lampland hinzu. — Die Diener kehrten mit Lichtern zurück; einer von ihnen brachte die Meldung, daß Mr. Ferrum nicht mehr auf seinem Zimmer sei — nur seine Gummihandschuhe lägen dort.
»So bringt sie!«, sagte Mr. Lampland, unausgesetzt die schmerzende, verstauchte Rechte reibend.
»Und seht, ob ihr Mr. Ferrum irgendwo entdecken könnt!«, rief ihnen Mr. Lowell nach.
Wir werden keine Spur mehr von ihm entdecken«, meinte Mr. Lampland. Mr. Lowell sah ihn fragend an.
Der Diener brachte die schwarzen Gummihandschuhe.

»Sehen Sie, Mr. Lowell«, sagte der Assistent, »mein Verdacht hat mich nicht getäuscht. Seit heute abend, seit wir den photographischen Apparat von neuem für das Fernrohr herrichteten und ich unseren Mr. Ferrum bei seinen Manipulationen beobachtete, entstand plötzlich — ich wüßte kaum zu sagen wie! — mein Verdacht; mich überkam ein Gefühl, als sei der Mann nicht der, für den er sich ausgab. Seine glänzenden chemischen und photographischen Kenntnisse machten ihn mir plötzlich nur noch mehr verdächtig; wie ein Blitzstrahl kam mir vorhin, als ich hier allein war, die Erleuchtung, daß alle die Vorkommnisse der letzten Tage sich wie Ringe einer Kette schlossen: der plötzliche Kurzschluss in der Leitung in dem nämlichen Augenblick, als ich gestern die Platte mit dem ›wandernden Fleck‹ mir genauer betrachten wollte, und die in der Dunkelheit und Verwirrung erfolgte Zerstörung der Aufnahme — der Vorfall mit der völlig unbelichteten Platte von heute — und schließlich hier — die Gummihandschuhe, die er fortwährend trug.«
Mr. Lampland hob sie empor. »Sehen Sie; jeder Handschuh hat fünf richtige Finger — aber der fünfte ist bei beiden ein künstlicher, ausgestopfter!«
Starr vor Überraschung, befühlte Mr. Lowell die Handschuhe —
»Wahrhaftig«, rief er, »der kleine Finger an jeder Hand ist falsch!«
»Nun«, sagte Mr. Lampland fortfahrend, »vierfingrige Menschen gibt es augenblicklich auf Erden noch nicht; nehmen Sie dazu sein seltsames Aussehen, ein Greisenkopf mit dem Körper eines Kindes, seine eigentümliche Aufregung, die um so höher stieg, je besser uns die Photographieen vom Mars gelangen, — die offenbar von ihm in einem unbewachten Augenblick in unseren Refraktor geschmuggelte Bombe, deren Zündschnur so berechnet war, daß sie heute nacht die Explosion und damit nach seinem Plan die Zertrümmerung des kostbaren Instruments herbeiführen sollte — vielleicht auch Ihre und meine Vernichtung! — so bleibt nur die Annahme übrig, und der alte römische Grundsatz cui bono! bestätigt sie: Mr. Ferrum war — kein Mensch, sondern — ein Spion vom Mars!
Mr. Lowell schüttelte den Kopf und wollte eben etwas erwidern, als einer der Diener, derselbe, der die Gummihandschuhe entdeckt hatte, ihm ein Stück eines photographischen Negativs überreichte, das er soeben beim Durchstöbern der Dunkelkammer in einem Winkel des Fußbodens entdeckt hatte.
Nur einen Blick warf der Assistent darauf; dann sagte er: »Dieser Glasscherben, der übriggebliebene Rest jener Aufnahme, die bei dem gestrigen Kurzschluß in Trümmer ging, bildet das Schlußglied meiner Beweisführung! Sehen Sie, Mr. Lowell, den ›wandernden Fleck‹! Ein günstiger Zufall hat es bei dieser einzigen Aufnahme so gefügt, daß die Sonne von dem rätselhaften schwebenden Etwas in der Marsatmosphäre einen ins Riesenhafte vergrößerten Schatten auf die schneeweiße Eiskappe des Pols geworfen hat — und ich glaube, Sie erkennen nun nach allem Vorangegangenen das rätselhafte Objekt — und verstehen, warum jener falsche Mr. Ferrum, offenbar im Auftrage seines Heimatplaneten, alles tat, um unsere Marsbeobachtungen zuerst zu kontrollieren, dann zu erschweren und schließlich für bestimmte Zeit unmöglich zu machen.« —
Mr. Lowell nickte und sagte ernst: »Noch bleibt mir manches von dem Geschehenen ein Rätsel; aber das Rätsel des ›wandernden Flecks‹ ist gelöst: der verräterische Schatten zeigt mir die ins Ungeheure verzerrten Konturen eines — R i e s e n f l u g s c h i f f e s , das sich unausgesetzt einem Ziele nähert: unserer Erde!«
Guten Tag, Pierre!«
»Ei — guten Tag, meine kleine Jeanne! Wie verläufst du dich hierher in die Schmiede Plutos?«
»Muß ich nicht in die garstige, rußige Höhle hineinkriechen, wenn ich dich einmal sehen will, du Böser! Dein Mütterchen ist schon ganz verzweifelt, weil du seit ein paar Tagen Essen und Trinken vergißt — wegen des alten Ungetüms da!«
»Dann mußt du eigentlich mit deinem künftigen Schwager, meinem aufmerksamen Bruder André, schelten und schmollen, kleine Jeanne! Er hat mir dies kuriose Mittelding zwischen einem Fahrrad und einem Webstuhl geschickt, weil er meine Vorliebe für allerlei mechanische Kunstwerke und Maschinen kennt. Du solltest übrigens mit ein wenig mehr Respekt von dieser Maschine sprechen; sie stammt geradewegs vom — — Grunde des Meeres!«
»Vom Grunde des Meeres? Hast du mich auch nicht zum besten, Pierre?«
»Aber, — — liebe Jeanne! Direkt vom Grunde des Ozeans, wo die Seejungfern und Wasserteufel sie benutzt haben!«
»Pfui, Pierre! Mußt du denn immer deinen Spott mit mir treiben — —« Und die zierliche, schlanke, schwarzlockige und dunkeläugige Südfranzösin verzog schmollend den Mund.
»Nun — nun, meine kleine Jeanne — — einen Scherz darf man doch machen!«
Der hochgewachsene, blonde junge Mann sprang hinter der seltsamen Maschine hervor und umfaßte das junge Mädchen, ihr einen Kuß auf die halbabgewandten Lippen drückend. Dann führte er sie aus dem Rahmen der Eingangspforte, wo sie noch immer gestanden, näher an das »alte Ungetüm« heran.
»Sieh dir das Wunderwerk nur erst an, kleine Jeanne! Es ist volle Wahrheit: sie stammt vom Grunde des Meeres. Du weißt, daß mein Bruder André bei den Hebungsversuchen des vor einigen Tagen gesunkenen Kanaldampfers ›Juno‹ in der Straße von Calais beschäftigt ist. Bei diesen Taucherarbeiten fand er in der Nähe des gesunkenen Schiffes, fast völlig im Meeresgrunde vergraben, diese Maschine. Da ihren Zweck niemand enträtseln konnte, auch niemand großes Interesse für sie zeigte, sandte er sie mir und wie du siehst, ist es mir gelungen, sie von dem Schlamm des Meeres und von allerlei sonstigen Unreinigkeiten zu säubern. Sieh einmal, wie ihre Teile nun wieder funkeln und blitzen: diese vernickelten Hebel und Stangen und Schrauben, diese Stangen aus Elfenbein und vor allem diese schöngedrehten Wellen aus einer durchsichtigen Substanz — —«
»Daß die nicht zerbrochen sind! — Es sieht doch aus wie Glas, nicht, Pierre?
»Ja, es ist aber kein Glas! Sieh doch einmal, wie sie funkeln und flimmern, liebe Jeanne! Man könnte beinahe denken, sie seien aus lauter Licht und Sonnenschein gemacht — und nicht aus einem festen, irdischen Stoffe —«
»Aber — was ist das für eine seltsame Maschine, Pierre?«
»— Ja, Liebste, — wenn ich das wüßte! Dann würde ich ja nicht Stunde für Stunde hier in der uralten Schmiede in der Kalksteinhöhle hocken und grübeln, sondern würde dir heute früh schon längst entgegengeeilt sein. Von Mütterchen wußte ich ja, daß du kommen würdest, und kannte ja auch deinen Weg zu uns — — immer am Ufer der Dordogne entlang, bis an unsere Holzbrücke, nicht wahr, Liebling? — Aber — ich weiß nicht, noch nicht, was diese vertrackte Maschine bedeuten soll! — Ich wollte eine Zeichnung von ihr anfertigen und sie an die Redaktion der ›Science‹ einschicken — vielleicht weiß man da eine Auskunft —«
»Aber sagtest du nicht selbst, sie sähe aus — halb wie ein Fahrrad und —«
»— halb wie ein Webstuhl — freilich. Hier ist ja auch ein Sitz, wie der Sattel eines Fahrrads — aber — die Räder fehlen, sind auch, wie die Konstruktion zeigt, nie vorhanden gewesen.«
»Und — du hast noch keinen Versuch gemacht, ob die Maschine geht — ob sie —«
»Nein, Liebste! Eher möchte ich all diese Wellen und Scheiben und Hebel nicht in Bewegung setzen, ehe ich mir nicht im Geiste über die ganze Konstruktion der Maschine klar geworden bin. Sie muß doch einen Zweck gehabt haben, zum Kuckuck! — Ehe du kamst, hatte ich übrigens einen Gedanken: ich glaubte einen Augenblick, das rätselhafte Ding sei die Gondel irgendeines unserer jetzigen modernen, lenkbaren Luftschiffe. Dafür spricht erstens ihr Fundort — auf dem Grunde des Meeres — wohin sie aus der Luft gestürzt sein mag, zweitens der Sattel und das räderlose Gestell; — dagegen spricht erstens der Mangel eines Motors — aber der könnte ja beim Absturz explodiert und losgerissen sein, obwohl sich an der Maschine nirgends bis auf ein paar verbogene Schienen die Spuren äußerer Gewalt zeigten — —«
»Und zweitens, Pierre?« — —
»Zweitens, liebe Jeanne, spricht dagegen die ganze diffizile Konstruktion, diese vielen Finessen in der Mechanik, dies Gewirr von Stangen und Walzen und Rollen und Scheiben — und nicht zuletzt — diese seltsam funkelnden Wellen aus Kristall —«
»Ja — aber, lieber Pierre — dann will ich doch lieber gleich wieder gehen und auf gelegenere Zeit wiederkommen —«
»Aber warum, meine kleine Jeanne?«, fragte Pierre, aufs neue den Arm um sie legend.
»Weil du gewiß noch viele Tage darüber grübeln wirst, was das kuriose Ding bedeuten soll, und — weil du dann gar keine Zeit übrig haben wirst für mich, deine Verlobte!«
»Aber — meine liebe kleine Jeanne! Ich verspreche dir —«
»Versprich nichts; ich kenne dich! Aber — einen Rat will ich dir doch noch geben, Pierre: Probieren geht über studieren! Grüble nicht länger, sondern — setz' dich in den Sattel des Dinges und versuch', ob du es von da aus nicht in Gang bekommst — —«
»Dir zu Gefallen, Kleine! Also — aufgesessen!«
Und mit einem gewandten Satze schwang sich der junge Mann in den Sattel der Maschine.
»So — liebe Jeanne! Da säß' ich auf meinem neuesten Steckenpferd — und was nun?« —
Jeanne lachte nun doch, als sie ihren Pierre auf dem seltsamen Gestell reitend erblickte. —
»Ja — nun weiß ich auch nicht weiter zu raten, Liebster —«
»Halt einmal! — Was ist denn das für eine Art Hebel, den ich hier gerade mit der ausgestreckten Hand fassen kann? — —«
Und Pierre griff mit der einen Hand nach einer halbversteckten kleinen Stange und drückte sie zurück — bis zum Anschlage — —
Wie ein heftiger Schlag ging es durch die kleine Schmiede in der uralten Kalkhöhle des DordogneTales. — Ein Luftwirbel erhob sich — —
Mit einem Aufschrei, so gellend und furchtbar, daß ihn die alte Mutter Pierres in dem anmutigen Landhäuschen am Talrande hörte, sank Jeanne ohnmächtig nieder.
Als sie die Augen wieder aufschlug, lag sie im Arm der Mutter Pierres, und teilnehmend standen die Nachbarn und Nachbarinnen des kleinen, südfranzösischen Ortes um sie her.
»Was ist denn geschehen, meine arme Jeanne?«, fragte die Greisin, ihr die Stirn streichelnd.
»— Wo ist Pierre, Mutter?«
»Pierre? — Ja, mein Gott, wir wissen es nicht! Hast du ihn nicht hier in der Schmiede gefunden, Töchterchen?«
»Ja, ich fand ihn — aber dann —«
Und sie erzählte in heftiger Aufregung das Geschehene bis zu dem Moment, wo Pierre verschwand.
»Aber wie ist denn das möglich? Wie ist denn das möglich? Ein Mensch kann doch nicht verschwinden, als ob ihn die Erde verschluckt hätte!«
— Immer größer wurde die Verwunderung und das Kopfschütteln der Umstehenden.
»Liebe Jeanne, besinne dich noch einmal genau! Du erzähltest, Pierre habe sich auf die Maschine gesetzt und habe irgendeinen Hebel daran bewegt — und dann — —?
»Dann? — Ja — dann — —«
Aufs neue schluchzte sie und barg das Gesicht im Schoße der Mutter.
»Dann, liebe Jeanne — —?«
»Dann — dann! O, es ist gräßlich! Dann wurde seine Gestalt plötzlich durchsichtig wie ein Schemen, immer durchsichtiger, immer flüchtiger: ich sah nur noch einen Wirbel von glänzenden Metallteilen — eine heftige Luftströmung traf mein Gesicht — eine Wolke aufgewirbelten Staubes umhüllte mich — ich schrie auf — weiter kann ich nichts sagen —«
Sie weinte aufs neue fassungslos.
Kopfschüttelnd entfernten sich einige der Umstehenden und holten den Maire des Ortes.
Ein Protokoll wurde aufgenommen. Der Maire ließ die Schmiede in der alten Kalksteinhöhle genau untersuchen. Zoll für Zoll der Wände und des Fußbodens wurde abgeklopft und geprüft. —
Nirgends fand sich etwas, das den rätselhaften Vorfall erklären konnte. Die Hinterwand der Höhle lief in einen langen, schmalen Gang aus, tief hinein in den Kalkfelsen, am Ende verschüttet von herabgebröckeltem Gestein. —
Aber auch hier keine Spur — —
— Pierre Maurignac war und blieb verschwunden!
Am Abend desselben Tages berichtete schon die »Agence Havas« in einem ausführlichen Telegramm über das seltsame Ereignis, und von ihr übernahmen die meisten größeren Zeitungen des In- und Auslandes die Notiz. Es war diesmal nicht die Zeit der »Enten« oder der »Hundstage«, und so wurde der merkwürdige Vorfall mehr oder weniger wissenschaftlich ernst glossiert. Eine eigentliche zureichende Erklärung vermochte aber keines der Tagesblätter für das seltsame Verschwinden des jungen Mannes zu geben. — Am meisten Wahrscheinlichkeit schien noch ein Erklärungsversuch der »Tägl. Rundschau« zu haben. Der Verfasser dieses Artikels versuchte das Verschwinden Pierre Maurignacs in der Hauptsache mit einem pathologischen Zustande der einzigen Zeugin Jeanne Dauvergne in Zusammenhang zu bringen. Er nahm dabei an, daß das junge Mädchen von ihrem Verlobten lange Zeit getrennt und infolgedessen seelisch aufgeregt gewesen sei und den ganzen Vorgang in der Höhlenschmiede nur als eine Art Halluzination erlebt habe. Die vorhergehende Erzählung der Mutter Pierres von der seltsamen Maschine habe dieser Autosuggestion den Boden geebnet. — Allerdings sei ja mit dieser Auffassung noch immer nicht das Verschwinden des jungen Maurignac objektiv erklärt; — aber da die ersten telegraphischen Nachrichten sofort nach dem Vorfall in die Presse gelangt seien, so müsse doch erst festgestellt werden, ob Monsieur Pierre nicht auf eine weniger wunderbare Weise den Ort verlassen habe. Vielleicht bringe die Zukunft hierfür eine Erklärung; — vielleicht — die Erzählung Jeanne Dauvergnes einmal einen Augenblick als objektive Betrachtung angenommen — sei die rätselhafte Maschinerie gar eine — Flugmaschine gewesen, nach dem Prinzip: »Schwerer als die Luft« gebaut — (man wisse ja eigentlich gar nichts genaueres über die Konstruktion als die unvollkommenen Angaben der Mutter und des Mädchens) — und Pierre Maurignac sei mit ihm vielleicht in die Luft geflogen — verunglückt vielleicht — —
Der Bericht schloß mit einem »Vielleicht« und konnte als schlüssige Erklärung auch noch nicht gelten.
— In dem kleinen Landhäuschen am Ufer der Dordogne aber saßen Mutter Maurignac und Jeanne Dauvergne und dachten des Verschwundenen in tiefer Trauer.
Da pochte es an der Pforte des Hauses — tief in der Nacht.
Die alte Dienerin öffnete.
»Ein Telegramm an Mutter Maurignac!«, rief der Depeschenbote.
Und schon stürzte Jeanne die Treppe hinab und riß es der Babette aus der Hand. —
Mit zitternden Händen öffnete es die alte Frau.
Und die beiden lasen:
»TELEGRAMM AUS LONDON, DEN...
PIERRE MAURIGNAC VERSCHWUNDEN AUF EINER MASCHINE, WIE ICH SIE IN MEINEM BUCHE ›DIE ZEITMASCHINE‹ BESCHRIEBEN HABE. BEHALTEN SIE HOFFNUNG UND GLAUBEN.
H.G. WELLS.«
Und fast um dieselbe Zeit lief in der Redaktion der »Tägl. Rundschau« ein ähnliches Telegramm sein.
Es lautete:
»TELEGRAMM AUS LONDON, DEN...
PIERRE MAURIGNACS VERSCHWINDEN IST BUCHSTÄBLICH SO GESCHEHEN, WIE ES JEANNE DAUVERGNE GESCHILDERT. ER IST AUF EINER ›ZEITMASCHINE‹ IN DIE ZEIT GEREIST.
NÄHERES DARÜBER ENTHÄLT MEIN BUCH ›DIE ZEITMASCHINE‹, ENTGEGEN MEINER VERMUTUNG, DIE ICH DORT IM 16. KAPITEL AUSSPRACH, HAT SICH ALSO DOCH, WENN AUCH NICHT DIE PERSON, SO DOCH DIE MASCHINE DES ZEITREISENDEN WIEDERGEFUNDEN; WIE SIE ABER AUF DEN GRUND DES KANALS KAM, WIRD WOHL FÜR IMMER EIN RÄTSEL BLEIBEN.
H.G. WELLS.«
— Auf einer Z e i t m a s c h i n e ?
Ja — auf einer Maschine, die so wunderbar konstruiert ist, daß sie dem darauf Sitzenden ermöglicht, in die Zeit, d. h. in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen. Der geniale Konstrukteur dieser Maschine betrachtet nämlich die Zeit als die vielgesuchte v i e r t e Dimension des Raumes, und wie wir bisher mit unsern gewöhnlichen Vehikeln i m R a u m e hin und her zu fahren vermögen, so fährt er auf seiner Maschine in der Z e i t d i m e n s i o n hin und her; er vermag also aus seiner Zeit heraus in eine andere zu reisen, vermag im Fluge kommende oder versunkene Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende zu durcheilen.
Doch der freundliche Leser kann das alles viel besser in dem erwähnten geistvollen Buche des obigen Telegrammabsenders selbst nachlesen...
Pierre Maurignac war verschwunden auf einer »Zeitmaschine«,
Das wußte man nun.
Aber — wohin? Und würde er wiederkommen — wiederkommen können?
— — Die alte Mutter Maurignac nahm noch einmal das Telegramm von Mr. H. G. Wells in die Hand — —
»Behalten Sie Hoffnung und Glauben!«, las sie leise der armen Jeanne vor. Und Jeanne Dauvergne richtete sich auf und küßte zärtlich die Stirn der Greisin.
»Die Liebe wird mich beides lehren, liebe Mutter!«
Und Pierre?
Was war mit ihm geschehen? Reise er wirklich i n d i e Z e i t ?
Er hätte es wahrscheinlich selbst nicht zu sagen vermocht — wenigstens nicht in den ersten Momenten seiner wunderbaren Fahrt!
Auch er sah sich plötzlich allein in dem Raume. Ein schauderhaftes Gefühl, als ob er in eine endlose Tiefe fiele, — ein Gefühl, das ein jeder in schwächerem Maße wohl schon einmal im Traume empfunden hat, — erfaßte ihn. Dabei schlingerte die Maschine, auf der er saß, so arg, daß er sich krampfhaft festhalten mußte, um nicht abgeschleudert zu werden.
Was war das? Was geschah mit ihm? Wo war seine kleine Jeanne? Und wo war er? Fuhr er oder stand er still und wanderte die Umgebung? Denn — er war nicht mehr in der alten Schmiede, welche die Bewohner des Örtchens seit alter Zeit schon in dem vorderen Raume der uralten Kalksteinhöhle eingerichtet hatten — eine gleichmäßige graue Dunkelheit umfing ihn wie eine schwere, greifbare, dichte Hülle.
So raste das geheimnisvoll arbeitende mechanische Ungetüm mit ihm dahin — wie lange schon, er wußte es nicht. Ihm schien es eine endlose Zeit!
Ob er abstieg von der fürchterlichen Maschine? — Aber er fühlte instinktiv an dem Luftstrom, der ihm an den pochenden Schläfen vorbeistrich, wie schnell seine Bewegung war und wie gefährlich ein Abspringen sein würde. Unbedingt mußte er die Maschine vorher zum Stillstand bringen. Aber — wie wurde das gemacht?
Dazu hätte es hell sein müssen, daß er den Mechanismus untersuchen konnte. Aber vielleicht, wenn er den Hebel, den er vorhin bewegt, wieder in seine alte Lage zurückführte?
Er versuchte es, aber in der Aufregung, die ihn gepackt hatte, in der lastenden Dunkelheit, die ihn umhüllte, in dem schauderhaften Gefühl des fortwährenden Fallens, bei dem Schlingern und Schwanken der zitternden Maschine griff er immer daneben. Es war zum Verzweifeln; er fand den Hebel nicht!
Da fiel ihm ein: er hatte ja Zündhölzer! Und den Sattel der Maschine fest mit den Schenkeln umklammernd, fand er glücklich die kleine Schachtel in der Tasche und entzündete ein Hölzchen.
Er schützte es mit der hohlen Hand gegen den Luftstrom, der ihn umsauste. — Und nun neigte er sich tief aus dem Sattel vornüber und tastete nach dem Hebel.
Er faßte ihn und versuchte ihn zurückzuführen — langsam; denn er fürchtete, daß eine plötzliche Hemmung der Maschinerie gefährlich sein könnte; das Beharrungsgesetz, das sich bei jedem plötzlich gebremsten Wagen jedem Insassen sehr unangenehm bemerkbar macht, würde bei dieser unheimlich dahinsausenden Maschine gewiß verderbliche Wirkungen zeitigen.
Langsam, langsam zog er den Hebel zurück!
Und er hatte richtig kalkuliert: die Maschine verlangsamte ihre Bewegung, alle Begleiterscheinungen wurden schwächer. —
Und mit einem Male fiel ein Lichtschein in das öde Grau der Umgebung — von rückwärts her, vom Eingange der Höhle!
Unwillkürlich wandte er den Kopf. Das sah ja aus — wie Morgensonnenschein!
Aber das war doch ganz unmöglich! Als ihn Jeanne vorhin aufgesucht hatte, war es fast Mittagszeit gewesen.
Er sah nach der Uhr. —
Sie zeigte auf Sieben!
Vor Überraschung hätte er fast wieder den Griff des Hebels fahren lassen; aber er haschte ihn noch wieder. — —
Einen Moment erlosch der Lichtschein von draußen wieder — aber dann wurde es wieder hell.
Und abermals sah er nach der Uhr. —
Jetzt zeigte sie plötzlich auf f ü n f Uhr!
Aber das war ja unmöglich! Lief denn seine Uhr plötzlich rückwärts?
Wieder huschten die Schatten durch den Raum und verdunkelten ihn einen Augenblick — und wieder kam das Licht.
Jetzt stand der Zeiger seiner Uhr fast auf D r e i !
Was war das? Das war ja ein Wunder! Das war ja, als ob seine Maschine und die Tageszeit im Zusammenhang stünde!
Und immer mehr näherte Pierre den Hebel der Nullstellung. —
Da fiel sein Blick auf die vier kleinen Zifferblätter am Rahmen der Maschine: drei der Zeiger standen still und nur der vierte umkreiste noch sein Zifferblatt, langsam und immer langsamer, je weiter er den Hebel zurückführte. —
Und jetzt schlug der Hebel an die Sicherung an. —
Da stand der letzte Zeiger still — und auch die Maschine stand.
Vorsichtig und langsam stieg Pierre ab. —
Es war ihm zumute wie einem Seekranken. Noch als er wieder den festen Boden unter den Füßen hatte, spürte er das atemraubende Gefühl des haltlosen Schwebens. —
Endlich wurde er ruhiger und sah sich um.
Von der alten Schmiede war keine Spur mehr zu entdecken!
Überall starrte ihm die kahle Felswand entgegen.
Kopfschüttelnd schritt er dem Eingange zu, von woher der Lichtschein schimmerte.
Wo war er?
Er faßte sich an die Stirn — aber er war völlig wach und Herr seiner Sinne.
Nun hatte er den Eingang erreicht und trat ins Freie.
Wie geblendet schlug er die Augen nieder. Das Licht der Sonne strahlte von einem riesigen Reflektor wieder, der die Hälfte des ganzen Horizontes einnahm.
Und dieser Reflektor war — ein ungeheurer Gletscher, der von den Höhen jenseits ins Tal herabhing!
Wo war er? — Wo waren all die freundlichen Bilder der Heimat geblieben? Mit einer Sehnsucht, die einem körperlichen Schmerze gleichkam, suchte er das Haus seiner Mutter. —
Aber der wohlbekannte Hügel am Eingange des Tales war leer — düstere Tannen krochen an seinen Hängen hinauf.
Keine Spur seines alten Heimatortes mehr! Nur dort drüben die Dordogne floß in ihren alten, ihm so vertrauten Krümmungen wie sonst durchs Land — —
Wo war er — und was war mit ihm geschehen?
Unschlüssig, aus allen seinen gewohnten Verhältnissen herausgerissen, wußte er nicht, was er tun sollte. Lange stand er sinnend, die Hand über den Augen, um das gleißende Licht der Gletscher abzuhalten. Dann begann ihn zu frösteln, und er merkte jetzt erst, wie kühl die Temperatur war. Instinktiv kehrte er um und ging in die Kalksteinhöhle zurück.
Da stand die rätselhafte Maschine, die ihn hierhergetragen in rasender Eile. Wieder fiel sein Auge auf die kleinen weißen Zifferblätter. er sah, daß die vier Zeiger auf verschiedenen Ziffern standen; diese hießen, von links nach rechts gelesen: 0, 7, 295, 225. Einen Sinn konnte er damit bis jetzt nicht verbinden.
Er untersuchte die Maschine, so gut es das Dämmerlicht in der Höhle gestattete; sie schien noch in demselben Zustande, wie er sie seiner Jeanne gezeigt. Wenn er nur etwas mehr Licht gehabt hätte! Er versuchte sie aus der Höhle heraus an das Tageslicht zu schleppen. Merkwürdigerweise aber erwies sich der ganze vordere Teil der Höhle, der früher die Schmiede gebildet hatte, bedeutend verengert, als hätten sich die Wände genähert. So mußte er das breitspurige Ding stehen lassen.
Eine verzehrende Sehnsucht nach den Seinen überkam ihn — ein Heimweh nach allem, was die Welt Liebliches, Trauliches — Menschliches hatte! Was sollte er tun? Sich aufs neue dem unheimlichen Dinge anvertrauen, dessen Mechanismus so Entsetzliches vermochte? Weiter fahren auf der Maschine — aber wohin?
Er machte ein paar Schritte dem Höhleneingange zu. Auf einem Felsenvorsprunge ließ er sich nieder und stützte verzweifelnd den Kopf in die Hände. —
Das ganze Gewicht seiner Verlassenheit, seines übermenschlichen Erlebnisses legte sich ihm auf die Seele. Er fühlte sich wie ausgestoßen in eine fremde Welt. —
Da spürte er plötzlich einen heißen Atem an seiner Wange, und ein schweres Etwas drückte plump und ungestüm auf seine Schulter.
Entsetzt fuhr Pierre auf und wandte sich um. —
Ein schwarzbraunes, zottiges Ungetüm hob drohend gegen ihn die Pranken. —
Ein Bär! — Ein Höhlenbär!

Pierre stieß einen furchtbaren Schrei aus und wollte fliehen. Aber der Bär drückte ihn an die Wand der Höhle und vertrat ihm mit seiner plumpen Masse den Weg.
Pierre riß sein Messer aus der Tasche und versuchte einen Stoß zu führen; aber die schwache Klinge drang kaum durch die dichten Zotten des Pelzes hindurch.
Durch den Stoß gereizt, packte ihn der Höhlenbär — ein fürchterliches Brummen ausstoßend — mit den Vorderpranken, um ihn zu erdrücken.
Vergebens suchte Pierre sich der mörderischen Umarmung seines Gegners zu entwinden. Heiß und keuchend lag der mit gewaltigen Zähnen besetzte Rachen des Ungetüms an seinem Halse.
Schon fühlte der junge Mann seine Kräfte erlahmen, da sauste ein schlankes, blitzendes Etwas an seinem Auge vorüber, und ein Schrei ertönte, wie der Kampfschrei eines Wilden.
Im Halse des Bären aber saß im nämlichen Augenblick ein — sichergeschleuderter Wurfspeer, dessen hölzerner Schaft noch unter der Gewalt des wuchtigen Wurfes erzitterte.
Die Umarmung lockerte sich; mit einem neuen entsetzlichen Gebrumm, bei dem eine rote Flut dem Rachen des Tieres entquoll, wandte sich der Bär gegen seinen neuen Angreifer. —
Und ein zweiter Wurfspieß folgte dem ersten. —
Mitten ins Herz getroffen, sank das Ungetüm mit einem letzten wütenden Zähnefletschen zusammen.
Pierre wandte sich nach seinem Retter um.
Da stand am Höhleneingange ein Wesen, fellumgürtet, mit nackten, wie braunpoliertes Elfenbein gefärbten Armen und Beinen — das Antlitz wild, mit dichtem, schwarzem, lockigem Haar und Bart!
Ein Mensch!
Pierre trat rasch auf ihn zu und reichte ihm mit einem dankbaren Lächeln die Hand.
Der Wilde nahm sie in seine beiden Hände und betrachtete sie aufmerksam. Dann wandte er sein Gesicht zu Pierre empor und sah ihn an mit dem ratlosen Ausdruck des Erstaunens und grenzenloser Verwunderung, wie sie wohl ein Kindergesicht zu zeigen vermag. Dabei murmelten seine vollen, aufgeworfenen Lippen wunderliche Kehllaute.
Am Höhleneingange wurde es lebendig; seltsame Stimmen ertönten — und nun sah sich Pierre umringt von einer Schar von Wilden, die alle seinem Retter ähnlich waren.
Ein unbeschreibliches Durcheinander von Tönen — ein wahres Tohuwabohu erfüllte die Höhle. — Bald betasteten die Wilden den Bären und bald den — — Pierre, und immer aufs neue begannen sie ihre lebhaften Reden.
Dann packten fünf oder sechs den Körper des erlegten Höhlenbären und schleiften ihn hinaus vor den Eingang.
Der »Retter« aber faßte Pierre am Arme, grinste ihm mit einem breiten, gutmütigen Lächeln ins Gesicht und führte ihn ebenfalls aus der Höhle hinaus.
Draußen fing man an, den Bären auszuweiden.
Pierre sah nun erst, wie groß das Ungetüm war. Ein Eisbär wäre klein gegen ihn erschienen. Allein der Kopf übertraf an Durchmesser den eines heute lebenden Bären wohl um das dreifache!
Schnell und geschickt hatten die Wilden die saftigsten Stücke ausgelöst; sie bedienten sich dazu steinerner Messer aus Nephrit, auch die Spitzen ihrer Wurfspeere bestanden aus diesem Material — —
D i e M e n s c h e n d e r S t e i n z e i t !
Ja — zu ihnen hatte die rätselhafte, wundersame Maschine Pierre zurückgebracht, so, als ob er nicht räumlich, sondern zeitlich sich bewegt hätte und zwar durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende hindurch!
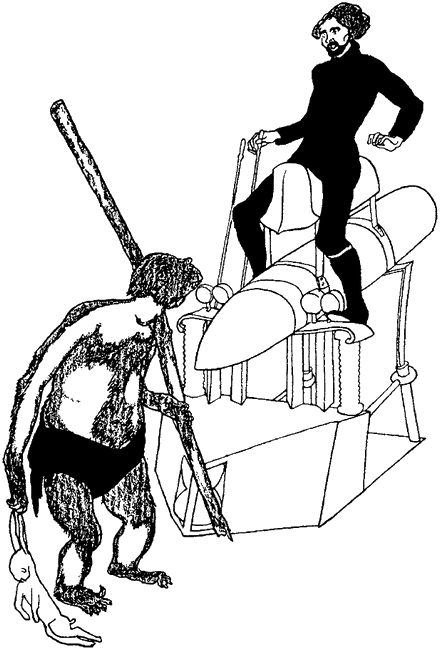
Das, was die forschende Wissenschaft sich mühsam aus spärlichen Überresten rekonstruieren mußte, er sah es leibhaftig, von Angesicht zu Angesicht!
Es schwindelte ihm — wieder und immer wieder blickte er auf die neben ihm sitzenden Menschen in ihrer Fellkleidung, auf die erlegte Riesenbeute, auf die glitzernden Gletschermassen am Horizont und — auf das ihm seit seiner Kindheit so vertraute Flüßchen, das allein das lebendige Band bildete, welches die uralte Vorzeit und seine eigene Gegenwart sichtbar verknüpfte — die leise rauschende Dordogne!
Eine neue Manipulation seiner Begleiter ließ ihn aus seinem Traume aufwachen. Die Wilden wollten Feuer machen. Voller Neugier beobachtete Pierre ihre Vorkehrungen: Aus einem köcherartigen Futteral zog der eine, ein herkulisch gebauter Mann, einen langen, rundlichen, geglätteten Stab, dessen Spitze vom Gebrauch schwärzlich, wie verkohlt, aussah, und einen dicken Klotz, in dem sich mehrere Aushöhlungen befanden. Dann brachte er noch einen dritten Gegenstand zum Vorschein, eine Art Pulverhorn, öffnete den als Verschluß hineingeschobenen Holzpflock und schüttete etwas von dem Inhalt in eines der Löcher im Klotze. Nun setzte er den langen Stab in dies Loch und drehte ihn wie einen Quirl mit rasender Schnelligkeit zwischen den Händen, indes die beiden Füße den Klotz am Boden festhielten.
Neugierig hatte sich Pierre gleich den andern zu Boden gebückt. Mit vollen Backen bliesen die Zunächsthockenden auf das Bohrloch des Klotzes — und nach wenigen Sekunden wirbelte feiner Rauch empor.
Mit verdoppelter Anstrengung quirlte jetzt der Feuermacher und pusteten die Wilden. —
Aber die rote Flamme, das heilige Feuer wollte sich nicht zeigen!
Der Feuermacher setzte ab und untersuchte Quirl und Klotz. Dann öffnete er von neuem das »Pulverhorn«, um nachzuschütten. Dabei ließ er eine Wenigkeit des Inhalts erst in die hohle Hand laufen und prüfte sie mit den Fingern.
Pierre sah, daß es feiner, weißer Sand war.
Der Feuermacher schüttete die Probe weg, stieß ein ärgerliches Geschrei aus und ließ ein neues Quantum in seine Hand laufen.
Auch dieses warf er weg mit noch heftigerem Schreien.
Nun griff ein anderer nach dem Horn und prüfte den Sand — auch Pierre nahm eine Probe davon und rieb sie zwischen den Fingern. Da verstand er den Ärger des Feuermachers: der Sand war feucht geworden; vielleicht war der Verschluß des Behälters nicht dicht genug gewesen.
Aufs neue nahm der Feuermacher das Horn und schüttete den Rest seines Vorrates in ein anderes Bohrloch des Klotzes.
Mit dem Aufgebot aller seiner Kräfte wiederholte er seine Kunst. —
Vergebens! — Die erzeugte Wärme steigerte sich bis zum Verkohlen des Holzes — wie vorhin schlug eine kleine Rauchsäule auf, — — aber das ersehnte Feuer blieb aus.
Eine tiefe Niedergeschlagenheit schien sich aller zu bemächtigen. Das Gemurmel und Geplauder verstummte mit einemmal — eine abergläubische Furcht sprach aus den meisten Gesichtern.
Da trat Pierre in den Kreis der Steinzeitmenschen und — entzündete ein Streichhölzchen — —
Als ob ein Blitz zwischen ihnen niedergefahren sei, sanken sie alle um ihn her in die Knie, die Hände halb wie zur Abwehr, halb wie zum Gebet gegen ihn emporstreckend.
Er aber rief ihnen freundlich zu, trat zu seinem Retter und reichte ihm das brennende Hölzchen. Vor Aufregung ließ es dieser zu Boden fallen und es erlosch.
Ein tiefer Seufzer — fast wie ein Klagelaut — ging durch die Reihen der Männer. —
Pierre brannte lächelnd ein neues an und hielt es selbst unter den Haufen trockener Zweige, den man am Eingange der Höhle aufgeschichtet hatte — — Nun schlug die Flamme empor, und ihr freundlicher, belebender Anblick brachte auch die noch immer scheuen Urmenschen allmählich wieder zu ihrer alten Vertraulichkeit zurück. Aber ihre Dankbarkeit und eine gewisse Ehrfurcht glaubte Pierre doch darin zu erkennen, daß sie ihm ein großes Stück der schnell am Spieß gerösteten Beute mit einer unbeholfenen Feierlichkeit überreichten.
Alle saßen und schmausten.
Und nach dem reichlichen Mahle trat bei dem kleinen Völkchen auch das Verlangen nach höheren Genüssen ein. — Ein kleiner, behender Wilder, dem Aussehen nach viel jugendlicher und zierlicher als die andern, von der kleinen Schar mit dem Rufe: »Julo!« und mit Händeklatschen begrüßt, sprang in den Kreis, der sich um das Feuer gebildet hatte, und brachte eine — Panflöte hervor, aus hohlen Vogelknochen kunstlos zusammengefügt.
Er blies eine schrille, aufreizende Weise, mit den Füßen stampfend. — Die Sitzenden klatschten mit den Händen den Takt — dann sprang einer auf und begann einen Tanz. Schnell folgten andere — und bald tanzten alle — Pierre beobachtete das Hüpfen und Stampfen und Händeklatschen. All die Beschreibungen fielen ihm ein, die er in der Jugend von den Sitten und Gebräuchen der heutigen Naturvölker, der Neger und Polynesier, gelesen — wie eng verwandt waren sich doch die Menschen gleicher Bildungsstufe, mochten sie auch viele Jahrtausende voneinander getrennt sein! —
Jäh sollte das kleine Völkchen aus seiner Fröhlichkeit gerissen werden.
Von den Höhen des Berges herab schallte plötzlich ein wildes Geheul — Wurfspieße flogen herab — mitten unter die Tanzenden!
Eine Schar angreifender Feinde, wie sie der Kampf ums Dasein in jener Urzeit planlos umhertrieb, hatte sie überfallen.
Die Feuersteinäxte machten rasche Arbeit. In wenigen Minuten lagen die meisten der Tänzer mit zerschmettertem Schädel am Boden.
Nur einigen, darunter dem Feuermacher, gelang es, wenn auch verwundet, zu entkommen.
Auch Pierre lag unter den Gefallenen.
Um das verödete Feuer aber lagerten sich die blutigen Sieger und setzten das Mahl fort...
Von einem unerträglichen Schmerze gefoltert, erwachte Pierre aus langer Bewußtlosigkeit. Der Schlag des Nephrithammers, den einer der Angreifer nach ihm geworfen, hatte ihn nur betäubt.
Er fand sich auf dem Gesicht liegend — — ein schneidendes Brennen und Prickeln zwischen den Schultern ließ ihn die Zähne zusammenbeißen — — Aber dieser Schmerz gab ihm schnell auch die ganze Besinnung wieder!! Seine Erlebnisse fielen ihm ein. Ein dumpfes Sausen im Kopfe erinnerte ihn an den Wurf des schweren Steinhammers — —
Vorsichtig hob er den Kopf und lugte umher — —
Etwas abseits von dem Feuer, das er entzündet, hockten die Feinde. Ihr Geschwätz gellte ihm in die Ohren.
Die Sonne war höher gestiegen. —
Er sah neben sich die Leiber der Erschlagenen; dicht vor seinem Kopfe aber hob sich ein schwarzbraunes, zottiges Etwas — — der Kopf des erlegten Höhlenbären.
Unschlüssig, was er tun sollte, lag Pierre, sich die Lippen blutig beißend, um nicht durch lautes Aufstöhnen seinen Schmerz und damit sein wiedergekehrtes Leben zu verraten.
Vorsichtig tastete er mit der Hand nach dem schmerzenden Rücken. Da fühlte er, daß seine Kleidung aufgerissen und seine Schulter entblößt war — Er fuhr mit der Hand über die schmerzende Stelle — sie fühlte sich klebrig an —
Er sah Blut an seinen Fingern...
Plötzlich erhob sich der Lärm der Sieger zu unbeschreiblicher Höhe — — Alle sprangen auf und eilten zu den Gefallenen.
Pierre barg den Kopf im Sande und stellte sich tot — —
Da sah er durch die halbgeöffneten Lider etwas Gräßliches.
Der vorderste der Wilden bückte sich zu dem einen Erschlagenen und hieb ihm mit einem Steinbeil den Kopf ab.
Dasselbe taten zwei, drei andere.
Nun näherte sich der große Haufe Pierre. Bei seinem Anblick nahm das Geschrei und Gekreisch den Ton eines triumphierenden Geheuls an. Jetzt bückte sich der Vorderste zu ihm nieder und tastete nach seinem Halse — —
In demselben Moment sprang Pierre auf — — stieß die verdutzten Feinde zurück und lief, so schnell er konnte — — nach der Höhle —
Einen Augenblick später waren die Wilden hinter ihm, und schon drängten sich zwei der Angreifer durch den Eingang, als Pierre die Zeitmaschine erreicht hatte und sich in den Sattel schwang.
Jetzt — — in der Todesnot — — fand er den Griff des kleinen Hebels sofort. Er riß ihn herum — —
— — Und die geschwungene Axt, die ihm den Schädel spalten sollte, verschwand vor seinem Blicke wie ein gespenstischer Schemen — — die Wilden verschwanden — — die grauen Schatten der ersten Fahrt kamen und legten sich um seine brennenden Augen; — das Gefühl des fortwährenden Fallens überkam ihn wieder, und schlingernd und stampfend arbeitete unter ihm die zitternde Maschine...
Nach einigen Minuten kam ihm die Ruhe und mit ihr die Überlegung zurück. Er sagte sich, daß ihn die rätselhafte Maschine bei ihrer jetzigen Gangart immer weiter zurücktrage in immer frühere Zeiträume der Urgeschichte —
Und er beschloß, Halt zu machen.
Langsam führte er den vorhin so rasend herumgerissenen Hebel wieder auf Null zurück. Die Maschine stand — — Pierre blieb aber auf ihr sitzen und schaute sich vorsichtig um — —
Er war allein in der Kalksteinhöhle. Vom Eingange her schimmerte nun ein bläuliches Licht.
Pierre stieg ab und schritt dem Ausgange zu. Er warf sich auf den Boden, ehe er aus der Höhle heraustrat, und spähte umher — —
Nirgends zeigte sich eine Spur eines lebenden Wesens.
Das bläuliche Licht aber, das er gesehen, war der Mond, der im vollen Glanze am nächtlichen Himmel stand.
Eine Sternennacht in der Urzeit!
Mit tiefer Ergriffenheit schaute Pierre zum gestirnten Himmel auf. — — Da blickten sie hernieder auf das verlassene Menschenkind, die treuen, ewigen Augen der Nacht! Er kam sich nicht mehr so einsam vor, seit er sie sah — —
Und doch — — immer mehr weiteten sich seine Blicke vor grenzenlosem Erstaunen — — das war gar nicht der Himmel, den er schon mit den frommen Augen seiner Kinderjahre geschaut! Er suchte die alten, ihm vertrauten Sternbilder, zuerst den Himmelswagen, dessen Spur er so oft in stiller Nacht seiner Jeanne am heimatlichen Himmel gewiesen — —
Aber er fand ihn nicht — — oder nicht mehr in der alten, vertrauten Gestalt, zu welcher sich in unserer Zeit seine sieben Sterne gruppiert haben. Daß er es sein mußte, vermutete Pierre nur aus der Anhäufung einer gleichen Anzahl hellglänzender Sterne und aus ihrer Lage zu einem einsamen hellglänzenden Sterne, den er für den ihm bekannten Polarstern hielt, wenngleich er dafür viel zu tief am Horizonte lag. Und an diesem Horizonte schimmerte noch ein anderes Sternbild, das sein Auge am Heimathimmel noch nie erblickt, das südliche Kreuz!
Er erinnerte sich einer Sternkarte, die er als Schüler des Polytechnikums einst studiert, welche die Sterne des Himmelswagens so geordnet zeigte, wie sie nach der Berechnung der Astronomen vor ca. 50 000 Jahren erschienen — — und wenn ihre Berechnungen Wahrheit waren, so lag die Zeit, in der Pierre auf seiner zweiten Zeitfahrt nun gelandet, mehr als fünfzig Jahrtausende hinter seiner Gegenwart zurück!...
Fremd und kalt und leer in all seiner glänzenden Fülle war nach diesen Entdeckungen das schimmernde Firmament für Pierre geworden. Traurig, mit einem namenlosen Gefühl des Verlorenseins im grenzenlosen All, saß er am Eingange zur Höhle und erwartete den Morgen — —
Zu schlafen wagte er nicht.
Und der Morgen kam.
Golden hob sich die Sonne aus den Tiefen des Horizontes empor — — und ihr segnendes Licht umfing ihn traulich und lind und warm — — wie Mutterliebe. — — Und alles war verändert!
Verschwunden waren die blendenden Gletscher — — höher und steiler hoben sich aus dem Tale die Hänge der Berge empor — — eine reiche, fast tropische Vegetation deckte die Ebene am Flusse.
Es war ein Paradies, in das ihn die wunderbare Maschine getragen!
Und dieses Paradies regte sich, gleich dem der Bibel, von allerlei Tieren:
Grellfarbige Papageien schaukelten sich auf den Zweigen der seltsamen Bäume. Durch die hohen, schlanken Baumstämme schimmerte es bunt wie das gefleckte Fell einer Giraffe. Und unten im Schilfe des Flusses, der sich zu einer sumpfigen Niederung erweitert hatte, lag ein sonderbares, riesiges Geschöpf, mit zwei langen Hauern im Unterkiefer, die nach unten gebogen, wie krumme Säbel herabhingen.
Nur der Mensch schien zu fehlen. Aber sein Halbbruder, der Affe, war vertreten; denn eben schwang sich ein langarmiger, dichtbehaarter Repräsentant dieser Gattung von einer am Ufer stehenden breitblättrigen Platane herab und näherte sich, schwerfällig mit einander zugekehrten eingeknickten Knieen, aufrecht gehend, mit den langen Armen hin- und herschlenkernd, dem Orte, wo Pierre auf seinem Beobachtungsposten im Schatten der Bergwand saß.
Pierre überlegte, was er tun sollte. Die Affen der Jetztzeit greifen den Menschen selten an und suchen am liebsten das Heil in der Flucht. Er beschloß, sich unbeweglich zu verhalten und die Dinge abzuwarten.
Der Vierhänder kam näher und jetzt — — jetzt sah Pierre in seiner Hand eine Waffe — —
Einen Baumast, an den ein roh zugehauener Feuerstein gebunden war! Diese primitive Waffe hatte ein höherer Intellekt ersonnen: das war kein Affe — —Das war ein Mensch!
Aber — — was für ein Mensch!
Auf dem plumpen, aber gewaltigen Körper saß ein riesiger, dicker Kopf. Die flache, fliehende Stirn war unter dem dichten Haarwuchs des Gesichts kaum zu entdecken. Dicke Knochenwülste hingen über den Augen; die Schläfen zeigten eigentümliche Vertiefungen, wodurch die Partie der Augen wie abgeschnürt erschien und diese selbst wie kurze Teleskope hervorstanden. Die Nase war klein und eingedrückt, der Mund groß, die Lippen wulstig aufgeworfen, das Kinn kurz, wie abgehackt, und der Unterkiefer dick und massig. Um die Hüften trug er die Haut eines Tieres, sonst war er völlig nackt.
Der Affenmensch schien Pierre nicht zu bemerken, und dieser glaubte die richtige Taktik für dieses Zusammentreffen befolgt zu haben, — — als plötzlich der Anblick der Höhle das seltsame Wesen Halt machen ließ. Offenbar erregte der dunkle Felseneingang seine Aufmerksamkeit.
Mit einem behenden Satze, bei dem er sich auf alle Viere niederließ, schwang er sich dicht in Pierres Nähe. Und jetzt erhob sich Pierre — — in dem Augenblick, als sich der Affenmensch anschickte, in die Höhle hineinzukriechen — —
In der Höhle stand die Maschine, und Pierre fürchtete die Neugier des Urmenschen.
Mit einem Aufschrei, der in seinem Klange völlig noch an ein wildes Tier erinnerte, taumelte das erschreckte Geschöpf zurück — — aber nur einen Augenblick; im nächsten hob der muskulöse, dichtbehaarte Arm die Waffe! Pierre bückte sich rasch und warf ihm eine Hand voll Sand ins Gesicht — — Wütend um sich schlagend, drang der Halbgeblendete auf ihn ein; aber Pierre war schneller und erreichte vor ihm den Höhleneingang. Wohl hörte er hinter sich seinen schnaubenden Verfolger — — aber da saß er auch schon auf der rettenden Maschine und faßte nach dem Hebel — —
Aber der Hebel bewegte sich nicht; irgend etwas mußte in Unordnung geraten sein, als Pierre vorhin, auf seiner ersten Flucht, ihn in voller Hast gedreht hatte.
Mit voller Wucht riß Pierre noch einmal an der metallenen Stange — — Sie brach ab!
Und da war der Feind — — jetzt in seiner Wut nur noch ein Tier, ein Tier mit Riesenkräften!
Zum Glück war die Stelle der Höhle, wo die Maschine stand, sehr eng, und der Affenmensch vermochte von seiner Waffe keinen rechten Gebrauch zu machen. Dafür hatte er Pierre rücklings um den Leib gepackt und suchte ihn herunterzureißen — —
Pierre hatte einige Jahre in England gelebt und verstand die Kunst des Boxens. Ein wohlgezielter Stoß in die Magengegend ließ den plumpen Vorfahren auf den Rücken stürzen.
Aber ebensoschnell erhob er sich wieder — —
Mit furchtbarem Gebrüll faßte er, sich aufrichtend, in das Getriebe der Maschine — —
Pierre glaubte sich verloren. Er sah das Antlitz des Pithecanthropus vor sich in seiner ganzen tierischen Wildheit: blutrot glühten die kleinen, funkelnden Augen in ihrer Höhlung; heiß brach sein Atem aus dem weitgeöffneten Munde, in dem die Eckzähne, jetzt von den in er Wut herabgezogenen Lippen entblößt, gleich Hauern heraustraten — —
— — Da zerfloß mit einem dumpfen Schlage vor Pierre die Erscheinung des furchtbaren Gegners — — wie in einem Nebel sah er noch einige Bruchteile einer Sekunde hindurch sein wutverzerrtes Gesicht — — dann umfing ihn wieder das eintönige Grau; — — das atemraubende Gefühl des rastlosen Fallens überkam ihn wieder, und unter sich fühlte er das Schlingern und Stampfen der dahinsausenden Maschine — —
Er war gerettet!
Aber auf welche Weise! Der Griff des Hebels war ja abgebrochen! Ob die herkulische Kraft des Affenmenschen vermocht hatte, trotzdem die Maschine in Bewegung zu setzen? Ob er mit seiner täppischplumpen Faust zufällig den wunderbaren, geheimnisvollen Mechanismus ausgelöst hatte?
Die Tatsache blieb bestehen; aber Pierre mußte suchen, ihr auf den Grund zu kommen. Er tastete nach seinen Zündhölzchen; zum Glück hatten die Wilden, welche ihn überfielen, das kleine Hartgummibüchschen nicht entdeckt. Er machte Licht und untersuchte, sich mit den Knien festklammernd, die stampfende Maschine.
Er fand die Stelle, wo der Hebel abgebrochen war, dicht über der Verschraubung; hier vermochte seine Hand nichts mehr zu reparieren. — — Er suchte weiter, ein Streichhölzchen nach dem andern entzündend, und fand endlich, dicht am Sitz, eine kleine Stange, die ähnlich der abgebrochenen, in entgegengesetzter Form und Richtung angeschraubt war.
Vorsichtig versuchte er sie zu drehen — —
Heiß und kalt überlief es ihn, und seine Hand zitterte — —
Aber es geschah nichts Besonderes.
Er drehte weiter — —
Der rasende Gang der Maschine wurde ruhiger. Der Druck und das Schwindelgefühl im Kopf ließ nach.
Nun gewann er Mut; langsam und gleichmäßig führte er den Hebel in derselben Richtung zurück, so weit es ging — —
Die Maschine stand!
Pierre stieg ab. Seine Umgebung schien noch die alte; aber die Höhle kam ihm jetzt wieder heller und geräumiger vor. Er schritt durch den langen Gang — —
Aber schon stockte sein Fuß —
Diese Kalkwand hatte sein Blick bisher noch nie gesehen!
Seltsame Linien entdeckte sein forschendes Auge, in launischen Krümmungen und Verschlingungen in die Kalkwand geritzt und mit Ocker gefärbt.
Unwillkürlich trat er zurück an die gegenüberliegende Seite, um die seltsamen Kritzeleien besser übersehen zu können.
Was sah er? — Er schüttelte ungläubig den Kopf, rieb sich die Augen und schaute wieder.
Diese scheinbar sinnlosen Linien setzten sich zu scharfumrissenen Bildern zusammen. Und diese rohen Zeichnungen stellten im Umriß vorzeitliche Tiere in lebendiger Naturtreue mit allen ihren charakteristischen Kennzeichen dar: Das Mammut mit seinen langen Stoßzähnen und seiner dichten Behaarung, das Renntier im Kampfe mit einem Nebenbuhler um ein Weibchen u. a.
Mit grenzenlosem Erstaunen betrachtete Pierre diese uralten Zeugnisse menschlicher Kunst und Beobachtungsgabe. Er bedauerte, daß er kein Notizbuch bei sich führte, um eine Skizze dieser Naturdarstellungen festzuhalten.
Wie aber wuchs sein Erstaunen, als er auf einer der am frischesten erhaltenen Zeichnungen s i c h s e l b s t erblickte, sicher und treu skizziert in seinem Kampfe mit dem Höhlenbären!
Denn das war er zweifellos: das war sein kurzgeschorener Kopf und sein scharfgeschnittenes Profil, sogar die Kleidung, die von der Fellumhüllung der Wilden so ganz abwich, war unverkennbar angedeutet. Hinter ihm stand auf dem Bilde sein Retter, in der Rechten den erhobenen Wurfspeer. Pierre stand in schweigender Verwunderung. Diese Bilderschrift war für ihn eine Urkunde, aus der er erfuhr, daß nicht alle von seinen damaligen Begleitern dem Überfall zum Opfer gefallen, daß sich einige gerettet — — und daß man ihn und sein Erscheinen unter ihnen für wert erachtet hatte, an der Steinwand verewigt zu werden.
Aber — — die Zeichnung stellte ein Geschehnis dar, das nur die Erinnerung festhalten konnte; das Bild war j ü n g e r als Pierres Abenteuer mit dem Höhlenbären!
Das aber bedeutete für ihn, daß ihn die Maschine auf ihrer letzten Fahrt nicht weiter zurück in die Vergangenheit — — sondern v o r w ä r t s getragen hatte!
V o r w ä r t s ! Aber — — da lag ja die Zukunft, die für ihn noch lebendige, beglückende G e g e n w a r t war! Da stand ja die liebe, vertraute Heimat und das kleine Haus am Hügel, wo zwei Herzen um ihn bangten, wo alte und junge Augen um ihn weinten wie um einen Verlorenen!
Im nächsten Augenblick schon saß er wieder im Sattel der Maschine und drückte den neuentdeckten Hebel zurück — —
Das alte Spiel begann; — — aber es trug ihn ja vorwärts, immer vorwärts! Sein Auge fiel wieder auf die Zifferblätter. Wenn er doch die Sprache dieser stummen Reisebegleiter richtig deuten lernte!
Wenn er annahm, daß jede Ziffer auf dem vierten (letzten) Blatt einen Tag bedeutete, so verzeichnete das dritte mit jeder Ziffer je tausend Tage. Pierre steigerte die Geschwindigkeit der Maschine, daß der Zeiger auf dem letzten Blatt nur noch wie ein herumlaufender Schatten zu sehen war, aber der Zeiger des dritten deutlich wahrnehmbar von Ziffer zu Ziffer sprang.
Als der dritte Zeiger einmal seine Runde vollendet hatte, sprang auch der des zweiten Zifferblattes um eine Ziffer; er notierte also damit eine Million Tage. — Auch das erste Zifferblatt trug die Ziffern 1—1000; aber sein Zeiger stand unbeweglich. Pierre hielt einen Augenblick an, um alle vier Zeigerstellungen ablesen zu können:
0... 3... 649... 975
das ergab also — — seine Annahme als richtig vorausgesetzt — — die Summe von 3 649 975 Tagen oder rund 10 000 Jahre!
10 000 Jahre! Aber — — von welchem Zeitpunkte gezählt? Das erst hätte den Zahlen den Wert chronometrischer Angaben gegeben — und dazu hätte Pierre beim Beginn seiner unfreiwilligen Reise genaue Ablesungen machen müssen. — Auf die Messung der Zeit durch die Ziffern konnte er sich also nicht verlassen.
Und aufs neue drehte Pierre den Hebel — —
Ihm fiel ein, daß die großen geschichtlichen Epochen alle noch vor ihm lagen: die Zeit der Pfahlbauer — — die Bronzezeit — — die Römerzeit — — die Zeit der Völkerwanderung usw. bis in die letzten geschichtlichen Zeiten hinein — — und er steigerte die Geschwindigkeit noch mehr.
Aber plötzlich überfiel ihn eine wahnsinnige Angst, die ihn die in rasender Hast dahinjagende Maschine plötzlich bremsen ließ — —
Wenn er z u w e i t fuhr! Zuweit in eine Zukunft hinein, für welche die Gegenwart, die Pierre Maurignac suchte, schon tote Vergangenheit war! Wo alle die längst dahin waren, die sein Herz hier geliebt! Denn ein Zurück gab es dann für ihn nicht mehr; der Hebel, der die Maschine rückwärts steuerte, war ja abgebrochen!
Was tun?
So sehr er sich scheute, die Maschine hinaus ins Freie zu bringen, wo sie — — in den Pausen seiner Fahrt, weil sie sichtbar wurde — — allen Wechselfällen und aller Unbill der Zeiten ausgesetzt war, so sehr er sich selbst dabei der vielleicht für ihn verhängnisvollen Neugier der Menschen aussetzte, die ihm in blindem Unverstand die wunderbare Maschine und damit die einzige Möglichkeit zur Heimfahrt vernichten konnten, — — — so sehr schien es doch im Interesse einer genauen Zeitbestimmung angebracht. Denn hier in der dunklen Höhle hatte er gar keine Kontrolle darüber, wie weit er fuhr.
Und eben wollte er versuchen, die schwere Maschine trotz aller Hindernisse herauszutransportieren, selbst, wenn der engergewordene Eingang ihre teilweise Zerlegung erfordern sollte — — als ihm plötzlich ein rettender Gedanke kam.
Er besaß ja ein untrügliches Merkmal dafür, ob er wieder in s e i n e r Zeit angekommen, also gewissermaßen auf den Nullpunkt seiner Fahrt zurückgekehrt war: Offenbar trug ihn die Maschine nur in der Zeit, nicht auch im Raume fort; denn sie hatte ihren Standort hier in der Kalksteinhöhle bisher nicht geändert, wie Pierre aus verschiedenen kleinen Merkzeichen sah.
Aber — dann mußte er auf seiner Heimfahrt durch dieselbe Minute wieder fahren, in welcher er in Gegenwart seiner lieben Jeanne hier in der Höhlenschmiede seine unfreiwillige, wunderbare Reise begann!
Und schon saß er im Sattel und drehte den Hebel — —
Und nun galt es, die Augen aufzuhalten!
Und das tat er — — und fuhr dahin in banger Hoffnung, durch die grauen Schatten, die in eintönigem Rhythmus heller und dunkler ihn umfluteten, wie brandende Wellen im unendlichen Meer — — endlos — — endlos —
In der alten Höhlenschmiede saß Jeanne Dauvergne in tiefer Trauer.
Hier war ja der Ort, wo sie mit Pierre zum letzten Male zusammengewesen, ehe er auf so rätselhafte Weise verschwand.
Alles lag und stand noch so, wie er es verlassen, all die Werkzeuge, mit denen er an der seltsamen Maschine gearbeitet.
Ach, wenn ihre Wünsche und Gebete ihn zurückrufen könnten! In ihrem Schmerz um den Verlorenen machte sie sich jetzt Vorwürfe, daß s i e ihn doch eigentlich veranlaßt, sich auf die unheimliche Maschine zu setzen, — — daß s i e also ihn dem dunklen Verhängnis überliefert habe... Lange saß sie so — — träumend und sich sehnend — —
Da fuhr sie auf.
Vor ihr, aus dem Halbdunkel der Höhle geboren, erschien plötzlich wie eine Halluzination — — Pierre, ihr Geliebter — — undeutlich, schattenhaft, wie ein Bild, das sich ins Nichts auflöst!
»Pierre!«, schrie sie auf, erfreut und entsetzt zugleich — —
Im nächsten Moment war die Erscheinung verschwunden.
Jeanne eilte aus der Höhle, zitternd, leichenblaß — —
Mit hochklopfendem Herzen, die Hände auf die stürmisch wogende Brust gepreßt, stand sie vor Pierres Mutter und erzählte ihr die Vision.
Die Greisin zog sie stumm an ihr Herz. Ihr war das Erzählte nur eine Selbsttäuschung des liebenden, im Grunde seines Wesens erschütterten Mädchens; warum aber sollte sie ihr den schönen Wahn mit kalten Worten zerstören! — — — —
Da ertönten auf dem Vorsaal Schritte — —
Die beiden Frauen horchten auf.
So ging nur e i n e r !
Die Tür flog auf — —
« P i e r r e ! «
Und lachend und weinend sank der Heimgekehrte in ihre Umarmungen.
Und die Zeitmaschine? wird der geneigte Leser fragen.
Der freundliche, hilfsbereite und — — neugierige Maire des kleinen Ortes ist schuld, daß sie — — nicht mehr vorhanden ist.
Als sich die Kunde von Pierres wunderbarer Reise und Wiederkehr schnell wie ein Lauffeuer von Haus zu Haus verbreitet hatte, kamen die Einwohner alle, um ihm zu gratulieren und ein klein wenig dabei ihre große Neugier zu befriedigen, — voran, in feierlicher Amtstracht, der Herr Maire.
Pierre erzählte, soviel er den Leuten von seinem Abenteuer verdeutlichen konnte, und führte sie schließlich in die Höhle, wo die Zeitmaschine stand.
Weil sich alle in dem engen Raume drängten, um das merkwürdige Ding zu sehen, schlug der Herr Maire vor, die Maschine vorsichtig ins Freie zu tragen.
Das geschah — — und bald stand das glitzernde Ding mit all seinen Stangen und Wellen und Scheiben unter Gottes freiem Himmel.
Pierre erklärte, soweit er es vermochte, den wunderbaren Mechanismus.
»Und Sie meinen, daß die Maschine wirklich wieder in die Zeit reist, sobald man diesen kleinen Hebel bewegt?«, fragte der Herr Maire.
»Augenblicklich!«, bestätigte Pierre.
»Ich kann es mir nicht denken!«, sagte der Maire, und wie er, schüttelten viele ungläubig den Kopf.
»Wenn Sie Lust haben, die Reise zu versuchen, bitte — —«, rief Pierre, mit einer verbindlich einladenden Handbewegung auf den Sattel der Maschine weisend.
»Das gerade nicht, Monsieur Pierre! Aber es ist doch unglaublich! Unglaublich! Also dieser kleine Hebel setzt das große, plumpe Ding in Bewegung? Und man sieht doch keine treibende Kraft, keinen Motor usw. — — Dieser kleine Hebel?!«
Und damit hatte der würdige Herr Maire die Hand auf die kleine Metallstange gelegt und sie — — halb aus Aufregung, halb aus ungeduldiger Neugier — — ein wenig bewegt — —
Ein Schlag ertönte — — ein Luftwirbel ließ die Umstehenden erschreckt zurückweichen — — einen Augenblick lang sah man noch ein Durcheinanderwirbeln von glänzenden Metallteilen, Stangen, Wellen und Scheiben — — Dann war der Platz, auf dem die Zeitmaschine gestanden, leer!
»Sie ist fort! Himmel! — Sie ist wahrhaftig fort, Monsieur Pierre!«, rief der Maire bestürzt aus.
»Sagte ich's Ihnen nicht? — — Ja, — — sie ist fort — — auf Nimmerwiedersehen, Herr Maire!« — — — —
Die Landleute standen und gafften mit offenen Mäulern — — und standen noch stundenlang — —
Die Maschine war und blieb verschwunden.
»Es ist doch schade«, sagte Pierres Mutter, »daß wir nun niemand mehr die wunderbare Maschine zeigen können — — nicht einmal Herrn H. G. Wells, dem du deine glückliche Heimkehr telegraphisch gemeldet hast! Wie viele werden noch kommen in den nächsten Tagen, wenn deine rätselhafte Fahrt erst mehr bekannt geworden ist, um dich und die Zeitmaschine zu bewundern! — — Schade! Nicht einmal einen gültigen Beweis hast du, daß du eine solche Wunderfahrt gemacht hast, mein Pierre — —«
»Ein Beweis wird sich schon noch finden, wenn man, wie mir der Maire zugesagt hat, um sein Mißgeschick in etwas wieder gutzumachen, den engen Gang hinter der alten Höhlenschmiede wieder gangbar gemacht haben wird, der jetzt durch herabgebröckeltes Gestein versperrt ist. All die uralten Zeichnungen, die ich gesehen, von jenen prähistorischen Zeitgenossen des Mammut, des Höhlenbären, des Renntiers in die Kalkwand gekritzelt, werden sich getreulich finden.(*) — Was ich erzählte, habe ich auch erlebt, und man muß mir glauben, auch — — wenn ich keinen sichtbaren Beweis jetzt aufweisen kann — —«
(*) Ist inzwischen geschehen: in dieser, wie in einigen benachbarten Höhlen hat man die von Pierre Maurignac zuerst gesehenen Zeichnungen prähistorischer Tiere aufgefunden. — Anm. des Verfassers.
»Und doch könntest du ihn aufweisen, Liebster!«, sagte Jeanne mit lächelndem Erröten.
»Wie meinst du das?«
»Verzeih'! — — Heut, als du heimkehrtest von der schrecklichen Fahrt, mit zerrissenem Gewand und blutigem Hemd, sah ich — —«
»Nun, liebe Jeanne — —?«
»Sah ich, als ich dir den Staub und das Blut ein wenig abwusch, auf deiner Schulter — —«
»Sprich, liebe Jeanne — — — eine kaum geheilte Wunde, nicht wahr? Ich erzählte euch doch von dem Überfall der Urmenschen — —«
»Nein — — keine Wunde — —«
»Keine Wunde? Was dann — —?«
»Eine — — T ä t o w i e r u n g ! «
»Eine Tätowierung! — — das wäre!«
Und rasch hatte Pierre das Jackett abgeworfen und, vor den Spiegel eilend, das Hemd von der Schulter gezogen — —
Jeanne hatte recht gesehen:
Zwischen den Schultern Pierres prangte — — in photographischer Treue — — der Kopf — — des Höhlenbären.
»Diese Halunken!«, rief Pierre, ärgerlich und belustigt zugleich. Also — — das war der schauderhafte, stechende Schmerz, der mich wieder zur Besinnung gebracht hat! — Diese infamen Halunken! Aber — — — — schließlich muß ich ihnen und ihrer Tätowierkunst nur dankbar sein! Ohne die stechenden Schmerzen, die mir ihr Feuersteinmesser bereitet, hätten sie auch mir wahrscheinlich in der Bewußtlosigkeit, wie den andern, den Schädel geraubt, um ihn zu einem Trinkgefäß umzuarbeiten — —«
Er zog Jeanne lächelnd an sich — — »Du wirst mir deshalb nicht gram werden, liebe, kleine Jeanne, nicht wahr? Der Höhlenbär ist ja nur ein Schönheitsfehler — — und zum Glück sieht ihn ja niemand weiter — —«
»Und — —«, schloß die alte Mutter, die Arme um beide legend und schalkhaft von dem einen zur andern sich wendend — — »und, Kinderchen, er wird ja hoffentlich sich nicht mit forterben!«
Im Studierzimmer des alten Professors Diluvius leuchtete noch immer die elektrische Arbeitslampe. Draußen vor den enggeschlossenen Jalousieen der Fenster erhellte schon der Schein des aufdämmernden Frühmorgens die Gegend. Aber der Herr Professor arbeitete noch immer. Es mußte ein seltenes und sehr interessantes Objekt sein, das den Gelehrten sich selbst und die Rücksicht auf seine leiblichen Bedürfnisse so ganz vergessen ließ.
Professor Diluvius war Vorsteher der paläontologischen Abteilung des Museums für Naturkunde. Seine Forschungen über die fossile Tierwelt, namentlich auf dem Gebiete der Dinosaurier, waren nach verschiedenen Richtungen hin epochemachend gewesen...
Seine eigentlichen Arbeitsräume befanden sich im ersten Stockwerke des Museums, und es mußten besondere Gründe ihn veranlassen, die Präparation eines paläontologischen Fundes in seiner Privatwohnung vorzunehmen.
Denn ein solches fossiles Objekt lag vor ihm, und seine trotz des Alters noch immer geschickten und sicheren Hände arbeiteten emsig an seiner Enthüllung.
Es war eine Platte lithographischen Schiefers aus der Gegend von Eichstätt, unregelmäßig geformt, die der Gelehrte mit seinen meißelartigen Werkzeugen bearbeitete. Vorsichtig und mit größter Schonung entfernte er, vom Rande der Platte her arbeitend, die Schichten des Kalkschiefers — bis an eine auf der Oberseite mit Bleistift umrandete, ungefähr kreisförmige Stelle.
Was für ein seltsames vorsintflutliches Geschöpf lag hier versteinert in den Ablagerungen des Kalkschiefers verborgen?
Ein ganzer Berg von der Platte abgelöster Bruchstücke häufte sich schon vor ihm auf, und noch immer gönnte er den müden Fingern und den brennenden Augen keine Ruhe — immer wieder griff er die Platte an, hin und wieder die Instrumente wechselnd.
Verwundert schaute »Grauchen«, eine prachtvolle graue Katze, die sich's auf der Chaiselongue bequem gemacht hatte, dem unverständlichen nächtlichen Treiben ihres Herrn zu. Sie war noch ein Vermächtnis seiner verstorbenen Frau, die einst das hilflose junge Kätzchen fast verhungert in einer Ecke des Hausflurs gefunden. — Erst schnurrend, dann leise miauend, suchte sie die Aufmerksamkeit des Professors auf sich zu lenken, schloß aber endlich verdrießlich blinzelnd die Augen wieder, als ihre Mühe vergeblich blieb.
Eine Uhr schlug irgendwo in der Nähe. Aufhorchend zählte Professor Diluvius die Schläge.
»Vier Uhr!«, sagte er. »Zwölf Stunden arbeite ich nun daran, und das Gröbste habe ich wohl herunter. Jetzt heißt es, doppelt und dreifach Vorsicht gebrauchen!«
Und wieder begann er zu sticheln und zu meißeln, und immer kleiner wurden die Kalkschüppchen, die er nun von der Platte abhob. Er arbeitete jetzt mit der kleinsten Nummer seiner stählernen Werkzeuge.
Fast zwei Stunden mochte er so in voller Emsigkeit weitergearbeitet haben. Ein etwas größeres Stück des Kalkschiefers hob sich jetzt beim Angriff des Meißels ab. —
»Da ist es!«, rief Professor Diluvius.
Aus der Platte ragte die Spitze eines eiförmigen Körpers hervor. —
»Sei mir gegrüßt, du Gnadengeschenk versunkener Jahrmillionen!«, frohlockte der alte Herr, in die Hände klatschend und vor Freude von einem Beine aufs andere hüpfend — »sei mir gegrüßt, du Spende einer rara avis! Das Ei des Kolumbus und — selbst das Ei der Leda ist gegen deinen Wert ein Schatten!«
Er hielt die Platte dicht an seine Studierlampe, den grünen Lampenschirm hochschiebend.
»Wie unscheinbar es aussieht! Wie alles, was seinen Wert im Innern trägt! — Graugrün mit schwarzen Tüpfeln! — Niemand würde vermuten, daß es gelegt wurde zu einer Zeit, da es noch keine Menschen auf unserem Planeten gab, von einem Geschöpf gelegt wurde, das eine Eidechse war und — ein Vogel werden wollte!«
Schnell griff er wieder nach seinen Werkzeugen, um es völlig aus der Hülle des Kalkschiefers freizulegen. Und so sehr ihn der erste Anblick des ersehnten Fundes begeistert hatte — mit eiserner Ruhe und Kaltblütigkeit arbeiteten seine Hände weiter, vom vorsichtig abwägenden Blick seiner scharfen grauen Augen gelenkt, bis es rund und heil und ganz vor ihm lag, das Ei des Urvogels Archäopteryx! — Und nun erst nahm er sich Zeit, das Begleitschreiben noch einmal zu studieren, das ihm sein junger Freund und ehemaliger Schüler Doktor Finder mit dem kostbaren paläontologischen Objekt gesandt hatte.
Es lautete:
»Eichstätt, den 5. Juli 19..
Mein lieber, hochverehrter Herr Professor!
Anbei übersende ich Ihnen ein Objekt, das vorläufig einzig in den Sammlungen unserer Museen dastehen dürfte, ein fossiles Ei, dem Fundorte nach (es stammt aus den Schieferbrüchen hier am Blumenberg) wahrscheinlich ein Ei von Archaeopteryx lithographica. Die Untersuchung der Platte durch die neue Art der Y-Strahlen zeigt nur, daß ein vollkommen gut erhaltenes Ei in der Schieferplatte steckt; ich habe die Lage des Objekts auf der Ober- und Unterseite der Platte durch eine Bleistiftlinie umrandet, so daß wenigstens ungefähr ein Anhalt für die Freilegung des Fundes gegeben ist.
Denn diese schwerste Arbeit muß ich Ihnen leider allein überlassen, lieber, hochverehrter Herr Professor; Sie kennen ja meine Aufgabe hier in den Kalkschieferbrüchen, die mir zu so diffizilen Extraarbeiten keine Zeit läßt. Aber Ihre so geschickte Hand hat schon Schwierigeres geleistet. Ich meinerseits hoffe, auch in dem noch in der Steinhülle steckenden Geschenk wird Ihnen die Liebe und Verehrung nicht verborgen bleiben, mit der ich allezeit sein werde
Ihr dankbarer Schüler
Dr. Finder.
P.S. Wenn man das Ei doch noch ausbrüten lassen könnte! — Aber dazu ist es doch wohl nicht mehr ›frisch‹ genug? D.O.«
Immer wieder kehrten die sinnenden Augen des alten Gelehrten zu diesem Postskriptum zurück. Ein ungeheuerlicher Gedanke drängte sich ihm auf: War es denn so ausgesprochen unmöglich, daß die scherzhafte Wendung des »Ausbrütenlassens« zur Wahrheit werden konnte?
Ein Geräusch an der Tür des Zimmers störte ihn in seinem Denken. Seine alte Wirtschafterin Pauline trat ein. Vor Schreck ließ sie Eimer und Schrubber fallen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
»Aber, Herr Professor, Herr Professor! Wenn das die selige Frau erlebt hätte! Sie sitzen n o c h über dem alten Steinklumpen? Und sind wohl gar nicht schlafen gegangen? Ach, lieber Herr Professor, wenn man schon über die Siebzig hinaus ist —«
»Ja, Sie haben ja recht, liebe Pauline! Aber es gibt eben Ausnahmen, und eine solche ist schuld, daß ich einmal eine Nacht hindurch gearbeitet habe. Nun seien Sie hübsch vernünftig und schelten Sie nicht mehr — sondern bringen Sie mir eine recht große Tasse schönen Kaffee, aber so, wie nur Sie ihn zu brauen verstehen, Pauline!«
Kopfschüttelnd zog die alte, treue Schaffnerin mit den Attributen des Reinemachens wieder ab.
Professor Diluvius wandte sich aufs neue dem seltsamen Funde zu. Er nahm das ArchäopteryxEi vorsichtig in die Hand und hielt es gegen das Licht der Studierlampe. Es erschien gleichmäßig undurchsichtig, als ob die Schale dicker sei als die unserer jetzigen Vogeleier. Das Bauernmittel fiel ihm ein: er hielt das kostbare Ei erst mit dem einen, dann mit dem andern Ende an die Lippe.
Beinahe hätte er es vor freudigem Schreck aus der Hand fallen lassen.
Das eine Ende erschien ihm wärmer als das andere!
Das Blut hämmerte ihm in den Schläfen vor plötzlicher Aufregung. U n g l e i c h warme Hälften! Aber vielleicht war es eine Sinnestäuschung — —
Er legte das Geschenk der Vorzeit mit zitternden Fingern auf die Platte seines Arbeitstisches und stand auf...
Der Morgen lugte durch die Spalten der Jalousieen. Der Professor zog sie auf und schaltete die Lampe seines Zimmers aus. Dann ging er ein paarmal auf und ab, öffnete im Vorbeigehen ein Fenster und lehnte sich ein Weilchen hinaus, mit vollen Zügen die duftige Frühluft atmend. Er wollte sich erst völlig wieder in der Gewalt haben, erst ganz wieder Herr seiner Nerven sein, ehe er die entscheidende Untersuchung des Objekts von neuem vornahm.
Nun erschien auch Pauline wieder mit dem duftenden Frühtrunk. Ihr gutes, etwas alltägliches Gesicht und ein Schluck des braunen Trankes wirkten besänftigend auf ihn ein. Schnell entschlossen, reichte er seiner Köchin das kostbare Urvogelei.
»Hier, liebe Pauline, prüfen Sie einmal, als wenn es ein Hühnerei wäre, ob dies ein frisches Ei ist! Aber vorsichtig, vorsichtig!«
Pauline machte die Probe ähnlich, wie ein Weilchen vorher der Professor Diluvius — nur hatte die einfache Köchin das Urteil der größeren Erfahrung vor ihm voraus.
»Es ist noch gut, Herr Professor! Soll ich's Ihnen kochen? Es ist wohl so'n ausländischer Leckerbissen?«
Mit beiden Händen griff der alte Herr nach dem wunderbaren Schatze.
»Nein — nein! Um Himmelswillen, Pauline! Dies Ei stammt von einem vogelartigen Geschöpf, welches vor langen, langen Zeiten auf unserer Erde gelebt hat.«
»Das Ei ist aber noch frisch, dafür garantiere ich Ihnen, Herr Professor! Und nun frühstücken Sie nur erst, und machen Sie ein bißchen Morgentoilette, wenn Sie doch nicht mehr schlafen gehen wollen!« Damit ging sie hinaus.
Der Professor nahm selbst nochmals das Ei zur Prüfung in die Hand.
Kein Zweifel! Das eine Ende war entschieden wärmer als das andere. Pauline hatte recht: es war »noch gut«, Seinem Gewicht nach war es kaum schwerer als ein mittelgroßes Hühnerei — eine Fossilisation des Inhalts erschien also merkwürdigerweise ausgeschlossen! Vielleicht hatte der feine Kalkschlamm des JuraMeeres die Poren der Eierschale so hermetisch verschlossen, daß die Fäulniskeime der Luft keinen Zutritt fanden und der Inhalt konserviert blieb...
Aber dann! — Dann konnte man es ja im Brutofen ausbrüten lassen! Dann war ja das Eiweiß noch lebens- und entwicklungsfähig — trotz des undenkbar langen Zeitraumes, den das Ei im verhärteten Kalkschlamm von Eichstätt eingebettet gelegen! Die Gedanken des Professors Diluvius begannen aufs neue zu kreisen...
Dann hatte er am Ende das unbeschreibliche Glück, einen lebendigen Urvogel, eine leibhaftig fliegende Archäopterix aus dem Wunderei hervorkriechen zu sehen!
Es war ein Glück, daß die alte Pauline längst wieder das Zimmer verlassen hatte und den indianischen Freudentanz nicht sehen konnte, den ihr alter Professor zwischen den Möbeln seines Arbeitszimmers ausführte. »Grauchens« Verwunderung, die abermals in ihrem Schlummer gestört worden war, war vielleicht noch größer — aber sie blieb stumm.
Ein paar Stunden später hatte sich Professor Diluvius durch einen Diener des paläontologischen Instituts einen Brutapparat besorgen lassen, ihn in Betrieb gesetzt und das kostbare ArchäopteryxEi sorglich darin eingebettet. — Wahrscheinlich brüteten die Urvögel der Jurazeit noch nicht selbst ihre Eier aus, sondern überließen dies Geschäft wegen ihrer noch schwachen Befiederung der Allmutter Sonne, so daß ein allzustrenges Einhalten einer genauen Brutwärme auch in der Natur wohl nicht möglich gewesen war. Die einzige Bedingung blieb, eine gewisse o b e r e Temperaturgrenze (etwa 60 Grad) nicht zu überschreiten, weil sonst das Eiweiß gerinnen mußte. Der Brutapparat, der durch eine Lampe erhitzt wurde, regulierte seine Temperatur selbst, nachdem er einmal auf eine maximale Wärme eingestellt worden war. Beim Erreichen dieser zulässigen Höchstgrenze ertönte entweder ein Alarmsignal für den Beobachter — oder der Apparat steuerte automatisch die Wärmezufuhr zurück auf ein geringeres Maß. Die letztere Einrichtung ist die gebräuchlichere. Da aber Professor Diluvius sich selbst mehr Vertrauen schenkte als dem besten Automaten, so hatte er den Apparat auf »Alarm« gestellt, um eventuell selbst die Überschreitung des Maximums zu regulieren. Mit Angst und Sorge dachte er aber schon an die Nachtstunden, wo er seinen unbezahlbaren Schatz schließlich doch der Selbstregulierung des Brutofens überlassen mußte. Einen Augenblick hatte er allerdings den Gedanken gehegt, sich mit seiner Wirtschafterin Pauline in die Zeit von je vierundzwanzig Stunden zu teilen, solange das Ausbrüten dauern würde — aber er wagte nicht, diesen Vorschlag der alten, treuen Seele zu machen, obwohl er für s e i n Teil gern alle Nächte und auch noch den halben Tag gewacht hätte.
Aber ungefähr mußte er sie doch in die Handhabung des Brutofens einweihen. — Er rief sie herein und erklärte ihr kurz die Wirkung des Apparates. Ungläubig lächelnd sah die brave Pauline auf den seltsamen Kasten — und dies Lächeln wurde sogar ein wenig spöttisch, als sie ihren alten Herrn Professor betrachtete, der ihr voller Eifer seinen geheimnisvollen Plan auseinandersetzte.
»Und das Küken soll ganz ohne Glucke aus dem Ei kommen?«
Der Herr Professor nickte.
»Wer pickt ihm denn die Schale auf, wenn es fertig ist, Herr Professor?«
Auch darüber beruhigte er sie und war froh, daß sie wenigstens die Handgriffe verstanden hatte, durch die einer Überschreitung der zulässigen Brutwärme vorgebeugt wurde.
»Und wie lange wird die blecherne Henne zu dem Küken brauchen, Herr Professor?«, fragte sie beim Hinausgehen.
»Wir müssen es abwarten, Pauline. Aber hoffentlich nicht viel länger als eine mit Fleisch und Federn!
Professor Diluvius lebte nur noch für seinen Urvogel. In dem Gedanken an das zu erwartende »freudige Ereignis« vergaß er Essen, Trinken und Schlafen.
Die alte Pauline war in heller Verzweiflung. Vergebens kochte sie ihm die schmackhaftesten Gerichte, vergebens ermahnte sie ihn, im Andenken an die »selige Frau Professor«, seinem alten Körper die nötige Pflege und Ruhe zu gönnen.
Drei Tage und Nächte hatte er so schon hintereinander vor der »blechernen Henne« gesessen. Neben ihm auf dem Tische lag aufgeschlagen die schöne Abbildung der Archaeopteryx lithographica aus den »Paläontologischen Abhandlungen von Dames und Kayser« (Bd. 2, Heft 3, vom Jahre 1884).
»Was für ein kostbares Objekt ist schon dieser prachtvoll erhaltene Abdruck aus dem Solenhofener Schiefer!«, murmelte er. »Das Deutsche Reich hat damals 26 000 Mark für die Erwerbung der Platte mit der Archäopteryx gezahlt — und ich, ich werde der Glückliche sein, der einzige auf Erden, der ein lebendiges Exemplar sein eigen nennt! Wie wird man mich beneiden! Wie werden sie kommen aus aller Herren Ländern, meine lieben, ungläubigen Kollegen, um den Wundervogel zu schauen! Und was werden sie mir bieten, um ihn käuflich zu erwerben! Aber nicht um die Welt soll er mir feil sein! Nicht um alles Gold dieser Erde!«
Mit dieser stolzen Wendung schloß der alte Gelehrte regelmäßig seinen Dithyrambus auf den Urvogel, den die belebende Wärme in stillschaffender Arbeit aus dem Ei hervorlocken sollte. —
Ein leises Schnurren klang durch das Zimmer, und der Herr Professor fühlte gleichzeitig, wie sich »Grauchen« an seinen Knien rieb. Liebkosend strich er ihr über den Rücken; er wollte Versäumtes ein wenig wieder nachholen. Dann aber sagte er:
»Du wirst dich vorläufig gewöhnen müssen, in der Küche zu hausen, liebes ›Grauchen‹! — Zwar bist du eine sehr artige Miesmies — aber ein Raubtier steckt doch in deinem weichen, schönen Fell, und noch dazu eins, das eine besondere Vorliebe für junge Vögelchen hat!«
Grauchen wollte auf seine Kniee springen, um wieder einmal den alten Platz einzunehmen, der ihr jahrelang eingeräumt worden war — aber der alte Herr wehrte ihr, stand auf und öffnete die Tür, um sie hinauszuweisen.
Eben wollte auch Pauline ins Zimmer treten. —
»Liebe Pauline, die Katze müssen wir vorläufig von meinem Zimmer fernhalten; sie ist ja auch in Ihrer Küche gut aufgehoben.«
»Jawohl Herr Professor — wie Sie wünschen! — Herr Professor, ich wollte nur fragen, ob Sie für die nächsten Stunden allein bleiben wollten; ich wollte gern mal meine Verwandten einen Augenblick besuchen —«
»Gehen Sie, gehen Sie, Pauline! Zum Abend sind Sie ja doch wieder hier —«
»Gewiß doch. Dann adieu, Herr Professor!«
Damit ging sie, Grauchen auf den Arm hebend, aus dem Zimmer...
Pauline, die gute, sorgende Seele, war am Ende mit ihrer Weisheit. Heute hatte sie das Unglaublichste erlebt: der Professor hatte sein Leibgericht: Frikassee von Huhn — nicht angerührt! Das k o n n t e nicht gut enden! Und alles wegen des unglückseligen Vogeleies!
Nicht ihre Verwandten suchte sie auf, sondern — den alten Hausarzt ihres Herrn, den Sanitätsrat Hartmann. Ihm schüttete sie ihr altes, treues Herz mit all seinen Sorgen aus: wie vor ein paar Tagen der Herr Professor eine große Steinplatte erhalten habe, wie er Tag und Nacht daran herumgemeißelt, um ein Ei herauszukriegen, das darin gesteckt habe, wie er nun seit drei Tagen und Nächten sich keine Ruhe gönne, kaum einen Bissen esse (nicht einmal sein Leibgericht!), wie er die schöne Graukatze, die der Herr Sanitätsrat ja als ein Vermächtnis der Seligen auch kenne, aus dem Zimmer gejagt habe — — und das alles, um das verwünschte Vogelei, das er in einen geheizten Blechkasten gelegt habe, zum Ausbrüten zu bringen! — Sie schloß ihren Bericht mit heißen Tränen und mit der inständigen Bitte, der Herr Sanitätsrat möchte doch einmal ihrem Herrn ins Gewissen reden, ehe es zu spät wäre!
»Schön, Fräulein Pauline, soll geschehen! Gehen Sie immer voraus, ich werde gleich hinterherkommen. Meine Sprechstunde ist ja ohnehin vorüber, und er soll denken, es handle sich um einen gelegentlichen Besuch, den ich nicht als Hausarzt, sondern als sein alter Freund bei ihm mache!«
Als eine Stunde später Sanitätsrat Hartmann die Tür zum Zimmer seines alten Freundes öffnen wollte, vernahm er schon vorher ein in kurzen Absätzen sich wiederholendes Klingelsignal.
Er trat ein, von Pauline gefolgt, die das Zeichen auch gehört hatte. —
Und — da lag der alte Herr, fest schlummernd — und sein weißgelocktes Haupt ruhte auf dem Bilde der Archäopteryx, das oben erwähnt wurde. So fest schlief er, daß er das schrille Klingeln vom Brutapparat nicht vernommen hatte.
Der Sanitätsrat übersah mit einem Blick die Situation. »Da bin ich wohl doch zu rechter Zeit gekommen!«, murmelte er. Er sah dem Schlafenden scharf ins Gesicht, prüfte seinen Puls und sagte dann:
»Seien Sie ohne Sorge, Fräulein Pauline, ich kenne seine Natur! Er wird im Schlaf alles Versäumte wieder einholen. Wir wollen ihm hier auf der Chaiselongue ein Lager zurecht machen: morgen um diese Zeit ist er wieder ganz auf dem Posten und wohl auch — vernünftiger!«
Dann trat der alte Sanitätsrat an den Brutofen heran... Es gab auch hier manches zu tun — — —
Ungefähr vierundzwanzig Stunden später erwachte Professor Diluvius.
Verwundert schaute er sich um, fand sich auf der Chaiselongue liegend, sorglich mit Kissen und Decken umgeben. —
Einen Augenblick lang irrten seine Gedanken ratlos umher. Da fiel sein Blick auf den Brutofen auf dem Arbeitstische.
Mit der Gewandtheit eines Jünglings sprang er auf und eilte an den Apparat.
Da lag das Ei — unversehrt, und das Thermometer zeigte die vorschriftsmäßige Brutwärme! Der Herr Professor klingelte.
Pauline mußte ganz in der Nähe gewesen sein, so schnell erschien sie.
»Guten Tag, liebe Pauline! Ich habe wohl lange geschlafen?«
»Es geht, lieber Herr Professor! Sie hatten sich wohl ein bißchen auf die Chaiselongue gelegt; ich habe Ihnen dann noch ein paar Kissen gebracht. Als ich von meinen Verwandten kam, da schliefen Sie so schön, daß ich Sie nicht stören wollte. Und da der Brutofen auch in Ordnung war —«
»Ja, richtig, Pauline — ich sehe eben, daß ich den Apparat auf ›Selbstregulierung‹ umgestellt habe, statt auf ›Alarm‹. Wahrscheinlich habe ich gefühlt, daß ich müde wurde, und habe noch zu rechter Zeit die Umschaltung besorgt. Gott sei Dank, daß alles richtig funktioniert hat! Der Apparat ist doch zuverlässiger als ein Mensch. — Und nun, Paulinchen, besorgen Sie mir etwas zu essen! Haben Sie vielleicht noch Frikassee?«
»Jawohl, jawohl, lieber Herr Professor! Gleich sollen Sie es haben — sofort!«
Und strahlend vor Freude eilte sie in die Küche.
Seit ihr alter Herr Professor wieder Frikassee aß, sorgte sich die gute Pauline nicht mehr um ihn. Und auch er selber hatte den Paroxismus der ersten Tage überwunden, seit er sich überzeugt hatte, daß man sich auf die automatische Regulierung des Brutapparates sicher verlassen konnte.
Erschien er so äußerlich als derselbe kühle und bedächtige Gelehrte wie sonst, so war doch sein Inneres von der aufgehenden Sonne seiner großen Hoffnung erhellt und verklärt!
So gingen die Tage in ruhigem Gleichmaß — und aus den Tagen wurden Wochen...
Am Nachmittage des vierundzwanzigsten Tages saß der Professor Diluvius in seinem Arbeitszimmer. Es war ein schwüler Tag, und die Julisonne mit ihrer Glut machte schläfrig. — —
Ein leichter Halbschlaf, ein Träumen mit offenen Augen hatte seine Sinne gefangen genommen. Ihm war es, als schöben sich die tapetengeschmückten Wände seines Zimmers auseinander — eine endlose Ferne öffnete sich, und ein Weg lag vor ihm in ein weites grünes Tal. Seltsame Pflanzen überragten in treibhausartiger Fülle und in wunderlichgrotesken Formen den Pfad. Zu seinen Füßen webte und lebte es und in dem Urwalddickicht regte und bewegte es sich von phantastischen, niegesehenen Lebewesen.
Plötzlich fiel ein gleitender Schatten auf seinen Weg.
Ein fliegendes Geschöpf schwang sich von einem der seltsamen Baumstämme hinüber zum andern.
Metallisch grün glänzte sein Gefieder, besonders der lange, wie ein Palmwedel geformte Schwanz. Nun flog das seltsame Wesen dicht über dem Haupte des Wandernden hinweg und hängte sich an einen der kandelaberartig verzweigten Stämme.
Da hing es mit zusammengeschlagenen Flügeln — an den langen, scharfen Krallen, die aus den Schwungfedern dicht am Flügelgelenk hervorragten. Und als es jetzt den Schnabel öffnete, um eine erhaschte Beute zu verspeisen, zeigten sich deutlich darin die spitzen, weißen Zähne.
»Archäopteryx!«, kam es unbewußt von den Lippen des Gelehrten.
Und noch in die letzten Sekunden seines Halbtraumes hinein tönte — ein scharfes Klirren, wie von plötzlich zerbrechendem Glase!
Professor Diluvius fuhr empor. Eben huschte ein Schatten an seinem noch halb geschlossenen Auge vorbei.
War sein Traum beglückende Wirklichkeit geworden? Er stürzte nach dem Brutapparat — da lag die zerbrochene Eierschale, die das ausgeschlüpfte Geschöpfchen abgestreift. — Wo aber war es? — Und wie hatte es die Glasscheiben des Apparats zerbrechen können?
In fieberhafter Eile durchsuchte er alle Ecken und alle Schlupfwinkel seines Studierzimmers — umsonst!
Er kroch in den Kamin — Auch da nichts.
Er stellte einen Stuhl auf den Tisch und untersuchte die Aufsätze seiner Spinden und die Falten der Stoffgardinen — Alles vergebens!
Da — unter der Chaiselongue — ein Geräusch!
Schnell faßte er zu —
Und seine zitternden Hände fassen — fassen — »Grauchen«, die Hauskatze, die sich unbemerkt eingeschlichen hat!
Sie leckt sich noch die blutige Schnauze — —
Einen Augenblick steht Professor Diluvius starr wie eine Bildsäule. Die weißen Locken ringeln sich wie Medusenhaare um seine marmorblassen Züge. Dann aber kehrt ihm Leben und Besinnung zurück. Seine grauen Augen sprühen Blitze! In namenloser Wut packt er jetzt die Übeltäterin im Genick. Wie ein Rasender stürmt er umher.
»Pauline«, ruft er, heiser vor Aufregung, »Pauline!«
Pauline stürzt entsetzt ins Zimmer.
»Die Bestie — hat sich hier eingeschlichen — hat die Glasscheibe des Brutofens eingedrückt — und — meine — eben — ausgebrütete Archäopteryx — g e f r e s s e n ! «
In einzelnen Absätzen hat er die Worte hervorgestoßen. — Und halb wahnsinnig vor Enttäuschung und Erbitterung setzte er hinzu:
»Ich werde das heimtückische Vieh töten und sezieren, um wenigstens die zermalmten Überreste meines kostbaren Urvogels zu retten!«
Und er schüttelt Grauchen, die sich vergebens aus den eisernen Klammern seiner Hände zu befreien sucht.
»O, du Bestie, du vermaledeite, hinterlistige Bestie! Das sollst du mir büßen! Das sollst du mir büßen!«
Pauline stand mit gefalteten Händen vor dem Wütenden.
»Herr Professor, lieber, guter Herr Professor —«
»Auch Sie haben Schuld, Pauline! Warum haben Sie nicht besser acht gegeben auf das schändliche Vieh? — Meine Archäopteryx, meine Sehnsucht, mein Traum und meine Hoffnung — die Frucht aller meiner wochenlangen Mühen und Sorgen! Das Geschenk ungezählter Jahrtausende, mir beschert durch die Gunst des Geschicks — gefressen von — einer mordlustigen Katze!«
Er trat an den Apparat.
»Da liegen die Scherben meines Glückes! Tausende hätten mich beneidet um diesen Schatz — und nun« — —
»Herr Professor —«
»Zu denken, daß es glücklich ausgebrütet wurde — daß es lebte! Und ich habe es nicht einmal lebend gesehen! Nicht lebend gesehen! O meine Archäopteryx!« — —
»Herr Professor, lieber guter Herr Professor«, begann Pauline wieder, und aus den Augen der treuen Dienerin rollten die Tränen — »hören Sie mich an: Es war gar nicht das Ei von dem unaussprechlichen Vieh, das — Sie ausgebrütet haben.« —
Professor Diluvius ließ die Katze los und starrte seine Köchin mit weit aufgerissenen Augen an.
»Herr Professor«, fuhr Pauline fort — »schon vor drei Wochen, als sie einmal so sehr fest eingeschlafen waren, ist d a s entzweigegangen! Der Herr Sanitätsrat war gerade hier, um Sie zu besuchen. Er sagte, die Hitze in dem Blechkasten wäre zu groß geworden. Weil er aber fürchtete, daß der Ärger über den Verlust Ihnen schaden könnte, hat er ein anderes Ei mit Tinte betüpfelt und in den Brutkasten gelegt. Der Vogel, der heute ausgekommen ist, war — eine E n t e ! «
»Und ich mag nicht!«
»Aber, Mabel, warum nicht?«
»Weil ich nicht mag!«
»Das ist aber doch kein Grund für meine kluge Freundin.«
»Grund genug. Und nun laß, bitte, deine gutgemeinten Ratschläge, liebste Gertrude, sonst zanken wir uns noch seinetwegen.«
»Aber er ist ein so lieber, ernster, seltener Mensch. Ich zitiere nur eine Zeile aus deinem ersten Briefe, liebe Mabel, den du mir damals von hier, gleich nach deiner Anstellung im Institut, nach Onkels Gut sandtest, und er hat dich gewiß recht lieb.«
»Das weiß ich und das sage ich noch heute«, entgegnete Mabel. »Aber ist das ein zwingender Grund für mich, seine Werbung anzunehmen? Ich bin früh selbständig geworden und brauche niemand!«
»Aber das stille, treue Werben eines solchen Mannes —«
»Fängst du schon wieder an? Nun ist's aber genug, hörst du?«
Die zierliche Brünette mit den hellbraunen Augen schwieg ein Weilchen, dann begann sie von neuem mit schelmischem Lächeln:
»Schade, schade, daß ihr beide nicht zusammen kommen sollt, die ihr doch so gut zusammen paßt!«
Mabel machte eine abwehrende Bewegung.
»Wenn du auch den Kopf schüttelst, Liebste, es ist doch so. Er ernst und ruhig — du auch; er groß und schlank — du auch; er klug und weise — du auch; er Chemiker vom Fach — du auch; er erhaben über die Torheiten anderer Menschenkinder meines Schlages — du auch — —«
»Hör' auf, hör' auf, Gertrude; deinen Spott habe ich nicht verdient.«
»Verzeih'!« Gertrude zog die Freundin zu sich herab und küßte sie. Darauf sagte sie:
»Lassen wir beide also den Herrn Privatdozenten Dr. Bartholomäus Schlichtmann da, wo er am liebsten weilt, bei seinen Retorten und Chemikalien, liebste Mabel! Du sagtest ja schon vorhin, bei meinem Eintritt ins Laboratorium, daß du für heute fertig seiest, und daß das übrige bei deiner Arbeit die Elektronen über Nacht besorgen würden, nicht? — Also komm, meine fleißige Mabel, draußen ist es Lenz, und du sollst sehen, der Lenz in Berlin ist wunderschön in seinem ersten Grün! Und gibt es bei uns auch keinen Hydepark, so haben wir doch einen Tiergarten, und er wimmelt jetzt genau so von fröhlichen, geputzten Menschenkindern, von glänzenden Karossen und leider auch von mißtönenden und mißduftenden Autos, wie wahrscheinlich dein gepriesener Hydepark! Komm! Dir zulieb will ich heute mein bestes Englisch hervorsuchen und zwei Stunden lang kein liebes, deutsches Wort aus meinem Munde gehen lassen, damit dir ein wenig heimatlicher zumute wird. Das ist doch lieb von mir, gelt?«
Miß Mabel sah ihre Freundin mit weichem Ausdruck an.
»Du kannst immer deutsch sprechen, liebe Gertrude! Ich liebe euer Deutschland, eure deutsche Wissenschaft und Kunst, und ich fühle mich gar nicht so heimatlos, als du glauben magst. Aber nun komm — ich will euren Frühling sehen, ich sehe ihn ja zum erstenmal!«
Damit streifte sie schnell den leinenen Schutzkittel ab, den sie im Laboratorium trug, säuberte sich ein wenig, strich ihre Frisur zurecht und setzte den Hut auf.
Ihre Freundin Gertrude hatte unterdes in dem Manuskript geblättert, das auf dem Arbeitstische der jungen Engländerin lag.
»Puh — was für vertrackte Formeln und Zeichen, sag' einmal, verstehst du denn das alles?«
»Ich hoffe doch, Gertrude.«
»Na — ich bekäme nichts in den Kopf davon — auf Ehre! Diese kuriosen Ausdrücke! Hier lese ich immer ein solch drolliges Wort in deiner Arbeit: Katalyse — was ist denn das?«
»Natürlich«, entgegnete Mabel belustigt, »du Unglückskind triffst gerade eine Sache, von der wir Chemiker noch wenig wissen, das heißt, was ihr eigentliches Wesen betrifft; was sie für die chemischen Vorgänge bedeutet, ist uns allerdings bekannt, und meine Arbeit beschäftigt sich eben mit einer Reihe katalytischer Prozesse unter Verwendung des Wasserstoffsuperoxyds; aber das verstehst du ja doch nicht, kleine Gertrude —«
»Nein, nein, laß nur!«, sagte diese, deren Augen ein Weilchen mit Interesse auf einer Stelle des Manuskripts geruht hatten, »ich weiß genug.«
»So schnell, Kleine?«
»Ja, so schnell, meine kluge Mabel! Und nun wollen wir gehen!«, setzte sie mit einer eigentümlichen Hast hinzu.
Die beiden Freundinnen schritten dem Ausgange zu.
»Eigentlich müßte ich doch erst Herrn Dr. Schlichtmann Bescheid sagen, der Ordnung wegen«, sagte Mabel stehenbleibend.
»Geniert's dich, Mabel? Ich werde es ihm an deiner Stelle sagen, du erlaubst doch?«
Damit öffnete sie die Tür zum Laboratorium des Dozenten.
»Ich gehe unterdes die Treppe hinab, beeile dich«, hörte sie noch die Freundin sagen.
Nach einem Weilchen traf sie wieder mit Mabel zusammen, die unten am Portal wartete.
»Du bliebst ja so lange?«
»Findest du? Er hielt es wohl für seine Pflicht, mir ein paar höfliche Worte zu sagen, und die mußte ich doch anhören. Und nun komm!«
Dr. Schlichtmann stand in seinem Laboratorium. Auch er arbeitete an einer Versuchsreihe über die — Katalyse, und zwar hatte er namentlich die katalytische Wirkung des feinverteilten Platins bei der Bildung von Säuren einer neuen, fruchtbaren Untersuchung unterworfen.
In diesen Augenblicken aber beschäftigte ihn im stillen eine sehr persönliche Angelegenheit. Der kluge Gelehrte trug seit Monaten eine tiefe Neigung zu der ersten Assistentin des Chemischen Instituts im Herzen. Es war bei ihm nach dem Sprichwort gegangen: Gelegenheit macht Liebe — er hatte sich ehrlich gewehrt gegen das Gefühl, das vom ersten Augenblick an in ihm für Mabel Whitestone wachgeworden war, umsomehr, als er von ihr keinerlei Aufmunterung empfing.
Sein Gefühl sagte ihm, daß all sein Werben um die Geliebte wohl aussichtslos bleiben werde — und doch horchte er jeden Morgen mit klopfendem Herzen auf ihren raschen, elastischen Schritt, wenn sie in das kleine Laboratorium neben dem seinen trat, und seine Hand zitterte, wenn sie bei irgendeiner Manipulation als Assistentin die seine berührte. Er litt körperlich und geistig unter diesem Zustande und sagte sich, daß es so nicht weiter gehen könne. Aber was sollte geschehen?
Eben klang ihr Schritt in der Nähe seiner Tür. Merkwürdig, er war heute noch leichter und schneller als sonst! Er öffnete die Tür, um seiner schönen Assistentin einen »Guten Morgen« zu bieten.
Er stutzte.
Es war nicht Mabel, es war die junge, anmutige Dame, die schon gestern ihm an ihrer Stelle eine Bestellung überbracht hatte.
»Verzeihung, Herr Doktor! Meine Freundin, Miß Mabel, sendet mich, um sich noch für ein Stündchen entschuldigen zu lassen, eine Landsmännin, eine Studiengenossin vom SmithsonianCollege, suchte sie auf, gerade, als sie sich hierher begeben wollte, ich habe sie ein Stück begleitet.«
»O, das ist schade! Ich hatte gerade heute auf Miß Mabels Assistenz gerechnet, schade! Die Studenten haben noch Ferien, sonst könnte ich mir einen der angehenden Chemiker aus dem Laboratorium holen, und den Institutsdiener habe ich soeben mit einem Auftrage weggeschickt, schade! Und Hilfe müßte ich schon haben, der Mensch ist leider nur ein Zweihänder! Und ich habe schon alles vorbereitet, sehen Sie dort, gnädiges Fräulein!«
Er wies auf die Apparatenanordnung auf einem der Experimentiertische.
»Herr Doktor — könnte ich nicht — so lange, bis meine Freundin kommt — ich habe zwar gar keine chemischen Kenntnisse — aber Ihren Laboratoriumsdiener hoffe ich doch ersetzen zu können — —«
»Sehr liebenswürdig, mein gnädiges Fräulein! Aber — ich weiß doch nicht — es handelt sich allerdings nur um ein paar Handgriffe —«
Gertrude lächelte. »Die werden Sie mir doch zutrauen, Herr Doktor, — ich helfe Ihnen so gern —«
»Und ich nehme Ihre freundliche Hilfe mit Dank an! Also — bitte, kommen Sie — sehen Sie! Hier an diesem Apparat —«
»Meinen Hut und mein Jackett darf ich doch erst —«
»Aber selbstverständlich! Verzeihen Sie! Darf ich ein wenig behilflich sein?«
»Ich danke, Herr Doktor!«
Und schon stand sie an seiner Seite. Der Privatdozent warf einen Blick auf Ihr hellfarbiges Promenadenkostüm.
»Erlauben Sie, gnädiges Fräulein, aber es ist doch besser, wenn Sie einen Schutzkittel anlegen — erlauben Sie —«
Damit nahm er seinen solchen aus einem Spind und half ihr beim Hineinschlüpfen.
»So«, sagte er lächelnd, »der paßt Ihnen ja ganz gut und kleidet Sie vortrefflich. Und nun lassen Sie uns anfangen! Sehen Sie hier zunächst diesen Taster; er schließt beim Niederdrücken einen Stromkreis, in welchen die auf ihre wachsende Leitfähigkeit für den elektrischen Strom zu untersuchende Substanz eingeschaltet ist, eben die Substanz, welche sich mit Hilfe der Katalyse bildet; Katalyse nennen wir — doch, was soll ich Ihnen den Kopf mit unsern chemischen Definitionen heiß machen, gnädiges Fräulein — was kümmert Sie die Katalyse? — Also diesen Taster bitte ich niederzudrücken, so oft die dort stehende Signaluhr ein Zeichen gibt, und dabei gleichzeitig den Ausschlag der Nadel hier am Galvanometer zu beobachten und die Ablesung zu notieren. Ist es Ihnen verständlich? Wollen Sie, bitte, einmal einschalten — die Uhr wird im Moment das Zeichen geben — und die Grade ablesen?«
Gertrude tat, wie ihr geheißen, mit etwas Herzklopfen freilich, und sie konnte es auch nicht verhindern, daß ein heißes Erröten ihr Stirn und Wangen färbte.
»Nun, welche Ablesung würden Sie jetzt notieren, gnädiges Fräulein? Die Teilstriche bedeuten Zehntelgrade.«
»Vier und drei Zehntel Grad.«
»Richtig, schön! Ich sehe, ich kann mich auf Sie verlassen. Und nun — jeder an seine Arbeit! Mein Platz ist dort«, er zeigte auf einen kompliziert gebauten Destillationsapparat an der andern Seite des Zimmers.
Mit einer Verbeugung ließ er die neu eingekleidete Assistentin allein und schritt an seinen Arbeitsplatz. Still und aufmerksam saß Gertrude und achtete mit peinlicher Gewissenhaftigkeit auf die Signale. So gingen die Minuten, und so war eine Stunde vergangen, als sie mit einem leichten Aufschrei die Hand vom Taster zurückzog.
»Was war dort?«, fragte Dr. Schlichtmann, immer noch seine Aufmerksamkeit auf seinen Apparat richtend.
»Eine bläuliche Flamme zuckte eben hier auf.«
Er war hinzugeeilt.
»Ein kleiner voltaischer Bogen! Sie haben wahrscheinlich den Taster nicht ganz bis zum Anschlage heruntergedrückt. Haben Sie sich verbrannt? Darf ich einmal sehen?«
»O, es ist nichts«, sagte sie, ihm die Hand entziehend.
»Es ist doch etwas! Zeigen Sie, bitte! Freilich — eine Brandblase! Warten Sie, für solche kleinen Laboratoriumsunfälle haben wir hier schnell Abhilfe.«
Er entnahm einem Wandschränkchen einen präparierten Verbandsstoff und riß einen Streifen davon ab.
»Und nun zeigen Sie mir noch einmal das kleine Malheur, gnädiges Fräulein!«
Mit geschickter und schonender Hand legte er um den mit einer Brandblase bedeckten Finger den Verband.
In diesem Augenblicke trat Miß Mabel ins Laboratorium.
Ihr erstaunter Blick fiel auf die beiden, auf Dr. Schlichtmann, der sich sorgsam zu ihrer Freundin Gertrude herabgebeugt hatte, und auf Gertrude, die mit einem hingebenden Ausdruck zu ihm aufschaute.
Sie wußte nicht, wie es kam, aber sie empfand ein sonderbares, unangenehmes Gefühl, etwas wie einen Schmerz, bei diesem Anblick.
Dr. Schlichtmann sah auf.
»O schön, daß Sie kommen, Miß Mabel! Ihre liebenswürdige Freundin hat Sie bisher tapfer und geschickt vertreten und hat sich auf dem Felde der Wissenschaft auch schon die erste Blessur geholt, eine kleine Brandwunde. Aber nun«, er wandte sich zu Gertrude, »nun haben Sie tausendmal Dank, daß Sie mir so brav assistiert haben, gnädiges Fräulein! Und es tut mir so leid, daß Sie Ihre liebenswürdige Bereitwilligkeit gleich mit einem Schmerz bezahlen müssen.«
Lächelnd wehrte Gertrude seinen Dank ab. »Ich habe es meiner Freundin zuliebe getan, Herr Doktor!«, sagte sie einfach. Sie entledigte sich mit Mabels Hilfe schnell des Laboratoriumskittels, dann sagte sie:
»Und nun darf ich wohl gehen! Adieu, Herr Doktor! Adieu, meine liebe Mabel, laß dich mein Beispiel lehren und nimm dich hübsch in Acht! Aber dich braucht man ja wohl nicht zu warnen vor plötzlichen Blitzstrahlen und heimlichen Flammen, nicht wahr?«
Damit war sie zur Tür hinaus.
Es war still zwischen den beiden, Dr. Schlichtmann und Mabel Whitestone. Mechanisch verrichtete jeder seine Arbeit.
Mabel war unruhig, warum — hätte sie wohl selbst kaum zu sagen vermocht. Beim Eintreten war ihr einen Augenblick der Gedanke gekommen, daß sie dem Augenscheine nach hier völlig überflüssig sei, daß sie wahrscheinlich dem Herrn Privatdozenten bei seiner Arbeit gar nicht gefehlt, und daß sich ihre muntere Freundin Gertrude als ihre Stellvertreterin offenbar geschickt gezeigt habe.
Und auch über Dr. Schlichtmann war sie verstimmt. Er hätte ihr doch ein Wort gönnen können! Sonst hatte er doch stets mit ihr geplaudert; was hatte er nur heute?
Ob sie ihn selbst anredete?
Und eben schickte sie sich an, ihm von ihrer Landmännin Annie Seymour zu erzählen, welche sie heute früh aufgesucht hatte, und von deren Arbeit mit Professor R... in London, als er selbst das Schweigen unterbrach.
»Kennen Sie Ihre Freundin, Fräulein, — ich weiß allerdings noch gar nicht ihren Familiennamen, also Fräulein Gertrude meine ich, schon lange, Miß Mabel?«
»Gertrude Kröning ist eine Reisebekanntschaft, die ich im vorigen Jahr machte.«
»Es ist mir interessant, Miß Mabel, daß Sie, die gewiß schwer mit jemand vertraut wird, sich so leicht und so innig an diese Dame angeschlossen haben.«
»O, das ist kein Verdienst von mir, sondern von meiner Freundin! Gertrude fand mich im Vorjahre auf dem halben Wege zur Blümlisalp, wo ich mich verstiegen, und eine Nacht und einen halben Tag kraftlos, mit einem verstauchten Knöchel, liegen geblieben war.«
»Und ihre Führer?«
»Die hatte ich ja nicht! Das war mein Ehrgeiz oder mein Eigensinn, daß ich allein das Ziel erreichen wollte.«
»Und Fräulein Gertrude fand Sie zufällig?«
»Ja, mit einer Gesellschaft kam sie in meiner Nähe vorüber und hörte meine Hilferufe, fand mich auf, rettete mich, führte mich hinab ins Tal, brachte mich zu Bett und pflegte mich, als ich tags darauf vor Aufregung und Erschöpfung in ein gefährliches Fieber fiel.«
»Also wie im biblischen Gleichnis vom barmherzigen Samariter?«
»Gerad so.«
»Nur daß die Räuber und Mörder fehlten.«
Sie lächelte, dann fuhr sie fort:
»O, die kamen diesmal hinterher, in meinen Fieberphantasien! Da war es mir immer, als läge ich noch hilflos in der Bergschlucht, und allerlei entsetzliche Gestalten, halb Menschen, halb Ungeheuer, drängten sich in meine Nähe.«
»Schauderhaft!«, rief Dr. Schlichtmann. »Aber ich kenne das auch, ich habe auch einmal im Wundfieber solche angenehmen Geschichten zusammenphantasiert.«
»Und da sah ich immer in lichten Augenblicken das liebe Antlitz meiner Gertrude über mir und hörte ihr freundliches Zureden und fühlte ihre weiche, kühle Hand, sie hat so wundervoll kühle Hände.«
»Ja, das habe ich heute auch bemerkt, als ich ihr den kleinen Verband anlegte«, flocht Dr. Schlichtmann ein.
Mabel verstummte. Der Moment trat wieder vor ihre Seele, als sie die beiden heute miteinander gesehen.
»Nun, und«, — fragte Dr. Schlichtmann.
Mabel zwang sich zum Weiterreden.
»Ja, und so hat sie mich gepflegt, tagelang, wochenlang, hat meinetwegen ihre Sommerreise unterbrochen, bis ich wieder genesen war und mit ihr auf das Gut ihres Onkels fahren konnte, um mich vollends zu erholen.«
»Das nenne ich eine Freundin! Miß Mabel, Sie können stolz auf diese Bekanntschaft sein; wahrlich, um einen solchen Menschen sind Sie zu beneiden, um die Liebe eines solchen Menschen —«
Ein Geräusch unterbrach ihn, wie von zischendem Dampfe.
»Was ist?«, rief er.
»Der Destillationsapparat ist undicht geworden, Herr Doktor, da, sehen Sie!«
Mabel wies auf einen feinen Dampfstrahl, der dem kupfernen Schlangenrohr entströmte.
»Schnell verstopfen!«, und er eilte hinzu.
Miß Mabel war schneller. Mit geschickter Hand versuchte sie die undicht gewordene Stelle durch Umlegen von Asbestband zu schließen. Wohl zischte der siedendheiße Dampf ihr um die Finger, aber es gelang ihr.
»Gott sei Dank, das hätten wir geschafft!«, rief Dr. Schlichtmann. »Haben Sie Dank, Miß Mabel. Hoffentlich haben Sie sich dabei nicht verbrannt?«
»Es ist nicht so schlimm, Herr Doktor.«
»Sie haben ja ›feuerfeste Finger‹, ich weiß es, sonst hätten wir heute hier die zweite Verbrennung. Aber sie wissen ja in solchen Fällen sich selbst schon zu helfen, und hier steht ja noch die Büchse mit Brandpflaster, wenn Sie sich bedienen wollen.«
»Ich danke, Herr Doktor! Aber ich möchte Sie bitten, mich für heute etwas früher zu verabschieden, meine Freundin vom SmithsonianCollege hat mich —«
Sie sprach sehr hastig, ihre Worte überstürzten sich fast.
»Gehen Sie, Miß Mabel, gehen Sie, bitte! Ich will nur noch diesen Versuch abschließen, und das kann ich ja allein. Empfehlen Sie mich, bitte, Ihrer liebenswürdigen Freundin, Fräulein Gertrude! Adieu!«
»Adieu, Herr Doktor.«
Mabel ging. Draußen vor der Tür des Instituts preßte sie die schmerzende Rechte mit den arg verbrannten Fingern gegen die Lippe. Ein heißes Wehgefühl wollte sie übermannen. Und wieder dachte sie an die Szene bei ihrem Eintritt in das Laboratorium.
Wie hatte er da sorglich und behutsam Gertrudes Hand verbunden!
Für sie aber waren nur ein paar oberflächliche Worte des Bedauerns gefallen: »Sie wissen sich ja selbst zu helfen, und hier steht die Büchse mit Brandpflaster, wenn Sie sich bedienen wollen.«
Es war gewiß alles so, wie es sein mußte, es war heute nicht anders als gestern, es war gewiß alles nur Torheit von ihr, und doch sah sie heute alles anders, so, als wäre es mit einem Male hell um sie geworden, hell von einem herniederfallenden Lichte; aber dieses Licht schmerzte sie, und es raubte ihr die alte, unbefangene Sicherheit, es zeigte alles um sie her in anderer Beleuchtung.
Sie ertappte sich zum ersten Male auf einem Gefühl des Neides gegen Gertrude.
Noch gestern hätte sie geglaubt, es koste sie, wenn sie wolle, nur ein Wort, ja nur einen Blick, Dr. Schlichtmann zu gewinnen.
Und heute! Heute hatte er kaum einen Blick, viel weniger ein Wort für sie gehabt; denn im Grunde hatte all sein Interesse von heute nur Gertrude gegolten, und auch sein Gespräch hatte sich nur immer um sie gedreht! Sie schüttelte das ihr unbekannte, häßliche Gefühl ab, aber sie konnte es nicht hindern, daß ihr heute etwas mit bitterer Deutlichkeit zum Bewußtsein kam:
Daß sie einsam war und heimatlos.
Am nächsten Tage, kurz vor ihrem Gange ins Laboratorium, erhielt Mabel Whitestone von Gertrude folgendes Billet:
»Berlin W., Landgrafenstr. 3.
Liebste Mabel!
Seit gestern abend glaube ich an einen neuen Gott. Sein Name heißt: Zufall! Und wenn ich nun wie Du klassisch angehaucht wäre und bei einer solchen Gelegenheit, wie Du Euren Shakespeare, unseren Schiller zitieren wollte, könnte ich tiefsinnig aus dem Wallenstein hinzusetzen:
›Es gibt keinen Zufall,
Und was uns blindes Ungefähr nur dünkt,
Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen.‹
Meinetwegen mag es auch so sein!
Aber daß Dr. Bartholomäus Schlichtmann gestern abend aus den ›tiefsten Quellen‹ zu mir gestiegen wäre, wird mir schwer zu glauben. Doch zur Sache.
Gestern abend war ich wieder einmal im Lessingtheater. Du weißt, ich bin gern und oft dort, und wenn ich auch nicht auf Hauptmann und Sudermann eingeschworen bin, so lasse ich doch ein Ibsenstück selten vorübergehen. Gestern ging der ›Volksfeind‹ neu einstudiert in Szene. Du hast mich ja schon immer mit meiner Schwärmerei für Albert Bassermann geneckt; aber er übertraf sich gestern selbst! O, wie liebe ich diese Idealisten, wie diesen Dr. Thomas Stockmann! Diese echten Adelsmenschen! Doch ich sehe schon Dein stolzes Antlitz spöttisch lächeln,
Du denkst, daß diese meine Vorliebe gar nicht so objektiv sei, sondern subjektiv zum größeren Teile dem Träger der Rolle gelte — ich schweige schon, Sittenrichterin!
Aber um auf den Zufall zu kommen! Ich hatte einen famosen Parkettplatz, nicht zu nah und nicht zu fern der Bühne, und war schon ziemlich früh gekommen. Das Theater füllte sich schnell, aber der Parkettsitz mir zur Linken blieb leer.
Er war also vorausbestellt; aber sein Inhaber schien im letzten Augenblick verhindert zu sein. Ich dachte schon im stillen, wie schön es gewesen wäre, wenn Du den leeren Platz neben mir hättest einnehmen können, und schalt ein wenig auf Deine Landsmännin Annie Seymour, daß sie Dich auch noch für den Abend in Beschlaggenommen hatte. Der Platz blieb leer. Das Zeichen zum Beginn ertönte, und im Zuschauerraum wurde es finster. Da, im Moment des Verdunkelns, ließ der Türschließer noch jemand herein, der im raschen Schritt sich durch die Reihe drängte und den Platz neben mir einnahm.
Dieser jemand war — ein Herr. Und dieser Herr war — Dr. Bartholomäus Schlichtmann!
Im ersten Augenblick war ich so konsterniert, daß ich wahrscheinlich ein äußerst dummes Gesicht gemacht habe. Dieses und die mangelnde Beleuchtung waren schuld, daß er mich nicht erkannte. Und so saß ich denn den ganzen ersten Akt neben ihm und freute mich auf den Zwischenakt, wo es wieder hell werden würde.
Und es wurde hell, und er sah, wer neben ihm saß. Und nun kam die Reihe, zu erstaunen, an ihn. Und auch er pries den glücklichen Zufall, der uns hier zusammengeführt. Und ich fand es nett von ihm, daß er sich gleich nach meiner in seinem Laboratorium verbrannten Hand erkundigte. ich beruhigte ihn und zeigte ihm, daß ich ohne Schmerz den Handschuh darauf tragen konnte. Und dann sprachen wir von allerlei: vom Theater im allgemeinen und von Ibsen im besonderen; und es stellte sich heraus, daß auch er diesen ernsten Erzieher zur Lebenswahrheit und Lebenshoheit liebt. — Dann nahm uns das Stück wieder gefangen, und dann plauderten wir wieder, und so verging im Wechsel der Abend.
Meine hohe Meinung von Dr. Schlichtmann ist seit gestern Abend nur noch gestiegen. Er ist kein ›Fachmann‹ der landläufigen Art; er hat einen universellen Zug in seiner Bildung, und das, was er über Ibsens Bedeutung für uns moderne Menschen sagte, war mir aus der Seele gesprochen. Und auch er hält große Stücke von Bassermann und rühmt die geniale Gestaltungskraft dieses Künstlers.
Nach Schluß des Theaters war er mir ein wenig behilflich, Mantel und Hut zu erobern. Dann war er noch so liebenswürdig, mir eine Droschke zu besorgen und verabschiedete sich mit dem Wunsche des Wiedersehens. — Ich unterschreibe jetzt aus eigener Erfahrung Dein Urteil über ihn: Ein lieber, ernster, seltener Mensch!
Man muß ihm gut sein! Unwillkürlich wird man ihm so vertraut.
Doch was langweile ich Dich damit!
Merkwürdigerweise haben wir den ganzen Abend kaum einmal von Dir gesprochen; nur flüchtig erwähnte Dr. Schlichtmann, daß auch Du Dir heute kurznach mir eine kleine Brandwunde geholt hättest, es sei aber nicht von Belang.
Sonst, wie gesagt, nichts von Dir. Doch Du wirst Dir wohl deshalb keine grauen Haare wachsen lassen; es wäre auch schade um Dein schönes Blond!
Das ist doch ein langer Brief, nicht? — Und nun — es ist nachts ein Uhr, ich will zu Bett gehen. Vielleicht hole ich Dich morgen wieder aus dem Laboratorium ab. Also, auf Wiedersehen, liebste Mabel!
Deine Gertrude.
P.S. Ich finde, er hat wunderschöne Augen; man muß sie nur nah genug betrachten können. D.O.«
Mabel starrte noch immer auf das Blatt. Wieder empfand sie das seltsame Gefühl von gestern! Im ersten Ansturm beschloß sie, heute nicht in das Laboratorium zu gehen. Mochte Gertrude sie dort auch vergebens suchen! Vielleicht konnte sie wieder seine Assistentin spielen, wie gestern! Vielleicht war ihr das ganz erwünscht. —
Und wieder stieg die Empfindung des Verlassenseins in ihr auf, heiß und schmerzend, bis ihre Augen sich verschleierten.
Aber da dachte sie an ihre Arbeit über die Katalyse. Sie durfte sie nicht versäumen! Und sie machte sich auf den Weg. Unterwegs nahm sie sich vor, heute in ihrem kleinen Laboratorium zu bleiben. Dr. Schlichtmann würde ihre Assistenz ja entbehren können. Mit diesem Vorsatz betrat sie ihren Arbeitsraum.
Auf dem Experimentiertische schimmerte ihr etwas Weißes entgegen. Eine Visitenkarte von Dr. Schlichtmann mit den flüchtig hingeworfenen Worten:
»Bin ein paar Stunden verhindert; bitte, so lange hier nach dem Rechten zu se
hen.«
Sie atmete auf. Ordentlich leicht wurde ihr zumute, daß sie einige Stunden allein mit sich und ihrer Arbeit sein konnte. Schnell schlüpfte sie in ihr Arbeitsgewand und begab sich an ihr Tagewerk. Es gelang ihr, ihre frühere unbeeinflußte Stimmung zurück zu gewinnen und wie sonst nur an ihre Arbeit zu denken.
Drei Stunden später näherten sich dem Eingange des Chemischen Instituts von verschiedenen Seiten ein Herr und eine Dame.
Der Herr war Dr. Schlichtmann, die Dame Gertrude Kröning.
Kurz vor dem Portal erkannten sie einander.
»Guten Morgen!«
»Guten Morgen!«
»Gut bekommen?«
»Danke! Ihnen doch auch? — Aber wie kommt es, Herr Doktor, daß Sie um diese Zeit sich nicht im Laboratorium befinden?«
»Ich hatte eine offizielle Abhaltung; ich habe aber Miß Mabel benachrichtigt, die also von uns dreien die einzige ist, welche bis jetzt ihren Tag nicht verloren hat, — oder sind Sie auch schon fleißig gewesen, gnädiges Fräulein?«
»Nein, nein! Ich habe gestern abend noch einen langen Brief an Mabel geschrieben und bin erst gegen ein Uhr zur Ruhe gegangen. Dafür habe ich heute morgen ein bißchen länger geschlafen, ausnahmsweise; ich bin sonst keine Langschläferin, Herr Doktor.«
»Nein, so sehen Sie auch nicht aus! Aber da sind wir ja!«
Er öffnete die Tür und ließ Gertrude vorangehen. Sie stiegen nebeneinander die Treppe empor, und eben wollte Gertrude die letzten Stufen betreten, die zur Tür von Mabels Laboratorium führte, als ein heftiger Knall ertönte!
Der Eindruck war so plötzlich und so überwältigend, daß Gertrude vor Schreck einen Moment die Besinnung verlor und die Treppe hinabgestürzt wäre, wenn nicht Dr. Schlichtmann sie in seinen Armen aufgefangen hätte. Einen Herzschlag lang ruht sie an seiner Brust — mit geschlossenen Augen.
In diesem Augenblick öffnete Miß Mabel die Tür.
Dr. Schlichtmann sah auf. Mit geisterblassem Antlitz stand sie im Rahmen der Tür und starrte auf die beiden. Ihr Haar, ihr Gewand waren mit Glassplittern übersät.
Sie stieß einen Schrei aus, in welchem sich Schreck und Schmerz ergreifend mischten. Dann schlug sie die Tür des Laboratoriums wieder zu, und man hörte den Schlüssel sich drehen.
»Was ist denn geschehen, was war denn?«, fragte Dr. Schlichtmann, sich zu Gertrude wendend, die ihre Fassung wieder gewonnen hatte und schnell die letzten Stufen bis zur Laboratoriumstür hinaufgeeilt war.
»Ja, — ich glaube, Herr Doktor, die Kata — die Katalyse ist eingetreten.«
»Was sagen Sie? Die Katalyse!? — Aber — was wissen Sie denn davon, gnädiges Fräulein?«
»Nicht viel; aber ich glaube doch, daß ich recht habe, Herr Doktor — und nun lassen Sie uns nach meiner Freundin sehen.«
Sie klopfte an die Tür. Nichts rührte sich innen. Sie klinkte; die Tür war verschlossen.
»Erlauben Sie, gnädiges Fräulein«, sagte Dr. Schlichtmann.
»Miß Mabel!«
Keine Antwort.
»Miß Mabel! Bitte, öffnen Sie!« Seine Stimme klang eher wie eine Bitte als wie eine Aufforderung.
Und abermals wiederholte er sie — und abermals.
Alles blieb still.
Und nun überkam es den ernsten, kühlen Gelehrten mit steigender Sorge.
»Mein Gott, wenn sie verletzt wäre! — Offenbar ist doch eine Explosion eingetreten! Der Knall war ziemlich stark! Und weshalb sie nur die Tür wieder geschlossen hat? Wahrscheinlich hat sie vor Schreck und Aufregung die ruhige Überlegung eingebüßt! — Mein Gott — ich verstehe das alles nicht!«
Über Gertrudes Antlitz ging es wie der Schein eines Lächelns.
Und abermals rüttelte der junge Gelehrte an der verschlossenen Tür.
»Was mache ich nur? Vielleicht hat sie ernstliche Verletzungen davongetragen — vielleicht gar die Besinnung verloren! Gott — wenn sie — und ich stehe hier und vermag ihr nicht zu helfen — ihr, die ich lieber als mein Leben —« er verstummte mit einem Blick auf Gertrude.
Gertrude ergriff seine Hand. »Beruhigen Sie sich, Herr Doktor!«, sagte sie leise, und ein zuversichtlicher Blick traf schalkhaft den seinen, dann setzte sie, plötzlich lauter sprechend, hinzu:
»Ich will den Institutsdiener rufen — im Souterrain, nicht wahr? — daß er einen Schlosser holt, falls es nötig sein sollte — was ich aber nicht glaube!«, schloß sie, wieder leiser sprechend.
Und schon eilte sie die Treppe hinab.
Dr. Schlichtmann versuchte noch einmal die Tür zu öffnen.
»Miß Mabel, hören Sie mich? Ich bitte, ich beschwöre Sie: öffnen Sie! Sind Sie verletzt? Was ist Ihnen denn? Weshalb die verschlossene Tür? Muß ich erst meine Stellung hier im Institut geltend machen — Ihnen gegenüber? Miß Mabel, liebste Miß Mabel, so öffnen Sie doch, ehe Fräulein Gertrude mit dem Schlosser zurückkehrt!«
Und abermals drückte er auf die Klinke.
Die Tür ging auf! Dr. Schlichtmann stürzte ins Zimmer.
Miß Mabel lehnte hinter der Tür, totenblaß. Von ihrem weißen Halse sickerte Blut.
Mit einem Aufschrei riß er sie an sich und hielt sie in seinen Armen.
»Mabel«, flüsterte er, »liebste Mabel!«
Sie sagte nichts, sie schloß die Augen, und ihre stolzen Lippen wichen seinem Kuß nicht aus.
Dann sagte sie, wie aus einer Betäubung erwachend:
»Wo — ist Gertrude?«
»Sie holt den Institutsdiener oder den Schlosser. Die Tür war ja verschlossen — bis jetzt! Woher kam denn der furchtbare Knall? Fräulein Gertrude wäre vor Schreck bei einem Haar die steile Treppe hinabgestürzt, wenn ich sie nicht noch im letzten Moment aufgefangen hätte. Mabel, wie haben Sie — wie hast du mich erschreckt!«
Die ernste Falte auf Mabels Stirn ist plötzlich verschwunden, und wie Sonnenschein bricht es aus ihren Augen, als sie sich jetzt aufs neue seiner Umarmung überläßt.
»Es war ja nichts weiter«, sagte sie dann lächelnd, »das kleine gläserne Gasometer hat den Druck der Dämpfe nicht ausgehalten —«
»Aber du blutest ja?«
Und er preßte sein Taschentuch auf die langsam hervorquellenden roten Tropfen.
»Ein Hautriß — wohl von einem vorbeifliegenden Splitter —«
»Habe ich dich auch nicht überrascht? Und darf ich dich die Meine nennen — endlich?«, fragte er dann, und ein Zagen klang plötzlich wieder aus seinen Worten.
Sie sagte nichts, nur ihre Blicke ruhten in den seinen, fest und froh und strahlend.
Draußen klopfte es leise.
»Herein!«, rief Mabel.
»Fräulein Gertrude«, jubelte Dr. Schlichtmann der Eintretenden entgegen. »Sie suchen hier eine Verletzte und finden eine — Verlobte!«
Mabel war zu ihr geeilt und küßte sie.
Gertrude sah schelmisch lachend von dem einen zum andern.
»Ich wußte es, meine Herrschaften!«, sagte sie dann, beiden gratulierend.
»Sie wußten es?«, fragte Dr. Schlichtmann ungläubig, »aber woher denn?«
»Aus den Erscheinungen der — Katalyse!«
»Katalyse? — das Wort haben Sie mir heute schon einmal gesagt, und ich möchte meine Frage wiederholen: Was wissen S i e denn davon, gnädiges Fräulein?«
»Spotten Sie nicht, Herr Doktor! — Ich habe auch ein Experiment gemacht, und es ist überraschend schnell und glänzend gelungen. Allerdings bin ich dabei ein wenig dem glücklichen Zufall verpflichtet; aber der ist ja wohl bei vielen Experimenten etwas mit im Spiele. Jedenfalls ist mein Experiment gelungen durch — Katalyse! — ›Katalyse aber nennen wir die Beschleunigung der Verbindung zweier Stoffe durch die bloße Gegenwart eines dritten, der dabei nicht verändert wird‹, nicht wahr, ich habe den Satz aus deiner wissenschaftlichen Abhandlung gut behalten, liebste Mabel?«
Es war um die achte Abendstunde eines Spätsommertages, als ein junger Mann im Reiseanzuge, der eben den Gepäckschalter des Bahnhofs Friedrichstraße in Berlin verlassen hatte, aus der geräumigen Vorhalle ins Freie trat.
Das lebendige Straßenbild, das einen jeden neu ankommenden Besucher Berlins gefangen nimmt, fesselte auch ihn, der früher jahrelang in der Reichshauptstadt gelebt hatte, von neuem. Die riesigen Effektbogenlampen warfen schon ihren blendenden, gelblichroten Schein auf die Passantenflut, die auf den breiten Trottoiren sich hin und her bewegte. Eine Wolke aufdringlichen Parfüms erfüllte die Luft; ein eigentümlicher Lärm, der gleichsam körperlich geworden war, beschäftigte unaufhörlich sein Ohr: das endlose Geräusch der unzähligen menschlichen Füße auf den Steinfliesen der Straße, das Summen so vieler Stimmen, das Ausrufen der Zeitungshändler und Blumenverkäufer, dazwischen das Donnern der Stadtbahnzüge, das Zischen und Schnauben der Lokomotiven, das Rollen der Droschken, das fast unaufhörliche Tuten der Autos, ab und zu aus den Nachbarstraßen das Klingeln der »Elektrischen«, Wie ein an- und abflutendes Meer nahm es den einsam Dahinschreitenden gefangen, dessen tief von der afrikanischen Sonne gebräuntes, ernstes Antlitz scharf von den fahlen, weißen Gesichtern ringsum seltsam abstach.
»O — mein stilles Mwangwa!«, seufzte er unwillkürlich und so laut, daß die Vorübergehenden ihn spöttisch und verwundert ansahen. Ärgerlich über die dreisten Blicke, mit denen man ihn musterte, bog er an der Weidendammer Brücke in eine Querstraße ein.
Er sah nach dem Straßenschild und überlegte einen Augenblick. Dann zog er die Uhr —
»Zehn Minuten nach Acht!«, sagte er, »dann treffe ich ihn wohl noch zu Hause —«
Und mit raschem Schritt eilte er die Straße entlang. An einem der Häuser blieb er stehen und warf einen Blick nach den Fenstern des zweiten Stockwerks.
»Er hat Licht — hoffentlich keine größere Gesellschaft!«
Damit zog er den Knopf am Portal, stieg die mit roten Läufern belegte Treppe hinauf und klingelte —
Eine würdige ältere Dame mit einem mütterlichfreundlichen Gesichte öffnete.
»Guten Abend, Frau Wenck!«, sagte der späte Besucher.
»Mit wem habe ich die Ehre?«, fragte Frau Wenck verwundert, mit etwas Förmlichkeit und Befremden im Ton.
»Kennen Sie mich nicht mehr? — Allerdings — fünf Jahre in Afrika können mich wohl fremd gemacht —«
»Ah — Herr Ingenieur Ott — Sie sind's? — Ja, jetzt erkenne ich Sie! Und so gebräunt —«
»Ja, die liebe Sonne meint's dort recht gut, verehrte Frau Wenck. — Aber — ist mein Freund, der Herr Amtsrichter, zu sprechen? Er ist doch zu Hause? — Und allein?«
»Gewiß — und das wird eine Freude für ihn sein —«
»Melden Sie mich nicht, bitte; ich möchte ihn überraschen, Frau Wenck —«, und damit schritt er zum Arbeitszimmer des Amtsrichters und klopfte.
»Herein!«, rief es von drinnen.
Ingenieur Ott trat ein.
Frau Wenck vernahm noch den Freudenschrei, mit welchem Amtsrichter Riesenthal seinen so plötzlich heimgekehrten Freund bewillkommete. Sie wußte, was nun folgen würde, und eilte in die Küche, um auch ihrerseits für ein freundliches Willkommen zu sorgen...
Bei einer Flasche Rüdesheimer und einer Zigarre saßen die beiden alten Freunde im Gespräch, das, wie immer bei einem Wiedersehen nach langer Trennung, sprungweise hin- und herging und im bunten Wechsel die verschiedenen Themata berührte.
»Also die Überlandbahn über den schwarzen Erdteil ist fertig, sagst du?«
»Betriebsfertig — und wenn du Lust haben solltest, amice, deine Hochzeitsreise nach Afrika zu machen, kann ich sie dir aus eigenster Anschauung nur empfehlen! Es ist eine herrliche Fahrt: von den blauen Fluten des Mittelmeeres, vorbei an den löwengelben Sanddünen der libyschen Wüste, durch die düsteren Urwälder Äquatorias, über donnernde Riesenströme mit wildschäumenden Katarakten, aber auch durch freundliche Täler, bebaut mit den kegelförmigen Hütten friedlich arbeitender Negerstämme, durch unsere blühenden Kolonieen — ja, amice! endlich sind wir soweit, uns unserer Kolonieen freuen zu können; lange genug hat's ja freilich gedauert! — vorbei am Schneegipfel des Ruwenzori, am Steppenrande der Karoo entlang, vorbei an den Diamantengruben des alten Transvaal — bis zur Kapstadt! Eine köstliche Fahrt, amice! — und, wie gesagt, wenn du deine Hochzeitsreise —«
»Lieber Alfred, du weißt, zur Hochzeitsreise pflegen immer zwei zu gehören; da es mir nun leider noch immer nicht gelungen ist, das zweite Individuum zu ermitteln —«
»Ja — du warst immer ein Weiberfeind —«
»Das möchte ich doch noch nicht so definitiv hinstellen — indessen, daß ich einmal den Spieß umkehre: du warest n i e ein Weiberfeind — und wo hast du deine bessere Hälfte?«
»Ach — ich! — Da draußen hat man gar keine Zeit, ernstlich an so etwas zu denken, und außerdem —«
»Und außerdem?«
»Nun — du weißt ja, amice! Heute vor fünf Jahren — mir fällt eben ein, daß es auf den Tag gerade ein Lustrum her ist, — saß ich auch hier bei dir auf dem Sofa und teilte dir meinen festen Entschluß mit, nach Afrika zu gehen, um dort den Bau einer Teilstrecke der Bahn am VictoriaNyanza zu leiten —«
»Ich — erinnere mich, mein Alter!«, sagte Amtsrichter Riesenthal, die Hand des Freundes drückend. »Du gingest eines Mädchens wegen aus dem Vaterlande —«
»Ja — wegen — Roswitha von Tinius —«
»Sie lebt, soviel ich weiß, noch immer hier in Berlin; aus der Zeitung ersah ich vor einiger Zeit, daß ihre alte, schwer leidende Tante endlich, darf man hier wohl sagen, das Zeitliche gesegnet hat —«
»Eine Erlösung für beide Teile!«
»Ja — sicherlich! — Aber, wenn es nicht alte Wunden aufreißt, sag' einmal, mein Alter, warum bist du eigentlich damals so Knall und Fall auf- und davongegangen?«
»Weil ich hier nicht länger leben konnte, amice! Weil ich keine Aussicht sah, Roswitha mir zu gewinnen! Du weißt, daß sie und ich immer ein wenig auf dem Kriegsfuße standen —«
»Wie Beatrice und Benedikt in Shakespeares ›Viel Lärm um nichts‹.« —
»Aber im Innersten meines Herzens hatt' ich sie doch lieb wie keine auf der Welt! — Und darum ertrug ich's nicht, als sie plötzlich gegen mich völlig gleichgültig tat, in einer gewissen höflichen Art, weißt du, die dem andern zu verstehen gibt, sie sei fertig mit ihm — und das ertrug ich nicht! Das nicht! Ihren Spott hab ich lachenden Mundes ertragen — aber ihre höfliche Gleichgültigkeit nicht! Darum ging ich, wahrlich nicht mit leichtem Herzen! — Aber noch heute weiß ich nicht, was sie eigentlich gegen mich hatte —«
»Du warest ein wilder Gesell, mein Alter, immer verliebt, heut in Braun, morgen in Blond, und schon durch deinen Beruf wenig zur Seßhaftigkeit geneigt. Auch pekuniär waren deine damaligen Aussichten —«
»Ich weiß — ich weiß — aber das weiß ich auch, daß m i c h nichts in der Welt veranlassen könnte, von ihr zu lassen — und ich weiß auch oder glaubte es wenigstens damals aus mehr als einem Beweise zu wissen, daß sie mich geliebt hat —«
Es war einen Augenblick still zwischen den beiden Freunden. Dann sagte der Amtsrichter leise:
»Du liebst sie noch?«
Ingenieur Ott sprang auf —
»Frage den verschwiegenen Urwald da unten am Victoria, wie oft ich ihren lieben Namen wie eine Beschwörungsformel gerufen habe! Wie oft ich nach ihr geseufzt, um sie gebangt mit dem nagenden Schmerze des Verbannten — oft mitten in der Nacht, wenn ich schlaflos in meinem Zelte lag — daß mein braver Daud, ein kleiner Kruneger, ins Zelt gestürzt kam: ›O Herr, guter Herr, soll ich den großen weißen Zauberer rufen, daß er dir das goldene Kreuz auf die Brust lege und die bösen Geister banne?‹ — Gelächelt hab' ich und gesagt: ›Da hilft kein Zauber, mein braver Daud, leg' dich wieder aufs andere Ohr!‹ Er ging — aber ich wußte, daß er noch lange hinter meinem Zeltvorhange mit bekümmertem Herzen lauschte. — Ja — ich liebe sie noch! Und ein Denkmal habe ich meiner Liebe gesetzt da unten im Urwalddickicht, amice! Ein Denkmal: aere perennius! In einen der mächtigsten Baobabstämme hab' ich ihren und meinen Namen mit der Axt eingegraben — da sollen sie stehen und dauern, hoff' ich, manches Jahrhundert lang!«
Er hob sein Glas und ließ es an das des Freundes anklingen. Sie leerten die Gläser; der Amtsrichter füllte sie wieder und sagte dann:
»Laß mich noch einmal Roswithas Partei nehmen, mein Alter! Du weißt, sie war eine fast unvermögende Waise, hatte nur ihre reichen, stolzen, sehr exklusiven Verwandten und war ganz auf sie angewiesen — sie war damals minorenn — wer weiß, welche Kette von Standesvorurteilen ein so erzogenes Mädchen immer hinter sich her schleppt! Wer weiß, aus wieviel feinen Fäden das Netz gesponnen war, mit dem man ihr freies, rein menschliches Empfinden dir gegenüber gefesselt hat! — Doch —«, unterbrach er sich selbst, als er sah, wie düster das Gesicht seines heimgekehrten Studienfreundes geworden war — »tempi passati, mein Alter! Sonst ist dir alles dort unten nach Wunsch gegangen? Ich weiß, du hattest immer ein Faible für Africa incognita, immer so besondere Ideen — als ob dieser schwarze Erdteil einmal in Zukunft berufen sei, der nordischen Menschheit als Zufluchtsort zu dienen, einst, wenn klimatische und geologische Umwälzungen unsere jetzige Heimat unbewohnbar gemacht haben —«
»Ja — das ist auch heute noch meine feste Überzeugung!«, rief der junge Ingenieur mit Wärme; »wir alle, die da unten gearbeitet haben und noch arbeiten an der Kultur des Erdteils, am Fortschritt der Zivilisation, an der Spitze all die unsterblichen Forscher, die der Wissenschaft zuerst sichere Kunde von den Geheimnissen Innerafrikas gebracht haben, wir alle sind nur Pioniere — Pioniere der kommenden Jahrtausende! Die Zeit wird sicher kommen, wo die Völker der jetzigen gemäßigten Zonen sich leben- und wärmeheischend um die Linie des Äquators zusammendrängen werden —«
Der Amtsrichter wollte etwas erwidern; aber da klingelte es am Telephon —
»Erlaube, amice — das wird mein Bureauvorsteher sein —«
Der Amtsrichter trat an den Apparat. Er nannte seinen Namen und lauschte ein Weilchen — dann sprach er schnell ein paar Worte.
»Noch Dienstliches?«, fragte der Ingenieur.
»Wir sind im Bureau einer sehr unangenehmen Geschichte auf der Spur: verschwundene Akten etc. etc.«, erwiderte ihm der Amtsrichter, aufs neue in das Telephon lauschend.
Eben trat Frau Wenck in die Tür und meldete, daß das Souper angerichtet sei.
»Ah — schön, teuerste Schaffnerin! Wir kommen sofort! Hoffentlich haben Sie auch heute, wie sonst, nach Ihrem famosen Grundsatze gehandelt: Je besser, desto mehr!« — Dann, sich zu seinem Freunde wendend:
»Sei so gut, mein Alter, und horche hier ein bißchen am Telephon; mein Bureauvorsteher wird sich gleich wieder melden — damit das Amt nicht erst wieder abklingelt — ich will schnell in den Keller laufen, um eine der Feier und Würde dieses Moments entsprechende Marke heraufzuholen —«
»Herr Amtsrichter, kann ich Ihnen nicht — oder das Mädchen — den Weg abnehmen?«
»Nein, teuerste Eurykleia — d i e Marke finden Sie nicht heraus!«
Damit eilte Riesenthal aus dem Zimmer, Frau Frau Wenck kehrte nach dem Eßzimmer zurück, und Ingenieur Ott trat ans Telephon.
— — Allerlei Geräusche vernahm der Lauschende: das Ticken der Uhr auf dem Vermittlungsamt, das sausende Geräusch, welches die vorbeifahrenden Straßenbahnen infolge der Induktion ihrer mächtigen Betriebsströme in den Telephondrähten hervorriefen, abgerissene Worte von Gesprächen — —
Noch immer meldete sich der Bureauvorsteher nicht; — aber jetzt!
Eine Stimme — eine w e i b l i c h e Stimme! Eine melodische Altstimme!
Der Ingenieur preßte die Hörmuschel fest ans Ohr, um keinen Laut zu verlieren. War das nicht dieselbe Stimme, die ihn einst —?
»Frau Oberin«, hörte er sie sprechen, »ich bin am Telephon — Roswitha von Tinius —«
Ingenieur Ott hat sich nicht getäuscht; die Stimme kennt er unter Tausenden heraus. Getreu hat seine Seele ihren Klang bewahrt —
Nun eine antwortende Stimme:
»Ja, liebes Kind — es ist recht, daß ich Sie noch sprechen kann. ich höre soeben, daß Sie heute zweimal nach mir gefragt haben —«
»Ja, Frau Oberin — ich kam, um Ihnen die Bitte auszusprechen, mich als Schwester in Ihre Anstalt aufzunehmen —«
»Das ist sehr lieb und brav von Ihnen, mein Kind! Haben Sie sich aber auch reiflich geprüft, ob Sie zu unserm schweren Berufe taugen? Wir haben viel Selbstaufopferung, viel Geduld nötig —«
»Ich habe meine seit Jahren schwer leidende Tante gepflegt bis zu ihrem kürzlich erfolgten Tode —«
»Dann wissen Sie ja ein wenig, was Ihrer wartet. — Also hören Sie, liebes Kind, weshalb ich Sie heute abend noch anrufe: Eine unserer Schwestern ist plötzlich schwer erkrankt —«
Ingenieur Ott steht am Telephon, wie ein Träumender. Wie ist denn das alles möglich? Wie kann er dies Gespräch der beiden in seiner Leitung hören? Er faßt sich an die Stirn —. Aber er will jetzt nicht grübeln; später wird er auch dies Rätsel lösen: nur hören will er, hören, daß ihm kein Laut der geliebten Stimme entgeht —
Und eben sagt Roswitha:
»Gern bin ich bereit, Frau Oberin, schon heute abend einzutreten —«
»Brav, mein liebes Kind! Sie helfen uns aus einer Verlegenheit. Und in welcher Zeit können wir Sie erwarten?«
»In zwei Stunden etwa — oder früher, wenn Frau Oberin —«
»Also in zwei Stunden. Auf Wiedersehen, liebes Kind!« — —
Ingenieur Ott steht noch immer mit dem Fernhörer am Ohr, blaß vor innerer Bewegung, die Augen starr ins Weite gerichtet —
Und eben meldet sich der Bureauvorsteher:
»Herr Amtsrichter, die Nummer des fraglichen Aktenstückes —«
Der Ingenieur hört nichts mehr. Er stürzt aus dem Zimmer, reißt Hut und Überzieher vom Garderobenhalter und eilt die Treppe hinab — seinen mit einem Arm voll Weinflaschen beladenen Freund fast hinabstürzend —
»Wohin denn — wohin? Wie siehst du denn aus? Was ist dir?«
»Laß mich — fort! Zu ihr — zu ihr!« — — —
Auf der Straße angekommen, sprang der Ingenieur in eine gerade vorüberfahrende Automobildroschke.
»Kesselstraße fünf, Kutscher! Aber schnell — schnell!«
»Vierte Geschwindigkeit!«, sagt der Fahrer trocken, den Einschalthebel herumlegend —
Wenige Minuten später hält das Gefährt schon an dem bezeichneten Hause. Alfred Ott eilt die altmodische Treppe mit den vielen Absätzen hinauf.
Sein Herz schlägt ihm bis zum Halse, als er nun vor Roswithas Türe steht. — Einen Augenblick muß er nach Fassung ringen dann zieht er die Klingel.
Ein Weilchen bleibt es still —
Dann ein rascher Schritt —
I h r Schritt! O, wie gut er ihn noch kennt! Wie sein Ohr diesen Rhythmus bewahrt hat all' die Jahre hindurch!
Die Korridortür öffnet sich —
Hellbeleuchtet vom Licht der Lampe steht sie vor ihm. Er sieht ihre Augen wieder, die ihm geleuchtet durch Afrikas Nächte. Ihre hohe Gestalt erscheint noch schlanker in dem tiefen Schwarz ihrer Kleidung. Ihr liebes Antlitz ist blässer als sonst; schwer liegen die reichen, dunklen Flechten auf ihrer schönen Stirn —
Sie erkennt ihn sogleich.
»Alfred — Herr Ingenieur Ott — Sie?«
»Ja — ich, liebe, einzige Roswitha! Verzeihen Sie, daß ich so spät noch Sie überfalle! Ich bin vor wenigen Stunden erst aus Afrika heimgekehrt —«
Und nun erzählt er ihr — noch auf dem Korridor stehend, wie er vorhin seinen Freund aufgesucht, wie er bei ihm durch einen wundersamen Zufall ihr Gespräch mit der Frau Oberin am Telephon belauscht — wie er darauf hierhergeeilt sei, um sie zu fragen — in letzter Stunde — ob sie die Seine werden wolle —
Er hat das alles hervorgestürzt in atemloser Hast, tief erregt, in banger Erwartung — und nun hängt sein Blick an ihren Lippen —
Sie aber legt ruhig und fest ihre Hand in die seine und sagt leise:
»Ich habe Sie immer geliebt, Alfred —«
Mit einem Jubelschrei preßt er sie an sich und schließt ihr den Mund mit einem Kuß, lang und innig —
Dann — nach einem Weilchen — macht sie sich sanft aus seiner Umarmung frei und tritt an den Spiegel, um sich den Hut aufzusetzen.
»Du willst ausgehen, Herzliebste? Wohin? Doch nicht zur — Oberin?«
Sie lächelte über sein bestürztes Gesicht. »Nein — nein! Sie wird mir verzeihen und der Himmel auch, daß ich dich lieber habe als ihre Patienten — Bescheid will ich ihr nachher noch telegraphisch geben — nein, ich will — zu deinem Freunde, dem Herrn Amtsrichter Riesenthal —«
»Bravo, Schatz! Das ist lieb und nett von dir! Der wird sich schön gewundert haben, als ich so plötzlich verschwand —«
»Eben darum! Ich muß doch dich und — mich bei ihm entschuldigen, Liebster!«...
Vor dem Hause Kesselstraße Nummer fünf schritt um dieselbe Zeit ein Herr unruhig auf und ab, immer wieder den Blick nach den Fenstern der dritten Etage werfend —
Endlich öffnete sich die Haustür — zwei Personen traten heraus, ein Herr und eine Dame.
»Gott sei Dank!«, rief Amtsrichter Riesenthal — denn er war es — erleichtert aus — »Sie kommen beide — Arm in Arm!«
»Guten Abend, meine hochverehrten Herrschaften!«, rief er, den beiden entgegentretend.
»Du bist's, amice?«, rief der Ingenieur fast gleichzeitig — »o, das ist schön! Siehst du, ich bin noch zu rechter Zeit aus Mwangwa heimgekommen, Roswitha zu gewinnen! Sie ist meine Braut!«
Der Amtsrichter gratulierte beiden; dann sagte er, sich zu Roswitha wendend:
»Darf ich fragen, wohin die Herrschaften jetzt ihre Schritte lenken wollten?«
»Zu Ihnen, Herr Amtsrichter — zu Ihnen«, entgegnete sie errötend, »um uns bei Ihnen über das unterbrochene Wiedersehen zu entschuldigen —«
»O — das ist ja ein äußerst liebenswürdiger Entschluß, der, wie ich annehmen muß, von Ihnen ausgegangen ist, gnädiges Fräulein; denn Alfred wird in seinem Glücke kaum an mich gedacht haben —«
»Du hast es getroffen, amice!«
»Nun denn, so lassen Sie uns Ihren guten Einfall zu dreien ausführen!«, sagte der Amtsrichter — »Kutscher!«
Eine der an der Ecke haltenden Droschken kam herangefahren.
Alfred bettete seine spätgefundene Braut sorglich im Fond des Wagens.
»Wie das Laub schon fällt!«, sagte der Amtsrichter einsteigend und den Wagenschlag schließend — »es wird Herbst —«
»Nein, amice!«, rief Ott mit strahlendem Lächeln, »nun soll es erst noch einmal Frühling werden, nicht wahr, mein Lieb!«
Und wieder fuhr er in raschem Tempo durch die Straßen, wie vorhin — aber jetzt saß das Glück neben ihm und lächelte ihn an.
»Frau Wenck wird Augen machen, wenn wir kommen«, sagte der Amtsrichter launig, als sie an seiner Tür angelangt waren.
Frau Wenck »machte allerdings Augen«, als sie die drei erblickte; — aber als sie alles erfahren, zog sie das junge Mädchen in mütterlichem Empfinden an sich und gratulierte ihr unter Lachen und Weinen. —
Und dann ging's zu Tisch.
»Es wird nichts mehr schmecken — klagte Frau Wenck, »es ist alles schon einmal aufgewärmt!«
Aber es mundete allen vortrefflich, und sie erntete lauter Lobsprüche.
»Und wie schön kühl der Rheinwein unterdes geworden ist!«, sagte der Amtsrichter, sein Glas erhebend — »Prosit, mein gnädiges Fräulein! Prosit, mein Alter — und nochmals meine allerherzlichste Gratulation!«
Und nun kam man auf den sonderbaren Zufall zu sprechen, der eigentlich das Glück des heutigen Abends geschaffen hatte.
»Du bist ja Fachmann, lieber Alfred, »sagte der Amtsrichter, »du müßtest doch eigentlich auch dafür eine zureichende Erklärung finden —«
»Eine Erklärung wohl —«, entgegnete der Angeredete, »aber ob sie zureicht, das will ich doch lieber nicht behaupten. Also höre: Ich nehme an, daß die Telephonleitung nach deiner Wohnung an irgend einer Stelle mit der nach dem Sprechzimmer der Frau Oberin, die Roswitha noch heute abend als Novize aufnehmen wollte —«, er unterbrach sich und wandte sich an Frau Wenck: »Apropos, liebe Frau Wenck — das Telegramm an die Frau Oberin —?«
»— ist richtig besorgt, Herr Ingenieur!«, antwortete die Hausdame lächelnd, und der Amtsrichter setzte schmunzelnd hinzu: »Fürchtest du noch immer, daß sie dir dein Glück streitig macht, amice?«
Ingenieur Ott zog Roswitha mit glücklichem Lachen an sich und fuhr dann fort: »— also, daß deine Leitung mit jener an irgend einer Stelle in nahe Berührung geraten ist — vielleicht durch die Lockerung eines Drahtes bei dem jetzigen stürmischen Wetter — und nun wirkte diese benachbarte Leitung induzierend auf die deine! Du kennst ja doch die Gesetze der Faraday'schen Induktion, nicht wahr, amice? Wir haben sie ja dereinst als Pennäler bei Professor Köster zusammen gelernt —«
»Forsche nicht weiter, Sterblicher!«, rief der Amtsrichter mit komischem Pathos.
»Jeder elektrische Strom, dessen Richtung oder Intensität wechselt, erzeugt in einem benachbarten Leiter einen sogenannten Induktionsstrom, der abhängig ist von der Stärke und Frequenz des induzierenden Stromes — oder in Formel —«
»Hör' auf, hör' auf!«, rief der Amtsrichter, sich die Ohren zuhaltend, »wenn du nicht willst, daß ich dir als Gegengabe ein halb Dutzend Paragraphen mit allem Drum und Dran zitiere, aus denen du wegen unerlaubter Ausnutzung einer diskreten Mitteilung Dritter zu verurteilen bist —«
Der junge Ingenieur lachte laut auf. »Ich schweige ja schon«, sagte er — »aber nur durch eine solche Induktionswirkung zufällig sich fast berührender Telephondrähte — oder richtiger: durch einen verirrten Draht, der dicht in die Nähe eines andern geraten ist, vermag ich das Erlebnis an deinem Fernsprecher zu erklären!«
Er zog Roswitha von neuem an sich; sie aber sagte, sich aus seiner Umarmung freimachend, indes ein plötzlicher Ernst auf ihre schöne Stirne trat:
»Vermagst du aber auch zu erklären, mein kluger Alfred, wie es kam, daß du gerade heute aus Afrika heimkommen mußtest, heute, wo ich im Begriffe stand, mich auf immer zu binden? Vermagst du zu erklären, wie es kam, daß du in der nämlichen Minute am Telephon des Herrn Amtsrichters standest, als ich mit der Frau Oberin sprach? Vermagst du zu erklären, warum gerade dieser eine Draht, der dir meinen Entschluß durch ›Induktion‹, verriet, sich in die Nähe des andern verirrt hat —«
»Nein, mein Liebling«, sagte der Ingenieur, nun auch ernster werdend, »das alles vermag ich nicht zu erklären!«
»Das ist das Geheimnisvolle«, schloß Amtsrichter Riesenthal fast feierlich — das Rätselhafte, welches uns allenthalben umgibt, das Wunderbare, das bei allem irdischen Geschehen als ein unerklärlicher Rest übrig bleibt! Seien Sie diesem Wunderbaren dankbar, daß es Ihnen beiden das schönste und schwerste Rätsel des Menschenlebens lösen half: die Liebe!«
Hell klangen die drei Gläser aneinander.
Und eben trat Frau Wenck wieder in die Tür, und hinter ihr erschien Auguste, »das Mädchen für alles«, mit dem silbernen Kübel, aus dem einige goldköpfige Flaschen verheißungsvoll hervorlugten —.
Miß Annie, die Cousine meiner Frau, in Chicago, Ill., 2** NorthCenter Avenue wohnhaft, sandte mir heute eine Nummer der deutschamerikanischen Zeitschrift »Chicagoer Tribüne«, worin sie folgenden Artikel rot angestrichen hatte:
»Eine sonderbare Geschichte, die selbst für unsere hiesigen Verhältnisse recht ›amerikanisch‹ klingt, wird aus einem unserer Landstädtchen gemeldet, zu deren Verständnis wir folgendes vorausschicken:
Schon seit einiger Zeit erregten einige kühn und geistvoll geschriebene Feuilletons in einem unserer größten Blätter die Aufmerksamkeit aller Gebildeten. Es waren nicht so sehr Energie und Feuer, die sie vor unserer Tagesliteratur auszeichneten, als die geradezu frappante Ähnlichkeit, die sie in Stil und Auffassung mit den Artikeln des bekannten Mr. Vivacius Style besaßen, der — wie unsere Leser sich erinnern werden — vor einigen Jahren bei dem Eisenbahnzusammenstoß bei Buffalo so plötzlich ums Leben kam. Sein zermalmter Körper wurde damals als einer der letzten unter den Trümmern des Zuges gefunden. Da der Kopf fehlte, wurde seine Identität nur durch einige in der Brusttasche seines Rockes gefundene Schriftstücke, darunter ein druckfertiges Manuskript über den Rassenkampf, festgestellt.
Wir beklagten damals mit dem ganzen Amerika, ja mit der ganzen zivilisierten Welt den großen Verlust, den die Publizistik, die Wissenschaft, die Menschheit mit dem Tode Mr. Styles erlitten hatte. Aber wir führten in unserem Nekrologe schon damals aus, daß das grausame Schicksal hier eigentlich trotz seiner rauhen Hand barmherzig gewesen sei und den berühmten Autor durch ein jähes Ende vor langem körperlichen Leiden bewahrt habe: denn den Vertrauten des Mr. Style sei es nur zu sehr bekannt gewesen, wie schwer krank er schon seit langen Jahren war. Nur ein so starker Geist, wie der seine, habe so lange über die Materie zu siegen verstanden, und niemand habe seinen glänzend geschriebenen, alle Vorzüge unserer besten Klassiker zeigenden Aufsätzen angemerkt, unter welchen körperlichen Qualen sie entstanden. Wir wagten es damals (vgl. 26. Jahrgang, Nr. 245) eine Parallele mit unserm großen deutschen Dichter Friedrich Schiller zu ziehen, für den wir DeutschAmerikaner vielleicht mehr als seine Landsleute daheim im Vaterlande übrig haben; wir führten aus, wieviel die Welt einst bei dem Tode des großen Dichters verloren habe, wieviel von seiner Feder noch zu hoffen gewesen, und daß die Zahl seiner ungeschriebenen Werke gewiß viel größer sei als die der hinterlassenen. Wir beklagten die Hinfälligkeit der Menschennatur, die einen solchen Feuergeist in die Fesseln eines kränklichen Körpers gebannt habe. ›Pegasus im Joche!‹ Wir schrieben, daß gerade solche Fälle es seien, welche uns Menschen den unbescheidenen Wunsch in der Seele erwecken, die Natur meistern zu können, das heißt im Interesse der Menschheit solche begnadeten Geister von dem Schicksal ihrer zufälligen körperlichen Konstitution befreien zu können.
Nun aber kommt, wie eingangs erwähnt, aus einem kleinen Landstädtchen am Ohio die unglaubliche Kunde, daß Mr. Vivacius Style noch lebt, daß jene famosen Artikel in der ›Sun‹ und anderen Blättern, welche die letzten aktuellen Fragen in überraschender, ganz eigenartiger, aber hochmoderner Weise beleuchten, buchstäblich von ihm herrühren. Dabei bleibt nur das eine rätselhaft, wie er und ob er bei dem Eisenbahnunglück gerettet worden ist, da doch seine Freunde seine Leiche rekognosziert haben. Seine früheren Verehrer glauben daher nicht an seine Autorschaft in bezug auf seine jetzigen Veröffentlichungen und halten die ganze Geschichte für ein schlaues Pressemanöver — um so mehr, als niemand bis jetzt den wiedererstandenen Vivacius Style gesehen oder gesprochen hat. Für die Wahrheit der Sache aber spricht unseres Erachtens trotz aller gegenseitigen Äußerungen die erschienene Artikelserie in einwandfreier, uns völlig überzeugender Weise. So schreibt nur einer von unseren lebenden Autoren — und das ist Mr. Vivacius Style! Ex ungue leonem! Wir erörtern gar nicht erst wie andere Zeitungen die verschiedenen Möglichkeiten einer plausiblen Erklärung der mysteriösen Angelegenheit: Benutzung früherer, noch unveröffentlichter Manuskripte Styles, Nachahmung seiner Schreibweise durch einen jüngeren, begabten Journalisten etc. — wir behaupten mit aller Entschiedenheit die Echtheit der Leitartikel in der ›Sun‹. Wir wissen, daß wir mit dieser Behauptung jetzt ziemlich allein stehen; aber die Zukunft wird uns recht geben. — — So weit hatten wir gestern geschrieben. Inzwischen hat die ganze Sache eine überraschende, um nichts weniger wunderbare Aufklärung gefunden.
Mr. Vivacius Style lebt tatsächlich — oder hat bis vor wenigen Tagen noch gelebt; allerdings muß man bei dem Wort ›leben‹ insofern eine Einschränkung machen, als nicht er selbst, sein ganzes körperliches Ich, seit jenem Eisenbahnunglück weitergelebt hat, sondern nur — sein Kopf!
Doktor Magician, dessen Name vielleicht manchem unserer Leser als der eines genialen Naturforschers und Bahnbrechers, namentlich auf biologischchemischem Gebiete, bekannt sein wird, hat zur Beruhigung der öffentlichen Meinung und zu seiner eigenen Rechtfertigung folgendes in NowhereCity zu Protokoll gegeben:
›Ich, Doktor Magnus Magician, war bei jenem Eisenbahnzusammenstoß zufällig in der Nähe der Unglücksstätte. Den wenigen Passagieren, die noch am Leben waren, leistete ich, so gut es ging, die erste Hilfe. Als ich schließlich auch in das Innere des fast ganz zerstörten Speisewagens drang, der nach Aussage der Überlebenden im Moment des Zusammenstoßes unbesetzt gewesen war, fand ich dicht bei dem explodierten Kohlensäureapparat einen — Kopf, kunstgerecht vom Rumpfe getrennt, wahrscheinlich durch ein von der Explosion geschleudertes Metallstück, wie vom Seziermesser des Anatomen. Dieser Kopf lag auf einem Häufchen von — Schnee wie auf einem Kissen, gebildet von der beim plötzlichen Ausströmen gefrierenden flüssigen Kohlensäure. Wunderbar ergreifend war mir, der ich in meinem Berufe so manche Sektion ausgeführt habe, der hohe Intellekt, der aus seinen Zügen sprach und die rätselhafte lebensfrische Farbe seines Antlitzes. Der Anblick ergriff mich so, daß ich mich zu ihm herniederbeugte. Dabei entdeckte ich, daß durch die gefrorene Kohlensäure eine plötzliche Stillung der Blutung eingetreten war; die Öffnungen der großen Arterien waren hermetisch durch Verschlußpfropfen von gefrorener Kohlensäure geschlossen, überhaupt die ganze Wundfläche mit einer dicken Schicht festen Eises überdeckt.
Ich beschloß, meinen Fund mitzunehmen, um an ihm wissenschaftliche Experimente zu machen. Sorgfältig umgab ich ihn mit einer Packung von Kohlensäureschnee, hüllte ihn behutsam ein und trug ihn in mein Automobil, das in der Nähe stand. — Unterwegs dankte ich dem Zufall, der mir ein solches Versuchsobjekt in die Hand geliefert. Ich arbeitete damals gerade an der Herstellung einer Ersatzflüssigkeit für Menschenblut, die ich bei drohender akuter und chronischer Herzschwäche, bei Verblutungen, Gasvergiftungen usw. durch Transfusion in die Blutbahn des menschlichen Körpers einführen wollte. Mein durch ein biologischchemisches Verfahren gewonnenes Präparat »Sanguinum« reagiert nach der Uhlenhuth'schen Methode genau wie Menschenblut; es mußte also imstande sein, die Funktionen des natürlichen Blutes zu erfüllen. — Zu Hause im Laboratorium angelangt, war meine erste Sorge, den Kopf sorgfältig und allmählich aufzutauen, die Wundflächen schmerzlos zu machen und ihn an den TransfusionsApparat anzuschließen. Dann öffnete ich den Hahn des nach Art eines Pulsometers funktionierenden Instruments, um mein künstlich erzeugtes Blut in die Arterien des Versuchsobjektes einzuführen. —
Es gehört nicht in ein amtliches Protokoll, hier von dem Gefühl zu sprechen, das mich erfaßte, als ich den leblosen Kopf allmählich wieder zum Leben erwachen sah: das leise Sichröten der Wangen, das Zittern der noch geschlossenen Augenlider, den Wechsel des Mienenspiels in den langsam sich belebenden Zügen und endlich — das Aufschlagen der Augen, die vom Tode erwacht, wieder zurück ins Leben blicken! Hier paßt einmal der Ausdruck voll und ganz, daß für ein solches Gefühl die Sprache zu arm ist. — Genug — er erwachte und sah mich an. Ich sah, wie seine Lippen sich bewegten; aber das Sprechen war ihm unmöglich; es fehlte ihm ja das Organ, das seinen Kehlkopf mit der dazu nötigen Luft versorgte. Ich neigte mich zu seinem Ohr und erzählte ihm langsam alles, sein Unglück, die Auffindung seines Hauptes und sein Hierherkommen — und sein Erwachen vom Tode.
Ungläubig starrte er mich lange an; — endlich ging ein Lächeln über seine Züge, ein sonniges, glückliches, befreiendes Lächeln, das auch meine Seele von einem stillen Selbstvorwurfe erlöste. Wieder wollte er sprechen, und mir war, als ob seine Lippen immer nur zwei Worte formten: »thank You!«
Meine nächste Sorge war, einen Apparat zu konstruieren, der ihm das Sprechen wieder möglich machte, d. h. eine Art automatischen Blasebalgs, der durch den noch vorhandenen Luftröhrenrest Luft in seinen Kehlkopf einführte. — Tag und Nacht arbeitete ich unausgesetzt, fieberhaft — endlich kam ich damit zustande und schaltete meinen Apparat ein.
Das Experiment gelang besser, als ich gehofft. Zwar fehlte seiner Stimme die Klangfülle, da ja die Resonanz des Tones im Brustkorbe fehlte, auch die Regulierung des Atems machte ihm anfangs noch Schwierigkeiten; aber er konnte doch sprechen und sich mir verständlich machen. Und nun erst erfuhr ich aus seinem eigenen Munde, welchen »illustren Kopf« ich beherbergte: Mr. Vivacius Style hatte ich gerettet, wenigstens, wie er selber launig bemerkte, den Teil seines Ichs, der an seinem Leibe im Leben allein etwas getaugt. — Und nun änderte sich mit einem Schlage mein Verhältnis zu meinem Versuchsobjekt: schon längst war ich ein begeisterter Verehrer des mir bisher persönlich unbekannten Vorkämpfers für edleres Menschentum, für Würde und Freiheit der Gesinnung, für Schaffung geistiger Werte, für den wahren Adel unseres Geschlechts gewesen. Durch meine Fachgenossen hatte ich mit Bedauern erfahren, daß gerade die Tage dieses seltenen, hochbegabten Menschen gezählt seien, daß er unter der Bürde eines kränklichen, schon von Haus aus schwächlichen Körpers leide. Von dieser Stunde an betrachtete ich es als meine edelste Lebensaufgabe, diesen begnadeten Intellekt der Menschheit zu erhalten und zu pflegen — mit allen Mitteln, welche mir die Wissenschaft und meine ärztliche Erfahrung an die Hand gaben; mußte ich doch in der wunderbaren Verkettung aller Umstände seiner Errettung mehr als bloße Zufälligkeiten erblicken! — —
Um ihm die journalistische Tätigkeit, nach der er sich sehnte, zu ermöglichen, schaffte ich einen Phonographen an, in den er seine Artikel sprach; später ersetzte ich diesen durch ein Poulsen'sches Telegraphophon, um ihm ungestört auch die Aufnahme längerer Abhandlungen zu ermöglichen. Gern habe ich mich der kleinen Mühe unterzogen, seine gesprochenen Aufsätze mit der Schreibmaschine in gewöhnliche Schrift zu übertragen. — So haben wir diese vergangene Zeit her zusammengearbeitet; ganz zuletzt bestand er darauf, um mich von der Arbeit des Niederschreibens zu entbinden, auf seine Kosten eine der neuerfundenen Sprechschreibmaschinen zu erwerben. Seit diesem Zeitpunkte hat er seine Manuskripte gang allein druckfertig hergestellt.
Auf seinen Wunsch sollte ich keiner lebenden Seele unser beiderseitiges Geheimnis seiner »körperlosen« Existenz verraten; selbst seinem langjährigen Freunde und Verleger, dem Herausgeber der »Sun«, gegenüber sollte ich schweigen, habe ihn aber dennoch heimlich ins Vertrauen gezogen, wie er mir jetzt, in Anbetracht der Sachlage, wohl gern bestätigen wird. — Nur einmal wurde es meinem armen Freunde schwer, sein Geheimnis zu bewahren — an jenem Tage, als er erfuhr, daß Miß Evelyn H..., seine begeisterte Freundin und Verehrerin, infolge seines schrecklichen, jähen Endes schwer erkrankt sei. In jener Stunde dichtete er das Sonett: »Der Tote an die Lebende«, das damals die Runde durch viele unserer großen Zeitungen machte, und dessen SchlußTerzinen (in deutscher Übersetzung) lauteten:
»Zwar bin ich fern — doch nicht im Reich der Geister;
Zwar nicht mehr Mensch, doch sterblich noch, wie einst;
Zwar körperlos — doch meiner Sinne Meister.
Ein Wunder — leb' ich, neu vom Tod geboren —
Und ob du um den jäh' Entriss'nen weinst,
Was du geliebt, das hast du nicht verloren!« —
Verse, die erst durch meinen jetzigen Bericht völlig verständlich werden. — Aber sonst arbeitete er, als ob nichts geschehen wäre; seine journalistische Gewandtheit, seine schlagende Dialektik, sein reiches Wissen und können — und last not least — seine Menschenliebe zeigten sich in unveränderter Weise in jeder Zeile. — Um ihn und mich das Ungewöhnliche und TraurigFurchtbare seiner Erscheinung vergessen zu lassen, das lebendige Menschenhaupt auf der arbeitenden Maschine, hatte ich ihm eine Kleidung zurechtgemacht, die wie ein bequemes Hausgewand bis zum Halse herauf geschlossen war und alles verhüllte. — Gerade um diese Zeit begann der Kampf um die sogenannte »Colored Bill« im Lande, die von Mr. Retrorsy eingebracht wurde, laut welcher den Farbigen aller Rassen nicht mehr die bisherigen Rechte im Gebiet der Vereinigten Staaten zustehen sollten — und gerade Mr. Vivacius Styles Artikel in der »Sun« waren es, welche durch ihren flammenden Protest gegen diese Bill die große Bewegung unter unsern Mitbürgern entfacht haben, in der wir noch stehen, eine Bewegung, welche sich schließlich in der Presse zu einem journalistischen Duell zwischen Mr. Style und Mr. Retrorsy zugespitzt hat. Es ist hier nicht der Ort, auf die Kampfesweise Mr. Retrorsys hinzuweisen, die das ganze Arsenal persönlicher und politischer Verdächtigungen gegen Mr. Style aufgefahren hat; — Mr. Vivacius Style hat trotz aller Verdächtigungen mit seiner Idee vor dem Forum der öffentlichen Meinung den Sieg davongetragen. Das war eine seiner letzten Freuden. Denn er selbst gefiel mir, dem Arzte, seit einiger Zeit gar nicht recht; seine sonstige Lebensfreudigkeit und sein goldener Humor nahmen ab. Besorgt prüfte ich meine Apparate, untersuchte ich seinen Zustand. Es war — wie ich erkennen mußte — ein rein seelisches Leiden, und ich glaubte auch mit Sicherheit den ursächlichen Zusammenhang seiner Melancholie mit der Krankheit Miß Evelyn H...s gefunden zu haben. Dazu kam, daß ich gern noch einen Vertrauten für unser Geheimnis gewonnen hätte, der mit liebevoller Sorgfalt für sein Wohlergehen, das hieß also in diesem Falle: für die peinlichgewissenhafte Bedienung der Apparate Sorge trug, wenn ich einmal irgendwie verhindert sein sollte. Beispielsweise muß das »Sanguinum« alle vierundzwanzig Stunden frisch bereitet werden u. a. Das alles brachte mich zu dem Entschluß, jene Freundin Mr. Vivacius Styles, von der ich durch vertrauliche Erkundigungen erfahren, daß auch ihre Krankheit nur noch seelischer Natur sei, aufzusuchen — natürlich ohne Mr. Styles Vorwissen. Ich mußte mich zu diesem Zwecke auf einen halben Tag von ihm entfernen, glaubte mich aber für diese kurze Abwesenheit auf meinen langjährigen Diener Phin verlassen zu können. — An dem Tage meiner Abreise kontrollierte ich noch einmal sorgfältig den Gang der Apparate; dann nahm ich kurzen Abschied von Mr. Style, mit dem Versprechen, in ein paar Stunden wieder bei ihm zu sein. — — Ich habe ihn nicht mehr lebend wiedergesehen.
Mr. Retrorsy hat bekanntlich immer die Echtheit jener Artikel in der »Sun« bestritten. Wenn es seinen immer wieder erhobenen Zweifeln auch nicht gelungen ist, Mr. Style und mich aus unserer Reserve hervorzulocken, so wird er doch anderseits weder Mittel noch Wege gescheut haben, hinter unser Geheimnis zu kommen. Wahrscheinlich hat der allmächtige Dollar auch hier sein Werk verrichtet. Irgend ein Detektivbureau wird mich als den Vermittler der Artikel ihm ausfindig gemacht haben; genug: es steht nach meinen Ermittelungen fest, daß er sich wochenlang in NowhereCity aufgehalten und schließlich meinen Diener mit einer großen Summe bestochen hat, ihm von einer längeren Abwesenheit meinerseits sofort Nachricht zu geben. — In den Stunden meiner Abreise ist er dann in mein Haus eingedrungen und hat die durch ein Kunstschloß verwahrte Tür meines Laboratoriums erbrochen. —
Was weiter geschehen ist, hat mir kein lebender Mund verraten, sondern — der Phonograph, der von mir für alle Fälle beim Weggange zur Aufnahme in Tätigkeit gesetzt wurde. Nach diesem phonographischen Bericht hat Mr. Retrorsy beim Anblick des in seiner Verhüllung völlig menschlich und natürlich erscheinenden Gegners ausgerufen:
»Goddam — der Kerl lebt wahrhaftig noch!« — worauf Mr. Style ruhig geantwortet hat:
»Ja, Mr. Retrorsy — und ich hoffe Ihnen das noch besser mit meiner Feder als mit meinem Anblick zu beweisen!«
»Wollen Sie mir nicht wenigstens im Interesse Ihrer vielen Freunde und — Gegner erzählen, wie Sie eigentlich lebendig aus jenem Eisenbahnzug Ihr wertes Ich gerettet haben, Mr. Style? Da eine große Zahl von Personen, darunter Ihre treuesten Anhänger, Sie damals als veritable Leiche agnosziert haben, wäre eine Aufklärung dieses Widerspruchs aus dem Munde Ihres politischen Gegners immerhin von Bedeutung — auch — Goddam! — für Ihre neuesten Schützlinge, die verdammten Farbig —«
In diesem Augenblicke hat, nach der Angabe des Phonographen, der automatische Regulator des TransfusionsApparats eingesetzt; das eigentümlich schnarrende Geräusch hat natürlich die Aufmerksamkeit Mr. Retrorsys erregt und damit seinen — Verdacht. Mitten im Wort hat er sich unterbrochen, um dann in höhnischem Tone fortzufahren:
»Was — was ist das? — Woher kam das? Haben Sie etwa ein Uhrwerk im Leibe, Mr. Style? — Ist Ihre jetzige Existenz doch nur ein verdeckter Humbug? — Goddam — das wäre! Lassen Sie doch sehen!« — —

Wahrscheinlich ist Mr. Retrorsy dann näher herangetreten und hat die Verkleidung Mr. Styles untersucht. Machtlos und wehrlos ist der Ärmste allen Angriffen seines Gegners ausgesetzt gewesen.
»Also — das ist Ihr Geheimnis, Mr. Style! — Sie sind gar kein ordentlicher Mensch mehr, sondern nur noch ein verkappter Mechanismus! Und Sie wagen es, sich noch immer in den Kampf der Meinungen zu mischen! Sie wagen es, mir allerlei Machinationen vorzuwerfen — und sind selbst nur noch eine Maschine, die dieser schlaue Medizinmann mit seiner verdammten Kunst wieder notdürftig zusammengeflickt hat! — Sie sollen mich nicht länger angreifen mit Ihren hirnverbrannten Artikeln — Goddam — Lassen Sie doch mich Sie einmal genauer untersuchen — es soll mir doch gelingen, Sie samt Ihrem Mechanismus fernerhin unschädlich zu machen! Haha! Hier ist ja ein Stück Glasrohr eingesetzt in Ihren Automatenleib — das wird sich doch zerbrechen lassen« —
Der Phonograph verzeichnet hier ein heftiges Geräusch, das Zerschmettern des Glasrohrs, wahrscheinlich durch einen Schlag mit dem Spazierstock — und ein zischendes Sprudeln, das Ausströmen des Sanguinums, des künstlichen Blutes.
Mr. Vivacius Style hat gefühlt und gewußt, daß es rasch mit ihm zu Ende gehe; er hat ausgerufen:
»Sie haben gehandelt, wie es Ihrem Charakter entspricht — wie ein feiger Schuft! Ich fühle, daß ich verbluten muß — O, Mr. Magician, mein lieber Freund, mit soviel Schlechtigkeit kämpft ein ehrlicher Mann vergebens! — Elender Retrorsy, so triumphiere denn! Mich hast du vernichtet, aber meine Idee nicht — und sie wird mich an dir rächen.« — —
— — Zur festgesetzten Zeit kehrte ich in mein Heim zurück. Ich kam mit frohem Herzen: Miß Evelyn H... fühlte sich kräftig genug, schon morgen bei mir einzutreffen, um sich mit mir in die Pflege des lieben Geretteten zu teilen. Erstaunt darüber, daß Phin mich nicht an der Hauspforte empfing, blieb ich einen Moment im Flur stehen und rief. Es erfolgte keine Antwort — wohl aber vernahm ich in diesem Augenblicke ein dumpfes Geräusch, das von einem heftigen Geknatter, wie von einer starken elektrischen Entladung, begleitet war.
Nichts Gutes ahnend, eilte ich in atemloser Hast die Treppe zum Laboratorium hinauf und stürzte hinein. —
Mein erster Blick flog auf Mr. Vivacius Style. — Bleich, wie ein edles Marmorbild, lag sein gesenktes Haupt, ein wenig zur Seite geneigt, auf dem Kissen, das ich ihm zur Stütze beim Schlummern angebracht. Ich sah mit blutendem Herzen, daß ich zu spät kam!
Ein weiterer Blick auf den von seiner Hülle halb entblößten Apparat ließ mich auch das Zerstörungswerk als die Ursache der plötzlichen Katastrophe erkennen.
Und nun fand ich auch den Täter! Er lag, in die Hochspannungsleitung meines Laboratoriums eingeklemmt, zu einem einzigen Krampf zusammengezogen, in einer Ecke unter dem Transformator...
Aus Abbildungen, die ich besaß, erkannte ich ihn als Mr. Retrorsy, den erbittertsten Feind meines verlorenen Freundes. Aber erst, nachdem ich mich mit trauriger, unumstößlicher Gewißheit überzeugt hatte, daß alle meine ärztliche Kunst und Wissenschaft diesmal bei Mr. Vivacius Style zu spät kam, erst dann — habe ich mich um Mr. Retrorsy bemüht. Ich stellte den Strom ab, löste seine zusammengekrampften Glieder von der Leitung und machte Wiederbelebungsversuche. Als diese fruchtlos blieben, führte ich ihm durch Transfusion Sanguinum zu, das künstliche Blut, das er meinem schändlich hingeopferten Freunde durch seine ruchlose Tat entzogen hatte. — Er erwachte endlich wieder und kehrte ins Leben zurück. Er erkannte mich und wollte sprechen, aber seine Zunge lag ihm wie Blei im verzerrten Munde. Er versuchte zu schreiben, aber seine Hände waren gelähmt und kalt und starr wie Stein!

Aber auch ohne sein Geständnis konnte ich mir das Geschehene vollends erklären: Wahrscheinlich hatte er mich kurz nach seiner vollendeten schmählichen Tat kommen hören und sich zur Flucht gewandt. Dabei war er gestolpert und hatte sich festhalten wollen, aber das Metallgestänge, das er in der Hast ergriffen, war das Kabel meiner Hochspannungsleitung — und der Schlag von 50 000 Volt hat ihn getroffen. —
Der Phonograph gab mir den Zusammenhang des Ganzen. Der Elende hat seinen Zweck erreicht, Mr. Vivacius Style ist nicht mehr! — Aber die gute Sache hat ihren treuen Kämpfer selbst gerächt, schneller, als er wohl selbst gedacht: Mr. Retrorsy ist gelähmt an Zunge und Händen für immer...‹«
Bis hierher hatte ich den Artikel in der »Chicagoer Tribüne« gelesen.
Kopfschüttelnd schlug ich die Zeitung um —, die Nummer war vom e r s t e n April cr....
Aber — Miß Annie —?
Den meisten Lesern ist jener Vorfall wohl noch in der Erinnerung, der sich in den ersten Tagen der Weltausstellung in St. Louis ereignete — wir meinen das Verschwinden jenes ersten Fesselballons, den ein plötzlich auftretender Zyklon in die Lüfte entführte. Jener furchtbare Wirbelsturm richtete bekanntlich auf dem Gelände der eben entstehenden Ausstellung bedeutenden Schaden an, der in den Zeitungen, wie üblich, nach so und soviel hunderttausend Dollar abgeschätzt wurde. Dagegen erschien freilich der Verlust eines Fesselballons von verschwindender Bedeutung —
Und so blieb auch den meisten Lesern unbekannt, was dem erwähnten Vorfalle ein rein menschliches Interesse zu geben geeignet war — daß jene zuerst vom Telegraphen verbreitete Notiz:
»Der Fesselballon der Ausstellung wurde trotz der starken Stahltrossen, die ihn hielten, vom Orkan losgerissen und entfloh auf Nimmerwiedersehen; zum Glück enthielt er wegen der späten Abendstunde k e i n e Insassen —«
— daß jene Notiz nur in ihrem e r s t e n Teil zutreffend war!
Denn der Fesselballon enthielt trotz der späten Abendstunde d o c h n o c h I n s a s s e n — und ihr Schicksal schildern die folgenden Blätter.
Eine kleine Gesellschaft Deutscher und DeutschAmerikaner war nach einem längeren Rundgange — wenn man die auf großen Strecken von einer Fahrt unterbrochene Besichtigung der Ausstellung so nennen darf — in einem der deutschen Wirtshäuser gelandet, wo echter Wein vom Rhein geschenkt wurde.
Es waren acht Personen, die sich an einem der runden Tische in einer Nische des Lokals niedergelassen hatten: der Privatdozent Dr. Heinz Sucher und seine Frau Elisabeth, TelegraphenInspektor Fritz Oldenburger und Frau Grete, geb. Schönthal, Mistreß Caroline Huebner aus Chicago und ihre Tochter Miß Annie, Dr. Felix Ridinger, Ingenieur und Mitbesitzer des »CaliforniaEisenwerkes« bei OregonCity, und seine Frau Maud, geb. Bruckner — Personen, die dem einen oder anderen Leser vielleicht nicht ganz unbekannt sind.
Wie immer, wenn beim goldnen Wein alte Freundschaft erneuert oder neue geschlossen wird, war die Stimmung der Gesellschaft äußerst angeregt und belebt; Mistreß Huebner, die als junges Mädchen aus Deutschland herübergekommen war, hatte Gelegenheit, sich durch den Augenschein zu überzeugen, daß die jungen Deutschen — denn es waren lauter jungvermählte Paare — genau noch so fröhlich zu sein verstanden, wie sie als Fräulein Caroline vor einem Menschenalter.
Am übermütigsten erschien der TelegraphenInspektor Fritz Oldenburger — das war vielleicht insofern erklärlich, als er sich — auf der Hochzeitsreise befand. Er war es auch, der durch seinen Vorschlag schließlich der schuldlose Urheber alles dessen wurde, was hinterher geschah...
Durch die mit Butzenscheiben verglasten Fenster schimmerte die rötlich untergehende Sonne. Frau Elisabeth Sucher öffnete, als die zunächst Sitzende, einen Flügel des Fensters, um den Geistern des Weines, wie sie sich schelmisch ausdrückte die Rückkehr in ihr luftiges Reich zu erleichtern — als Fritz Oldenburger plötzlich wie elektrisiert aufsprang.
»Meine Herrschaften, wissen Sie, was unserm heutigen fröhlichen Beisammensein noch zur Vollendung fehlt?«
»Noch einige Flaschen von diesem Rüdesheimer!«, rief launig Dr. Sucher.
»Die auch, lieber Freund«, warf Oldenburger dazwischen, — »und sie sollen uns nicht fehlen! — Nein, meine Herrschaften, schauen Sie dorthin, sehen Sie —«, er wies durch das geöffnete Fenster — »vom Lichte der scheidenden Sonne vergoldet, den Einsamen da oben, der wie der Adler aus Schillers ›Spaziergang‹ ›im einsamen Luftraum hängt und knüpft an das Gewölke die Welt‹.« —
»— den Fesselballon!«, rief seine Frau.
»Ja, Gretulein — ihn mein' ich. Lassen Sie uns zum Abschluß des heutigen Tages noch einen Aufstieg im Fesselballon machen —«
»Er wird eben herabgewunden«, sagte Ridinger, »er hat wohl den letzten Aufstieg für heute gemacht«, — er sah nach der Uhr — »ja — es ist Schluß für heute.«
»So lassen Sie uns eilen, ladies and gentlemen!«, rief Oldenburger zum Aufbruch drängend, — »der allmächtige Dollar wird uns helfen, falls die bittenden Blicke so vieler schöner Augen bei den Beamten des Fesselballons machtlos bleiben — kommen Sie, kommen Sie!«
— Ehe man sich recht besann, war man schon auf dem Wege zur Aufstieghalle. Zuerst wollte ja die eine oder andere Dame protestieren; aber der diplomatische Fritz Oldenburger hatte sich die Zustimmung der Mistreß Huebner zu sichern gewußt — und so wollte sich die Jugend nicht vom reiferen Alter beschämen lassen: der übermütige Vorschlag ging allseitig durch.
Um sich die Herren der Gesellschaft noch geneigter zu stimmen, ließ der junge TelegraphenInspektor einen Korb voll Rüdesheimer Wein an Ort und Stelle bringen.
»Heinz, Bruderherz, wie muß da oben d e r Wein erst schmecken!«, hatte er enthusiastisch gerufen, als er Dr. Sucher davon berichtete. — —
Alles ging nach Wunsch. Einen Augenblick hatte zwar der Ingenieur, Mr. Sidney Morris, Einwendungen erhoben, hatte aber auf die Bitten der Damen hin doch das Signal zum nochmaligen Aufstieg des riesigen Luftungetüms gegeben.
»Aber nur wenige Minuten, mein Herr —«, sagte er bestimmt zu Oldenburger. »Die Wolkenwand dort im Südwesten kommt immer näher —«
»Im voraus besten Dank, Mr. Morris!«
— Und so stieg man auf. Anfangs klammerten sich die jungen Frauen ängstlich an ihre Eheherren — aber als das eigentümliche Schwindelgefühl überwunden war, genoß man einen Ausblick und Rundblick über die gesamte Ausstellung und ihre Umgebung, der unvergleichlich war.
Die lustigen Gespräche verstummten alle — der Eindruck des Erhabenen drängte sich mit zwingender Gewalt in die Menschenseele...
Der Ballonführer, Mr. Morris, reichte den Insassen ein Fernrohr zur bessern Beobachtung des schon im Dämmerlicht verschwimmenden Horizontes.
Und eben bückte sich Fritz Oldenburger, um einige der mitgenommenen Flaschen zu einem »Toast in den Lüften« aus ihrer Verpackung zu lösen — als ein pfeifender Windstoß den riesigen Ballon von der Seite packte, daß die Seidenhülle tiefe Einbuchtungen erhielt und krachend gegen das Netzwerk gepreßt wurde —
Entsetzt klammerte sich alles an den Rand der Gondel — die Damen schrien vor Schreck auf —
Schnell gab der Führer durch das Telephon das Zeichen zum Abstieg. Man fühlte an dem Erzittern der großen Gondel, wie der Ballon ruckweise herabgezogen wurde —
Die Insassen atmeten erleichtert auf. Oldenburger stand noch immer, in jeder Hand eine Flasche Rüdesheimer, unschlüssig, ob er sie nicht doch noch öffnen sollte — — als die Gondelinsassen von einem zweiten, viel gewaltigeren Stoße durcheinandergeschleudert wurden —
Ingenieur Morris beugte sich über den Gondelrand —
Da ringelte sich das sonst straffgespannte Stahldrahtseil wie eine Schlange in den Lüften —
Es war zerrissen.
Der Druck des Orkans war zu groß gewesen...
Pfeilschnell flog der entfesselte Riesenballon in die Höhe. Morris warf einen Blick auf das Barometer. Die Quecksilbersäule fiel rapid —
Wie ein Kreisel drehte sich das Luftschiff um sich selbst, immer höher steigend. In wenigen Sekunden war es in einem Wolkenmeere verschwunden, das der nun voll einsetzende Wirbelsturm zusammengetrieben hatte. Das war auch der Grund, weshalb Morris nicht die Ventilleine zog. Die Geschwindigkeit dieser Taifune ist bekanntlich sehr groß, erreicht nicht selten 40—50 Meter pro Sekunde. Dazu verhinderte die graugelbe Wolkenhülle jede Orientierung, so daß eine Landung völlig unmöglich schien, noch dazu mit solchen Insassen.
Denn in der Gondel sah es traurig aus — Weinen und Schluchzen und verzweiflungsvolle Schreie nach Hilfe übertönten die Trostworte der ruhigeren Männer. — Aber auch diese erkannten bald den ganzen, furchtbaren Ernst ihrer Lage.
»Derartige Stürme pflegen nur selten von längerer Dauer zu sein«, sagte Morris beruhigend zu den Verzweifelnden. »Hoffentlich können wir in ganz kurzer Zeit wieder landen. Unser Ballon ist vom besten Material und besitzt wegen seiner Größe eine bedeutende Tragkraft. Wir sind in dem gleichen Falle, wie Luftschiffer im freien Ballon, die vom Wirbelsturm unvermutet gepackt werden, ladies and gentlemen. Darum bitte ich Sie alle immer wieder: verzweifeln Sie nicht, behalten Sie Hoffnung, fassen Sie Mut!« —
Aber dieser Taifun war einer der seltenen, die tagelang andauern. Die Nacht kam mit all ihrem Dunkel und all ihrem Schrecken — und der Morgen kam, bleigrau schimmerte sein fahles Licht durch die graugelben Wolkenmassen. Hagel- und Regenschauer prasselten auf die Ballonhülle hernieder, und noch immer wagte man nicht zu landen — — —
Ungefähr sechzig Stunden nach dem unglücklichen Aufstieg — die Verzweiflung der Balloninsassen war unterdes aufs höchste gestiegen! — sah der Führer Morris mit dem Fernrohr durch den nun in einzelne Fetzen zerrissenen Wolkenmantel unter sich — das wogende Meer, das in langen, weißköpfigen Wellen dahinflutete.
»Der Ozean —«, sagte er leise zu Mr. Ridinger, der mit seiner jungen Gattin neben ihm am Rande der Gondel stand.
»Aber welcher Ozean, Mr. Morris?«, fragte Mrs. Maud — »Atlantik oder Pazifique?«
»Ja, Mrs. Ridinger, diese Frage habe ich mir in unser aller Interesse eben auch schon gestellt, ohne sie bis jetzt beantworten zu können —«
»Wie hoch schätzen Sie die Geschwindigkeit dieses Wirbelsturmes, Mr. Morris?«
»Ich besitze leider zu wenig meteorologische Erfahrung, aber ich glaube, sie wird sich von der Durchschnittsgeschwindigkeit derartiger Zyklone nicht weit entfernt haben, die ungefähr vierzig Meter in der Sekunde beträgt —«
»Das ergibt also für jede Stunde unserer unfreiwilligen Ballonfahrt zirka hundertvierzig Kilometer« — sagte der eben hinzutretende Dr. Sucher.
»Ja, nur daß dabei die Richtung der bewegten Luftmassen — also auch des in ihnen schwebenden Ballons — fortwährend wechselt und nacheinander alle Örter der Windrose durchläuft, eine halbwegs zutreffende geographische Orientierung nach der Länge der durchflogenen Wegstrecke also kaum möglich sein wird —«, vollendete Morris.
»Auf jeden Fall müssen wir versuchen zu landen, Mr. Morris!«, rief Fritz Oldenburger besorgt aus, »schon um nicht zu verhungern — von allen andern Gefahren, die uns mit jeder Stunde mehr bedrohen, gar nicht zu reden. Sie sagten selbst, daß der Gasverlust unseres Ballons seit gestern immer bedeutender wird —«
»Gewiß muß eine Landung um jeden Preis versucht werden«, sagte der Ballonführer zustimmend. »Der Taifun scheint ja allmählich abzuflauen; wir wollen zunächst, so ungern ich etwas von unserem Gasvorrat opfere, noch etwas tiefer herabsteigen — vielleicht ist der Ausblick unter dieser Wolkenschicht freier —«
Er faßte nach der Schnur und öffnete das Ventil am oberen Ende des Ballons. Mit einem scharfen Zischen entwich das Gas. Die Wolkenschicht unter ihnen kam plötzlich näher — scheinbar; nun hüllten sie die Wolkenmassen selbst in undurchdringlichen Nebel —
Nochmals zog der Führer die Ventilleine.
Mit einem gewaltigen Ruck sank der Ballon durch die hüllenden Wolken —
Unter ihnen flutete endlos — bis an die Grenzlinien des äußersten Horizontes das freie Meer — —
»Vielleicht sehen wir ein Schiff!«, sagte Frau Grete Oldenburger, die nun auch die Gruppe der stumm in einer Gondelecke sitzenden Frauen verlassen und den Platz neben ihrem Gatten eingenommen hatte.
»Hoffen wir es!«, sagte Mr. Morris ernst...
Und über den Rand der Gondel gelehnt, starrten alle mit der Ausdauer, wie sie nur letzter Mut, letzte Hoffnung und letzte Kraft verleihen können, in die öde, weite, trostlose Wasserfläche, die in trübem Graugrün ihre Wellen in endlose Fernen wälzte. — — —
Fast achtundvierzig Stunden waren seitdem wieder vergangen. —
— Da wir nach dem mündlichen Bericht eines Augenzeugen erzählen, hätten wir vielleicht länger bei der Schilderung und Ausmalung der Gemütsstimmung unserer Luftreisenden verweilen müssen, hätten im einzelnen und anschaulicher namentlich die schrecklichen Stunden der Nacht schildern müssen, in denen wild aufschluchzende Verzweiflung und dumpfe Betäubung hoffnungslosen Schmerzes abwechselten, hätten die Leiden namentlich der weiblichen Insassen, nicht zuletzt die Qualen des Hungers, der sich nach den ersten vierundzwanzig Stunden der Fahrt mit seinem lähmenden Schrecken nur um so stärker geltend machte, und gegen den man nur etwas Biskuit und Schokolade hatte — mit satterem Pinsel malen müssen — wir haben es nicht getan und meinen, bei unserer Zurückhaltung auf die Zustimmung des gütigen Lesers rechnen zu dürfen. —
— Noch immer ringsum das weite Meer.
Greifbar nahe aber lag es jetzt unter ihnen; denn trotz des Auswerfens aller entbehrlichen Ausrüstungsgegenstände der Gondel, die bisher als Ballast die Fahrt erschwert hatten, zeigte der Ballon am heutigen Morgen kaum noch soviel Tragkraft, als nötig war, ihn über den Kämmen der hochaufschäumenden Wogen schwebend zu erhalten.
Dazu schien auch die Geschwindigkeit der Fahrt, die Morris in den letzten Stunden als eine südsüdöstliche festgestellt hatte, mit einem Male nachzulassen.
— Sidney Morris war allein wach und spähte mit seinem Glase in die Runde. Immer ernster wurden seine Züge, und als er jetzt einen Blick auf die zusehends schlaffer werdende, fast gasleere Ballonhülle warf, die lose in ihrem Netze schlotterte — und einen zweiten auf die Gruppe der vor Erschöpfung schlafenden Männer und Frauen unter dem Zeltdach der Gondel, wurde zum ersten Male sein Antlitz blaß.
Noch einmal musterte er das Aussehen des Ballons und sah nach dem Barometer —
»Noch eine oder zwei Stunden — dann —«, kam es tonlos über seine Lippen. Seine Augen suchten dabei das junge Mädchen, das bleich wie eine Statue im Arme ihrer Mutter lag, Miß Annie — und abermals wandte er sein Antlitz nach allen Richtungen der Windrose, als könne er so die Rettung herbeiführen —
Nach einer Weile legte jemand die Hand auf seine Schulter.
Er wandte sich rasch um — Maud Ridinger stand hinter ihm.
»Es geht zu Ende mit uns, nicht wahr, Mr. Morris? Unser Ballon wird ins Meer sinken, ehe —«
»Das wollen wir nicht hoffen, teuerste Mrs. Ridinger; jeder Augenblick kann uns ein Schiff oder eine Küste zur Rettung zeigen —«
»Wie er sie uns bis jetzt gezeigt hat, nicht wahr, Mr. Morris. Ach, nicht um leere Redensarten zu machen, habe ich mich zu Ihnen geschlichen — hören Sie meinen Plan!«
Und mit leiserem Flüstern fuhr sie fort:
»Ich bin eine gute Schwimmerin, Mr. Morris — eine oder zwei Stunden Schwimmfahrt im Wasser machen mir nicht viel! Ich will mich also an einem der hier in der Gondel befindlichen Seile bis zum Meeresspiegel herablassen und mit dem Seil am Gürtel, schwimmend den Weg des Ballons begleiten. Das bedeutet für den Ballon immerhin eine Erleichterung um —« sie lächelte ein wenig — »um rund fünfundsechzig Kilogramm —«
Mr. Morris küßte ihr gerührt die Hand.
»Nein, teuerste Mrs. Ridinger — nein! Wenn ein Opfer gebracht werden muß, bin ich der nächste dazu. Auch mir tun ein paar Stunden Schwimmfahrt nicht viel und — ich erleichtere den Ballon um mehr als fünfundsechzig Kilogramm. Zudem erkaufen wir die Erleichterung des Ballons infolge der Bremswirkung des im Wasser nachschwimmenden Körpers mit einer Verlangsamung des Fluges.«
Maud Ridinger vermochte nicht zu antworten; denn unbemerkt war ihr Gatte herzugetreten und schloß ihr mit einem Kusse den Mund.
»Ich weiß, was sie tun will«, sagte er, »schon gestern abend sprach sie davon, Mr. Morris, und nur auf meine Bitte hin hat sie bis jetzt geschwiegen —«
»Schade, my darling, daß du nicht ein Viertelstündchen länger geschlafen hast; dann hätten weder Mr. Morris noch du mich an der Ausführung meines Entschlusses hindern sollen. Gut«, setzte sie entschlossen hinzu, »schließen wir einen Kompromiß, Mr. Morris: Zeigt sich binnen einer Stunde keinerlei Aussicht auf Rettung, so lassen Sie mich an einem Seile hinab aufs Meer; — falls ich mit meinen Kräften zu Rande bin, ehe wir Hülfe gefunden haben, dürfen Sie mich ablösen —«
»Aber — so lassen Sie m i c h doch zuerst —«
»Nein, Mr. Morris! Sie sind der Führer unseres Fahrzeugs, der einzige, der Fachkenntnisse hat, und in diesen letzten Stunden doppelt und dreifach hier oben nötig unter den Verzweifelnden —«
»Es sei, wie du gesagt, Liebling!«, sagte Ridinger ernst und entschieden. »Gott möge deine Opfertat segnen an uns allen!« — — —
— Und nun war die verabredete Stunde — ach, so bleiern langsam für die meisten der Insassen, so entsetzlich schnell für Mr. Ridinger und Mr. Morris — vergangen.
Nirgends ein Punkt am Horizont, der Rettung verhieß — nirgends! Und alle standen an der Brüstung der Gondel und alle wußten, daß sich in den nächsten Stunden ihr Schicksal entscheiden müßte! Auch den todesmütigen Entschluß der tapferen Maud kannten alle, und alle hatten sie vergebens umzustimmen versucht —
»Es ist Zeit, Mr. Morris«, sagte nun die kühne DeutschAmerikanerin. Sie entledigte sich ihres Oberkleides, und Morris legte ihr mit Hilfe Ridingers ein Seil um die Hüften. Nun schwang sie sich über den Rand der Gondel —
Das Seil, an dem sie über der Tiefe hing, spannte sich straff an. Zoll um Zoll ließen Morris und Ridinger das Tau durch die Hände gleiten. Auf der gegenüberliegenden Seite der Gondel aber blickten die andern Insassen bang hinab und sahen die kühne Schwimmerin dem tückischen Elemente immer näher kommen —
Nun ein Aufklatschen des Wassers.
»Halloh!«, klang es von unten, und gleichzeitig machte der flügellahme Ballon einen gewaltigen Satz vertikal aufwärts —
»Nachlassen!«, rief es abermals aus der Tiefe, und die Gondelbewohner sahen, daß der plötzlich um ihr Gewicht erleichterte Ballon beim Emporschnellen Frau Maud wieder mit in die Luft gerissen hatte. Im nächsten Augenblick hatten die beiden Männer das Seil frei nachgelassen. Und nun schwamm die kühne junge Frau ruhig, wie daheim im Schwimmbassin, auf den sich immer mehr glättenden Wellen.
»All right!«, rief sie noch von unten.
— Es schien, als sei der Ballon durch das erneute Steigen in eine kräftigere Windströmung geraten, die noch mehr östlich gerichtet war. — Die Sorge um die einsame Schwimmerin im endlosen Meere da unten ließ alle Balloninsassen die eigene Gefahr vergessen, um so mehr, als sie wußten, daß Mauds Opfermut die letzte Ursache war für die erreichte veränderte Schnelligkeit und Richtung ihrer jetzigen Fahrt.
Ein furchtbarer Gedanke allein drängte sich allen immer wieder auf; besorgt hatte Dr. Sucher ihn eben Mr. Morris gegenüber geäußert: Die Möglichkeit, daß sich Haifische zeigen könnten!
Freilich glaubte Morris den jungen Gelehrten insofern beruhigen zu können, als erfahrungsgemäß diese »Hyänen des Meeres« nur solche Regionen des Ozeans bevölkern, welche einen regen Schiffsverkehr zeigen, weil da ihre Gefräßigkeit am ehesten Beute findet.
»Daß wir aber nicht in der Nähe der eigentlichen Schiffsrouten sind, müssen wir nach unserer fast viertägigen Irrfahrt wohl leider annehmen!« —
Trotzdem spähten aller Augen ängstlich in die graugrünen Fluten, ob nicht doch irgendwo die unheimliche »graue Flosse« des gefürchteten Ungeheuers sichtbar werde — —
Da rief plötzlich eine helle freudige Stimme:
»Land — ich sehe Land! dort — dort!«
Miß Annie Huebner, die mit dem Fernrohr den Horizont abgesucht, hatte es gerufen. Dann sank sie mit Tränen der Freude ihrer Mutter in die Arme.
Nun blickte einer nach dem andern durch das erlösende Fernrohr — und alle sahen, was sie zuerst geschaut — das rettende Land, die gastliche Küste —
Und als wollte das segnende Geschick den Mut und die Opferfreudigkeit noch mehr belohnen, frischte plötzlich, trotzdem der immer mehr sich leerende Ballon von der durch seine Entlastung erreichten Höhe langsam herabgesunken war, eine stärkere Brise auf, die gerade in der Richtung zur ersehnten Küste wehte...
»Wie lange werden wir noch zu fahren haben, wenn diese Windstärke anhält, Mr. Morris?«
»Kaum eine halbe Stunde, Mr. Ridinger. Und da nun die Küste schon etwas klarer in Sicht ist, wollen wir Mrs. Ridinger wieder heraufziehen. Es ist besser, wenn wir im Augenblick unserer Landung alle beisammen sind — wenn Mistreß auch ihr Schwimmpensum noch nicht ganz erledigt hat!«
— Muntere Zurufe belehrten die unverdrossene Schwimmerin über die freundliche Wendung, die ihr Geschick genommen.
»Kann ich nicht bis zum Lande schwimmen? Ich bin noch gar nicht müde!«
»Wir möchten aber alle, daß Sie wieder zu uns kommen, Mrs. Ridinger!«, rief Morris hinab, und ohne ihre Zustimmung abzuwarten, begann er mit Mr. Ridinger das Seil hochzuziehen —
Zwar sank der Ballon in dem Augenblick, als der Körper der Schwimmerin das Wasser verließ, so tief, daß die Damen entsetzt aufschrien aus Furcht, er stürze ins Meer hinab — aber er blieb doch hoch genug über der Wasserfläche, um seinen Flug fortsetzen zu können, und — was Morris einen Moment leise befürchtet, als er den heftigen Sturz bemerkte — auch seine Fahrtrichtung und Schnelligkeit änderte sich trotz der geringen Lufthöhe nicht.
— Als Mrs. Maud den Rand der Gondel erreichte, streckten sich ihr sechzehn Arme entgegen, um sie hereinzuheben. Sie aber fiel mit einem glücklichen Lächeln ihrem Gatten um den Hals und sagte:
»Du freust dich am meisten, daß mich kein Haifisch verschluckt hat, nicht, my darling?«
»Um Gottes willen, Liebste, hast du a u c h daran gedacht?
»Jeden Augenblick, Liebling — aber ich wollte doch dir und den andern nicht das Herz noch schwerer machen!«
Ungefähr eine halbe Stunde später fiel der schlaffe Ballon, den in den letzten Minuten der Fahrt nur noch die leere Hülle wie ein großer Flugschirm über die Schaumkämme der Wellen geschleppt hatte, wie ein todwunder Vogel auf der leicht aufsteigenden Küste des glücklich erreichten Landes nieder!
Die Gondelinsassen kugelten zwar trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ihres Führers ein paarmal bunt durcheinander — aber sie vermochten doch alle aus der Gondel zu steigen und den zitternden Fuß heil und gesund wieder auf den festen, treuen Erdboden zu setzen.
»Neun Kolumbusse auf einmal!«, rief Fritz Oldenburger, der, seit er festen Boden unter den Füßen fühlte, schnell wieder seine alte fröhliche Art zurückgewonnen hatte.
Lachend und weinend vor Freude über ihre Rettung halfen sich die Irrfahrer gegenseitig aus der umgestürzten Gondel heraus.
»Wo mögen wir gelandet sein?«, war die erste allgemeine Frage. Dr. Sucher betrachtete aufmerksam mit Felix Ridinger die Formation der Küste —
»Vulkanisch — nicht wahr?«, fragte der erstere.
»Ja — entschieden, und daraus schon möchte ich den Schluß ziehen, daß wir im Stillen Ozean gelandet sind —«
»Auch m e i n e Meinung, Mr. Ridinger«, sagte nun Dr. Morris, der so lange den Damen behilflich gewesen war, »damit würde auch Dauer und Richtung unserer Luftfahrt am besten übereinstimmen!«
»— Aber auf welcher Küste sind wir?«, fragte Dr. Sucher. »Der vulkanische Ursprung würde auf eine kleine, verlorene Insel des Pazifischen Ozeans hinweisen — leider flog der Ballon so tief, daß wir noch keinen Überblick über ihre Ausdehnung gewinnen konnten —«
»Also n e u n R o b i n s o n s und nicht Kolumbusse!«, rief Fritz Oldenburger, der, sein Frauchen am Arme, näher getreten war.
»Hoffentlich auch die nur vorübergehend, Mr. Oldenburger«, sagte Morris, auf seinen Scherz eingehend. Dann wandte er sich zu den andern:
»Das allererste in unserer neuen Lage wird wohl sein, ladies and gentlemen, uns nach einer Mahlzeit umzusehen. Bis jetzt hat uns vor dem Verhungern Mrs. Huebners Picknicktasche mit ihrem schier unerschöpflichen Vorrat an Biskuit und Schokolade —«
»Er war nicht unerschöpflich, lieber Mr. Morris«, sagte Mrs. Caroline Huebner lachend, »man muß nur einzuteilen verstehen, wie in jedem Haushalt, und man muß so zufriedene Tischgäste haben, als all die Balloninsassen gewesen sind. Freilich habe ich gestern und heute die Bissen gar zu klein machen müssen —«
»Folglich«, nahm Morris seine Rede wieder auf, »müssen wir sie etwas größer zu machen versuchen und wollen also den Strand nach Muscheln absuchen — vielleicht können wir dann auch ein kleines Feuer machen, um sie zu rösten! Also auf — wer sich noch kräftig genug fühlt!«
Und alle brachen auf, und bald verkündeten fröhliche Rufe, daß dieser oder jener einen eßbaren Fund gemacht, den die eben einsetzende Ebbe freilegte. — —
Der wunderbare Wechsel ihres Schicksals, das aus übermütiger Feststimmung heraus sie tagelang dem furchtbaren Zyklon mit seinen tausend Schrecken ausgesetzt, um sie dann in letzter Stunde auf dem müden Fittich des erschöpften Luftseglers auf diesem Eiland in Sicherheit zu bringen, hatte bei den neun Ballonfahrern ein fast kindliches Glücksgefühl erzeugt, das ebenso sehr der überströmenden Dankbarkeit gegen das gütige Geschick als der Freude am neugeschenkten Dasein entsprang...
Wie eine schwärmende Schar fröhlicher Kinder tummelten sie sich am Strande beim Muschelsammeln. In allen geeigneten oder ungeeigneten Behältern — Hüten, Rocktaschen, Taschentüchern usw. — wurden sie geborgen. Auch ohne weitere Zubereitung schmeckten sie den teilweise recht verwöhnten Gaumen der »Schiffbrüchigen« vortrefflich und halfen über den allerersten, nagendsten Hunger hinweg. — Und als Fritz Oldenburger schließlich den von ihm fest an das Weidengeflecht der Gondel geschnürten Korb mit dem »Rüdesheimer« aus dem deutschen Wirtshaus in St. Louis — bis auf eine zerbrochene Flasche heil und unversehrt fand und von diesem glücklichen Fund Mitteilung — im wörtlichen Sinne — machte, fühlte sich die Reisegesellschaft so gestärkt, daß sie über all das Erlebte plaudern konnte, wie über einen schweren, bösen, angstvollen Traum...
An einer gegen die See etwas geschützten Stelle des Ufers beschlossen die Herren dann ein Feuer zu machen.
»Aber das Brennmaterial?«, fragte Frau Grete Oldenburger.
»Vorläufig wollen wir das trockene Seegras dazu benutzen, das der Wellenschlag dort am Ufer seit langer Zeit angetrieben hat. Da wird sich auch wohl etwas Treibholz finden, hoff' ich!«, antwortete Dr. Sucher.
»Gewiß — das ist ja immer so — bei allen Robinsons, liebe Grete!«, sagte ihr Gatte lachend. »Bis jetzt haben wir alles programmäßig absolviert: Nr. 1: unerlaubte Abreise — Nr. 2: Irrfahrt — Nr. 3: Schiffbruch — Nr. 4: Landung an einer rettenden Küste — Nr. 5: Aufsuchen von Seemuscheln usw. zur ersten Mahlzeit — bleibt also Nr. 6: Feuermachen! — nur daß wir es damit wahrscheinlich bequemer haben. Denn wir haben ja als Kinder einer modernen Zeit und im Zeitalter der Chemie — Streichhölzer! Nicht wahr, meine Herren? Selbst ich — als Nichtraucher —« er faßte in die Tasche seines Überziehers —
»Donnerwetter! Die habe ich irgendwo liegen gelassen oder bei der Fahrt verloren! — Aber Sie, meine Herren?« —
Er sah fragend auf die andern.
»Ich bin, wie Sie, Nichtraucher, Mr. Oldenburger«, sagte Morris, »und ich habe leider auch keine bei mir —«
»Aber du, Freund Heinz —«
»Ich denke doch!«, sagte dieser und begann zu suchen. Sein Gesicht wurde rot und wieder blaß.
»Aber ich muß eine Schachtel ›Schweden‹ bei mir haben!«, wiederholte er, in nervöser Hast alle seine Taschen durchsuchend, immer von neuem... Aber — er fand keine!
Schon während der Privatdozent zu suchen begann, hatte der Ingenieur Ridinger lächelnd in eine Tasche seines Mantels gegriffen — und als jetzt Oldenburger ihn ängstlich fragte:
»Und Sie, Mr. Ridinger?« —
— reichte er ihm einen kleinen Apparat.
»Ein Taschenfeuerzeug, Mr. Oldenburger!«, sagte er zur Erklärung. »Es enthält eine kleine, elektrische Batterie, welche beim Druck auf diesen Knopf ein PlatinAsbestgewebe zum Glühen bringt. Mit dieser Glühvorrichtung läßt sich bequem die Zigarre entzünden — Sehen Sie!«
Er drückte auf den Knopf —
Aber der Platindraht blieb dunkel!
Nochmals versuchte er es — und nochmals —
Hastig nahm er den kleinen, kompendiösen Apparat auseinander, untersuchte die Kontakte und Verbindungen, setzte ihn wieder zusammen, probierte abermals —
Alles umsonst — das Taschenfeuerzeug funktionierte nicht mehr —
»Vielleicht ist es bei unserer Landung naß geworden, so daß die Batterie gelitten hat«, meinte Morris.
»Oder das feine Platingewebe ist zerstört, durchgebrannt vom oftmaligen Gebrauche —«, setzte Dr. Sucher hinzu.
Kopfschüttelnd untersuchte Ridinger sein Instrument immer wieder — — das Endergebnis blieb das gleiche!
»Ja«, sagte Fritz Oldenburger nach einer Pause allgemeiner Bestürzung — »dann sind wir allerdings nicht besser daran, als der OriginalRobinson Daniel Defoes und müssen eventuell auf einen gutherzigen Blitzstrahl warten, der irgendwo einen Baum entzündet —«
»Erlaube, Fritz, daß ich dir zu Hilfe komme!«, sagte Frau Grete, sich vor ihrem Gatten mit einem triumphierenden Lächeln verneigend — »jetzt ist der große Augenblick gekommen, wo ich die Lektüre meiner Mädchenjahre verwerten kann! Wie oft hast du gescholten, wenn du mich wieder einmal bei einem phantastischen Roman J u l e s V e r n e s fandest!«
Und sie wendete sich zu den übrigen:
»Kennen Sie ›Die geheimnisvolle Insel‹, meine Herrschaften? — Oder ›Die Abenteuer des Kapitäns Hatteras?‹ — Darin ist beschrieben, daß man sich Feuer verschaffen kann, indem man zwei Uhrgläser, mit Wasser gefüllt, zu einer Brennlinse zusammenkittet — oder indem man aus Eis mit den warmen Händen eine solche zurechtschmilzt —«
»Das letztere ist leider vorläufig unmöglich, mein kluger Schatz!«, unterbrach sie neckenden Tones ihr Gatte.
»Aber das erstere nicht! — Schnell, meine Herren — zwei Uhrgläser! Zum Zusammenkitten der Ränder können sie wohl feuchten Seesand benutzen —«
Lachend zogen die Angeredeten die Uhren aus der Tasche, klappten die Sprungdeckel auf und versuchten die Gläser herauszunehmen.
Als aber Dr. Sucher und Ridinger die ihren glücklich unzerbrochen ausgelöst hatten, zeigte es sich, daß sie viel zu flach, fast eben geschliffen waren, als daß man sie zu einer wirksamen Brennlinse hätte verkitten können.
»Aber —«, mit einem schallenden Gelächter schlug Fritz Oldenburger sich vor die Stirn — »wozu brauchen wir solch komplizierte Vorrichtung, meine Herren! Haben wir nicht Mr. Morris' Fernrohr? Darin sind ja mindestens drei Linsen, wie wir sie bedürfen! Bitte, Mr. Morris!«
Und er raffte selbst ein Büschel trockenen Seegrases zusammen, indes Morris die größte der Fernrohrlinsen abschraubte. —
Aber als er sie eben auf das Seegras richtete, ging die Sonne weg, die diesen ganzen Morgen lang herniedergestrahlt, und der Himmel überzog sich mit Wolken.
So blieb die Hoffnung, ein Feuer anzünden zu können, vorläufig unerfüllt. Auf Morris' Rat begannen die Herren die Gondel des Ballons, die halb im Ufersande versunken lag, aufzurichten. Man zog sie weiter auf den Strand, wo sie vor dem Anprall des Meeres geschützt war, und verankerte sie mit Stricken und Steinen im Boden, so gut es ging.
Ein Teil der Ballonhülle wurde dazu verwendet, in roher Form ein Zeltdach herzustellen, das die Gondel geräumig überspannte. — Über dieser Arbeit, an deren letztem Teile sich auch die Damen eifrig beteiligten, ging fast der ganze Tag dahin. — Zum Vesper- oder Abendbrot gab es wieder eine Portion Seemuscheln mit Rüdesheimer und den letzten Rest Bisquit aus Mistreß Huebners Picknickbeutel.
Nachdem Morris und Ridinger noch gegenseitig verabredet, je zur Hälfte die Nachtwache zu übernehmen, suchte die kleine Gesellschaft die Ruhe, und jeder bereitete sich in der Gondel sein Lager, so bequem es bei der geringen Ausstattung möglich war. Schlief man doch heute das erstemal wieder auf festem Boden!
Indes Ridinger am Strande auf- und niederschritt, stieg Morris den Uferhang hinan, der an einem Punkte ziemlich steil war. Oben angelangt, richtete er sein Fernrohr nach allen Seiten. —
Zwar wechselte schon am fernen Horizont die nur kurze Dämmerung in den Schatten der Nacht; aber noch blieb es einen Augenblick hell genug, um zu schauen, was er gefürchtet. —
Auf allen Seiten — ringsum — Wasser, nichts als Wasser!
— Ein winziges Eiland, eine Oase im Weltmeer, kaum ein paar tausend Schritt im Umfange. — —
Wie lange würden sie auf diesem baumlosen, unfruchtbaren Felsen im Ozean ihr Leben fristen können — neun Menschen, darunter fünf zarte Frauen?
Am andern Morgen — der Himmel zeigte ein trübes Grau — rief Morris die Mitglieder der kleinen Kolonie zusammen und führte sie auf die Spitze der Uferhöhe, die zirka fünfzig Meter über dem Spiegel des Meeres sich erhob.
»Eine kleine Insel!«, riefen einige der Damen beim Umschauhalten.
»Ja, meine Damen«, sagte Ridinger, den Morris gestern abend noch verständigt hatte, »leider nur eine kleine Insel. —«
»Und wie es scheint, ganz unbewohnt«, fügte Dr. Sucher nach einer längeren Besichtigung durch das Fernrohr hinzu.
»Desto besser für uns«, fiel Fritz Oldenburger ein — »dann brauchen wir uns nicht vor den Kannibalen zu fürchten, die sonst ein unentbehrliches Requisit jeder echten und ehrlichen Robinsonade bilden —.«
»Die Vegetation scheint auch sehr spärlich zu sein«, sprach Frau Elisabeth, mit dem Fernrohr einzelne grüne Stellen der Insel absuchend.
»Ja — leider!«, sagte ihr Gatte zustimmend — »das ganze Gebiet macht eben den Eindruck der Neuheit sozusagen — als sei das Eiland erst vor wenigen Jahren aus dem Schoße des Meeres aufgestiegen.«
»Der offenbar vulkanische Charakter der Insel würde diese Ansicht nur noch unterstützen«, äußerte Ridinger.
»Und der Mangel einer Bevölkerung auch!«, setzte Oldenburger hinzu.
»Leider sinken damit auch unsere Aussichten auf baldige Befreiung; denn der neuerliche Ursprung der Insel läßt befürchten, daß sie noch auf keiner der gewöhnlichen Schiffskarten verzeichnet ist«, sprach Sidney Morris ernst. »Ich halte es nämlich auf jeden Fall für das beste, ladies and gentlemen, unsere Lage von vornherein klar ins Auge zu fassen. Lassen Sie uns alle gleich weit von sorglosem Optimismus als verzagendem Pessimismus bleiben! Unsere nächste Aufgabe ist nach meinem Dafürhalten eine dreifache: erstens — kein Mittel unversucht zu lassen, etwa vorüberfahrende Schiffe von unserem Hiersein zu verständigen, zweitens — unser Obdach so wohnlich und wettersicher als möglich zu machen; denn nach Beobachtung aller Umstände müssen wir annehmen, daß wir auf einer Insel des Pazifischen Ozeans, nach dem Laufe der Sonne zu schließen, vielleicht in der Nähe des südlichen Wendekreises, gelandet sind, wo uns jetzt die Äquinoktialstürme bevorstehen, — und drittens, daß wir alles aufbieten müssen, jeder an seinem Teile, um ausreichendere Nahrung, Trinkwasser und — last not least — Feuer für uns zu verschaffen!«
Morris hatte geendet, und alle fühlten, daß er recht hatte.
»Vielleicht«, sagte nach einer Pause Ridinger, »ist es für diese letzte Aufgabe vorteilhaft, eine Teilung der Arbeit vorzunehmen, so daß die Damen den Strand regelmäßig nach Muscheln absuchen, indes wir den übrigen Teil in Angriff nehmen. Ich schlage darum zunächst eine genauere Besichtigung der Insel vor. Vielleicht entdecken wir dabei trinkbares Wasser und irgend etwas Eßbares, meinen Sie nicht auch, Mr. Morris?«
Morris nickte. »Ich habe nur ein Bedenken, die Damen ohne jeden Schutz hier am Ufer allein zu lassen —«
»Dann will ich hierbleiben«, sagte Fritz Oldenburger.
»Gut, Mr. Oldenburger. Und nun: Good bye, ladies and gentlemen!«
Damit stieg Morris mit Sucher und Ridinger auf der anderen Seite der Anhöhe hinab, indes die übrigen sich anschickten, an den Strand zurückzukehren.
Die drei Pioniere stiegen über das Basaltgeröll der auf dieser Seite steiler abfallenden Felsbildung vorsichtig auf das eigentliche Inselterrain hinab. Schweigend schritten sie eine ganze Weile nebeneinander her, die Augen emsig nach allen Seiten richtend. —
Dann blieb Morris plötzlich stehen, zog das Fernrohr aus der Tasche, stellte es ein und betrachtete einen Punkt mitten in der fast ebenen Inselfläche.
»Was haben Sie bemerkt, Mr. Morris?«, fragte Ridinger, der vorangeschritten war und sich nun umsah.
»Bitte, nehmen Sie einen Augenblick das Glas, meine Herren, und blicken Sie auf den glänzenden Streif dort mitten in dem Terrain!«
Die beiden Angeredeten taten, wie ihnen geheißen.
»Nun, gentlemen, was ist dies?«
»Irgend ein spiegelndes Objekt, das den Reflex des Himmels zeigt, Mr. Morris!«, sagte Ridinger.
»Also — Wasser offenbar, meinen Sie nicht auch?«
»Wir wollen es hoffen«, meinte Dr. Sucher zweifelnd, »leider könnte es auch irgend ein vulkanischer Glasfluß, eine Art von Obsidian sein, der in diesem Eruptivgestein eine Spalte des aufgetriebenen Bodens ausgefüllt hat —«
»Wir werden es bald wissen! Vorwärts, meine Herren!«
Und die Männer schritten, so schnell das unregelmäßige Gefüge des Terrains es ihnen erlaubte, auf die fragliche Stelle zu. —
Es war wirklich Wasser!
Morris bückte sich rasch und schöpfte mit der hohlen Hand.
»Es ist nicht salzig!«, rief er froh. »Ich fürchtete schon, es sei von einer Überflutung der Insel zurückgebliebenes Brackwasser —«
Wahrscheinlich ist es durch Regen und sonstige atmosphärische Niederschläge entstanden«, antwortete Ridinger, seinen Spazierstock hineintauchend. »Übrigens, die natürliche Zisterne scheint ziemlich tief zu sein, sehen Sie doch!«
Trotzdem er auch den ausgestreckten Arm noch fast ganz in das Wasser tauchte, stieß er nicht auf den Grund.
»Derartige vulkanische Spalten sind häufig sehr tief«, entgegnete Morris.
»Desto besser für uns alle!«, rief Dr. Sucher, der nun auch das Wasser gekostet hatte — »ich finde, es schmeckt ganz rein.«
»Verdursten werden wir also wahrscheinlich nicht«, schloß Morris die Untersuchung, nochmals die ziemlich breite Spalte, die in einer Länge von fast zehn Metern im Boden verlief, mit den Augen messend.
»Dann weiter!«, rief Dr. Sucher. »Entdecken wir auch Nummer zwei: unser täglich Brot in irgend einer Gestalt, gleichviel, ›ob es kreucht oder fleugt‹! Ich muß sagen, ich hoffe auf etwas, das da fleugt. Derartige einsame Felseninseln sind eigentlich dafür bekannt, daß sie den Seevögeln als Brutplätze dienen —«
»Das ist auch meine Hoffnung«, sagte Ridinger; »denn ich glaube kaum, daß unsere noch verhältnismäßig junge Insel etwas anderes beherbergt.«
— Aber diese Hoffnung schien sich leider nicht zu erfüllen! Es gewann immer mehr den Anschein, als berge die Insel außer ihnen keine Spur lebender Wesen. Und obwohl die drei Kundschafter stundenlang, die Kreuz und Quer, alle Bodensenkungen, alle erreichbaren Uferlöcher untersuchten, fanden sie nichts, so sehr auch der sich einstellende Hunger ihre Sinne schärfte...
Der Küstenrand fiel hier ziemlich steil ab und zeigte sich in seiner zerklüfteten Form wie geschaffen für nistende Vögel — aber diese selbst waren nicht zu entdecken.
Verzweifelt trat man den immer wieder aufgeschobenen Rückweg an, diesmal am Ufer entlang kletternd, immer noch in der Erwartung, die Spuren von Seevögeln zu finden.
»Was fangen wir nur an, Mr. Morris?«, rief Ridinger ein Mal über das andere verzweifelt aus.
Aber auch Morris wußte keinen Rat.
»Ob wir es einmal mit dem Fischfang versuchen —«, fiel Dr. Sucher ein, »was meinen Sie? Ein Netz würden unsere Damen aus den vorhandenen Ballonstricken wohl knüpfen können. Wir könnten wohl auch versuchen, Angeln zu legen —«
»Wenn wir nur irgendwelchen Köder dafür hätten!«, seufzte Morris. — Schweigend begannen sie dann ihre Uferkletterei von neuem...
Noch einmal unterbrach Morris seine Wanderung, kurz vor dem Ziele —
»Feuer müßten wir uns aber auf alle Fälle zu verschaffen suchen, schon um unser einförmiges Seemuschelgericht durch Rösten schmackhafter zu machen. Der Zufall scheint uns dabei zu Hilfe zu kommen: ich sehe da unten eben einige große Büschel von vertrocknetem Seegras hängen, in denen sich ein größeres Stück Treibholz gefangen hat. Ich möchte daraus eine Art Stativ zurechtschnitzen, um daran nach Mr. Oldenburgers Rat eine Linse meines Fernrohrs zu befestigen.«
Damit kletterte er vorsichtig tiefer hinab. Sich fest an den Uferhang anklammernd, gelang es ihm, seinen Fund dicht über dem Wasserspiegel der leise anflutenden See zu ergreifen und in Sicherheit zu bringen.
Freudig zeigte er seinen Gefährten den erbeuteten Schatz. Dann schnitzte er ein primitives Stativ zurecht, indes Ridinger eine Klammer oder Gabel aus einem abgespaltenen Stück des Treibholzes herzustellen versuchte —
»Geben Sie mir doch einmal die Linse, die Sie benutzen wollen, Mr. Morris — ich möchte sie einpassen«, sagte der letztere.
»Bitte, Mr. Ridinger —« Morris faßte in die Tasche seines Überziehers, in der er das kleine Teleskop zu bergen pflegte —
Sie war leer.
Abermals durchsuchte er hastig auch die übrigen Taschen seiner Kleider — Ridinger hatte ihn mit steigender Sorge beobachtet —
»Ihr Teleskop, Mr. Morris?«
»— ist verschwunden!«
»So müssen Sie es verloren haben — vielleicht an der Süßwasserzisterne!«, meinte Dr. Sucher.
»Sollte es beim Wasserschöpfen — ich bückte mich allerdings ziemlich tief und ziemlich hastig — aber — das hätte ich doch wohl gemerkt —«
»Oder vorhin beim Klettern an der Uferwand, Mr. Morris? —«
»Aber ein so hellglänzender, metallner Gegenstand — so winzig war er doch nicht, daß ich ihn nicht hätte fallen hören —«
Aber bei dem letzten Worte wurde Morris blaß —
»Sollte ich es doch verloren haben? Als ich mich nach dem Stück Treibholz herabbückte, hörte ich etwas ins Wasser plumpsen — ich hielt es für ein Stück abbröckelndes Gestein, das unter mir losbrach —«
»— Sollen wir umkehren, es zu suchen, Mr. Morris?«
»Das wird kaum Erfolg haben, Mr. Ridinger. Auf ebenem Boden kann ich es nicht verloren haben, und vom Grunde des Meeres werden wir es schwerlich heraufholen können!«
»— Falls es nicht doch noch auf dem Boden der Zisterne liegt«, sagte Dr. Sucher.
»— Nein, nein! Das glaube ich bestimmt versichern zu können, daß ich es nach unserem Aufbruch von der Wasserspalte noch in der Tasche fühlte. — Kommen Sie! Sagen Sie aber den übrigen noch nichts von meinem Malheur, Gentlemen, ich bitte Sie —«
— — Trauriger als zuvor schritten sie vorwärts. Nach kurzer Wanderung kam der flache Teil des Ufers in Sicht, und die Damen schwenkten schon von weitem die Taschentücher, als sie die Zurückkehrenden erblickten.
»Haben Sie etwas gefunden, meine Herren?«, rief Frau Grete Oldenburger ihnen entgegen.
»Nur Trinkwasser!«, klang es traurig zurück.
»Aber wir —«, jubelte sie, »haben etwas Eßbares! Kommen Sie, sehen Sie, schmecken Sie — g e b a c k e n e F i s c h e ! «
Starr vor Verwunderung standen die Drei vor der primitiven Bratpfanne, in der Morris unschwer die kupferne Fassung des Ballonventils wiedererkannte —
Sie war gefüllt mit einem Gericht knusperig gebratener Fische!
»Wer hat dies Zauberkunststück vollbracht?«, fragte endlich Dr. Sucher.
»In der Theorie deine kluge Frau, lieber Heinz — in der Praxis — wir alle, nicht wahr, meine Damen?«
»Das meiste Verdienst haben Sie aber doch, Fritz«, entgegnete Frau Dr. Sucher; denn Sie haben das kostbarste uns geschenkt — d a s F e u e r ! «
»Und die Damen, namentlich Miß Annie, haben das Fischnetz gestrickt — Sie hätten einmal all die flinken Fingerchen sehen sollen! Ich konnte gar nicht soviel Bindfaden aus den Ballonstricken aufdröseln, als sie verknüpften — und Mrs. Ridinger hat das Netz ein großes Stück ins Meer hineingeschleppt. — Dann haben wir es wieder eingezogen, und das übrige haben die gefälligen Fische besorgt, die von Mrs. Huebners Biskuitkrumen angelockt waren. — Essen Sie, meine Herren, essen Sie! Wir haben es bereits getan und sind wirklich alle vollständig satt.«
»Aber die Butter zum Backen —«, fragte kopfschüttelnd Mr. Morris. »Ich weiß wohl, daß die Indianer ihre Fische am offenen Feuer rösten — aber diese haben ja beinahe das Aussehen, als ob sie — wie sagt man — paniert und in wirklicher Butter gebraten wären?«
»Ei, Mr. Morris — dies Küchengeheimnis sollen wir Ihnen auch verraten?«, scherzte Maud Ridinger. »Nun — da steht das Glückskind, dem der gütige Meergott dies Geschenk beschert hat, unsere liebe Miß Annie! — Erzählen Sie ihm doch, wie Sie den Fund gemacht haben, liebste Miß!«
Das junge Mädchen lächelte.
»O, es war sehr einfach. Die Damen hatten das Netz ausgelegt, und ich grub auf Mamas Rat eine tiefe, viereckige Grube in den Sand, in die wir die gefangenen Fische hineinlegen wollten. Da stieß ich beim Graben mit dem Spazierstock Mr. Oldenburgers auf einen harten Gegenstand, der sich in den Ufersand eingebettet hatte — es war —«
»Eine Kokosnuß!«, rief Morris, der eben einen der kleinen Fische verzehrt hatte.
»Ja, Mr. Morris — schmecken Sie es heraus?«
Alle lachten.
»Mr. Oldenburger hat dann die Kokosnuß geöffnet, so geschickt, daß wir die Schale noch zu einem Gefäß benutzen können«, ergänzte Maud Ridinger die Erzählung der Miß, — dann hat er uns eine Bratpfanne aus dem scheibenförmigen Kupferblech des Ballonventils zurechtgehämmert« —
»Respekt, meine Herren, Respekt!«, flocht Oldenburger lachend ein, »es war nicht so leicht — mit einem Stein als Hammer und einem anderen als Amboß! — Ich habe vor Kupfer- und sonstigen Schmieden seit ein paar Stunden mehr Hochachtung als früher —«
»— Und als die Pfanne fertig war, haben wir Kokosschnittchen geröstet und dann haben wir die Fische in der ›Kokosbutter‹ gebraten, wir, das heißt eigentlich nur unsere teure Mrs. Huebner!«, schloß die Sprecherin.
»Aber das Feuer?«
»Das hat Mr. Oldenburger als unser Prometheus uns verschafft, ihn müssen Sie fragen, Mr. Morris.«
»Aber wie nur, Mr. Oldenburger —«
»O — auch sehr einfach! Hören Sie: Als Sie drei gegangen waren, saß ich noch ein Weilchen mit Frau Elisabeth und meiner Frau auf der Anhöhe — Welches sind denn eigentlich die Methoden, Feuer zu erzeugen? fragte ich mich dabei immer wieder, und schließlich, als mich meine Schülererinnerungen im Stiche ließen, auch mein Gretel aus Jules Verne keinen Rat mehr wußte, gab Frau Elisabeth als würdige Tochter ihres gelehrten Herrn Vaters an der Hand der wissenschaftlich bekannten Methoden, Wärme zu erzeugen, die Geschichte des Feuerzeugs — von dem Feuerbohrer der SüdseeInsulaner bis in die neueste Zeit der elektrischen Küche. — Leider ist uns verfeinerten Kulturmenschen gerade die primitivste Art des Feuermachens, das Aneinanderreiben eines harten und weichen Holzes, wegen mangelnder Erfahrung, Geschicklichkeit und Ausdauer unmöglich geworden. — Dann kam die Zeit der Feuersteine an die Reihe — und einen Augenblick lang dachte ich daran, nach geeigneten Steinen hier am Strande Umschau zu halten. Dann fielen mir allerdings die mißglückten Versuche aus meiner Knabenzeit ein, bei denen wir, trotzdem ›Stahl und Stein und Zunder‹ vorhanden waren, immer nur ›tote‹ Funken erhielten. — Ihre Methode, Mr. Morris, mit der Brennlinse Feuer zu machen, blieb schließlich in unserer Lage die einzige, die Aussicht auf Erfolg versprach — leider belehrte mich ein Blick auf den trüben, grauen Himmel auch über ihre vorläufige Unausführbarkeit —«
»Sie wäre auch bei Sonnenschein leider nicht mehr möglich gewesen!«, seufzte Mr. Morris, mit kurzen Worten sein Mißgeschick erzählend.
»— All' die schönen Mittel, Feuer zu machen, die Frau Elisabeth dann in chronologischer Ausführlichkeit berichtete: die Döbereiner'sche Zündmaschine, die SchwefelsäureTunkhölzer, die Phosphorhölzer, die echten oder unechten Schweden ›utan svafel och phosphor‹ — hinterließen in mir bei ihrer Aufzählung nur den Schmerz der schönen Erinnerung und das Gefühl ihrer Unerreichbarkeit für uns Schiffbrüchige. — Ganz zuletzt und beiläufig — als Zugabe gewissermaßen — sprach meine gelehrte Dozentin dann das Wort aus, das wie ein Blitzstrahl meine Seele erhellte, das Wort:
›P n e u m a t i s c h e s F e u e r z e u g!‹
›Heureka!‹, rief ich aus, aufspringend und den Abhang hinuntereilend. — Das Wort hatte mir zaubergleich einen Winkel meiner Schülererinnerungen erleuchtet: ich sah in der Physikstunde auf dem Experimentiertische den kleinen Apparat stehen — einen fußhohen, dickwandigen Glaszylinder, in welchen ein strengschließender Kolben rasch hinabgestoßen wird, der am unteren Ende ein Flöckchen Zunder oder Schwamm trägt. Durch die schnelle Kompression der Luft wird soviel Wärme erzeugt, daß das Schwammflöckchen ins Glimmen gerät. — Greifbar sah ich dies wieder vor mir und wußte auch mit einem Male, woher ich in unserer armseligen Lage das dickwandige Glasrohr nehmen sollte: das QuecksilberBarometer in unserer Gondel lieferte es mir. Schelten Sie nicht, Mr. Morris, daß ich es entzwei gemacht habe — es war schon bei unserer Landung trotz seiner sogenannten ›stoßsicheren‹ Aufhängung mitten durchgebrochen und enthob mich der heiklen Aufgabe, die dickwandige Glasröhre passend zu zerschneiden. Das obere, zugeschmolzene Ende hatte noch reichlich Fußlänge, war also für meinen Zweck wie geschaffen. Ein passender Kolben dazu war aus einer Stahlspreize von Gretels Sonnenschirm durch Umhüllung mit einem schmalen Streifen Ballonzeug schneller hergestellt, als ich dachte — einen Flocken Verbandwatte als Zunder lieferte mir die kleine Taschenapotheke aus Mrs. Huebners unerschöpflicher Picknicktasche.«
»Ach, Mrs. Huebner —«, rief Dr. Sucher, der alten Dame beide Hände reichend, »was fingen wir an, wenn wir Sie nicht mit auf unsere Insel gebracht hätten! Sie sind der gute Geist unserer Gesellschaft!«
Alle jubelten Beifall. — Mr. Oldenburger aber fuhr fort:
»Mit klopfendem Herzen unternahm ich mein erstes Experiment! Rasch stieß ich den Kolben in die Röhre hinab — es mißlang! Auch das zweite! Aber das dritte zeigte mir das Aufglimmen des Watteflöckchens im Innern des Glasrohres — nur hatte ich in meiner Freude vergessen, den Kolben mit dem glimmenden Flöckchen schnell wieder herauszuziehen! Aber der nächste Versuch brachte volles Gelingen — und schnell hatte ich die kostbare Glut in ein Häufchen Papierschnitzel und Seegras gebracht, das ich mir schon vorher hergerichtet hatte. — Aber wie habe ich mich doch gefreut, als ich durch mein eifriges Pusten endlich die kleine rote Flamme hervorlockte! — Dann haben die Damen aus Steinen einen Herd gebaut — das übrige wissen Sie. — Wie gesagt — sehr einfach! Und hier ist der ›gläserne Prometheus‹, meine Herren!«
Er zeigte ihnen die einfache Vorrichtung und zeigte auch, wie sie beim Komprimieren ein Flöckchen Zunder entzündete, von dem er sich durch Ansengen eines Taschentuches gleich einen Vorrat hergestellt hatte. —
»Wir wollen aber dieses unersetzliche Feuerzeug nicht für gewöhnlich benutzen, nicht wahr, Mr. Oldenburger —«, sagte Morris besorgt — »die Glasröhre könnte doch einmal zerbrechen —«
»Ganz meine Meinung, Mr. Morris! — Es wird unsere Aufgabe sein, in der Asche unseres Herdes immer etwas Glut zu bewahren —«, rief Fritz Oldenburger zustimmend — »ich habe darum Miß Annie im Namen aller feierlich zur ›Vestalin‹ ernannt, die gleich ihren römischen Schwestern die große Aufgabe hat, die heilige Flamme unseres Herdes zu hüten!« — Die Herren verbeugten sich vor der schlanken jungen Miß, die lächelnd errötete.
— Am anderen Morgen, bei langentbehrtem Sonnenschein, finden wir die Herren der Kolonie wieder auf der Höhe der Insel.
Eine wichtige Aufgabe sollte heute gelöst werden: die Aufstellung irgend eines weithin sichtbaren Signals für etwa am Horizont vorüberfahrende Schiffe.
Leider mangelte es dazu am Unentbehrlichsten, am Holz; denn die wenigen Stücke Treibholz mußten für die »Küche« aufgespart bleiben.
Diese hatte übrigens sich heute morgen völlig auf der Höhe der Situation gezeigt: Mrs. Huebner hatte in der Kokosschale von dem letzten Rest der mitgenommenen Schokoladetafeln einen süßen Morgentrank gekocht, bei dem »Reih' um« getrunken wurde — wegen Tassenmangels — was im übrigen der allgemeinen fröhlichzuversichtlichen Stimmung durchaus keinen Eintrag tat; im Gegenteil!
— Man kam schließlich dahin überein, aus zusammengetragenem Steingeröll eine Art Pyramide aufzubauen und an ihrer Spitze einen langen Wimpel aus Ballonstoff zu befestigen.
»Die leuchtend g e l b e Farbe, mit der man das Seidenzeug getränkt hat, um den GuttaperchaÜberzug vor der zerstörenden Wirkung der ultravioletten Sonnenstrahlen zu schützen, kommt uns dabei trefflich zu statten«, meinte Morris.
»Und ich denke eben daran, daß dieser GuttaperchaÜberzug uns ja ein famoses Mittel gibt, wasserdichte Schläuche oder Säcke herzustellen, in denen wir unseren Wasservorrat schöpfen und aufbewahren können. Das erspart den Damen viel Lauferei nach der Zisterne —«, setzte Dr. Sucher hinzu.
Und er eilte noch einmal den Abhang hinab, um den in der Gondel sitzenden Damen diesen neuen Auftrag der »Ansiedlungskommission« zu überbringen.
— Der ganze Vormittag verging über der Arbeit des Steinesammelns und Aufbauens. Das Mittagsmahl brachte, wie gestern, gebackene Fische, zu denen sich heute noch ein Gericht gerösteter Muscheln gesellte, während der »Umtrunk« aus einem Gemisch »Rüdesheimer« und Wasser bestand, von Fritz Oldenburger bereitet.
— Am Nachmittage halfen auch die Damen beim Bau der Signalpyramide — mit Ausnahme von Mrs. und Miß Huebner, die am Strande zurückgeblieben waren.
Miß Annie lag, die Arme unter dem Köpfchen, ausgestreckt im warmen Ufersande und blickte in den unendlichen Äther über sich, der heute wolkenlos war. Nirgends zeigte sich ein Punkt, der den Blick fesselte, und so schlossen sich die Lider ihrer Augen immer öfter und immer länger —
Plötzlich fuhr sie auf —
Ein weißschimmerndes Etwas glitt über ihrem Haupte schnell dahin!
»Ein Vogel!«, schrie sie laut und freudig auf —
Beim schnellen Aufrichten sah sie noch, wie er an einer der steilsten Stellen der östlichen Uferwand hinstrich.
Dann war er mit einem Male verschwunden, als habe ihn ein Zauber unsichtbar gemacht!
Schnell rief sie ihre Mutter und erzählte ihr diese Beobachtung. Beide Damen blickten nun stundenlang nach dem Steilufer — aber der Vogel, wenn es ein solcher gewesen, erschien nicht wieder! — — —
Am Abend wehte ein stolzer, sonnengelber Wimpel vom höchsten Punkte der Insel hernieder.
»Hoffentlich lockt er uns bald ein braves Schiff heran!« Mit diesem Ausspruche verließ Felix Ridinger als letzter die Anhöhe und sprach damit aus, was heute wohl ein jeder der »Schiffbrüchigen« beim Herantragen und Auftürmen jedes einzelnen der vielen Steine immer wieder von neuem still gewünscht hatte.
Miß Annie hatte über ihr Erlebnis berichtet.
Trotz der nahen Dämmerung beschloß Morris, mit Hilfe der anderen Herren den bezeichneten Teil des östlichen Uferhanges noch zu untersuchen. Rasch wurden Seile aus dem Ballon herbeigeschafft. Im Eilschritt ging es an Ort und Stelle. Morris seilte sich an und begann sich an dem stark überhängenden Felsvorsprunge hinabzulassen, von den Gefährten gehalten, die, durch seine Zurufe geleitet, das Seil mehr oder minder ablaufen ließen. So untersuchte er stückweise die stark zerklüftete Steilwand —
Und endlich, an der verstecktesten, unzugänglichsten Stelle, fand sein scharfes Auge eine dunkle Höhlung, kaum so groß allerdings, daß er mit der Hand hindurchfassen konnte. Vorsichtig tastete er hinein —
Ein zischendes Geräusch ließ sich hören — Ein Schmerz, wie von einem scharfen Hieb, ließ seine Hand einen Augenblick zurückzucken; aber schon hatte er gefühlt, um was es sich handelte —
Als er die blutende Hand zurückzog, hielt sie — ein Vogelei!
»— Morgen mehr!«, sagte er, als ihn die Genossen wieder zu sich heraufgezogen hatten. Schnell schichtete man am Uferrand noch ein paar auffällige Steine auf, um das Seevögelnest leichter auffindbar zu machen; dann schritt man heim.
Miß Annie, der Morris beim Eintritt in das Gondelzelt das hellschokoladenbraune, getüpfelte Ei überreichte, sott es in der heißen Asche des Herdfeuers und kostete es auf seinen Wunsch —
Es war völlig frisch und schmeckte vortrefflich.
Am nächsten Tage begaben sich Morris und seine Begleiter von neuem auf die Suche.
Die Tatsache, daß eine Ansiedlung von Seevögeln auf ihrer Insel vorhanden war, stand fest. Es war noch festzustellen, wie zahlreich sie sei.
»Der Fall ist immerhin denkbar«, sagte Dr. Sucher, »daß es sich um ein einzelnes Pärchen handelt, das als Kundschafter diese ihnen noch unbekannte Brutstätte aufgefunden hat.«
»Gewiß«, entgegnete Morris. »Allerdings glaubte ich gestern abend an der Steilwand reichliche Guanospuren zu bemerken — nun, wir werden ja sehen!«
An der gestern markierten Stelle angelangt, wollte sich Morris gerade anseilen lassen, als ein Geräusch wie Flügelschlagen hörbar wurde!
Gleich darauf schoß ein Vogel von der Größe einer recht großen Taube aus der Felshöhlung hervor —
Sein Gefieder war blendend weiß, an der Unterseite leicht rosenrot, wie vom Strahle der Morgensonne gefärbt; der schöne, schneeweiße Schwanz erschien länger als der ganze Vogel.
Er wiegte sich einen Augenblick mit ruhig ausgebreiteten Flügeln über dem endlosen Meere — dann verschwand er in der Ferne...
»Wissen Sie, meine Herren, in welcher Gegend des Stillen Ozeans, unter welcher geographischen Breite unsere kleine Insel liegt?«, fragte nach seinem Verschwinden plötzlich Ridinger seine Begleiter.
»Wenn wir länger hier bleiben müssen, werden wir dies durch astronomische Beobachtungen noch genauer festzustellen haben«, antwortete Morris.
»Ich glaube, schon jetzt behaupten zu dürfen«, fuhr Ridinger fort, »daß wir nicht weit vom südlichen Wendekreise gelandet sind —«
»Woher wollen Sie dies jetzt so bestimmt —«
»Der weißschwänzige Vogel hat es mir eben verraten, Mr. Morris. Es war, — und ich glaube mich nicht getäuscht zu haben: von väterlicher Seite steckt ein wenig vom Ornithologen in mir — ein sogenannter › w e i ß s c h w ä n z i g e r T r o p i k v o g e l ‹ oder, wie sein wissenschaftlicher, poetisch klingender Name heißt, den ihm schon der berühmte Linné gegeben, ein ›Phaëton aetherëus‹.
»Die Schiffer wissen bei seinem Erscheinen, daß sie sich der Tropenzone nähern; er brütet in der Gegend der Wendekreise. Unsere Insel kann also nicht viel südlicher als zwischen 20—30 Grad südlicher Breite liegen. Daraus möchte ich für uns den tröstlichen Schluß ziehen, daß wir doch nicht so ganz außerhalb aller Schiffsrouten verschlagen worden sind —«
»Möchten Sie recht haben!«, rief Dr. Sucher im Sinne der anderen. —
— Und als sei der Ausflug des einen nur das Signal für die anderen gewesen, erhob sich jetzt aus dem »Flugloch« ein Phaëton aetherëus — und ihm folgten schnell noch mehrere. — —
Als Morris, am Seile hängend, jetzt im hellen Tageslichte die Steilwand untersuchte, fand er in der Nähe der schon entdeckten Öffnung viele kleinere und größere Spalten, die zwar enger waren, als die erste, aber doch Luft und Licht genügend hindurchließen und ihm zu seiner Freude zeigten, daß sich hinter diesen Uferlöchern ein geräumiger Stollen befand, der in seinem größten Teile von brütenden Tropikvögeln besetzt war.
»Unsere Aufgabe wird sein«, meinte er nach dem Aufwinden, »die vorgefundene Öffnung vorsichtig zu erweitern, ohne die Vögel allzusehr zu beunruhigen. Dann liefert uns dieser ›Taubenschlag‹ auf lange Zeit hinaus eine willkommene Bereicherung unserer Mahlzeiten.«
»Das wird die Damen noch mehr mit unserem Schicksal aussöhnen, hoff' ich«, sagte Dr. Sucher...
Man wandte sich heimwärts.
Unterwegs blieb Morris noch einmal stehen —
»Mr. Ridinger, Sie sind Chemiker und Geologe. Wie werden wir den harten Basalt des Ufers bearbeiten, ohne Werkzeuge?«
»— Auch dafür werden wir ein Mittel finden, Mr. Morris«, tröstete ihn Ridinger. »Vielleicht hilft uns das Feuer. Vielleicht können wir uns auch von oben, gewissermaßen vom Dach der Höhlung her, leichter Zugang verschaffen. Ich glaube bemerkt zu haben, daß der Felsboden an dieser Stelle mehr poröser, blasiger Natur ist, dem Bimsstein ähnlich. — Kommen Sie, Mr. Morris, kommen Sie! Schon das Bewußtsein, einen Herd nistender Vögel auf unserer einsamen Insel zu wissen, macht sie mir heimischer und vertrauter. — In meiner deutschen Heimat preist man das Haus glücklich, worin die Schwalbe nistet: lassen Sie uns glauben, daß dieser schöne ›ätherische‹ Vogel, der sich hier niedergelassen, auch uns — Glück bringt!« — — —
Der Nachmittag dieses Tages vereinigte alle Mitglieder der »Kolonie« wieder auf der Höhe, wo die Signalpyramide stand.
— Über ihnen rauschte, leuchtend im Winde sich wiegend, die goldgelbe Flagge!
Die Stimmung des kleinen Völkchens war heute gar nicht »schiffbrüchig»; Fritz Oldenburger, der zur Feier des »Phaëton aetherëus« die letzte Flasche Rüdesheimer unverfälscht zum besten gab, behauptete schließlich, solch kleiner Schiffbruch sei ganz nach seinem Geschmack, und er habe große Lust, für immer hier zu bleiben und mit seiner Grete hier — Adam und Eva zu spielen. Wer weiß, wie viele Kokosnüsse schon im Ufersande verborgen lägen, die das Meer freigebig hierher transportiert habe! Bald würden sich auch die daraus entsprießenden »Palmen« zeigen. Wie idyllisch sei es hier, wo es noch keine Telegraphen, keinen Post- oder Schiffsverkehr gäbe! Er als geplagter Post- und Telegrapheninspektor fühle das am besten.
— So gingen die Scherzreden hin und her. Man plauderte vom Vaterlande und von der Hoffnung, es bald wiederzusehen. —
Schließlich bat man allgemein Frau Elisabeth Sucher, die ihnen allen als musikalische Künstlerin bekannt war, um ein kleines Lied...
Und sie sang mit ihrer wunderbaren Altstimme — und es war, als ob auch das Weltmeer ihr zu Füßen, leiser atmend, lausche, — das alte, in zwei Hemisphären heimische, oft gesungene:
»Home, sweet home —«
Ganz am äußersten Uferrande stand Miß Annie und schaute in die endlose See — neben ihr Sidney Morris.
Als der letzte Ton des ihnen so vertrauten Liedes verklungen war, sah Morris in Miß Annies liebliches Antlitz —
Vielleicht hatte das alte Lied für sie beide heute noch einen tieferen, süßeren Klang — und ihre Blicke begegneten sich.
— Nun sank die Sonne rasch, wie immer, in steilem Bogen gegen den Horizont, und man schickte sich zum Abstieg an — —
Und — da kam's heran, plötzlich, gedankenschnell!
Aller Augen richteten sich auf eine Stelle des Ozeans —
Haushoch erhob sich ein langgestreckter Wogenberg mitten in der glatten See! Weißmähnig kam es dahergerast, — zischen und pfeifend und brüllend, gleich einem Riesenungeheuer der Vorzeit — von unfaßbarer Größe!
— Entsetzt, keines Wortes mächtig, keiner Bewegung fähig, starrten alle auf das herannahende, grausige Rätsel —
Und jetzt hatte es den flachen Strand erreicht, wo im Schatten der Felsmauer das Gondelzelt stand —
Mit einem Schlage überflutete es die Küste —
Ein Krachen und Donnern und Heulen, als seien die Schrecken der Unterwelt entfesselt — ein Aufschäumen der Wogen, so hoch, daß der weiße Gischt wie Schaum aus einem Riesenrachen dem sich angstvoll aneinanderdrängenden Menschenhäuflein ins Gesicht gespritzt wurde —
Dann ein hohler, pfeifender Ton —
Nun ein Abfluten all der gewaltigen Wassermengen —
Und alles war vorüber!
— Ruhig lag die See, wie noch vor wenigen Minuten; — nur die kleinen Wellen leckten am Strande wie sonst — —
Aber von der Gondel und dem Zelt war nichts mehr zu sehen!
— Eine jeder rätselhaften Springfluten, wie sie in so unheimlicher Gestalt nur der Stille Ozean kennt, hatte den kaum Geretteten noch das Wenige geraubt, was ihnen das Leben möglich und erträglich machte!
Weinend standen die armen Frauen, stumm, in ohnmächtigem Zorn gegen die Macht der Elemente, die ernsten Männer —
Und als sei die tückische Flut ihr Vorbote gewesen, kamen jetzt die weißschimmernden Tropikvögel wieder heimwärts geflogen aus den Tiefen des Himmels — und ihr Geschrei, das sie beim Erblicken der Signalflagge und des verzweifelten Menschenvölkleins ausstießen, klang wie Gelächter!
»Ihre Glücksvögel!«, sagte Morris leise zu dem neben ihm stehenden Felix Ridinger, und ein bitteres Lächeln ging über sein ernstes, entschlossenes Gesicht.
Die Sonne war verschwunden und die Nacht kam...
Um die Steinpyramide geschart, fand sie die Verlassenen, die es nicht gewagt hatten, den überfluteten Strand zu betreten.
In wunderbarem Glanze funkelten über ihnen die ewigen Sterne.
Das südliche Kreuz, das wie ein Lichtzeiger der Weltenuhr die Mitternacht kündet, neigte sich langsam, langsam —
Die Nacht ging und der Morgen kam.
Und die Sonne ging auf, herrlich, wie noch an keinem Tage, in strahlender Schöne — und der Ozean glühte wie flüssiges Gold!
Traurig schickten sich die Männer an, hinabzusteigen, um den Strand nach Muscheln abzusuchen —
Da — eine helle freudige Stimme!
Miß Annie stand am äußersten Uferrande und deutete hinaus auf den endlosen Ozean — —
Und — da kam er heran, weißschimmernd, in stolzer, rascher Fahrt — und über ihm wehte — die deutsche Flagge!
»— Ein Schiff!«
Jauchzend riefen es alle, und Freudentränen weinten alle —
— Nach einer Stunde waren sie alle wohlgeborgen an Bord des « P h a ë t o n « , eines Schiffes der deutschen TiefseeExpedition, das, von den GalápagosInseln kommend, nach Kap Horn steuerte und auf seiner Fahrt den einsamen Felsen mit der Notflagge unter 84° 12' westl. L. und 27° 4' südl. Br. heute bei Sonnenaufgang gesichtet hatte.
Auf dem Wege zur »Abendschule« erlebte ich heute ein seltsames Abenteuer, das ich meinem Tagebuche noch in später Nachtstunde anvertraue: — — Heute ist Freitag, der Tag, an dem wir uns, wie der freundliche Leser vielleicht aus früheren Erzählungen weiß, in der Regel in den Abendstunden fern vom Getriebe der Weltstadt bei einem frischen Trunke zu versammeln pflegen — sieben an der Zahl.
Auf dem Wege dahin hatte ich das sonderbare Erlebnis. Auf meiner Wanderung an der Peripherie Berlins angelangt, drehte ich mich nach alter Gewohnheit um, den Blick auf die unzähligen Lichter zu genießen, die aus den schon abendlich erleuchteten Fenstern der Häuser, den schnurgeraden Reihen der Straßenlaternen und dem bunten Heer der Signal- und Richtungslaternen von den Geleisen der Stadt- und Ringbahn herübergrüßten.
— — Als ich mich wieder zum Gehen wandte, sah ich plötzlich etwas Unerklärliches: vor mir, mitten auf dem Wege, erstrahlte ein geheimnisvolles Licht!
Es schwebte frei in der Luft, ja, es wechselte seinen Ort, launisch hin und her hüpfend. Seine Farbe erschien grünlichweiß.
Im ersten Augenblick dachte ich an das bekannte St. Elmsfeuer, das bei hoher elektrischer Spannung der Atmosphäre an hochragenden Gegenständen erscheint. Dann verwarf ich diesen Gedanken, weil mir der seltsam grünliche Ton des Lichts den magischen Glanz des R a d i u m s in die Erinnerung zurückrief, das uns Dr. Mathieu, einer unserer »Abendschüler«, einst gezeigt. Dagegen sprach aber seine Größe, wie seine Form, die beim Näherkommen bestimmte Umrisse zeigte. Immer mehr verdichtete sich der diffus leuchtende Schimmer — und nun schwebte es vor mir wie eine Gestalt, eine zierliche, ätherische Menschengestalt!
Ein wunderliches Gefühl, aus Neugier und Grauen gemischt, überfiel mich. So sehr mich die erste trieb, näher zu kommen, so sehr hielt mich letzteres zurück.
»Ein Irrlicht!«, dieser Gedanke gab mit plötzlich neuen Antrieb. War auch in der Nähe kein sumpfiges Terrain, so umgaben doch Wiesen den Weg. Mein wissenschaftliches Interesse siegte über meine natürliche Scheu; rasch trat ich auf die rätselhafte Erscheinung zu.
Und da verschwand sie, wie wenn ein Licht erlischt!
Ich stand, wie gebannt, auf demselben Flecke still in der Erwartung, das seltsame Phänomen wieder auftauchen zu sehen. —
Vergebens!
Alles schien nur ein Spiel meiner Sinne gewesen zu sein! — Halb lachend, halb ärgerlich, machte ich mich endlich auf den Weg. Mit einer kleinen Verspätung, die mir einen vorwurfsvollen Blick Fennmüllers zuzog, langte ich in der »Abendschule« an und fand die Mitglieder vollzählig beisammen: den alten Herrn Oberlehrer und seine beiden Töchter, den Großhändler Deckers, den Rentier Fennmüller, Doktor Mathieu — und auch Herr Sandter, unser freundlicher Wirt, saß mit in der Runde.
Erst wollte ich mich mit einer banalen Ausrede entschuldigen, daß ich später kam — ich dachte an Freund Fennmüllers spöttisches Lächeln, als ich damals A d a m P e r e n n i u s , den Zeitgenossen Friedrichs des Großen, mit in die Abendschule gebracht hatte; aber dann erzählte ich ehrlich den Grund meines Späterkommens.
Fennmüller lachte natürlich — aber, wann hätte der einmal nicht gelacht! Die beiden Damen neckten mich mit meinem »Irrlicht«, das wahrscheinlich Fleisch und Blut gehabt und nach der neuesten Mode gekleidet gewesen sei. — Doktor Mathieu berichtete von einer interessanten Wahrnehmung, die Professor Miethe vor einiger Zeit auf einer Ferienreise gemacht — es handelte sich um eine erste, wissenschaftlich einwandfreie Beobachtung eines Irrlichts — und der Oberlehrer erzählte eine gruselige Geschichte von einem Spuk im Moor aus seiner ostpreußischen Heimat. Schließlich erinnerte Großhändler Deckers an Reichenbach und sein »Odlicht«,
»Und von dem violetten Heiligenscheine des seligen Reichenbach bis zum modernen Spiritismus ist ja nur noch ein kleines Schrittchen!«, spottete Fennmüller — »seien Sie doch wenigstens modern in Ihren Erzählungen und sagen Sie, Sie hätten den Astralleib irgendeines Mediums gesehen auf seiner geheimnisvollen Wanderung!«
»Spotten Sie nur, Herr Fennmüller«, entgegnete ich. »Ich bin gewiß der letzte, der spiritistischen Anschauungen huldigt; aber ich muß doch sagen, was ich gesehen habe, und noch kann ich nicht glauben, daß mir meine sonst so zuverlässigen Sinne einen Streich gespielt haben.«
»Und doch wird es sich dabei wohl um eine subjektive Täuschung handeln«, sagte Doktor Mathieu in seiner ruhigüberzeugenden Weise — »apropos, haben Sie genaueres an dem Phänomen beobachten können?«
»Ich kann nur sagen, daß es mir wie eine sehr zierliche Menschenfigur erschien; genaueres vermag ich nicht anzugeben, dazu war ich leider noch zu weit entfernt. Aber eine Vorstellung von der Erscheinung können sich die Herrschaften doch machen, wenn Sie an die Radiumtänzerin denken, die wir vor einiger Zeit hier im ›Wintergartentheater‹ gesehen haben. Ihre Gewänder waren mit selbstleuchtenden Radiumsalzen getränkt und strahlten im Dunkeln ein magisches Licht aus.«
»Sie sah wunderbar aus — überirdisch — geisterhaft!«, riefen die Damen dazwischen.
»Nun — so war der Eindruck des heutigen Abends für mich« — —
»Vielleicht war es die Dame aus dem ›Wintergarten‹, scherzte Fennmüller, »vielleicht — —«
»Vielleicht! Vielleicht!«, unterbrach ich ihn lachend. »Mit all Ihren ›Vielleichts‹ laß ich mir meine Begegnung von vorhin nicht abstreiten, Herr Fennmüller! — Ich wünschte nur, Sie wären dabei gewesen, daß ich Sie ungläubigsten aller Thomasse als Augenzeugen hier aufrufen könnte.« —
»Den Gefallen würde ich Ihnen vielleicht doch nicht tun — auch dann nicht!«, erwiderte Fennmüller, »eher würde ich die Zuverlässigkeit meiner Augen bezweifeln. Es ist doch sonderbar, daß sich solche Wunder immer nur Ihnen bemerkbar machen, Ihnen, mein Verehrter, dessen Phantasie immer auf Abwegen wandelt! Ich bin überzeugt: einem nüchternen ›Normalmenschen‹ wird so etwas nicht pass...«
Er verstummte — mitten im Wort.
Wir alle blickten ihn an. Er saß wie versteinert. Auf seinem Gesichte wechselten Röte und Blässe.
Wir riefen ihn an. Großhändler Deckers, der ihm zunächst saß, rüttelte ihn. Die beiden Damen kamen angstvoll hinzu. —
Endlich wich die Erstarrung aus seinen Zügen.
»Was war denn mit dir, Paule?«, fragte der Oberlehrer besorgt.
»Ich — habe — soeben — auch — eine Erscheinung gehabt!«, — sagte er, sich zu einem schwachen Lächeln zwingend.
»Du — Fennmüller?« Deckers lachte ihm ungläubig ins Gesicht.
»Ja, Ludwig — ich! Zwar keine sichtbare — aber eine fühlbare!«
»Aber — Fennmüller —?«
»Im Ernst! — Ich habe das Gefühl gehabt, als ob mich jemand am linken Ohrläppchen zupfte.«
Wir mußten nun doch alle lachen; aber Fennmüller sprach weiter:
»Ja — bestimmt! — und da ich weiß, daß keiner der verehrten Anwesenden sich diesen Scherz mit mir erlaubt hat —«
»War es auch keine Sinnestäuschung, Herr Fennmüller?«, fragte Doktor Mathieu.
»Nein, mein verehrtester Herr Doktor! Es ist zwar schon lange her, daß ich zum letzten Male aus der Erfahrung dies Gefühl kennen gelernt habe — damals, als ich noch mit dem A—B—C im Zwiespalt lag, wird es gewesen sein — aber eine Selbsttäuschung ist für mich ausgeschlossen. Es muß also ein — unsichtbarer Gast gewesen sein!«
»Das wäre!«, rief der Herr Oberlehrer — »die Abendschule als spiritistische Séance — mit einem entmaterialisierten Medium als geheimnisvollem Gast? Herr Wirt, das bringt Ihr Lokal in Verruf! Halten Sie Ihr Haus rein!«
Wir waren alle aufgesprungen; nur Großhändler Deckers blieb sitzen und zitierte aus »Faust»:
»Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel,
Wir sind so klug, und dennoch spukt's in Tegel.«
Sandter schaltete auf einmal alle Glühlampen ein. — Einen Augenblick war es mir, als sähe ich an der Wand des Lokals einen flüchtigen Schatten, — aber es war doch wohl eine unter der Erregung entstandene Selbsttäuschung.
»Da — dort!«, rief Fennmüller.
»Wo — was?«
»An der Tür dort!«
»Was denn?«
»Die Klinke! — Sehen Sie doch! Sie bewegt sich von selbst!«
»Es kommt wohl noch ein Gast — Hans vielleicht —?«
Hans war der Sohn des Oberlehrers, Studiosus der Philologie.
Die Tür ging auf — soweit, daß ein Mensch hindurchgehen konnte; aber niemand kam herein!
»Ein Zufall!«, sagte Doktor Mathieu. »Die Tür war schlecht eingeklinkt — vielleicht ein Windstoß.« —
Ich eilte nach der Tür — ebenso unser Wirt.
Aber wir konnten nichts entdecken.
Und so kam es, daß unsere kleine Gesellschaft sich bald wieder beruhigte. Zwar ließ sich Fennmüller s e i n Abenteuer nun auch nicht ausreden; aber wir übrigen waren doch alle mehr oder minder geneigt, die Vorgänge des heutigen Abends auf subjektive Täuschungen oder harmlose Zufälligkeiten zurückzuführen.
Deckers erzählte schließlich noch die Geschichte von dem wunderbaren Vogelnest aus den Simplizianischen Schriften von Grimmelshausen, das die merkwürdige Eigenschaft besaß, seinen Eigentümer u n s i c h t b a r zu machen.
»Ja«, meinte dazu Doktor Mathieu, »der brave Christoph von Grimmelshausen hatte vor reichlich zwei Jahrhunderten leichtes Spiel mit den Gebilden seiner Phantasie: die Leichtgläubigkeit und Wundersucht seiner Zeitgenossen, die sich im Behexen, im Verzaubern und Unverwundbarmachen, im Bereiten von Lebenselixieren und Goldtinkturen und allerlei alchimistischem Hokuspokus nicht genug tun konnte, kam seiner Fabulierkunst auf halbem Wege entgegen! Aber der heutige Erzähler muß mit der naturwissenschaftlichen Bildung und dem nüchternen Skeptizismus seiner Leser rechnen, wenn er dergleichen Ungewöhnliches zu berichten wagt.«
»Das Unsichtbarmachen eines körperlichen Wesens ist wohl schlechthin unmöglich!«, warf der Oberlehrer ein.
»Ja — und nein!«, antwortete Doktor Mathieu. »Fragen wir einmal positiv: wann wird uns ein Gegenstand sichtbar? Er wird es, wenn er eigenes oder reflektiertes Licht in unser Auge zu senden vermag. Dazu gehört aber noch eine Bedingung, die das N e i n in meiner Antwort rechtfertigt; der von diesem Licht auf die Retina unseres Auges ausgeübte Reiz muß eine bestimmte Dauer haben, um die Enden unseres Sehnerves in Schwingungen versetzen zu können; zu kurze Lichteindrücke wirken nicht auf unser Auge, bleiben also für uns unsichtbar.«
»Wie die Flügel eines tätigen Ventilators oder ein fliegendes Geschoß«, warf der Oberlehrer ein.
»Ja, und es wird den verehrten Herrschaften gewiß interessant sein, daß ein kleines Insekt der Tropen, um sich seinen Verfolgern unsichtbar zu machen, dasselbe Prinzip befolgt. Es schwirrt, auf demselben Punkte bleibend, so rasend schnell mit den Flügeln, daß sein ganzer Körper unsichtbar wird.«
»Das wäre also der Weg«, meinte ich lächelnd, »auf dem man sich heutzutage noch unsichtbar machen könnte!«
»Denken Sie bis zur nächsten Abendschulsitzung fleißig darüber nach«, sagte Fennmüller launig, »vielleicht treffen Sie auch den Mann mit dem Vogelnest oder gar den kühnen Recken Siegfried, der ihnen seine Tarnkappe im heutigen nüchternen Zeitalter billig überläßt. — Aber das bitte ich mir aus, daß Sie es uns hübsch vorher sagen, wenn Sie unsichtbar geworden sind! Erschrecken Sie uns nicht!«
»Soll geschehen, Herr Fennmüller!«
»Und wählen Sie, bitte, ein anderes Mittel, sich bemerkbar zu machen; Ohrenzupfen macht nervös.«
Wir lachten nun alle wieder, und unter Lachen und Scherzen standen wir alle auf und machten uns auf den Heimweg...
Von diesem Abend an begann für mich eine Zeit der Wunder! —
Es war, als ob Heinzelmännchen in meinem Heim ihr wunderliches Wesen trieben seit meiner Heimkehr — oder, als ob die Dinge um mich ein selbständiges Leben erhalten hätten!
Es war mir, als ob die spiritistischen Phänomene, die ich bisher mit der Tätigkeit des menschlichen Unterbewußtseins zu erklären versucht hatte, es darauf anfingen, mich zu bekehren. Auf Schritt und Tritt stieß ich auf unerklärliche Vorkommnisse: leblose Dinge veränderten ihren Ort, aufgeschlagene Bücher blätterten sich selbsttätig um, auf meinen Löschblättern entdeckte ich den Abdruck seltsamer Schriftzeichen.
Doch tue ich vielleicht am besten, aus meinem Tagebuche ein paar Auszüge herzusetzen:
12. August.
Heute fand ich ein Buch — es war »Experimentelle Untersuchung von Gasen von M. W. Travers« — das ich am Morgen geschlossen auf meinen Arbeitstisch gelegt hatte, a u f g e s c h l a g e n — auf dem Fensterbrett.
14. August.
Wenn mich unsichtbare Gestalten umgeben, so müssen sie doch noch nicht ganz allem Körperlichen abgestorben sein: ein Körbchen mit Kirschen, die ich gezählt hatte, verringerte seine Anzahl seit gestern, ohne daß ich einen sichtbaren Eingriff bemerken kann.
15. August.
Heute endlich gelang es mir, einen Vorgang direkt zu beobachten, der mir Gewißheit gibt, es mit einem körperlichen, wenn auch für meine Augen unter gewöhnlichen Umständen nicht sichtbaren Wesen zu tun zu haben. — Ermüdet von meiner Berufsarbeit, hatte ich mich am Nachmittage ein wenig in die Sofaecke zum Schlummer gedrückt. Die Rouleaux waren zugezogen. Das Körbchen mit Kirschen stand auf dem Büfett drüben an der wand, mir gegenüber. Mein Schlaf ist sehr leise, und irgend ein leichtes Geräusch muß mich munter gemacht haben; ich blieb aber in meiner bequemen Lage. Durch die halbgeöffneten Finger der aufgestützten Hand sah ich plötzlich etwas Absonderliches: eine Kirsche auf der Fruchtschale wurde beweglich und wanderte über den Rand der Schale nach unten in das Halbdunkel des Zimmers; eine zweite, eine dritte folgte. Mit großer Willenskraft gelang es mir, äußerlich unbeweglich zu bleiben. Ich strengte meine Augen aufs äußerste an, das Halbdunkel des Raumes zu durchdringen — aber ich sah nichts!
Vom Fenster fiel ein feiner Spalt des Sonnenlichts ins Zimmer. Beim Hin- und Herwandern trafen meine Blicke auch die gegenüberliegende Wand — — und da war es mit meiner Selbstbeherrschung vorbei!
Der schmale Sonnenstreifen hätte sich — wie ich aus täglicher Beobachtung wußte, an dieser Wand hell abzeichnen müssen; — aber die Wand war dunkel,so, als wenn einundurchsichtiger Körper ihm im Wege stünde! Und nun entdeckte ich auch, scheinbar mitten im leeren Raum stehend, den flimmernden Sonnenstreif!
Ich sprang auf und haschte mit der Hand in der Luft umher — ich tastete in alle Ecken des Zimmers, riß die Vorhänge zurück — —
Vergebens!
Einen Moment war es mir, als ich die Rouleaux zurückzog, als ob ein leichter Schatten vorbeihuschte, von einem flatternden Geräusche begleitet —
Aber — ich fand nichts und lachte mich schließlich selber aus...
16. August.
Heute besuchte ich meinen Freund Justus Starck, den bekannten Entdecker unserer »Feinde im Weltall«, dessen wunderbar empfindliche Apparate uns die ersten Nachrichten über die Bewohner anderer Planeten gegeben haben. Seine damals dem Reichskanzler gemachten Enthüllungen über unsere extramundanen Gegner sind dem Leser ja bekannt. — Ich erzählte ihm meine wunderlichen Erlebnisse. Aufmerksam und schweigend, in der ihm eigenen Weise die klugen Augen fest auf mich gerichtet, hörte Justus mir zu.
Als ich geendet, spielte er mit einem goldenen Bleistifte an seiner Uhrkette und — schwieg noch immer. Seine Augen wanderten wie abwesend im Zimmer umher und zum Fenster hinaus.
»Nun?«, fragte ich ungeduldig, »du sagst ja gar nichts, Justus? Ist dir die ganze Geschichte nicht interessant genug?«
Justus sah mit einem rätselhaften Blicke an mir vorbei, gerade so, als wenn er neben oder hinter mir jemand sähe. Dies unerklärliche Hinstarren irritierte mich schließlich so, daß ich mich umdrehte und hinter mich blickte.
»Was in aller Welt hast du denn? Was suchen denn deine Blicke? So sprich doch ein Wort! Oder hältst du mich auch, wie Fennmüller neulich, für einen Phantasten?«
»Lieber Freund«, sagte Justus, »ich fürchte, du würdest mich für einen noch größeren Phantasten halten, wenn ich dir heut schon meine Meinung über all diese seltsamen Vorkommnisse sagen würde. — Es liegt in der Natur der Sache, wenn ich seit der Feststellung der Tatsache, daß unsere schöne Erde das Ziel für die Eroberungsgelüste fremder Planetenbewohner geworden ist, immer zuerst an derartige außerirdische Eingriffe denke, falls, wie hier, unerklärliche Dinge vorliegen. — Mehr möchte ich für heut' nicht sagen, um dich nicht unnötig zu beunruhigen — und«, er lächelte geheimnisvoll — »auch aus einem andern Grunde nicht!«
Es war nichts weiter aus ihm herauszubringen. Und so verabschiedete ich mich von ihm, mit einem letzten forschenden Blick in sein nachdenkliches Gesicht.
Schon war ich halb aus der Tür, als er mich mit einem halb unterdrückten Aufschrei zurückrief.
»Nun?« —
Er zog mich dicht zu sich heran und preßte seinen Mund fest an mein Ohr.
»Mein neues Modell des verbesserten Kohärers? — Es ist doch noch —«
»— sicher und wohlgeborgen in meinem Besitz — unter deinem Sicherheitsschloß!«
»Schön —«, erwiderte Justus, »es wäre auch für mich« —
»Beruhige dich — oder noch besser — komm und überzeuge dich selbst!«
Damit schied ich von ihm...
Abends 11 Uhr.
Ich bin doch noch einmal aus dem Bett geklettert; Justus' Sorge um sein neues Kohärermodell ließ mich nicht schlafen. Er hat diesen neuesten Empfangsapparat für drahtlose Telegraphie vorläufig nur in zwei Exemplaren hergestellt, von denen er mir das eine für alle Fälle zur Aufbewahrung anvertraut hat. Vielleicht hält er seine Erfindung bei mir für sicherer vor unberufenen Händen als — anderswo.
Ich habe mein Spind aufgeschlossen, in dessen einem Fach, in einer angeschraubten stählernen Kassette, sich das kleine Wunderwerk befindet. Denn ein Wunderwerk muß man es nennen in seiner Empfindlichkeit auch für die allerkleinsten Hertz'schen Wellen, eine Empfindlichkeit, die den ganzen umständlichen Empfangsapparat von Drähten und Stangen usw. völlig überflüssig macht — mit seiner Aufnahmefähigkeit für Ätherschwingungen, die kaum noch tausendmal größer sind als die Lichtwellen. — Die Kassette habe ich nicht geöffnet — ich wollte jetzt — mitten in der Nacht — den Geheimmechanismus des Sicherheitsschlosses nicht in Betrieb setzen — ich dachte auch an das unsichtbare Geheimnis, das mich zu umgeben scheint. Aber die Kontrollstreifen, welche über die Ränder der Kassette geklebt sind, waren unverletzt.
Justus kann also ruhig schlafen — und ich will es auch tun!...
17. August, morgens.
Einen verrückten Traum habe ich gehabt! Aber das kommt davon, wenn man sich so spät in der Nacht noch allerlei unnütze Gedanken macht; denn — alles in allem — ist mein kurioser Traum nur die Fortsetzung der Gedankenreihe von gestern abend, wenn auch das im Traume ohne Kontrolle arbeitende Gehirn die einmal geknüpften Fäden bunt genug versponnen hat. Ich will ihn aber doch aufschreiben; also:
Mir war, als stünde ich noch immer vor der eisernen Kassette, die Justus' Apparat verbirgt.
Plötzlich hörte ich eine Stimme, ein Stimmchen, so fein und doch so melodisch, wie eine Äolsharfe! Ich bückte ich hernieder. —
»O, mach mich frei! O, mach mich frei!«
Anfangs glaubte ich — im Traum — an eine Täuschung meiner Sinne; aber zum dritten Male hörte ich jetzt ganz deutlich, leise, unsagbar rührend und klagend:
»O, mach mich frei!«
»Wo bist du?«, fragte ich, neugierig und aufgeregt. —
»In der eisernen Kiste — gefangen — ach, so lange! — Eingesperrt!« —
»Wer hat dich eingesperrt?«
»Ich weiß es nicht!«
»Was bist du für ein wunderbares Wesen, wenn du in einer solchen Kassette Platz finden kannst?«
»Ich bin ein Luftweibchen!«, sagte die feine Silberstimme, »o, mach mich frei! o, mach mich frei! Ich will dir auch immer dankbar sein!« —
Im Traum erschien mir das alles ganz plausibel, und ich beeilte mich, das komplizierte Kassettenschloß zu öffnen.
Auf der Vorderseite des stählernen Behälters befindet sich eine Reihe von Knöpfen, die man in bestimmter Reihenfolge und in bestimmtem Rhythmus niederdrücken muß, so, als ob man eine Melodie spielt.
Das alles tat ich — wie ich träumte — ganz vorschriftsmäßig, und ich erinnere mich, daß ich dabei ordentlich neugierig wurde und Herzklopfen bekam, je näher der Moment des Öffnens kam.
Und nun sprang der Deckel auf!
Wahrhaftig! — Da entschwebte dem eisernen Grabe eine elfengleiche, zierliche Gestalt!
Und sie glich — dem »Irrlicht«, das ich auf dem Wege zur Abendschule gesehen!
»Hab' Dank!«, hauchte sie und neigte sich zu mir hernieder.
Ich sah ein wundersam zartes, schneeigweiß schimmerndes Antlitz, in welchem strahlend zwei nachtschwarze Augen standen — in weichen Wellen umflutete mich ihr bläulich schimmerndes Haar.
Wie einen sanften Hauch fühlte ich ihren Kuß auf meiner heißen Stirn — und ein Duft wie von frischen Veilchen umfing mich.
Dann muß ich plötzlich erwacht sein! Verwundert schaute ich in dem dunklen Zimmer umher, und es dauerte eine ganze Weile, ehe ich Traum und Wirklichkeit unterscheiden konnte. Seltsamerweise glaubte ich noch immer einen Veilchengeruch im Zimmer wahrzunehmen.
Eine längere Zeit muß ich so im Hindämmern zwischen Traum und Wachen gelegen haben, dann bin ich doch wieder fest eingeschlafen — und erst der hellhereinbrechende Tag weckte mich wieder. Nun ruft meine Berufsarbeit; aber meinen kuriosen Traum habe ich, beim Morgenkaffee sitzend, doch noch aufgeschrieben.
Mittags.
Justus Starck hat mich besuchen wollen, wie mir der Portier erzählt; leider bin ich nicht zu Hause gewesen. Aber das Telegramm, das ich soeben erhielt, gibt mir den Zweck seines Kommens an, es lautet:
»Muß Apparat haben!«
Ich werde ihm also noch heute seinen so sorgsam gehüteten Schatz zurückbringen — — —
Es war furchtbar — geradezu furchtbar für mich!
Diese Entdeckung! Dieser unerklärliche, mir so schrecklich peinliche Vorfall! —
Der Apparat ist aus der Kassette verschwunden!
Die Kassette ist vorschriftsmäßig geöffnet worden; nirgends zeigt sich eine Spur von äußerer Gewalt!
Das neue, kostbare Kohärermodell, mit dem Justus Starck besser als bisher die uns feindlichen Vorgänge auf dem Nachbarplaneten und in den Höhen der Atmosphäre belauschen wollte — ist geraubt worden! —
In meiner Aufregung und Bestürzung bin ich zu Justus geeilt. Er las mir die Hiobsbotschaft vom Gesicht.
»Komm herein«, sagte er, den Arm um meine Schulter legend, »komm herein und erzähle!«
Er öffnete die Tür zu seinem Privatzimmer.
Und ich erzählte ihm alles — auch meinen sonderbaren Traum!
»Alles dies paßt zu meiner Kombination«, sagte er, als ich geendet, »und es fehlt vielleicht nur noch das allerletzte Glied in der Kette meiner Beweisführung. Höre zu.«
Und er führte aus, daß alle diese scheinbar unerklärlichen Vorkommnisse sich sofort zwanglos erklären lassen durch die Annahme eines Wesens, das sich u n s i c h t b a r zu machen versteht! — Und da dies nach dem heutigen Stand der Wissenschaft so gut wie unmöglich für einen Menschen ist, so folgert er gerade daraus, daß es ein Abgesandter eines andern Planeten ist, der in dieser schützenden Verhüllung sicher und bequem unsere irdischen Verhältnisse studieren kann und leicht überall Zutritt findet, wohin ihn seine Oberen zu senden für nützlich halten. Justus kombiniert sogar noch weiter und meint, meine Begegnung mit dem »Irrlicht« sei von langer Hand vorbereitet; da seine Kontrollapparate ihm jetzt mehr als sonst Meldungen über allerlei geheimnisvolle Vorgänge in den obersten Schichten unserer Atmosphäre machen, glaubt er, daß die feindlichen Planetenbewohner — man weiß immer noch nicht genau, woher sie stammen — jetzt mehr als je an der Arbeit sind. Solche unsichtbaren Pioniere würden sich vortrefflich dazu eignen, das Privatleben namentlich solcher Personen zu beobachten, die aus irgendeinem Grunde ihr Interesse erregt haben.
»Aber Justus — erlaube!«, unterbrach ich ihn an dieser Stelle, »dann würde es doch viel mehr im Interesse eines solchen ›unsichtbaren‹ Detektivs liegen, völlig unsichtbar und unbemerkbar zu bleiben! Aber — ich habe das ›Irrlicht‹ doch deutlich gesehen, und Fennmüllers Ohrenzupfen war doch wohl auch nicht bloße Einbildung?«
»Hast du mir nicht selbst erzählt, daß ihr alle euch gewisser spiritistischer Anwandlungen kaum erwehren konntet? — Wie? — Wenn auch dies nur ein ›Trick‹ zur besseren Verhüllung der eigentlichen Zwecke gewesen wäre? In manchen Kreisen unserer heutigen Gesellschaft sind ja spiritistische Séancen sehr beliebt.«
»Und die rätselhafte Entwendung deines Apparates — und mein seltsames Traumabenteuer? — Willst du beides auch auf das Konto des Unsichtbaren setzen?«
»Gewiß! — Weißt du, wer die nach meinem Dafürhalten einbruchsichere Kassette geöffnet hat?«
»Wahrscheinlich also das unsichtbare Wesen, das in meinem Hause spukt?«
»Du selbst!«
»Ich?!«
»Ja, du!«
»Ich? — Ja — im Traum — meinst du?«
»Nein — in der Hypnose! — Höre zu: Das betreffende Wesen, das in deinem Heim sich aufhält, wahrscheinlich mit viel besseren Seelenkenntnissen ausgerüstet als wir, hat — unsichtbar in stetem Zusammensein mit dir — deine Eigentümlichkeiten, deine Gemütsanlage studiert, wahrscheinlich manche deiner Notizen gelesen, hat dich während des Einschlafens hypnotisiert, deine Träume beeinflußt und dir die Vorstellung von dem eingesperrten Luftweibchen so lebendig suggeriert, daß du in der Traumhypnose wie ein Nachtwandler aufgestanden bist und die Kassette geöffnet hast — das weitere ist ein geschickt inszenierter Theatercoup des klug berechnenden Geschöpfes! — Die Tatsache bleibt, daß jenes Modell, das ich so sorgsam hüten wollte, verschwunden ist. Zwar besitze ich noch das andere, aber mit der Geheimhaltung ist es vorbei.«
»Und was willst du nun tun, Justus?«, fragte ich.
»Abwarten — und arbeiten! Arbeiten, um, wenn möglich, ein noch vollkommeneres Modell eines Kohärers zu konstruieren.«
»Und — du zürnst mir nicht?«
»Aber, lieber Freund! — Kannst du dafür, wenn du träumst? Nach allem, was du mir erzählt, hätte ich wahrscheinlich dem gefangenen Luftweibchen auch den eisernen Kerker geöffnet! Wir bleiben die alten! Und — sobald dir oder mir wieder etwas Neues, Sonderbares vorkommt, geben wir uns ein Telegramm. — Adieu!«
»Und so bin ich, nachdenklicher als je, in mein Heim zurückgekehrt und habe aufmerksamer als je alle Winkel meiner Wohnung durchgestöbert, habe aber nichts Auffälliges bemerkt...
18. August, mittags.
Es wird immer rätselhafter! Heute früh noch schrieb ich an Justus, daß seit ein paar Tagen in meiner Wohnung all die kleinen Anzeichen zu fehlen scheinen, an denen ich das Vorhandensein eines unsichtbaren Mitbewohners bisher heimlich zu kontrollieren pflegte — und soeben erhalte ich von ihm folgendes Telegramm:
»SPIRITUS FAMILIARIS JETZT BEI MIR. BESUCHE MICH BALD! JUSTUS.«
Also spukt es jetzt bei Justus Starck. Gleich heute will ich ihn aufsuchen, ehe ich in die »Abendschule« gehe.
Abends sechs Uhr.
War bei Justus. Fand ihn wider Erwarten nicht in seiner Privatwohnung, sondern noch im Staatslaboratorium. Er empfing mich in alter, lieber Weise, wie immer. War eben im Begriff, nach Hause zu fahren.
»Begleite mich, bitte. Wir bleiben noch ein Stündchen zusammen. Zu rechter Zeit sollst du schon noch in deine ›Abendschule‹ kommen, dafür laß mich sorgen. Ich weiß ja: heute ist Freitag!«
»Also es spukt jetzt bei dir, Justus?«, fragte ich, als wir beide in seinem Elektromobil saßen.
»Ja«, erwiderte er, plötzlich sehr ernst werdend, »aber wir sind dabei, den Spuk zu bannen!«
Und nun entwickelte er mir seinen Plan, dem unerklärlichen, unsichtbaren Geheimnis, das zwischen seinen Apparaten seit einigen Tagen sein Wesen treibt, auf die Spur zu kommen — einen Plan, den ich den Blättern dieses Tagebuches lieber nicht anvertrauen möchte.
Aber eines weiß ich: Fennmüller wird staunen, wenn ich ihm heute abend all das Vorgefallene erzähle!
Jedermann kennt eigentlich schon aus den Tagesblättern die Schlußszene dieser Erzählung:
»In der Nacht vom 18. zum 19. August cr. war das Kaiserliche Institut für Landesverteidigung der Schauplatz einer in ihren Einzelheiten noch nicht völlig aufgeklärten, geheimnisvollen Begebenheit. Mitten in der Nacht, zwischen 12 und 1 Uhr, wurde Direktor S t a r c k plötzlich durch ein elektrisches Alarmsignal nach dem großen Laboratorium gerufen. Er war darauf vorbereitet und in wenigen Minuten an Ort und Stelle. Hier bot sich ihm und seinen Begleitern ein rätselhafter Anblick. Mitten unter der Kuppel des großen Saales, dicht neben dem Riesenfernsender, mit dem augenblicklich Versuche zur Übermittlung drahtloser Depeschen an Orientierungsballons in den verschiedensten Höhenschichten unserer Atmosphäre angestellt werden, lag ein rätselhaftes Geschöpf, wahrscheinlich bei der unvorsichtigen Berührung eines der dort aufgestellten Hochspannungsapparate von der elektrischen Entladung getroffen: ein — — weibliches Wesen, von zierlichschlanker sylphidenhafter Gestalt — der Körper, viel kleiner als der eines menschlichen Weibes im Durchschnitt, bekleidet von einem dicht anschließenden Gewande, das wie aus metallenem Gewebe angefertigt schien. Das Antlitz zeigte ein fast durchsichtiges Weiß, wie das einer Statue aus Alabaster. Dazu bildete das bläulich schimmernde Haar einen wundersamen Gegensatz. Die Stirn, die Schläfen, Nase, Wangen, Mund und Kinn waren von so zierlicher, feiner Modellierung, daß unsere menschlichen Gesichter dagegen bäurischderb erschienen; ebenso feinnervig und zart geformt waren die überschlanken Hände, die merkwürdigerweise nur vier Finger an jeder Hand zeigten...
Sofort angestellte Wiederbelebungsversuche schienen nach langen Mühen endlich doch von Erfolg gekrönt zu sein — als plötzlich ein zweites, noch rätselhafteres Ereignis eintrat: Mit einem furchtbaren Krach stürzte das eine der mächtigen, hohen Bogenfenster an der linken Seitenwand des Saales zertrümmert herab — in der leeren Wölbung erschien schwebend ein fischartig geformtes Luftfahrzeug! Ehe sich die Anwesenden noch Rechenschaft von dieser neuen geheimnisvollen Erscheinung zu geben vermochten, wurden sie mit unwiderstehlicher Gewalt beiseite geschleudert — unsichtbare Hände ergriffen den am Boden liegenden Körper des wunderbaren Geschöpfes und trugen ihn hinweg — in das Luftschiff, das in der nächsten Sekunde wie ein riesenhaftes, unheimliches, schwarzes Luftungeheuer mit pfeifendem Zischen im Dunkel der Nacht verschwand.«
Soweit der Bericht der Tageszeitungen.
Aus eigenen Erlebnissen aber kann ich dem noch folgendes hinzusetzen: An dem Abend, welcher dieser ereignisreichen Nacht voranging, befand ich mich, nach meinem Besuche bei Justus Starck, wie oben angedeutet, in der Abendschule, im Kreise der lieben Menschen, die der Leser kennt. Zwar konnte ich Herrn Rentier Fennmüller noch nichts über mein Verfahren, mich unsichtbar zu machen, mitteilen; aber auch das wenige, was ich von meinen und meines Freundes Erlebnissen berichten durfte, erregte allseitiges, berechtigtes Interesse.
Wie aber wuchs unsere Aufregung, als uns der Fernsprecher mitten in der Nacht — wir wollten gerade zum Nachhausegehen aufbrechen — in das Kaiserliche Institut für Landesverteidigung rief! Durch Justus wußte ich, daß alle Apparate dort durch unterirdische Leitungen mit seiner Privatwohnung verbunden waren. Ja, auch das letzte äußerste Mittel, dem unsichtbaren Geheimnis auf die Spur zu kommen, hatte mir Justus verraten: die Taster der riesigen Funkspruchapparate, überhaupt alle im Kuppelsaale des Instituts aufgestellten Maschinen, waren über Nacht stets der vollen Entladung eines Wechselstroms von 100 000 Volt ausgesetzt, sodaß ein den Apparat Berührender sich selbst in die Funkenbahn einschalten und den vernichtenden Schlag erhalten mußte.
Im Automobil des Großhändlers Deckers fuhren wir wenige Minuten nach dem Anruf ins Kaiserliche Institut.
Dort fanden wir — die Unsichtbare, endlich sichtbar geworden, nachdem der gewaltige Flammenbogen der elektrischen Entladung ihr rätselhaftes, unsichtbar machendes Zaubergewand zerstört hatte.
Was aber hatte sie über Nacht in dem Institute gewollt?
Auf dem Tische, vor dem wir sie fanden, stand — das verschwundene Kohärermodell, und Justus entdeckte bei genauerer Untersuchung, daß es völlig betriebsfertig für den Empfang drahtloser Telegramme montiert war! Er fand auch Anzeichen dafür, daß sie trotz der Signalleitungen einzelne seiner neuesten Apparate untersucht haben mußte, ja, einige Zeichen schienen auch dafür zu sprechen, daß sie die Unbrauchbarmachung besonders wichtiger und empfindlicher Teile versucht hatte.
Dabei hatte der elektrische Schlag sie getroffen!
Wir standen alle noch wie gelähmt unter den letzten Eindrücken. Die Existenz und die Überlegenheit unserer »Feinde im Weltall« hatte sich uns klugen Menschen mit furchtbarer Deutlichkeit enthüllt. Greifbar hatte es vor uns gelegen, das sichtbar gewordene Unsichtbare, ein weibliches Wesen aus der Heimat jener geheimnisvollen Planetenbewohner, die seit Jahren auf unserer Erde Fuß zu fassen versuchten! Nach verzweifelten Bemühungen war es uns doch gelungen, das Rätselgeschöpf wieder zum Leben zu erwecken, und ungeduldig harrten wir des Augenblicks, da es die Augen öffnen, da seine Lippen das erste Wort formen würden, das nicht auf dieser Menschenerde geboren war.
Und ich? Ich war vielleicht der Bestürzteste von allen! Denn dies leblos vor mir liegende Zauberwesen war — das »Irrlicht«, wie ich es im Wachen und im Traum — ach, und wie deutlich im Traum! vor mir gesehen. Justus hätte mich wegen meiner Charakterlosigkeit gewiß gescholten: ich vermochte dem schönen Rätsel nicht einmal zu zürnen, als es so, von unsern künstlichen Blitzen getroffen, am Boden lag. Vergessen war all das Spionieren in meinen vier Pfählen, vergessen der Traumbetrug samt der Entwendung des kostbaren Apparates — wie Mitleid regte sich's in meiner Seele. Und auch Deckers mußte etwas ähnliches fühlen, denn er sagte einmal ganz unvermittelt:
»Welcher Mut, welche Selbstverleugnung und Selbstbeherrschung gehörte doch zu einem solchen Unterfangen! Welche begeisterte Hingabe an eine Idee mag in dem zierlichen Geschöpf gelebt haben!«
»Nun«, rief Justus Starck dazwischen, »denken wir zunächst an uns! Es ist ein glücklicher Zufall, daß die Elektrizität uns das Mittel gewiesen hat, diese neue, geheimnisvolle Waffe unserer fernen Feinde, das Unsichtbarmachen, unschädlich zu machen, wenn wir auch über das Material des unsichtbarmachenden Gewandes, nun die Unsichtbare uns mit Gewalt entführt worden ist, nichts wissen und wissen werden; denn die gewaltige Wechselstromladung hat den wunderbaren Stoff völlig verflüchtigt.«
»Nicht völlig!«, sagte da auf einmal Doktor Mathieu und trat näher an den Tisch heran, an welchem Justus stand.
»Ich stieß vorhin mit der Fußspitze an ein leichtes Hindernis auf dem Fußboden«, sprach er erklärend weiter, »ich richtete ganz mechanisch den Blick zu Boden, sah aber nichts. Aber beim nochmaligen Überschreiten derselben Stelle fühlte ich die gleiche elastische Berührung. Ich bückte mich danach und erfaßte es glücklich. Hier ist es!«

Dabei hielt er das fragliche Etwas gegen das Licht der Nernstlampe über dem Tische.
Wir sahen einen unregelmäßig begrenzten Schatten, wie von einem Kleiderfetzen.
Und nun legte Doktor Mathieu das fragliche Objekt auf die braunpolierte Tischplatte.
Und da verschwand es fast momentan für unsere Augen; nur mit gespanntester Aufmerksamkeit, geleitet von Doktor Mathieus Hand, fanden wir seine Konturen wieder!
»Schutzfärbung!«, rief ich, aufs höchste überrascht aus, »wie bei Schmetterlingen und Heuschrecken! An dieses Mittel hat keiner gedacht!«
»Ja, Schutzfärbung!«, bestätigte Doktor Mathieu meine Vermutung, »aber von einer Anpassungsfähigkeit und Vollkommenheit, wie sie sich auf unserer Erde in ähnlicher Weise nur noch bei einer kleinen Krebsart im Atlantischen Ozean findet, einer kleinen Garneele — M y s i s ist ihr wissenschaftlicher Name! — Sie vermag ihre Hautfärbung zum Zwecke des Unsichtbarwerdens der Farbe ihrer jeweiligen Umgebung sofort anzupassen, sieht auf dem dunklen Meeresgrunde schwärzlich aus, wird aber im hellen Sonnenscheine fast augenblicklich wasserhell durchsichtig, auf weißem Seesand weiß und für das Auge völlig ununterscheidbar, ja, sie durchläuft alle Farben, welche das Meerwasser mit der wechselnden Tageszeit und Beleuchtung annimmt, vom hellsten Rosenrot bis zum tiefsten Violett!« —
S c h u t z f ä r b u n g! Das war also das Geheimnis der Unsichtbaren gewesen! Gleich der Haut eines lebendigen Geschöpfes besaß der Stoff des sie verhüllenden Gewandes die Fähigkeit, sich momentan der Farbe seiner Umgebung anzupassen. Freilich mußte es die Trägerin dieses Gewandes verstanden haben, sich mit ihrem elfengleichen Körper allzugrellen Kontrasten der Beleuchtung zu entziehen. Das diffuse Licht unserer Wohnungen war ihr dabei wohl auch zu statten gekommen.
Noch vermochten wir alle es kaum zu glauben.
»Es will mir noch immer nicht in den Kopf, Herr Doktor!«, sagte der Oberlehrer nach einer kleinen Pause, »ein toter Stoff soll diese wunderbare Anpassungsfähigkeit, ein solches fast künstlerisch gesteigertes Reaktionsvermögen auf so differenzierte Reize besitzen?«
Doktor Mathieu schwieg einen Augenblick; er hob den auf der braunen Tischplatte ganz unsichtbar gewordenen Stoffrest auf und legte ihn auf den Ärmel von Fennmüllers graublaumeliertem Überzieher.
In wenigen Sekunden verwandelte sich die im Moment des Auflegens noch braune Färbung in ein meliertes Graublau!
Und nun sagte er:
»Was hindert uns anzunehmen, daß es lebendige Organismen sind, welche in die Fasern des Stoffes eingebettet liegen?« Dann sich zu mir wendend: »Gerade die rätselhafte Phosphoreszenz, von der Sie uns an jenem ersten Abend erzählten, spricht für die Annahme solcher Mikroorganismen. Wer weiß, was jener uns feindliche Planet für wunderbare Wesen und Kräfte beherbergen mag! Hoffen wir, daß dies kleine Zipfelchen uns das Rätsel lösen hilft von dem Zaubergewande der Unsichtbaren!«
«... und die beobachtete Störung ist also von verschiedenen Seiten objektiv festge stellt. ich ersuche Sie daher, zum Zwecke einer vergleichenden Untersuchung die Sternwarten Europas zur Nachforschung in der angedeuteten Richtung zu veranlassen. Hoffentlich stellt sich dann die Befürchtung meines jungen Mitarbeiters doch als übertrieben heraus — Es wäre ja auch schade um uns — meinen Sie nicht, lieber, verehrter Herr Kollege? — Ich hoffe doch noch immer, Sie einmal hier in< unserm Observatorium begrüßen und Ihnen unsern neuen 50Zöller vorführen zu dürfen. Kommen Sie also lieber bald — falls die Sache doch schief geht!
Möchte meine Schlußformel heute mehr als eine Formel sein:
Auf Wiedersehen!
T.E. Leskop.«
— Der Empfänger dieses Briefes saß in seinem Arbeitszimmer auf der Sternwarte zu P*** und blickte nach Beendigung der Lektüre ein Weilchen sinnend vor sich hin —
Dann stand er rasch auf und drückte auf einen Knopf.
»Ich lasse Herrn Dr. Steinweg bitten, sich auf einen Augenblick hierher zu bemühen!«, sagte er zu dem eintretenden Institutsdiener.
Dem Gerufenen überreichte der Direktor der Sternwarte das erwähnte Schreiben.
Dr. Steinweg las aufmerksam. Seine klugen hellbraunen Augen hefteten sich um so emsiger auf die Zeilen, je weiter er las —
»Nun?«, fragte der Direktor, als er geendet.
Dr. Steinweg sah den Direktor mit einem seltsamen Ausdruck an.
»Nun, Herr Doktor?«
»Herr Direktor! Der Brief sagt mir nichts Neues — wenn auch die letzten Schlußfolgerungen darin mir neu sind —«
»Wie — Sie haben —«
»Ich habe die erwähnten Störungen schon seit Wochen beobachtet —«
»Was —? Und haben mir nicht einmal Mitteilung gemacht?«
»Ich war meiner Sache eben noch nicht sicher genug, Herr Direktor! Der Fall liegt so außergewöhnlich, springt so ganz aus dem Rahmen astronomischer Ereignisse heraus —«
»Ich verstehe, lieber Herr Doktor. Aber nun sagen Sie: — Was halten Sie von der geheimnisvollen Geschichte?«
»Ich möchte mich auch heute noch nicht bestimmt erklären, Herr Direktor. Nach meinen Beobachtungen und Berechnungen glaube ich aber doch soviel sagen zu können, daß —«
»— daß? Nun, Herr Doktor?«
»— daß — so unwissenschaftlich und phantastisch es klingen mag — ein unbekannter Himmelskörper von gewaltiger Masse sich unserm Planetensystem mit unvorstellbarer Geschwindigkeit nähert —«
»Aber — dann müßte er doch längst sichtbar und von irgend einer Sternwarte avisiert worden sein —«
»Und — wenn es ein u n s i c h t b a r e s Gestirn wäre?«
»Sie meinen — nach der Hypothese von H o l e t s c h e k — ein Komet, der auf seiner Bahn nicht aus den Strahlen der Sonne heraustreten kann, wie der Komet ›Khedive‹ von 1882, der auch nur zufällig bei der photographischen Aufnahme der total verfinsterten Sonnenscheibe in der allernächsten Nähe der SonnenKorona entdeckt wurde —?«
»Diese Hypothese würde wenigstens seine Unsichtbarkeit erklären; — rätselhaft bleibt aber noch immer sein gewaltiger Einfluß auf unser System, zum Beispiel auf die Mondbahn, ein Einfluß, der auf eine viel größere Masse schließen läßt, als wir sie sonst an einem Kometen kennen —«
»Ja — aber — dann ist es am Ende gar kein Komet im gewöhnlichen Sinne! Apropos — haben Sie aus den Abweichungen im System genauer die Position des unbekannten Störenfrieds zu berechnen versucht, die Elemente seiner Bahn —?«
»Noch nicht, Herr Direktor.«
»O, so lassen Sie uns gleich ans Werk gehen! Die hier im Briefe enthaltenen Daten werden die Arbeit ein gut Teil leichter machen —«
Damit gab der Herr Direktor seinem ersten Assistenten das umfangreiche Schriftstück, dessen Schluß der freundliche Leser oben gelesen.
Das große, auf dem höchsten Punkte der Umgebung von P*** errichtete Observatorium lag einsam und verlassen.
Einsam in dem umfangreichen Gebäude saß in seinem Arbeitszimmer Dr. Steinweg. — Vor ihm auf dem Tische lagen die mit Formeln und Ziffern bedeckten Schriftstücke, über denen er all die Zeit her gegrübelt.
Und was sagten diese krausen schwarzen Zeichen?
Was wollte die endlose Formel da auf dem Blatt bedeuten, das der Assistent gewiß schon ein dutzendmal in diesen Momenten zur Hand genommen?
... Wochenlang hatte Dr. Steinweg schon gewisse Störungen im Laufe des Mondes wahrzunehmen geglaubt, die sich mit den dem Astronomen von jeher bekannten kleinen Unregelmäßigkeiten nicht völlig erklären ließen.
Zwar waren die beobachteten Abweichungen so minimal, daß eben nur eine minutiöse Schärfe in der Beobachtung sie überhaupt wahrnehmen ließ, und Dr. Steinweg hatte anfangs die Sache auf kleine Mängel seiner Beobachtung geschoben. Aber mit jeder neuen Wahrnehmung verlor die Unregelmäßigkeit den Schein persönlichen Irrtums und verdichtete sich mehr und mehr zu objektiver Wahrscheinlichkeit. Schon hatte er soviel festgestellt, daß nur ein gewaltiger, sich unserm Planetensystem in entsetzlicher Geschwindigkeit nähernder Weltkörper durch die Kraft seiner Attraktion diese von Tag zu Tag sich steigernden Unregelmäßigkeiten bewirken könne — als das ominöse Schreiben Direktor T. E. Leskops vom Mount Hamilton eintraf.
In diesem Schreiben wurde nicht nur seine Wahrnehmung bestätigt, die mitgeteilten astronomischen Daten lieferten gleichzeitig soviel neues Material, daß er die Bahnelemente des rätselhaften, noch völlig unsichtbaren Himmelskörpers bestimmen konnte.
Abermals griff er nach dem Blatt mit den Formeln und Zeichen —
»Es ist so und bleibt so!«, sagte er dann mit einem eigentümlich leeren Ton in der Stimme.
Er nahm eine Himmelskarte, auf der der Lauf der Erde in der Ekliptik für die einzelnen Tage des Jahres eingetragen war, und zog mit dem Bleistift eine schwachgekrümmte Kurve —
Dann stand er auf und öffnete das Fenster.
Weich und warm umschmeichelte die Abendluft seine Stirn. — Vor ihm breitete sich in schwellender sommerlicher Schöne die reiche Flur da unten im Tal mit ihren wogenden Kornfeldern, mit ihren Milliarden sich rundender und färbender Früchte in Gärten und Gehegen —
Schwer von reifendem Segen...
Den schmalen Feldweg drüben am Hange empor schritt heimwärts ein junges Weib in bäurischer Tracht, langsam und müde, als trüge auch sie eine Bürde —
Schwer von reifendem Segen...
Dr. Steinweg setzte sich zurück an seinen Arbeitstisch und schloß die Augen, wie einer, der all den Sommersegen da draußen nicht länger zu schauen vermag —
Er saß und sann.
Das kommende Schicksal fragt nicht nach Sommer und Winter, nicht nach Tag und Stunde, nicht nach Saat und Ernte, nicht nach Blüte und Frucht...
Und doch hat der große Brite recht, wenn er vom Leben des Menschen fordert: »Reif sein ist alles!«
— Dr. Steinweg dachte an sein vergangenes Leben: Wohl war manche Frucht aus junger Tage Blüte auch ihm gereift, wohl würde das Kommende ihn nicht unbereit finden; aber seines Lebens schönste Blume brach, ehe sie noch sich entfaltet —
Und er dachte der Zeit, da er jung war —
In den Augen der Frauen, der Mädchen und Mütter seines Bekanntenkreises galt er ja noch heute für jung, trotz seiner grauen Haare — er war ja unvermählt und hatte ein glänzendes Einkommen.
Aber er dachte an seine wahre Jugend. Er dachte an seine junge Liebe, der seine ersten Verse und Tränen geweiht waren.
Keusch und ernst und rein war seine Neigung gewesen — nur zu e i n e m scheuen Kuß hatte er sich in einem seligen Augenblicke Mut gefaßt — Der ernste, einsame Gelehrte lächelte noch heute bei der Erinnerung an diesen Kuß und bei dem Gedanken an ihre beiderseitige Verlegenheit —
Das Schicksal hatte sie auseinandergeführt, hatte ihn ziemlich hart und wild gepackt —
Er hat sie nie wiedergesehen; aber er weiß, daß auch sie einsam lebt fern von hier — eine stolze, herbe, verschlossene Seele —
In diesem Augenblick klopfte es, und der alte Direktor trat ins Zimmer.
»Dachte ich's doch, lieber Doktor, daß Sie noch hier wären! — Denken Sie sich, ich habe noch drei weitere Telegramme erhalten, die alle das gleiche Phänomen betreffen —«
»Ja«, sagte der Angeredete, »die Tatsache ist wohl nicht länger mehr anzuzweifeln! — Bitte, Herr Direktor, hier ist die Bahnberechnung des unsichtbaren Gestirns —«
Damit legte er dem weißhaarigen Herrn seine Arbeit vor.
Der Direktor beugte sich über die Schriftstücke und begann eine endlose Reihe von Formeln und Zahlen zu murmeln —
Immer ernster wurde sein Gesicht. Nach einer Weile sagte er hastig: »Aber — Herr Doktor! Das ist ja ernster, als wir vermuten konnten! Ich sehe, Sie haben die K r a f t 'sche Formel benutzt, die mit nur einer Konstanten die Position der fraglichen Nova zu bestimmen ermöglicht?«
»Gewiß, Herr Direktor —«
»Und Sie halten diese Angabe —« er deutete auf eine Stelle der mathematischen Rechnung — »für sicher?«
»Soweit mein Wissen reicht — ja, Herr Direktor!«
»Aber — dann nähert sich ja der unsichtbare Störenfried ganz bedenklich der Erde! Geben Sie mir doch einmal die Karte der Erdbahn — das ist mir ja beinahe, als müsse die Erde um dieselbe Zeit —«
Dr. Steinweg reichte ihm die Karte, auf der er vorhin die Kurve eingezeichnet —
Einen Blick warf der Direktor darauf — dann sah er seinen Assistenten mit einem seltsamen, ernsten Blicke an und sagte:
»Ich sehe, Sie haben das Fazit der ganzen Rechnung schon gezogen!«
Und dann, nach einer kleinen Pause, fuhr er sehr ernst fort:
»Am 3. August cr. also wird das unbekannte, unsichtbare Gestirn mit unserer Erde zusammentreffen —«
»Mit einer Schnelligkeit von ca. 150 Kilometern in einer Sekunde!«, setzte Dr. Steinweg hinzu.
»Das bedeutet also — das Ende der Welt!«, sagte der Direktor leise, wie zu sich selbst.
»Das Ende der Welt wohl nicht — aber das Ende — der Erde!«
»Das Ende der Erde!«
Nur langsam sickerte diese in Fachkreisen in kurzer Zeit zur Gewißheit werdende Kunde in die Schichten der menschlichen Gesellschaft. Im Beginn ihres Auftretens nur eine vertrauliche Meldung der einzelnen Observatorien, gewann sie allmählich in die Spalten der Tageszeitungen Eingang —
Zuerst freilich in negativer Form.
Die meisten Blätter leiteten ihre Meldung von dem kommenden Ereignis mit der Formel ein:
»Wieder einmal soll die Welt untergehen! Aber obgleich diese Botschaft diesmal aus astronomischen Kreisen stammt, glauben wir ihr doch nicht mehr Wert beilegen zu sollen, als allen ihren Vorgängerinnen —«
Und nun folgte in der Regel eine längere oder kürzere Aufzählung aller bisher prophezeiten Weltuntergänge — und der Schluß der Nachricht lief bei den meisten Zeitungen wieder in die gleiche stereotype Phrase aus:
»Hoffen wir also, daß auch diesmal, wie bisher, unsere alte, gute Mutter Erde am Leben bleibt, unsern Lesern zum Trost und allen Unglückspropheten zum Trotz, die mit mathematischer Gewißheit den Weltuntergang am 3. August cr. verkün den!« — —
Die Witzblätter hatten wieder einen dankbaren Stoff: das Neue in der astronomischen Meldung, daß ein unsichtbarer Himmelskörper von gewaltiger Masse sich unserer Erde aus den Tiefen des Weltraumes nähere, griff man heraus und variierte es in mancherlei Gestalten; der uralte Fenriswolf riß seinen Riesenrachen auf und die Midgardschlange ringelte sich durch das empörte All — —
Am Abend des 3. Juli — nachdem in den Morgenblättern der Residenz noch einmal die BeschwichtigungsHofräte in aller Ausführlichkeit und Bestimmtheit ihres Amtes gewaltet und die Bevölkerung durch das bekannte Wort Aragos beruhigt hatten, daß die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes der Erde mit einem Kometen etc. sich verhalte wie 1 : 280 Millionen, d. h. daß es so gut wie ausgeschlossen sei, daß die Erde einen Zusammenstoß zu erwarten habe — am Abend dieses Tages hielt der alte, weißhaarige Direktor der P***er Sternwarte, O. B. Servator, einen Vortrag vor einer vieltausendköpfigen Menge.
Er war von höherer Seite dazu veranlaßt worden — wohl in der Erwartung, daß seine Darlegungen, die eines Gelehrten von Weltruf, am ersten geeignet sein würden, unnötige Besorgnisse zu zerstreuen.
Der greise Astronom begann ganz schlicht und ohne jedes Pathos die Geschichte des Ereignisses zu erzählen und ging dann auf die besonderen Eigentümlichkeiten ein, die gerade dieser Fall für den Gelehrten von Fach habe; vor allem errege die Unsichtbarkeit des herannahenden Weltkörpers, den man ja in landläufiger Weise einen Kometen nennen könne, und die aus den Störungen berechnete enorme Masse das Interesse der Astronomen. Die Bahnelemente des neuen Weltkörpers seien nunmehr genau festgestellt und zwar mit einer Genauigkeit, wie überhaupt astronomische Berechnungen möglich seien — und bestimmt am 3. August cr., nachmittags 3 Uhr 34 Minuten 52 Sekunden, werde der herannahende Himmelskörper unsere Erde erreicht haben. — —
Bis hierher war die Versammlung den Ausführungen des Astronomen nur mit halbem Ohre gefolgt; — man kannte ja den größten Teil davon aus den Berichten der Zeitungen. Aber nun ging es wie ein Zurechtrücken durch die tausendköpfige Menge, wie ein geistiges Ohrenspitzen —
Man erwartete ja nun das große »A b e r« zu hören, die offizielle Erklärung, daß trotz aller dieser einwandfreien Berechnungen und Voraussetzungen dennoch das gefürchtete Ereignis n i c h t eintreten werde, daß es wohl allerlei Spektakel von Sternschnuppen und Meteoren am Himmel geben werde, daß aber im übrigen keinerlei Grund vorliege, die »süße Gewohnheit des Daseins« für ernstlich bedroht zu halten — und daß die Erde noch ungezählte Millionen von Jahren ungehindert ihre Bahn im Weltraum durchlaufen werde. — —
Der alte Direktor hatte eine kleine Pause gemacht, in der er eine vor ihm liegende Mappe öffnete und ihr ein Blatt entnahm. Dann fuhr er fort:
»Es ist uns auf unserm Observatorium gelungen, gestern in den ersten Morgenstunden endlich eine Photographie des unsichtbaren Kometen zu erhalten. — Die Methode besteht — um dies hier kurz anzudeuten, — im wesentlichen darin, daß man auf einer Platte eine lichtempfindliche Schicht erzeugt, welche aber nicht, wie die gewöhnlichen Trockenplatten, für die Strahlen des sichtbaren Spektrums, sondern für die des ultravioletten Teiles, ungefähr von einer Wellenlänge von 200 Millionstel Millimeter abwärts, empfänglich ist. Der Erfinder dieser Photographie des Unsichtbaren ist unser erster Assistent, Herr Dr. Steinweg — und auf diesem Bilde sehen Sie den Erfolg seiner Arbeit.«
Der Direktor reichte den ihm zunächst Sitzenden das oben erwähnte Blatt —
Von allen Seiten drängte man sich herzu —
Und was zeigte diese Photographie?
Etwas, das auch dem Laien sofort auffiel: keine Spur einer Ähnlichkeit mit dem Aussehen sonstiger Kometen; es fehlte ihm vor allem der Schweif mit seiner mehr oder weniger phantastischen Form, der den Kometen früherer Zeiten den Namen »himmlischer Zuchtruten« verschafft hat. Aber auch der eigentliche Kopf des Kometen, der gewöhnlich immer aus H ü l l e und K e r n besteht, war im Bilde nicht vorhanden; man sah nur eine einfache runde Scheibe, die in mattem, phosphoreszierendem Schimmer sich von der Umgebung des Himmels abhob — weiter nichts!
— Allgemeine Enttäuschung machte sich darum auch bei allen Beschauern des Bildes geltend. Das kleine Scheibchen also war der gefürchtete Himmelskörper, der seit Wochen und Monden die ganze Menschheit der Erde in Aufregung hielt? Nicht einmal einen ordentlichen Schweif, vor dem man sich gruseln konnte, hatte das Ding!
Und diese Stimmung machte sich in einem Ausrufe Luft, mit dem ein behäbiger Berliner Weißbierphilister die Photographie kritisierte:
»Und vor det bisken Nischt habe ich mir nu' jejrault!«
»Ein bißchen Nichts« — das war das Urteil, das man über den angekündigten Weltwanderer zu fällen bereit war, noch ehe der alte Direktor von neuem das Wort ergriffen hatte. Diese Stimmung der Zuhörer war die Veranlassung, daß er jetzt, noch vom Gelächter der Umstehenden über jene ulkige Redensart umdröhnt, mit einer Stimme, die gegen vorhin scharf und schneidend klang, in den Saal hineinrief:
»Ja! — das bißchen Nichts wird uns alle noch graulen machen!« Und nun, jedes seiner Worte mit dem ganzen Ernst seiner Überzeugung betonend, führte er in großen Zügen aus, was der Erde diesmal geschehen würde. Diesmal würde es nicht mit einem harmlosen Sternschnuppenfeuerwerk abgetan sein, wie wenn ein kleiner Komet die Erdbahn schneidet, — diesmal würde es zu einem entsetzlichen Zusammenstoße kommen, von dem das Aufeinanderfahren zweier mit höchster Geschwindigkeit fahrender ExpreßZüge eine schwache Vorstellung geben könne. Bei diesem Zusammenstoß, der die Bewegung der Erde wahrscheinlich sofort zum Stillstand bringen werde, müsse sie, falls sie den Aufprall selbst überstehe, in Weißglut geraten; so groß sei die durch den Stoß und die plötzlich gebremste Bewegung erzeugte Wärmemenge. — Er halte es für seine Pflicht, das hier zu sagen; er wisse wohl, daß man von ihm erwartet habe, er werde die Reihe der Beschwichtigungshofräte vermehren, deren Elaborate vielleicht viele der Zuhörer erst heute morgen in den Tageszeitungen wieder hätten genießen können; aber die Pflicht gegen die Wahrheit und die Wissenschaft gebiete ihm, so zu sprechen, wie er gesprochen. Die Lage sei ernst, entsetzlich ernst. Wenn nicht ein unvorhergesehener Zwischenfall einträte, so gäbe es nach seiner Meinung keine Rettung für die Erde.
»Ich liebe es nicht«, so ungefähr schloß der Redner, »in Paradoxen zu sprechen, sonst würde ich sagen: Wenn einst A r a g o die Wahrscheinlichkeit eines verderblichen Zusammenstoßes zwischen der Erde und einem Kometen wie 1 : 280 Millionen annehmen zu dürfen glaubte, so möchte ich diesmal die Möglichkeit eines glücklichen, ungefährlichen Ausgangs für uns Erdbewohner mit demselben Wahrscheinlichkeitsverhältnis ausdrücken — wie 1 : 280 Millionen!« —
— — Es war allmählich totenstill im Saale geworden. Wie eine Ahnung des Kommenden lag es über der Versammlung. Jeder hörte an den Worten des Sprechers, daß sie Wahrheit, volle, bittere Wahrheit enthielten; jeder fühlte, daß das Schicksal der Erde besiegelt sei. Wohl mochte sich der eine oder andere noch wie an einen Strohhalm an die Worte des Redners klammern, in denen er von einem rettenden Zwischenfalle sprach, der allein noch das kommende Verhängnis aufhalten könnte, — aber die alte sorglose Zuversicht, mit der man bisher die kleine tägliche Sensation von der Annäherung des unsichtbaren »Kometen« mit dem Morgenkaffee zugleich genossen hatte, war dahin!
Man umdrängte den Redner, als er geendet; man hoffte im Privatgespräch von ihm doch noch eine »inoffizielle«, nur für den Privatgebrauch gültige, tröstlichere Ansicht zu erfahren — vergebens: der alte Direktor befreite sich von allen Belagerungen mit den kurzen Worten: »Es ist alles gesagt, was zu sagen war von meiner Seite — und das Reden über die Gefahr schafft sie nicht aus der Welt!«
Und als einer der Zunächststehenden sich die Frage erlaubte, was man tun könne, um das kommende Schicksal wenigstens zu mildern, da sagte der alte Herr — und ein Leuchten brach aus seinen dunklen, von den buschigen weißen Brauen überschatteten Augen — nur das eine Wort: »Hoffen!« —
— Als wieder etwas Stille eingetreten war, stand an Stelle des greisen Gelehrten am Rednerpult — Dr. Steinweg.
»Was will der noch?«, fragten einige. »Wer ist das?«, riefen andere.
»Das ist der erste Assistent am Observatorium«, antwortete ein Herr in der Nachbarschaft der Fragenden, — »Dr. Steinweg —«
»Ach, Dr. Steinweg! — der verschrobene alte Junggeselle!«, tuschelte eine »ältliche« junge Dame ihrer Begleiterin ins Ohr — »paß' auf, Ella, jetzt kommt die ›sittliche Forderung‹« —
»Meine verehrten Anwesenden!«, begann der Redner — »mein hochverehrter Herr Direktor und Vorredner hat mir gestattet, hier noch ein paar Worte zu Ihnen zu sprechen, für die ich nun auch bei Ihnen um freundliches Gehör bitte! — Wie ein Alp wird das soeben Gehörte auf Ihnen liegen. Soweit menschliches Wissen und menschliche Voraussicht reichen, stehen wir vor dem ›Weltuntergang‹, von dem die Weissagungen aller Kulturvölker erzählen. Der ›Jüngste Tag‹ wird hereinbrechen, wenn auch in anderer Gestalt, als gläubige Gemüter erwarten. Das Ende, das jedem von uns beschieden ist, naht, — aber es naht Millionen und Abermillionen zugleich! Vergebens forschen wir in diesem Schicksalsnetz nach einem Loch, wo wir entschlüpfen können; vergebens rufen wir die Götter unserer Tage — die Wundermächte der Technik — um Hülfe an: sie versagen alle! Kein Dampfschiff, kein Blitzzug ist schnell genug, uns diesem Verderben zu entführen; kein Flugschiff vermag das selige Eiland zu erreichen, an dem das kosmische Unheil gnädig vorübergeht! Sie klagen mit mir über das Ende unseres Planeten, über den Untergang der Menschheit; — ich sage Ihnen: das ist nicht das Schlimmste, was uns treffen kann! Schon lange hat uns Schlimmeres getroffen —«
»Was er nur damit meint? Verstehst du diesen Faselhans, liebe Ella?«, fragte die oben erwähnte Dame ihre junge Nachbarin. Diese hatte nicht Zeit, zu antworten; denn der Redner fuhr fort: »Schon längst sind unsere Seelen untergegangen in der hochgepriesenen Kultur unserer Tage! Schlimmer als der leibliche Untergang unseres Geschlechts ist das seit Jahrzehnten immer schneller und unaufhaltsamer unter uns fortschreitende Versinken alles dessen, was unser armes Leben erst wahrhaft lebenswert zu machen vermag, alles dessen, wofür die edelsten Geister der Menschheit gestritten und gelitten, wovon unsere Dichter gesagt und gesungen haben —«
»Ein Idealist!«, rief einer, — »was will der noch in unserer Zeit?«
»Was ein Idealist in unsern Tagen soll?«, rief der Redner, der den Zuruf gehört hatte. »Blicken Sie hinein in unsere Zeit! Wer unter uns darf noch von sich sagen, daß er seinem Ideale treu geblieben ist? Wer hat unter uns noch den Mut, der allgemeinen geistigen Verlotterung entgegenzutreten! Was ist aus uns geworden in der Hetzjagd nach äußeren Erfolgen, unter der Peitsche des Strebertums! Die fortschreitende Kultur unseres hochgepriesenen Zeitalters hat unsern Fuß beschwingt, unser Wort beflügelt, hat unser Auge geschärft und unser Ohr verfeinert, hat in unsre Hand die Macht gelegt, Millionen von Pferdekräften mit elektrischem Zügel zu bändigen — aber sie hat unsern Geist verflacht und unser Herz verödet! In den oberen Schichten der Gesellschaft äußerer Glanz und raffinierter Lebensgenuß bei innerer Hohlheit und Verderbnis — in den untersten Klassen des Volkes völliger Zusammenbruch! Und was soll daraus werden in den Tagen, die uns bevorstehen? Die Bestie im Menschen wird übrig bleiben, die Bestie, die durch den Fortschritt der Wissenschaften nur noch raffinierter in ihren Mitteln geworden ist. Darum, meine Freunde, lassen Sie dies MeneTekel nicht vergebens mit seiner unheimlichen Hand erscheinen! Lassen Sie uns retten, was noch zu retten ist! Ist uns der Untergang beschieden, so lassen Sie uns untergehen als wahre Menschen! Niemand wird unsere Geschichte schreiben, niemand uns richten und strafen wegen unsres Tuns und Lassens in den Stunden des Untergangs — ein jeder von uns wird sein eigener Richter sein. Die Erde kann in Trümmer gehen — aber unsre Menschenwürde nicht, und erhaben über Raum und Zeit, erhaben über Werden und Vergehen, über alles kosmische Geschehen ist das Ich in uns, das Bewußtsein unserer Persönlichkeit, das Ewige, das Göttliche —«
Lautes Gemurmel erhob sich. Einzelne wüste Rufe wurden laut: »Phrasen! — Unsinn! — Schluß! Schluß!«
»Ausreden lassen! Ruhe! Ruhe!«, riefen andre.
Und schon begann die Menge sich in Parteien zu spalten. Pfeifen und Zischen ertönte. Im Hintergrund erhob sich wilder Lärm —
Von der Galerie des Saales flogen plötzlich hunderte bedruckter Blätter unter die Versammelten.
»Extrablätter! A u f r u h r i n N e w - Y o r k! R e v o l u t i o n i n C h i c a g o!«
»Vorlesen! Vorlesen!«, riefen einige.
Ein junger Mann in Arbeitertracht stieg auf einen Tisch und las:
»Telegramm aus NewYork: Geheimbericht des hiesigen Staats Observatoriums heute entdeckt! Erdzusammenstoß am 3. August cr.
Furchtbare Katastrophe unvermeidlich! Untergang alles Bestehenden wahrscheinlich! Aufruhr unter der Bevölkerung! Erstürmung von Tamany-Hall! Plünderung der Banken und Warenhäuser! Auch in Chicago offene Revolution! Regierung machtlos! Krieg aller gegen alle!«
»K r i e g a l l e r g e g e n a l l e !« Wie ein Flugfeuer lief das Wort durch die Menge.
Ein unbeschreiblicher Tumult entstand. Man umdrängte den Redner; Fäuste ballten sich; Schreien und Johlen erfüllte den weiten Raum. Die bessern Elemente in der Versammlung flüchteten aus dem Saale.
Dr. Steinweg stand unbeweglich und sah mit festem Blick auf die tobende Menge —
Eine Hand faßte seinen Arm.
Sein alter Direktor war es, der ihn vom Rednerpulte hinwegführte.
»Kommen Sie, lieber Doktor und Freund! Sie sehen, wo die Sache hier hinauswill! Ein Einzelner ist machtlos dagegen! Kommen Sie — der täppischtückische Zufall mit den amerikanischen Alarmnachrichten hat vollends alles verdorben. Aber vielleicht haben Sie doch dem einen oder andern das schlummernde Gewissen geweckt. — Sie wissen, ich denke wie Sie! Und wenn es noch einmal eine Menschenerde gibt, so gehört der Fortschritt, der uns wirklich h ö h e r führen kann, dem Idealisten; denn nur der Idealismus kann Sieger werden über die Entartung unserer Tage, über das Irdische, AllzuIrdische in und um uns! Kommen Sie — qui vivra verra!«
Und nun schlug die allgemeine Stimmung in ihr Gegenteil um. Immer zahlreicher wurden die Alarmnachrichten. Und daß man den herannahenden Feind nicht sah, wie andere Kometen, weil er sich noch fortgesetzt in den Strahlen der Sonne verbarg, machte die Situation noch grausiger. Aber man würde ihn schon noch sehen; das hatten die Astronomen festgestellt — allerdings erst kurz vor dem Zusammenstoß!
So vereinigte sich alles, um die menschliche Gesellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern.
Jetzt hätte die moderne Zivilisation, die hochgepriesene Kultur unserer Tage, einmal beweisen können, was sie wert war, hätte zeigen können, zu welchen gefesteten Wesen sie die Menschen mit ihren UrInstinkten gemacht —
Und sie versagte kläglich, wie schon der erste Anfang in Amerika bewiesen hatte! Die Arbeit stockte, trotz aller Vorkehrungen, welche die Regierungen, teilweise mit Gewalt, getroffen hatten. Die Massen des Volkes belagerten die öffentlichen Gebäude. Überall regte sich der Aufruhr.
— Allerlei wunderliche Fahrzeuge für Wasser und Luft wurden gebaut, Schiffe, die nicht untergehen sollten, riesige Fesselballons etc. Auch die vorhandenen Ballons für militärische und aeronautische Zwecke wurden von der räuberischen Menge mit Beschlag belegt, um für den Tag des Zusammenstoßes disponibel zu sein. Über die Frage, w o h i n sich die Überlebenden in den Ballons retten würden, zerbrach man sich dabei nicht den Kopf. — Allerlei tolle Vorschläge zur Rettung der Erde wurden gemacht: der eine schlug vor, auf der Bahn des Kometen innerhalb unserer Atmosphäre riesige Fesselballons, mit Sprengstoffen gefüllt, steigen zu lassen, die beim Anstoß explodieren und ihn aufhalten sollten; ein anderer empfahl, mit Krupp'schen Riesengeschützen nach ihm zu schießen, sobald er sichtbar geworden wäre; ein dritter wollte die gesamte Wasserkraft des Niagara zur Erzeugung einer starken elektrischen Entladung benutzen, um den sich nähernden Kometen zu vernichten; ein vierter wollte den Lauf des Kometen durch irgend welche Kräfte so beeinflussen, daß er an einer der tiefsten Stellen des großen Ozeans die Erde treffe, dessen Wassermenge wie ein Stoßkissen die Heftigkeit des Anpralls mindern sollte — und was dergleichen Unmöglichkeiten mehr waren.
Alle Klassen der Bevölkerung hatte nach und nach die bleiche Furcht vor dem Kommenden ergriffen.
Nur eins hob sich aus dieser Flut des Egoismus leuchtend empor: das war die alte deutsche Treue im Berufe, die ihre Pflicht tut bis zuletzt, auch auf dem verlorenen Posten; doppelt hell brach sie hervor aus dem Wust des Strebertums, das sich überall an den hervorragendsten Stellen breit gemacht hatte.
All die Ausgeburten abergläubischer Furcht, von denen der Chronist aus dem Jahre 1000 n. Chr. erzählt, wiederholten sich, wenn auch in modernerer Form — und wie einst feierte besonders die religiöse Ekstase ihre Orgien. Auf allen Plätzen, an allen Straßenecken, mehrten sich ordinierte und nichtordinierte Bußprediger. Alle Schrecken, welche die gequälte Phantasie finsterer Jahrhunderte für den »Jüngsten Tag« ersonnen, lebten wieder auf in den Gemütern. Die »Heilsarmee« gewann ungeheure Scharen neuer Anhänger, und um ihre Hauptquartiere mit den bunten Fahnen flutete Tag und Nacht eine leidenschaftlich hin- und herwogende Menge.
Auch das »Geschäft« blühte. Von Amerika aus sandten spekulative Versicherungsgesellschaften lockende Prospekte, in denen sie gute Plätze in stoßsicheren, wasserdichten Gondeln ihrer riesigen, mit reinem Helium gefüllten Luftschiffe — gegen gute Bezahlung anpriesen...
Am 13. Juli, in den Spätnachmittagsstunden, sah man in Europa zum ersten Male einen dunklen Punkt vor der leicht durch Wolkenschleier abgeblendeten Sonnenscheibe. Man hätte das Phänomen für eine kleine partielle Sonnenfinsternis halten können; leider aber stand für diesen Tag keine im Kalender!
Die Menschen blieben auf der Straße stehen und zeigten einander den runden schwarzen Fleck —
Der Zerstörer!
Er existierte also — trotz aller noch immer auftretenden Ableugnungs- und Vertuschungsversuche, und er kam mit jeder Sekunde ca. zwanzig Meilen der Erde näher!
Die Angst, die Aufregung und Verzweiflung der einen und die Zügellosigkeit und Zerstörungswut der andern wuchs mit Riesenschritten, je größer der Fleck vor der Sonnenscheibe wurde.
Am 23. Juli, nachmittags 5 Uhr 34 Minuten 31 Sekunden, verschwand zum ersten Male die leuchtende Sonnenscheibe auf einige Augenblicke g a n z hinter der dunklen Scheibe des »Kometen«,
Das grausigschöne Schauspiel einer totalen Sonnenfinsternis ward den Bewohnern eines Teiles der nördlichen Erdhälfte unerwartet zuteil. Wie eine Prophezeiung kommenden Unheils umgab eine riesige, gleich feurigen Schwertern lodernde, blutrote Korona die verdunkelte Sonnenscheibe...
In dem kleinen thüringischen Landstädtchen Camburg stand in der Abenddämmerung an dem geöffneten Giebelfenster eines freundlichen villenartigen Landhauses eine einsame Frauengestalt und blickte hinab ins Tal der Saale.
Nicht mehr der Zauber der ersten Jugend lag auf diesem Antlitz, in welchem große, blaue Augen zu dem tiefkastanienbraunen Haar einen reizvollen Gegensatz bildeten — aber ein Abglanz seelischer Hoheit verklärte wie ein von innen strahlendes Leuchten die ganze Gestalt, und das Weiß ihres Gewandes, das sie in weichen Linien umfloß, erhöhte noch diesen Eindruck.
Mit gleichgültigem Auge sah sie all die Hunderte von Menschen da unten am Ufer der Saale, die alle, wie gebannt, nach einer Stelle des Himmels starrten —
Hoch im Blauen über ihnen hing wie ein großer, dunkler Ball der »Zerstörer«, der Komet, der sich unaufhaltsam der Erde näherte und nun, scheinbar n e b e n der Sonne stehend, infolge seiner enormen Größe, sichtbar war.
Flüchtig hefteten sich Hanna Rodtbachs Augen einen Moment auf den schwarzen Schatten da oben im lichten Blau.
Sie weiß, was er bedeutet; aber sie fürchtet ihn nicht.
Ihr wird er kein Zerstörer werden; sie sieht in ihm einen Befreier. Das Leben, das viele so preisen, um das viele jetzt so jammerten, ihr war es ein Zerstörer geworden, ein Zerstörer ihrer Lebenshoffnungen, ein Vernichter alles dessen, was ihr Dasein notwendig und lebenswert gemacht hätte. — Der Schrecken da oben am Firmament lenkt ihr stilles Sinnen und Träumen plötzlich zu dem zurück, dessen Beruf es geworden, den Himmel und seine Gesetze zu erforschen — zu Dr. Steinweg, als er noch Erwin Steinweg für sie war, zu dem Geliebten ihrer Jugend. — —
Vielleicht hefteten sich auch seine Augen in diesen Momenten nach dem Himmelskörper da oben — mit dem Interesse des Forschers. Was würde er ihr alles erzählen können, wenn er noch, wie einst, vor mehr als fünfzehn Jahren, an ihrer Seite unter dem sternbesäten Firmament durch die abendlichen Fluren der Heimat schreiten könnte!
Dahin! — —
Heute weiß sie, daß sie beide schuldlos waren an ihrem Auseinandergehen. Das Leben war stärker als sie! All die kleinlichen Rücksichten kleiner Verhältnisse haben sie um ihr Glück betrogen. Mit Bitterkeit denkt sie an alle die Listen und Tücken ihrer besorgten Verwandten, mit denen man ihr den Geliebten entfremdet hat — mit leiser Bitterkeit auch gegen sich selbst und ihre Verzagtheit, und wie so manches Mal geht ihr sein letzter Gruß durch die erinnernde Seele:
»Verlaß mich nicht! Du bist ein lichter Engel,
Das Morgenglüh'n auf deiner Stirne lacht,
Und ich bin finster, voller Fehl' und Mängel;
Ob meinem Haupte flutet düstre Nacht.
Und kannst den armen Narren du verlassen,
Leb' wohl! Nicht darf ich halten dich und fassen;
Doch wenn dein Herz nur leis' noch für mich spricht
— Verlaß mich nicht!...«
Er hat sie nie wiedergesehen — sie ihn nur ein einziges Mal, als sie einem Vortrage beiwohnte, den er vor einiger Zeit in einem wissenschaftlichen Vereine der NachbarResidenz über eine von ihm gemachte Entdeckung gehalten hat. Sie saß in einer versteckten Saalnische und hatte ihn ungestört beobachten können. Wie treu hatte sein männlichernstes Gesicht die lieben, ihr so vertrauten Züge des Jünglings bewahrt! Und wie tief hatte sie gefühlt, daß ihr Herz noch immer ihm gehörte, trotz alledem!...
Ein Geräusch an der Tür hat sie vom Fenster zurückgezogen —
Und da — steht er mitten im Zimmer!
Sie erschrickt und faßt nach ihrem Herzen.
Er aber nimmt ihre Hand fest und treu in die seine und sagt nur:
»Das Schicksal hat uns beiden verwehrt, mit einander zu leben, liebe, unvergessene Hanna; aber es soll uns nicht hindern — wenn du es willst —«
»Mit einander zu sterben!«, sagte sie, seine Worte vollendend, und ein befreiendes Aufleuchten strahlt aus ihren seelentiefen Augen...
Und über der angstvoll hin- und hergestikulierenden Menge, deren Schreien und Jammern immer lauter herauftönt, steht am Fenster, fest umschlungen, ein seliges Paar, vielleicht die einzigen, die den dunklen, jetzt in der abendlichen Dämmerung doppelt grausig erscheinenden Zerstörer da oben am Himmel mit ruhigem Herzen betrachten.
Die Feder erlahmt bei der Schilderung all der fürchterlichen Szenen, die sich nun, wenige Stunden vor dem Zusammenstoße, unter den Menschen abspielten. Die Zeiten der französischen Revolution kehrten wieder, aber in tausendmal schrecklicheren Gestalten! So wie auf einem untergehenden Schiff der brutale Egoismus in seiner entsetzlichsten Erscheinung die Zähne fletscht, so hundertfach, zehntausendfach wiederholten sich jetzt, in den letzten Stunden die Szenen, in denen die zweibeinige Bestie, nur noch geleitet von ihren angeborenen Trieben, den Kampf ums Dasein führte. Feigheit und Grausamkeit überall! — Die Gelehrten hatten die Örtlichkeit von Berlin als den wahrscheinlichen Punkt für den Zusammenstoß berechnet — und hier tobte der Kampf aller gegen alle in seiner ganzen Furchtbarkeit. Die wenigen Züge, die noch abgelassen werden konnten, wurden gestürmt, und um einige Luftballons wurden förmliche Schlachten geliefert. Die Zurückbleibenden ließen ihre Wut und Verzweiflung in allerlei Schändlichkeiten aus: Denkmäler wurden zertrümmert, deren es ja in Berlin eine große Anzahl gab, Gefängnisse gestürmt, Fabriken mit Dynamit zerstört, Eisenbahnbrücken gesprengt — stundenlang tobte der Kampf zwischen den Regierungstruppen und dem wütenden Mob in den Straßen; zu Hunderten türmten sich die Leiber der Gefallenen auf — —
Ziehen wir einen Schleier über diese letzten Stunden, da fast ein Dritteil des ganzen Firmaments schon verdeckt war von dem nahenden Weltungeheuer, das wie das sichtbar gewordene dunkle Schicksal seine Todesfittiche über die Erde spannte — —
Im Observatorium zu P*** stand der greise Direktor an seinen Instrumenten.
»Ein braves Pferd stirbt in den Sielen!«, hat unser großer Bismarck einmal gesagt, und ein gut Teil von seinem Lebensernst und seinem Pflichtgefühl hat auch der alte Gelehrte. — Zwar weiß er nicht, für wen er all die interessanten Abweichungen in der Mechanik des Himmels in diesen Tagen aufzeichnet — aber er tut es in peinlicher Gewissenhaftigkeit. Zu den astronomischen Störungen gesellen sich nun auch allerlei terrestrische. Vor einer Stunde ungefähr durchzuckte ein gewaltiges Beben den Erdkörper; die Seismographen im Kellergeschoß des Observatoriums weisen auf eine momentan auftretende Erderschütterung hin, deren Epizentrum in der westlichen Erdhälfte zu liegen scheint. —
Als Dr. Steinweg ihm vor ein paar Tagen seinen Entschluß mitteilte, hier auf der Sternwarte bei ihm auszuhalten, wie ein Soldat auf Posten, bis zum letzten Augenblicke, da hatte er ihm die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt:
»Nein, lieber Doktor und Freund! Für Sie gibt es einen schöneren Platz zum Sterben —«
Und als der Assistent ihn mit einem ahnungsvollen Erblassen ansah, sagte er gütig:
»Haben Sie mir nicht selbst einmal erzählt, warum Sie einsam geblieben sind!«
Dr. Steinweg drückte ihm stumm die Hand.
»Nun also! Auch s i e ist einsam in diesen schweren Stunden. Gehen Sie zu ihr!«
»Aber Sie, lieber, verehrter Herr Direktor? Sie sind ja auch ganz einsam hier oben?«
»Kann ich's ändern, daß mir mein Frauchen genommen wurde — oder richtiger ausgedrückt, daß ich sie unvorschriftsmäßiger Weise überlebt habe? Um mich sorgen Sie sich nicht, Herr Doktor. Und der alte Kulpe bleibt ja auch hier oben! Ich will zum letztenmal Ihnen gegenüber den allwaltenden Direktor spielen und Sie in optima forma von Ihren Amtspflichten hier im Observatorium entbinden. Reisen Sie mit Gott! Beinahe hätt' ich gesagt: Auf Wiedersehen! — Nun — wie der Himmel will!« — Noch ein letzter Blick Aug' in Auge, ein fester, treuer Handschlag — dann war Dr. Steinweg gegangen. —
Ein Klingelsignal ertönte. Der Direktor fuhr auf aus seinem Sinnen.
Ein Klappern wurde hörbar. Der Ferndrucker des ÜberseeTelegraphen meldete ein Telegramm.
Der Direktor trat an den Apparat —
Auf dem abrollenden, automatisch bedruckten Papierstreifen las er folgende Depesche, aufgegeben in NewYork vormittags 8 Uhr 49 Minuten 38 Sekunden amerikanischer Zeit:
»FURCHTBARE EXPLOSIONSARTIGE VULKANAUSBRÜCHE IN DER ANDENKETTE. HUNDERTE LÄNGST ERLOSCHENER KRATER PLÖTZLICH WIEDER IN TÄTIGKEIT! NÄHERE NACHRICHTEN FEHLEN NOCH.«
Nachdenklich überlas er nochmals das Telegramm.
»Also das war das von unserm Erdbebenmesser registrierte Beben. Es ist wahrscheinlich eine Folge der Anziehungskraft des ›Kometen‹«, sagte er dann, »auch die Gluten des Erdinnern werden, wie die Wasser des Ozeans, zu einer einzigen riesigen Flutwelle emporgerissen und bahnen sich einen Weg durch ihre alten Schlünde! Die Erde bebt in Erwartung des Kommenden.« —
Und wieder war eine Stunde vergangen, langsam und schwer, und immer tiefer senkte sich die dunkle Last herab auf die bangende Erde.
Der Direktor trat an das BeobachtungsFernrohr, um abermals Rektaszension und Deklination des »Kometen« zu bestimmen —
Ein Aufschrei entfuhr ihm, als er die neue Ablesung machte.
In fieberhafter Eile warf er Formeln und Ziffern auf Papier —
Eine Stunde war so vergangen.
Und aufs neue prüfte er den Stand des Kometen, und aufs neue begann er zu rechnen —
Dann eilte er an den Telegraphen —
Wohl zitterten ihm die alten Finger, als er den Taster in Bewegung setzte; aber es waren ja nur wenige Zeichen, die er dem Apparat zur Botschaft anvertraute.
Dann sank er, von der Aufregung erschöpft, in den Sessel vor seinem Arbeitstische.
Auf seiner Stirne aber lag ein rätselhafter Glanz —
Und nun war die Stunde des Untergangs gekommen. — —
Dr. Steinweg sah auf seinen Taschenchronometer —
Noch 34 Minuten 52 Sekunden!«, sagte er zu Hanna Rodtbach, die Arm in Arm neben ihm am Fenster ihres Giebelstübchens stand, »es ist drei Uhr« —
»Sieh' nicht mehr nach der Uhr, Liebster!«, bat sie leise. »Die Zeit wird schnell genug dahin sein — für dich und mich und für uns alle —«
Und mit unnennbarem Schauer sah sie vor sich, über sich am Himmel, fast zwei Dritteile des Horizontes verhüllend, die riesige schwarze Scheibe, die mit jedem Augenblick, wie ein heransausender ExpreßZug, an Größe wuchs —
Infolge einer optischen Täuschung erschien dieser dunkle Körper ausgehöhlt, wie ein gähnender schwarzer Schlund, in den die Erde hineinstürzen würde!
Die Sonne war verdeckt von dem riesigen Gestirn; das fahle, schauerliche, bleifarbene Licht einer totalen Sonnenfinsternis hüllte alles ein und vermehrte noch die Schrecken der letzten Minuten.
Gewaltige elektrische Entladungen erschütterten die Atmosphäre, und nicht endenwollender Donner hallte wider aus den Tiefen des Firmaments. Heftig pfeifende orkanartige Windstöße traten auf, die über die Fluren dahinsausten, alles vernichtend unter einem Hagel von riesigen Eisstücken.
— Und jetzt — die Uhren an den öffentlichen Gebäuden zeigten auf 4 Minuten nach halb 4 Uhr — blieben nur noch wenige Sekunden —
Einen Augenblick lang schien das ganze Firmament erfüllt von dem schwarzen Riesenball, dessen Peripherie von einer unaufhörlich wie ein Nordlicht hin- und herflutenden Aureole umzuckt wurde —
Hanna Rodtbach küßte den ernsten Mann an ihrer Seite.
»Noch einmal habe Dank, daß du gekommen! Halte mich fest, Geliebter!«
Dr. Erwin Steinweg blickte ihr fest ins Auge — — —
Da fiel ein heller Schein auf ihr bisher in dem bleifarbenen Zwielicht totenbleiches Antlitz und glitt über ihr braunes Haar — ein lichter Schein vom Fenster her —
War es die irdische Glut ausbrechenden Feuers?
War es die vom Himmel fallende Lohe des Weltbrandes?
Es war — ein erster schüchterner Sonnenstrahl!
Dr. Steinweg zog die Uhr — sie zeigte auf 4 Uhr 37 Minuten 29 Sekunden. Fast drei Minuten über die berechnete Zeit!
Und die Erde hatte noch keinen Zusammenstoß erlitten!?
Und da erschien wahrhaftig seitlich schon die Sonne wieder!!!
Was war geschehen?!
Wie war das Unmögliche möglich geworden!?!
Das kurze Telegramm, welches das Reichsamt kurz vor der Sekunde des Zusammenstoßes empfing, kam aus dem Observatorium bei P*** und enthielt die Worte:
ZUSAMMENSTOß ABGELENKT DURCH ABWEICHUNG DER ERDE VON IHRER BAHN, DIE EINIGE STUNDEN VORHER PLÖTZLICH EINGETRETEN. GRUND DAFÜR UNBEKANNT. DER ›KOMET‹ UM 3 UHR 54 MINUTEN 52 SEKUNDEN SCHON CA. 100 MEILEN VON DER ERDE ENTFERNT. O.B. SERVATOR.«
— — Ja — die Erde war gerettet — in zwölfter Stunde!
Wohl folgten noch einige bange Stunden des Zweifels, und solange der schwarze Schatten noch dräuend am Horizonte hing, stand auch noch die Sorge im Herzen der Menschen; als aber der Morgen des neuen Tages golden und sonnig heraufstieg, wie seit Jahrmillionen, und der »Zerstörer« nicht mehr den Himmel verdunkelte, da kehrte auch dem Verzagtesten Mut und Hoffnung zurück. Im Laufe der nächsten Tage fand sich die Menschheit wieder in ihr altes Gleis, schneller als man gedacht. — — —
In dem Briefe, in welchem Dr. Steinweg seinem alten Direktor seine Vermählung meldete, bat er ihn gleichzeitig um die astronomischen Aufzeichnungen, die dieser in den Stunden vor dem erwarteten Zusammenstoße gemacht hatte.
Der Direktor schloß seinen Gratulationsbrief mit den Worten:
»Anbei also lasse ich Ihnen das gewünschte Material zugehen. Frau Hanna wird — nach allem, was Sie mir von ihr berichtet, nicht schmollen, wenn Sie ab und zu einmal ihren Blick von dem Himmel Ihres häuslichen Glückes wieder zu dem außerirdischen wenden, der ja nun einmal für uns Astronomen nur eine Tafel voll gelöster und noch ungelöster Rechenexempel ist. Und daß das letzte noch ungelöste Rätsel: ›warum der erwartete Zusammenstoß mit dem ominösen Kometen nicht eingetreten ist«, Sie ebenso quält wie mich, weiß ich auch, lieber Herr Doktor und Freund! Aber vielleicht sind Sie bei dessen Lösung glücklicher als ich. —
Daß Sie das im allgemeinen und im besondern sein mögen, ist der aufrichtige
Wunsch Ihres ergebenen
O.B. Servator.«
— Der Wunsch des alten Herrn Direktors ging in Erfüllung: einige Wochen später legte Dr. Steinweg der Akademie der Wissenschaften eine Arbeit vor, welche den Titel trug:
Der Verfasser wies darin an der Hand eingehender Berechnungen nach, daß die kurz vor dem Zusammenstoße erfolgte plötzliche Abweichung der Erde von ihrer Bahn einfach eine Wirkung des Rückstoßes sei, welchen die momentan erfolgende Eruption der Hunderte von Kratern in der Andenkette auf den Erdkörper ausgeübt habe. All die momentan explosionsartig in Tätigkeit tretenden Vulkane mit ihren tausende von Metern tiefen, von den Ablagerungen ganzer Erdperioden verschütteten und belasteten Kratern seien solche Riesengeschütze, die ihre Ladung in den Raum schleuderten. Die in der Kettenform der Anden liegende, reihenweise Anordnung der Vulkane ergebe lauter gleichzeitig und in gleicher Richtung gegen den Erdkörper gerichtete Reaktionsstöße, deren Summierung die Kraft erzeugt habe, die hinreichend war, die Erde aus ihrer Bahn um die Sonne zu schleudern, zwar nur um winzige Bruchteile einer Bogensekunde — aber doch ausreichend, um den gefürchteten Zusammenstoß zu verhindern. —
Der Bericht schloß:
»Ist es nicht, als ob der von dem unsterblichen Darwin zuerst in seinen Konsequenzen gewürdigte ›Kampf ums Dasein‹ sich auch in diesem Falle in wahrhaft grandioser Weise, wie in einem lebendigen Organismus, durchgesetzt habe? Wie überall in der Welt des Lebens die Not die schlummernden Kräfte der Organis<>men weckt oder zu erneuter Betätigung zwingt, so hat in diesem ›struggle for life‹ unsere Mutter Erde die in ihr seit ungezählten Jahrtausenden vorhandenen, aber zeitweilig schlummernden Kräfte in der einfachsten, aber wirksamsten Weise zur Rettung vor dem herannahenden Feinde benutzt — und damit unserm Geschlechte die Fortentwicklung auf weitere Jahrmillionen hinaus gesichert. Denn im Aufbauen und Weiterbauen — in der Evolution — ruht das Geheimnis und der Sinn alles Lebens. Das Paradies liegt v o r uns und nicht h i n t e r uns.«
Der letzte Satz der Abhandlung war im Manuskript von einer Frauenhand geschrieben, von Hanna Steinwegs Hand. Und wenn er auch zunächst nur wie eine rein persönliche Verheißung klang — für den Bund, den sie in jener letzten Stunde noch mit dem Immergeliebten geschlossen, so sprach sich doch darin ebenso zuversichtlich die Hoffnung aus auf ein Besserwerden der menschlichen Gesellschaft überhaupt. Denn in allen Ständen und Klassen der Bevölkerung regte sich's leise, aber unaufhaltsam, wie ein neues, höheres Leben!
Er stürmte die Bahnhofstreppe hinauf, im Fluge noch einen Blick auf die Auslage des Buchhändlers werfend; denn schon donnerte der Stadtbahnzug in die abendlich erleuchtete Halle.
Noch einen Moment hielt ihn die Kontrolle des Billetschaffners auf. —
Schon ertönte das Zeichen zur Abfahrt, und ächzend, wie ein zur Arbeit sich reckender Riese, begann die Lokomotive ihr Werk von neuem. Glücklich erreichte Tramm noch mit einem gewandten Sprunge eines der letzten Coupés und warf sich aufatmend in die nächste Ecke. Das Coupé war nur wenig besetzt; es enthielt außer ihm nur noch zwei Personen. Ihm schräg gegenüber saß ein junger Mann, anscheinend ein Kaufmann, ihm zur Rechten ein älterer Herr. Letzterer erregte sofort sein Interesse. Ein eigentümliches Etwas ging von seiner Erscheinung aus, eines jener rätselhaften Fluida, welche auch in unserem nüchternen wissenschaftlichen Zeitalter noch immer geheimnisvoll ihre Kreise ziehen und ihren Träger aus der Sphäre gewöhnlicher Menschen herausheben. Äußerlich fiel an ihm sein langer Bart auf, nicht allein seiner Länge, sondern vor allem seiner Farbe wegen; er glich in seinem silbergrauen Glanze einem feinen Metallgespinst und sah aus, als ob ihn nicht erst die Jahre so gefärbt, sondern als ob er von Anfang an so gewesen.
Der Mann schien augenleidend zu sein; die Augen waren hinter einer Brille mit eigentümlich gefärbten und geschliffenen Gläsern verborgen. — Tramm wandte sich von der Betrachtung seines Nachbarn ab und schloß ein Weilchen die müden Augen. Sein Tagwerk ging an seinem Geiste vorüber: der Unterricht in den Frühstunden, der ihm soviel Freude machte, aber auch Nerven kostete, die wenigen Minuten häuslichen Glückes am Mittagstisch, dann die emsige Arbeit im Laboratorium bis zum Abend und manchmal, wie heute, noch die Vorträge in den Abendstunden. Es war doch eigentlich eine Hatz'! Eine Hatz', die nun schon Jahre um Jahre dauerte.
Er dachte an seine Jugend...
Wie hoffnungsreich war er in sein Leben hinausgestürmt! Ihn trugen glänzendere Fittiche als nur die raschen Schwingen der Jugend! Die Poesie mit ihren farbenschimmernden Flügeln umrauschte seine Seele, schirmend, tragend und segnend.
Seine Poesie! Ach, wo war sie geblieben all die letzten Jahre hindurch! Abringen mußte er sich die kargen Stunden, um der Muse zu opfern. Und »die Poesie verlangt den ganzen Menschen.«

Die letzten Jahre waren schwer gewesen. Der Tod riß schmerzliche Lücken in den trauten Kreis der Wesen, die ihm teuer waren, drohend gegen ihn den knöchernen Finger hebend. Schwere Krankheit hielt ihn lange ans Lager gefesselt. Eine böse Erinnerung an diese böse Zeit war ihm geblieben: die alte, unversiegliche Spannkraft des Körpers und des Geistes schien für immer dahin. Die Nerven wollten nicht mehr mit! — Eine Bewegung seines Nachbarn ließ ihn aufsehen.
Der alte Herr schien eingeschlafen zu sein. Er hatte die Schutzbrille abgenommen und bedeckte die Augen mit der Rechten. Die Linke hielt die seltsam geformte Brille, und ihr lässiges Herabsinken hatte Tramm aufgeschreckt.
Er sah, daß die Brille im nächsten Augenblicke den im Schlaf sich öffnenden Fingern entgleiten mußte. Er wollte den Schläfer wegen solcher Kleinigkeit nicht wecken — und so nahm er ihm vorsorglich und leise die Brille aus der Hand.
Mechanisch hob er sie zum Auge empor und warf einen Blick hindurch, um Schliff und Art der Gläser kennen zu lernen...
Und da entfiel sie fast seinen Fingern...
Was hatte er gesehen?
Mit einem aus Grauen und Verwunderung gemischten Erstaunen betrachtete Tramm die Brille. Wie war denn das möglich?
Einen Augenblick glaubte er zu träumen...

Aber er war doch wach! Er sah seine Umgebung vor sich wie sonst: das erleuchtete Coupé mit den beiden Insassen.
Abermals hob er die Brille vor die Augen.
Und abermals, mit dem nämlichen Schreck, setzte er sie wieder ab...
Ihm schräg gegenüber saß, wie oben erwähnt, ein junger Mann, dem Aussehen nach ein Kaufmann. Sein Gesicht zeigte einen frischen, energischen Zug, der durch einen goldenen Kneifer noch mehr hervortrat.
Und als Tramm jetzt die rätselhafte Brille zum drittenmal vors Auge brachte, sah er zum drittenmal, was ihn zweimal so sehr erschreckt...
Er sah gleichsam durch die körperliche Hülle seines Gegenübers hindurch — in seine Seele! Als ob, um einen rohen Vergleich zu brauchen, eine kunstvolle automatische Figur plötzlich durchsichtig würde und ihren verborgenen Mechanismus enthüllte. Er vermochte nicht sich darüber Rechenschaft zu geben, ob und wie so etwas möglich sei — aber er sah nicht mehr den netten jungen Kaufmann; er sah einen brutalen Egoisten, sah durch eine unerklärliche Wirkung der Brillengläser mitten hinein in den Denkapparat seines Gegenübers, sah, wie das Gehirn des Mannes eben die Pläne spann, um — morgen die Mittagstunde, wo er mit seinem Chef allein im Kontor war, zu einem Riesendiebstahl zu benutzen. Tramm nahm an dem ganzen verbrecherischen Plane teil, als ob er in seinem eigenen Gehirn entstehe; — er sah das behaglich eingerichtete Kontor mit den braunen Ledertapeten vor sich, das gütige, wohlwollende Gesicht des alten Handelsherrn mit den tausend Fältchen um die klugen braunen Augen, glattrasiert bis auf den graumelierten Backenbart; — er sah, wie der junge Mann den Moment benutzen wollte, wo sein Prinzipal nach alter Gewohnheit sich nach einem kleinen Wandschränkchen umdrehte, um daraus eine Zigarre zu entnehmen. In diesem Augenblick wollte er ihm von hinten den Hals zudrücken...
Er sah das natürlich nicht körperlich; er nahm nur teil an den seelischen Vorgängen seines Gegenübers — aber doch so, als ob durch die wunderbaren Kristallgläser der Brille die Nervenschwingungen in den Zellen der Großhirnrinde des andern transformiert und wie gewöhnliche Lichtschwingungen sichtbar gemacht würden.
Unwillkürlich wandte Tramm den Blick zur Seite auf die leere Wand des Coupés. Da sah er durch den Lack- und Farbenüberzug hindurch die Fasern der Holzwand vibrieren unter den starken Erschütterungen des schnellfahrenden Zuges, sah, wie die eisernen Bänder, Nieten und Schrauben fast bis zum Zerreißen belastet wurden, sah ihre Deformierung an den Stellen höchster Beanspruchung...
Von der Coupéwand ihm gegenüber ging sein Blick zum offenen Fenster hinaus, hinaus in die Nacht des Frühherbstes.
Aber dieser Himmel, der ihm noch vorhin auf seinem kurzen Wege zur Stadtbahnstation so dunkel und lichtlos erschienen war, flammte in niegesehener Sternenpracht — als ob der Beschauer plötzlich seinen Standpunkt um 10 000 Meter erhöht, oder als ob die Lufthülle der Erde dünner geworden sei.
Er nahm die Wunderbrille vom Auge.
Und alles war wieder wie sonst!
Sein Gegenüber saß vor ihm mit der undurchsichtigen Miene des wohlerzogenen jungen Mannes — das Eisenbahncoupé erschien fest und solid gebaut — und der nächtliche Himmel schwarz und düster wie vorher...
Aber so etwas war ja gar nicht möglich! Das konnte ja einfach nicht möglich sein! Solche Brillengläser gab es ja gar nicht!
Und abermals setzte er sie auf.
Und nun sah er noch etwas, was seinen Gedanken mit einem Male eine andere Richtung gab.
Er hatte seinen Blick nach dem Coupéfenster gewandt, das ihm zunächst lag und geschlossen war.
Die Fensterscheibe wirkte mit dem dunklen Himmel draußen als Hintergrund wie ein Spiegel.
Und nun sah er sich selbst — durch die Gläser der Erkenntnis!
Das war er?
Dieses Antlitz mit den schattenhaften Zügen? Diese seltsamen, wie aus einer anderen Welt hereinblickenden Augen? Ihre Pupillen, ja die ganze Iris erschien hell, gleichsam wie von innen erleuchtet, und es war ihm, als ob er durch diese Pforten ins Innere seines Selbst schaute!
Gewiß ging das alles viel wunderbarer zu, als er es in diesen Sekunden namenloser Überraschung und Ergriffenheit sich erklären konnte. Aber ihm war doch, als blicke er in sein innerstes Ich, in seiner Seele Seele!
Und er sah — oder die geheimnisvollen Schwingungen der Moleküle in den Zellen seiner Großhirnrinde wurden durch die Gläser der Brille als Lichteindrücke sichtbar —, wie der kunstvolle Mechanismus seiner Nerven nur noch mit Benutzung der letzten Reserven arbeitete —, sah trillionenfach vergrößert das Spiel der Gehirnzellen wie einen unbeschreiblich wunderbaren Mikrokosmos vor sich, — er sah den verheerenden Abbau in den Lecithinvorräten seiner Nervenzentren, gleich einem Miniaturpalast lebendiger Kristalle, den eine hereinbrechende Flut umtost...
Das Ende sah er — das frühe Ende!
Ein Schauer rann ihm durch die Glieder — ein überwältigendes Gefühl erfaßte ihn, als er so seinem Schicksal ins unverhüllte Antlitz schaute. Er hatte die Brille wieder abgesetzt. Was waren das für entsetzliche Gläser? Wer war der rätselhafte Alte, der sie trug?
Wer war der furchtbare Nachbar zu seiner Rechten? An ihm selbst wollte er die alles enthüllende Wirkung seiner Brille doch zuletzt noch probieren!
Schnell wandte er sich nach ihm um und wollte die Brille vor die Augen heben — —
Da sah er die wunderbar leuchtenden Augen des geheimnisvollen Fahrgastes gerade auf sich gerichtet — mit einem Blick, der ihn wie ein Speer durchdrang.
Überrascht und verlegen übergab er ihm die Brille.
»Entschuldigen Sie, mein Herr. Ich glaubte, Sie schliefen, und fürchtete, die Brille würde Ihrer Hand entgleiten.«
Wortlos, mit einem langsamen Neigen des gewaltigen Hauptes nahm der Fremde sein Eigentum zurück und erhob sich, um das Coupé zu verlassen; denn eben pfiff der Zug.

Auch der junge Kaufmann stand auf, um nach ihm auszusteigen. Ob der Fremde ihn nicht hinter sich bemerkte, oder ob ihn die Eile trieb, er warf die Coupétür heftig hinter sich zu.
Sie traf die rechte Hand des jungen Kaufmanns mit voller Wucht!
Mit einem furchtbaren Aufschrei stürzte der Verletzte aus dem Wagen. Und von diesem Aufschrei erwachte Tramm.
Er sah die hellen Lichter der Station. Verwundert schaute er sich um und — fand sich allein in seinem Coupé.
Hatte er das alles nur geträumt?
Die seltsame Begegnung mit dem geheimnisvollen Nachbar? Die rätselhaften Enthüllungen durch die Gläser seiner Wunderbrille?
Das alles ein Traum?! Aber so logisch und bedeutungsvoll träumt man doch nicht!
Wer war der Fremde, der mehr sah als andere Menschen?
Und wenn er an die erschreckenden Dinge dachte, die ihm die wunderbaren Brillengläser enthüllt hatten?
Sein Gegenüber kam ihm in den Sinn und der schwarze Plan, dessen Entstehen ihm die seltsame Brille gezeigt...
War es am Ende n i c h t ein unglücklicher Zufall, der jenem die Rechte zerschmetterte? Hatte der rätselhafte Alte ihn auch mit seinen Wundergläsern durchschaut und ihm absichtlich die Hand gelähmt, ehe sie ihre verbrecherische Tat vollbringen konnte?
Wie ein flammendes Licht fiel es auf einmal in seine Seele! Nein — nein! das konnte nicht bloß Traum und Phantasie sein! Für i h n wenigstens nicht! Für ihn war der Blick durch die Gläser der Erkenntnis eine rettende Wahrheit geworden, eine letzte, bittere Notwendigkeit gewesen!
Schnell raffte er sich auf und stieg aus. Eben begann sich der Zug wieder in Bewegung zu setzen.
Er stand allein auf dem Perron des kleinen Vororts. Noch war seine Seele voll des Erlebten. Eine wunderbare Fügung hatte ihm das heutige Erlebnis gesandt. Eine starke Hand hatte einmal in sein Leben hineingegriffen. Er fühlte es, daß er der Wahrheit selbst in das ernste, strenge Antlitz geblickt hatte — und s e i n e S e e l e w a r g e n e s e n !
Ein anderer wollte er werden von dieser Stunde an. Die ihm noch geschenkte Zeit wollte er besser auskaufen — für sich und die Seinen. Nicht mehr in allerlei zerstreuenden, aufreibenden Beschäftigungen seine Tage verschleudern, seine Kräfte zersplittern! Seiner S e e l e wollte er leben von nun an und ihrer Sehnsucht.
Er breitete die Arme aus —, hinein in das nächtliche Dunkel — als umfasse er eine Hohe, Unsichtbare, und wie ein inbrünstiges Gebet rangen sich die Worte aus den Tiefen seiner Seele und fanden sich auf seinen Lippen:
Noch einmal nimm mich auf in deine Arme,
Eh' sie mich in die dunkle Tiefe betten,
Du, Göttin Leben, Schöpferin! Erbarme
Dich deines Kindes! Gib ihm Zeit zu retten,
Was seine Seele schaffend birgt im Schoße;
Noch einmal schüttle gnädig ihm die Lose!
Noch einmal laß mich ganz dich fassen, Leben;
Um meine Seele breite deine Schwingen,
Noch einmal laß mich Sonnenschein umgeben,
Im falben Laub noch süße Frucht zu bringen;
Noch einmal — eh' es nachtet mir auf Erden —
Laß Morgen es und gold'nen Frühling werden!
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.