
RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover
Based on an image created with Microsoft Bing software
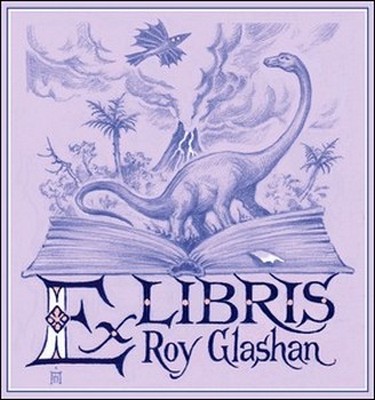
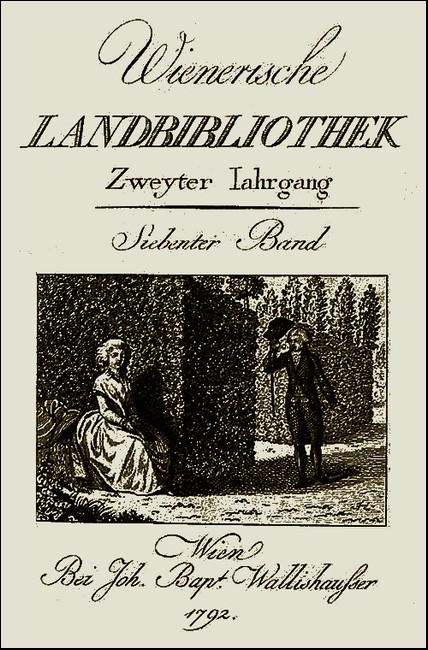
Impressum des Verlegers
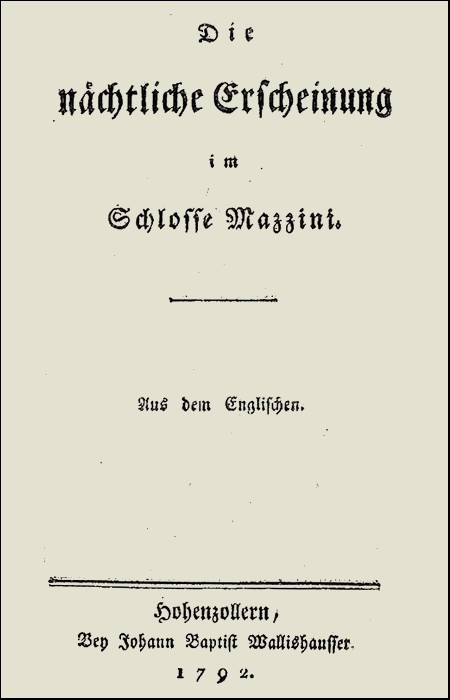
Titelblatt der Erstaugabe
Das Original dieses Romans, den ich in der Hoffnung übersetze, den Lesern, die gern in den Gefilden der Einbildungskraft schwärmen, keine ununterhaltende Lectüre in die Hände zu geben, erschien Ostern 1790 unter dem Titel: A Sicilian Romance, in zwey Bändchen in London. Ich gestehe, daß ich diesen Titel, alles Kopfbrechens ungeachtet, auf keine Weise wohllautend zu verdeutschen wußte, und habe mir daher die Freyheit erlaubt, ihn mit einem andern, der meinem Bedünken nach, die Geschichte individueller bezeichnet, zu vertauschen. Indessen glaubte ich zu einer Anzeige dieser unschuldigen Veränderung verbunden zu seyn, damit nicht etwa unter zweyerley deutschen Gestalten einerley Werk erschiene, wenn vielleicht der Zufall einen andern Übersetzer auf das Original aufmerksam machte, ohne daß er das Daseyn einer frühern Verdeutschung unter verändertem Titel vermuthete.
Frontispiz der Erstausgabe

"Halt, Niederträchtiger! Erst emp-
fange den Lohn deiner Verätherei!"

Illustration aus der Ausgabe von 1798.
An der nördlichen Küste von Sicilien ragen noch die prächtigen Ruinen eines Schlosses hervor, das einst dem edlen Hause der Mazzini gehörte. Es steht an einem kleinen Meerbusen auf einer Anhöhe, die von einer Seite in die See hinab gleitet, und von der andern zu einem Berge anschwillt, den dunkle Waldungen krönen. Die Lage ist bewundernswürdig schön und mahlerisch; die majestätische Größe dieser Überreste der Vorzeit, die feyerliche Stille, welche über der ganzen Gegend schwebt, erfüllen den Wanderer mit Schauder und Ahndung. Ich besuchte diesen Ort auf meiner Reise durch Italien; ich erklimmte einen Steinhaufen, und überschaute den unermeßlichen Umfang des Gebäudes und die erhabene Pracht der Ruinen. Meine Fantasie versetzte mich in die Zeiten zurück, da diese Mauern stolz in ihrer ursprünglichen Hoheit prangten, wo die Säle Scenen der Gastfreyheit und festlicher Pracht waren, und von den Stimmen derer ertönten, welche längst der Tod von der Erde abgestreift hat. »Eben so,« rief ich aus, »wird die gegenwärtige Generation, wird er, der jetzt im Elende erliegt, und er, der im Taumel der Vergnügungen fortschwimmt, dahin gehen, und in Vergessenheit sinken!« Mein Herz schwoll in mir bey dem Gedanken; ich wendete mit einem Seufzer mich ab, und entdeckte einen Mönch, dessen ehrwürdige Gestalt, sanft zur Erde geneigt, keinen uninteressanten Gegenstand in der Gruppe bildete. Sein Blick traf den meinigen, er sah meine Bewegung, schüttelte den Kopf, und zeigte auf die Ruinen.
»Diese Mauern,« sagte er, »waren einst der Sitz der Üppigkeit und des Lasters. Sie zeugten von einem wunderbaren Beyspiele der reichenden Wiedervergeltung des Himmels, und wurden von dem Augenblicke an verlassen, und dein Untergange überliefert.«
Seine Worte erregten meine Neugierde, und ich forschte nach ihrem Sinne.
»Eure schauerliche Geschichte ist von diesem Schlosse zu erzählen, aber für jetzt ist sie zu lang und zu verwickelt. Einer unsrer Ordensbrüder, ein Abkömmling aus dem edlen Hause Mazzini, zeichnete sie auf, und hinterließ die Urschrift unserm Kloster als Vermächtniß.«
Ich wünschte sie zu sehen, und der gute Mönch führte mich in sein Kloster. Er stellte mich dem Prior vor, der Gefallen an mir fand, und auf mein Bitten mir erlaubte, Auszüge aus jener Urschrift zu machen, die ich hier in veränderter Gestalt dem Leser vorlege.
Gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts bewohnte Ferdinand, fünfter Marquis von Mazzini, dieses Schloß, welches seit mehrern Generationen seine Vorväter zu ihrem Hauptsitze gewählt hatten. Es war ein Mann von wollüstigem, herrschsüchtigen Charakter. In früher Jugend vermählte er sich mit Louise Bernini, der zweyten Tochter des Grafen della Salario, einer Frau, die sich mehr noch durch Sanftheit und gefällige Sitten, als durch ihre hohe Schönheit auszeichnete. Sie gebar ihm einen Sohn und zwey Töchter, die in früher Kindheit ihre liebenswürdige Mutter verloren. Viele glaubten, daß die rauhe unfreundliche Behandlung des Marquis ihre Tage verkürzt hätte. Nicht lange nach ihrem Tode knüpfte er eine zweyte Verbindung mit Maria de Vellorno, einem jungen Fräulein, welches die fesselndsten Reize der Gestalt, aber nicht ihrer Vorgängerinn Seele besaß. Sie war schlau, verstellt, dem Vergnügen ergeben. von hoch strebendem unbiegsamem Geiste. Ihr Leichtsinn, ihre Sucht nach Vergnügungen ließ ihr nicht zu, sich um des Marquis häusliche Angelegenheiten zu bekümmern, und da sein Herz für väterliche Zärtlichkeit taub war, so vertraute er die Erziehung seiner Töchter einer Anverwandten der verstorbnen Marquise an; auch hätte er sie in keine beßere Hände geben können.
Bald nach seiner zweyten Vermählung vertauschte er das einsame Mazzini mit den glänzenden, fröhlichen Scenen von Neapel, wohin sein Sohn ihn begleitete. Seiner von Natur stolzen, gebietherischen Gemüthsart ungeachtet stand er jetzt ganz unter der Herrschaft eines Weibes. Er hatte heftige Leidenschaften, und die Marquise verstand die Kunst, sie nach ihren Absichten zu lenken, und wußte ihre Gewalt so schlau zu verbergen, daß er am unumschränktesten zu regieren glaubte, wo er am meisten Sclave war. Er pflegte ein Mahl des Jahrs nach dem Schlosse Mazzini zu kommen, wohin die Marquise ihn selten begleitete, und wo er nur verweilte, um einige Befehle über die Erziehung seiner Töchter zu ertheilen, die mehr sein Stolz als Zärtlichkeit ihm eingab. Emilie, die älteste, war ganz das Bild ihrer Mutter: mit einem sanften, fein fühlenden Herzen vereinigte sie einen hellen Verstand. Ihre jüngere Schwester Julie war weit lebhafter. Eine äußerst reizbare Empfindlichkeit trübte oft ihre Laune; sie war auffahrend, aber großmüthig; ein Verweis lockte ihr Thränen ab, nie aber machte er sie mürrisch. Sie besaß eine feurige Einbildungskraft, und zeigte früh Spuren von Genie. Madame de Menon ließ es sich eifrigst angelegen seyn, den Charakteranlagen ihrer jungen Zöglinge entgegen zu arbeiten, welche einst ihrer Ruhe gefährlich werden konnten, und niemand war wohl fähiger zu einem solchen Geschäfte. Eine Kette früher Leiden hatte ihr Herz weich gemacht, ohne die Kräfte ihres Geistes zu schwächen. Einsamkeit hatte ihr einen Theil ihrer verlornen Ruhe wieder gegeben, und ein scharfes Gefühl des Kummers zu sanfter Schwermuth gemildert. Sie liebte ihre jungen Pflegetöchter mit mütterlicher Zärtlichkeit, und fand in ihrer stufenweisen Vervollkommnung in ihrer ehrerbiethigen Liebe allen Ersatz für ihre aufopfernde Sorgfalt. Sie war Meisterinn in der Musik und im Zeichnen. Oft, wenn ihre Seele zu gepreßt war, als daß sie aus Büchern Trost schöpfen konnte, wiegten diese holden Trösterinnen des Lebens ihren Kummer ein, und sie unterließ nicht, auch ihren jungen Schülerinnen Talente mitzutheilen, deren wohlthätigen Einfluß sie so oft an sich selbst empfunden hatte. Emilie fand vorzüglich Geschmack am Zeichnen, und brachte es bald sehr weit darin. Julie war in seltnem Grade empfänglich für den Zauber der Harmonie; ihre Gefühle tönten im süßen Einklange mit den Saiten des Instruments.
Sie faßte Madame's Unterricht mit bewundernswürdiger Leichtigkeit, und brachte es bald zu einer Höhe, die Frauenzimmer selten erreichen. Sie hatte ihre ganz eigne Manie. Ihre Stärke bestand nicht so wohl in schneller Fertigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, in künstlichen Sprüngen und Läufen, als vielmehr in einer Feinheit des Geschmacks und einem bezaubernden Ausdrucke, der jedem Ton eine Seele einzuhauchen scheint, und unwiderstehlich das Herz des Zuhörers fesselt. Die Laute war ihr Lieblingsinstrument; die zärtlichen Töne derselben harmonirten mit der süßen schmelzenden Melodie ihrer Stimme.
Das Schloß Mazzini war ein großes unregelmäßiges Gebäude, und schien für ein so zahlreiches Gefolge erbaut zu seyn, als die Sitte der damahligen Zeit in Krieg und Frieden um den Adel versammelte. Die gegenwärtige Familie füllt nur einen kleinen Theil desselben aus, und auch diesem gaben die weitläuftigen, geräumigen Zimmer, die langen einsamen Gänge, die zu denselben führten, ein verlassenes, verödetes Ansehen. Melancholische Stille thronte in den gewölbten Hallen, und oft unterbrach ganze Stunden lang kein Fußtritt das tiefe Schweigen in den Vorhöfen, die von hohen Thürmen beschattet wurden. Julie, die früh schon Geschmack am Lesen fand, mochte sich gern Nachmittags in ein kleines Cabinett zurück ziehen, wo sie ihre Lieblingsschriftsteller um sich liegen hatte. Dieses Zimmer bildete den westlichen Winkel des Schlosses; eines der Fenster stieß auf die See, über welche hinaus das Auge dämmernd die schwarze, felsige Küste von Calabrien erblickte, welche den Horizont begrenzte; aus dem andern Fenster, das in den Schloßhof ging, hatte man eine Aussicht auf die umliegenden Wälder. Juliens Instrument, und alles, was ihren Lieblingszeitvertreib ausmachte, war hier um sie versammelt. Manche kleine Verzierungen, die sie selbst erfand, und einige Zeichnungen von ihrer Schwester verschönerten dieses reizende Gemach. Ihr Schlafzimmer stieß daran, und war nur durch einen kurzen Gang von Madame's Zimmern abgesondert. Die kleine Gallerie führte durch einen andern langen, sich krümmenden Gang zu der großen Treppe, die zur so genannten nördlichen Halle herab lief, an welche die Hauptzimmer von der Nordseite des Gebäudes stießen.
Madame de Menons Zimmer gingen in beyde Gallerien. In dem größten brachte sie gewöhnlich ihre Vormittage mit der Ausbildung ihrer jungen Zöglinge zu. Die Fenster stießen auf die See, und das Zimmer war hell und angenehm. Des Mittags speisten sie in einem der untern Säle und hatten bey Tisch einen Mann zur Gesellschaft, den der Marquis seit vielen Jahren im Schlosse unterhielt, und der die jungen Fräulein im Lateinischen und in der Geographie unterrichtete. Sein Nahme war Vincent. In den schönen Sommerabenden hielt diese kleine Gesellschaft oftmahls ihre Abendmahlzeiten in einem Pavillon, der auf einen Hügel in dem Gehölz, das zum Schlosse gehörte, gebaut war. Von diesem Flecke hatte das Auge eine beynahe grenzenlose Aussicht über See und Land. Man überschaute die Meerenge von Messina, die gegen über liegenden Ufer von Calabrien, und eine große Fläche der wilden, mahlerischen Gegenden von Sicilien. Der Berg Ätna, mit ewigem Schnee bedeckt, und aus den Wolken hervor brechend, machte ein großes, erhabenes Gemählde im Hintergrunde der Scene. Auch die Stadt Palermo lag im Gesichte, und wenn Julie die schimmernden Thürme derselben anstarrte, mahlte ihre Einbildungskraft ihr die Schönheiten dieser Stadt, während sie insgeheim nach einem Anblicke der Welt seufzte, von welcher die widrige Eifersucht der Marquise, und ihre Furcht vor der verdunkelnden Schönheit ihrer Stieftochter sie bisher ausschloß. Sie wendete allen ihren Einfluß bey dem Marquis an, sie in der Einsamkeit des Schlosses zurück zu halten, und obgleich Emilie jetzt achtzehn und ihre Schwester sechzehn Jahre alt war, hatten sie noch nie die Grenzen von ihres Vaters Gebiethe überschritten. — Oft erzeugt Eitelkeit unnöthige Besorgnisse; allein hier hatte die Marquise gerechten Grund zu fürchten. Die Schönheit der beyden Schwestern hat wohl nie ihres Gleichen gehabt. Emiliens Gestalt war nach dem feinsten Ebenmaße gebaut; ihre Haut zart, ihr Haar blond und ihre dunkeln blauen Augen voll süßen Ausdrucks. Sie hatte einen gewissen Adel in ihrem ganzen Wesen, verbunden mit einer weiblichen Sanftheit, einer holden Schüchternheit, die unwiderstehlich die Herzen fesselte. Juliens Wuchs war schlank und geschmeidig, ihr Gang leicht und schwebend, ihre Physiognomie voll Seele, und ihr Lächeln bezaubernd. Ihre Züge standen in schönem Verhältnisse — jede lachende Grazie spielte um ihren Mund, und ihr Gesicht verrieth schnell alle Bewegungen ihrer Seele. Das dunkle, kastanienbraune Haar, das sich in üppiger Fülle um ihren Nacken lockte, vollendete den Reiz ihrer Gestalt. — So lieblich, und so in Dunkelheit verschleyert blühten die Töchter des edlen Hauses Mazzini. Allein sie waren glücklich; sie kannten noch nicht genug von der Welt, um ernstlich die Entbehrung ihres Genusses zu beklagen. Wenn auch Julie zu Zeiten nach dem Luftbilde seufzte, das die Fantasie ihr mahlte, und ein schmerzliches Sehnen nach dem bunten Schauplatze, von dem sie abgeschnitten war, in ihr aufstieg: so verscheuchte eine Zurückkehr zu ihren gewohnten Vergnügungen das idealische Bild aus ihrer Seele, und gab ihrem Herzen seine glückliche Selbstgenügsamkeit wieder. Bücher, Musik und Mahlen theilten ihre Mußestunden, und mancher schöner Abend schwand im Pavillon, wo Madame's verfeinerte Unterhaltung, Tasso's Gedichte, Juliens Laute und Emiliens Freundschaft eine Gattung von Glückseligkeit schufen, welche nur fein gebildete und hochempfängliche Seelen zu genießen und mitzutheilen fähig sind. Madame verstand und übte alle angenehmen Künste der Unterhaltung, und ihre jungen Freundinnen fühlten den Werth derselben, und suchten ihren Geist zu haschen.
Die Unterhaltung kann in zweyerley Classen getheilt werden, in vertrauliche und sentimentalische. Es ist das Gebieth der erstern, Freude und Zwanglosigkeit zu verbreiten, das Herz des Menschen gegen den Menschen zu öffnen, und einen milden Sonnenschein über die Seele zu strahlen. — Um uns für die Reize der andern, die ich hier sentimentalische Conversation nennen will, und worin Madame de Menon Meisterin war, empfänglich, und zu ihrer Ausübung fähig zu machen, müssen Natur und Kunst zusammen treffen. Ein hoher Grad von Geistescultur muß mit natürlich gutem Verstande, lebhaftem und feinem Gefühle verbunden seyn, und um sie unwiderstehlich anziehend zu machen, wird eine Kenntniß der Welt und eine bezaubernde Leichtigkeit des Tons erfordert, die man nur im öftern Umgange mit den verfeinerten Kreisen des höhern Lebens erlangt. Die sentimentalische Conversation bringt Gegenstände auf die Bahn, die Herz und Einbildungskraft fesseln; man verhandelt sie gleichsam scherzend mit Geist und Feuer, und verweilt nie so lange dabey, daß sie ermüden könnten. Oder mit andern Worten: Man schöpft ein wenig von der Oberfläche ab; denn in einem feinen Zirkel einen Gegenstand gründlich zu behandeln, wäre allerdings ein horribles Verbrechen gegen den Wohlstand. Anmerkung. ( der Übers. — D.Hrsg.) Hier blüht die Fantasie; das Gefühl ergießt sich, und Witz, von Delicatesse geleitet, und durch Geschmack verschönert, trifft zum Herzen.
So war Madame de Menons Unterhaltung, und die anmuthige Lage des Pavillons schien ihn ganz zur Scene geselligen Vergnügens bestimmt zu haben. Am Abende eines sehr schwülen Tages, da sie in ihrem Lieblingsaufenthalte gespeist hatten, reizte die Kühle und Schönheit der Nacht die glückliche Gesellschaft, länger, als gewöhnlich, darin zu bleiben. Als sie nach dem Hause zurück gingen, überraschte sie der Schimmer eines Lichts durch die zerbrochenen Fensterladen eines Zimmers in einem Flügel des Schlosses, der seit vielen Jahren verschlossen war. Sie standen stille, um es zu beobachten; es verschwand plötzlich, und ließ sieh nicht wieder sehen. Madame de Menon, über diese Erscheinung beunruhigt, eilte ins Schloß, um nach der Ursache zu forschen, als ihr im nördlichen Vorplatze Vincent begegnete. Sie erzählte ihm, was sie gesehen hatte, und befahl, daß man unverzüglich nach den Schlüsseln zu diesen Zimmern suchte. Sie fürchtete, daß jemand, in der Absicht zu rauben, in diesen Theil des Gebäudes gedrungen wäre. Sie kannte keine kleingeisterische Furcht, wo ihre Pflicht im Spiele war, und rief sogleich die Bedienten herbey, um sie dahin zu begleiten. Vincent lächelte über ihre Besorgnisse, und schrieb das, was sie gesehen hatte, einer Täuschung zu, welche die Feyerlichkeit der Stunde ihrer Fantasie gespielt hätte. Madame beharrte aber dessen allen ungeachtet auf ihrem Entschlusse, und nach mehrmahligem langen Suchen brachte man einen schweren, verrosteten Schlüssel herbey. Sie ging nun mit Vincent, und von den Bedienten begleitet, die voll ungeduldiger Verwunderung waren, nachdem südlichen Flügel des Gebäudes. Der Schlüssel wurde an ein eisernes Thor gebracht, das in einen Vorhof ging, der diesen Flügel von den andern Theilen des Schlosses absonderte. Sie gingen in den Hof, der mit Graf und Strauchwerk bewachsen war, und stiegen einige Stufen hinauf, zu einer großen Thüre, die sie sich vergebens zu öffnen bemühten. Alle Schlüssel aus dem ganzen Schlosse wurden umsonst versucht, und sie mußten endlich fortgehen, ohne ihre Neugier befriedigt, und ihre Furcht gestillt zu haben. Alles blieb indessen stille, und das Licht erschien nicht wieder. Madame verhehlte ihre Besorgnisse, und die Familie legte sich zur Ruhe.
Dieser Vorfall blieb bey Madame de Menon haften, und lange Zeit verstrich, ehe sie wieder einen Abend in dem Pavillon zuzubringen wagte. Einige Monden verflossen, ohne daß sie etwas sahen oder entdeckten, bis eine neue Erscheinung ihre Furcht wieder erweckte. Julie war eines Abends länger als gewöhnlich in ihrem Cabinette geblieben; ein Lieblingsbuch hatte ihre Aufmerksamkeit weit über die gewöhnliche Stunde der Ruhe hinaus gefesselt, und jeder Bewohner des Schlosses, sie allein ausgenommen, lag lange in Schlummer begraben. Die Schloßuhr, die eins schlug, weckte sie plötzlich aus ihrer Vergessenheit. Erschrocken, daß es so spät war, stand sie eilends auf, und wollte in ihr Schlafzimmer gehen, als die schöne Nacht sie ans Fenster lockte. Sie öffnete es, und lehnte sich heraus, um die schöne Wirkung des Mondlichts auf den dunkeln Wäldern zu betrachten. Nicht lange hatte sie so gelegen, als sie einen schwachen Schimmer durch einen Fensterrahmen in jenem unbewohnten Theile des Schlosses wahrnahm. Ein plötzlicher Schrecken ergriff sie, und kaum konnte sie sich aufrecht halten. Das Licht verschwand nach wenig Augenblicken, und bald darauf kam eine Gestalt mit einer Laterne aus einer verborgnen Thür des südlichen Thurms hervor, schlich sich außen längs den Schloßmauern hin, und drehte sich um den südlichen Winkel, der sie vor Juliens Blick verbarg. Erstaunt und voll Schrecken lief sie in Madame de Menons Zimmer, und erzählte ihr, was sie gesehen hatte. Man weckte sogleich die Bedienten, und das ganze Haus gerieth in Aufruhr. Madame ging in die nördliche Halle, wo die Bedienten bereits versammelt waren. Keiner hatte Muth genug, in den Vorhof zu gehen, und Madamen's Befehle wurden nicht geachtet, da der Eindruck abergläubigen Schreckens ihnen entgegen stand. Sie sah, daß Vincent fehlte, und wollte ihn eben rufen lassen, als er in die Halle trat. Voll Verwunderung, die ganze Familie versammelt zu finden, fragte er nach der Ursache. Er befahl sogleich einem Theile der Bedienten, ihn rings um die Schloßmauern zu begleiten, und mit einigem Widerstreben und mehr Furcht noch gehorchten sie ihm. Sie kamen alle zurück, ohne etwas gesehen zu haben; allein obgleich ihre Furcht nicht bestätigt war, war sie doch auf keine Weise zerstreut. Die Erscheinung eines Lichtes in einem Flügel des Schlosses, der seit vielen Jahren verschlossen war, und dem Zeit und Umstände ein Ansehen besonderer Verödung gegeben hatten, mußte in hohem Masse Verwunderung und Schrecken erregen. Der gemeine Mann empfängt begierig jeden Eindruck des Wunderbaren, und die Bedienten standen nicht an zu glauben, daß eine übernatürliche Macht im südlichen Flügel des Schlosses wohnte. Zu unruhig um schlafen zu können, beschlossen sie, das Übrige der Nacht zu durchwachen. Zu diesem Zwecke begaben sie sich in die östliche Gallerie, wo sie eine Aussicht auf den südlichen Thurm hatten, aus welchem das Licht hervor gegangen war. Die Nacht verstrich ohne weitere Störung, und die Morgendämmerung, die sie mit unaussprechlichem Vergnügen anbrechen sahen, zerstreute auf eine Weile ihre ängstlichen Besorgnisse. Die Zurückkehr des Abends aber erneute sie wieder, und mehrere Nächte bewachten die Bedienten den südlichen Thurm. Obgleich nichts sich sehen ließ, entstand dennoch das Gerücht und fand Glauben, daß es im südlichen Flügel des Schlosses spukte. Madame de Menon war zwar über den kleingeisterischen Wahn des Aberglaubens erhaben, wußte aber nicht, was sie aus der Erscheinung machen sollte, und beschloß, wenn das Licht sich je wieder sehen ließe, dem Marquis Nachricht davon zu geben, und die Schlüssel zu den Zimmern zu fordern.
Der Marquis, in den Vergnügungen von Neapel versunken, dachte selten an das Schloß und seine Bewohner. Sein Sohn, der unter seiner unmittelbaren Aufsicht erzogen wurde, war der einzige Gegenstand seines Stolzes, so wie die Marquise der alleinige Gegenstand seiner Liebe war. Er hing mit romantischer Zärtlichkeit an ihr, die sie mit anscheinendem Gegengefühle und geheimer Untreue vergalt. Sie erlaubte sich freyen Genuß der ausschweifendsten Vergnügungen, beobachtete aber eine so schlaue Vorsicht, daß sie aller Entdeckung, ja sogar dem Verdachte selbst auswich. Sie war in ihren Liebschaften eben so unbeständig als feurig, bis der junge Graf Hippolytus de Vereza ihre Aufmerksamkeit fesselte. Ihre natürliche Unbeständigkeit schien bey ihm zu verschwinden, und alle Wünsche ihres Herzens concentrirten sich auf ihn allein.
Der Graf von Vereza hatte in früher Kindheit seinen Vater verloren. Er war jetzt mündig, und hatte eben den Besitz seiner Güter angetreten. Seine Person war angenehm und männlich zugleich, sein Verstand aufgeklärt, seine Sitten fein und gefällig. Sein Gesicht drückte eine glückliche Mischung von Muth, Adel und Wohlwollen aus, welches die Hauptzüge seines Charakters waren. Ein edleres Gefühl lehrte ihn die wollüstigen Laster der Neapolitaner verachten, und nach höheren Zwecken streben. Er war der ausgewählte und frühe Freund des jungen Ferdinands, und kam fast täglich in des Marquis Haus. Die Marquise behandelte ihn vom ersten Augenblicke an mit auffallender Auszeichnung, und machte ihm endlich Avancen, die weder die Ehre noch Neigung des jungen Grafen ihm zu bemerken erlaubte. Er betrug sich gegen sie mit eiskalter Höflichkeit, welche die Leidenschaft, die sie ertödten sollte, nur noch mehr entflammte. Bis auf diesem Augenblick hatte man gierig um die Gunst der Marquise gebuhlt, mit Entzücken sie empfangen, und die zurück stoßende Kälte, die sie jetzt fand, rief allen ihren Stolz auf, und setzte jede Kunst der Koketterie in Bewegung.
Gerade um diese Zeit fiel Vincent in eine Krankheit, die so schnell zunahm, daß sie in kurzer Zeit mit äußerster Gefahr drohte. An seinem Leben verzweifelnd, verlangte er, daß man sogleich einen Bothen an den Marquis schickte, um ihn von seinem Zustande zu benachrichtigen, und schien inständigst zu wünschen, ihn, ehe er stürbe, zu sehen. Der Fortschritt seiner Krankheit both jeder Kunst der Arzeney Trotz, und seine sichtliche Seelenangst schien sein Schicksal zu beschleunigen. Als er fühlte, daß seine Stunde heran nahte, verlangte er einen Beichtvater. Man hohlte einen Mönch aus einem benachbarten Kloster, der lange Zeit bey ihm eingeschlossen blieb, und schon hatte er die letzte Öhlung empfangen, als Madame de Menon an sein Bett gerufen wurde. Die Hand des Todes lag bereits auf ihm; kalter Schweiß stand auf seiner Stirne, und mühsam schlug er seine schweren Augen nach ihr auf. Er winkte ihr, näher zu treten, bath sie, niemand ins Zimmer zu lassen, und schwieg einige Augenblicke. Seine Seele schien unter einer quälenden Erinnerung zu arbeiten; er versuchte zu verschiedenen Mahlen zu sprechen; aber es gebrach ihm an Entschlossenheit oder Kraft. Endlich haftete er einen Blick unaussprechlicher Angst auf sie.
»Ach Madame!« sprach er, »der Himmel gewährt die Bitte eines so Elenden nicht! Ich muß sterben lange bevor der Marquis ankommen kann. Da ich ihn nicht mehr sehen werde, wünschte ich Ihnen ein Geheimniß zu offenbaren, das schwer auf meinem Herzen liegt, und meine letzten Augenblicke eben so furchtbar macht, als Sie ohne Hoffnung sind.«
»Beruhigen sie sich,« unterbrach ihn Madame, die sein feyerlicher Ton bis ins Innerste bewegte; »beruhigen Sie sich: man hat uns glauben gelehrt, daß Vergebung nie aufrichtiger Reue verweigert wird.«
»O Madame! Sie kennen mein ungeheures Verbrechen noch nicht, wissen nicht das schreckliche Geheimniß, das auf meiner Brust liegt. Meine Schuld ist in dieser Welt ohne Hülfe, und ich fürchte, sie wird in der zukünftigen ohne Vergebung bleiben. Doch ist es noch in meiner Macht, etwas Gutes zu thun; lassen Sie mich denn Ihnen das Geheimniß offenbaren, das so wunderbar mit den Erscheinungen im südlichen Theile des Schlosses« —
»Wie?« unterbrach ihm Madame voll Ungeduld; »mit diesen nächtlichen Erscheinungen?« —
Vincent gab keine Antwort mehr; erschöpft von der Anstrengung des Redens, war er in Ohnmacht gesunken. Madame rief nach Hülfe, und durch wirksame Mittel kehrten seine Sinne zurück; seine Sprache aber war dahin, und eine Stunde nach dieser mystischen Unterredung verschied er. — Madame's Verwirrung und Erstaunen war durch diesen letzten Auftritt zu einem peinlichen Grade erhöht. Sie erinnerte sich an alle besondern Umstände, die sich auf den südlichen Flügel des Schlosses bezogen — die vielen Jahre, die er unbewohnt stand — das tiefe Schweigen, das man stets darüber beobachtete — die Erscheinung des Lichts und der Gestalt — das fruchtlose Suchen nach den Schlüsseln — das allgemein geglaubte Gerücht — und so stellte ihr Gedächtniß ihr eine Reihe von Umständen dar, die nur ihre Befremdung vermehrten, ihre Neugierde erhöhten. Ein geheimnißvoller Schleyer hüllte diesen Theil des Schlosses ein, und es schien jetzt unmöglich, ihn je zu durchdringen, da die einzige Person, die ihn wegziehen konnte, nicht mehr war. — Den Tag nach Vincents Tode langte der Marquis an. Er kam nur von wenigen Dienern begleitet, und stieg mit einem ungeduldigen Wesen und einem Gesichte, das starke Bewegung ausdrückte, vor dem Thore ab. Madame und die jungen Fräulein empfingen ihn in der Halle. Er grüßte eilends seine Töchter, ging in das angrenzende Zimmer, und bath Madame, ihm zu folgen. Sie gehorchte, und er fragte mit großer Unruhe nach Vincent. Als er seinen Tod vernahm, ging er mit hastigem Schritte im Zimmer auf und ab, schwieg eine Weile, setzte sich endlich, sah Madame mit durchforschenden Blicken an, und that einige Fragen über die nähern Umstände von Vincents Tode. Sie erwähnte sein ernstliches Verlangen, den Marquis zusehen, und wiederhohlte seine letzten Worte. Der Marquis wollte sie unterbrechen, schwieg aber sogleich wieder, und sie erzählte ihm nun weiter alle Umstände von dem südlichen Flügel des Schlosses und die nächtlichen Erscheinungen, die sie ihm zu entdecken für unumgänglich nothwendig hielt. Er behandelte die Sache sehr oben hin, lachte über ihre Folgerungen, stellte ihr die Erscheinungen, die sie beschrieb, als Täuschungen eines schwachen furchtsamen Kopfes vor, und brach das Gespräch ab, um in Vincents Zimmer zu gehen, worin er lange Zeit verweilte. — Den folgenden Tag aßen Emilie und Julie mit dem Marquis. Er war finster und schweigend; ihr Bestreben, ihn zu unterhalten, schien ihm nur mißfällig zu seyn, und so bald die Mahlzeit vorbey war, ging er in sein Zimmer, und ließ seine Töchter voll Verwunderung und Betrübniß zurück. — Vincent sollte nach seinem eignen Wunsche in der Kirche des St. Nicolas-Klosters begraben werden. Einer von den Bedienten, dem der Marquis einige nöthige Befehle wegen des Leichenbegängnisses ertheilte, wagte es, ihn von den Lichterscheinungen im südlichen Thurme zu benachrichtigen. Er erwähnte die abergläubigen Gerüchte, die im Hause umher gingen, und klagte, daß die Bedienten sich weigerten, nach Dunkelwerden über den Hof zu gehen.
»Und wer hat euch diese Geschichte aufgetragen?« sagte der Marquis in mißfälligem Tone: »müssen die kindischen, schwachen Grillen der Weiber und Bedienten mir vorgetragen werden? — Fort! laßt euch nicht wieder vor mir sehen, bis ihr von Dingen zu sprechen gelernt habt; die mir zu hören geziemen.«
Robert zog sich beschämt zurück, und niemand wagte seit dem, der Sache gegen den Marquis wieder zu erwähnen.
Die Volljährigkeit des jungen Ferdinands nahte nunmehr heran, und der Marquis beschloß, diesen Zeitpunct mit festlicher Pracht auf dem Schlosse Mazzini zu feyern. Er rief die Marquise, und seinen Sohn von Neapel herbey, und ließ prächtige Zurüstungen veranstalten. Emilie und Julie fürchteten die Ankunft der Marquise, deren Einfluß sie lange gefühlt hatten, und von deren Gegenwart sie einen peinlichen Zwang voraus ahndeten. Unter der sanften Führung der Madame de Menon waren ihre Stunden in glücklicher Ruhe hingeschwunden; sie kannten eben so wenig die Freuden, als das Ungemach der Welt. Dieses beugte sie nicht nieder, und jene entflammten sie nicht. Mit Streben nach Kenntnissen und mit der Erwerbung verschönernder Talente beschäftigt, flohen ihre Augenblicke leicht dahin, und nur die Fortschritte ihrer Vervollkommnung bezeichneten den Flug der Zeit. Madame vereinigte die Zärtlichkeit einer Mutter mit der Theilnahme einer Freundinn, und sie hingen mit warmer, unverbrüchlicher Liebe an ihr. — Der nahe Besuch ihres Bruders, den sie seit vielen Jahren nicht gesehen hatten, erfüllte sie mit Freude. Zwar erinnerten sie sich seiner nicht deutlich; allein sie dachten sich ihn mit warmer, entzückender Erwartung, voll Tugend und Talente, und hofften in seiner Gesellschaft einen Trost für das Mißvergnügen zu finden, das die Gegenwart der Marquise ihnen verursachen würde. Auch sah Julie die heran nahenden Festlichkeiten auf keine Weise mit gleichgültigen Augen an. Eine neue Scene eröffnete sich ihr, die ihre jugendliche Einbildungskraft mit den wärmstem glühendsten Farben der Freude ausmahlte. Die wirkliche Annäherung des Vergnügens erweckt oft das Herz zu Empfindungen, die eine entfernte und abgezogene Betrachtung nie hervor bringen würde. Julie, die aus der Ferne ruhig auf die bunten, schimmernden Scenen des Lebens hingeblickt hatte, durchseufzte jetzt in ungeduldiger Erwartung die Augenblicke, die noch zwischen dem Genusse standen. Emilie, deren Gefühl weniger lebhaft, deren Einbildungskraft weniger stark war, sah das nahe Fest mit ruhiger Betrachtung kommen, und beklagte beynahe die stillen Freuden unterbrochen zu sehen, die ihrem Geiste und Herzen angemeßner waren. — Nach Verlauf von wenig Tagen langte die Marquise auf dem Schlosse an. Ein großer Zug folgte ihr, und Ferdinand mit verschiedenen vom italienischen Adel, die das Vergnügen an ihr Gefolge haftete, begleitete sie. Der Schall der Musik verkündigte ihren Einzug, und die Thore, die lange an ihren rostigen Angeln hingen, wurden aufgerissen, sie zu empfangen. Die Vorhöfe und Hallen, die noch vor kurzem Dunkelheit und Verödung verkündigten, erschienen jetzt mit plötzlichem Glanze, und hallten die Töne der Fröhlichkeit und Freude wieder. Julie sah aus einem verborgenen Fenster die Scene an, und als der Schall des Triumphs durch die Lüfte bebte, klopfte ihr Herz vor Freude, und ihre Furcht vor der Marquise verlor sich in einer Art von wildem Entzücken, das ihr bisher unbekannt gewesen war. In der That schien die Ankunft der Marquise das Signal zu allgemeinem, unbegrenztem Vergnügen zu seyn. Als der Marquis heraus kam, sie zu empfangen, schmolz die Finsterniß, die bisher auf seinem Gesichte hing, in gefälliges Lächeln, welches die ganze Gesellschaft als Einladung zur Freude zu betrachten schien. — Emiliens ruhiges Herz konnte gegen einen so einladenden Auftritt nicht Stand halten; sie seufzte, bey dem Anblicke, ohne selbst zu wissen warum. Julie zeigte ihrer Schwester die einnehmende Gestalt eines jungen Mannes, der der Marquise folgte, und äußerte den Wunsch, daß dieß ihr Bruder seyn möchte. Man rief sie von ihrem fernern Anschauen ab zur Marquise. Julie zitterte vor Furcht, und wünschte auf einige Augenblicke das Schloß in seinen alten Zustand zurück. Sowie sie durch den Saal gingen, in welchem sie der Marquise vorgestellt werden sollten, überzog eine hohe Röthe Juliens Wangen; Emilie aber, obgleich eben so furchtsam, behielt ihre ungezwungene Würde bey. Die Marquise empfing sie mit einem Lächeln, worin Herablassung und Höflichkeit gemischt waren, und ihre Eleganz und Schönheit zog sogleich die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft auf sich. Juliens forschende Augen suchten vergebens ihren Bruder zu entdecken, dessen dunkel ihr vorschwebendes Bild sie in keinem der Gegenwärtigen fand. Endlich führte ihr Vater ihn zu ihr; und mit einem Seufzer sah sie, daß er nicht der Jüngling war, den sie vom Fenster bemerkt hatte. Er nahete sich ihr mit einem sehr einnehmenden Wesen, und sie sagte ihm ein unerkünsteltes Willkommen. Seine Figur war schlank und majestätisch; er hatte einen edlen, muthvollen Anstand, und sein Gesicht drückte Milde und Hoheit zugleich aus. Das Abendessen wurde im östlichen Saale aufgetragen, und die Tische waren verschwenderisch mit Leckereyen besetzt. Eine Bande Musikanten spielten während der Mahlzeit, und ein Concert schloß den Abend.
Der von Julien so lange und ungeduldig ersehnte Tag des Festes brach endlich an. Der ganze Adel aus der Nachbarschaft war dazu eingeladen, und die Thore des Schlosses wurden zu einem allgemeinen Freudenfeste geöffnet. Ein prächtiges Gastmahl, das aus den leckersten und kostbarsten Gerichten bestand, wurde in den Sälen aufgetragen. Sanfte Musik flötete längs den gewölbten Decken; die Wände waren mit Verzierungen behangen, und die Hand eines Magikers schien dieses vormahls düstere Gebäude plötzlich in einen Feenpallast umgewandelt zu haben. Nur der Marquis saß oft mit abwesender Seele mitten unter allem Genuß, und die Beklemmung seines Herzens war mit sichtlichen Zügen auf sein Gesicht geprägt. — Gegen Abend war großer Ball. Die Marquise, die sich noch immer durch Schönheit und durch einnehmendes Betragen auszeichnete, erschien in glänzendem Putze. Ihr Haar war reich mit Juwelen geschmückt, aber so geordnet, daß es ihrer ganzen Gestalt ein wollüstiges Ansehen gab. So bewußt sie sich auch ihrer Reize war, sah sie doch mit neidischem Auge Emiliens und Juliens Schönheit, und mußte heimlich eingestehen, daß die einfache Eleganz ihres Anzugs bezaubernder war, als alle studierte Kunst eines glänzenden Putzes. Sie waren beyde gleich in leichte sicilianische Tracht gekleidet, und nur einige Perlenschnuren hielten die üppige Fülle ihres fliegenden Haares zurück. — Ferdinand und Donna Mathilda Constanza eröffneten den Ball. Emilie tanzte mit dem jungen Marquis della Fazelli, und benahm sich mit der Ungezwungenheit und Würde, die ihr so natürlich war. Julie empfand eine gemischte Regung von Furcht und Vergnügen, als der Graf von Vereza, den sie für eben den Cavalier erkannte, welchen sie vom Fenster ab bemerkt hatte, sie zum Tanze führte. Die Grazie ihrer Bewegungen, das schöne Ebenmaß ihrer Gestalt erregten in der Gesellschaft ein leises Murmeln des Beyfalls, und die sanfte Röthe, die sich auf ihre Wangen schlich, gab ihren Reizen noch einen Zusatz mehr. Als aber die Musik sich veränderte, und sie nach dem sanften sicilianischen Tactmaße tanzte, verwandelte die schwebende Anmuth ihrer Bewegung, der süße, zärtliche Ausdruck auf ihrem Gesichte, die Aufmerksamkeit in bewundrungsvolles Schweigen, welches noch fortdauerte, als längst schon der Tanz aufgehört hatte. Die Marquise bemerkte die allgemeine Bewunderung mit erkünsteltem Vergnügen und geheimem Grimm. Sie hatte die peinlichste Angst ausgestanden, als der Graf von Vereza Julien zur Tänzerinn wählte, und verfolgte ihn den ganzen Abend hindurch mit dem forschenden Auge der Eifersucht. Ihr Busen, der vorher nur von Liebe glühte, ward jetzt von andern heftigern und zerstörendern Leidenschaften zerwühlt. Unruhig irrten ihre Gedanken umher. Die Scene vor ihr konnte ihre Seele nicht beschäftigen, und es erforderte alle ihre Kunst, ein ruhiges Äußeres zu zeigen. Sie sah, oder glaubte einen leidenschaftlichen Blick bey dem Grafen zu sehen, so oft er Julie anredete, und dieser Wahn nagte mit wüthender Eifersucht an ihrem Herzen. — Um zwölf wurden die Schloßthore geöffnet, und die Gesellschaft wanderte hinaus in das prächtig erleuchtete Gehölz. Schwibbogen von Licht liefen die langen Alleen hinab, die sich mit Pyramiden von Lampen endigten, welche dem Auge eine glänzende Flammensäule darstellten. In unregelmäßiger Entfernung waren Gebäude errichtet, mit bunten Lampen behangen, die in mannigfaltigen, fantastischen Formen geordnet waren. Unter den Bäumen standen Tische mit Erfrischungen. Die Musikanten hatten sich an den entlegensten, belaubtesten Plätzen gelagert, um sich dem Auge zu verbergen, und die Einbildungskraft zu täuschen. Der ganze Schauplatz schien bezaubert zu seyn; das Auge sah nichts als Schönheit und romantischen Glanz; das Ohr fing nur Töne der Freude und Harmonie auf. Der jüngere Theil der Gesellschaft formirte Gruppen, die bald durch die Waldung hervor schlüpften, bald wieder verschwanden. Julie schien die Zauberköniginn des Orts zu seyn. Ihr Herz hüpfte vor Freude, und goß einen Ausdruck reinen, wohlgefälligen Entzückens über ihre Züge. Ein edles, freymüthiges und hohes Gefühl funkelte aus ihren Augen, und beseelte ihr Wesen. Ihr Busen glühte von wohlwollender Zärtlichkeit, und sie schien allem, was um sie war, eine eben so reine Glückseligkeit, als sie selbst genoß, mittheilen zu wollen. Wohin sie nur ging, folgte Bewunderung ihren Schritten: Ferdinand war eben so froh, als die Scene rings um ihn. Emilie war vergnügt, und der Marquis schien seine Melancholie im Schlosse zurück gelassen zu haben. Die Marquise allein war elend. Sie speiste mit einer ausgewählten Gesellschaft in einem Pavillon am Seeufer, den man mit besonderer Eleganz ausgeschmückt hatte. Er war mit weißer Seide behangen, die mit Blumenkränzen aufgebunden und mit reichen goldenen Fransen besetzt war. Die Sopha's waren von eben dem Stoff, und abwechselnde Kränze von Rosen und Lampen umwanden die Säulen. Eine Reihe kleiner Lampen um das Gesimse formirte einen Lichtsaum rings um die Decke, der nebst den andern unzähligen Lichtern in einer glänzenden Flamme aus den großen Spiegeln, die das Zimmer schmückten, wiederstrahlte. Der Graf Muriani war mit von der Gesellschaft. Er becomplimentirte die Marquise über die Schönheit ihrer Töchter, und nachdem er scherzhaft die Gefangenen, welche ihre Reize fesseln würden, beklagt hatte, kam er auf den Grafen von Vereza.
»Gewiß,« sagte er, »verdient dieser junge Mann am besten unter allen Donna Julie zu besitzen. Als sie tanzten, dünkte mich, ich sähe ein vollkommenes Ebenbild der Schönheit beyder Geschlechter, und wenn ich nicht sehr irre, so haben sie einander gegenseitige Bewunderung eingeflößt.«
Die Marquise suchte ihren Unmuth zu verbergen und antwortete: »Ich will dem Grafen keinesweges das Verdienst abstreiten, das Sie ihm zuschreiben; allein nach dem, was ich von ihm gesehen habe, zu urtheilen, ist er zu flüchtig zu einer ernsthaften Verbindung.«
In eben dem Augenblicke trat der Graf in den Pavillon.
»Sieh da, Graf!« sagte Muriani lachend; »eben waren Sie der Gegenstand unsrer Unterhaltung, und sind gerade zur rechten Zeit gekommen, die Ehre, die Ihnen angethan worden, zu vernehmen. Ich verwendete mich bey der Marquise für Sie um Donna Julie, allein sie lehnt es durchaus ab; ob sie gleich Ihr Verdienst anerkennt, schützt sie vor, daß Sie von Natur leichtsinnig und unbeständig wären. Was sagen Sie dazu? — würde nicht Donna Juliens Schönheit Ihr unstätes Herz fesseln?«
»Ich weiß nicht, wodurch ich's verdient habe, bey der Marquise in diesem Credite zu stehen,« sagte der Graf lächelnd; »allein das Herz müßte in ungewöhnlichem Grade krank oder fühllos seyn, das in Donna Juliens Gegenwart sich der Freyheit rühmen könnte.«
Die Marquise, empfindlich gekränkt bey dem ganzen Gespräche, fühlte alle Stärke von Vereza's Antwort, die ihr mit besonderem Nachdrucke auf sie gerichtet zu seyn schien.
Das Fest endigte sich mit einem großen Feuerwerke, das am Seeufer angestellt war, und die Gesellschaft trennte sich erst, als der Morgen andämmerte. Julien that es weh, die Scene verlassen zu müssen. Sie war bezaubert von der neuen Welt, die sich ihr jetzt eröffnete, und nicht kalt genug, die lebhafte Gluth der Einbildungskraft von den Farben wirklichen Glücks zu unterscheiden. Sie glaubte, daß das Vergnügen, welches sie jetzt empfand, stets und in gleichem Maße durch die Gegenstände, die zuerst es erregten, müßte erneuet werden. Jugendliche Seelen sind nie geneigt, die Schwäche der Menschheit wahrzunehmen. Es ist eine schmerzhafte Wahrheit, daß Gegenstände auf uns wirken, deren Eindrücke eben so veränderlich als unerklärlich sind, und daß wir dasjenige, was gestern tief uns bewegte, heute nur schwach, morgen vielleicht gar nicht mehr fühlen. Wenn endlich diese unwillkommne Wahrheit in das Herz eindringt, so verwerfen wir im ersten Augenblicke mit Ekel allen Anschein des Guten; wir verschmähen es, eine Glückseligkeit zu kosten, über die wir nicht gebiethen können, und sinken nicht selten in eine vorüber gehende Verzweiflung. Weisheit oder Zufall rufen uns endlich von unserm Irrthume zurück, und biethen uns einen Gegenstand dar, welcher fähig ist, eine angenehme und doch dauernde Wirkung hervor zu bringen, welche wir Glückseligkeit trennen können. Glückseligkeit ist darin wesentlich von dem, was wir gewöhnlich unter Vergnügen verstehen, verschieden, daß Tugend ihre Basis ausmacht, und daß man von ihr, als dem Resultate der Vernunft, eine gleichförmige Wirkung erwarten darf.
Die Leidenschaften, die bisher in Juliens Herzen geschlummert hatten, brachen, zufällig berührt, in voller Kraft hervor, und ließen sie den Schmerz und das Entzücken erfahren, das mit ihrem Erwachen verbunden ist. Vereza's Schönheit und Vorzüge erregten in ihr eine neue, mannigfaltige Bewegung, welche aufzumuntern die Vernunft sie zurück hielt, und die dennoch zu süß war, um ihr ganz widerstehen zu können. Einem Gefühle von Entzücken entgegen klopfend, noch durch keine getäuschte Hoffnung zurück gescheucht, bewillkommt das junge Herz jedes Gefühl, das nicht geradezu schmerzhaft ist, mit einer romantischen Erwartung, es in Seligkeit aufgelöst zu sehen. — Mit ängstlicher Sorgfalt suchte Julie Vereza's Gesinnung gegen sie zu ergrübeln; sie rief sich alle Ereignisse des Tages wieder hervor: allein sie gewährten ihr wenig Befriedigung; sie warfen nur ein schimmerndes trügliches Licht zurück, welches statt sie zu führen, sie nur noch mehr verwirrte. Jetzt erinnerte sie sich eines Beweises besonderer Aufmerksamkeit und jetzt wieder eines Zeichens anscheinender Kälte. Sie verglich sein Betragen mit dem Betragen des andern jungen Abels, und es schien ihr, als wenn jeder sich um den Beyfall jedes gegenwärtigen Frauenzimmers eben so viel Mühe gegeben hatte. Doch dünkte ihr, alle Frauenzimmer hätten um Vereza's Aufmerksamkeit gebuhlt, und sie zitterte, daß er zu sehr die Auszeichnung gefühlt haben möchte. Sie konnte keinen festen Schluß aus diesen Betrachtungen ziehen; aber wenn sie gleich zwischen ängstlichen Zweifeln schwebte, so war doch selbst dieß Gefühl so innig mit Entzücken verwebt, daß sie nicht wünschen konnte, es mit ihrer vorigen Ruhe zu vertauschen. Rastlos, von Gedanken zu Gedanken irrend, flog der Schlaf von ihren Augen, und mit Ungeduld harrte sie dem Morgen entgegen, der sie wieder zu Vereza führen, und in Stand setzen würde, weiter zu forschen. Sie stand früh auf, und kleidete sich mit ungewöhnlicher Sorgfalt an. In ihrem traulichen Cabinette erwartete sie die Frühstücksstunde, und wollte lesen; aber ihre Gedanken schweiften von ihrem Buche ab. Ihre Laute, ihre Lieblingsarien konnten ihr nicht mehr gefallen; der Tag schien stille zu stehen — sie fiel in Schwermuth, und glaubte, die Frühstücksstunde würde nimmer anbrechen. Liebe lehrte sie Verstellung. Bis diesen Augenblick hatte sie Emilien jeden Gedanken ihrer Seele mitgetheilt; jetzt gingen sie schweigend ins Frühstückszimmer hinunter, und Julie fürchtete beynahe, ihrer Schwester Auge zu begegnen. Sie fanden das Zimmer noch leer; Julien war es unmöglich, ein Gespräch mit ihrer Schwester auszuhalten, deren Bemerkungen, weil sie den Lauf ihrer Gedanken unterbrachen, ihr uninteressant und beschwerlich waren. Sie stand eben im Begriffe, wieder hinauf in ihr Cabinett zu gehen, als der Marquis herein trat. Seine Miene war stolz, sein Blick strenge und trocken. Kalt begrüßte er seine Töchter, und sie hatten kaum Zeit, auf seine allgemeinen Fragen zu antworten, ehe die Marquise, und bald nach ihr, die andere Gesellschaft herein trat. Julie, die mit so schmerzhafter Ungeduld auf den Augenblick gewartet hatte, wo sie Vereza sehen würde, seufzte nun, daß er da war; kaum wagte sie, ihre furchtsamen Blicke von der Erde aufzuschlagen; und wenn sie zufällig die seinigen traf, ergriff sie ein sanftes Beben, und die Furcht, daß er ihre Empfindungen entdecken würde, machte ihre Verwirrung nur noch sichtbarer. Endlich rief ein Blick von der Marquise ihre verirrten Gedanken wieder zurück; eine andre Furcht unterdrückte die Furcht der Liebe, und sie gewann nach und nach ihre Fassung wieder. Sie konnte in Vereza's Betragen keine Merkmahle besonderer Aufmerksamkeit entdecken, und beschloß, mit strenger Sorgfalt über ihre eigenen Bewegungen zu wachen.
Dieser Tag war wie der vorige der Freude gewidmet. Abends wurde ein Concert gehalten, worin sich hauptsächlich der junge Adel hervor that. Ferdinand spielte das Violoncell, Vereza die Flöte, und Julie den Flügel, den sie mit einem Geschmacke und Ausdrucke berührte, welche jeden Zuhörer fesselten. Man denke sich Juliens Bestürzung, als Ferdinand ein schönes Duett auswählte und Vereza bath, mit seiner Flöte seine Schwester zu begleiten. Doch überwand das Bewußtseyn ihrer Geschicklichkeit bald ihre Furcht, und setzte sie in den Stand, alle ihre Kräfte aufzubiethen. Die Arie war einfach und rührend, und sie gab ihr alle Reize des Ausdrucks, die sie so ganz in ihrer Macht hatte. In schöner Begleitung berührte sie die Saiten ihres Piano Forte; gegen das Ende der zweyten Stanze ruhte ihre Stimme auf einer Note, schwoll zu einer solchen Höhe hinan, und stieg dann zu einigen einfachen Tönen herab, die sie mit so leidenschaftlicher Zärtlichkeit berührte, daß jedes Auge um sie sich feuchtete. Der Hauch der Flöte bebte, und Hippolytus fortgerissen, vergaß zu spielen. Eine tiefe Stille folgte beym Schlusse des Stückes, und dauerte fort, bis ein eintöniger Seufzer die Versammlung aus ihrer Bezauberung aufzuwecken schien. Unter dem allgemeinen Beyfalle schwieg Hippolytus. Julie bemerkte es, schlug sanft ihre Augen gegen ihn auf, und las die Empfindungen, die sie ihm eingeflößt hatte. Ein hohes Gefühl durchbebte ihr Herz, und sie erfuhr einen dieser seltnen Augenblicke, die das Leben mit einem Strahle von Seligkeit erleuchten, der seine gewohnte Finsterniß durchbricht. Furcht, Zweifel, alle ängstlichen Gefühle verschwanden, und den übrigen Abend hindurch fühlte sie nur Entzücken. Eine furchtsame Ehrerbiethung bezeichnete Hippolytus Betragen, und war Julien schmeichelnder, als die feurigste Erklärung. Ein Ball schloß den Abend, und sie war wiederum die Tänzerinn des Grafen. Als der Ball aufbrach, zog sie sich in ihr Zimmer zurück, nicht aber um zu schlafen. Freude ist eben so rastlos, als Furcht oder Kummer. Sie schien in eine neue Existenz eingetreten zu seyn — jenes feine Triebwerk zärtlicher Empfindungen, das bisher verborgen lag, war nun berührt, und ließ sie ein Entzücken genießen, höher als alles, was je ihre Einbildungskraft gemahlt hatte. Sie dachte an die Ruhe ihres vergangenen Lebens zurück, verglich sie mit der hoch fliegenden Wonne dieser Stunde,und frohlockte über den Abstand. Alle ihre vorigen Vergnügungen schienen ihr nur unschmackhaft; sie erstaunte, daß sie je sie fesseln konnten, und daß sie so ruhig die langweilige Einförmigkeit ertragen hatte, zu der sie bisher verdammt war. Jetzt erst schien sie zu leben. Versenkt in den einzigen Gedanken, geliebt zu seyn, schwebte ihre Einbildungskraft in den Regionen romantischer Seligkeit, und hob sie hoch hinaus über die Möglichkeit des Leidens. Von Hippolytus geliebt, konnte sie nur glücklich seyn. Der Ton einer Musik gerade unter ihrem Fenster weckte sie aus diesem bezaubernden Zustande. Es war eine Laute, von einer Meisterhand berührt. Nach einer milden melancholischen Symphonie schwoll eine Stimme von mehr als Zauberklang zu einer so rührenden, zärtlichen Arie an, daß sie die Seele der Liebe selbst zu athmen schien. Die Saiten der Laute wurden in leiser, süßer Begleitung berührt. Julie horchte, und unterschied folgende Worte: »Still ist der Hauch der Nacht; kein einsamer Fußtritt schleicht sich durch das Schweigen dieser grausigen Stunde; tiefer Schlaf schwebt über diesen hohen Zinnen, und senkt auf alle seine süße, betäubende Kraft; nur nicht auf mich! —Vergebens erfleh' ich seinen Thau, in kurze Vergessenheit meine Sorgen zu senken. Der erschrockne Gott flieht, wo Liebe verfolgt, und verweigert des unglücklichen Liebenden Flehn.«
[An dieser Stelle befindet sich im englischen Original folgender Text:
Sonnet.
Still is the night-breeze! — not a lonely sound
Steals through the silence of this dreary hour;
O'er these high battlements Sleep reigns profound,
And sheds on all, his sweet oblivious power.
On all but me — I vainly ask his dews
To steep in short forgetfulness my cares.
Th' affrighted god still flies when Love pursues,
Still — still denies the wretched lover's prayers.]
Eine Pause folgte; die Arie wurde wiederhohlt, und die Musik verschwand. Wenn Julie vorher nur wähnte, von Hippolytus geliebt zu seyn, so war sie jetzt von der süßen Wahrheit überzeugt. Endlich fiel der Schlaf auf ihre Sinnen, und die Luftgestalten idealischer Wonne schwebten nicht länger vor ihrer Einbildungskraft. Der Morgen kam, und leicht und erquickt stand sie auf. Wie verschieden waren ihre Gefühle von denen des vorigen Tages! Ihre Angst hatte sich in entzückende Gewißheit aufgelöst, und sie schwebte in dem Taumel des Geistes, der alles zur Wonne mit sich fortreißt, und mit einer Macht, gleich der Berührung einer Zauberruthe, Wüsten in Paradiese umschaffen würde. Sie flog in das Frühstückzimmer, kaum fühlend, daß sie sich bewegte; als sie aber hinein trat, überwältigte sie eine süße Beschämung; sie fühlte ihre Wangen glühen, und fürchtete beynahe Vereza's Augen zu begegnen. Sie wurde bald von ihrer Angst befreyt; Vereza war nicht da; die Gesellschaft versammelte sich — Julie sah ängstlich auf, so oft jemand herein trat; er, nach dem sie blickte, erschien nicht. Betroffen und unruhig haftete sie ihre Augen auf die Thür, und so oft sie aufging, klopfte ihr Herz von einer Erwartung, die eben so oft vereitelt wurde. Trotz all ihres Bestrebens sank ihre Lebhaftigkeit in Schmachten, und sie fühlte nun, daß Liebe auch andere, als Empfindungen des Entzückens, hervor bringen kann. Sie fand es möglich, unglücklich zu seyn, obgleich Hippolytus sie liebte, und mußte mit einem schmerzhaften Seufzer sich eingestehen, daß jetzt ihr Friede von ihm abhinge. Er erschien nicht beym Frühstücke; eben so wenig wurde seiner gedacht: Delicatesse hielt sie ab, nach ihm zu fragen; das Sprechen wurde ihr lästig, und sie zog sich in Madame de Menons Zimmer zurück. Hier beschäftigte sie sich mit Zeichnen, und suchte die Zeit bis zur Mittagsstunde zu tödten, wo sie Hippolytus zu sehen hoffte. Madame war, wie gewöhnlich, freundlich und offen; allein sie bemerkte eine Zurückhaltung in Juliens Betragen, und errieth leicht die Ursache. Nur wußte sie den Gegenstand nicht, der ihrer Pflegetochter Herz aus seinem Gleichgewichte gebracht zu haben schien. Endlich kam die so heiß erwünschte Stunde, und mit klopfendem Herzen trat Julie in den Saal. Der Graf war nicht da, und sie hörte nur zufällig, daß er früh Morgens nach Neapel gereist war. Die Scene, die noch vor kurzem ihrem Auge bezaubert schien, veränderte nun ihre Farbe; mitten in der Gesellschaft, von Freude umgeben, war sie einsam und traurig. Sie klagte sich selbst an, daß sie ihr Urtheil von ihren Wünschen irre leiten lassen, Galanterie für ein zärtlicheres Gefühl gehalten hätte. Sie fing an zu glauben, daß der Sänger unter ihrem Fenster nicht der Graf gewesen sey, und so schwand auf ein Mahl das idealische Gebäude ihrer Glückseligkeit hin. Welch eine kurze Zeit stürzt oft den Gang unserer Empfindungen um, macht das, was wir gestern verachteten, uns heute wünschenswerth! Den ruhigen Zustand, den sie noch vor wenig Stunden zu verlassen frohlockte, erseufzte sie jetzt zurück. Ihr einziger Trost war der Gedanke, daß der Graf ihre Empfindungen nicht kannte, und daß süße Bewußtseyn, einem feinen Gefühle von Anstand und Sittlichkeit gemäß gehandelt zu haben.
Die öffentlichen Freudenfeste auf dem Schlosse gingen mit der Woche zu Ende; allein der lebhafte Geist der Marquise ließ keine Zurückkehr zur Ruhe zu, und sie wußte an die Stelle dieser lärmenden Vergnügungen andre zu setzen, die zwar nicht so geräuschvoll, aber kaum weniger glänzend waren, als jene. Mit Verdruß hatte sie am Abende des Concerts Hippolytus Betragen, und mit Schmerz seine Abreise bemerkt; doch verachtete sie es, Mißvergnügen durch Betrachtung zu verlängern, und suchte im Taumel der Zerstreuung das Gefühl ihrer vereitelten Hoffnung zu ersticken. Allein ihr Bemühen, ihn aus ihrem Gedächtnisse zu tilgen, blieb unwirksam. Nicht gewöhnt, sich dem Strome ihrer Neigungen zu widersetzen, behaupteten sie jetzt eine ungebundene Herrschaft, und sie fand zu spät, daß wir, um unsre Leidenschaften zu unterjochen, sie an frühen Gehorsam gewöhnt haben müssen. Unbezähmte Leidenschaft bringt eben so wohl Schwäche als Ungerechtigkeit hervor. Sie besaß nicht Seelenstärke genug, den Schmerz getäuschter Hoffnung, der jetzt auf ihrem Herzen lag, zu ertragen, und suchte durch Kränkung des Unschuldigen ihn zu mildern. Julie, deren Schönheit, wie sie glaubte, den Grafen gefesselt, und ihn in seiner Gleichgültigkeit gegen sie bestärkt hätte, war jetzt der Gegenstand ihres Unmuths, und sie quälte sie unaufhörlich durch die mannigfaltigen, boßhaften kleinen Künste, die dem Auge des gewöhnlichen Beobachters entwischen, und nur dem merklich werden, der sie gefühlt hat; Künste, die einzeln unbedeutend sind, gehäuft aber eine grausame, entscheidende Wirkung hervor bringen. In Juliens Seele war jetzt das Bild der Glückseligkeit erstorben. Freude hatte ihren Strahl von der Aussicht abgezogen, und die Gegenstände, welche ihr Sonnenschein nicht mehr erhellte, waren finster und farbenlos geworden. So oft ihre Lage es vergönnte, zog sie sich von der Gesellschaft zurück, und suchte in ihrer Einsamkeit Freyheit, ihren schwermüthigen Gedanken nachzuhängen, und der Verzweiflung freyen Lauf zu lassen, die so leicht der Täuschung unsrer ersten Hoffnung folgt. Woche nach Woche verstrich, und man gedachte noch keiner Rückkehr nach Neapel. Endlich erklärte der Marquis, daß er den Überrrest des Winters auf dem Schlosse zuzubringen dächte. Die Marquise unterwarf sich diesem Entschlusse ohne Widerstreben; sie war hier mit einem Haufen von Anbethern umgeben, und ihre Erfindungskraft wußte stets neue Vergnügungen herbey zu schaffen; die Fröhlichkeit, welche Neapel ihr so theuer machte, schimmerte in den Wäldern von Mazzini, und ertönte durch das Schloß. — Madame de Menons Zimmer waren groß und prächtig. Die Fenster stießen auf die See, und gaben eine Aussicht auf die Meerenge von Messina, an einer Seite von den schönen Ufern der Insel Sicilien, und an der andern durch Calabriens hohe Gebirge begrenzt. Der Canal voller Schiffe, deren bunte Fahnen in den Sonnenstrahlen schimmerten, stellte dem Auge eine sich immer bewegende Scene dar. Das Hauptzimmer ging auf einen Balcon, der über der Terrasse des Schlosses hing, und von dem man eine Aussicht hatte, die an Schönheit und Umfang alles übertraf. Diese Zimmer wurden vormahls für die schönsten im Schlosse gehalten, und als der Marquis das Schloß mit Neapel vertauschte, hatte er sie der Madame de Menon und ihren jungen Zöglingen zur Wohnung angewiesen. Der Marquise gefiel die Aussicht aus den Fenstern und von dem Balcon so sehr, daß sie die Zimmer in ihren vorigen Rang wieder einzusetzen beschloß. Sie sagte ihre Absicht der Madame, für die andre Zimmer zurecht gemacht wurden. Da Juliens und Emiliens Zimmer einen Theil der Reihe ausmachten, wurden sie ebenfalls von der Marquise in Anspruch genommen, und Julie behielt blos ihr Lieblings-Cabinett. Die Zimmer, wohin sie verlegt wurden, waren geräumig, aber dunkel; sie waren verschiedene Jahre unbewohnt gewesen, und ob man sie gleich zur Aufnahme ihrer neuen Bewohner aufgeputzt hatte, herrschte doch eine gewisses Verödung darin, die unwillkürlich melancholische Gefühle erregte. Julie bemerkte, daß ihr Zimmer, welches über Madame's Zimmern hinaus lag, zu dem südlichen Flügel gehörte, mit welchem es aber keine Gemeinschaft zu haben schien. Die geheimnißvollen Erscheinungen in diesem Theile des Gebäudes stellten sich ihrer Einbildungskraft wieder dar, und erzeugten einen Schrecken, den die Vernunft nicht überwältigen konnte. Sie theilte ihrer Hofmeisterinn ihre Besorgnisse mit, und diese, mehr klug als aufrichtig, lachte sie mit ihrer Furcht aus. Das Betragen des Marquis, die Worte des sterbenden Vincents und alle vorher gehenden Umstände hatten sich tief in Madame's Seele geprägt; allein sie sah die Nothwendigkeit ein, Zweifel, welche die Zeit allein auflösen konnte, in ihrer Brust zu verschließen.
Julie suchte sich in die Veränderung zu schicken, und bald ereignete sich ein Umstand, der alle ihre gegenwärtigen Gefühle in Vergessenheit senkte und neue, weit anziehendere in ihr schuf. Eines Tages, da sie einige Papiere in den Auszügen eines kleinen Schreibkästchens, das in ihrem Zimmer stand, in Ordnung legte, fand sie ein Gemählde, das ihre ganze Aufmerksamkeit fesselte. Es war ein Miniaturgemählde einer Dame, deren Gesicht mit tiefem Kummer bezeichnet war, und einen Ausdruck milder Ergebung athmete. Der sanft klagende Blick ihrer Augen, die flehend zum Himmel aufgeschlagen waren, die schmachtende Schwermuth, welche ihre Züge beschattete, rührte Julien so tief, daß ihre Augen unwillkürlich sich mit Thränen füllten. Sie seufzte; sie konnte ihre Blicke nicht von dem Gemälde los reißen, das mir einer Art von Zauberkraft sie zu fesseln schien. Es schien ihr, als ob es athmete, und als ob seine Augen mit einem Blicke durchdringender Zärtlichkeit sich auf die ihrigen hafteten. Innigst bewegt zeigte sie es der Madame, deren Schmerz und Erstaunen ihre Neugierde erhöhten. Aber welcher Strom von Gefühlen drang in ihr Herz, als sie hörte, daß sie über dem Bilde ihrer Mutter geweint hatte! Einer Mutterzärtlichkeit beraubt, ehe sie den Werth derselben fühlen konnte, klagte sie nun erst über einen Verlust, den keine Klagen zurück zu rufen vermochten. Emilie vermischte mit nicht minder starkem Gefühle ihre Thränen mit den Thränen ihrer Schwester. Mit feuriger Ungeduld drangen sie in Madame, ihnen die Ursache des Kummers zu entdecken, der so unverkennbar den Zügen ihrer Mutter aufgeprägt war. — »Ach meine Kinder!« sagte Madame tief seufzend, »ihr legt mir ein zu schweres Geschäft auf, nicht nur für euren, auch meinen Frieden, weil ich bey der Erzählung, die ihr verlangt, Scenen aus meinem eignen Leben zurück rufen muß, die ich auf immer vergessen zu können wünschte: dennoch aber wäre es grausam und ungerecht, euch eine Erläuterung vorzuenthalten, die euch so nahe angeht, und ich will meine Ruhe euren Wünschen aufopfern. — Louise von Bernini, eure Mutter, war, wie ihr wißt, die zweyte Tochter des Grafen Bernini; das Unglück eurer Familie aber, wißt ihr, glaube ich, noch nicht. Die Hauptgüter des Grafen lagen im Val di Demona; ein Thal, das wegen der Nähe des Berges Ätna, den die gemeine Sage mit Teufeln bevölkert, diesen Rahmen hat. In einem der schrecklichen Ausbrüche des Ätna, die dieses Thal mit einer Feuerfluth überschwemmten, wurde ein großer Theil von eures Großvaters Gebiethe verwüstet. Der Graf befand sich gerade damahls mit einem Theile seiner Familie zu Messina, die Gräfinn aber und ihr Sohn, die auf den Gütern waren, kamen um. Die übrigen Güter des Grafen waren verhältnißmäßig unbeträchtlich, und der Verlust seiner Gattinn und seines Sohnes beugten ihn tief. Er zog sich mit Louisen, seinem einzigen lebenden Kinde, die damahls funfzehn Jahre alt war, nach einem kleinen Gute bey Catanea zurück. Euer Großvater war mit dem meinigen Geschwisterkind, und eure Mutter hing durch Bande der Empfindungen an mir, die uns, so wie wir heran wuchsen, stärker noch, als die Bande des Blutes, verknüpften. Unser Geschmack, unsere Vergnügungen waren dieselben, und eine Gleichförmigkeit des Unglücks war vielleicht der Keim unserer frühen Freundschaft. Ich verlor, so wie sie, einen Blutsfreund bey dem Ausbruche des Ätna. Meine Mutter war gestorben, ehe ich ihren Werth fühlen konnte, mein Vater aber, den ich zärtlich verehrte und liebte, kam in einer dieser erschrecklichen Überschwemmungen um: seine Güter wurden unter der Lava begraben, und er ließ nur einen Sohn und mich zurück, um sein Schicksal zu bejammern, und dem Übel der Armuth entgegen zu kämpfen. Der Graf, der unser nächster lebender Verwandter war, nahm uns großmüthig zu sich ins Hans, und erklärte, das er uns als seine Kinder betrachten wollte. Zur Beschäftigung seiner Mußestunden übernahm er es selbst, die Erziehung meines Bruders zu vollenden, der damahls siebzehn Jahre alt war, und dessen aufkeimendes Genie die Bemühungen des Grafen zu belohnen versprach. Auch Louise und ich genossen oft den Unterricht unsers Vaters, und in diesen Stunden war Orlando gewöhnlich gegenwärtig. Die ruhige Stille, worin der Graf lebte, die vernünftige Eintheilung seiner Zeit zwischen eignem Studieren, der Erziehung derer, die er gütig seine Kinder nannte, und dem Umgange einiger vertrauten Freunde, verfrühte die Wirkung der Zeit, und stimmte seinen herben Schmerz zu stiller sanfter Melancholie herab. Louise und ich waren noch Neulinge im Leben; unsere Lebensgeister besaßen noch die glückliche Spannkraft der Jugend, und nach und nach gingen unsere Herzen von Kummer zur Ruhe, von Ruhe zur Glückseligkeit über. Oft, wenn mein Bruder uns eine schöne Stelle verlas, glaubte ich auf Louisens Gesichte eine zärtliche Theilnahme zu lesen, welche mehr der Vorleser als der Verfasser hervor zu bringen schien. Diese Tage, gewiß die beneidenswürdigsten unsers Lebens, verflossen in reinem Genusse, in stufenweiser Ausbildung unsers Geistes und Herzens. Der Graf bestimmte meinen Bruder für die Armee, und die Zeit rückte heran, wo er zu dem Regimente gehen sollte, bey dem er eine Stelle hatte. Die Gedankenabwesenheit, die Niedergeschlagenheit meiner Muhme enthüllten mir jetzt das Geheimniß, welches sie so lange vor sich selbst verborgen hatte. Erst als Orlando im Begriffe stand abzureisen, fühlte sie, wie theuer er ihrem Herzen war. Am Abende vor seiner Abreise beklagte der Graf mit väterlicher obgleich männlicher Zärtlichkeit die Entfernung, welche bald uns trennen sollte. »Aber wir werden uns wieder sehen,« sagte er,« wenn mein Sohn, mit dem Ruhme seiner Tapferkeit gekrönt zurück kehren wird.« Louise erblaßte, ein halb unterdrückter Seufzer entwischte ihr, und sie eilte zum Claviere, um ihre Bewegung zu verhehlen. Mein Bruder hatte ein kleines Hündchen, das sein Favorit war; er schenkte ihn Louisen, ehe er fortging, und bath, daß sie gütig gegen ihn seyn, und sich zu Zeiten seines Herrn bey ihm erinnern möchte. — Er unterdrückte eine Bewegung; als er sich aber von ihr wendete, sah ich eine Thräne über seine Wangen rollen. Er ging, und mit ihm schien der Geist unsers Glücks verschwunden zu seyn. Die Scenen, welche seine Gegenwart vormahls belebte, waren jetzt verödet und traurig; doch mochten wir gern an den Orten wandeln, die einst sein Lieblingsaufenthalt waren. Louise enthielt sich, meines Bruders zu erwähnen, selbst gegen mich; oft aber, wenn sie sich unbemerkt glaubte, schlich sie an ihr Clavier, und wiederhohlte die Melodie, die sie am Abende vor seiner Abreise gespielt hatte. Von Zeit zu Zeit hörten wir von ihm, daß er wohl war, und obgleich seine Bescheidenheit ihm nicht zuließ, selbst seiner Thaten zu erwähnen, so erfuhren wir doch durch andere, daß er sich sehr tapfer bewies. Endlich nahte die Zeit seiner Zurückkunft heran, und Louisens neu belebte Geister zeigten den Einfluß, den er über ihr Herz behalten hatte. Er kam zurück, und trug das öffentliche Zeugniß seiner Tapferkeit in den Ehrenstellen, die ihm ertheilt waren. Er wurde mit allgemeiner Freude empfangen; der Graf bewillkommete ihn mit dem Stolz und der Zärtlichkeit eines Vaters, und die Villa wurde wiederum der Sitz des Glücks. Seine Person und Sitten hatten sich gebildet; die zarte Schönheit der Jugend hatte sich in die einnehmende Würde des Mannes verwandelt, und Kenntniß der Welt hatte seine wissenschaftlichen Kenntnissse bereichert. Die Freude, welche aus seinem Gesichte strahlte, als er Louisen sah, sprach zugleich seine Bewunderung und Liebe aus, und die Röthe, welche ihre Wangen überzog, würde selbst dem gleichgültigsten Zuschauer entdeckt haben, daß diese Freude gegenseitig war. Orlando brachte einen jungen Franzosen, einen Officier von seinem Regimente, mit, der ihn in der Schlacht aus einer dringenden Gefahr befreyet hatte, und den er dem Grafen als seinen Erhalter vorstellte. Der Graf nahm ihn mit Dank und Auszeichnung auf, und er blieb lange zum Besuche in unserer Villa. Seine Sitten waren äußerst einnehmend, sein Verstand angebaut und verfeinert. Er verrieth eine Zärtlichkeit für mich, und war in der That zu liebenswürdig, um mit gleichgültigen Augen angesehen zu werden. Dankbarkeit für das unschätzbare Leben, welches er erhalten hatte, war vielleicht der Grundkeim einer Hochachtung, die bald zur heißesten Liebe anwuchs. Unsere Zuneigung wuchs mit unsrer Bekanntschaft, und endlich hielt der Chevalier de Menon bey dem Grafen um mich an. Dieser zärtliche Pflegevater zog mein Herz zu Rathe; und da er es günstig für ihn gestimmt fand, zog er nähere Erkundigungen von der Familie des Fremden ein. Er erhielt gute befriedigende Nachrichten, der Chevalier war der Sohn eines französischen Edelmanns, der vor einigen Jahren gestorben war, und ansehnliche Güter in Frankreich besaß. Er hinterließ mehrere Söhne, und das Familienvermögen fiel folglich auf den ältesten; allein auch den beyden jüngsten hatte er ein ansehnliches Erbtheil ausgesetzt. Unsere Vermählung wurde in aller Stille im Beyseyn des Grafen, Louisens und meines Bruders vollzogen. Bald nach der Hochzeit wurden mein Gemahl und Orlando nach ihren Regimentern zurück berufen. Meines Bruders Zärtlichkeit war jetzt unveränderlich auf Louisen gehäftet; allein Delicatesse und Edelmuth legten ihm Schweigen auf. Arm, wie er war, um Louisens Hand zu werben, würde, glaubte er, die Güte des Grafen mit Undank belohnen heißen. Ich habe den innern Kampf seines Herzens gesehen, und das meinige hat vor ihm geblutet. Der Graf und Louise bathen mich so dringend, während des Feldzugs bey ihnen zu bleiben, daß mein Gemahl endlich einwilligte. Wir trennten uns — o daß ich diesen Zeitpunct vergessen könnte! — Hätte ich ihn begleitet, so, wäre vielleicht alles gut gegangen, und die langen Jahre des Elends, die nun folgten, wären mir ersparet worden!« —
Das Signal zum Mittagsessen ertönte jetzt, und unterbrach Madame's Erzählung. Ihre schönen Zuhörerinnen trockneten die Thränen aus den Augen und gingen mit äußerstem Widerstreben in den Saal hinab. Der Tag wurde in Gesellschaft und Zerstreuungen hingebracht, und erst spät Abends durften sie sich zurück ziehen. So bald sie erlöst waren, eilten sie zur Madame, und zu ungeduldig, um schlafen zu können, zu dringend, um abgewiesen zu werden, bathen sie um die Fortsetzung ihrer Geschichte. Sie schützte die späte Stunde vor, gab aber endlich ihren Bitten nach. Sie zogen ihre Stühle dicht zu dem ihrigen, und jeden Sinn einzig in den Sinn des Gehörs verloren, folgten sie ihr bis zum Ende ihrer Erzählung. »Mein Bruder,« fuhr Madame de Menon fort, »reiste wieder fort, ohne seine Gefühle zu entdecken; die Anstrengung, welche dieses Verheelen ihm kostete, war sichtliche; allein sein Gefühl von Ehre überwand jede andere Betrachtung. Louise senkte aufs neue ihr Haupt, und schmachtete in stillem Kummer. Ich trauerte nicht minder um meine Freundinn als um meinen Bruder, und habe tausend Mahl die falsche Delicatesse verwünscht, welche sie von einer Glückseligkeit zurück hielt, die sie so leicht und auf so unschuldigem Wege hätten erlangen können. Das Betragen des Grafen schien zu versprechen, daß er mit Freude diese Verbindung zugeben würde. Ungefähr um diese Zeit sah der Marquis von Mazzini Louisen, und liebte sie. So schmeichelhaft seine Anträge auch waren, wollte sich doch der Graf der unbegrenzten Gewalt eines Vaters nicht bedienen, und drang nicht weiter auf diese Verbindung, als er sah, daß sie Louisen wirklich zuwider war. Sie fühlte die Großmuth seines Betragens, und konnte kaum ohne einen Seufzer, den ihre Dankbarkeit der Güte ihres Vaters zollte, den Antrag abweisen. Bald aber ereignete sich ein Umstand, der alle unsere Luftgebäude zu Boden stürzte. Ein Streit, der durch eine Kleinigkeit veranlaßt zu seyn schien, aber sehr ernsthaft wurde, entstand zwischen dem Chevalier de Menon und meinem Bruder. Das Schwert mußte ihn entscheiden, und ach! mein Bruder starb von der Hand meines Gemahls. — Ich kann nicht bey dieser Erinnerung verweilen — schwer fiel sein Tod auf Louisen. Die Welt war ihr gleichgültig geworden, und da sie keine Aussicht auf Glückseligkeit für sich selbst mehr hatte, wollte sie wenigstens ihrem Vater, der es so sehr um sie verdiente, sie nicht verweigern. Sie gab dem Marquis, der noch immer in seiner Bewerbung beharrte, ihre Hand. Die Charaktere des Marquis und seiner Gemahlinn waren ihrer Natur nach zu verschieden, um eine glückliche Vereinigung schaffen zu können. Louise fühlte es bald, und obgleich ihre sanfte Gemüthsart sich der harten Gewalt ihres Mannes geduldig unterwarf, drang dennoch sein Betragen tief in ihr Herz, und geheimer Gram verzehrte sie. Sie konnte nicht umhin, den Charakter des Marquis mit dem zu vergleichen, an dem so gerecht und zärtlich ihre Liebe hing. Diese Vergleichung erhöhte ihre Leiden, nagte an ihren Kräften, und zerrüttete bald ihren Körper. Ihr Zustand ging dem Grafen tief zu Herzen, und traf mit den Schwachheiten des Alters zusammen, sein Leben zu verkürzen. Nach seinem Tode sagte ich meiner Muhme Lebewohl, und ging nach Italien, woselbst der Chevalier de Menon mich seit geraumer Zeit erwartet hatte. Unsere Zusammenkunft war äußerst rührend. Mein Unwillen gegen ihn schmolz hinweg, als ich sein bleiches, eingefallenen Gesicht sah, und die Melancholie wahrnahm, welche an seinem Herzen nagte. Alle seine ehemahlige Lebhaftigkeit war dahin, und er war zur Beute unablässigen Schmerzens und folternder Gewissensbisse geworden. Sein ermordeter Freund stand stets vor ihm, und meine Gegenwart schien aufs neue Wunden zu öffnen, welche die Zeit zu heilen anfing. Sein Kummer, mit dem meinigen vereinigt, war mehr, als ich ertragen konnte; allein ich war bestimmt zu leiden und ein noch härteres Geschick war über mich verhängt. In einem Feldzuge, der bald erfolgte, stürzte sich mein Gemahl, des Daseyns müde, in die Hitze der Schlacht, und erkämpfte einen ehrenvollen Tod. In einem Papier, das er zurück ließ, hatte er geschrieben, es sey seine Absicht, in der Schlacht umzukommen; lange hätte er den Tod gewünscht, und auf eine Gelegenheit geharrt, ihn zu finden, ohne seinen Nahmen mit der feigen That eines Selbstmords zu beflecken, oder mich durch eine brutale Handlung zu kränken. — Dieser Fall gab mir den letzten Stoß. — Aber laßt mich zurück gehen! noch sein anderes Unglück wartete meiner, als ich es am wenigsten erwartete. Der Chevalier de Menon starb ohne Testament, und seine Brüder weigerten sich, sein Vermögen heraus zu geben, wenn ich nicht ein Zeugniß meiner Heirath herbey schaffen könnte. Ich ging nach Sicilien zurück, wo ich zu meinem unaussprechlichen Schmerz fand, daß eure Mutter, während meiner kurzen Abwesenheit — wie ich fürchte, eine Beute des Schmerzens — gestorben war. Dem Priester, der unsere Heirath vollzog, war um eines Kirchenvergehens willen Strafe angedroht worden, und er hatte heimlich das Land verlassen. So war ich also der Beweise beraubt, die meine Ansprüche auf meines Mannes Nachlaß bekräftigen konnten. Meine Brüder, die mich nie gesehen hatten, waren entweder zu eingenommen gegen mich, um an die Rechtmäßigkeit meiner Ansprüche zu glauben. oder zu unredlich, sie einzugestehen. Ich war also mit einem Streiche dem Kummer und der Armuth hingegeben, und ein kleines Vermächtniß vom Grafen Bernini war alles, was mir übrig blieb. Als der Marquis sich mit Maria de Vellorno vermählte, welches ungefähr um diese Zeit geschah, beschloß er Mazzini mit Neapel zu vertauschen. Sein Sohn sollte ihn begleiten, euch aber, die ihr noch sehr jung waret, wollte er der Sorgfalt einer Person anvertrauen, die eurer Erziehung vorstehen konnte. Meine Umstände machten mir diese Stelle wünschenswerth und meine ehemahlige Liebe zu eurer Mutter ließ mich süße Freude in meiner Pflicht finden. Der Marquis war, wie ich glaube, froh, sich die Mühe erspart zu sehen, weiter nach dem zu suchen, was er bisher schwer zu erhalten gefunden hatte, eine Person, die Neigung so wohl, als Pflicht, an sein Interesse bände.« — Hier hörte Madame auf zu reden, und beyde Schwestern weinten über das Gedächtniß ihrer Mutter, deren Unglück diese Geschichte ihnen sagte. Das Leiden der Madame, ihre Freundschaft für die verstorbene Marquise machten sie ihren Pflegetöchtern theuer, die von diesem Augenblicke an durch alles, was Zärtlichkeit und feine Aufmerksamkeit nur aufbiethen konnten, die Spuren ihres Kummers auszutilgen suchten. Madame erkannte ihre Zärtlichkeit, und sie brachte im innigern Grade die gewünschte Wirkung hervor. Bald aber erschien ein Gegenstand, der ihre Seelen von der Betrachtung über ihrer Mutter Schicksal zu einem wundervolleren und ebenso interessanten Gegenstande rief.
Eines Abends, da Emilie und Julie durch Gesellschaft länger, als gewöhnlich in feyerlichem Zwange gehalten waren, verführte sie Madame de Menons angenehme Unterhaltung, und das Vergnügen, welches eine Zurückkehr zur Freyheit nie zu erzeugen verfehlt, die Stunde der Ruhe zu verschieben, bis die Nacht weit vorgerückt war. Sie waren eben in einem interessanten Gespräche begriffen, als Madame, die gerade das Wort führte, von einem dumpfen Geräusche unterbrochen wurde, das unter dem Zimmer hervor stieg, und wie das Zumachen einer Thür lautete. In Schweigen geschreckt, horchten sie, und hörten es deutlich wiederhohlt. Furchtbare Ideen drängten sich um ihre Einbildungskraft, und erfüllten sie mit einem Schrecken, das ihnen kaum zu athmen erlaubte. Das Geräusch dauerte nur einen Augenblick, und tiefe Stille folgte. Ihre Betäubung ließ endlich nach, und sie wollten eben in Madame's Zimmer gehen, als sie das Geräusch nochmahls hörten. Halb wahnsinnig vor Furcht stürzten sie in das Zimmer, wo Emilie halb ohnmächtig aufs Bett sank. Lange Zeit verstrich, ehe Madame ihre Sinnen wider hervorrufen konnte. Sie mußte nun alle ihre Überredung aufbiethen, beyde Fräulein einiger Maßen zu beruhigen, und sie abzuhalten, das ganze Schloß in Aufruhr zu bringen. Von furchtbaren dunklen Zweifeln umringt, behauptete sie Herrschaft genug über sich, ihre Gefühle zu unterdrücken, und sich ein ruhiges Ansehen zu geben. Das neuliche Betragen des Marquis hatte sie überzeugt, daß er bey dem Geheimnisse, welches über diesem Theile des Schlosse hing, nahe interessirt war, und sie fürchtete seinen Zorn reger zu machen, wenn sie fernere Besorgnisse blicken ließ, die vielleicht Täuschung waren, und deren Wirklichkeit sie auf keine Art beweisen konnte. Durch diese Betrachtungen geleitet, suchte sie Emilien und Julien zu bewegen, schweigend eine Bestätigung ihrer Zweifel abzuwarten; allein ihre Furcht machte dieß zu einem sehr schweren Geschäfte. Endlich gaben sie so weit nach, daß sie ihr versprachen, diese Umstände vor jedermann, außer vor ihrem Bruder, zu verbergen, ohne dessen beschützende Gegenwart es ihnen unmöglich sey, noch eine Nacht in den Zimmern hinzubringen. Den Rest von dieser Nacht beschlossen sie durchzumachen. Um die langweilige Zeit zu beschleichen, suchten sie eine Unterhaltung anzuknüpfen; aber ihre Seelen waren zu voll von diesem schrecklichen Gegenstande, als daß sie an etwas Anderes denken konnten. Sie stellten diesen Umstand mit der Erscheinung der Gestalt und des Lichts, das sie vormahls gesehen hatten, zusammen; ihre Einbildungskraft schuf wilde Träume, und sie bathen Madame inständigst, ihnen aufrichtig zu sagen, ob sie glaubte, daß es entkörperten Geistern vergönnt sey, diese Erde zu besuchen. — »Meine Kinder,« sagte sie, »ich will es nicht unternehmen, euch zu überreden, daß die Existenz solcher Geister unmöglich sey. Wer darf sagen, daß der Gottheit irgend etwas unmöglich ist? Wir wissen, daß er uns, die wir bekörperte Geister sind, geschaffen hat, er kann also auch unbekörperte Geister machen. Wenn wir das Daseyn solcher Geister nicht begreifen können, so sollten wir die beschränkte Kraft unsers Verstandes erwägen, der manches nicht fassen kann, was unwiderleglich wahr ist. Niemand weiß, warum die Magnetnadel sich nach Norden richtet, und dennoch steht ihr, die ihr nie einen Magnet sahet, keinen Augenblick an, diese Eigenschaft desselben zu glauben, weil es euch in Büchern und mündlich versichert ist. Da wir also gewiß sind, daß Gott nichts unmöglich ist, und daß solche Wesen existiren können, ob wir gleich nicht zu sagen vermögen, wie; so müssen wir uns darauf beschränken, durch was für Zeugen ihr Daseyn behauptet wird. Ich sage nicht, daß Geister erschienen sind, allein wenn mehrere vorsichtige, uneingenommene Personen mich versicherten, daß sie einen Geist gesehen hätten, so würde ich nicht stolz und anmaßend genug seyn, zu antworten: es ist unmöglich! — Lasset also eure Gemüther durch solche Gedanken nicht beunruhigen. Ich habe so viel gesagt, weil ich nicht gern euern Verstand irre führen wollte; jetzt liegt es euch ob, eure Vernunft zu gebrauchen, und das unerschütterliche Vertrauen der Tugend beyzubehalten. Solche Geister, wenn sie je erschienen sind, können nur auf ausdrückliche Erlaubniß Gottes, und zu ganz besondern Zwecken erschienen seyn. Seyd versichert, daß es keine Gattung von Wesen gibt, die ungesehen von ihm handelte, und daß es folglich keine geben kann, die der Unschuld Leides zufügten.«
Keine unterirdischen Töne beunruhigten sie für dieß weiter, und ehe der Morgen anbrach, überwältigte unmerklich Müdigkeit ihre Furcht, und senkte sie in Ruhe.
Als Ferdinand die Umstände von dem südlichen Flügel des Schlosses hörte, fing seine Einbildungskraft begierig den Anschein eines Geheimnisses auf, und flößte ihm ein unwiderstehliches Verlangen ein, die Mysterien dieses verödeten Gebäudes zu durchdringen. Er versprach ohne Anstand, mit seinen Schwestern in Juliens Zimmer zu wachen; weil aber das seinige in einem entfernten Theile des Schlosses lag, so hatte es einige Schwierigkeit, unbemerkt zu ihnen zu kommen. Sie machten also aus, daß er, wenn alles zu Bette wäre, den Versuch machen sollt — und Emilie und Julie erwarteten nun mit rastloser bebender Ungeduld die Zurückkunft der Nacht. — Endlich hatte sich das ganze Haus zur Ruhe gelegt. Die Schloßglocke hatte eins geschlagen und Julie begann, zu fürchten, daß Ferdinand entdeckt sey, als sie an der Thür des Vorsaals klopfen hörte. Ihr Herz schlug von einer Furcht, welche die Vernunft nicht rechtfertigen konnte. Madame stand auf, und auf ihre Frage, wer da sey, antwortete Ferdinands Stimme. Freudig öffnete sie die Thür. Sie zogen ihre Stühle dicht um ihn, und suchten die Zeit mit Gespräch hinzubringen; allein Furcht und Erwartung zogen alle ihre Gedanken auf Einen Gegenstand, und Madame allein behielt ihre Fassung bey. Die Stunde war nun gekommen, wo sie in der Nacht zuvor die unterirdischen Töne gehört hatten, und alles war Ohr. Indessen blieb alles ruhig, und die Nacht verstrich ohne weitere Störung. — Der größte Theil verschiedener folgenden Nächte wurden auf gleiche Art durchwacht; aber kein Laut unterbrach die Stille. Ferdinand, in dessen Gemüthe die letzten Umstände einen Grad von Verwunderung und Neugier rege gemacht hatten, der gewöhnliche Hindernisse überstieg, nahm sich fest vor, sich, wo möglich, Eingang in diese Gemächer des Schlosses zu verschaffen, die seit so vielen Jahren vor dem menschlichen Auge verborgen gewesen waren. Dieß Vorhaben war indessen schwer auszuführen; denn die Schlüssel zu diesem Theile des Gebäudes waren in des Marquis Händen, dessen Betragen er nur zu richtig beurtheilte, um sich mit der Erwartung zu schmeicheln, daß er sie würde öffnen lassen. Er spannte seine Einbildungskraft auf die Folter, um Mittel auszusinnen, sich Zugang zu derselben zu verschaffen; endlich erinnerte er sich, daß Juliens Zimmer einen Theil dieser Gebäude ausmachte, und es fiel ihm ein, daß nach der Bauart in vorigen Zeiten vielleicht vormahls eine Gemeinschaft zwischen beyden gewesen seyn könnte. Er schloß nun weiter, daß vielleicht gar eine verborgene Thür darin zu finden wäre, und beschloss, in der folgenden Nacht sorgfältig alles zu durchsuchen. — Das Schloß war in Schlaf begraben, als Ferdinand wieder zu seinen Schwestern in Madame's Zimmer kam. Mit ängstlicher Neugier folgten sie ihm in das Zimmer. Es war mit Tapeten behangen. Ferdinand untersuchte sorgsam die Wand, welche an den südlichen Flügel stieß. Sie gab an einer Stelle einen Schall zurück, der ihn überzeugte, daß etwas weniger Solides als Stein daselbst sey. Er räumte behuthsam die Tapeten weg, und entdeckte zu seiner unaussprechlichen Freude eine kleine Thür. Mit einer Hand, die vor Begierde zitterte, schob er die Riegel auf, und wollte vorwärts dringen, als er sah, daß ein Schloß seinen Durchgang hemmte. Vergebens versuchte er alle Schlüssel der Madame und seiner Schwester, und mußte in eben dem Augenblicke, wo er sich des glücklichen Erfolgs freute, ihn vereitelt sehen; denn er hatte keine Werkzeuge bey sich, das Schloß zu sprengen. Er starrte die Thür an, schmerzlich sein Mißgeschick beklagend, als ein dumpfes Geräusch von unten gehört ward. Emilie und Julie ergriffen seinen Arm, und beynahe überwältigt von Schrecken, horchten sie schweigend. Sie hörten deutlich einen Fußtritt, als wenn es durch das untere Zimmer ginge, worauf alles still ware. Ferdinand durch diese Bestätigung seiner eignen Sinne noch mehr befeuert, drang aufs neue gegen die Thür an, und versuchte nochmahls, sich einen Weg zu bahnen; allein sie widerstand aller Anstrengung seiner Kraft. Die Frauenzimmer freuten sich jetzt über einen Umstand, den sie kurz zuvor beklagt hatten; denn der Schall hatte ihr Schrecken erneuet; und obgleich die Nacht ohne weitere Beunruhigung verstrich, konnten sie sich doch von ihrer Furcht nicht wieder erhohlen. — Ferdinand, dessen ganze Seele mit Erstaunen erfüllt war, konnte kaum die Wiederkehr der Nacht erwarten. Emilie und Julie waren nicht minder ungeduldig; sie zählten jede Minute, und so bald das Haus zur Ruhe war, eilten sie mit klopfendem Herzen in Madame's Zimmer. Ferdinand kam bald zu ihnen; er hatte sich mit Werkzeugen versehen, das Schloß zu sprengen. Sie blieben einige Augenblicke in furchtvollem Stillschweigen, aber kein Ton unterbrach das Schweigen der Nacht. Ferdinand nahm ein Messer, und brachte bald das Schloß herunter, die Thür gab nach, und öffnete einen großen finstern Gang. Er nahm ein Licht; seine Schwestern, die sich allein im Zimmer zu bleiben fürchteten, wollten ihn begleiten; jede ergriff einen Arm von Madame, und schweigend folgten sie ihm. Der Gang war an manchen Stellen eingefallen, das Tafelwerk zerbrochen, die Fensterladen zerschmettert, welches mit der Feuchtigkeit der Mauern zusammen genommen, dem Orte ein wildes, verwüstetes Ansehen gab. Sie schlichen leise fort, denn ihre Schritte liefen in flüsternden Echo's durch den Gang, und oft warf Julie einen furchtsamen Blick um sich her. Die Gallerie ging bis zu einer breiten, alten Treppe, die zu einer Halle hinunter führte; zur Linken sah man verschiedene Thüren, die in abgesonderte Zimmer zu führen schienen. Während sie sich besonnen, welchen Weg sie nehmen sollten, schimmerte ein schwaches Licht die Treppe herauf, und verschwand einen Augenblick nachher; zugleich hörten sie in der Ferne einen Fußtritt. Ferdinand zog sein Schwert, und sprang vorwärts; seine Begleiterinnen schrien vor Schrecken, und liefen in Madame's Zimmer zurück. Ferdinand stieg eine lange gewölbte Halle hinab; er ging quer durch eine Thür, die halb offen stand, und durch die ein Lichtstrahl flimmerte. Die Thür ging in einen engen gewundenen Gang; er trat hinein; das Licht wich zurück, und verlor sich schnell in den Krümmungen. Er ging immer weiter; der Gang wurde enger, und die vielen herunter gefallenen Steine erschwerten den Weg. Eine niedrige Thür, die der gleich sah, durch welche er herein gekommen war, verschloß den Zugang. Er öffnete sie, und entdeckte einen viereckigen Platz, von welchem eine Windeltreppe hinaufstieg, die in den südlichen Thurm führte. Ferdinand stand stille und horchte; kein Fußtritt ließ sich mehr hören, und alles war in tiefem Schweigen. Er entdeckte eine Thür zur Rechten, versuchte sie zu öffnen; allein sie war inwendig befestigt. Er schloß also, daß die Gestalt, wenn wirklich ein menschliches Wesen das Licht, das er sah, getragen hatte, den Thurm hinauf gegangen sey. Er stand einen Augenblick bey sich an, und beschloß muthig, die Treppe hinauf zu steigen; aber ihr verfallener Zustand machte dieß zu einem sehr gewagten Unternehmen. Die Stufen waren eingesunken und zerbrochen, und die losen Steine mußten jeden Fußtritt unsicher machen. Durch einen unwiderstehlichen Trieb fortgerissen, ließ er sich nicht abschrecken, und versuchte hinaus zu steigen. Er war noch nicht weit gegangen, als die Steine von einer Stufe, die er eben verlassen hatte, durch seine Schwere los gerissen, nachgaben, und indem sie die angrenzenden Stufen mit fortrissen, eine Lücke in der Treppe machten, welche selbst Ferdinanden erschreckte, der mit unsicherm Tritte auf der schwankenden Hälfte der Treppe blieb, und augenblicklich erwarten mußte, mit dem Steine, worauf er stand, zu Boden zu sinken. In dem Schrecken, der sich jetzt seiner bemächtigte, wollte er versuchen, sich zu retten, und nach einem Balken greifen, der über die Stufen hervor ragte, als das Licht ihm aus der Hand fiel, und er in stockfinsterer Nacht zurück blieb. Entsetzen verdrängte nun alle anderen Empfindungen; er wußte nicht mehr, was er that. Er konnte nicht weiter gehen, weil er fürchten mußte, daß die obern Stufen, eben so los als die untern, nachgeben würden; — zurück zu gehen, war unmöglich; denn die Dunkelheit verhinderte ihn zu sehen, wo er hintrat. Er beschloß also, in dieser Lage zu bleiben, bis das Licht durch die schmahlen Ritzen in den Mauern dämmerte, und ihn in den Stand setzte, ein Mittel auszufinden, wieder herab zu kommen. Über eine Stunde war er auf seinem schrecklichen Platze geblieben, als er plötzlich eine Stimme von unten hörte. Sie schien aus dem Gange zu kommen, der nach dem Thurme führte, und drang immer näher. Seine Unruhe stieg jetzt aufs höchste; denn er hatte keine Mittel sich zu vertheidigen, und während er in dieser qualvollen Erwartung blieb, fiel ein Lichtstrahl auf die Treppe unter ihm. Gleich darauf hörte er sich bey Nahmen nennen; seine Furcht verschwand; denn er kannte die Stimme der Madame und seiner Schwestern. In tödtlicher Angst hatten sie sein Zurückkommen erwartet, bis endlich alle Furcht für sie selbst sich in Besorgniß um ihn verlor, und sie, die noch vor einer Stunde um keinen Preis diesen Theil des Schlosses würden betreten haben, gingen jetzt unerschrocken hinein, um Ferdinanden aufzusuchen. Welches Gefühl, als sie seine gefährliche Lage entdeckten! — Das Licht setzte ihn jetzt in den Stand, den Ort genauer zu übersehen. Er sah, daß einige Steine von den herab gefallenen Stufen noch an der Mauer hingen, fürchtete sich aber, sich auf sie allein zu verlassen. Die Mauer war indessen zum Theile verfallen, und die Ecken halb abgebrochener Steine ragten an derselben hervor. An diese kleinen Stücke hing er sich mit Hülfe der halb abgebrochenen Stufen, und erreichte endlich sicher die untern Stiegen. Es wäre schwer zu sagen, wer von der Gesellschaft sich am meisten über seine Rettung freute. Der Morgen dämmerte an, und Ferdinand stellte fürs erste seine weitern Nachforschungen ein.
Diese mystischen Ereignisse hatten Julien so sehr beschäftigt, daß sie ihre Aufmerksamkeit von einem Gegenstande abzogen, der für ihren Frieden noch gefährlicher war. Doch schlich sich noch oft Vereza's Bild vor ihre Fantasie, erweckte die Erinnerung an jene glücklichen Gefühle, und lockte einen Seufzer hervor, den alle ihr Bemühen nicht unterdrücken konnte. Gern mochte sie der Schwermuth ihres Herzens in der Einsamkeit der Wälder nachhangen. Eines Abends ging sie mit ihrer Laute nach einem Plätzchen am Seeufer, überließ sich ganz einer süßen Melancholie, und ergoß sich in klagenden Tönen. Der Himmel war mit der Purpurröthe des Abends überzogen. Die Sonne, in Wolken von glänzenden unzählig schattirten Farben gehüllt, ging im Meere unter, in dessen Spiegelfläche ihr Glanz wiederstrahlte. Die Schönheit des Anblicks, das leise Murmeln auf den hohen Bäumen, deren Laub von der leichten Berührung des Zephyrs über ihr zitterte, das sanfte Plätschern der Wellen, die über das Ufer hinaus schäumten, versenkte ihre Seele in süßer Ruhe. Sie berührte die Saiten ihrer Laute, und sang ein Lied voll schwärmerischen Ausdrucks.
[Das im Original an dieser Stelle stehende Lied wurde von der Übersetzerin ausgelassen. Es lautet:
Evening
Evening veil'd in dewy shades,
Slowly sinks upon the main;
See th'empurpled glory fades,
Beneath her sober, chasten'd reign.
Around her car the pensive Hours,
In sweet illapses meet the sight,
Crown'd their brows with closing flow'rs
Rich with crystal dews of night.
Her hands, the dusky hues arrange
O'er the fine tints of parting day;
Insensibly the colours change,
And languish into soft decay.
Wide o'er the waves her shadowy veil she draws.
As faint they die along the distant shores;
Through the still air I mark each solemn pause,
Each rising murmur which the wild wave pours.
A browner shadow spreads upon the air,
And o'er the scene a pensive grandeur throws;
The rocks—the woods a wilder beauty wear,
And the deep wave in softer music flows;
And now the distant view where vision fails,
Twilight and grey obscurity pervade;
Tint following tint each dark'ning object veils,
Till all the landscape sinks into the shade.
Oft from the airy steep of some lone hill,
While sleeps the scene beneath the purple glow:
And evening lives o'er all serene and still,
Wrapt let me view the magic world below!
And catch the dying gale that swells remote,
That steals the sweetness from the shepherd's flute:
The distant torrent's melancholy note
And the soft warblings of the lover's lute.
Still through the deep'ning gloom of bow'ry shades
To Fancy's eye fantastic forms appear;
Low whisp'ring echoes steal along the glades
And thrill the ear with wildly-pleasing fear.
Parent of shades!—of silence!—dewy airs!
Of solemn musing, and of vision wild!
To thee my soul her pensive tribute bears,
And hails thy gradual step, thy influence mild.]
Ihr Gefühl überwältigte sie; die Laute entfiel ihrer Hand, und sie blieb stumm, verloren in den Empfindungen, welche die Musik und der Schauplatz in ihr erregten. Ein Seufzer, der sich durch die Bäume schlich, weckte sie aus ihrer Träumerey — sie richtete ihre Augen nach dem Orte, woher er kam, und sah Hippolytus. — Tausend süße und gemischte Regungen durchdrangen ihr Herz; kaum wagte sie ihren Augen zu trauen. Er trat hervor, und warf sich zu ihren Füßen. »Lassen Sie mich,« sagte er mit bebender Stimme, »Ihnen die Empfindungen entdecken, die Sie mir eingeflößt haben, und Ihnen die Weihe eines Herzens darbringen, das nur von Liebe und Bewunderung schlägt.«
»Stehen Sie auf, Graf!« sagte Julie, und hob sich mit Würde von ihrem Sitze empor; »diese Stellung geziemt weder Ihnen anzunehmen, noch mir zu dulden. Der Abend bricht an, und Ferdinand wird ungeduldig seyn, Sie zu sehen.«
»Nimmer, nimmer will ich aufstehen, Donna!« antwortete der Graf mit leidenschaftlichem Blicke; — »nimmer, bis —«
Die Erscheinung der Marquise, die in diesem Augenblicke ins Hölzchen trat, unterbrach ihn. Als sie den Grafen in dieser Stellung sah, wollte sie zurückgehen. — »Bleiben Sie, Madame!« rief Julie vor Scham halb versinkend. —
»Auf keine Weise,« antwortete die Marquise in spöttischem Tone; »meine Gegenwart würde nur eine sehr angenehme Scene unterbrechen. Der Graf wünscht, wie ich sehe, Ihnen am frühesten seine Begrüßung zu bringen.« — Mit diesen Worten verschwand sie, und ließ Julien verwirrt und beleidigt, und den Grafen aufs höchste aufgebracht, zurück. Er wollte den Gegenstand wieder anknüpfen; allein Julie folgte eilends der Marquise nach, und ging ins Schloß. Die Scene, von der sie Augenzeuginn war, erregte einen Aufruhr schrecklicher Bewegungen in dem Herzen der Marquise. Liebe, Haß, Eifersucht tobten abwechselnd in ihrer Brust, und bothen allem Zwange Trotz. Der wechselsweisen Gewalt derselben unterworfen, empfand sie einen herbern Schmerz, als sie noch je gefühlt hatte. Ihre Einbildungskraft, durch Widerstand nur noch mehr entflammt, erhöhte Hippolytus Reize; ihr Busen glühte von heißerer Leidenschaft, und ihr Gehirn wurde endlich beynahe bis zum Wahnsinne erhitzt. — In Julien erregte diese plötzliche unerwartete Zusammenkunft ein gemischtes Gefühl von Liebe und Schmerz, das nicht so bald nachließ. Endlich hob das entzückende Bewußtseyn von Vereza's Liebe sie über alle andern Empfindungen hinaus; die Scene vor ihr glänzte heller als je, und noch ein Mahl überwand ihre Fantasie jede Möglichkeit eines Übels. — Den ganzen Abend über zeichnete eine zärtliche und ehrerbiethige Aufmerksamkeit das Betragen des Grafen gegen Julien aus, die, in der gewissen Überzeugung, geliebt zu seyn, ihre Empfindung zu verhehlen beschloß, bis er ihr eine befriedigende Erläuterung seiner plötzlichen Abreise von Mazzini und seiner langen Abwesenheit gegeben hätte. Sie sah, daß die Marquise sie den ganzen Abend unablässig beobachtete, und vermied sorgfältig, dem Grafen eine Gelegenheit zu geben, den Gegenstand ihrer Unterredung wieder anzuknüpfen, der, so oft er sich ihr nahte, auf seinen Lippen zu schweben schien. — Die Nacht kehrte zurück, und Ferdinand verfügte sich in Juliens Zimmer, um seine Untersuchung fortzusetzen. Noch nicht lange war er daselbst geblieben, als der grausige, fremde Schall von unten sich aufs neue hören ließ. Der Umstand, der die Seelen der Schwestern in Schrecken versenkte, befeuerte Ferdinanden mit neuer Begierde; er ergriff eilends ein Licht, stürzte durch die Thür, und verschwand aus ihren Augen. — Er stieg in eben die wüste Halle hinab, durch die er den Abend zuvor gegangen war. Kaum hatte er die untern Stufen erreicht, als ein schwaches Licht durch die Halle schimmerte, und sein Auge den Schatten einer Gestalt auffaßte, die schnell durch die niedrige Thür, welche zum südlichen Thurme führte, davon eilte. Er zog sein Schwert, und drang vorwärts. Ein schwacher Laut erstarb längs dem Gange, dessen Krümmungen ihn verhinderten, die Gestalt, welche er verfolgte, zu sehen. In der That hatte er nur einen so flüchtigen Blick von ihr gehascht, daß er kaum wußte, ob sie eine menschliche Form hatte. Das Licht verschwand schnell, und er hörte die Thür, die zum Thurme führte, plötzlich zufallen. Er erreichte sie, zwang sie auf, stürzte hinein; aber der Ort war dunkel und einsam, und niemand schien hindurch gegangen zu seyn. Er sah den Thurm hinauf, und die Lücke auf der Treppe überzeugte ihn, daß kein menschliches Wesen hinauf gedrungen seyn konnte. Versteinert stand er da; er untersuchte mit forschendem Auge den Ort, nahm eine Thür wahr, welche die herüber hangende Treppe zum Theile verbarg, und die bis jetzt seiner Bemerkung entwischt war. Hoffnung verstärkte seine Begierde; allein seine Erwartung wurde schnell vereitelt, denn auch diese Thür war verschlossen. Vergebens versuchte er sie zu öffnen; er klopfte, und ein dumpfer, hohler Schall wiederhallte durch die Mauern und verlor sich in einiger Entfernung. — Er konnte nun nicht länger zweifeln, daß jenseit dieser Thüre Zimmer von großem Umfange seyn müßten; allein nach langen fruchtlosen Versuchen, hinein zu dringen, mußte er endlich abstehen, und verließ den Thurm eben so unwissend und weniger befriedigt, als er hinein gegangen war. Er ging in die Halle zurück, die er nun zum ersten Mahle frey überschaute. Es war ein großer verödeter Platz, dessen hohes gewölbtes Dach Pfeiler von schwarzem Marmor unterstützten. Der Fußboden so wie die Treppe waren von eben der Substanz. Die Fenster waren hoch und in gothischem Geschmacke. Eine stolze Größe, mit wunderbarer Wildheit vereint, charakterisirte diese Halle, an deren äußersten Ende einige gothische Wölbungen aufstiegen, welche den Raum dahinter dunkel beschatteten. Zur Linken sah man zwey Thüren; jede derselben war befestigt; und zur Rechten war der große Eingang von den Vorhöfen. Ferdinand beschloß den dunkeln Raum hinter der Halle zu untersuchen, und so wie er hindurch ging, vervielfachte seine erhitzte Einbildungskraft den Wiederhall seiner Fußtritte in gewisse Töne von fremder, furchtbarer Bedeutung. Er erreichte die Wölbungen, und entdeckte jenseit derselben eine Art von innerer Halle von beträchtlichem Umfange, die am äußersten Ende durch ein Paar massive Flügelthüren, schwer mit Schnitzwerk überladen, verschlossen war. Ein starkes Schloß hing davor, das seiner äußersten Stärke Trotz both. — Als er in schweigender Verwunderung den Platz übersah, stieg ein dumpfes Geheul unter dem Orte, wo er stand, empor. Sein Blut erstarrte; es ward wieder still, und da nichts sich weiter hören ließ, schrieb er den vermeinten Ton der Täuschung einer von Schrecken geschwängerten; Fantasie zu. Er machte noch einen Versuch, die Thür zu sprengen, als das Geheul dumpfer und gräßlicher, als zuvor, wiederhohlt ward. In diesem Augenblicke verließ ihn sein Muth; er verließ die Thür, und eilte zur Treppe, die er halb athemlos vor Entsetzen hinauf stieg. — Madame de Menon und seine Schwestern erwarteten mit peinlicher Angst seine Zurückkunft, und zwey Mahl getäuscht in seinem Bestreben, das Geheimniß dieser Gebäude zu durchdringen, des fruchtlosen Forschens müde, beschloß er, alle weitere Nachsuchung einzustellen. — Als er seinen Schwestern alle Umstände seines letzten Abenteuers noch erzählte, stieg ihr Schrecken dermaßen, daß er alle Rücksichten der Klugheit überwältigte. Ihre Furcht vor des Marquis Zorn verlor sich in einem stärkern Gefühle, und sie beschlossen, nicht länger in Zimmern zu bleiben, die ihrer Fantasie nur Schreckbilder darbothen. Madame de Menon nicht minder beunruhigt, und bestürzter gemacht durch diese Kette seltsamer unerklärlicher Erscheinungen, widersetzte sich ihnen nicht länger. Man beschloß also, daß Madame morgendes Tags der Marquise, so viel nöthig war, ihre Furcht zu rechtfertigen, von der Sache sagen, ihr nur den Umstand mit der verborgenen Thür, und was unmittelbar damit im Zusammenhange stand, verhehlen, und dann ernstlich auf eine Veränderung der Zimmer dringen sollte. — Madame ging dem gemäß zur Marquise. Sie hörte die Nachricht Anfangs mit Verwunderung, und nachher mit Gleichgültigkeit an, und ließ sich herab, der Madame Vorwürfe zu machen, daß sie ihre jungen Zöglinge zum Aberglauben aufmunterte. Sie schloß damit, die erzählten Umstände zu bespotten, und erklärte, daß sie, wegen der vielen Besuche im Schlosse die Forderung auf keine Weise gewähren könnte. — Das Schloß war allerdings voller Besuche. Die vorigen Zimmer der Madame de Menon waren die einzigen leeren, und diese hatte man zum Vergnügen der Marquise, die nicht gewohnt war, ihre Wünsche dem Besten anderer aufzuopfern, prächtig aufgeputzt. Sie behandelte also die Sache obenhin, weil sie, im ernsthaften Lichte betrachtet, ihren neuen Plan des Vergnügens in Gefahr gesetzt haben würde. — Emilie und Julie aber waren zu ernsthaft beunruhigt, um den Bedenklichkeiten der Delicatesse zu gehorchen, oder sich so leicht abweisen zu lassen. Sie bewegten Ferdinanden, dem Marquis die Sache vorzutragen. — Während dessen hatte Hippolytus, der die Nacht in schlafloser Angst durchbrachte, mit schmerzlicher Ungeduld auf eine Gelegenheit geharrt, Julien die Leidenschaft, die in seinem Herzen glühte, deutlicher zu entdecken. Der erste Augenblick, wo er sie sah, hatte eine Bewunderung in ihm erregt, die seitdem zu einem zärtlicheren Gefühle gereift war. Der Umstand, der ihn so plötzlich nach Neapel rief, eine gefährliche Krankheit des Marquis von Lomelli, seines nächsten Verwandten, hatte ihn abgehalten, seine Liebe förmlich zu erklären. Ganz schweigend aber abzureisen, war ihm zu schwer, und ehe er dem Bothen folgte, der in der Nacht nach dem Balle ankam, ging er unter Juliens Fenster, und sang ihr seine Leidenschaft in den Tönen, die so tiefen Eindruck auf ihr Herz machten.
Als Hippolytus nach Neapel kam, lebte der Marquis noch; starb aber wenig Tage nach seiner Ankunft, und hinterließ dem Grafen die kleinen Besitzungen, welche die Verschwendung ihrer Vorfahren übrig gelassen hatte. — Das Geschäft, seine Rechte in Ordnung zu bringen, hatte ihn bis jetzt von Sicilien entfernt gehalten, wohin er einzig in der Absicht, seine Liebe zu erklären, kam. Er traf hier auf unerwartete Hindernisse. Die eifersüchtige Wachsamkeit der Marquise schien mit Juliens Delicatesse im Bunde zu stehen, ihm die Gelegenheit, die er so feurig wünschte, zu entziehen. — Als Ferdinand dem Marquis die Geschichte mit dem südlichen Gebäude vortrug, vermied er geflissentlich, der verborgenen Thür zu erwähnen. Der Marquis hörte eine Weile mit finsterm Schweigen der Geschichte zu; endlich aber nahm er eine mißfällige Miene an, und warf Ferdinanden vor, daß er auf leere Hirngespinste, die bloße Eingebungen einer furchtsamen Einbildungskraft wären, baute; — »Hirngespinnste,« fuhr er er fort, »die im schwachen Kopfe eines Weibes leicht Eingang finden können, welche aber die stärkere Seele des Mannes verachten sollte. Entarteter Knabe! belohnest du so meine Sorgfalt? Muß ich erleben, meinen Sohn zum Spiele jedes schalen Weibermährchens gemacht zu sehen? Lerne deiner Vernunft und deinen Sinnen trauen, und dann wirst du meiner Achtung würdig seyn.«
Mit diesen Worten wollte der Marquis fortgehen und Ferdinand fühlte nun, daß es nothwendig war, ihm zu sagen, daß er ein Augenzeuge dessen, was er anführte, gewesen sey. »Noch einen Augenblick, mein Vater!« sagte er; »in dem letzten Punkte habe ich gehandelt, wie Sie mir in Zukunft zu thun vorschrieben. Meine Sinne sind die einzigen Zeugen gewesen, denen ich traute; ich habe die Töne gehört, an deren Wirklichkeit ich nicht länger zweifeln kann.« —
Der Marquis schien zu erschrecken. Ferdinand bemerkte die Veränderung, und führte seine Sache so nachdrücklich, daß der Marquis plötzlich eine feyerlich ernsthafte Miene annahm, und ihm befahl, gegen Abend in sein Cabinett zu kommen. — Als Ferdinand von dem Marquis ging, begegnete er Hippolytus. Er ging mit schnellen Schritten in dem Gange auf und ab; so bald er aber Ferdinanden sah, kam er auf ihn zu. »Ich bin herzenskrank,« sagte er klagend; »stehe mir mit deinem Rathe bey. Wir wollen in dieß Zimmer gehen, wo wir ungestört reden können.« — »Du kennst,« fuhr er fort; und warf sich in einen Stuhl, »du kennst die zärtlichen Empfindungen, welche deine Schwester mir eingeflößt hat. Ich beschwöre dich bey der heiligen Freundschaft, die uns seit so langer Zeit vereinigt, verschaffe mir eine Gelegenheit, ihr meine Liebe zu erklären. Ihr Herz, das andern Eindrücken so offen steht, ist, fürchte ich, der Liebe unempfänglich. Verschaffe mir aber wenigstens die Befriedigung, Gewißheit über einen Punct zu erhalten, wo die Qualen des Zweifels die schrecklichsten sind.«
»Dein Scharfsinn,« erwiederte Ferdinand, »hat dich einmahl verlassen, sonst würdest du dir die Qualen, worüber du klagest, ersparet, und entdeckt haben, was ich längst bemerkte, daß Julie dich nicht mit gleichgültigem Auge ansieht.«
»Mache nicht durch Schmeicheley die Vereitlung meiner Hoffnungen noch schrecklicher, und laß nicht die Parteylichkeit der Freundschaft dein Urtheil irre führen. Was du wahrgenommen haben willst, gab dir nur dein warmes Gefühl ein, und weil du denkest, daß ich ihre Aufmerksamkeit verdiene, glaubest du auch, daß ich sie besäße. Ach! du täuschest dich, aber mich nicht!« —
»Gerade das Gegentheil!« antwortete Ferdinand; »du selbst täuschest dich, oder vielmehr täuscht dich allzu besorgliche Liebe, die deiner Anerkennung einer Wahrheit, wobey deine Glückseligkeit so sehr im Spiele ist, entgegen wirket. Glaube mir, ich spreche nicht ohne Grund — wahrlich sie liebt dich!« —
Bey diesen Worten sprang Hippolytus von seinem Sitze auf, als wollte er Ferdinanden umarmen. »Bezaubernde Worte!« rief er mit leidenschaftlichem Entzücken, »könnte ich sie, dürfte ich sie glauben; o Gott! wie glücklich wäre ich!«— Bey diesem Ausrufe denke man sich Juliens Bewegung, die in dem angrenzenden Cabinette saß. Eine Thür, die in das Zimmer ging, in welchem dieses Gespräch gehalten wurde, stand halb offen. So großes Entzücken auch diese Erklärung bey ihr erregte, zitterte sie doch vor Furcht, entdeckt zu werden. Kaum wagte sie zu athmen, noch weniger zur andern Thür des Cabinetts hinaus auf den Gang zu gehen, von wo sie wahrscheinlich unbemerkt hätte entwischen können; allein sie fürchtete, ihr Fußtritt möchte sie verrathen. Gezwungen also zu bleiben, wo sie war, saß sie in peinlicher Angst, die keine Sprache abschildern kann. »Ach!« fuhr Hippolytus fort; »ich ließ zu geschwinde die Möglichkeit von dem zu, was ich wünsche. Wenn du willst, daß ich dir wirklich glauben soll, so bestätige durch Beweise, was du gesagt hast.«
»Von Herzen gern! sagte Ferdinand. — Juliens Herz klopfte schnell. — »Als du wegen der Krankheit des Marquis Lomelli so plötzlich nach Neapel gerufen würdest, habe ich ihr Betragen sorgfältig beobachtet, und die Empfindungen ihres Herzens darin gelesen. Den Morgen beym Frühstücke bemerkte ich auf ihrem Gesichte eine Unruhe, die ich nie zuvor gesehen hatte. Mit begieriger Erwartung, die eben so oft vereitelt wurde, bewachte sie die Thür, so oft jemand herein trat. Bey Tische wurde deiner Abreise gedacht — sie verschüttete den Wein, den sie an ihre Lippen bringen wollte, und blieb den ganzen Tag über niedergeschlagen und traurig. Ich sah ihr furchtloses Kämpfen, den Druck ihres Herzens zu verbergen. Von dieser Zeit an, ergriff sie alle Gelegenheit, sich von der Gesellschaft zurück zu ziehen. Die Fröhlichkeit, die noch vor kurzem sie bezaubert hatte, bezauberte sie nicht mehr; sie wurde tiefsinnig, stille, und oft habe ich sie an einem einsamen, entlegenen Orte die rührendsten Arien singen hören. Deine Zurückkunft brachte eine sichtliche, augenblickliche Veränderung hervor; sie hat jetzt ihre Heiterkeit wieder bekommen, und die süße Verwirrung auf ihrem Gesichte, so oft du erscheinst, könnte dich allein schon von der Wahrheit dessen, was ich sage, überführen.«
»O, sprich ewig so!« rief Hippolytus; — »diese Worte sind meiner Seele so süß, daß ich dir zuhören könnte, und die Grenzen der Zeit vergessen. — Ja, Ferdinand! ich zweifle nun nicht länger; süße Überzeugung öffnet meiner Seele eine Fluth von Entzücken, das ich noch nie kannte. O, führe mich zu ihr, daß ich die Empfindungen meines überströmenden Herzens vor ihr aushauchen kann!«
Sie standen auf, als Julie, in deren Herzen Scham und Entzücken abwechselnd kämpften, durch eine unwiderstehliche Furcht augenblicklicher Entdeckung getrieben, ebenfalls aufstand, und leise nach dem Gange eilte. Der Schall ihrer Tritte beunruhigte den Grafen, und besorgt, daß man ihn behorcht haben könnte, stürzte er in das Cabinett, um zu sehen ob jemand darin wäre, und — entdeckte Julien. Sie ergriff einen Stuhl, um ihren zitternden Körper zu unterstützen, und überwältigt von Scham und Verwirrung sank sie hinein, und verbarg ihr Gesicht in ihrem Kleide. Hippolytus warf sich zu ihren Füßen, ergriff ihre Hand, und drückte sie in seelenvollem Schweigen an seine Lippen. Einige Augenblicke verstrichen, ehe ihre gegenseitige Verwirrung ihnen zu sprechen erlaubte. Endlich bekam er Sprache wieder: »Können Sie, Donna! diese so unschuldige Überraschung vergeben? oder wird sie mich der Achtung berauben, die ich kühn genug war, zu hoffen,; und die ich mehr schätze, als das Daseyn selbst? O sprechen Sie meine Verzeihung aus! Lassen Sie mich nicht glauben, daß ein einziger Zufall meinen Frieden auf immer zerstört hat!« —
»Wenn Ihr Friede, Graf,« antwortete Julie mit bebender Stimme, von einer Überzeugung meiner Achtung abhangt, so ist er Ihnen bereits gesichert. Wenn ich sogar wünschte, Ihnen meine Empfindungen zu verhehlen, so würde es jetzt vergebens seyn, und ich kann es auch nicht mehr wünschen.«
Hippolytus konnte nur seinen Dank in heißen Küssen auf ihrer Hand ausathmen. — »O lassen Sie mich jetzt!« sagte Julie; »ich bedarf der Einsamkeit!« — Er wagte es nicht, sie zurück zu halten; sie verließ eilends das Cabinett, und ließ Hippolytus zurück, von der süßen Bestätigung seiner Wünsche beynahe überwältigt und Ferdinanden peinlich überrascht durch Juliens unerwarteten Anblick. Er fühlte, wie tief seine Unbehuthsamkeit ihre Delicatesse verwundet haben müßte, und daß keine Entschuldigungen ihr die Ruhe wieder geben würden, die er so grausam, obwohl unschuldig, tränkte.
Ferdinand erwartete die vom Marquis bestimmte Stunde mit ungeduldiger Neugier. Die feyerliche Miene, die er annahm, als er ihm befahl, zu ihm zu kommen, hatte sich seiner Seele tief eingeprägt. So wie die Zeit heran nahte, erhöhte sich seine Erwartung, und jeder Augenblick schien sich in Stunden zu verlängern. Endlich ging er in das Cabinett, wo nicht lange nach ihm der Marquis erschien. Seine Stimme war eben so zurück scheuchend feyerlich, als gestern. Er schloß die Thür des Cabinetts ab, setzte sich, und redete Ferdinanden in folgenden Worten an: »Ich bin jetzt im Begriffe, ein Vertrauen in dich zu setzen, welches ernstlich die Stärke deiner Ehre prüfen wird. Bevor ich dir aber ein Geheimniß offenbare, das bisher so sorgfältig verhehlt ward, und jetzt mit solchem Widerstreben gesagt wird, mußt du mir über diesen Gegenstand ewiges Schweigen schwören. Wenn du an deiner unverbrüchlichen Verschwiegenheit zweifelst, so sage es jetzt, und erspare dir die Schande und die unglücklichen Folgen, welche ein Bruch deines Eides über dich bringen muß. — Wenn du dich aber einer standhaften Beobachtung deines Versprechens fähig glaubst, so nimm die Bedingungen an, und empfange das Geheimniß!« —Ferdinand schauderte bey dieser Anrede; die Ungeduld der Neugierde wich auf einige Augenblicke, und er stand an, ob er auf solche Bedingungen ein Geheimniß annehmen sollte. Endlich bezeugte er seine Einwilligung; — der Marquis stand auf, und zog sein Schwert aus der Scheide. »Hier —«! sagte er, und hielt es Ferdinanden dar; »versiegle deine Gelübde. Schwöre bey diesem geheiligten Pfande der Ehre, nimmer zu wiederhohlen, was ich dir jetzt anvertrauen werde.«
Ferdinand neigte sich auf das Schwert, schlug feyerlich seine Augen zum Himmel auf, und schwor. Der Marquis setzte sich wieder auf seinen Platz, und fuhr fort: »Ich brauche dir nicht zu sagen, daß vor einem Jahrhunderte dieses Schloß im Besitz meines Großvaters, Vincent, dritten Marquis von Mazzini, war. Um diese Zeit herrschte ein aufgeerbter Haß zwischen unsrer Familie und den Della Campos. Es ist jetzt nicht die Zeit, mich über den Ursprung dieses Hasses auszulassen, oder die barbarischen Folgen desselben zu erzählen; genug, die Macht unsrer Familie setzte die Della Campos außer Stand, ihr voriges Gewicht in Sicilien zu behaupten, und sie verließen es, um in einem fremden Lande in ungestörter Sicherheit zu leben. —
Mein Großvater, der Ursache hatte, zu glauben, daß sein Feind Heinrich Della Campo ihm nach dem Leben trachtete, stellte Spione um ihn her. Er bediente sich einiger der vielen Banditen, die in seinem Dienste Schutz suchten, und nachdem sie einige Wochen auf eine Gelegenheit gelauscht hatten, ergriffen sie Heinrichen und brachten ihn insgeheim auf dieß Schloß. Er wurde eine Zeitlang in ein verborgenes Zimmer des südlichen Flügels eingesperrt, wo er umkam. — Durch was für Mittel, geziemt mir nicht zu erwähnen. Der Plan war so gut angelegt, und das Geheimniß wurde so strenge beobachtet, daß alles Bemühen der Familie, sein Verschwinden aufzuspüren, fruchtlos blieb. Wenn sie auch Verdacht auf unsre Familie hatten, konnten sie ihn doch durch keine Beweise unterstützen, und noch bis diesen Tag wissen die Della Campos die Art seines Todes nicht. Lange vor dein Tode meines Vaters ging ein Gerücht, daß die südlichen Gebäude des Schlosses von Geistern bewohnt würden. Ich glaubte nicht daran, und behandelte die Sache oben hin. Eines Nachts aber, als jedes menschliche Wesen im Schlosse, mich ausgenommen, in Ruhe lag, hatte ich solche starke und gräßliche Beweise der allgemeinen Behauptung, daß ich selbst diesen Augenblick nicht ohne Grausen daran denken kann. Laß sie mich, wo möglich vergessen! von dem Augenblicke an verließ ich diese Gebäude; sie sind seitdem immer verschlossen geblieben, und dieser Umstand ist die wahre Ursache, warum ich so wenig auf dem Schlosse gewohnt habe.«
Ferdinand horchte mit schweigendem Entsetzen dieser Erzählung zu. Er erinnerte sich an die Verwegenheit, womit er in jene Zimmer zu dringen gewagt hatte, an das Licht, an die Gestalt, an das unterirdische Winseln, und vor allem an seine Lage auf der Treppe im Thurme. Jede Nerve bebte in ihm, und die Schrecken der Erinnerung kamen beynahe denen der Wirklichkeit gleich. — Der Marquis erlaubte seinen Töchtern, ihre Zimmer zu vertauschen, band aber Ferdinanden ein, ihnen zu sagen, daß er bey Gewährung ihrer Bitte bloß ihre Ruhe Rathe zöge, und auf keine Weise von der Nothwendigkeit der Sache überzeugt sey. Sie wurden wieder in ihre vorigen Zimmer eingesetzt, und bloß das große Zimmer von Madame's Wohnung blieb für die Marquise, die den Marquis durch Spott und Klagen ihr Mißvergnügen fühlen ließ. Der Marquis warf insgeheim seinen Töchtern ihre kindischen Grillen, wie er es nannte, vor, und verlangte, daß sie das Schloß nie wieder damit beunruhigen sollten. Sie nahmen seinen Vorwurf mit schweigender Unterwerfung an, zu froh über die Erfüllung ihrer Bitte, um eine andere Empfindung, als Freude, fühlen zu können.
Wenn Ferdinand über diese letzte Entdeckung nachdachte, so kränkte ihn tief, was sich jetzt seinem Glauben aufzwang, daß er der Abkömmling eines Mörders war. Er wußte nun, daß unschuldiges Blut an den Mauern des Schlosses klebte, und daß sie noch immer die Wohnung eines unruhigen Geistes waren, der laut zu der Nachwelt um Rache über den zu schreyen schien, der seine ewige Ruhe zerstört hatte. Hippolytus sah seine Niedergeschlagenheit, und flehte ihn an, ihm seinen Kummer mitzutheilen. Allein Ferdinand, der bis jetzt frey und offen auch keinen Gedanken seiner Seele vor ihm verhehlt hatte, beobachtete jetzt ein unverbrüchliches Schweigen. »Dringe nicht auf eine Entdeckung von dem, was mir zu sagen verbothen ist; dieß ist der einzige Punct, worüber ich dich zu schweigen beschwöre; und auch selbst dieses kann ich dir nicht erläutern.«
Hippolytus erstaunte, und berührte die Sache nie wieder. — So beschämend auch die Umstände, welche Hippolytus ihre Liebe entdeckten, Anfangs für Julien waren, empfand sie doch, nachdem der erste Stoß vorüber war, eine mehr süße als schmerzhafte Regung. Dieses Gespräch hatte ihr in starken Farben die Liebe des Grafen gezeigt. Seine Zweifel, sein blödes Zögern, die Wirkung seines Verdienstes wahrzunehmen, sein Entzücken, als die Überzeugung endlich in seine Seele drang, sein Betragen, als er sie entdeckte, bewies ihr zugleich die Delicatesse und Stärke seiner Leidenschaft, und sie gab ihr Herz den Regungen eines reinen unvermischten Entzückens hin. Ein Befehl von dem Marquis, zu ihm in die Bibliothek zu kommen, schreckte sie aus diesem Taumel schwärmerischer Wonne auf. Ein so ungewöhnlicher Befehl überraschte sie, und sie gehorchte mit zitternder Erwartung. Sie fand ihn in tiefen Gedanken im Zimmer auf und abgehen, und hatte die Thür zugemacht, ehe er sie wahrnahm. Die ernste Strenge auf seinem Gesichte beunruhigte sie, und bereitete sie auf einen Gegenstand von Wichtigkeit vor. Er setzte sich zu ihr, und schwieg einen Augenblick. Endlich sagte er mit fest auf sie gehefteten Blicken: »Ich ließ dich rufen, mein Kind, um dir die Ehre kund zu thun, die auf dich wartet. Der Herzog von Luovo hat um deine Hand angehalten. Eine so glänzende Verbindung übersteigt meine Erwartung. Du wirst diesen Vorzug mit der Dankbarkeit aufnehmen, die er verdient, und dich zur Feyer der Hochzeit anschicken.«
Diese Rede drang wie der Pfeil des Todes in Juliens Herz. Ohne Bewegung versteinert und sprachlos saß sie da. Der Marquis bemerkte ihre Bestürzung, und mißdeutete die Ursache. »Ich gestehe,« sagte er, »daß die Sache etwas schnell zugegangen ist; allein die Freude, welche eine von deiner Seite so unverdiente Auszeichnung hervor bringen muß, sollte die kleinen weiblichen Schwachheiten, denen du zu einer andern Zeit immerhin nachhangen mögtest, überwinden. Geh, suche dich zu fassen, und bedenke« — setzte er mit finsterm Tone hinzu — »daß hier keine Zeit zu übertriebenen Scrupeln ist.«
Diese Worte weckten Julien aus ihrer schrecklichen Betäubung. »O Vater!« sagte sie, und warf sich zu seinen Füßen, »bedienen Sie sich nicht ihrer väterlichen Gewalt, mich zu zwingen, wo Gehorsam schrecklicher als Tod wäre; wo Gehorsam in der That unmöglich ist.« — »Lege diese kindische Ziererey ab,« sagte der Marquis; »und betrage dich, so wie es dir geziemt.«
»Vergeben Sie mir, Vater! mein Schmerz ist, ach! unerkünstelt. Ich kann den Herzog nicht lieben.«
»Fort! —« unterbrach sie der Marquis; — »reize nicht meinen Zorn durch so kindische, abgeschmackte Einwendungen.«
»O hören Sie mich, mein Vater!« sagte Julie, und Thränen stiegen in ihre Augen — »haben Sie Mitleiden mit den Qualen eines Kindes, das bis diesen Augenblick nie Ihre Befehle zu bestreiten gewagt hat.«
»Auch sollst du es jetzt nicht,« erwiederte der Marquis. »Was?wenn Ehre, Rang und Reichthum zu meinen Füßen gelegt werden, soll ich sie ausschlagen, weil ein thörichtes Mädchen, ein wahres Kind, das noch nicht Gutes und Böses zu unterscheiden versteht, weint, und sagt: daß sie nicht lieben kann? — Ich mag nicht weiter daran denken — mein gerechter Zorn könnte vielleicht die Schonung überlaufen, und mich reizen, deine Thorheit zu züchtigen. Nur noch ein Wort! — du heirathest den Herzog, oder verläßt dieses Schloß auf immer, und irrest, wohin du willst.« Mit diesen Worten riß er sich los, und Julie, die weinend an seinen Knien gehangen hatte, fiel auf die Erde nieder. Ihr heftiger Fall vermehrte die Wirkung ihres Schmerzens, und halb ihrer Sinne beraubt, blieb sie eine lange Zeit liegen. Als sie wieder zu sich selbst kam, brach die Betrachtung ihres Elends mit einer Gewalt auf sie ein, welche aufs neue sie überwältigte. Endlich stand sie auf, und versuchte nach ihrem Zimmer zu gehen; kaum aber hatte sie den großen Gang erreicht, als Hippolytus herein trat. Ihre zitternden Glieder wollten sie nicht länger tragen; sie ergriff einen Pfeiler, um sich zu halten, und Hippolytus war mit aller Schnelligkeit kaum im Stande, sie vom Niedersinken abzuhalten. Die Blässe auf ihrem Gesichte erschreckte ihn, und ängstlich fragte er, was ihr fehle. Sie konnte ihm nur durch Thränen antworten, die keine Gewalt zurück zu halten vermochte, und sanft sich losmachend, schwankte sie in ihr Cabinett. Hippolytus begleitete sie an die Thür, wagte aber nicht weiter in sie zu dringen. In zärtlichem Stillschweigen drückte er ihre Hand an seine Lippen, und ging voll Qual und Unruhe zurück. — Julie gab sich ganz der Verzweiflung hin, und hing in der Einsamkeit dem Übermaße ihres Schmerzens nach. Ein so schreckes Elend hatte sich ihrer Einbildungskraft noch nie dargestellt. Die vorgeschlagene Verbindung würde ihr an sich selbst gehässig gewesen seyn, wenn auch ihr Herz keine frühere Liebe gekannt hätte; was mußte also jetzt ihr Elend seyn, da sie ihr Herz demjenigen gegeben hatte, der es so ganz verdiente, und ihre Liebe in so vollem Maße erwiederte. — — Der Herzog von Luovo war im Charakter dem Marquis sehr ähnlich. Liebe nach Macht war seine herrschende Leidenschaft; kein sanftes oder großmüthiges Gefühl milderte die Härte seiner Gewalt, oder lenkte seine Handlungen zum Wohlwollen. Nackte, unversteckte Tyranney war sein Entzücken. Zwey Mahl war er verheirathet gewesen, und die unglücklichen, seiner Herrschaft unterworfenen Weiber fielen als Schlachtopfer der langsamen, aber verzehrenden Hand des Kummers. Er hatte einen Sohn, der vor einigen Jahren der Tyranney seines Vaters entwischte, und seitdem nicht wieder gesehen ward. — Bey dem letzten Feste hatte der Herzog Julien gesehen, und ihre Schönheit machte einen so tiefen Eindruck aufs ihn, daß er um ihre Hand anhielt. Der Marquis, entzückt über die Aussicht zu einer Verbindung, die seiner Lieblingsleidenschaft so schmeichelhaft war, gewährte bereitwillig seine Einwilligung, und versiegelte sie unmittelbar mit einem Versprechen. — Julie blieb den Rest des Tages in ihrem Cabinette verschlossen, wo Madame und Emilie sich aufs zärtlichste bemühten, ihren Kummer zu mildern. Gegen Abend kam Ferdinand. Hippolytus, über ihre Abwesenheit erschrocken, hatte ihren Bruder gebethen, sie zu besuchen, ihren Kummer zu besänftigen, und wo möglich die Ursache zu erforschen. Ferdinand, der seine Schwester zärtlich liebte, gerieth über Hippolytus Worte in die äußerste Unruhe, und suchte sie sogleich auf. Ihre Augen waren vom Weinen angeschwollen, und ihr Gesicht sprach nur zu deutlich die Angst ihrer Seele aus. Ferdinands Schmerz, als sie ihm ihres Vaters Erklärung sagte, war kaum schwächer, als der ihrige. Er hatte sich an der Hoffnung geweidet, die Schwester seines Herzens mit dem Freunde, den er liebte, zu vereinigen. Eine Handlung barbarischer Gewalt sollte nun den Feentraum von Glückseligkeit zerstören, den seine Fantasie geschaffen hatte, und den Frieden derer vernichten, die seinem Herzen am theuersten waren. Lange saß er schweigend und niedergeschlagen da; endlich starrte er aus seiner melancholischen Träumerey auf, wünschte Julien gute Nacht, und ging zu Hippolytus, der voll ängstlicher Ungeduld in der nördlichen Halle auf ihn wartete.
Ferdinand fürchtete die Wirkung der Verzweiflung, welche diese Nachricht in Hippolytus Seele hervor bringen würde. Er sann auf Mittel, die schreckliche Wahrheit zu mildern; allein Hippolytus, schnell das Übel zu ahnden, welches Liebe ihm fürchten lehrte, ergriff auf ein Mahl die Wahrheit. »Sage mir alles,« sprach er mit angenommener Festigkeit; »ich bin auf das Schlimmste gefaßt.«
Ferdinand eröffnete ihm nun den Entschluß des Marquis, und Hippolytus versank in einen Schmerz, der aller Kraft des Trostes, so sehr sie auch aufgebothen ward, Trotz both.
Julie zog sich endlich in ihr Schlafzimmer zurück; allein der Kummer, der auf ihrer Seele lag, verscheuchte den Segen des Schlafes von ihr. Mit zerrütteter Fantasie, rastlos stand sie auf, und öffnete leise das Fenster ihres Zimmers. Die Nacht war stille, und auch nicht ein Lüftchen trübte die Spiegelfläche des Wassers. Der Mond schüttete einen milden Strahl auf die Wellen herab, die in sanften Krümmungen auf dem Sande hinwallten. Unmerklich wiegte die Scene ihre Geister in Ruhe ein; eine stille, süße Melancholie goß sich über ihre Seele aus, und in gefühlvolles Sinnen versenkt, hörte sie das Plätschern entfernter Ruder. Einen Augenblick nachher sah sie ein kleines Boot auf der hellen Fläche des Wassers. Der Schall der Ruder hörte auf, und eine feyerliche Harmonie — so wie die Fantasie sie von den Wohnungen der Seligen herab weht — schlich sich durch das Schweigen der Nacht. Ein Chor von Stimmen schwoll jetzt durch die Lüfte, und erstarb in der Ferne. Julie erkannte die mitternächtliche Hymne an die Jungfrau, und heilige Begeisterung füllte ihr Herz. Der Chor wurde wiederhohlt, von dem feyerlichen Getöne der Ruder begleitet. Ein Seufzer himmlischer Andacht schlich sich aus ihrem Busen. Es ward stille. Die göttliche Melodie hatte den Tumult ihrer Seele eingewiegt, und sie sank in süße Ruhe. — Durch einen leichten Schlummer erquickt, stand sie früh Morgens auf; allein die Erinnerung an ihre traurige Lage kehrte bald mit erneueter Stärke wieder, und siechende Schwäche überwältigte sie. In diesem Zustande erhielt sie eine Bothschaft vom Marquis, sogleich zu ihm zu kommen. Sie gehorchte, und er befahl ihr, sich anzuschicken, den Herzog zu empfangen, der diesen Morgen aufs Schloß kommen würde. Er hieß sie, sich reich kleiden, und ihn freundlich bewillkommen. Julie unterwarf sich schweigend. Sie sah, daß der Marquis unwiderruflich entschlossen war, und zog sich zurück, um der Angst ihres Herzens freyen Lauf zu lassen, und sich auf diese verabscheute Zusammenkunft vorzubereiten.
Die Glocke hatte zwölf geschlagen, als ein Trompetenstoß die Annäherung des Herzogs verkündigte. Juliens Herz sank bey dem Schalle, und bestürmt von bittern Gefühlen, warf sie sich auf den Sopha hin. Bald rief eine Bothschaft vom Marquis sie ab. Sie stand auf, umarmte zärtlich Emilien, und vereint flossen ihre Thränen. Endlich rief sie alle ihre Stärke auf, und ging in die Halle herab, wo der Marquis ihr entgegen kam. Er führte sie in den Saal, wo der Herzog saß, hielt ein kurzes Gespräch, und ließ sie mit ihm allein. Juliens Bewegung in diesem Augenblicke übertraf alles, was sie noch gelitten hatte; plötzlich aber gab eine unerwartete Stärke, welche die Macht des äußersten Unglücks uns zuweilen gibt, nach der aber sein geringerer Grad von Schmerz vergebens strebt, ihr ihre Fassung wieder, und setzte sie in ihre natürliche Würde wieder ein. Sie erstaunte über sich selbst, und faßte den gefährlichen Entschluß, sich der Großmuth des Herzogs anzuvertrauen, ihm ihre Abneigung gegen die Verbindung einzugestehen, und ihn zu bitten, von seiner Bewerbung abzulassen.
Der Herzog trat mit einer Miene stolzer Herablassung zu ihr, faßte sie bey der Hand und setzte sich neben sie. Nach einigen steifen und allgemeinen Lobsprüchen ihrer Schönheit ging er weiter, und erklärte sich als ihren Bewunderer. Sie hörte einige Zeit seinen Erklärungen zu, und als er geneigt schien, sie reden zu lassen, wendete sie sich an ihn.
»Ich erkenne, wie ich soll, gnädiger Herr! die Ehre, die Sie mir antragen, und muß bedauern, daß ehrerbiethige Dankbarkeit die einzige Empfindung ist, die ich Ihnen zurück zu geben vermag. Nichts kann stärker mein Vertrauen in Ihre Großmuth beweisen, als daß freye Geständniß, daß väterliche Gewalt mich zwingt, meine Hand zu geben, wo mein Herz sie nicht begleiten kann.« Sie hielt inne; der Herzog schwieg — »Nur Sie, gnädiger Herr!« fuhr sie fort, »können aus einer so quälenden Lage mich befreyen; und an Ihre Güte und Gerechtigkeit wende ich mich, überzeugt, daß Nothwendigkeit mein sonderbares Betragen entschuldigen wird, und daß Sie mich nicht vergebens werden stehen lassen.«
Der Herzog war verlegen; eine fliegende Röthe des Stolzes überzog sein Gesicht, und er kämpfte sichtlich, die Empfindungen zurück zu halten, die sein Herz anschwellten.
»Ich war auf eine ganz andere Aufnahme vorbereitet,« sagte er, »und gestehe, ich glaubte nicht Ursache zu haben, zu erwarten, daß der Herzog von Luovo vergebens seufzen würde. Da Sie aber gestehen, Madame, daß Sie bereits über Ihre Neigungen bestimmt haben, werde ich gewiß sehr bereitwillig seyn, wenn der Marquis mich von unsern gegenseitigen Verpflichtungen frey sprechen will, Sie einem begünstigteren Liebhaber zu überlassen.«
»Verzeihen Sie, gnädiger Herr!« sagte Julie erröthend, »erlauben sie mir, Ihnen zu versichern —«
»Ich lasse mich nicht so leicht täuschen, Madame!« unterbrach sie der Herzog. — »Ihr Betragen kann nur aus einer frühern Neigung entspringen; und obgleich dieser Umstand bey einem so jungen Frauenzimmer allerdings ein wenig sonderbar ist, so habe ich doch zuverlässig kein Recht, Ihre Wahl zu censiren. Erlauben Sie mir, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen.« Er verneigte sich tief und ging aus dem Zimmer. Julie fühlte nun eine neue Pein; sie fürchtete den Zorn des Marquis, wenn er ihre Unterredung mit dem Herzoge erführe, dessen Charakter sie nur zu gut beurtheilte, um nicht das in ihn gesetzte Vertrauen zu bereuen. — Der Herzog ging, als er Julien verließ, zu dem Marquis, mit dem er sich einige Stunden lang unterhielt. So bald er das Schloß verlassen hatte, ließ der Marquis seine Tochter rufen, ergoß seinen Zorn gegen sie in den heftigsten Drohungen und mit aller Bitterkeit der Verachtung. Er verspottete ihre Verschenkung ihres Herzens in so harten Ausdrücken, drohte ihr so schreckliche Ahndung ihres Ungehorsams an, daß sie sich kaum in seiner Gegenwart sicher glaubte. Zitternd und betroffen stand sie da und hörte seine Vorwürfe an, ohne Vermögen, eine Antwort hervor zu bringen. Endlich sagte er ihr, daß die Hochzeit am dritten Tage vom heutigen an sollte gefeyert werden, und so wie er das Zimmer verließ, kam eine Fluth von Thränen ihr zu Hülfe, und befreyte sie von einer Ohnmacht.
Julie brachte den übrigen Tag in ihrem Cabinette mit Emilien hin. Die Nacht kam wieder, brachte aber ihr keinen Frieden mit. Lange, nachdem Emilie fort war, saß sie noch da, nahm ein Buch in die Hand, um ihren Gedanken zu entgehen, und bemühte sich die Empfindungen wieder aufzuregen, welche vormahls das Lesen desselben in ihr hervor gebracht hatte. Sie schlug eine Stelle auf, deren zärtlicher Ausdruck mit ihrer Lage sympathisirte, und ihre Thränen flossen aufs neue. Bald trat Furcht an die Stelle des Schmerzens. Eine Todesstille hatte bisher im Schlosse geherrscht, die nur zu Zeiten vom Winde unterbrochen wurde, der in tiefen Tönen durch die langen Gänge pfiff. Jetzt glaubte sie einen Fußtrit an ihrer Thüre zu hören; gleich darauf aber war alles stille; und sie glaubte, daß der Wind sie getäuscht hatte. Der Augenblick nachher aber überzeugte sie, daß sie nicht geirrt hatte; sie hörte deutlich in der Gallerie leise flüstern. Ihr Muth, den der Kummer bereits geschwächt hatte, verließ sie; gleich nachher rief eine leise Stimme sie bey Nahmen, und Ferdinand öffnete die Thür. — Sie schrie und sank um. Als sie sich wieder erhohlte, fand sie sich in Ferdinands und Hippolytus Armen, die sich diesen Augenblick der Stille und Sicherheit zu Nutze gemacht hatten, sich zu ihr zu schleichen. Hippolytus kam, um ihr einen Vorschlag zu thun, den die Verzweiflung allein eingehen konnte.
»Fliehen Sie, meine Julie!« sagte er, »von der Gewalt eines Vaters, der seine Macht mißbraucht, und behaupten Sie die Freyheit der Wahl, welche die Natur ihnen angewiesen hat. Lassen Sie den verzweifelnden Stand meiner Hoffnungen die anscheinende Kühnheit dieser Bitte entschuldigen, und lassen Sie den Mann, der nur für Sie lebt, das Mittel seyn, Sie vom Verderben zu retten. Ach Julie! Sie schweigen; vielleicht habe ich durch diesen Vorschlag das Vertrauen verscherzt, welches zu besitzen ich noch vor wenig Tagen mir schmeichelte. Wenn das ist, so will ich mich schweigend meinem Geschicke unterwerfen, und morgen einen Aufenthalt verlassen, der meiner Seele nur Bilder der Qual darbiethet.«
Julie konnte nur durch Thränen antworten. Ein Gewühl starker und streitender Leidenschaften kämpfte in ihrer Brust, und raubte ihr die Kraft zu sprechen. Ferdinand unterstützte des Grafen Vorschlag.
»Es wäre überflüssig, meint Schwester!« sagte er, »dir das Elend zu schildern, welches hier deiner wartet. Ich liebe dich zu zärtlich, um dich geduldig dem Ehrgeize und einer noch verhaßteren Leidenschaft aufgeopfert zu sehen. Ich setze meinen Stolz darein, Hippolytus meinen Freund zu nennen; laß mich nicht lange mehr zögern, ihn als Bruder zu begrüßen. Ich kann keinen stärkern Beweis meiner Achtung für seinen Charakter darbringen, als diesen Wunsch. Glaube mir, er hat ein Herz, des deinigen werth, edel und groß, wie dein eignes.«
»O Ferdinand!« — sagte Julie;—— »höre auf von einem Herzen zu reden, dessen Werth ich innig empfinde. Deine Güte und sein Verdienst können nie von der vergessen werden, an deren Schicksal du so großmüthigen Antheil nimmst.«
Sie hielt inne, und sann schweigend nach. Ein Gefühl von Delicatesse verzögerte die Entscheidung, wozu ihr Herz sie drängte. Wenn sie mit Hippolytus floh, so entging sie einem Übel, um dem andern in die Arme zu stürzen. Sie entfloh dem schrecklichen Geschicke, welches ihrer wartete, mußte aber vielleicht den Ruf beflecken, der ihr theurer als das Daseyn war. In einer Seele, wie die ihrige, hoch empfänglich für den Stolz der Ehre, vermochte diese Furcht jeder andern Rücksicht entgegen zu wirken, und sie zwischen peinlichen Zweifeln hin und her zu treiben. Sie seufzte tief, und schwieg noch immer. Die qualvolle Verwirrung auf ihrem Gesichte stürzte Hippolytus in die schrecklichste Unruhe. »O meine Julie!« rief er; »befreyen Sie mich von dieser fürchterlichen Ungewißheit! — reden Sie mit mir — erläutern Sie dieses Stillschweigen.« Sie blickte ihn klagend an; ihre Lippen bewegten sich, aber kein Laut drang hervor: als er seine Bitte wiederhohlte, winkte sie mit der Hand, und sank in ihren Stuhl zurück. Sie sank in keine Ohnmacht, aber in einen Zustand starrer Betäubung, der nicht weniger beunruhigend war. Die Wichtigkeit der Frage, die sie beantworten sollte, hatte ihrer schon von Kummer überwältigten Seele die Besinnung geraubt. In unaussprechlicher Angst hing Hippolytus über ihr, und Ferdinand wiederhohlte umsonst ihren Nahmen. Endlich stieß sie einen tiefen Seufzer aus, richtete sich auf, und blickte, als aus einem tiefen Traume erwachend, um sich her. Hippolytus dankte Gott mit heißer Empfindung.
»Sagen Sie mir nur, daß Sie wohl sind,« rief er, »Seele meines Lebens! und daß Sie mir nicht zu hoffen verbiethen, und wir wollen Ihre Ruhe nicht länger stören.«
»Meine Schwester!« sagte Ferdinand, »zieh deine eignen Wünsche zu Rathe, und überlaß das Übrige mir. Laß dein Vertrauen auf mich die Zweifel zertheilen, die auf deinem Herzen liegen.«
»Ferdinand!« sagte Julie mit Wonne, »wie soll ich dir das Gefühl des Danks ausdrücken, das deine Güte in mir erregt hat?«
»Du wirst mir deinen Dank,« antwortete er, »am besten beweisen, wenn du deine eignen Wünsche zu Rathe ziehst. Sey versichert, daß alles was, nur deine Glückseligkeit befördert, wesentlich zu der meinigen beyträgt. Laß nicht die Vortheile der Erziehung dich elend machen. Glaube, daß eine Wahl, bey der das Glück oder Elend deines ganzen Lebens auf dem Spiele steht, nur durch dich selbst entschieden werden muß.«
»Laß uns jetzt,« sagte Hippolytus, »nicht weiter auf diesen Gegenstand dringen — Sie bedürfen der Ruhe, meine Julie! und ich will nicht, daß meine eigennützige Ungeduld Sie länger davon zurück halte. Gewähren Sie mir nur diese einzige Bitte, daß ich morgen Nachts um diese Stunde wieder hierher kommen darf, um mein Urtheil zu empfangen.«
Julie willigte ein, ihn und Ferdinand anzunehmen, und sie verließen sogleich das Cabinett. Als sie sich in den großen Gang drehten, erschraken sie, ein Licht zu sehen, das auf die Wand strahlte, die ihre Aussicht hemmte. Es schien von einer Thür zu kommen, die auf eine schwarze, steinerne Treppe ging. Sie schritten eilends darauf los; aber es war fast augenblicklich verschwunden, und auf der Treppe war alles stille. Sie trennten sich nun, und gingen in ihre Zimmer, allerdings unruhig über einen Umstand, der sie argwöhnen ließ, daß ihr Besuch bey Julien bemerkt war. — Julie brachte die Nacht in unterbrochenem Schlummer Das Original hat hier »ununterbrochenem Schlummer«, was nur einer von zahlreichen Satzfehlern ist; in der englischen Originalausgabe ist von »broken slumbers« die Rede. — Anm.r.Hrsg., und ängstlichem Nachsinnen hin. Die Krisis ihres Schicksals hing an ihrer jetzigen Entscheidung. Ihr Bewußtseyn, welchen Einfluß Hippolytus über ihr Herz behauptete, machte sie furchtsam, dem Triebe desselben zu folgen, der ihr Urtheil bestechen konnte. Sie schrak vor dem schimpflichen Gedanken einer Flucht zurück; und doch sah sie kein Mittel diese zu vermeiden, außer sich in das Schicksal zu stürzen, das schrecklich über ihrer Einbildungskraft hing.
In der folgenden Nacht, als die Einwohner des Schlosses sich zur Ruhe gelegt hatten, erschien Hippolytus, dessen Ungeduld die Stunde in Jahrhundert ausdehnte, von Ferdinand begleitet, im Cabinett. Julie, die seit sie von ihr gingen, keinen Augenblick der Ruhe gekannt hatte, empfieng sie mit großer Bewegung. Der lebhafte Glanz der Gesundheit war von ihren Wangen geflohen, und eine matte Blässe, weniger schön, aber tiefer rührend, war an seine Stelle getreten. Sie antwortete nichts auf Hippolytus feurige Fragen, lächelte schwach durch Thränen hin, reichte ihm ihre Hand, und verhüllte ihr Gesicht in ihrem Gewande. »Ich empfange diese theure Hand«, rief er, und warf sich vor ihr hin; »ich empfange sie als das Pfand meiner Glückseligkeit, — aber lassen Sie Ihre Lippen das Geschenk bestätigen!«
»Wenn dieses Geschenk mich in Ihrer Achtung nicht herab setzt«, sagte Julie mit leiser Stimme —»so ist diese Hand die Ihrige auf ewig.« — »Herabsetzen? o meine Geliebte — bey diesem zärtlichen Nahmen darf ich Sie jetzt nennen — dieses Geschenk würde, wenn es möglich wäre, meine Achtung vermehren. Da aber diese keines Zuwachses mehr fähig ist, so kann sie nur meine Meinung von mir selbst erhöhen, und meinen Dank gegen Sie vergrößern; einen Dank, den ich durch die innigste Sorgfalt für Ihr Glück, durch die zärtliche Aufmerksamkeit eines ganzen Lebens, zu zeigen mich bestreben werde. Von diesem gesegneten Augenblicke an«, fuhr er mit Entzücken fort, »laß mich als Weib dich begrüßen; laß auch von diesem Augenblicke an jede Spur des Kummers verwischen, und diese Thränen trocknen,« — indem er sanft ihre Wangen mit seinen Lippen berührte — »und nie, nie mögen sie wieder quellen!«
Ferdinands Dank und Freude vereinigte sich mit Hippolytus Zärtlichkeit, Juliens beunruhigte Lebensgeister zu besänftigen, und nach und nach ihre Fassung wieder herzustellen. — Sie berathschlagten nun über ihren Plan zur Flucht, bey dessen Ausführung keine Zeit zu verlieren war, weil die Vermählung mit dem Herzoge am übermorgenden Tage gefeyert werden sollte. Sie beschlossen also, ihren Plan, was er auch seyn möchte, in der folgenden Nacht auszuführen. Als sie aber vom ersten Feuer des Unternehmens zu genauerer Untersuchung herab stiegen, sahen sie bald die Schwierigkeiten desselben ein. Die Schlüssel des Schlosses hatte Robert, ein alter vertrauter Diener des Marquis, in Verwahrung, der sie alle Nächte in einem eisernen Kasten in seiner Kammer verwahrte. Sie durch eine List in die Hände zu bekommen, schien unmöglich zu seyn, und Ferdinand wagte es ungern, die Treue dieses Mannes zu bestechen, der seit vielen Jahren in des Marquis Diensten war. So gefährlich der Versuch auch war, zeigte sich doch kein andrer Ausweg, und sie sahen sich genöthigt, es darauf ankommen zu lassen. Es wurde also ausgemacht, daß Ferdinand und Hippolytus, wenn sie sich die Schlüssel verschaffen könnten, zu Julien ins Cabinett kommen sollten; daß sie dann sie ans Ufer brächten, von wo aus ein Boot, welches daselbst ihrer wartete, sie nach der gegen über liegenden Küste von Calabrien bringen sollte, woselbst ohne Furcht vor einem Überfalle die Vermählung gefeyert werden könnte. Weil aber Ferdinand sich durchaus nicht den Anschein geben durfte, dabey geholfen zu haben, so wurde beschlossen, daß er, so bald seine Schwester eingeschifft wäre, aufs Schloß zurück kehrte. Nach dieser Anordnung ihres Plans trennten sie sich bis auf die folgende Nacht, welche Hippolytus und Juliens Schicksal entscheiden sollte. Julie, deren Herz durch Ferdinands brüderliche Zärtlichkeit und Hippolytus Versicherungen beruhigt war, genoß nun einen kurzen Schlaf. Beym Anbruche des Tages erwachte sie neu gestärkt und in leidlicher Fassung. Sie legte die wenigen Kleidungsstücke, die sie bedurfte, zurechte, und brachte alles zur Abreise in Ordnung. Ein Gefühl von Großmuth rechtfertigte ihre Zurückhaltung gegen Emilien und Madame de Menon, in deren Treue sie keinen Zweifel setzen konnte, die sie aber zu zärtlich liebte, um ihnen die Schmach zuzuziehen, die auf sie gefallen seyn würde, hätte man entdeckt, daß sie zu ihrer Flucht behülflich gewesen wären. — Während dessen war das ganze Schloß in Bewegung. Die prächtigen Zurüstungen zur Hochzeitsfeyer beschäftigten alle Augen und Hände. Die Marquise ordnete das Ganze an, und ihre Betriebsamkeit zeigte, wie sehr sie diese Verbindung wünschte, und erregte einen Verdacht, daß sie die Hände dabey im Spiele gehabt hatte. So war also Julie zum vereinten Opfer des Ehrgeizes und sträflicher Liebe bestimmt! — — Juliens Fassung ging mit dem Tage zu Ende, dessen Stunden schwerfällig dahin geschlichen waren. So wie die Nacht anbrach, stieg ihre Angst über den Erfolg von Ferdinands Unterhandlung mit Robert auf einen peinlichen Grad. Ein Getümmel neuer Bewegungen drängte sich an ihr Herz und drückte ihre Lebensgeister nieder. Als sie Emilien gute Nacht wünschte, schien es ihr, als ob sie zum letzten Mahle sie sähe. Der Gedanke an die Entfernung, welche bald sie trennen würde, an die Gefahren, denen sie vielleicht entgegen ging, drang mit einem Heer wilder, furchtvoller Vorgefühle an ihre Seele. Thränen traten in ihre Augen, und es ward ihr schwer, ihre Bewegung nicht zu verrathen. Auch von ihrer mütterlichen Freundinn nahm ihr Herz ein zärtliches Lebewohl. Endlich hörte sie den Marquis in sein Zimmer gehen, und die Thüren von den Zimmern der Gäste eine nach der andern zu machen. Mit zitternder Aufmerksamkeit horchte sie auf den allmählichen Übergang vom Getümmel zur Ruhe, bis endlich alles stille war. — Sie hielt sich nun bereit fortzugehen, so bald Ferdinand und Hippolytus, auf deren Schritte im Gange sie ängstlich horchte, erscheinen würden, Die Schloßglocke schlug zwölf. Der Klang schien den Pfeiler zu erschüttern — Julie fühlte ihn auf ihrem Herzen nachbeben. — »Zum letzten Mahle höre ich dich!« seufzte sie. — Stille des Todes folgte. Sie horchte weiter; kein Schall traf ihr Ohr. Lange saß sie in einem Zustande angstvoller Erwartung, den keine Sprache beschreiben kann. Die Glocke schlug nach einander die einzelnen Viertel, und ihre Furcht stieg mit jedem neuen Schalle. Endlich hörte sie Eins schlagen. Dumpf hallte der Klang, und furchtbar für ihre Hoffnungen; kein Hippolytus, kein Ferdinand erschien. Furcht und getäuschte Hoffnung rissen sie nieder. Ihre Seele, welche Erwartung zwey Stunden lang in Spannung erhielt, gab sich jetzt der Verzweiflung hin. Leise öffnete sie die Thür ihres Cabinetts, sah hinaus auf den Gang — alles war einsam und stille. Es war nun gewiß, daß Robert sich geweigert hatte, ihnen behülflich zu seyn, und wahrscheinlich, daß er sie dem Marquis verrieth. Überwältigt von bittern Gefühlen, warf sie sich im ersten Wahnsinne der Verzweiflung aufs Sopha hin. Plötzlich glaubte sie ein Geräusch in der Gallerie zu hören, und als sie aufsprang, um näher zu lauschen, öffnete Ferdinand leise die Thür ihres Cabinetts. »Komm, meine Liebe!« sagte er; »die Schlüssel sind unser, und wie haben nicht einen Augenblick zu verlieren: unser Zögern war unvermeidlich; allein jetzt ist keine Zeit zu Erläuterungen.« Julie, halb betäubt, gab Ferdinanden ihre Hand, und Hippolytus, den sie kaum anzublicken wagte, folgte ihr nach. Sie kamen vor Madame's Zimmer vorbey, gingen mit leisem Schritte furchtsam und schweigend durch die Gallerie, und stiegen in die Halle hinab. Quer durch führte eine Thür durch verschiedene Wege zu einem entlegenen Theile des Schlosses, aus welchem eine geheime Thür auf die Mauern ging. Ferdinand führte alle Schlüssel bey sich. Sie riegelten die Hallenthür hinter sich zu, und gingen durch einen schmalen Gang, der auf eine Treppe stieß. — Sie stiegen herab, und kaum waren sie unten, als sie ein lautes Lärmen oben vor der Hallenthür, und gleich darauf viele Stimmen hörten. Julie fühlte kaum mehr, wo sie hintrat, und Ferdinand flog, eine Thür aufzuschließen, die ihnen den Weg versperrte. Er versuchte alle Schlüssel, und fand endlich den rechten; allein das Schloß war verrostet und wollte sich nicht umdrehen lassen. Ihre Angst war unbeschreiblich. Das Lärmen oben ward immer ärger, und es schien, als wenn die Leute die Thür sprengten. Hippolytus und Ferdinand versuchten umsonst, den Schlüssel umzudrehen. Ein plötzliche Krachen von oben überzeugte sie, daß die Thür nachgegeben hätte; voll Verzweiflung machten sie noch einen Versuch, und der Schlüssel brach im Schlosse ab.
Zitternd und erschöpft gab Julie sich für verloren. Sie hing sich an Ferdinanden; umsonst versuchte Hippolytus sie zu trösten — plötzlich hörte das Geräusch auf. Sie horchten und fürchteten, es erneut zu hören; allein zu ihrem äußersten Erstaunen blieb alles stille.
Sie hatten nun Zeit zu athmen und zu überlegen, wie sie ihre Flucht bewirken könnten; denn vom Marquis durften sie keine Barmherzigkeit erwarten. Hippolytus, der sich überzeugen wollte, ob die Leute wirklich die Thür oben verlassen hatten, war im Begriffe, die Treppe hinauf zu gehen; aber kaum hatte er die ersten Stufen betreten, als das Geräusch mit erneuter Heftigkeit ausbrach. Er zog sich schnell zurück, stieß mit aller Gewalt der Verzweiflung an die Thür unten, die ihnen den Weg versperrte; sie schien zu weichen, und auf einem zweyten Stoß von Ferdinand sprang sie auf. Sie hatten keinen Augenblick zu verlieren, denn sie hörten jetzt die Treppe herab kommen. Der Vorsaal, worin sie waren, ging in eine Art von Zimmer, aus welchem drey Wege liefen, wovon sie augenblicklich den ersten wählten. Eine neue Thür versperrte ihnen jetzt den Weg, und sie mußten stille stehen, während Ferdinand die Schlüssel versuchte.
»Um Gotteswillen! mach fort!« schrie Julie — »oder wir sind verloren! — O wenn dieß Schloß auch verrostet ist! — »Stille!« sagte Ferdinand. — Sie entdeckten nun, was Furcht sie zuvor nicht hatte wahrnehmen lassen, daß keine Schritte sie mehr zu verfolgen schienen, und daß alles wiederum stille war. Da nur ein Irrthum ihrer Verfolger, die ohne Zweifel den unrechten Weg genommen hatten, hieran Schuld seyn konnte, beschlossen sie, sich diesen Vortheil zu erhalten, und Ferdinand versteckte das Licht unter seinen Mantel. Die Thür ging auf; sie drangen durch, verwickelten sich aber in den Irrgängen des Orts, und wanderten vergebens umher, einen Ausweg zu finden. Oft standen sie stille um zu lauschen, und oft ließ die Fantasie sie Töne des Schreckens hören. Endlich kamen sie in den Gang, der, wie Ferdinand wußte, gerade zu einer Thür führte, die in den Wald ging. Frohlockend hatten sie bald die Stelle erreicht, welche ihnen Freyheit zusichern sollte. — Ferdinand drehte den Schlüssel um; die Thür that sich auf, und zu ihrer unaussprechlichen Freude sahen sie die graue Dämmerung. — »Jetzt, meine Julie, sind Sie sicher,« rief Hippolytus — »und ich glücklich!« —.—»Halt Niederträchtiger!— erst empfange den Lohn deiner Verrätherey!« — rief eine Stimme von außen; in eben dem Augenblicke fühlte Hippolytus ein Schwert in seinem Körper; er stieß einen Seufzer aus, und fiel zu Boden. — Julie schrie laut, und sank in Ohnmacht. Ferdinand zog seinen Degen, ging auf den Mörder los, dessen Gesicht jetzt der Schein der Laterne erhellte, und sah in ihm seinen Vater. — Der Degen fiel ihm aus der Hand, und mit schauderndem Entsetzen starrte er zurück. Augenblicklich umringten ihn des Marquis Leute, und ergriffen ihn, während der Marquis selbst Rache über sein Haupt ausrief, und ihn in den Schloßkerker zu werfen befahl. Die Bedienten des Grafen, die am Seeufer auf ihn gewartet hatten, hörten den Tumult, eilten herbey und sahen ihren geliebten Herrn verwundet und in seinem Blute sich wälzend. Unter lautem Jammergeschrey brachten sie ihn an Bord des Schiffs, das für ihn und Julien bereit stand, und segelten unverzüglich nach Italien auf. —
Als Julie ihre Sinne wieder erhielt, fand sie sich in einem kleinen Zimmer, dessen sie sich nicht erinnerte, und ihr Mädchen über ihr weinend. Die zurück kehrende Erinnerung brachte ihrer Seele ein Gewicht von Kummer mit, welches alle vorigen Begriffe von Leiden überstieg; und doch wurde ihr Elend durch die Nachricht, welche sie erhielt, noch erhöht. Sie hörte, daß Hippolytus leblos von seinen Leuten fortgetragen, daß Ferdinand auf Befehl des Marquis in einen Kerker gesperrt und sie selbst in einem abgelegnen Zimmer Gefangene war, aus welchem sie übermorgen in die Schloßkapelle geschleppt, und da dem Ehrgeize ihres Vaters und der abgeschmackten Liebe des Herzogs von Luovo aufgeopfert werden sollte. — Diese Zusammenhäufung von Leiden überwältigte jede Kraft in ihr, und stürzte sie in einen Zustand, der vom Wahnsinne nicht weit entfernt war. Niemand, außer ihrem Mädchen und dem Bedienten, der ihr Essen brachte, durfte sich ihr nähern. Emilie, die, obgleich durch Juliens anscheinenden Mangel von Vertrauen gekränkt, doch innig an ihrem Kummer Theil nahm, flehte, sie zu sehen; allein ihre Bitte wurde mit solcher Härte verweigert, daß sie es nicht wagte, sie zu wiederhohlen.
Ferdinand, in die Finsterniß eines Kerkers gehüllt, war allen schmerzhaften Erinnerungen des Vergangenen und der schrecklichen Vorahndung des zukünftigen Preis gegeben. Er hatte von dem Zorne des Marquis, dessen Leidenschaften alle wild und schrecklich waren, und der in seinem Gebiethe unumschränkt über Leben und Tod geboth, alles zu fürchten. Doch machte selbstsüchtige Besorgniß bald einem edleren Kummer Platz. Er klagte über Hippolytus Schicksal und Juliens Leiden. Er konnte die Vereitelung ihres Plans bloß Roberts Verrätherey zuschreiben, ob er gleich Ferdinands Wünschen dem Scheine nach mit großer Aufrichtigkeit und edelmüthiger Theilnahme an Juliens Schicksale entgegen gekommen war. An der zur Flucht bestimmten Nacht hatte er Ferdinanden die Schlüssel eingehändigt, und dieser eilte sogleich damit in Hippolytus Zimmer. Ein leises Geräusch, das von Zeit zu Zeit erneuet wurde, und sie überzeugte, daß jemand im Hause noch auf seyn müßte, hielt sie bis ein Uhr in demselben zurück. Dieses Geräusch entstand ohne Zweifel von den Leuten, die der Marquis auf die Wache gestellt hatte, und deren Wachsamkeit zu treu war, um die Flüchtlinge entwischen zu lassen. Da Robert die Schlüssel zur großen Thür und zu den Vorhöfen behalten hatte, war der Marquis des Orts, aus welchem sie zu entwischen dachten, gewiß, und war folglich im Stande, ihre Hoffnungen in eben dem Augenblicke, wo sie sich des Siegs freuten, zu vereiteln. Als die Marquise Hippolytus Schicksal erfuhr, machte die Rache eifersüchtiger Liebe den Regungen des Mitleids Platz. Ihre Rache war nun befriedigt, und sie konnte jetzt nur das unglückliche Schicksal eines Jünglings beklagen, dessen persönliche Reize sie eben so tief gerührt, als seine Tugend ihre Hoffnung vereitelt hatten. Immer ihrer Leidenschaft treu, und der Vernunft verschlossen, schüttete sie über die vertheidigungslose Julie alle Wuth aus, womit sie ein Unglück empfand, von dem jene die unschuldige Ursache war. Durch schlauen Gebrauch ihrer Macht hatte sie auf die Leidenschaften des Marquis so zu wirken gewußt, daß sie ihn rastlos im Verfolgen ehrgeiziger Zwecke, und unersättlich in der Rache seiner vereitelten Erwartung gemacht hatte. Allein die Wirkung ihrer Kunstgriffe überschritt ihre Absicht, und indem sie nur eine Nebenbuhlerinn ihrer Liebe aufopfern wollte, gab sie den Gegenstand selbst der Rache Preis.
Der Hochzeitsmorgen, Julien so furchtbar, und vom Marquis so ungeduldig erwartet, war nun angebrochen. Die Heirath sollte mit einem Glanze gefeyert werden, der die Freude, womit der Marquis sie vollziehen sah, bewies. Das Schloß war mit einer Pracht und Größe ausgeputzt, desgleichen man noch nie darin gesehen hatte. Der benachbarte Adel war zu einem Feste eingeladen, welches mit einem glänzenden Balle und Abendessen endigen sollte und die Thore sollten für alle, die an dem Feste Theil nehmen wollten, weit aufgerissen werden. Der Herzog zog bey guter Zeit, von einem zahlreichen Gefolge begleitet, ins Schloß ein. — Ferdinand hörte aus dem Kerker, worin die Strenge und Politik des Marquis ihn noch immer verhaftete, das laute Klirren der Hufe in dem Schloßhofe über ihm, das Rasseln der Wagenräder und alle das tumultuarische Geräusch, welches der Einzug des Herzogs verursachte. Er errieth die Ursache desselben nur zu wohl, und sie erweckte in ihm Gefühle, denen gleich, welche den verurtheilten Verbrecher durchbeben, wenn der Laut der Schreckenstöne, die seiner Hinrichtung vorher gehen, in seine Ohren dringet. — Wenn er fähig war, an sich selbst zu denken, so wunderte er sich, wie der Marquis seine Abwesenheit bey den Gästen entschuldigen würde. Indessen kannte er den leichtsinnigen Charakter des sicilianischen Adels zu wohl, um zu zweifeln, daß sie jede Geschichte, welche er erfände, bereitwillig glauben, und selbst, wenn sie die Wahrheit wüßten, nicht geneigt seyn würden, es merken zu lassen, um nicht die dargebothne Freude zu unterbrechen. — Der Marquis und die Marquise gingen dem Herzoge bis in die nördliche Halle entgegen, und führten ihn in den Saal, wo er einige Erfrischungen, die für ihn bereit standen, zu sich nahm, und dann in die Kapelle ging. Der Marquis ging hinauf, um Julien zum Altare zu führen, und Emilien war befohlen, sie an der Thüre der Kapelle zu erwarten, in welcher der Priester und eine zahlreiche Gesellschaft bereits versammlet waren. Die Marquise, eine Beute stürmender, einander verdrängender Leidenschaften, frohlockte in der nahen Vollendung ihres Lieblingsentwurfs — indessen war ihr eine Kränkung bereitet, welche auf ein Mahl den Triumph ihrer Bosheit und ihres Stolzes vereitelte. Der Marquis fand Juliens Gefängniß leer! — Wuth und Erstaunen überwältigten beynahe seine Vernunft; er rief alle Bedienten im Schlosse zusammen, und befragte sie um ihre Flucht, aber mit solcher Wuth und Heftigkeit, daß er ihnen keinen Raum zu antworten ließ. Sie konnten indessen nichts weiter sagen, als daß ihr Mädchen sich den ganzen Morgen nicht hätte sehen lassen. Im Gefängnisse fand man die Brautkleider, welche die Marquise selbst den Abend zuvor mit dem Befehle, sich früh Morgens bereit zu halten, an Julien herauf geschickt hatte, und folgende Zeilen, mit Bleyfeder geschrieben, an Emilien: »Lebe wohl, theure Emilie, nie wirst du deine unglückliche Schwester wieder sehen, die vor dem grausamen Schicksale, das jetzt für sie bereitet wird, flieht, überzeugt, daß nie ein noch schrecklicheres ihr zustoßen kann. In Glück oder Elend, in Hoffnung oder Verzweiflung — was auch dein Loos sey, erinnre dich immer meiner mit Liebe und Mitleid. Theure Emilie, lebe wohl! Mögest du, die du ewig die Schwester meines Herzens seyn wirst, nie die Gefährtinn meines Elends werden!« — Während der Marquis diesen Brief las, flog die Marquise, in der Vermuthung, daß irgend ein Widerstand von Julien an der Verzögerung Schuld sey, in das Zimmer. Auf ihren Befehl wurden alle bewohnbaren Plätze des Schlosses durchsucht, und sie selbst war dabey behülflich. Endlich drang die Nachricht, in die Kapelle, und die Bestürzung wurde allgemein. Der Priester stieg vom Altare, und die Gesellschaft kehrte in den Saal zurück. — Als Emilie den Brief erhielt, erregte er Empfindungen in ihr, die sie zu verbergen unmöglich fand, die aber dennoch sie nicht vor dem Verdachte schützten, daß sie um die Sache gewußt habe, und daß diese Zeilen nur Maske waren. — Der Marquis schickte unverzüglich Bediente auf den flüchtigsten Pferden aus seinem Stalle ab, mit Befehl, verschiedene Wege zu nehmen, und jeden Winkel der Insel nach der Flüchtigen zu durchsuchen. Durch diese Veranstaltungen einiger Maßen beruhigt, sann er nun nach, auf was Art Julie ihre Flucht bewirkt haben könnte. Sie war in ein kleines Zimmer in einem entlegenen Theile des Schlosses gesperrt gewesen, in welches niemand gelassen wurde, als ihr Mädchen und Robert, des Marquis vertrauter Bedienter. Selbst Lisette hatte nur in Roberts Begleitung hinein gehen dürfen, in dessen Zimmer seit jener unglücklichen Nacht die Schlüssel regelmäßig gebracht wurden. Ohne die Schlüssel konnte sie unmöglich entflohen seyn; denn die Fenster des Zimmers waren mit Gittern und Stangen verwahrt, und gingen sehr hoch von der Erde in einen innern Hof. Und außer dem allen, auf wessen Schutz konnte sie sich verlassen? Die Gehülfen ihrer ersten Flucht waren ganz außer Stande, ihr nur mit Rathe beyzustehen. Ferdinand war Gefangener, und Hippolytus war leblos an Bord eines Schiffs gebracht, das unverzüglich nach Italien absegelte. Robert, der die Schlüssel in Verwahrung gehabt hatte, wurde von dem Marquis scharf ins Verhör genommen. Er beharrte auf einer einfachen und gleichförmigen Erklärung seiner Unschuld; weil aber der Marquis es für unmöglich hielt, daß Julie ohne sein Mitwissen entwischt seyn könnte, wurde er in Verhaft gelegt, bis er die Sache würde bekannt haben. — Der Stolz des Herzogs war durch diese Flucht schmerzlich verwundet, welche Juliens äußerste Abneigung bewies, und die Schmach der abweisenden Erklärung, die er von ihr erhalten hatte, vollendet. Der Marquis hatte ihm ihren ersten Versuch zu entwischen, und ihre nachfolgende Verhaftung sorgfältig verhehlt; jetzt aber brach die Wahrheit durch die Verschleyerung, und stand in bitterer Nacktheit da. Der Herzog, voll Unwillen über des Marquis Falschheit, ergoß seinen Zorn in übermüthigen, bitteren Schmähungen, und der Marquis, den diese unglücklichen Umstände so schon in Galle gejagt hatten, war nicht in der Stimmung, seinem natürlichen Ungestüme Einhalt zu thun. Er antwortete mit Schärfe, und die Folgen würden sehr ernsthaft geworden seyn, hätten sich nicht die Freunde beyder Parteyen ins Mittel gelegt. Mit vieler Mühe söhnte man die Streitenden aus, und es wurde beschlossen, mit vereintem und unermüdetem Suchen Julien zu verfolgen, und so bald man sie fände, ohne Verzug die Hochzeit zu feyern. Dieses Betragen bestand vollkommen mit dem Charakter des Herzogs. Seine Leidenschaften, von vereitelter Hoffnung entflammt, und durch Widerstand nur erhöht, bothen jetzt allen Hindernissen Trotz; und die Betrachtungen, die in einem feinen, fühlenden Herzen seine ursprüngliche Neigung würden überwunden haben, vermehrten nur die Gewalt der seinigen.
Madame de Menon, die Julien mit mütterlicher Zärtlichkeit liebte, beobachtete mit inniger Theilnahme alles, was im Schlosse vorging. Sie hatte das grausame Schicksal, welches der Marquis seiner Tochter bestimmte, schmerzlich beklagt; doch konnte sie sich kaum freuen, daß Julie durch Flucht ihm entgangen war. Sie zitterte für die Sicherheit ihres Zöglings, und hatte keine Aussicht, die Ruhe, welche Bekümmerniß für das Schicksal anderer trübte, so bald wieder zu erlangen. — Die Marquise hatte längst einen geheimen Groll gegen Madame de Menon genährt, deren Tugend ein stiller Vorwurf für ihr eigenes Betragen war. Der Abstand ihrer Charaktere erregte in der Marquise eine Abneigung, die zur Verachtung gestiegen seyn würde, hätte nicht die Würde der Tugend, welche Madame's ganzes Betragen stämpelte, sie gezwungen zu fürchten, was sie verachten zu können wünschte. Ihr Gewissen flüsterte ihr zu, daß dieß Mißfallen gegenseitig sey, und sie weidete sich jetzt an der Gelegenheit, die sich von selbst darzubiethen schien, Madame's Charakter zu verschwärzen. Sie stellte sich also, als glaubte sie, Madame hätte Ferdinanden zum Ungehorsam gegen seinen Vater aufgemuntert, und wäre bey der Flucht behülflich gewesen; sie klagte sie dieser Vergehungen wegen an, und reizte den Marquis, ihr Betragen zu ahnden. Allein Madame de Menons Rechtschaffenheit durfte nicht ungeahndet geschmäht werden. Ohnedaß sie sich würdigte, auf die Anklage zu antworten, verlangte sie eine Stelle niederzulegen, deren man sie nicht länger würdig glaubte, und wollte ohne Verzug das Schloß verlassen. Dieses konnte die Politik des Marquis nicht zulassen, und er sah sich folglich genöthigt, ihr so reichliche Vergütung zu geben, daß sie sich bewegen ließ, noch für's Erste zu bleiben. — Die Nachricht von Juliens Entweichung kam endlich zu Ferdinands Ohren, dessen Freude darüber seiner Verwunderung gleich war. Er verlor auf einen Augenblick das Gefühl seines eignen Zustandes, und dachte nur an Juliens Flucht. Bald aber kehrte sein Kummer mit erneuter Stärke zurück, wenn er bedachte, daß es Julien vielleicht jetzt an dem Beystande gebräche, welchen ihr zu verschaffen einzig seine Gefangenschaft ihn abhalten konnte.
Die Bedienten, die ihr nachgeschickt waren, kamen ohne befriedigende Nachricht zurück. Woche nach Woche verstrich in fruchtlosem Forschen; dennoch beharrte der Herzog auf seinem Zwecke. Bothen wurden nach Neapel und nach den verschiedenen Gütern des Grafen Vereza geschickt; allein alle kehrten unverrichteter Sache wieder. Man hatte nichts von dem Grafen gehört, seit er von Neapel nach Sicilien ging. Während dieser Nachfragen brach ein neuer Gegenstand zur Unruhe im Schlosse Mazzini aus. In der Nacht, die für Hippolytus und Juliens Hoffnungen so unglücklich war, sah, nachdem der Tumult sich gelegt hatte, und alles still war, ein Bedienter, der vor dem Fenster von der großen Treppe vorbey nach seiner Kammer ging, ein Licht durch den schon erwähnten Fensterladen im südlichen Flügel schimmern. In dem Augenblicke, da er stille stand, um es zu beobachten, verschwand es und erschien bald darauf wieder. Die vorigen geheimnißvollen Umstände mit diesen Gebäuden fielen ihm ein, und von Verwunderung angefeuert, weckte er einige von seinen Kameraden, zu kommen, und diese wunderbare Erscheinung anzusehen. — Als sie in schweigendem Schrecken staunend da standen, sahen sie eine kleine Thür, die in den südlichen Thurm führte, offen, und eine Gestalt mit einem Lichte in der Hand heraus kommen, die längs den Schloßmauern hinschlich, und sich schnell vor ihrem Blicke verlor. Von Furcht ergriffen, liefen sie in ihre Kammern, und dachten sich alle die letzten wundervollen Ereignisse zurück. Sie zweifelten nicht, daß dieses die Gestalt sey, welche Fräulein Julie zuvor gesehen hatte. Die plötzliche Vertauschung von Madame de Menons Zimmern war ihnen nicht unbemerkt geblieben, und sie waren nun nicht länger ungewiß, welcher Ursache sie solche zuzuschreiben hätten. Sie erinnerten sich an alle die mancherley und sonderbaren Umstände mit diesem Theile des Gebäudes; und indem sie dieselben mit dem gegenwärtigen verglichen, wurde ihre abergläubische Furcht bestätigt, und ihr Schrecken zu einem solchen Grade erhöht, daß viele von ihnen sich entschlossen, den Dienst des Marquis zu verlassen. — Der Marquis, über diese plötzliche Verlassung erstaunend, fragte nach der Ursache, und erfuhr die Wahrheit. Voll Verdruß über diese Entdeckung beschloß er dennoch, wo möglich, den nachtheiligen Wirkungen vorzubeugen, die eine Verbreitung eines solchen Gerüchts nach sich ziehen könnte. Zu diesem Zwecke war es nothwendig, die Gemüther seiner Leute zu beruhigen, und sie zu verhindern, aus seinem Dienste zu gehen. Nachdem er ihnen ihre thörichte Furcht strenge verwiesen hatte, sagte er ihnen, um sie von der Ungründlichkeit ihres Argwohns zu überzeugen, wolle er sie in den Theil des Schlosses führen, der den Gegenstand ihrer Furcht in sich schließen sollte, und befahl ihnen, mit einbrechender Nacht sich in der nördlichen Halle zu versammeln. Emilie und Madame, über dieses Verfahren erstaunt, harrten in schweigender Erwartung auf den Ausgang. — Die Bedienten, des Marquis Befehlen gehorsam, versammelten sich Abends in der nördlichen Halle. Das wüste Ansehen dieser südlichen Gebäude, und der Umstand, daß sie seit so vielen Jahren verschlossen gewesen waren, konnten allein schon einen gewissen Schauder erregen, hätte auch nicht die Überzeugung dieser Leute, daß sie die Wohnung eines unruhigen Geistes wäre, sie mit Schrecken erfüllt. Der Marquis erschien jetzt mit den Schlüsseln in der Hand, und jedes Herz schlug von wilder Erwartung. Er befahl Roberten, mit einer Fackel voran zu gehen, und die andern Bedienten mußten ihm folgen. Ein Paar eiserne Thore wurden aufgemacht, und sie gingen durch einen Hof, der mit langem Grase bewachsen war, zu der großen Thür des südlichen Gebäudes. Hier fanden sie einige Schwierigkeit; das Schloß, welches seit vielen Jahren keinen Schlüssel gesehen hatte, war eingerostet. Während dieser Zwischenzeit versiegelte schweigende Erwartung Aller Lippen. Endlich sprang das Schloß auf; die Thür, welche seit so langer Zeit nicht geöffnet war, krachte schwer auf den Angeln, und zeigte die schwarze marmorne Halle, durch welche Ferdinand jene Nacht ging. »Jetzt« — rief der Marquis in spöttischem Tone, als er hinein trat — »erwartet die Geister zu treffen, von denen ihr mir sagtet; wenn es euch aber nicht gelingt, sie zu besiegen, so schickt euch an, meinen Dienst zu verlassen. Die Leute, die bey mir leben, sollen wenigstens Muth und Fähigkeit genug haben, mich vor diesen Geisteranfällen zu schützen. Das Einzige, was ich befürchte, ist, daß der Feind nicht erscheinen wird, und daß ihr keine Probe eurer Tapferkeit werdet ablegen können.« Keiner wagte zu antworten, alle aber folgten in schweigender Furcht dem Marquis, der die große Treppe hinaufstieg, und in die Gallerie ging. »Schließt diese Thür auf!« — sagte er, und zeigte auf eine Thür zur Linken — »und wir wollen bald die Geister aus ihrer Wohnung treiben.« — Robert steckte den Schlüssel hinein, seine Hand aber zitterte so heftig, daß er ihn nicht umdrehen konnte. — »Hier ist ein Bursch,« rief der Marquis, »der es mit einer ganzen Legion Geister aufnehmen kann; Anton! nimm du den Schlüssel, und versuche dein Heil!«
»Verzeihen Euer Gnaden,« antwortete Anton; »ich habe mich nie darauf verstanden, »Thüren aufzuschließen; aber hier Georg wird es können. —
»Halten Sie mir zu Gnaden!« — sagte Georg; — »ich bin wirklich zu ungeschickt; aber hier ist Richard.« —
»Laßt sehn!« sagte der Marquis: — »ich will eure Feigheit beschämen, und es selbst thun.« Mit diesen Worten schloß er auf, und wollte hinein dringen; allein die Thür wollte nicht aufgehen; sie schütterte unter seinen Händen, und es schien, als wenn jemand von der andern Seite sie hielte.Der Marquis wurde befremdet, und machte einige Versuche, zu öffnen; aber umsonst. Er befahl seinen Bedienten, sie aufzusprengen; sie sprangen alle zurück, und schrien mit einer Stimme: »um Gottes willen, gnädiger Herr! gehen Sie nicht weiter; wir sind zufrieden: es sind keine Geister da; lassen Sie uns nur zurück gehen.«
»Jetzt ist die Reihe an mir, zufrieden zu seyn,« antwortete der Marquis — »und bis ich es bin, soll keiner von euch von der Stelle! Öffnet mir die Thür!«
— »Gnädiger Herr!« —
»Nun!« — sagte der Marquis, und nahm eine finstere gebietherische Miene an — »streitet nicht gegen meine Befehle; ich will nicht mit mir spaßen lassen.«
Sie gingen nun vorwärts, und lehnten sich mit aller Gewalt an die Thür, als ein lautes, plötzliches Getöse von innen ausbrach, und durch die hohlen Zimmer wiederhallte. — Die Bedienten starrten erschrocken zurück, und wollten über Hals über Kopf die Treppe herunter stürzen, als des Marquis Stimme ihre Flucht aufhielt. Mit Todesangst klopfendem Herzen kamen sie zurück. — »Merkt, was ich sage,« redete der Marquis sie an — »und betragt euch nicht als Memmen. Jene Thür dort,« er zeigte auf eine entfernte Thür, — »wird uns durch andre Zimmer in dieses Gemach führen. Schließt sie also auf; ich will die Ursache dieses Getöses wissen.« — Voll Entsetzen über diesen Entschluß bathen sie den Marquis aufs neue, nicht weiter zu gehen, und er mußte seine ganze Autorität aufbiethen, um sie zum Gehorsam zu bringen. Die Thür wurde geöffnet, und führte zu einem langen schmalen Gange, in welchen sie durch einige Stufen herunter gingen. Er führte zu einer großen Gallerie, die bis zu einer schwarzen Treppe ging, wo sie verschiedene Thüren sahen, wovon der Marquis eine aufschloß. Oben zeigte sich ein geräumiges Zimmer, dessen verfallene und von der Feuchtigkeit entfärbte Wände einen traurigen Beweis von Verödung darbothen. — Sie gingen durch eine lange Reihe hoher, edler Zimmer, die in eben dem verfallenen Zustande waren, und erreichten endlich das Gemach, aus welchem das Getös hervor gegangen war. — »Geh mit dem Lichte voran!« sagte der Marquis zu Robert, als sie sich der Thüre näherten — »hier ist der Schlüssel.« Robert gehorchte zitternd, und die andern Bedienten folgten stille schweigend nach. Sie blieben einen Augenblick vor der Thür stehen, um zu horchen; aber alles blieb stille. Die Thür wurde aufgemacht, und zeigte ein großes gewölbtes Zimmer, denen gleich, durch die sie gekommen waren, und als sie rings um sich sahen, entdeckten sie auf ein Mahl die Ursache ihres Schreckens. Ein Theil des verfallenen Dachs war eingestürzt, und der Schutt und die Steine, die vor der Galleriethür lagen, versperrten den Weg. Sie sahen nun deutlich, woher das Getös, welches sie in so großen Schrecken gejagt hatte, entstanden war: die losen Steine, die gegen die Thür aufgethürmt lagen, hatten durch den Versuch, sie zu öffnen, einen Stoß bekommen, und waren den Boden hinunter gerollt. Nachdem sie den Ort durchsucht hatten, gingen sie wieder nach der schwarzen Treppe, die sie hinunter stiegen, und durch die Krümmungen eines langen Ganges wieder in die Marmorhalle kamen— »Nun,« — sagte der Marquis — »was denkt ihr jetzt? — Was für böse Geister bewohnen diese Mauern? Seyd also in Zukunft vorsichtiger, leeren Schattenbildern zu trauen; denn nicht immer möchtet ihr einen Herrn treffen, der sich herab läßt, euch die Augen zu öffnen.«
Sie gestanden des Marquis Güte ein, erklärten, daß sie von der Irrigkeit ihres gehabten Argwohns vollkommen überzeugt wären, und bathen, daß er sie nicht weiter möchte suchen lassen. — »Ich will eurer Einbildungskraft nichts übrig lassen,« — antwortete der Marquis — »damit sie euch nicht in der Folge zu einem ähnlichen Irrthume verleitet. Folgt mir! ihr sollt jeden Winkel dieser Gebäude sehen.« — Er führte sie nach dem südlichen Thurme. Sie erinnerten sich, daß die Gestalt, die sie gesehen hatten, aus einer Thüre des Thurms hervor gegangen war, und ungeachtet ihrer eben gegebenen Versicherung, daß ihr Argwohn aus dem Wege geräumt sey, schwebten sie noch immer in tödtlicher Furcht, und würden gern alle weiteren Nachsuchungen eingestellt haben. »Will einer von euch sich entschließen, diesen Thurm hinauf zu steigen?« sagte der Marquis, und zeigte auf die zerbrochene Treppe. »Was mich betrifft, ich bin nur sterblich und fürchte also ein Wagestück; ihr aber, die ihr mit entkörperten Geistern Gemeinschaft haltet, könnt vielleicht etwas von ihrer Natur annehmen, und ohne Furcht gehen, wo der Geist wahrscheinlich vor euch gegangen ist.« — Sie schämten sich über diesen Verweis, und schwiegen. Der Marquis wendete sich nach einer Thüre zur Rechten, und befahl sie aufzuschließen. Sie ging aufs Feld, und die Bedienten erkannten sie für eben die, aus welcher die Gestalt hervor gegangen war. Nachdem er sie wieder zugeschlossen hatte, sagte er: »Hebt die Fallthür in die Höhe! wir wollen in die Gewölbe hinunter steigen.«
»Welche Fallthür, gnädiger Herr?« sagte Robert mit vermehrter Angst; »ich sehe keine.« — Der Marquis zeigte mit dem Finger, und Robert entdeckte eine Thür, die unter den Steinen, welche von der Treppe oben herunter gefallen waren, beynahe verdeckt lag. Er wollte die Steine wegräumen, als der Marquis sich plötzlich umdrehte. »Ich habe eurer Thorheit schon genug nachgesehen,« sagte er, »und bin des Spiels müde. Wenn ihr im Stande seyd, euch durch Wahrheit überzeugen zu lassen, so müßt ihr jetzt überzeugt seyn, daß diese Gebäude nicht die Wohnung eines übernatürlichen Wesens sind; und seyd ihr dieser Überzeugung nicht fähig, so ist es unnütz, weiter zu gehen. Du, Robert, kannst dir also die Mühe sparen, den Schutt wegzuräumen; wir wollen diese Gebäude verlassen.«
Die Bedienten gehorchten freudig. Der Marquis schloß alle Thüren wieder zu, und kehrte mit den Schlüsseln nach dem bewohnbaren Theile des Schlosses zurück.
Alles Forschen nach Julien war bisher vergebens gewesen, und die von Natur gebietherische Gemüthsart des Marquis, jetzt durch Verdruß erhöht, wurde allen, die um ihn waren unerträglich. So wie die Hoffnung, Julien wieder zu finden, abnahm, verstärkte sich sein Glaube, daß Emilie zu ihrer Flucht behülflich gewesen wäre, und er ließ sie die Härte seines ungerechten Verdachtes empfinden. Sie erhielt Befehl, ihr Zimmer nicht zu verlassen, bis ihre Unschuld an den Tag gebracht, oder ihre Schwester wieder gefunden wäre. Die treue Theilnahme der Madame de Menon war der einzige Trost ihres gepreßten Herzens. Ihre Angst um Julien vermehrte sich täglich. Sie wußte niemand, dem ihre Schwester sich anvertrauen, keinen Ort, wo sie Schutz finden könnte, und mußte die schrecklichsten Übel für sie erwarten. — Eines Tages, als sie, in traurige Betrachtungen versenkt, in ihrem Zimmer am Fenster saß, sah sie einen Mann in voller Eile ins Schloß sprengen. Ihr Herz klopfte von Furcht und Erwartung; seine Eile ließ sie vermuthen, daß er Nachricht von Julien brächte, und kaum konnte sie sich enthalten, den Befehl des Marquis zu brechen, und in die Halle zu stürzen, um zu erfahren, was er brächte. Sie hatte richtig vermuthet. Es war ein Spion vom Marquis, und er kam ihm zu sagen, daß Fräulein Julie in einer Hütte im Walde bey Marentino versteckt sey. Der Marquis frohlockte über diese Nachricht, und gab dem Manne eine reichliche Belohnung Er hörte zugleich, daß ein junger Cavalier sie begleitete, welches ihn in die äußerste Verwunderung setzte; denn er wußte außer dem Grafen Vereza niemand, dem sie sich anvertrauet haben könnte, und der Graf war von seinem Schwerte gefallen. Er befahl sogleich einem Theile seiner Leute, dem Bothen nach dem Walde bey Marentino zu begleiten, und bey Todesstrafe weder Julien noch den Cavalier entwische zu lassen. — Als der Herzog von Luovo von dieser Entfernung Nachricht erhielt, bath er den Marquis um Erlaubniß, ebenfalls nachzuspüren, und erhielt sie. Er machte sich sogleich auf den Weg, bewaffnet, und von einer großen Anzahl seiner Leute begleitet. Es war sein Vorsatz, alle Gefahr zu laufen, und das Äußerste zu wagen, ehe er den Gegenstand seines Unternehmens verfehlte. — Der Wald lag einige Meilen von Mazzini entfernt, und der Tag neigte sich, als sie die Grenzen desselben erreichten. Das dicke Laub der Bäume verbreitete einen tiefern Schatten umher, und sie mußten mit Vorsicht reiten. Dunkelheit hatte längst die Erde bedeckt, ehe sie an die Hütte kamen, zu welcher ein Licht sie führte, das von fern durch die Bäume schimmerte. Der Herzog ließ seine Leute in einiger Entfernung, stieg ab, und ging nur von einem Bedienten begleitet auf die Hütte zu. Als er sie erreicht hatte, stand er stille, und sah durch das Fenster einen Mann und eine Frau in Bauernkleidung beym Abendessen sitzen Sie waren im eifrigen Gespräche begriffen, und der Herzog, der nähere Nachricht von Julien zu vernehmen hoffte, suchte sie zu behorchen. Sie priesen die Schönheit einer jungen Dame; der Herzog zweifelte nicht, daß es Julie sey, und die Frau sprach viel zum Lobe des Cavaliers. »Er hat ein edles Herz,« sagte sie; »und ich bin nach seinem Ansehen gewiß, daß er aus einer vornehmen Familie seyn muß.«
»Ach was! —« antwortete ihr Gefährte; — »die Dame ist so gut, als er. Ich bin zu Palermo gewesen, und weiß wohl, was vornehme Leute sind; und wenn sie nicht dazu gehört, lasse ich mir den Hals abschneiden. Das arme Ding! wie sie sich in den Kleidern ausnahm! Das Herz that mir wehe, wenn ich sie ansah.«
Sie schwiegen ein Weilchen. Der Herzog klopfte an die Thür, und fragte den Mann, der sie aufmachte, nach der Dame und dem Cavalier, die jetzt in seiner Hütte wären.
Man versicherte ihn, es sey niemand in der Hütte, als die Leute, die er jetzt sähe. Der Herzog bestand darauf, daß die Personen, nach welchen erfragte, darin versteckt wären, und als der Mann eben so hartnäckig läugnete, gab er das Signal, worauf seine Leute hervor kamen, und die Hütte umgaben. Die Bauern erschraken, und gestanden, daß eine Dame und ein Cavalier so wie er sie beschriebe, einige Zeit in der Hütte verborgen gewesen, jetzt aber fortgegangen wären. — Der Herzog mißtraute dieser letzten Aussage, und befahl seinen Leuten, die Hütte und den umliegenden Theil des Holzes zu durchsuchen. Sie fanden nichts. — Der Herzog beschloß indessen, sich alle mögliche Nachricht von den Flüchtigen zu verschaffen, nahm eine finstere Mine an, und befahl dem Bauer bey Strafe augenblicklichen Todes, alles, was er wüßte, zu entdecken. — Der Mann antwortete, daß ungefähr vor einer Woche in einer sehr finstern und stürmischen Nacht zwey Personen in die Hütte gekommen wären, und um Zuflucht gebethen hätten. Sie hätten niemand zur Begleitung gehabt, sondern vornehme Personen in verstellter Kleidung zu seyn geschienen; sie hätten für alles, was sie bekommen, sehr freygebig bezahlt, und wären wenige Stunden vor der Ankunft des Herzogs aus der Hütte fortgereist. — Der Herzog erkundigte sich, welchen Weg sie genommen hätten, und nachdem er Nachricht erhalten hatte, stieg er wieder auf sein Pferd, und setzte nach. Der Weg ging verschiedene Meilen weit durch den Wald, und die Finsterniß und die Wahrscheinlichkeit, auf Banditen zu treffen, machte die Reise sehr gefährlich. Mit Tages Anbruche kamen sie aus dem Holze, und sahen ein wildes, gebirgiges Land, durch welches sie viele Stunden fortritten, ohne eine Hütte oder menschliches Wesen wahrzunehmen. Keine Spur von Anbaue war zu sehen; kein Laut drang in ihr Ohr, außer das Stampfen ihrer Pferde, und das Brüllen des Windes durch die dicken Wälder, die über den Bergen hingen. Das Nachsehen war mißlich; aber dennoch beschloß der Herzog zu beharren. Endlich erblickten sie eine Hütte, und der Herzog hörte zu großer Freude, daß zwey Personen; so wie er sie beschrieb, vor ungefehr zwey Stunden hier angehalten, und Erfrischung zu sich genommen hätten. Er fand es nothwendig, zu eben dem Zwecke anzuhalten: Brot und Milch, das Einzige, was die Hütte vermochte, wurde aufgetischt, und seine Leute würden sehr zufrieden gewesen seyn, wäre nur von diesem häuslichen Mahle genug da gewesen, ihren Hunger stillen. Sie verschlangen eilends, was da war, und begaben sich wieder auf den Weg, den man ihnen als denjenigen, welchen die Flüchtlinge genommen hatten, anwies. Das Land gewann nun eine fröhlichere Gestalt. Korn, Weinberge, Wäldchen von Oliven und Maulbeerbäumen schmückten die Hügel. Die schattigen Thäler verschönerten oft die Krümmung eines hellen Stroms, und abwechselnd sah man halb verborgene Hütten haufenweise zusammen stehen. Hier ragten die hohen Thürme eines Klosters über die dicken Bäume, welche sie umgaben, hervor, und dort bildeten die wilden Wüsten, durch welche die Reisenden gekommen waren, einen kühnen und mahlerischen Hintergrund in der Landschaft.
Der Herzog erhielt auf seine Fragen an die verschiedenen Leute, denen er begegnete, Antworten, die ihn aufmunterten, weiter zu gehen. Um Mittag hielt er in einem Dorfe an, um sich und seine Leute zu erfrischen. Er konnte keine Nachricht von Julien erhalten, und wußte nicht, welchen Weg er nehmen sollte; endlich aber beschloß er, den, worauf er war, zu verfolgen, und machte sich wieder auf. Er reisete viele Meilen weit, ohne jemand zu finden, der ihm die nöthigen Nachrichten geben konnte, und er gab beynahe alle Hoffnung auf, sie zu finden. Die verlängerten Schatten der Wälder und das schimmernde Licht verkündigten den Untergang des Tages — als er plötzlich von der Spitze eines kleinen Hügels zwey Personen zu Pferde im Thale unten entdeckte. An der einen unterschied er eine weibliche Tracht, und glaubte in ihrem Wuchse Julien zu erkennen. Während er stille hielt, und sie aufmerksam betrachtete, sahen sie sich nach dem Hügel um, und als von einem plötzlichen Schrecken getrieben, sprengten sie eilends über die Thäler. Der Herzog zweifelte nicht länger, daß sie diejenigen waren, die er suchte, und befahl also einigen von seinen Leuten, sie zu verfolgen, während er selbst sein Roß in vollen Galopp setzte. Ehe er das Thal erreichte, waren die Fliehenden, die sich schnell um einen Hügel gedreht hatten, ihm aus dem Gesichte. Der Herzog setzte seinen Weg fort, und seine Leute, die weit vor ihm voraus waren, erreichten endlich den Hügel, hinter welchem die zwey Personen verschwunden waren. Keine Spur von ihnen war zu sehen, und sie kamen in einen engen Weg zwischen zwey Reihen hoher, wilder Berge; zur Rechten rollte ein reißender Strom hin, dessen tiefes, wiederhallendes Gemurmel die feyerliche Stille des Ortes unterbrach. Die Abendschatten sanken nun dick herab, und bald war die Gegend in Dunkelheit gehüllt; allein der Herzog, den eine ungestüme Leidenschaft forttrieb, achtete diese Hindernisse nicht. Ob er gleich wußte, daß die Wildnisse von Sicilien oft von Banditen durchschwärmt werden, ließ ihn doch sein zahlreiches Gefolge keinen Angriff fürchten. Nicht so seine Begleiter, von welchen verschiedene Bewegungen blicken ließen, die ihrem Muthe nicht sehr zur Ehre gereichten; sie starrten vor jedem Busche zurück, und glaubten, daß er einen Räuber verhehlte. Sie bemühten sich, den Herzog vom Weitergehen abzubringen, äußerten wie ungewiß es sey, ob sie auf dem rechten Wege wären, und empfohlen die offenen Thäler; allein der Herzog, der mit wachsamem Auge die Flucht der Flüchtlinge bemerkt hatte, und sich nicht von seinem Vorhaben abbringen ließ, trieb schnell ihre Argumente zurück. Sie setzten ihren Weg fort, ohne eine einzige Person zu treffen. — Der Mond stieg nun auf, und verschaffte ihnen einen schattigen unvollkommenen Blick von den umliegenden Gegenständen. Die Aussicht war wüst und dunkel, und ihre Augen trafen auf keine menschliche Wohnung. Sie hatten nun alle Spur von den Flüchtlingen verloren, und fanden sich in einer wüsten, wilden Gegend verirrt. Ihre einzige Sorge war nun, sich aus einer so trostlosen Lage zu befreyen, und mit ängstlicher Sorgfalt horchten sie bey jedem Schritte nach einem Laute, der ihnen eine menschliche Wohnung entdecken könnte. Sie horchten vergebens; die Stille der Nacht wurde nur vom Winde unterbrochen, der zuzeiten in hohlem, tiefem Gebrülle durch die Berge pfiff. So wie sie mit schweigender Behuthsamkeit weiter ritten, sahen sie in einiger Entfernung ein Licht durch die Felsen schimmern. Der Herzog stand an, ob er sich heran wagen sollte, da es wahrscheinlich von einer Bande Banditen kam, womit diese Gebirge erfüllt seyn sollten. Während er sich besann, verschwand es; allein er hatte noch wenig Schritte zurück gelegt, als es wieder erschien. Er sah nun, daß es aus der Mündung einer Höhle hervor ging, und einen hellen Schimmer auf die überhangenden Felsen und Gesträuche warf.
Er stieg ab, und von zweyen seiner Leute begleitet — die übrigen ließ er in einiger Entfernung — ging er schweigend und mit langsamem Schritte nach der Höhle zu. So wie er näher kam, hörte er den Schall vieler Stimmen bey einem hohen Saufgelage. Plötzlich hörte das Getümmel auf, und eine helle, männliche Stimme sang folgende Worte:
Auf, schenket reichlich ihr Zecher!
Füllet den schäumenden Becher
Bacchus zu Ehren mit Wein!
Mit Wonne soll er durchglühen
Jegliches Aug' so entfliehen
Trüben Gedanken der Zukunft.
Bilder von Wonn' und Entzücken,
Schweben vor unseren Blicken,
Während der Geist sich ergießt.
In uns ströme die Gottheit,
Sanfte Gefühle und Frohheit,
Die kein Nüchterner kennt!
Die letzten drey Zeilen wurden im lautem Chore wiederhohlt. Der Herzog horchte mit Erstaunen zu. Solche gesellige, jovialische Fröhlichkeit in dieser wüsten Einöde schien mehr der Bezauberung, als der Wirklichkeit zu gleichen. Er würde sie ohne Bedenken für einen Haufen Banditen gehalten haben, hätte ihm nicht ihr Gesang für Menschen von dieser Classe zu seyn geschienen — — Er konnte nun die ganze Höhle übersehen, und der Augenblick, der ihn von seinem Irrthume überführte, vermehrte auch seine Verwunderung. Er sah bey dem Lichte eines Feuers eine Bande Banditen im tiefsten Grunde der Höhle rings um eine Art von plumpem Tische, der in den Felsen gehauen war, sitzen. Der Tisch war mit Speisen besetzt, die sie mit großer Begierde und Freude verschlangen. Die Gesichtsbildungen dieser Menschen zeigten eine wunderbare Mischung von Muth und Geselligkeit, und der Herzog wähnte beynahe, in diesen Räubern eine Bande der frühern Römer zu sehen, ehe Wissenschaften sie verfeinert, Luxus sie geschwächt hatte. Allein es blieb ihm nicht lange Zeit zu Betrachtungen; — ein Gefühl seiner Gefahr hieß ihn fliehen, so lange noch Fliehen in seiner Macht war. Als er sich umdrehte, um fortzugehen, sah er zwey gesattelte Pferde nahe bey der Mündung der Höhle grasen. Es fiel ihm sogleich ein, daß sie Julien und ihrem Gesellschafter gehören könnten. Er besann sich, und beschloß endlich, noch ein wenig zu warten, und dem Gespräche der Räuber zuzuhören, in Hoffnung einen Aufschluß seiner Zweifel zu erhalten. Sie sprachen eine lange Zeit in hoher Jovialität, und priesen frohlockend viele von ihren Thaten. Sie beschrieben mit spöttischen Anspielungen und mit rohem Witze das Benehmen verschiedener Leute, die sie beraubt hatten, während die Höhle von lautem Gelächter und Beyfalle wiederhallte. Sie beharrten in dieser lärmenden Fröhlichkeit, bis einer von ihnen den armseligen Gewinn ihres letzten Abenteuers verwünschte, aber die Schönheit einer Dame pries, worauf sie alle die Stimmen senkten, und über einen ungewöhnlich interessanten Punct zu debattiren schienen. Die Leidenschaften des Herzogs wurden aufgereizt, und er war überzeugt, daß Julie das Frauenzimmer seyn müßte, von dem sie sprachen. Im ersten Antriebe seines Gefühls zog er sein Schwert; allein der Gedanke an die Zahl seiner Widersacher hielt seine Muth zurück. Er drehte sich von der Höhle, um seine Leute zusammen zu rufen, als der Schein des Feuers auf den blanken Griff seines Degens blitzte, und einem von den Banditen ins Auge fiel. Er sprang von seinem Sitze auf; seine Kameraden erhoben sich voller Bestürzung, und entdeckten den Herzog. Mit lautem Geschreye stürzten sie aus der Höhle — er versuchte zu seinen Leuten zu entwischen; aber zwey der Banditen schwangen sich auf die Pferde, die neben der Höhle graseten, hohlten schnell ihn ein, und ergriffen ihn. Seine Kleidung und Anstand zeigten, daß er eine Person von Stande war, und jubelnd in der Hoffnung auf reiche Beute, schleppten sie ihn mit Gewalt in die Höhle. Hier erwarteten ihre Kameraden sie; aber was waren des Herzogs Gefühle, als er in dem Räuberanführer, der zuvor mit dem Rücken nach der Thüre gesessen hatte, seinen eigenen Sohn erkannte! Um der bittern Strenge seines Vaters zu entgehen war Riccardo vor einigen Jahren aus seinem Schlosse entflohen, und hatte nie wieder von sich hören lassen. — Er hatte sich an die Spitze einer Räuberbande gestellt, und erfreut über die Freyheit, die er nie zuvor gekostet hatte, und über die Macht, die seine neue Lage ihm verschaffte, gefiel ihm diese wilde, gesetzlose Lebensart so wohl, daß er beschloß, sie nicht zu verlassen, bis der Tod die Bande auflöste, welche jetzt seinen Rang ihm nur zur Bürde machten. Dieser Umstand aber schien noch so weit entfernt zu seyn, daß er sich selten nur daran zu denken erlaubte. Wenn er aber einträte, so zweifelte er nicht, daß er entweder, ohne Gefahr entdeckt zu werden, seinen Rang wieder annehmen, der sein gegenwärtiges Betragen als eine Jugendausschweifung entschuldigen könnte, welche einige Handlungen der Großmuth leicht gut machen würden. Er wußte, daß seine Macht in einem Lande, wo das Volk an unbegrenzte Subordination gewöhnt ist, und selten über die Handlungen des Adels zu richten wagte, ihn vor Tadel sicher stellen würde. Doch waren seine Empfindungen, als er seinen Vater entdeckte, auf keine Weise angenehm; indessen erkannte er den Herzog an, und schützte ihn vor weiterer Schmach. — Bei dem Herzoge, dessen Herz keine sanften Regungen kannte, trat Zorn an die Stelle väterlichen Gefühls. Sein Stolz war die einzige Leidenschaft, welche bey der Entdeckung litt, und er war unüberlegt genug, um den Unwillen, den die Aufführung seines Sohns erregte, in ungezähmten Schmähungen zu ergießen. Die Banditen, durch die Schmach, die er auf ihren Stand warf, in Wuth gesetzt, drohten ihm augenblickliche Strafe für seine Vermessenheit, und kaum konnte Riccardo's Ansehen sie in Schranken halten. Die Drohungen, und endlich die Bitten des Herzogs, seinen Sohn zu bewegen, von dieser seltsamen Lebensart abzustehen, waren gleich unwirksam. Sicher in seiner eigenen Macht lachte Riccardo über die ersten, und achtete auf die letzten nicht; und sein Vater sah sich endlich genöthigt, den Versuch aufzugeben. Indessen klagte er ihn kühn und heftig an, daß er eine Dame und einen Cavalier von seinen Freunden geplündert und eingesperrt hätte, und beschrieb ihm zugleich Julien, für deren Befreyung er ihm eine große Belohnung anboth. Riccardo läugnete die Sache, welches den Herzog dermaßen aufbrachte, daß er sein Schwert zog, um es seinem Sohn in die Brust zu stechen. Die ihn umringenden Banditen hielten seinen Arm zurück; mit halb gezückten Schwertern standen sie in drohender Stellung da. Das Schicksal des Vaters hing jetzt an den Lippen des Sohns. Riccardo hob den Arm auf, ließ ihn sogleich wieder sinken, und wendete sich ab. Die Banditen steckten ihre Schwerter in die Scheide, und wichen zurück. Riccardo schwor nun feyerlich, daß er nichts von den beschriebenen Personen wüßte; der Herzog überzeugte sich endlich von der Wahrheit seiner Behauptung, verließ die Höhle, und ging wieder zu seinen Leuten. Seinen Sohn in einer so entehrenden, verworfenen Lage zu entdecken, hatte alle ungestümen Leidenschaften seiner Natur aufgereizt und entflammt. Doch war mehr sein Stolz als seine Tugend gekränkt, und er wünschte seines Sohnes Tod mehr, um sich selbst Schande zu ersparen, als ihn von der wirklichen Entehrung des Lasters zu retten. Er hatte keine Mittel, ihn zurück zu fordern; es durch Gewalt zu versuchen, wäre in diesem Augenblicke Tollkühnheit gewesen: denn sein Gefolge, obgleich zahlreich, war undisciplinirt, und würde gewiß als Schlachtopfer einer wilden und im Kampfe geübten Räuberbande gefallen seyn. —Zwischen stolzen und ängstigenden Gedanken hin und her getrieben, setzte er seine Reise fort; und da er alle Spur von Julien verloren hatte, suchte er nur einen Wohnort, der ihn vor der Nacht schützen, und ihn und seinen Leuten eine nothwendige Erfrischung verschaffen könnte. Allein diesen zu finden, schien wenig Hoffnung vorhanden zu seyn.
Die Nacht wurde stürmisch. Hohl pfiff der Wind über die Berge, und blies Kälte und Frost um sich her; Wolken überzogen schnell das Antlitz des Mondes, und oft hüllte gänzliche Dunkelheit den Herzog und sein Gefolge ein. Schweigend und niedergeschlagen waren sie einige Stunden fortgeritten, und hatten sich in den Wildnissen verirrt, als sie die Glocke eines Klosters zum mitternächtlichen Gebethe läuten hörten. Ihre Herzen lebten auf bey dem Schalle, dem sie zu folgen suchten; allein sie waren noch nicht weit gegangen, als der Wind ihn verwehte, und sie der ungewissen Leitung ihrer eigenen Vermuthungen überlassen blieben. — Sie hatten eine Weile den Weg verfolgt, der ihrer Meinung nach zum Kloster führte, als das Geläute der Glocken mit dem Winde zurück kehrte, und ihnen zeigte, daß sie den Weg verfehlt hatten. Nach langem Umherirren und Beschwerden kamen sie, von Müdigkeit überwältigt, vor den Thoren eines großen, dunklen Gebäudes an. Die Glocke schwieg, und alles war stille. Durch das Mondlicht, das durch zerbrochene Wolken jetzt auf das Gebäude strahlte, wurden sie überzeugt, daß es das Kloster war, welches sie suchten, und der Herzog klopfte selbst laut an das Thor. — Einige Minuten verstrichen. Niemand erschien, und er wiederhohlte das Klopfen. Alsobald hörte man von innen gehen; das Thor wurde aufgeschlossen, und eine hagre, klappernde Gestalt trat hervor. Der Herzog bath, eingelassen zu werden, wurde aber abgewiesen, und erhielt einen Verweis, das Kloster in der heiligen Stunde des Gebethes beunruhigt zu haben. Er gab nun seinen Rang zu erkennen, und bath den Mönch, dem Prior zu sagen, daß er um eine Zuflucht auf die Nacht bitte. Der Mönch, der einen Betrug fürchtete, und dem vor Räubern bange war, weigerte sich standhaft, und wiederhohlte, daß das Kloster im Gebethe begriffen sey; er hatte das Thor beynahe wieder zugemacht, als der Herzog, den Hunger und Ermüdung verzweifelnd machte, neben ihm hinschlüpfte, und in dem Hof drang. Es war seine Absicht, sich dem Prior zu zeigen, und er war noch nicht weit gegangen, als Gelächter und viele Stimmen in lautem, fröhlichem Jubel seine Schritte lenkten. Er folge dem Schalle, und kam durch verschiedene Gänge zu einer Thür, durch deren Spalten er Licht sah. Er stand einen Augenblick stille, und hörte innerhalb ein wildes Gewühl von Gesang und Freude. Erstaunen ergriff ihn, und kaum konnte er seinen Sinnen trauen. — Er öffnete die Thür, und sah in einem großen, hell erleuchteten Zimmer eine Gesellschaft Mönche in ihrem Ornate, rings um einen Tisch sitzen, der verschwenderisch mit Wein und Früchten besetzt war. Der Prior, den seine Kleidung von seinen übrigen Gefährten auszeichnete, prangte an der Spitze der Tafel; er hob einen großen Pocal an seine Lippen, und rief, gerade als der Herzog in's Zimmer trat: »Verschwendung und Verwirrung!«« — Des Herzogs Eintritt verursachte eine allgemeine Zerstörung. Diejenigen von der Gesellschaft, die noch nicht zu arg betrunken waren, hoben sich von ihren Sitzen auf, und der Prior, der seinen Pocal aus der Hand fallen ließ, bemühte sich, eine finstre Miene anzunehmen, welche sein frostiges Gesicht Lügen strafte. Der Herzog erhielt einen Verweis, der in den lallenden Tönen der Trunkenheit ausgesprochen, und durch öftere Unterbrechungen von Rülpsen verschönert wurde. Er machte seinen Stand, seine Bedrängniß bekannt, und bath um ein Nachtquartier für sich und seine Leute. Als der Prior den hohen Rang seines Gastes vernahm, erschlafften seine Muskeln in ein freundliches Bewillkommungslächeln; er nahm den Herzog bey der Hand, und setzte ihn neben sich. Der Tisch wurde schnell mit leckern Gerichten besetzt, und Befehl gegeben, daß des Herzogs Leute eingelassen und versorgt würden. Man setzte ihm eine Menge feiner Weine vor, und endlich, hoch gelaunt durch klösterliche Gastfreyheit, zog er sich in sein angewiesenes Zimmer zurück, indem er den Prior in einer Verfassung zurück ließ, die alle Ceremonie ausschloß. Früh Morgens reiste er ab, höchlich erbaut von den bequemen Grundsätzen klösterlicher Religion. Man hatte ihm gesagt, daß der Genuß der Annehmlichkeiten des Lebens der sicherste Beweis unsrer Dankbarkeit gegen den Himmel sey, und es schien, daß diese Vorschrift und die Ausübung derselben mit gleicher Stärke in den Mauern eines sicilianischen Klosters regierten. Er wußte jetzt nicht, welchen Weg er nehmen sollte; denn er hatte keinen Faden, ihn zu dem Gegenstande seines Suchens zu leiten; doch stärkte Hoffnung ihn noch immer, und trieb ihn zur Beharrlichkeit an. Er war nicht weit mehr von der Küste entfernt, und es fiel ihm ein, daß die Flüchtlinge vielleicht, in der Absicht nach Italien zu entwischen, ihren Weg dahin nehmen könnten. Er beschloß also, nach der See zu reisen, und längs dem Ufer fortzugehen. — In dem Hause, wo er, um Mittag zu machen, stille hielt, hörte er, daß zwey Personen, die seiner Beschreibung gleich kamen, ungefähr eine Stunde vor seiner Ankunft daselbst abgetreten waren, sich aber bald in großer Eile wieder davon gemacht hatten. Sie hatten ihren Weg nach der Küste zu genommen, woraus der Herzog schloß, daß sie sich einzuschiffen dachten. Er wollte sich nicht aufhalten, die aufgetragne Mahlzeit zu verzehren, sondern stieg sogleich wieder aufs Pferd, um seine Verfolgung fortzusetzen. Eine Zeit lang erhielt er auf seine Fragen an die Personen, welche der Zufall ihm in den Weg führte, günstige Antworten; endlich aber wurde er in Ungewißheit verwickelt, und ritt einige Stunden durch nach einer Richtung, welche mehr Zufall als Urtheil ihn nehmen hieß.
Der einbrechende Abend verwirrte aufs neue seine Aussicht, und vernichtete seine Hoffnungen. Die trüben, schweren Wolken, welche den Horizont einhüllten, und die tief blasende Luft verkündigten ein Ungewitter. Der Donner rollte in der Ferne, und die gehäuften Wolken wurden dunkler. Der Herzog und seine Leute befanden sich auf einer wilden, öden Haide; vergebens blickten sie rings um nach einer Zuflucht, die Aussicht endigte von allen Seiten in eine traurige Wüste. Sie ritten so schnell, als ihre Pferde sie tragen wollten, und endlich spürte einer aus dem Gefolge am Ende der Wildniß ein großes Gebäude aus, wohin sie sogleich ihren Lauf richteten. — Der Sturm überfiel sie, und in eben dem Augenblicke, als sie das Gebäude erreichten, brach ein Donnerschlag, der die Grundpfeiler zu erschüttern schien, über ihren Häuptern los. Sie befanden sich nun in einem großen, antiken Gebäude, das ein verödetes Ansehen hatte, und zu verfallen anfing. Dieses Gebäude zeichnete sich durch eine Pracht aus, die mit der Gegend umher schlecht zusammen stimmte, und einige Verwunderung bey dem Herzoge erregte, der indessen den Eigenthümer vollkommen rechtfertigte, einen Ort verlassen zu haben, welcher dem Auge nur Aussichten in eine rohe verheerte Natur darboth. — Der Sturm vermehrte sich mit großer Heftigkeit, und drohte den Herzog die Nacht über in seinem jetzigen Aufenthalte gefangen zu halten. Die Halle, von welcher er und sein Gefolge Besitz genommen hatten, trug allenthalben das Gepräge von Verfall und Verödung. Das marmorne Pflaster war an manchen Stellen zerbrochen, die Wände zerfallen, und rings um die hohen, durchlöcherten Fenster wehte ein einsames Lüftchen im langen Grase. Neugier trieb ihn an, die Gemächer des Gebäudes zu untersuchen. Er verließ die Halle, und ging in einen Gang, der ihn zu einem entlegenen Theile des Gebäudes führte. Im finstern Nachdenken wanderte er durch die wüsten, geräumigen Zimmer, und stand oft stille, um mit Verwunderung die Rudera von Pracht, die er vor, sich sah, zu betrachten. Das Gebäude war wüst und unregelmäßig, und er verwickelte sich in den Irrgängen desselben. In dem Bestreben, den Rückweg zu finden, verirrte er sich nun immer mehr, bis er endlich vor einer Thür ankam, die seiner Meinung nach in die erste Halle führte. Er öffnete sie, und, statt der Halle sah er bey dem schwachen Lichte des Mondes einen großen Platz, von dem er nicht wußte, ob er ihn für ein Kloster, für eine Kapelle, oder Halle halten sollte. Er zog sich in langer Aussicht in Schwibbögen fort, und endigte in einem großen, eisernen Thore, das aufs offne Feld stieß. Die Blitze, die blau und hell rings umher flammten, der Donner, der das weite Gewölbe des Himmels zu zerreißen schien, und das traurige Ansehen des Orts flößten dem Herzoge einen solchen Schauder ein, daß er unwillkürlich sein Gefolge herbey rief. Nur das tiefe Echo, das murmelnd durch den Saal lief, und in einiger Entfernung verhallte, antwortete seiner Stimme, und der Mond, der jetzt hinter eine Wolke sank, ließ ihn in finstrer Nacht zurück Er schrie lauter, und hörte endlich Fußtritte heran nahen. Nach einigen Minuten wurde er aus seiner Angst errettet, und seine Leute erschienen. Der Sturm brüllte noch laut, und der schwere, mit Schwefel angefüllte Dunstkreis ließ nicht hoffen, daß er sich bald legen würde. Der Herzog ergab sich darein, die Nacht in dieser Lage zuzubringen, und ließ ein Feuer an dem Orte, wo er war, anzünden, welches mit vieler Schwierigkeit geschah. Er warf sich nun vor demselben aufs Pflaster hin, und suchte sich in die Enthaltsamkeit zu schicken, die er den Abend vorher im Kloster so schlecht beobachtet hatte. Zu seiner großen Freude aber hatten seine Leute, vorsichtiger als er, sich kein Bedenken gemacht, einen reichlichen Mundvorrath, der ihnen im Kloster angebothen wurde, anzunehmen, und leerten jetzt ihren Quersack auf dem Pflaster aus. Der Herzog labte sie, und gab ihnen den Überrest Preis. Nachdem er ihnen befohlen hatte, abwechselnd vor dem Thore zu wachen, hüllte er sich in seinen Mantel, und legte sich zur Ruhe.
Die Nacht verstrich ohne Störung. Frisch und glänzend stieg der Morgen auf; das Gewölbe des Himmels war hell, und ohne Wolken; selbst die wilde Haide lächelte, vom Regen erquickt, und sandte mit dem Morgenlüftchen einen Strom von Wohlgeruch herauf. Der Herzog verließ das Gebäude, und setzte, von dem fröhlichen Morgen neu belebt, seine Reise fort. Er konnte keine Nachricht von den Flüchtlingen einziehen. Um Mittag fand er sich in einer schönen romantischen Gegend, und nachdem er den Gipfel eines jähen Felsens erreicht hatte, hielt er stille, um die mahlerische Landschaft unten zu betrachten. Ein schattiges, eingeschloßnes Thal schien tief zwischen den Felsen begraben, und im Grunde desselben zeigte sich ein Teich, in dessen heller Fläche die überhangenden Felsen und der Schatten der hervor ragenden Gesträuche sich spiegelte. Bald aber wurde seine Aufmerksamkeit von den Schönheiten der leblosen Natur auf noch interessantere Gegenstände gezogen: er bemerkte zwey Personen, die er sogleich für eben diejenigen erkannte, welche er zuvor über das Thal verfolgt hatte. Sie saßen am Rande des Sees, unter dem Schatten einiger hohen Baume am Fuße der Felsen, und schienen ein kleines Mahl zu verzehren, das auf dem Grase ausgebreitet war. Zwey Pferde graseten in der Nähe. Der Herzog erkannte in dem Frauenzimmer Juliens Wuchs und Anstand, und sein Herz klopfte bey dem Anblicke. Sie saßen mit dem Rücken gegen den Felsen, worauf der Herzog stand, und er konnte sie also ungestört betrachten. Sie waren beynahe in seiner Gewalt; die einzige Schwierigkeit nur, die Felsen herab zu klimmen, deren ungeheuere Höhe und rauhe Spitzen sie ungangbar zu machen schienen. Er untersuchte sie mit forschendem Auge, und entdeckte endlich an einem Orte, wo der Fels zurück wich, einen schmalen, krummen Pfad. Er stieg ab, und einige von seinen Leuten folgten ihm die Klippen hinab mit leisem Schritte, damit nicht ihre Fußtritte sie verriethen. In eben dem Augenblicke, da sie den Grund betraten, nahm die Dame sie wahr, floh zwischen die Felsen, und wurde sogleich von des Herzogs Leuten verfolgt. Der Cavalier hatte nicht Zeit zu entwischen, zog sein Schwert, und vertheidigte sich gegen den wüthenden Angriff des Herzogs. — Das Gefecht wurde an beyden Seiten einige Minuten lang mit gleichem Muthe und Behendigkeit geführt, als der Herzog die Spitze von seines Gegners Degen auffing, und umsank. Der Cavalier, der zu entwischen suchte, wurde von des Herzogs Leuten ergriffen, die jetzt mit der schönen Fliehenden erschienen — aber wer kann die Kränkung; die Wuth des Herzogs mahlen, als er in der Person des Frauenzimmers eine ganz Fremde sah! Das Erstaunen war gegenseitig, allein die damit verbundenen Gefühle waren in den verschiedenen Personen von ganz entgegen gesetzter Art. Bey dem Herzoge wurde Erstaunen durch Verdruß erhöhet, durch vereitelte Hoffnung erbittert; bey der Dame ward es durch die Freude einer unerwarteten Befreyung gemildert. — Diese Dame war die jüngste Tochter eines sicilianischen Edelmanns, dessen Geiz oder Bedürfnisse sie für ein Kloster bestimmt hatten. Um das angedrohte Schicksal zu vermeiden, floh sie mit einem Liebhaber, an den Neigung sie lange gefesselt hatte, und dessen einziger Fehler selbst in den Augen ihres Vaters ein jüngeres Geschlecht war. Sie waren jetzt auf dem Wege nach der Küste, von wo sie nach Italien überzugehen dachten, woselbst die Kirche die Bande befestigen sollte, welche ihre Herzen bereits geknüpft hatten. Dort wohnten die Anverwandten des Cavaliers, und bey ihnen glaubten sie eine sichere Zuflucht zu finden. — Der Herzog, der nicht wesentlich verwundet war, ließ, nachdem der erste Ausbruch seiner Wuth sich gelegt hatte, sie abreisen. Von ihrer Furcht befreyet, machten sie sich freudig auf den Weg, und überließen ihrem Verfolger den Schmerz seiner Niederlage, und seines fruchtlosen Bemühens. Er wurde wieder auf sein Pferd gebracht, und nachdem er zwey von seinen Leuten abgeschickt hatte, um ein Haus aufzusuchen, wo er einige Hülfe erhalten könnte, trat er langsam seinen Rückweg nach dem Schlosse Mazzini an. — Er war noch nicht lange geritten, als ihm ein Umstand beyfiel, an den er in der ersten Bestürzung seines Verdrusses nicht gedacht hatte, der aber in so wesentlicher Beziehung mit dem ganzen Gebäude seiner Hoffnungen stand, daß er aufs neue unschlüssig wurde, wie er verfahren sollte. Er bedachte, daß dieses zwar die Flüchtlinge nicht waren, die er über die Thäler verfolgt hatte, daß sie aber vielleicht auch nicht die wären, die sich in der Hütte verborgen hatten, und daß Julie dennoch die Person seyn könnte, welche sie von dortaus verfolgten. Dieser Gedanke erweckte seine Hoffnung aufs neue; eben so schnell aber ward sie wieder zerstöret, als er bedachte, daß die einzigen Personen, welche ihm Aufschluß geben konnten, schon ich weiter Entfernung waren. Julien zu verfolgen, wo keine Spur von ihrer Flucht übrig blieb, war ungereimt, und er sah sich also genöthigt, eben so unwissend, und hoffnungsloser, als er ihn verlassen hatte, zum Marquis zurück zu kehren. — Mit großer Beschwerde erreichte er das Dorf, welches seine Abgesandten für ihn ausgespürt hatten, und fand zum Glücke einen Chirurgus daselbst. Seine Unpäßlichkeit zwang ihn, hier liegen zu bleiben; — der Schmerz seiner Seele kam seinem körperlichen gleich. Die ungestümen Leidenschaften, welche seinen Charakter bezeichneten, waren zu einem solchem Grade gereizt und hinauf getrieben, daß sie mächtig auf seinen Körper wirkten, und ihm die gefährlichsten Folgen drohten. Die Unruhe seiner Seele erhöhte die Wirkung seiner Wunde, und ein Fieber, welches schleunig ein sehr ernsthaftes Ansehen gewann, trug bey, sein Leben in Gefahr zu setzen.
Das Schloß Mazzini war noch immer der Schauplatz der Zwietracht und des Jammers. Des Marquis Befremdung und Ungeduld stieg von Tage zu Tage durch die verlängerte Abwesenheit des Herzogs; er schickte Bediente in den Wald von Marentino, um nach der Ursache dieser Verzögerung zu forschen. Sie kamen mit der Nachricht zurück, daß weder Julie, noch der Herzog, noch irgend jemand von seinem Gefolge daselbst wäre. Er schloß also, daß seine Tochter von der Annäherung des Herzogs Nachricht bekommen, und die Hütte verlassen hätte, und daß der Herzog noch im Nachsehen begriffen sey. Gegen Ferdinanden, der noch immer in seinem Kerker schmachtete, blieb seine Strenge ungemildert. Er fürchtete, daß sein Sohn, wenn er befreyet wäre, bald Juliens Aufenthalt ausspüren, und sie durch Rath und Beystand in ihrem Ungehorsame bestärken würde. — Ferdinand brütete in seinem stillen, einsamen Kerker in finstern, unwirksamen Klagen über das vergangenen Unglück. Das Bild seines Hippolytus, seines gemordeten Hippolytus stieg rastlos vor seiner Einbildungskraft auf, und überwältigte die stärksten Versuche seiner Kraft. Auch Julien sah er, seine geliebte, unbeschützte, unbefreundete Schwester, die in eben dem Augenblicke, wo er sie beklagte, unter den schrecklichsten Leiden der Menschheit erlag. Die Luftplane künftiger Glückseligkeit, die er einst aus der Vereinigung zweyer ihm so theuren Wesen sich schuf — die frohen Erscheinungen verschwundener Wonne schwirrten vor seiner Fantasie, und der Glanz, den sie zurückstrahlten, erhöhte nur durch den Contrast, die düstre Finsterniß seiner jetzigen Aussichten. Dennoch fand er neuen Stoff zum Erstaunen, der oft seine Gedanken von dem gewohnten Gegenstande abzog, und eine weniger schmerzvolle, obwohl kaum weniger mächtige Empfindung an die Stelle desselben setzte. — Eines Nachts, als er da lag, in traurigem Tiefsinne an der Vergangenheit wiederkäuend, wurde die Stille des Orts plötzlich durch einen tiefen, schrecklichen Laut unterbrochen. In hohlen Seufzern kehrte er von Zeit zu Zeit wieder, und schien aus einer schmerzlich gefolterten Brust zu kommen. Furcht wirkte so mächtig auf seine Seele, daß er ungewiß war, ob diese Töne von innen oder außen aufstiegen. Er sah rings in seinem Kerker umher, konnte aber durch die undurchdringliche Finsterniß keinen Gegenstand unterscheiden. So wie er in tiefem Erstaunen horchte, erschollen die Töne in noch dumpferm Geheule wieder. Grausen ergriff ihn, und umwölkte seine Vernunft; er starrte von seinem Lager auf, und entschlossen, heraus zu bringen, ob jemand außer ihm im Kerker sey, tappte er mit ausgestreckten Armen längs den Wänden hin. Der Ort war leer; als er aber an einen gewissen Fleck kam, drang der Schall deutlicher in seine Ohren. Er rief laut, und fragte: wer da sey — erhielt aber keine Antwort. Bald nachher ward alles stille, und nachdem er lange gehorcht hatte, ohne die Töne wieder zu hören, legte er sich zum Schlafen nieder. — Am folgenden Morgen erzählte er dem Mann, der ihm zu essen brachte, was er gehört hatte, und fragte nach der Ursache des Geräusches. Der Bediente schien sehr zu erschrecken, konnte ihm aber keine Nachricht geben, welche nur das mindeste Licht auf die Sache warf, bis er endlich erwähnte, daß der Kerker nahe bey den südlichen Gebäuden läge. Die schreckliche Erzählung, die ihm der Marquis anvertrauet hatte, fiel Ferdinanden sogleich in den Sinn, und er stand nicht an zu glauben, daß das Gewinsel, das er gehört hatte, von dem rastlosen Geiste des ermordeten Della Campo sey. Schauder durchbebte seine Nerven; allein er erinnerte sich an seinen Eid und schwieg. Doch unterlag sein Muth dem Gedanken, noch eine Nacht allein in diesem Gefängnisse hinzubringen, wo Entsetzen ihn tödten könnte, wenn der Rache dürstende Geist des Ermordeten erschiene. — Ferdinands Seele war über den gewöhnlichen Wahn des Aberglaubens weit erhaben; allein hier zeigten sich solche zusammen treffende Umstände, daß sie selbst den Unglauben zum Weichen zu zwingen schienen. Er selbst hatte seltsame und schreckliche Töne in den südlichen Gebäuden gehört — er vernahm von seinem Vater ein schreckliches Geheimniß, das sich darauf bezog; ein Geheimniß, woran seine Ehre, ja sogar sein Leben gebunden war. Auch hatte sein Vater gestanden, daß er selbst Erscheinungen gesehen hätte, an die er sich nicht ohne Entsetzen erinnern könnte, und die ihn bewogen hätten, diesen Flügel des Schlosses zu verlassen. Alle diese Erinnerungen stellten Ferdinanden eine Kette von Beweisen dar, die zu stark war, um ihr zu widerstehen, und er konnte nicht zweifeln, daß es für ein Mahl dem Geiste des Todten erlaubt worden sey, die Erde zu besuchen, und Rache auf die Abkommen des Mörders herab zu rufen. — Diese Überzeugung schuf in ihm ein Entsetzen, welches keine Furcht vor einer sterblichen Macht erregt haben könnte, und er beschloß, wo möglich, Petern zu bewegen, die Stunden der Mitternacht mit ihm in seinem Kerker zuzubringen. Peters strenge Treue gab Ferdinands Überredungen nach, obgleich keine Bestechung ihn reizen konnte, sich dadurch, daß er ihn entwischen ließe, der Rache des Marquis auszusetzen.
Ferdinand brachte den Tag in zögernder, ängstlicher Erwartung hin, und die Zurückkunft der Nacht führte Petern in den Kerker. Seine Gefälligkeit setzte ihn einer Gefahr aus, die er nicht vorher gesehen hatte; wie leicht hätte sein Gefangener, da er mit ihm allein im Kerker saß, ihn überwältigen, die Flucht ergreifen, und sein Leben der Wuth des Marquis Preis geben können! Ferdinands Menschlichkeit erhielt ihn; er nahm zwar sogleich seinen Vortheil wahr, verachtete es aber, einen unschuldigen Mann ins Verderben zu stürzen, und verbannte den Gedanken aus seinem Herzen. — Peter, dessen Freundschaft stärker war, als sein Muth, zitterte vor Angst, als die Stunde heran kam, in welcher in der vorhergehenden Nacht das Gewinsel sich hören ließ. Er erzählte Ferdinanden eine Menge schrecklicher Umstände, die nur in der mehrsten Einbildungskraft seiner Kameraden ein Daseyn hatten, aber als Thatsachen von ihnen verfochten wurden. Unter dem übrigen ermangelte er nicht, des Lichtes und der Gestalt, die in der Nacht, als Julie entfliehen wollte, aus dem südlichen Thurme hervorgegangen war, zu erwähnen; ein Umstand, den er mit unzähligen Zusätzen der Furcht und Verwunderung verschönerte. Er schloß damit, die allgemeine Bestürzung, die dadurch verursacht sey, und das nachherige Betragen des Marquis zu beschreiben, der die Furcht seiner Leute verlachte, und sich doch herab ließ, sie durch eine förmliche Besichtigung der Gebäude, aus welchen ihr Schrecken entsprang, zu beruhigen. Er erzählte den Umstand mit der Thür, die nicht nachgeben wollte, die Töne, welche von innen aufstiegen, und die Entdeckung des eingefallenen Daches, erklärte aber, daß weder er, noch irgend einer von seinen Kameraden glauben könnte, daß das Getöse, oder die Versperrung des Wegs daher entstanden sey; »denn, gnädiger Herr!« fuhr er fort —»es schien, als wenn die Thür blos an einer Stelle gehalten würde, und das Getös — o mein Gott! ich werde nie vergessen, was für ein Getös das war — tausend Mahl ärger, als was Steine machen können.« — Ferdinand hörte mit stiller Verwunderung dieser Erzählung zu; eine Verwunderung, die nicht das Abenteuer selbst, sondern die Kühnheit und anscheinende Unbesonnenheit des Marquis in ihm erregte, der auf solche Art den schrecklichen Ort, den er selbst aus Erfahrung die Wohnung eines gekränkten Geistes zu seyn wußte, der Besichtigung seiner Leute Preis gegeben hatte; ein Ort, den er bisher sorgsam vor dem menschlichen Auge und menschlicher Neugier verbarg, und den er seit so vielen Jahren selbst nicht zu betreten gewagt hatte. — Peter fuhr weiter fort, ward aber alsobald durch ein dumpfes Winseln, das aus der Erde herauf zu steigen schien, unterbrochen: »Heilige Jungfrau!« rief er aus. Ferdinand horchte in schauderlicher Erwartung. Länger und gräßlicher ward das Geheul wiederhohlt, als Peter von seinem Sitze aufsprang, die Laterne aufraffte, und aus dem Kerker sprang.
Ferdinand, der in gänzlicher Finsterniß zurück blieb, folgte ihm zur Thür, die der erschrockne Peter sich nicht Zeit genommen hatte, zu verschließen, die aber von selbst eingesprungen war, und durch ein Schloß gehalten zu werden schien, das nur von außen geöffnet werden konnte. — Ferdinands Empfindungen, als er sich so gezwungen sah, im Kerker zurück zu bleiben, sind unbeschreiblich. Die Schrecken der Nacht, was sie auch seyn mochten, mußte er allein ertragen; nach und nach erlangte er den Muth der Verzweiflung. Beynahe eine Stunde lang ließen sich die Töne von Zeit zu Zeit wieder hören; dann aber kehrte Stille zurück, und er blieb die ganze Nacht über ungestört. Keine Erscheinung schreckte Ferdinanden, und endlich sank er, von Angst und Wachen ermattet, in Schlummer.
Am folgenden Morgen kehrte Peter in den Kerker zurück, kaum wissend, was er erwarten sollte; dennoch aber etwas sehr Seltsames, vielleicht die Ermordung, vielleicht die übernatürliche Verschwindung seines jungen Herrn erwartend. Mit diesen wilden Schreckbildern erfüllt, wagte er sich nicht allein hinzugehen, sondern überredete einige von den Bedienten, denen er seine schreckliche Geschichte erzählt hatte, ihn bis zur Thür zu begleiten. Unter Weges erst fiel ihm ein, daß er sie zu verschließen vergessen hatte, und er fing nun an zu fürchten, daß sein Gefangener ohne Wunder entwischt sey. Er eilte zu der Thür, und erstaunte aufs höchste, sie verschlossen zu finden. Er hielt dieses für das Werk einer übernatürlichen Macht, als auf sein lautes Rufen eine Stimme von innen ihm antwortete. Seine unsinnige Furcht ließ ihm nicht zu, Ferdinands Stimme zu erkennen; auch ließ er sich nicht träumen, daß Ferdinand unterlassen haben könnte, zu entwischen; er schrieb also die Stimme dem Wesen zu, welches er in der vorher gehenden Nacht gehört hatte, sprang von der Thür zurück, und floh mit seinen Kameraden in die große Halle. Hier rief der Lärm, den ihr plötzliches Eindringen verursachte, eine Menge Menschen zusammen, worunter sich auch der Marquis befand, der alsobald von der Ursache des Aufruhrs und von der langen Geschichte der vorigen Nacht unterrichtet wurde. Bey dieser Nachricht nahm der Marquis einen sehr finstern Blick an, verwies Petern seine Unbesonnenheit aufs strengste, und warf zugleich den andern Bedienten ihr unpflichtmäßiges Betragen vor, daß sie so seine Ruhe störten. Er erinnerte sie, wie gütig er sich herab gelassen hatte, ihre Furcht zu zerstreuen, und an den Ausgang der Untersuchung, und versicherte sie dann, da Nachsicht nur ihre Unverschämtheit aufgemuntert hätte, würde er in Zukunft strenger verfahren, und daß der erste, der ihn wieder mit diesen lächerlichen Besorgnissen beunruhigte, oder den Frieden des Schlosses durch Verbreitung solcher einfältigen Mährchen zu stören wagte, aufs strengste gestraft, und aus seinem Gebiethe verbannt werden sollte. Sie erschraken bey dieser Drohung, und schwiegen. »Bringt mir eine Fackel,« sagte der Marquis, »und leuchtet mir in den Kerker! Ich will noch ein Mahl mich herab lassen, euch zu widerlegen.« — Sie gehorchten, und stiegen mit dem Marquis herab, der so, wie er vor den Kerker kam, die Thür aufriß, und den erstaunten Augen seiner Begleiter — Ferdinanden zeigte. — Ferdinand starrte befremdet auf, als er seinen Vater in solcher Begleitung herein treten sah. Der Marquis schoß einen strengen Blick auf ihn, den er vollkommen verstand. —»Nun,« rief er, und wendete sich zu seinen Leuten; »was seht ihr jetzt?— Meinen Sohn, den ich selbst hierher brachte, und dessen Stimme, als sie eurem Rufen antwortete, ihr in unerhörte Töne umgeschaffen habt. — Sprich, Ferdinand, und bestätige was ich sage!« — Ferdinand that's. »Was für ein furchtbarer Geist erschien dir in der vorigen Nacht?« fuhr der Marquis fort, und sah ihn fest an. »Ergetze diese Burschen mit einer Beschreibung desselben; denn sie können nicht ohne etwas Wunderbares leben.«
»Ich sah keinen Geist, gnädiger Herr!« antwortete Ferdinand, der des Marquis Betragen nur zu wohl verstand.
»Es ist gut,« rief der Marquis, »und dieß ist das letzte Mahl gewesen,« indem er sich zu seinen Bedienten wendete, »daß eure Thorheit so gelinde behandelt worden.« Er redete nicht weiter von der Sache, und enthielt sich, Ferdinanden in Gegenwart der Bedienten nur eine Frage über die nächtlichen Töne, welche Peter beschrieben hatte, vorzulegen. Er verließ den Kerker, indem er feste Blicke voll Zorn und Argwohn auf Ferdinanden schoß. Er fürchtete, daß sein Sohn sich durch sein Schrecken hätte verleiten lassen, Petern einen Theil des ihm anvertrauten Geheimnisses zu verrathen, und suchte schlau mit anscheinender Gleichgültigkeit Petern über die Umstände der vorher gehenden Nacht auszuforschen; allein seine Antwort sprach Ferdinanden ehrenvoll von aller Unbesonnenheit frey, und befreyte den Marquis von seinen quälenden Besorgnissen.
Die folgende Nacht verstrich ruhig; kein Schall, keine Erscheinung störte Ferdinands Frieden. Den andern Tag aber hielt es der Marquis für zuträglich, die Härte seiner Leiden zu mildern, und ließ ihn aus seinem Kerker in ein Zimmer bringen, das zwar mit starken Gittern versehen, aber doch dem Lichte des Tages zugänglich war. —Indessen ereignete sich ein Umstand, der die allgemeine Zwietracht vermehrte, und Emilien mit dem Verluste ihres letzten Trostes bedrohte — der Rath, die zärtliche Theilnahme der Madame de Menon. Die Marquise, deren Leidenschaft für den Grafen Vereza endlich der Abwesenheit und dem Drange der gegenwärtigen Umstände wich, beglückte jetzt einen jungen, italiänischen Cavalier, der zum Besuche auf dem Schlosse war, und zu viel von dem Geiste der Galanterie besaß, um eine Dame vergebens schmachten zu lassen, mit ihrem Lächeln. Der Marquis, dessen Seele mit andern Leidenschaften erfüllt war, bemerkte das sträfliche Betragen seiner Gemahlinn nicht, die zu allen Zeiten Verschlagenheit genug besaß, ihre Laster unter dem Anstriche von Tugend und unschuldiger Freyheit zu verbergen. Das Schicksal wollte, daß Madame diese Liebschaft entdeckte. Eines Tages, da sie im Sprachzimmer ein Buch hatte liegen lassen, ging sie hinunter, um es zu suchen. So wie sie die Thür öffnete, hörte sie den Cavalier in sehr leidenschaftlichen Ausrufungen, und als sie herein trat, sah sie ihn in großer Bestürzung von den Füßen der Marquise aufstehen, die einen bittern Blick auf Madame schoß, und von ihrem Stuhle ebenfalls aufstand. Madame, betroffen über das, was sie gesehen hatte, zog sich schnell zurück, und begrub in ihren Busen ein Geheimniß, welches unfehlbar des Marquis Ruhe vergiftet haben müßte.
Die Marquise, welche von dem Edelmuthe, der Madame de Menons Betragen lenkte, keinen Begriff hatte, zweifelte nicht, daß sie den Augenblick der Wiedervergeltung ergreifen, und ihr Betragen an dem Orte kund machen würde, wo sie es bekannt zu wissen am meisten fürchtete. Das Bewußtseyn der Schuld quälte sie mit unaufhörlicher Furcht, verrathen zu werden, und von diesem Augenblicke an sann sie nur darauf, die Person, welcher ihr Charakter bekannt geworden war, aus dem Schlosse zu treiben. Dieses ward ihr nicht schwer. Madame's feines Gefühl ließ sie schnell ein Betragen, daß der natürlichen Würde ihres Charakters so wenig gemäß war, fühlen, und sich demselben entziehen. Sie setzte sich vor, das Schloß zu verlassen; weil sie es aber verachtete, selbst einen siegenden Feind zu beschämen, so beschloß sie, über einen Punct zu schweigen, welcher augenblicklich den Triumph von ihrer Feindin ab, und auf sie gebracht haben würde. Sie enthielt sich, dem Marquis auf sein inständiges Fragen nach der Ursache ihres Entschlusses die Wahrheit Im Original an dieser Stelle ein Setzfehler: »wahre« statt »Wahrheit«. — Anm.d.Hrsg. zu sagen, und ließ ihn in Ungewißheit und Kränkung zurück.
Emilien verursachte dieser Vorsatz einen Schmerz, welcher beynahe Madame's Entschlossenheit überwältigte. Ihre Thränen und Bitten sprachen mit der kunstlosen Stärke des Kummers. Sie verlor in Madame ihre einzige Freundinn, und wußte ihren Werth zu gut zu schätzen, um sie ohne die tiefste Trauer abreisen zu sehen. Fortdauernde Zärtlichkeit für das Andenken ihrer Mutter hatte Madame bewegt, die Erziehung ihrer Töchter zu übernehmen, deren gefällige Gemüthsart gleichsam eine erbliche Zuneigung auf sie fortgepflanzt hatte. Nur Achtung und Rücksicht für Emilien und Julien hatten sie seit einiger Zeit auf dem Schlosse zurück gehalten; jetzt aber überwältigten andere zu starke Betrachtungen diese Gefühle. — Weil sie nur ein kleines Einkommen besaß, so war es ihr Plan, sich nach ihrem Geburtsorte, der in einem entfernten Theile der Insel lag, zurück zu ziehen, und daselbst in einem Kloster ihre Wohnung aufzuschlagen. — Emilie sah mit wachsendem Kummer die Zeit von Madame's Abreise heran nahen. Mit einem gegenseitigen Schmerz, der ihrem Herzen Ehre machte, verließen sie einander. Als nun auch ihre letzte Freundinn dahin war, wanderte die trostlose Emilie mit einer schmerzhaften Sehnsucht, welche nur diejenigen sich denken können, die einst eine ähnliche Lage erfuhren, durch die verlaßnen Zimmer, wo sie mit Julien zu sprechen, Trost und Theilnahme von ihrer mütterlichen Freundinn zu empfangen gewohnt war. Auch Madame setzte ihre Reise mit beklemmtem Herzen fort. Getrennt von den Gegenständen ihrer zärtlichsten Liebe, von den Scenen und Beschäftigungen, an welche lange Gewohnheit sie gekettet hatte, schien sie keine Theilnahme, keinen Bewegungsgrund zur Thätigkeit mehr in sich zu fühlen. Die Welt schien ihr eine weite, dunkle Wüste, wo kein Herz freundlich sie bewillkommte, kein Gesicht bey ihrer Annäherung sich in Lächeln erheiterte. Seit vielen Jahren hatte sie Calini verlassen, und in der Zwischenzeit hatte der Tod die wenigen Freunde, die sie dort ließ, hinweg gerafft. Die Zukunft both ihr nur eine finstre Aussicht dar; nur der Rückblick auf Jahre, die in ehrenvoller Thätigkeit, in strenger Rechtschaffenheit verlebt wurden, strahlte Heiterkeit und einen Schimmer von Hoffnung in ihr Herz. — Nur vermochte ihr äußerstes Bestreben nicht, die Angst zu unterdrücken, womit Juliens ungewisses Schicksal sie erfüllte. Wilde, schreckliche Bilder stiegen vor ihrer Einbildungskraft auf. Fantasie zeichnete die Scene; sie vertiefte die Schatten, und der schreckliche Anblick der Gegenstände, welche sie darstellte, ward noch durch die Dunkelheit, worein sie gehüllt waren, erhöht.
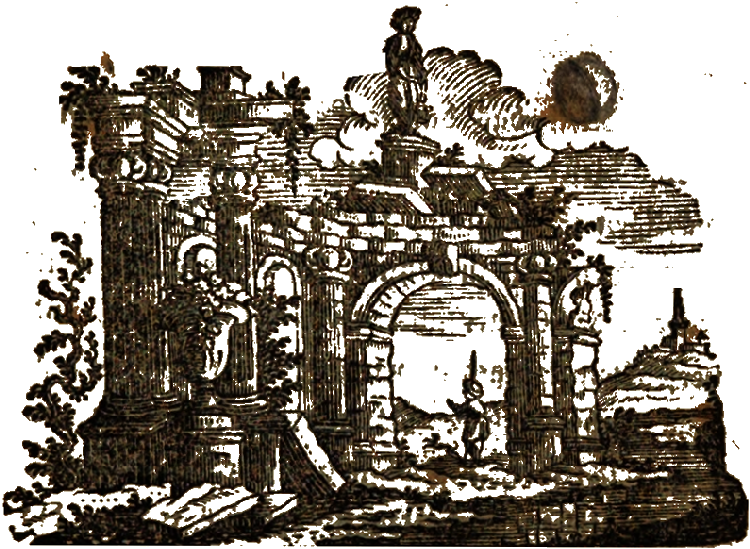
Illustration aus der Ausgabe von 1798.
Mit Tagesneige kam Madame in einem kleinen Dorfe zwischen Gebirgen an, wo sie die Nacht zuzubringen dachte. Der Abend war außerordentlich angenehm, und die romantische Schönheit der umliegenden Gegend lud sie zu einem Spaziergange ein. Sie folgte den Krümmungen eines Baches, der sich in einiger Entfernung zwischen üppigen Kastanienwäldern verlor. Die reiche Farbe des Abends glühte durch das dunkle Laub, und die düstre Stille dieser Schattengänge, die mit der gegenwärtigen Stimmung ihrer Seele harmonirte, lockte sie hinein zu gehen. Ihre Gedanken weilten auf den Gegenständen rings um sie her, und versenkten sie nach und nach in eine süße, behagliche Schwermuth. Unmerklich schritt sie immer weiter fort, und folgte dem Laufe des Bachs, bis die tiefen Schatten sich zurück zogen, die Gegend sich dem Tageslichte wieder öffnete, und ihr eine so mannigfaltige, erhabne Aussicht zeigte, daß sie in entzücktem Staunen da stand. — Eine Gruppe wilder, grotesker Felsen, deren fantastische Gestalten die Natur in ihren erhabensten, wunderbarsten Stellungen zeigten, stiegen im Halbzirkel auf. Hier hob die weite Pracht der Schöpfung die Seele des Anschauenden zu hoher Begeisterung empor: Fantasie haschte das schwirrende Gefühl auf, und durch ihre Berührung wurden die aufgethürmten Stufen mit unwirklicher Dunkelheit umschattet; finstrer runzelten die Klüfte ihre Stirnen; die hervorragenden Klippen blickten furchtbarer, und das wild überhangende Gesträuch wehte in tieferm Gemurmel in die Lüfte. Schauder und Ehrfurcht durchdrangen Madame de Menon; unwillkürlich stiegen ihre Gedanken von der Natur zu der Natur Schöpfer auf. Der letzte, sterbende Schimmer des Tages röthete die Felsen, und strahlte auf das Wasser, das sich durch einen rauhen Canal zurück zog, und sich in der Ferne zwischen den weichenden Klippen verlor. — Während sie seinem fernen Gemurmel zuhörte, stieg eine süße, melodische Stimme zwischen den Felsen auf, und sang ein Lied, dessen schwermüthiger Ausdruck alle ihre Aufmerksamkeit rege machte, und ihr Herz durchdrang. Die Töne schwollen, und starben leise hinweg in den hellen und doch sanften Echo's, die mit einer der Bezauberung gleichen Wirkung von den Felsen wiederhallten. Madame sah sich nach der süßen Sängerinn um, und entdeckte in einiger Entfernung ein Bauernmädchen, das auf einem kleinen Abhange des Felsens, von herab hängendem Geißblatt beschattet, saß. Sie ging langsam nach dem Orte zu, und hatte ihn beynahe erreicht, als der Laut ihrer Schritte die kleine Syrene erschreckte, und zum Schweigen brachte; sie stand auf, als wollte sie von dannen eilen. — Madame's Stimme hielt sie zurück; sie kam näher — und welche Sprache kann Madame de Menons Empfindung ausdrücken, als sie in der Verkleidung einer Bäuerinn Juliens Züge erkannte, deren Augen mit plötzlicher Erinnerung sich aufschlagen, und die, von Freude überwältigt, in ihre Arme sank. Als der erste gegenseitige Ausbruch ihrer Empfindungen sich gelegt, und Julie auf ihre Fragen nach Ferdinanden und Emilien Antwort erhalten hatte, führte sie Madame nach ihrem heimlichen Aufenthalte. Es war eine einsame Hütte, in einem eingeschloßnen Thale von Bergen umgeben, deren Klippen jedem menschlichen Fußtritte unzugänglich zu seyn schienen. Die tiefe Einsamkeit der Scene zerstreute auf ein Mahl Madame's Verwunderung, daß Julie so lange unentdeckt geblieben war; und sie erstaunte nur, wie Julie einen so tief verborgenen Platz hatte auffinden können. Mit tiefem Kummer aber bemerkte sie, daß auf Juliens Gesichte nicht länger das Lächeln der Gesundheit und Freude strahlte. Ihren schönen Zügen war nicht nur der Eindruck der Schwermuth, sondern tiefen Schmerzens aufgeprägt. Madame seufzte, als sie sie anblickte, und las zu deutlich die Ursache dieser Veränderung. Julie verstand den Seufzer, und beantwortete ihn mit Thränen. In wehmüthigem Stillschweigen drückte sie Madame's Hand an ihre Lippen; eine Carminröthe überzog ihre Wangen. Endlich faßte sie sich. — »Ich habe Ihnen viel zu erläutern, meine mütterliche Freundinn,« sagte sie; »ehe Sie mich wieder in die Achtung aufnehmen werden, welche einst mein gerechter Stolz war. Ich hatte keine Hülfsmittel vor dem Elende, als Flucht, und von dieser konnte ich Sie nicht zur Vertrauten machen, ohne unedel Sie in die Schmach derselben zu verwickeln.»
»Sagen Sie nichts weiter darüber, meine Liebe! ich habe Ihr Betragen in Rücksicht meiner bewundert, und schmerzlich Ihre Lage beklagt. Lassen Sie mich lieber hören, durch welche Mittel Sie Ihre Flucht bewirkten, und wie es Ihnen seit dem gegangen ist?«
Julie schwieg einen Augenblick, als wollte sie ihre aufsteigende Bewegung ersticken, und fing dann ihre Erzählung an: — »Sie wissen bereits das Geheimniß der Nacht, die für meinen Frieden so unglücklich war. Ich rufe die Erinnerung daran mit einem Schmerze zurück, welchen zu verhehlen nicht in meiner Macht ist; und warum sollte ich ihn auch verhehlen, da ich um einen klage, dessen edle Eigenschaften meine ganze Anbethung rechtfertigten, und mehr verdienten, als mein schwaches Lob gewähren kann; der Gedanke an ihn wird der letzte seyn, der in meiner Seele dämmert, bis der Tod diese traurige Scene schließt.« — Ihre Stimme bebte; sie hielt inne. Nach einigen Augenblicken setzte sie ihre Erzählung fort. — »Ich will mir den Kummer ersparen, zu Auftritten zurück zu gehen, die Ihnen nicht unbekannt sind, und eile lieber zu dem, was Ihre Theilnahme unmittelbar erregen wird. Sie wissen, daß mich mein treues Mädchen, Catharine, in meinen Verhaft begleitete; ihrer Freundschaft verdanke, ich meine Flucht. Sie erhielt von ihrem Liebhaber, einem Bedienten im Schlosse, den Beystand, der mir die Freyheit verschaffte. Eines Nachts, als Carlo, der zu meiner Wache ernannt war, schlief, kroch Nicolo in seine Kammer, und stahl ihm die Schlüssel zu meinem Gefängnisse. Er hatte zuvor eine Strickleiter angeschafft. — O! nie werde ich meine Bewegung vergessen, als ich in der Todesstunde eben der Nacht, die meinem Opfertage vorher gehen sollte, die Thür meines Kerkers aufschließen hörte, und mich zur Hälfte in Freyheit sah! Kaum konnten meine zitternden Glieder mich tragen, als ich Catharinen in den Saal folgte, dessen niedrige und auf die Terrasse stoßende Fenster unserm Vorhaben günstig waren. Wir erreichten ohne Mühe die Terrasse, wo Nicolo uns mit der Strickleiter erwartete. Er befestigte sie auf der Erde, und nachdem er die Spitze der kleinen Geländermauer erstiegen hatte, ließ er sie geschwinde an der andern Seite herunter. Er hielt sie, während wir hinauf und herunter stiegen, und bald athmete ich wieder die Luft der Freyheit. Allein die Furcht, eingehohlt zu werden, wirkte noch immer zu stark, um mir einen vollen Genuß meiner Flucht zu vergönnen. Mein Plan war, nach meiner treuen Catharine Geburtsorte zu gehen, wo sie mich einer sichern Zuflucht in der Hütte ihrer Ältern, vor denen ich leicht meinen Stand verhehlen konnte, da sie mich nie zuvor gesehen hatten, im voraus versicherte. Dieser Ort, sagte sie, sey dem Marquis ganz unbekannt, der sie erst vor einigen Monden zu Neapel gemiethet hatte, ohne sich nach ihrer Herkunft zu erkundigen. Sie hatte mir gesagt, daß das Dorf viele Meilen weit vom Schlosse entfernt läge, daß sie aber den Weg sehr gut wüßte. Am Fuße der Mauer verließen wir Nicolo, der, um allem Verdacht vorzubeugen, ins Schloß zurück gehen, und die Schlüssel wieder an Ort und Stelle legen wollte, sich aber vorsetzte, es zu einer weniger gefährlichen Zeit zu verlassen, und nach Farrini zu seiner guten Catharine zu kommen. Ich schied mit vielem Dank von ihm, und schenkte ihm ein kleines diamantenes Kreuz, das ich zu dem Ende von den Juwelen, die mir zum Brautschmucke geschickt wurden, genommen hatte. — Ungefähr eine Viertelstunde weit von den Mauern standen wir stille, und ich zog die Kleidung an, worin Sie mich jetzt sehen. Meine eigenen Kleider banden wir an einen schweren Stein, und Catharine warf sie in den Strom, dessen Rauschen Sie so oft bewundert haben. Die Strapaze und das Ungemach, welches ich auf dieser Reise zu Fuße erduldete, würde zu jeder andern Zeit mich umgeworfen haben; allein meine Seele war so ganz mit der Gefahr, der ich entfloh, beschäftiget, daß ich geringere Übel nicht fühlen konnte. Wir kamen wohlbehalten in der Hütte an, die in einiger Entfernung von dem Dorfe Farrini stand, und wurden von Catharinens Ältern mit einiger Verwunderung zwar, aber mit mehr Freundlichkeit noch aufgenommen. Ich sah bald ein, daß es unnütz, und sogar gefährlich seyn würde, wenn ich die Rolle, welche ich angenommen hatte, fortspielen wollte. Ich las in den Augen von Catharinens Mutter ein gewisses Staunen und Bewunderung, welche zeigten, daß sie mich von höherm Range glaubte. Ich hielt es für klüger, ihre Treue durch Anvertrauung meines Geheimnisses zu gewinnen, als es durch Verhehlung ihrer Neugier oder ihrem Scharfsinne Preis zu geben, und entdeckte ihr also meinen Stand und mein Unglück, und erhielt starke Versicherungen ihrer Treue und Hülfe. Um noch sicherer zu seyn,; begab ich mich an diesen verborgenen Ort. Die Hütte, worin wir jetzt sind, gehört einer Schwester von Catharinen, auf deren Treue ich mich mit Recht bisher verließ. Allein auch hier bin ich nicht furchtfrey, weil man vor einigen Tagen Leute zu Pferde von sehr verdächtigem Ansehen nahe bey Marcy bemerkt hat, das nur eine halbe Stunde von hier liegt.«
Hier endigte Julie ihre Erzählung, welcher Madame mit einer Mischung von Erstaunen und Mitleid, daß sich sichtlich in ihren Augen mahlte, zugehört hatte. Der letzte Umstand beunruhigte sie ungemein. Sie erzählte Julien, daß der Herzog ihr nachgesetzt hatte, und zweifelte nicht, daß die Reiter, deren Julie erwähnte, ein Theil seines Gefolges waren, Sie rieth ihr dringend, ihre gegenwärtige Lage zu verlassen, und sie verkleidet in das St. Augustinerkloster zu begleiten, wo sie eine sichere Zuflucht finden würde, weil, wenn man auch selbst ihren Aufenthalt entdeckte, die höhere Autorität der Kirche sie schützen würde. Julie nahm den Vorschlag mit Freuden an; weil es aber nothwendig war, daß Madame in dem Dorfe schlief, wo sie ihre Bedienten und Pferde gelassen hatte, so wurde ausgemacht, daß sie mit Tages Anbruche nach der Hütte zurück kehrte, wo Julie sie erwarten wollte. Madame nahm einen zärtlichen Abschied von Julien, deren Herz, Trotz der Vernunft, in ihr sank, als sie für den kurzen Zwischenraum der Ruhe sie fortgehen sah. — Mit der Tagesdämmerung stand Madame auf. Ihre Bedienten, die sie zur Reise miethete, kannten Julien nicht, die also nichts von ihnen zu fürchten hatte. Madame ließ ihre Leute in einiger Entfernung zurück, und erreichte noch vor Sonnenaufgang die Hütte. Ihr Herz weissagte ihr nichts Gutes, als sie an die Thür klopfte, und keine Antwort erhielt. Sie klopfte nochmahls, und alles blieb stille. Durch das Fensterloch konnte sie in der grauen Dämmerung des Tages keinen Gegenstand unterscheiden; sie öffnete endlich die Thür, und fand zu ihrer unaussprechlichen Bestürzung die Hütte leer. Sie ging weiterhin ein kleines, inneres Zimmer, wo einige Kleidungsstücke von Julien lagen. Es schien nicht, als wenn jemand in dem Bette geschlafen hätte, und jeder Augenblick erhöhte und bestärkte ihren Verdacht. Während sie ihr Suchen weiter fortsetzte, hörte sie plötzlich Fußtritte vor der Hüttenthür, und gleich nachher kam jemand herein. Ihre Besorgnisse für Julien wichen nun der Angst um ihre eigene Sicherheit, und sie war unschlüssig, ob sie sich zu erkennen geben, oder sich verbergen sollte, als Juliens Erscheinung sie aus ihrer Unschlüssigkeit riß. — Als die gute Frau zurück kam, die Madame am Abend zuvor nach dem Dorfe begleitet hatte, ging Julie nach der Hütte zu Farrini. Ihr dankbares Herz erlaubte ihr nicht fortzugehen, bevor sie Abschied von ihren treuen Freunden genommen, ihnen für ihre Güte gedankt, und sie von ihren künftigen Aussichten unterrichtet hatte. Sie bathen sie, die wenigen Zwischenstunden in dieser Hütte zuzubringen, aus welcher sie eben gekommen war, um Madame zu treffen. — Sie eilten jetzt nach dem Orte, wo die Pferde standen, und traten ihre Reise an. Einige Meilen weit reisten sie schweigend und gedankenvoll durch ein wildes, romantisches Land. Die Landschaft war mit reichen, mannigfaltigen Farben tingirt, und der herbstliche Glanz, der von den Hügeln strahlte, machte eine schöne und lebhafte Wirkung auf die Scene. Alle Pracht der Weinberge stand vor ihrem Blicke da: die Purpurtrauben blickten durch das dunkle Grün der Blätter, und die Aussicht glühte von reicher, üppiger Fülle. — Sie stiegen nun in ein tiefes Thal herab, welches mehr einem Feenplatze, als der Wirklichkeit glich. Auf dem Grunde hin rollte majestätisch ein heller Strom, dessen Ufer mit dicken Lustwäldern von Orangen und Citronenbäumen geschmückt waren. Mit stillem Wohlgefallen überschaute Julie die Gegend; bald aber traf ihr Auge auf einen Gegenstand, welcher augenblicklich den Ton ihrer Gefühle erschütterte. Sie nahm einen Haufen Reiter wahr, die sich einen Hügel hinter ihnen herab wanden. Ihre ungewöhnliche Eile beunruhigte Julien, und sie setzte ihr Pferd in Galopp. Als sie sich umsah, bemerkte sie deutlich, daß sie verfolgt wurde. Bald nachher erschienen die Leute plötzlich hinter einem dunklen Gehölze in kleiner Entfernung von ihnen, und als sie näher kamen, sank Julie, von Furcht und Ermüdung überwältigt, athemlos vom Pferde. Einer von den Verfolgern fing sie in seine Arme auf. Madame nebst den übrigen wurde schnell eingehohlt, und so bald Julie wieder zum Leben kam, wurden sie gebunden und nach dem Hügel geführt, von dem sie herunter gekommen waren. Nur die Einbildungskraft kann sich Juliens Schmerz mahlen, als sie sich so der Gewalt ihrer Feinde ausgeliefert sah. Madame erkannte unter dem Haufen keinen von des Marquis Leuten, und sie waren also allem Anscheine nach in des Herzogs Händen. — Nachdem sie einige Stunden lang gereiset waren, verließen sie die ordentliche Straße, und lenkten in einen kleinen, krummen Weg, von hohen Bäumen überschattet, welche beynahe das Licht ausschlossen. Die Dunkelheit des Orts flößte schreckliche Bilder ein. Julie zitterte, als sie hinein trat, und ihre Bewegung wurde erhöht, als sie in einiger Entfernung durch die lange Reihe von Bäumen ein großes, verfallenes Gebäude wahrnahmen. Die düstern Schatten ringsum verbargen es zum Theil vor ihrem Blicke; als sie aber näher kam, enthüllte sich nach und nach jeder verlaßne und verfallene Theil des Gebäudes, und erfüllte ihr Herz mit einem Grausen, das sie noch nie zuvor gefühlt hatte. Die zerbrochenen Zinnen, mit Epheu überwachsen, verkündigten die gefallene Größe des Ortes, während die zerschmetterten, leeren Fensterrahmen seine Verödung anzeigten, und das hohe Gras, welches über der Thürschwelle hervor ragte, zu sagen schien, daß seit langer Zeit kein sterblicher Fuß sie betreten hatte. Der Ort schien nur zu Zwecken der Gewaltthätigkeit und Zerstörung brauchbar zu seyn, und die unglücklichen Gefangenen fühlten, als sie die Thore desselben betraten, die ganze Gewalt seiner Schrecknisse. — Sie wurden von ihren Pferden gehoben,und nach einem innern Theile des Gebäudes gebracht, der, wenn er einst ein Zimmer gewesen war, nicht länger den Nahmen verdiente. Die Wache sagte ihnen hier, daß ihr befohlen sey, sie bis zur Ankunft ihres Herrn, der diesen Ort zur Zusammenkunft bestimmt hätte, hier zu behalten. Er wurde in wenig Stunden erwartet, und dieses waren Stunden unaussprechlicher Qual für Julien und Madame. Von den wüthenden Leidenschaften des Herzogs, die durch öftre Vereitelung nur noch heftiger gereizt waren, hatte Julie alles zu fürchten, und die Einsamkeit des Orts, den er gewählt hatte, setzte ihn in den Stand, jedes noch so gewaltthätige Unternehmen zu vollbringen. Zum ersten Mahle bereute sie, ihres Vaters Haus verlassen zu haben. Madame weinte über sie; Trost aber hatte sie nicht zu geben. Der Tag neigte sich; der Herzog erschien nicht, und Juliens Schicksal schwebte noch in gefahrvoller Ungewißheit. Endlich sah sie aus einem Fenster des Zimmers, worin sie war, Fackeln durch die Bäume schimmern, und gleich nachher überzeugte sie das Klappern von Hufen, daß der Herzog heran nahte. Ihr Herz sank bey dem Schalle; sie schlug ihre Arme um Madame's Hals, und gab sich der Verzweiflung hin. Bald schreckten einige Leute, welche die Ankunft ihres Herrn zu verkündigen kamen, sie auf. Nach wenig Minuten hallte der Ort, in welchem bis jetzt tiefe Stille herrschte, von Getöse wieder; eine plötzliche Lichtflamme erleuchtete das Gebäude, und zeigte nur stärker die Schrecknisse desselben. Julie lief ans Fenster, und sah in einer Art von Vorhofe einen Haufen Menschen von ihren Pferden steigen. Die Fackeln verbreiteten ein theilweises Licht, und während sie sich ängstlich nach der Person des Herzogs umsah, trat die ganze Gesellschaft ins Haus. Sie horchte einem verworrnen Gewühle von Stimmen zu, die aus dem Zimmer unten herauf tönten, und bald nachher in ein leises Gemurmel sanken, als wenn ein Punct von Wichtigkeit verhandelt würde. Einige Augenblicke saß sie in folternder Todesangst da, als sie Fußtritte auf das Zimmer zuschreiten hörte, und ein plötzlicher Schimmer von Fackeln Licht auf die Wände blitzte.
»Elende! hab' ich dich endlich in Sicherheit gebracht?« — sagte ein Cavalier, der jetzt ins Zimmer trat. Er fuhr zurück, als er Julien wahrnahm, und wendete sich zu seinen Leuten, die außen standen.
»Sind dieses die Flüchtlinge, die ihr gefangen nahmt?« —
»Ja, gnädiger Herr!» —
»Dann habt ihr euch betrogen und mich irre geführt: dieses ist nicht meine Tochter.«
Diese Worte strahlten das plötzliche Licht der Wahrheit und Freude in Juliens Herz, welche Schrecken zuvor beynahe leblos gemacht hatte, und die nicht sah, daß der Hereinkommende ein Fremder war. Madame nahm nun das Wort für ihren Zögling, und es erfolgte eine Erklärung, woraus sich zeigte, daß der Fremde der Marquis Murani war, der Vater der schönen Flüchtigen, welche der Herzog zuvor für Julien hielt. Juliens Ansehen und augenscheinliche Flucht hatten die Banditen, deren dieser Herr sich bediente, glauben gemacht, daß sie der Gegenstand ihres Suchens sey, und ihr diese unnöthige Qual verursacht. Allein die Freude, die sie jetzt fühlte, sich so unerwartet in Freyheit zu finden, übertraf, womöglich, ihre vorher gehende Angst. Der Marquis gab Madame und Julien allen Ersatz, der nur in seiner Macht war; er erboth sich, sie sogleich wieder auf den ordentlichen Weg zu führen, und sie bis zu einem Sicherheitsorte für die Nacht zu begleiten. Dieses Anerbiethen wurde dankbar und freudig angenommen, und so erschöpft sie auch von Angst, Ermüdung und Mangel an Nahrung waren, bestiegen sie doch freudig ihre Pferde wieder, und verließen bey Fackellicht das Gebäude. Nach einem Ritte von einigen Stunden kamen sie in einer kleinen Stadt an, wo sie sich die ihnen so nöthige Bequemlichkeit verschafften. Hier verließen ihre Führer sie, um ihr Suchen weiter fortzusetzen. Mit der Dämmerung standen sie auf, und setzten ihre Reise fort, in unaufhörlicher Angst, des Herzogs Leute zu treffen. Um Mittag erreichten sie Azulia, von wo das Kloster, oder die St. Augustinerabtey nur eine Stunde entfernt lag. Madame schrieb an den Padre Abbate, mit dem sie etwas verwandt war, und erhielt bald nachher eine sehr günstige Antwort. An eben dem Abende noch verfügten sie sich in die Abtey, wo Julie, noch ein Mahl von der Furcht vor Verfolgung befreyt, ein Gebeth der Dankbarkeit zum Himmel schickte, und ihren Kummer durch Andacht zu besänftigen suchte. Der Abt nahm sie mit einer väterlichen Zärtlichkeit, und die Nonnen sie mit dienstfertiger Freundschaft auf. Erheitert durch diese Behandlung und durch das friedliche Ansehen von allem, was um sie war, legte sie sich zur Ruhe, und brachte die Nacht in friedlichem Schlummer hin. Sie fand in ihrer gegenwärtigen Lage viel Neues, das sie, unterhalten, viel ernsthaften Stoff, der ihre Seele beschäftigen konnte. Durch Kummer weich gemacht, fügte sie sich gern in die stillen Sitten ihrer Gesellschafterinnen, und in die friedliche Einförmigkeit eines klösterlichen Lebens. Sie mochte gern durch die einsamen Kreuzgänge und durch die hohen Kirchenwölbungen wandeln, deren lange Aussichten sich in einfacher Größe endigten, und heilige Ruhe ringsum verbreiteten. Sie fand viel Vergnügen im Umgange mit den Nonnen, worunter einige außerordentlich liebenswürdig waren, und über deren Wesen eine milde Würde einen unwiderstehlichen Reiz goß. Die sanfte Schwermuth, die ihrem Gesichte eingedrückt war, mahlte den Zustand ihrer Seelen, und erregte in Julien eine interessante Mischung von Mitleid und Achtung. Sie verschwendeten an Julien die liebevolle Benennung Schwester, und alle die fesselnde Zärtlichkeit, die sie so ganz in ihrer Gewalt hatten, und so gut ihre Wirkung kannten, in der Hoffnung, sie für ihren Orden zu gewinnen. Durch Madame's Gegenwart, durch die Freundschaft der Nonnen und durch die Stille und Heiligkeit des Ortes gesänftigt, erlangte ihre Seele nach und nach einen Grad von Ruhe wieder, den sie lange nicht nicht gekannt hatte. Doch drängte, Trotz alle ihrem Bemühen, oftmahls Hippolytus Bild mit einer Gewalt, die plötzlich ihre ganze Stärke zu Boden warf, sich in ihre Seele, und senkte sie in eine vorübergehende Verzweiflung. Unter den heiligen Schwestern unterschied Julie eine, deren auszeichnend heiße Andacht und schwermüthiger Blick, durch mattes Kranksehen gemildert, ihre Neugier anzog, und einen starken Grad von Mitleid in ihr erregte. Die Nonne schien ebenfalls durch eine gewisse Sympathie zu Julien hingezogen zu werden, welche sie durch unzählige Handlungen der Zuneigung an den Tag legte, die das Herz schnell versteht und erkennt, obgleich die Beschreibung sie nicht erhaschen kann. Im Gespräche mit ihr suchte Julie, so sehr es die Delicatesse verstattete, eine Erklärung des mehr als gewöhnlichen Kummers zu erhalten, welcher diese Züge beschattete, aus denen Schönheit, durch Duldung rührend gemacht, durch Religion geadelt, mit mildem, süßem Glanze hervor strahlte. —
Der Herzog von Luovo, den das Fieber, welches seine Wunden hervor brachten, und seine aufgereizten Leidenschaften verlängerten, einige Wochen verhaftet hatte, kam nun auf dem Schlosse Mazzini an. Als der Marquis ihn zurück kommen sah, und sich an die Fruchtlosigkeit der Schritte erinnerte, wodurch er so prahlerisch Julien wieder zu bekommen versprochen hatte, trotzte die natürliche Heftigkeit seines Temperaments der Kunst der Verstellung, und brach in verächtlichen Spöttereyen über die Tapferkeit und den Scharfsinn des Herzogs aus, die alsobald mit gleicher Bitterkeit zurück gegeben wurden. Wahrscheinlich würden die Folgen sehr unglücklich gewesen seyn, hätte nicht des Marquis Ehrgeiz das plötzliche Aufbrausen seiner untergeordneten Leidenschaften überwunden, und ihn vermocht, die Strenge seiner Beschuldigungen zu mildern und sie zurück zu nehmen. Der Herzog, dessen Leidenschaft für Julien durch die Schwierigkeit, welche sich ihr entgegen setzte, erhöhet ward, ließ eine Zurücknahme Statt finden, die er unter andern Umständen würde verworfen haben; und so unterwarf sich jeder, durch die herrschende Leidenschaft des Augenblicks besiegt, der Sclave seines Widersachers zu seyn. Emilie wurde endlich aus dem Verhafte, der ihr so ungerechter Weise auferlegt war, befreyt. Sie bekam den Gebrauch ihrer alten Zimmer wieder, wo einsam und niedergeschlagen ihre Stunden schwerfällig hinschlichen, durch unaufhörliche Angst um Julien, und durch Kummer um die verlorne Gesellschaft der Madame de Menon verbittert. Die Marquise, deren Vergnügen durch die gegenwärtige Verwirrung im Schlosse auf einige Zeit unterbrochen ward, ließ alle mürrischen Launen, welche Verdruß und lange Weile in ihr erzeugten, an dem einzigen übrig bleibenden Gegenstande aus. Emilie war verurtheilt zu leiden, ohne daß sie selbst die Freyheit zu klagen behielt. Wenn sie in die Begebenheiten der letzten wenigen Wochen zurück blickte, so sah sie die, welche ihr am theuersten waren, verkannt oder verhaftet durch den geheimen Einfluß eines Weibes, in deren Charakter jeder Zug das Gegenbild der liebenswürdigen Mutter war, deren Stelle sie ersetzen sollte. Das Suchen nach Julien wurde immer fortgesetzt, und blieb immer fruchtlos. Des Marquis Erstaunen wuchs mit seinem vereitelten Bemühen; denn wo konnte Julie, die des Landes unkundig, von Freunden entblößt war, möglicher Weise eine Zuflucht gefunden haben? Er schwor mit einem schrecklichen Eide, wenn er je sie wieder fände, die Unruhe, den Verdruß, den sie ihm gemacht hatte, an ihrem Haupte zu rächen. Allein er kam mit dem Herzoge überein, das Nachforschen auf eine Weile einzustellen, damit Julie dreister würde, und wenn sie anfinge, sich vor Verfolgung sicher zu glauben, sich nach und nach aus ihrem verborgnen Aufenthalte hervor wagte. —
Während dessen strebte Julie, in den dunklen Behältnissen des St.Augustinerklosters verborgen, sich einen Grad der Ruhe zu eigen zu machen, welche so auffallend die Gegenstände um sie charakterisirte. Die St. Augustinerabtey war eine große, prächtige Masse von gothischer Bauart, deren düstre Martern und majestätische Thürme in stolzer Erhabenheit zwischen den finstern Schatten ringsum hervor ragten. Sie war im zwölften Jahrhunderte gegründet, und stand da, ein stolzes Monument von mönchischem Aberglauben und fürstlicher Pracht. In den Zeiten, wo Italien durch innerlichen Aufruhr zerrissen, durch fremde Verheerer verfolgt wurde, gewährte dieses Gebäude manchen italiänischen Emigranten, die den Rest ihrer Tage hier der Religion weihten, eine Zuflucht. Bey ihrem Tode bereicherten sie dann das Kloster mit den Schätzen, welche zu retten es sie in den Stand gesetzt hatte. — Der Anblick dieser Gebäude regte in der Seele dessen, der sie sah, die Erinnerung an vergangne Zeitalter auf. Die Sitten und das Gepräge, welche sie auszeichneten, erhoben sich vor seiner Fantasie, und durch den langen Zwischenraum von Jahren erblickte er die Gebräuche und Sitten, welche einen so auffallenden Contrast mit den Gebräuchen seiner eignen Zeiten machten. Die rohen Sitten, die stürmenden Leidenschaften, der kühne Ehrgeiz, der vernunftwidrige Ablaß, welche vormahls den Priester, den Edelmann und den Monarchen charakterisirten, begannen jetzt der Gelehrsamkeit, den Reizen verfeinerter Unterhaltung, politischen Intriken, und geheimen Ränken Platz zu machen. So verändern sich die Scenen des Lebens mit den herrschenden Leidenschaften des Menschengeschlechts und mit den Fortschritten der Cultur. Die Sonne der Wissenschaft durchbricht die dunklen Wolken des Vorurtheils, und nach und nach sich zertheilend, lassen sie die erleuchtete Hemisphäre dem Einflusse ihrer Strahlen frey. Jetzt aber schienen nur noch wenige gebrochne Strahlen, die nur stärker die großen, schweren Massen zeigten, welche die Form der Wahrheit verhüllten. Vorurtheil, nicht Vernunft hielt hier den Einfluß der Leidenschaften zurück, und scholastische Gelehrsamkeit, mystische Philosophie und Wunderglaube herrschte statt Weisheit, Einfalt und reiner Andacht. — In der Abtey traf Einsamkeit und Stille mit dem feyerlichen Ansehen des Gebäudes zusammen, um die Seele mit heiligem Schauder zu erfüllen. Das trübe Glas der hoch gewölbten Fenster, mit den Farben mönchischer Dichtungen bemahlt, und beschattet von den dicken Bäumen, welche die Abtey umgaben, verbreiteten ein heiliges Dunkel rings umher, das dem Anschauenden gleichförmige Gefühle einflößte. Wenn Julie durch die Kreuzgänge schlich, und dieses weite Monument barbarischen Aberglaubens überschaute, erinnerte sie sich oft an eine Ode des Hippolytus, die sie mit schwermüthigem Gefühle wiederhohlte.
Aberglaube.
»Hoch zwischen Alverna's schauerlichen Felsenstufen wohnen ewige Schatten und Dunkelheit und Schweigen; sicher, wenn das einsame Lüftchen den Wiederhall herbey weht, traurige, feyerliche Melodien schwach empor schweben zu hören. — Thronend zwischen den wild herab hangenden Felsen, in Wolken gehüllt, über zukünftigem Weh brütend, erschüttert der Dämon Aberglaube die Natur, und schwenkt sein Zepter über die unten liegende Welt. — Rings um seinen Thron, durch die Mischung der Schatten hin, gleiten langsam wilde, scheußliche Gestalten. Er gebiethet ihnen zu fliegen, um der Erde glänzendste Blüthen zu verdüstern, und die Flamme der Verheerung weit umher zu verbreiten. — Sieh in der verdunkelten Luft ihren feurigen Flug! Verwüstung läßt auf der Erde sich nieder; Schrecken leitet mit wüthender Kraft ihre Schritte, und Tod und Rache schließen den Geisterzug. — Sieh die Purpurströme fließen! Höre das tiefe Brüllen des Schmerzens! der wahnsinnigen Furie Todtengeheul, der Tugend Seufzen, des Kummers Winseln! Weit, weit schwellen die Phantome, Raserey und Verzweiflung, die geschwängerte Luft mit Angstgeschrey! — Hört auf, ihr Verwüster! sterbt, bleiche Schreckbilder! Wendet eure Schritte weg! hemmt euren Grimm! gebt dem trauernden Tage Frieden wieder!«
[Im Original handelt es sich, anders als in der Übersetzung, tatsächlich um einen lyrischen Text:
Superstition
An Ode
High mid Alverna's awful steeps,
Eternal shades, and silence dwell.
Save, when the gale resounding sweeps,
Sad strains are faintly heard to swell:
Enthron'd amid the wild impending rocks,
Involved in clouds, and brooding future woe,
The demon Superstition Nature shocks,
And waves her sceptre o'er the world below.
Around her throne, amid the mingling glooms,
Wild — hideous forms are slowly seen to glide,
She bids them fly to shade earth's brightest blooms,
And spread the blast of Desolation wide.
See! in the darkened air their fiery course!
The sweeping ruin settles o'er the land,
Terror leads on their steps with madd'ning force,
And Death and Vengeance close the ghastly band!
Mark the purple streams that flow!
Mark the deep empassioned woe!
Frantic Fury's dying groan!
Virtue's sigh, and Sorrow's moan!
Wide — wide the phantoms swell the loaded air
With shrieks of anguish — madness and despair!
Cease your ruin! spectres dire!
Cease your wild terrific sway!
Turn your steps — and check your ire,
Yield to peace the mourning day!]
Sie weinte über dem Gedächtnisse vergangener Zeiten, und eine wollüstige, unbeschreibliche Schwermuth bemächtigte sich ihrer Gefühle. Madame bezeugte ihr die zärtlichste Aufmerksamkeit, und suchte ihre Gedanken von ihrem traurigen Gegenstande abzuziehen, indem sie den Geschmack an Lesen und Musik wieder hervor rief, welche ihren Talenten so angemessen waren; allein ein ernstlicher, interessanter Gegenstand beschäftigte jetzt die Aufmerksamkeit, welche bloße Vergnügungen nicht anziehen konnten. Juliens geliebte Nonne, für die ihre Liebe und Achtung täglich wuchs, schien dem Drucke ihres geheimen Kummers zu erliegen. Julien ging ihre Lage tief zu Herzen, und ob sie es gleich nicht in ihrer Macht hatte, ihrem Kummer Tröstung darzubiethen, suchte sie doch ihren körperlichen Leiden Linderung zu verschaffen. Sie pflegte sie mit unermüdeter Sorgfalt, und schien begierig, diese Gelegenheit zu ergreifen, ihrem eignen Kummer zu entwischen. Die Nonne schien sich vollkommen mit ihrem Schicksale ausgesöhnt zu haben, und zeigte während ihrer Krankheit so viel Sanftmuth, Geduld und stille Ergebung, daß sie alle, die um sie waren, mit Mitleid und Liebe erfüllte. Ihre engelgleiche Milde, ihre standhafte Festigkeit schienen mehr die Verklärung einer Heiligen, als den Tod eines sterblichen Wesens zu verkündigen. Julie lauschte mit ängstlicher Bekümmerniß auf jede Wendung ihrer Krankheit, und endlich belohnte Corneliens Wiedergenesung ihre Sorgfalt; nach und nach besserte sich ihre Gesundheit, und sie schrieb diese Besserung der unermüdeten Wartung und Zärtlichkeit ihrer jungen Freundinn zu, gegen die ihr Herz sich in warmer, unverhaltner Liebe ergoß. Endlich wagte es Julie, sie um das zu bitten, was sie so lange und inständig gewünscht hatte, und Cornelia eröffnete ihr die Geschichte ihres Leidens. — »Es ist mehr als gerecht,« sagte sie, »daß Sie die Begebenheiten des Lebens erfahren, welches Ihre Sorgfalt verlängert hat. Zwar sind diese Begebenheiten weder neu noch auffallend, und wenig vermögend, diejenigen zu interessiren, die nicht darin verwickelt waren. Indessen sind sie in der Wirkung unerwartet schrecklich für mich gewesen, und mein Herz versichert mich, daß sie Ihnen nicht gleichgültig seyn. werden. — Ich bin die unglückliche Abkömmlinginn eines alten, erlauchten italiänischen Hauses. In früher Kindheit ward ich der Vorsorge meiner Mutter beraubt; allein die Zärtlichkeit meines zurück gebliebenen Vaters ließ mich ihren Verlust kaum fühlen. Lassen Sie mich hier dem Charakter dieses edlen Vaters Gerechtigkeit erzeigen. Er vereinigte in hohem Maße die sanften Tugenden des geselligen Lebens mit dem festen, unbiegsamen Geiste der alten Römer, seiner Vorfahren, von welchen seinen Ursprung herzuleiten er stolz war. In der That wohnte ihr Verdienst stets auf seiner Zunge, und er bestrebte sich unaufhörlich, ihre Handlungen nachzuahmen, so weit es mit dem Charakter seiner Zeiten und mit der beschränkten Sphäre, worin er sich bewegte, bestehen konnte. Die Erinnerung seine Tugenden erhebt meine Seele, und erfüllt mein Herz mit einen edlen Stolze, den selbst die kalten Mauern eines Klosters nicht haben auslöschen können. — Meines, Vaters Vermögen war seinem Range nicht angemessen. Um seinen Sohn in den Stand zu setzen, einst die Würde seiner Familie zu behaupten, wurde mir der Schleyer bestimmt. Ach! das Herz, welches bereits einem irdischen Gegenstande sich geweiht hatte, war unwerth, dem Himmel zur Wohnung angebothen zu werden! Der jüngere Sohn eines benachbarten Edelmannes, dessen Character und Vorzüge meine frühe Liebe anzogen, meine spätere Achtung befestigten, hatte längst mein Herz gefesselt. Unsre Familien waren vertraut, und unser jugendlicher Umgang erzeugte eine Zuneigung, welche sich mit unsern Jahren erweiterte und erhöhte. Er hielt bey meinen Vater um mich an; aber hier stand ein unübersteiglicher Schranken unsrer Verbindung im Wege: — die Familie meines Geliebten seufzte unter eben so eingeschränkten Glücksumständen, als die unsrige. — Sie war edel, aber arm! Mein Vater, der die Stärke meiner Zärtlichkeit nicht kannte, und eine in Armuth geknüpfte Verbindung als zerstörend für die Glückseligkeit betrachtete, schlug seine Bewerbung ab. Von Verdruß und Kränkung durchdrungen, ging er sogleich bey Sr. neapolitanischen Majestät in Dienst, und suchte im Getümmel des Ruhms Zuflucht vor den Qualen betrogner Liebe. Bey mir, deren Stunden in einem ewigen Kreise langweiliger Einförmigkeit hinschlichen, die keinen Zweck zu verfolgen, keine Abwechslung ihre sinkenden Lebensgeister aufzurichten hatte, blieb aller Versuch zur Vergessenheit unwirksam. Angelo's geliebtes Bild stieg unaufhörlich vor meiner Einbildungskraft auf, und seine Zauberkraft, durch Abwesenheit, ja vielleicht durch Verzweiflung erhöht, verfolgte mich mit unablässiger Pein. In tiefem Schweigen verbarg ich die Angst, die an meinem Herzen nagte, und gab mich zum willigen Schlachtopfer klösterlicher Strenge hin. Aber ein neues, schreckliches und unerwartetes Übel drohte mir jetzt. Ich war so unglücklich, die Aufmerksamkeit des Marquis Marinelli auf mich zu ziehen, der bey meinem Vater um mich anhielt. Er war groß von Geburt und Vermögen, und seine Besuche konnten nur mir unwillkommen seyn. Schrecklich war der Augenblick; als mein Vater mir seinen Antrag entdeckte. Mein Schmerz, den ich vergebens zu unterjochen strebte, enthüllte den wahren Zustand meines Herzens, und rührte meinen Vater tief. Nach einer langen, schauderlichen Pause erlöste er mich großmüthig von meinem Elende, und ließ es mir frey gestellt, des Marquis Hand oder den Schleyer zu wählen. Ich fiel zu seinen Füßen, überwältigt durch die edle Uneigennützigkeit seines Betragens, und nahm augenblicklich den Schleyer an. Dieser Vorfall zog die Decke weg, womit ich bisher mein Herz verhüllt hatte. Mein Bruder — mein edelmüthiger Bruder erfuhr den wahren Stand seiner Neigungen. Er sah den Schmerz, der an meiner Gesundheit nagte; er eröffnete ihn meinem Vater, und verlangte großmüthig, um meine Glückseligkeit wieder herzustellen, einen Theil des Vermögens abzutreten, das bereits als Erbrecht von seiner Mutter auf ihn gekommen war. Ach Hippolytus! deine Tugenden hätten ein besseres Schicksal verdient!«
»— Hippolytus?« rief Julie bebend — »Hippolytus, Graf von Vereza?« —
»Eben der,« erwiederte die Nonne mit Verwunderung.
Julie war sprachlos; Thränen kamen ihr zu Hülfe. Corneliens Erstaunen überstieg einige Augenblicke lang allen Ausdruck; endlich blitzte ein Strahl von Ahndung in ihre Seele und sie verstand nur zu wohl den Auftritt vor ihr. Nach einiger Zeit kam Julie wieder ins Leben, und Cornelia näherte sich ihr zärtlich. — »Umarme ich also meine Schwester?« sagte sie, »Vereint durch Empfindung müssen wir es auch im Unglücke seyn?«
Julie antwortete nur durch Seufzer, und ihre Thränen mischten sich in zärtlicher Sympathie. Endlich setzte Cornelia ihre Erzählung fort: — »Mein Vater, gerührt durch Hippolytus Betragen, dachte über sein Anerbiethen nach. Die Erschütterung meiner Gesundheit war zu sichtlich, um seiner Bemerkung zu entwischen. Kampf zwischen Stolz und väterlicher Zärtlichkeit machte ihn eine Zeitlang unschlüssig; endlich aber überwältigte die letzte jedes entgegensträubende Gefühl, und er gab seine Einwilligung zu meiner Verbindung mit Angelo. Der plötzliche Übergang von Schmerz zur Freude war für meinen schwachen Körper beynahe zuviel; urtheilen Sie also, was die Wirkung des schrecklichen Umsturzes seyn mußte, als die Nachricht anlangte, daß Angelo in einer auswärtigen Schlacht gefallen sey! Lassen Sie mich, wo möglich, den Eindruck so schrecklicher Empfindungen auslöschen! der Schmerz meines Bruders, dessen großmüthiges Herz so zart für andrer Leiden fühlen konnte, war kaum geringer, als der meinige. —Nachdem das erste Toben meiner Verzweiflung sich gelegt hatte, verlangte ich von einer Welt mich zurück zu ziehen, die mit Trugbildern von Glück nur meiner gespottet hatte, und Scenen zu verlassen, welche die Erinnerung aufregten, und mein Elend verlängerten. Mein Vater billigte meinen Entschluß, und ich wurde sogleich als Novize in dieses Kloster aufgenommen, mit dessen Prior mein Vater in früher Jugend vertraut war. Nach Ablauf des Jahrs nahm ich den Schleyer. O, ich erinnere mich noch ganz, mit welcher vollkommenen Ergebung, mit welcher ruhigen Freude ich die Gelübde ablegte, die mich an ein Leben der Abgeschiedenheit und des heiligen Friedens binden! Die hohe Wichtigkeit des Augenblicks, das Feyerliche der Ceremonie, die heilige Dunkelheit, welche mich umwallte, das schauerliche Schweigen rings umher, als ich das unwiderrufliche Gelübd' aussprach — alles traf zusammen, meine Einbildungskraft zu erhitzen, und meine Blicke gen Himmel zu heben. Als ich vor dem Altare kniete, glühte die heilige Flamme der Andacht in meinem Herzen, und trug auf hohen Fittichen meine Seele empor. Die Welt und alle ihre Erinnerungen schwanden aus meinem Herzen, und überließen es ganz einer reinen, heiligen Begeisterung, welche keine Worte beschreiben können. Bald nach meiner Aufnahme hatte ich das Unglück, meinen Vater zu verlieren. Doch fand in der Ruhe dieses Klosters, in der tröstenden Freundschaft meiner Gefährtinnen und in geistlichen Übungen mein Schmerz Linderung, und der Stachel desselben stumpfte sich ab. Meine Ruhe war von kurzer Dauer. Ein Umstand ereignete sich, der das Elend erneuete, welches jetzt nur in dem Grabe mich verlassen kann, nach dem ich hinblicke, nicht mit ängstlicher Furcht, nein, als nach einer Zuflucht vor Leiden, fest vertrauend, daß die Macht, deren Güte ich anbethete, als sie mich beugte, das Mangelhafte meiner Andacht, und das zu ofte Abschweifen meiner Gedanken nach den einst so theuren Gegenständen verzeihen wird.« — So, wie sie sprach, schlug sie ihre Augen, die von Wahrheit und süßer Zuversicht strahlten, zum Himmel, und der Strahl der Andacht von ihrem Gesichte schien die Schönheit einer begeisterten Heiligen zu versinnlichen. — »Eines Tags,« fuhr sie fort, »nie werde ich ihn vergessen, ging ich wie gewöhnlich zum Beichtstuhle, ein Bekenntniß meiner Sünden abzulegen Mit zur Erde gesenkten Augen kniete ich vor dem Vater, und sagte mit leiser Stimme meine Beicht. Ich hatte nur ein Verbrechen zu bejammern, die zu zärtliche Erinnerung an den, um welchen ich klagte, und dessen meinem Herzen eingeprägtes Bild es zu einer befleckten Opfergabe für die Gottheit machte. Der Laut eines tiefen Schluchzens unterbrach meine Beicht; ich schlug die Augen auf, und o Gott! mit welchem Gefühle erkannte ich in den Zügen des heiligen Vaters meinen einst so geliebten Angelo! Sein Bild stand wie ein Traum gegen mir über, und leblos sank ich zu seinen Füßen hin. Als ich wieder erwachte, fand ich mich auf meiner Matte, und eine Schwester bey mir, aus deren Gespräche ich merkte, daß sie die Ursache meiner Erschütterung nicht wußte. Krankheit hielt mich einige Tage im Bett; als ich wieder aufstand, sah ich Angelo nicht mehr, und hätte beynahe meinen Sinnen gemißtrauet, und geglaubt, daß eine Erscheinung vor mir vorüber gegangen sey, als ich eines Tages ein beschriebenes Papier in meiner Zelle fand. Ich erkannte auf den ersten Blick Angelo's Züge, diese wohl bekannten Züge, die so oft mich zu andern Empfindungen erweckt hatten! Ich zitterte bey dem Anblicke — mein klopfendes Herz erkannte die geliebten Züge an; ein kalter Schauder durchbebte mich; halb athemlos ergriff ich das Papier. Bald aber besann ich mich — ich stand an — Pflicht gab endlich der stärkern Versuchung nach, und ich las die Zeilen, o diese Zeilen, von Verzweiflung eingehaucht — von meinen Thränen bethaut! jedes Wort gab meinem Herzen einen neuen Stich, und schwellte seine Todespein über das Vermögen der Menschheit an. Ich las, daß Angelo in einer auswärtigen Schlacht schwer verwundet als todt auf dem Felde blieb; daß die Menschlichkeit eines gemeinen feindlichen Soldaten, der einige Zeichen des Lebens an ihm wahrnahm, und ihn in ein Haus brachte, sein Leben rettete. Man verschaffte ihm schleunige Hülfe; allein seine Wunden hatten den gefährlichsten Anschein. Einige Stunden lang schmachtete er zwischen Leben und Tod, bis endlich seine Gesundheit und Jugendkraft den Kampf überstanden, und er nach Neapel zurück kehrte. Hier sah er meinen Bruder, der bey seinem Anblicke vor Erstaunen und Schmerz außer sich gerieth, und ihm alles, was vorgegangen war, und die Gelübde, die ich auf das Gerücht von seinem Tode abgelegt hatte, erzählte. — Es wäre überflüssig, die unmittelbare Wirkung dieser Erzählung zu erwähnen; die endliche Wirkung derselben legte einen seltnen Beweis seiner Liebe und Verzweiflung an den Tag. — Er widmete sich dem Klosterleben, und wählte diese Abtey zum Orte seines Aufenthalts, weil sie den theuersten Gegenstand seiner Zärtlichkeit in sich faßte. Er benachrichtigte mich in seinem Briefe, daß er absichtlich vermieden, sich mir zu entdecken, und sich damit begnügt hätte, mich von Zeit zu Zeit im Stillen zu sehen, bis der Zufall jene unglückliche Zusammenkunft herbey führte. Da aber die Wirkungen davon so gegenseitig schmerzhaft gewesen wären, so wollte er mich von der Furcht eines ähnlichen Auftritts durch die Versicherung befreyen, daß ich nie ihn wieder sehen würde. Er blieb seinem Versprechen treu; ich habe ihn von diesem Tage an nicht wieder erblickt, und weiß gar nicht einmahl, ob er noch in diesen Mauern wohnt. Das Aufbiethen aller Kraft der Religion, und die gerechte Besorgniß, Aufsehen zu erregen, haben mich vom Nachfragen abgehalten. Allein der Augenblick unsers letzten Sehens ist gleich zerrüttend für meinen Frieden und für meine Gesundheit gewesen, und ich hoffe, bald von den qualvollen, ohnmächtigen Kämpfen erlöst zu werden, womit das Bewußtseyn unvollkommen erfüllter heiliger Gelübde und irdischer, nicht ganz unterjochter Empfindungen diese Brust zerreißt.«
Cornelia schwieg, und Julie, die mit tiefer Aufmerksamkeit ihrer Erzählung zugehört hatte, bewunderte, liebte und beklagte sie zugleich. Als Hippolytus Schwester neigte ihr Herz sich zu ihr hin, und unverbrüchlich ketteten die feinen Bande sympathetischen Kummers es an sie. Gleichförmigkeit der Empfindungen und Leiden vereinigte sie mit den festesten Banden der Freundschaft, und so floß aus Erwiederung der Gedanken und Gefühle ein reiner, süßer Trost. Julie hing gern dem traurigen Vergnügen nach, von Hippolytus zu reden, und in dieser Beschäftigung schlichen unmerklich die Stunden vorüber. Tausend Fragen wiederhohlte sie von ihm; allein auf die, welche am meisten sie interessirte, erhielt sie keine befriedigende Antwort. Cornelia, die von der unglücklichen Begebenheit auf dem Schlosse Mazzini gehört hatte; bedauerte mit ihr die nur zu gewisse Folge derselben. —Julie gewöhnte sich, an schönen Abenden, unter den Schatten der hohen Bäume, die rings um die Abtey standen, spazieren zu gehen. Die unzähligen Rosenfarben, welche die erlöschenden Sonnenstrahlen an die Felsenhöhen warfen, der Purpurglanz, der sich über die romantische Gegend unten ergoß, und die sanft vor dem Auge erlosch, so wie die Nachtschatten herab fielen, erregten ein süßes Gemisch von Empfindungen in ihr, und senkten ihren Kummer in kurze Vergessenheit. Die tiefe Einsamkeit des Orts ertödtete ihre Besorgnisse, und eines Abends wagte sie es, mit Madame de Menon ihren Spaziergang zu verlängern. Sie kehrten nach der Abtey zurück, ohne ein menschliches Wesen gesehen zu haben, außer einen Mönch aus dem Kloster, der in der benachbarten Stadt Lebensmittel eingekauft hatte. Am folgenden Abende wiederhohlten sie ihren Spaziergang, und im Gespräche verwickelt, entfernten sie sich weit von der Abtey. Die entfernte Glocke des Klosters, die zur Vesper läutete, erinnerte sie an die Stunde; sie sahen sich um, und sahen die äußerste Spitze des Waldes. Sie kehrten um, und wollten wieder nach der Abtey gehen, als einige majestätische Säulen, die zwischen den Bäumen hervor ragten, ihnen ins Auge fielen. Sie standen stille. Neugier reizte sie zu untersuchen, zu welchem Gebäude Säulen von so prächtiger Bauart in einer so rauhen Gegend gehören konnten. — Auf der Spitze eines Felsens, der über das Thal herab hing, zeigten sich die Rudera eines Pallastes, dessen Schönheit die Zeit nur verheeret hatte, um seine Erhabenheit zu erhöhen. Ein Schwibbogen von auszeichnender Pracht, hinter welchem wilde Klippen in weiter Ferne zurück wichen, war noch beynahe ganz geblieben. Die eben untergehende Sonne warf einen zitternden Glanz auf die Ruinen, und vollendete die Wirkung der Scene. Sie starrten in stummer Verwunderung den Anblick an; allein das schwindende Licht, und die thauige Kühle der Luft mahnte sie zurück zu kehren. Als Julie den letzten Blicks auf die Gegend warf, sah sie in einiger Entfernung zwey Leute im eifrigen Gespräche begriffen an die Ruinen gelehnt. So wie sie sprachen, richteten sie so aufmerksam ihre Blicke auf sie, daß sie nicht zweifeln konnte, sie selbst sey der Gegenstand ihres Gesprächs. Beunruhigt ging sie eilends mit Madame nach der Abtey zurück. Sie gingen schnell durch das Holz, dessen Schatten durch die Dunkelheit des Abends verdickt, sie verhinderte zu bemerken, ob sie verfolgt würden. Sie erstaunten, als sie wahrnahmen, wie weit sie sich vom Kloster verirrt hatten, dessen dunkle Thürme sie nur verworren durch die Bäume, welche die Aussicht schlossen, aufsteigen sahen. Beynahe hatten sie die Thore erreicht, als sie zurück blickten, und eben die Leute langsam heran kommen sahen, nicht als ob sie die Absicht hätten, sie zu verfolgen, sondern bloß, als wollten sie den Ort, nach welchem sie zurück gingen, beobachten. Dieser Umstand beunruhigte Julien aufs höchste. Sie mußte nothwendig glauben, daß diese Leute Spione des Marquis wären; — war dieses gegründet, so war ihre Zuflucht entdeckt, und sie hatte alles zu fürchten. Madame glaubte nunmehr, daß es für Juliens Sicherheit nothwendig sey, dem Abt ihre Geschichte zu eröffnen, und ihm zu entdecken, daß sie eine heilige Zuflucht in seinem Kloster gesucht hatte, und ihn anflehte, sie vor väterlicher Tyranney zu schützen. Dieß war ein gewagter, aber nothwendiger Schritt, um der gewissen Gefahr vorzubeugen, worein sie gerathen mußte, wenn der Marquis seine Tochter von dem Abte forderte, und der erste war, der ihn mit ihrer Geschichte bekannt machte. Handelte sie anders, so mußte sie befürchten, daß der Abt, dessen Großmuth sie sich nicht vertraute, dessen Mitleid sie nicht angefleht hatte, sie aus stolzer Empfindlichkeit ausliefern, und daß sie so das gewisse Schlachtopfer des Herzogs von Luovo werden würde. Julie billigte diese Eröffnung, ob sie gleich für den Ausgang derselben zitterte, und bath Madame, bey dem Abt ihre Sache zu führen. Am folgenden Morgen also hielt Madame um eine Audienz bey dem Abt an; sie erhielt Erlaubniß, ihn zu sehen, und mit zitternder Angst begleiteten Juliens Augen sie nach seinem Zimmer. Die Conferenz war lang und jeder Augenblick schien Julien eine Stunde zu seyn, die in furchtvoller Erwartung mit Cornelien auf den Ausspruch horchte, der ihr Schicksal entscheiden mußte. Sie war jetzt Corneliens unzertrennliche Gefährtinn, deren abnehmende Gesundheit ihr Mitleid anzog, und ihre Zärtlichkeit verstärkte. Indessen eröffnete Madame dem Abte Juliens traurige Geschichte. Sie pries ihre Tugenden, lobte ihre Vorzüge, und beklagte ihre Lage. Sie schilderte ihm die Charaktere des Marquis und Herzogs, und schloß damit, ihm nachdrücklich vorzustellen, daß Julie in diesem Kloster eine letzte Zuflucht vor Ungerechtigkeit und Elend gesucht hätte, und ihn anzuflehen, ihr sein Mitleid und seinen Schutz zu gewähren. — Der Abt beobachtete, während sie sprach, ein finstres Stillschweigen; seine Augen waren zur Erde gestreckt, und seine Miene nachdenkend und feyerlich. Als sie ausgeredet hatte, folgte eine tiefe Stille, und sie saß in ängstlicher Erwartung da. Sie suchte aus seinem Gesichte seine Antwort voraus zu lesen, konnte aber keinen Trost daraus schöpfen. Endlich richtete er den Kopf auf, und aus seiner tiefen Träumerey erwachend, sagte er ihr, daß ihr Gesuch Überlegung fordere, und daß der Schutz, den sie für Julien verlangte, ihn in sehr ernsthafte Folgen verwickeln könnte, da man von einem so entschlossenen Charakter, als der Marquis besäße, sehr gewaltsame Maßregeln erwarten müßte. »Sollte seine Tochter ihm verweigert werden,« so schloß er, »so könnte er es sogar wagen, dieß Heiligthum zu verletzen.« Madame, von der finstern Gleichgültigkeit seiner Antwort betroffen, schwieg einen Augenblick. Der Abt fuhr fort: »Wozu ich mich auch entschließen mag, so hat das junge Frauenzimmer immer Ursache, sich Glück zu wünschen, in diesem heiligen Hause aufgenommen worden zu seyn; denn ich will jetzt sogar wagen, ihr zu versichern, daß, wenn der Marquis sie nicht zurück fordert, ihr unbelästigt in diesem Heiligthume zu bleiben vergönnt werden soll. Sie, Madame, werden diese Nachsicht und den Werth des Opfers fühlen, welches ich durch die Gewährung derselben bringe; denn indem ich also ein Kind vor seinem Vater verhehle, bestärke ich es im Ungehorsam, und opfre folglich mein eigenes Gefühl von Pflicht dem auf, was mit Recht eine schwache Menschlichkeit genannt werden kann.«
Madame hörte mit schweigendem Kummer und Unwillen diese pomphafte Deklamation an. Sie machte noch einen Versuch, den Abt für Julien zu interessiren; allein er beharrte auf seiner finstern Unbiegsamkeit, wiederhohlte, daß er die Sache in Überlegung nehmen, und ihr die Entscheidung kund thun wollte, stand mit großer Feyerlichkeit auf, und verließ das Zimmer. Sie bereuete nun beynahe, Vertrauen auf ihn gesetzt, und sein Mitleid angefleht zu haben, da er Eine Seele zeigte, die unfähig war, das eine zu schätzen, und den Einfluß des Andern zu fühlen. Mit schwererm Herzen kehrte sie zu Julien zurück, die in ihrem Gesichte, so wie sie herein trat, Neuigkeiten von keinem glücklichen Inhalte las. Als Madame ihr die nähern Umstände der Unterredung mittheilte, ahndete Julie nur Elend vorher, gab sich für verloren, und brach in Thränen aus. Sie bejammerte heimlich das Vertrauen, wozu sie sich hatte bereden lassen; denn sie sah sich jetzt in den Händen eines von Natur strengen, fühllosen Mannes, dem sie, wenn er es für gut hielte, sie zu verrathen, auf keine Weise entwischen konnte. Allein sie verhehlte die Angst ihres Herzens, und um Madame zu trösten, stellte sie sich, als ob sie hoffte, wo sie nur verzweifeln konnte. Einige Tage verstrichen, und keine Antwort vom Abte erschien. Julie verstand nur zu gut dieses Schweigen. Eines Morgens kam Cornelia mit ängstlicher, unruhiger Miene in ihr Zimmer, und sagte ihr, daß Abgesandte vom Marquis im Kloster wären; daß sie am Sprachgitter nach dem Abte gefragt hätten, bey dem sie wichtige Geschäfte zu haben gesagt hatten. Der Abt hatte ihnen sogleich Audienz gegeben, und sie waren jetzt in tiefem Gespräche mit ihm begriffen. Bey dieser Nachricht verließen Julien ihre Lebensgeister; sie zitterte, erblaßte, und stand in stummer, starrer Verzweiflung da. Madame, obgleich kaum weniger geängstigt, behielt ihre Gegenwart des Geistes bey. Sie kannte jetzt den Charakter des Priors zu gut, um zu zweifeln, daß er ohne Bedenken Julien des Marquis Händen ausliefern würde. An diesem Augenblicke also hing die Krisis ihres Schicksals! — Diesen Augenblick konnte sie noch entwischen; im nächsten war sie Gefangene. Sie rieth also Julien, den Zeitpunct zu benutzen, und aus dem Kloster zu fliehen, bevor die Conferenz geendigt sey, weil man alsdann die Thore vor ihr verschließen würde, und versprach ihr zugleich, sie auf ihrer Flucht zu begleiten. Madame's großmüthiges Betragen lockte Thränen der Dankbarkeit aus Juliens Augen, die jetzt aus dem Zustande der Betäubung, worein Schrecken sie gestürzt hatte, erwachte. Ehe sie aber ihrer treuen Freundin danken konnte, kam eine Nonne herein, und rief Madame auf, unverzüglich zum Abte zu kommen. Madame rieth Julien zu entwischen, während sie den Abt im Gespräch aufhielte, weil es nicht wahrscheinlich war, daß er bereits Befehl, sie zurück zu halten, ertheilt hätte. Sie überließ sie der Ausführung dieses Vorsatzes mit der Versicherung, ihr so bald als möglich aus der Abtey zu folgen. Ihre kalte Entschlossenheit verließ sie, als sie sich des Abts Zimmer näherte, und sie wurde ungewisser über die Ursache seines Befehls. Der Abt war allein. Sein Gesicht war bleich vor Ärger, und mit langsamen, aber unruhigen Schritten ging er im Zimmer auf und ab. Die finstre Strenge seines Blicks erschreckte sie. — »Lesen Sie diesen Brief,« sagte er, und reichte die Hand dar, worin er einen Brief hielt; »lesen Sie, und sagen Sie mir, was der Sterbliche verdient, welcher unsern heiligen Orden zu schmähen und unserm geweihten Vorrechte Trotz zu biethen wagt!« Madame erkannte die Handschrift des Marquis, und die Worte des Priors setzten sie in das äußerste Erstaunen. Sie nahm den Brief. Er war von dem Geiste stolzer, rachsüchtiger Wuth eingegeben, welcher so stark den Charakter des Marquis stämpelte. Da er Juliens Aufenthalt entdeckt hatte, und glaubte, daß das Kloster ihr eine willige Zuflucht vor seiner Verfolgung gewährte, klagte er den Abt an, daß er sein Kind in offenbarer Auflehnung gegen seinen Willen bestärkte. Er belud ihn und seinen geheiligten Orden mit Schmähungen, und drohte, wofern er nicht unverzüglich Julien den wartenden Bothschaftern auslieferte, in Person eine Macht herbey zu führen, welche die Kirche zwingen sollte, der höhern Gewalt des Vaters zu weichen. Des Abts Stolz war durch diese Drohung aufgereizt; und Julie erhielt von seinem geistlichen Hochmuthe den Schutz, welchen weder seine Grundsätze, noch seine Menschlichkeit ihr gewährt haben würden. »Der Mann soll zittern,« rief er, »welcher unsrer Macht Trotz zu biethen, unsre heilige Obergewalt in Zweifel zu ziehen wagt. Donna Julie ist sicher. Ich will sie vor diesem stolzen Schmäher unsrer Rechte beschützen, und ihn wenigstens die Macht zu verehren lehren, welche er nicht überwältigen kann. Ich habe mit dieser Antwort seine Bothschafter zurück geschickt.«
Diese Worte strahlten plötzliche Freude in Madame de Menons Herz; allein sie besann sich sogleich, daß Julie jetzt bereits die Abtey verlassen hätte, und daß eben die Vorsicht, welche ihr Sicherheit verschaffen sollte, sie wahrscheinlich in die Hände ihres Feindes gestürzt haben würde. Dieser Gedanke verwandelte ihre Freude in Angst, und in wilder Hoffnung, daß Julie vielleicht noch nicht fort sey, wollte sie aus dem Zimmer stürzen, als des Abts finstre Stimme sie zurück hielt.
»Nehmen Sie so die Ankündigung unsers großmüthigen Entschlusses auf, Ihre Freundinn zu beschützen? Verdient solche herab lassende Güte keinen Dank? — ist sie nicht werth, erkannt zu werden?« Madame kehrte um, in tödlicher Angst, daß ein Augenblick Verzug Juliens Unglück seyn könnte, wenn sie das Kloster noch nicht verlassen hätte. Sie fühlte, daß sie sich den Schein eines Mangels an Dankbarkeit gegeben hatte, und daß ihr plötzliches Fortgehen, welches sie nicht entschuldigen konnte, ohne ein Geheimniß zu verrathen, das seine ganze Rache entflammt haben würde, den Abt sehr befremden mußte. Indessen verlangte sein Zorn ein Sühnopfer, und diese Umstände setzten sie in die peinlichste Verlegenheit. Sie brachte eine kurze Entschuldigung hervor, und nachdem sie ihren Dank für seine Güte ausgedrückt hatte, versuchte sie wieder fortzugehen, als der Abt in tiefem Unwillen die Stirn runzelte, und mit Zorn funkelnden Augen von seinem Sitze aufstand. »Bleiben Sie!« sagte er; »woher diese Ungeduld, vor ihrem Wohlthäter zu fliehen? — Wenn meine Großmuth keinen Dank erregen konnte, so soll wenigstens mein Zorn Furcht erregen. Seit Donna Julie fühllos gegen meine Herablassung ist, ist sie meines Schutzes unwerth, und ich will sie dem Tyrannen, der sie fordert, überantworten.«
Mit fürchterlicher Ungeduld hörte Madame auf diese Rede, wodurch der Abt, dessen beleidigter Stolz alles Gefühl von Gerechtigkeit überwältigte, Julien für den Fehler ihrer Freundinn zu strafen drohte. Jedes Wort, das sie zurück hielt, stach Todesqual in ihr Herz; allein das Schlußurtheil verursachte ihr neuen Schrecken, und sie bebte vor demselben zurück. In Todesqual fiel sie dem Abt zu Füßen. — »Hochwürdiger Vater!« sagte sie; »strafen Sie nicht Julien für die Beleidigung, welche ich allein beging; ihr Herz wird ihren großmüthigen Beschützer segnen, und auch ich, genehmigen Sie die Versicherung, ich fühle aufs vollkommenste den Werth Ihrer Güte.«
»Schicken Sie Donna Julie selbst zu mir!« sagte der Abt.
Dieser Befehl vermehrte Madame's Bestürzung, die nicht zweifelte, daß ihr unfreywilliges Zögern für Julien unglücklich gewesen sey. Endlich durfte sie fort gehen, und zu ihrer unaussprechlichen Freude fand sie Julien in ihrem Zimmer. Die Furcht, des Marquis Leuten in die Hände zu fallen, hatte ihren Entschluß, zu fliehen, überwältigt. Sie wurde durch Cornelien in dieser Furcht bestärkt, die ihr sagte, daß eben jetzt einige Leute zu Pferde vor dem Thore auf die Zurückkunft ihrer Gefährten warteten. Dieses war eine schreckliche Nachricht für Julien, welche nun einsah, daß es ganz unmöglich war, das Kloster zu verlassen, ohne sich in gewisses Verderben zu stürzen. Sie bejammerte ihr Geschick, als Madame herein trat, und ihr den Inhalt ihrer Unterredung und den Befehl des Abts hinterbrachte. — Sie mußten nun die Wirkung der zärtlichen Angst fürchten, welche sein Zorn aufgereizt hatte, und Julie, die bey seinem ersten Entschlusse in freudiges Entzücken gerieth, sank plötzlich bey seiner letzten Erklärung in Verzweiflung. Sie erbebte vor der bevor stehenden Unterredung, obgleich jedes Augenblicks Zögern, das ihre Furcht erflehte, den Zorn des Abts erhöhen, und nur die gefürchtete Gefahr vermehren mußte. — Endlich that sie sich eine plötzliche Gewalt an; sie rief ihren Muth auf, und eilte nach des Abts Zimmer, um ihr Urtheil zu empfangen. Er saß in seinem Stuhle, und sein finstrer Blick machte ihr Herz gefrieren. — »Tochter!« hob er an; »du hast dich abscheulicher Verbrechen schuldig gemacht. Du hast die gesetzmäßige Autorität deines Vaters nicht nur zu bestreiten, nein, dich öffentlich dagegen aufzulehnen gewagt. Du bist dem Willen desjenigen ungehorsam gewesen, dessen Vorrecht nur dem unsrigen weicht. Du hast sein Recht in einem Punkte in Zweifel gezogen, der unter allen der entscheidendste ist: das Recht eines Vaters, über die Heirath seines Kindes zu bestimmen. Du bist sogar aus seinem Schutze geflohen, und hast es gewagt, hinterlistig und niederträchtig hast du's gewagt, deinen Ungehorsam hinter diesem heiligen Obdache zu beschirmen. Du hast durch dein Verbrechen unser Heiligthum entweiht; du hast Schmach auf unsern geweihten Orden gebracht, und unserm hohen Vorrechte frevelhaften Trotz zugezogen. Welche Strafe ist einer Schuld, gleich dieser, gemäß?«
Der hochwürdige Vater hielt inne, seine Augen fest auf Julien gerichtet, die blaß und zitternd kaum sich aufrecht halten konnte, und nicht zu antworten vermochte.
»Ich will barmherzig, und nicht gerecht seyn,« sagte er; »ich will die Strafe, die du verdientest, mildern, und dich bloß deinem Vater überantworten.«
Bey diesen schrecklichen Worten brach Julie in Thränen aus, sank zu den Füßen des Abts, zu dem sie flehend ihre Augen aufschlug, war aber unfähig zu sprechen. Er ließ sie in dieser Stellung bleiben.
»Deine Falschheit,« fuhr er fort, »ist nicht die kleinste deiner Beleidigungen. Hättest du dich um Vergebung und Schutz an unsere Großmuth gewendet, so würde dir vielleicht Nachsicht gewährt seyn: allein du verbargst deine Laster unter der Maske der Tugend, und deine Bedürfnisse wurden unter dem Schleyer der Andacht verhehlt.«
Diese falschen Anklagen regten in Julien den Stolz geschmähter Tugend auf; mit einer Würde, die selbst den Abt betroffen machte, sagte sie: »Hochwürdiger Vater, mein Herz verabscheut das Verbrechen, dessen Sie erwähnen, und läugnet alle Gemeinschaft damit ab. Was auch meine Beleidigungen seyn mögen, von der Sünde der Häucheley weiß ich mich wenigstens frey, und Sie werden
mir verzeihen, wenn ich Sie erinnere, daß mein Vertrauen stets so war, daß es vollkommen meine Ansprüche auf den Schutz, um welchen ich ansuche, rechtfertigt. Wenn ich in diesen Mauern Zuflucht suchte, so geschah es in der Vermuthung, daß sie mich vor Ungerechtigkeit beschützen würden; und gewiß, hochwürdiger Herr! würden Sie das Betragen des Marquis mit keinem andern Ausdrucke benennen, wenn nicht die Furcht vor seiner Macht die Gebothe der Wahrheit überwältigte.«
Der Abt fühlte die ganze Stärke dieses Vorwurfs; weil er aber zu stolz war, es sich merken zu lassen, hielt er seine Empfindlichkeit zurück. Da sein verwundeter Stolz so aufgereizt, und alle bösartigen Leidenschaften seiner Natur so zur Thätigkeit aufgerufen waren, fühlte er sich in der That zu der grausamen Auslieferung geneigt, die er zuvor nicht ernstlich beabsichtet hatte. Sein hochmüthiger Geist trieb ihn an, die unabsichtliche Beleidigung der Madame de Menon zu strafen, und er fand ein Wohlgefallen daran, einen Schrecken zu erregen, den er nie zu verwirklichen dachte, bloß um sich noch weiter um den Schutz anflehen zu lassen, den zu gewähren er bereits entschlossen war. Allein dieser Vorwurf von Julien traf ihn auf seiner empfindlichsten Seite, weil er sich der Wahrheit desselben bewußt war, und der kurze Triumph, den er nach seiner Meinung ihr gewährte, zündete seine Empfindlichkeit zur Flamme an. Er sann in unbeweglicher Stellung in seinem Stuhle nach. — Sie sah in seinem Gesichte das tiefe Arbeiten seiner Seele — sie bildete sich das Schicksal ab, das er ihr bereitete, und stand in zitternder Angst, ihr Urtheil zu empfangen. — Der Abt erwog jeden erschwerenden Umstand von des Marquis Drohung, jedes Wort von Juliens Rede, und seine Seele erfuhr, daß das Laster nicht nur mit der Tugend, sondern mit sich selbst unbestehend ist — er sah, daß er, um seine Boßheit zu befriedigen, seinen Stolz aufopfern mußte, da es unmöglich war, den Gegenstand der ersten zu strafen, ohne sich die Befriedigung des letzten zu versagen. Diese Betrachtung hielt seine Seele in einem qualvollen Zustande, und er saß da in finstres Schweigen gehüllt. — Der Muth, welcher kurz zuvor Julien beseelte, war mit ihren Worten verschwunden — jeder Augenblick des Stillschweigens vermehrte ihre Angst; das tiefe Brüten seiner Gedanken bestärkte sie in ihren traurigen Ahndungen, und mit aller kunstlosen Beredtsamkeit des Schmerzes suchte sie ihn zum Mitleide zu besänftigen. In mürrischem Stillschweigen hörte er ihren Bitten zu. Jeder Augenblick kühlte jetzt die Gluth seines Zorns gegen sie ab, und verstärkte sein Verlangen, sich dem Marquis entgegen zu stemmen. Endlich nahmen die herrschenden Grundzüge seines Charakters ihren gewohnten Einfluß wieder an, und überwältigten die Anreizungen untergeordneter Leidenschaften. Stolz auf seine geistliche Gewalt, beschloß er, nimmer das Vorrecht der Kirche dem des Vaters nachzusetzen, und der Gewalt des Marquis mit gleicher Gewalt zu begegnen. — Er ließ sich also herab, Julien von ihrer Angst zu befreyen, und sie seines Schutzes zu versichern; allein dieses geschah auf eine so unholde Art, daß die Dankbarkeit, welche das Versprechen heischte, beynahe dadurch vernichtet wurde. Julie eilte mit der fröhlichen Nachricht zu Madame de Menon, die, Thränen gerührter Freude an ihrem Halse weinte.
Beynahe vierzehn Tage waren verstrichen, ohne daß man eine Feindseligkeit vom Marquis merkte, als eines Nachts, lange nach der Stunde der Ruhe, Julie durch ein Geläut im Kloster geweckt wurde. Sie wußte, daß jetzt nicht die gewohnte Stunde zum Gebethe war, und horchte mit Schrecken und Erstaunen auf den Laut, der durch die tiefe Stille des Gebäudes rollte. Unmittelbar darauf hörte sie die Thüren verschiedener Zellen an ihren Angeln krachen, und schnelle Fußtritte in den Gängen rauschen; und durch die Spalten ihrer Thüre erblickte sie vorüber gehende Lichter. Das Rauschen der Fußtritte vermehrte sich, und alles im Kloster schien wach zu seyn. Ihr Schrecken stieg immer höher; es fiel ihr ein, daß der Marquis die Abtey mit seinen Leuten umringt hätte, um sie gewaltsam aus ihrer Zuflucht zu reißen, und sie stand eilends auf, um in Madame de Menons Zimmer zu gehen, als sie ein leises Klopfen an der Thür hörte. Ihre Frage, wer da wäre, wurde von Madame beantwortet, und ihre Furcht schnell vertrieben; denn sie hörte, daß das Geläut die Schwesterschaft zusammen rufen sollte, um eine sterbende Nonne zum Altare zu begleiten, wo sie die letzte Öhlung empfangen sollte. Sie verließ mit Madame das Zimmer, und ging nach der Kirche. Der Schein der Fackeln an den Mauern, der Schimmer, den ihr Auge oft von den Mönchen in ihren langen, schwarzen Gewändern auffing, die schweigend durch die engen, sich krümmenden Gänge schritten, das feyerliche Geläut der Glocken entzückte die Einbildungskraft, und flößte ihrem Herzen heilige Ehrfurcht ein. Allein die Kirche zeigte einen feyerlichen Anblick, wie sie noch nie zuvor gesehen hatte. Unvollkommen sah man die dunkeln Wölbungen durch das Kerzenlicht vom Hochaltare, der ein schwaches Licht auf die entlegenen Theile des Gebäudes warf, und große Massen von Licht und Schatten, mächtig und erhaben in ihrer Wirkung, hervor brachte. Während sie staunend da stand, hörte sie einen fernen Gesang durch die Flügel herein dringen; die Töne schwollen in leisem Gelispel zum Ohre, und kamen immer näher und näher, bis eine plötzliche Lichtflamme aus einer der Thüren hervor ging, und die Procession hereintrat. Die Orgel stimmte sogleich einen erhabenen, feyerlichen Choral an; alle Stimmen erhoben sich vereint und verstärkten die heilige Melodie. An der Spitze erschien der Padre Abbate mit langsamem, abgemessenem Schritte, das heilige Kreuz in seiner Hand. Gleich hinter ihm folgte ein Tragbett, auf welchem die Sterbende lag, mit einem weißen Schleyer bedeckt, und von weißgekleideten Nonnen, jede eine brennende Kerze tragend, umgeben. Zuletzt kamen die Mönche, zwey und zwey, schwarz gekleidet, und jeder ein Licht in der Hand.
Als sie den Hochaltar erreichten, wurde die Bahre nieder gesetzt, und nach wenig Augenblicken hörte der Chor auf. Der Abt trat herzu; die letzte Öhlung zu ertheilen; der Schleyer der sterbenden Nonne ward aufgedeckt — und —— o Gott! Julie erkannte ihre geliebte Cornelia! —Das Bild des Todes war bereits ihrem Gesichte aufgedrückt; allein in ihren Augen schimmerte ein schwacher Strahl von Erinnerung, als sie sich auf Julien häfteten, die einen kalten Schauder durch ihre Nerven beben fühlte, und sich an Madame lehnte. Zum ersten Mahle sah Julie jetzt Corneliens unglücklichen Geliebten, in dessen Zügen die Angst seines Herzens gemahlt war, und der bleich und schweigend über der Bahre hing. Nach geendigter Ceremonie hob der Chor wieder; an; die Bahre ward aufgehoben — Cornelia winkte schwach mit der Hand, und ward wieder auf den Stufen des Altars niedergelassen. In wenig Minuten hörte die Musik auf; sie richtete ihre schweren Augen mit einem Ausdrucke unaussprechlicher Zärtlichkeit und Schmerzens auf ihren Liebhaber, versuchte zu sprechen, allein die Töne erstarben auf ihren erstarrenden Lippen. Ein schwaches Lächeln schwebte über ihr Gesicht hin, und wurde durch einen Strahl hoher Andacht verdrängt; sie faltete ihre Hände auf ihrer Brust, schlug mit einem Blicke sanfter Ergebung ihre Augen, in welchen jetzt die letzten Funken des scheidenden Lebens flammten, gen Himmel auf, und in einem kurzen, tiefen Seufzer floh ihre Seele von dannen. — Ihr Liebhaber sank zurück, kämpfend, seine Bewegung zu verhehlen; allein das tiefe Schluchzen, welches seine Brust zerriß, verrieth seine Qual, und die Thränen aller Anwesenden bethauten den geheiligten Fleck, wo Schönheit, Verstand und Unschuld dahin ging. — Die Orgel schwoll nun in klagenden Tönen, und die Stimmen der Versammlung sangen in Choralmelodie ein tiefes, feyerliches Requiem dem Geiste der Abgeschiedenen. Madame trieb Julien, die beynahe eben so leblos war, als ihre geschiedene Freundinn, aus der Kirche fort. Ein so plötzlicher Tod erhöhete den Schmerz, welchen Trennung ohnehin verursacht haben würde. Corneliens Krankheit war von solcher Art, daß sie einen trieglichen Anschein hatte. Sie nahm seit langer Zeit ab, aber so allmählich und unmerklich, daß sie die Besorgnisse ihrer Freunde in Sicherheit wiegte. Mit ihr selbst war es anders; sie fühlte die Veränderung, wollte aber diejenigen, welche zärtlichen Theil an ihr nahmen, nicht mit der Wahrheit betrüben. Die Stunde ihrer Auflösung kam ihr selbst plötzlich und unerwartet; allein sie war gefaßt und sogar glücklich. Julie schien in Corneliens Tode Hippolytus Tod aufs neue zu beklagen. Ihr Hinscheiden schien das letzte Band aufgelöst zu haben, welches sie an sein Gedächtniß knüpfte. — Madame erkannte mit Erstaunen in einem der Klostermönche den Pater, der den sterbenden Vincent Beicht gehört hatte. Sein Anblick erweckte die Erinnerung an die Scene, welche sie auf dem Schlosse Mazzini mit ansah, und Vincents letzte Worte, mit den Umständen, welche seit dem sich ereignet hatten, vereinigt, erneueten all ihr Erstaunen und Neugierde. Allein mehr noch, als Empfindungen der Verwunderung, erregte sein Anblick. Sie fürchtete, daß er vom Marquis, der ihn kannte, bestochen seyn möchte, seinen Einfluß bey dem Abt für Juliens Auslieferung zu verwenden. — Julie wagte sich jetzt nicht mehr aus den Mauern des Klosters hervor. In der Abenddämmerung schlich sie sich zu Zeiten in die Kreuzgänge, und wandelte oft nach Corneliens Grabe, wo sie um Hippolytus so wohl als um ihre Freundinn klagte. Eines Abends während der Vesper wurde die Klosterglocke plötzlich gezogen; der Abt, dessen Gesicht zugleich Erstaunen und Mißfallen ausdrückte, hielt mit dem Dienste inne, und verließ den Altar. Die ganze Gemeinde verfügte sich in den Saal, wo sie vernahmen, daß ein Mönch, der nach dem Kloster zurück gegangen sey, einen Haufen bewaffneter Leute durch den Wald habe heran kommen sehen, und da er nicht zweifelte, daß es des Marquis Leute wären, die in feindlichen Absichten heran nahten, so hätte er es für nöthig gehalten, die Glocke zu ziehen. Der Abt stieg auf einen Thurm, und entdeckte von da durch die Bäume ein Schimmern von Waffen, und gleich darauf ging ein Haufen Leute aus dem Walde hervor in eine lange Allee, die gerade auf den Fleck stieß, wo er stand. Man konnte nun das Klappern der Hufe deutlich hören, und Julie, die vor Schrecken beynahe umsank, erkannte den Marquis an der Spitze des Haufens, der sich bald in zwey Flügel theilte, und das Kloster umzingelte. Die Thore wurden sogleich verschlossen; der Abt stieg vom Thurme herab, und versammelte die Mönche im Saale, wo seine Stimme bald durch alles Getümmel sich hören ließ. Juliens Schrecken machte sie des hochwürdigen Vaters Versprechen ganz vergessen, und sie wünschte, in die tiefen Höhlen des Klosters, die unter den Wäldern sich hinwinden, fliehen zu können. Madame, die Scharfsinn genug besaß, um des Abts Charakter richtig zu beurtheilen, gründete ihre Sicherheit auf seinen Stolz. Sie rieth also Julien von jedem Versuche ab, die Ehrlichkeit des Klosterdieners, der die Schlüssel zu den Gewölben führte, zu bestechen, und rieth ihr, sich gänzlich auf die Wirkung des Zorns, den der Abt gegen den Marquis hägte, zu verlassen. — Während Madame ihr Fassung einzusprechen suchte, erschien eine Bothschaft vom Abt, der sie augenblicklich zu sehen verlangte. Sie gehorchte, und er befahl ihr, ihm in ein Zimmer, das gerade über den Klosterthoren war, zu folgen. Von da aus sah sie ihren Vater, von dem Herzoge von Luovo begleitet, und in eben dem Augenblicke, da ihr Herz bey dem Anblicke erstarb, rief der Marquis wüthend dem Abte zu, sie unverzüglich in seine Hände zu liefern, und drohte, die Thore zu sprengen, wenn sie nur einen Augenblick zurück gehalten würde. Bey dieser Drohung verdunkelte sich des Abts Gesicht; er schleppte Julien mit Gewalt an das Fenster, von welchem sie zurück gefahren war. »Frevelhafter Prahler!« rief er; »ewige Rache über dich! — Von diesem Augenblicke an treiben wir dich von allen Rechten und Gemeinheiten unserer Kirche aus. So kühn und vermessen du auch bist, lache ich deiner Drohungen! Sieh hier,« sagte er, und zeigte auf Julien, »und vernimm, daß du in meiner Gewalt bist; wenn du es wagst, diese geheiligten Mauern zu verletzen, so will ich laut in das Angesicht des Tages ein Geheimniß ausrufen, welches das Blut in deinem Herzen erstarren machen soll; ein Geheimniß, worein deine Ehre, ja dein Leben selbst verwickelt ist. Nun triumphire und frohlocke in gotteslästerlichen Drohungen!« Der Marquis fuhr bey dieser Rede unwillkürlich zusammen; seine Züge veränderten sich — bald aber suchte er sich zu fassen, und seine Bestürzung zu verhehlen. Er war einige Augenblicke unschlüssig, ungewiß, wie er verfahren sollte. Von der Gewalt abzustehen, hieß sich des gedrohten Geheimnisses schuldig bekennen; und doch fürchtete er sich, den Abt aufs äußerste zu treiben, dessen Drohungen sein eigenes Herz nur zu sehr unterstützte. Endlich rief er: »Alles, was ihr gesagt habt, verachte ich als die feige Ausflucht mönchischer List. Eure neuen Schmähungen setzen zu dem Verlangen, meine Tochter wieder zu bekommen, noch das hinzu, euch zu strafen. Ich würde zu augenblicklicher Gewalt schreiten; allein das wäre nur eine unvollkommene Rache, und ich ziehe also meine Leute zurück, um an eine höhere Macht zu appelliren. So sollt ihr mit eins gezwungen werden, meine Tochter heraus zu geben, und eure schändlichen Schmähungen meiner Ehre abzubüßen.« — Mit diesen Worten drehte er sein Pferd von den Thoren, und mit seinem Gefolge hinter sich zog er sich schnell zurück, und ließ den Abt, frohlockend in seinem Siege, und Julien in Erstaunen und zweifelhafter Freude verloren. Als sie Madame die Umstände dieser Conferenz erzählte, verweilte sie besonders bey den Drohungen des Abts; allein Madame, obgleich ihre Verwunderung bey jedem Worte stieg, sah wohl ein, wie das Geheimniß, was es auch seyn mochte, in Erfahrung gebracht war. Sie hatte Vincents Beichtvater bereits im Kloster bemerkt, und ohne Zweifel hatte er alles, was aus Vincents sterbenden Worten aufgehascht war, dem Abte entdeckt. Sie wußte auch, daß das Geheimniß nie würde entdeckt werden, außer als Strafe für unmittelbare Gewaltthätigkeit, da es einer der ersten Grundsätze der Klosterreligion ist, ein unverbrüchliches Stillschweigen über alles, was im Beichtstuhle anvertrauet wird, zu beobachten. — Als der erste Sturm von Juliens Bewegungen sich geleget hatte, machte ihre Freude über die plötzliche Abreise des Marquis Besorgnissen Platz. Er hatte gedroht, an eine höhere Macht zu appelliren, die den Abt zwingen sollte, sie heraus zu geben. Diese Drohung erregte ein gerechtes Schrecken in ihr, und es blieb kein Mittel, der Tyranney des Marquis zu entgehen, außer das Kloster zu verlassen. Sie hielt also um eine Audienz bey dem Abte an, und nachdem sie ihm die Gefahr ihrer gegenwärtigen Lage vorgestellt hatte, bath sie um seine Erlaubniß, nach einem sicherern Aufenthalte sich umsehen zu dürfen. Der Abt, der wohl wußte, daß der Marquis ganz in seiner Macht war, lachte, als sie seine Drohungen wiederhohlte, und schlug ihre Bitte unter dem Vorwande ab, daß er jetzt der Kirche für sie Rede stehen müßte. Er hieß sie ruhig seyn und versprach ihr seinen Schutz; allein seine Versicherungen wurden so kalt und hochmüthig ertheilt, daß Julie ihn mehr mit verstärkter, als mit verminderter Furcht verließ. Als sie durch den Saal ging,— sah sie einen Mann eilends zu einer andern Thür herein kommen. Er trug keine Ordenskleider, sondern war in einen Mantel gewickelt, und schien gern unbemerkt bleiben zu wollen. Als sie bey ihm vorüber ging, richtete er den Kopf auf, und Julie erkannte — ihren Vater. Er schoß einen Blick der Rache auf sie; ehe sie aber nur denken konnte, verhüllte er sein Angesicht, als besänne er sich plötzlich, und rauschte an ihr vorbey. Ihre zitternden Glieder konnten sie kaum nach Madame's Zimmer tragen, wo sie sprachlos auf einen Stuhl sank, und nur durch das Entsetzen in ihrem Blicke die Angst ihrer Seele ausdrücken konnte. Als sie sich etwas erhohlt hatte, erzählte sie, was sie gesehen hatte, und ihre Unterredung mit dem Abte. — Madame war in eben so großer Verwirrung, als sie, wie sie des Marquis Erscheinung erklären sollte. Warum kam er nach dieser letzten vermessenen Drohung insgeheim, um den Abt zu besuchen, durch dessen Hülfe er allein Zugang ins Kloster konnte gefunden haben! Und was konnte den Abt zu einem solchen Verfahren bewegen? — Diese Umstände, alle gleich unerklärlich, bestärkten sie in der Furcht vor Verrath und Auslieferung. Aus der Abtey zu entwischen, war jetzt unmöglich; denn die Thore waren stets besetzt: und wäre es selbst möglich gewesen, heraus zu gelangen, so mußte Julie unfehlbar erwarten, von des Marquis Leuten entdeckt zu werden, die in die Wälder gelagert waren. So mit Gefahr umzingelt, konnte sie nur im Kloster den Ausgang ihres Geschicks abwarten. — Während sie mit Madame ihr unglückliches Schicksal beklagte, erschien aufs neue ein Bothe, der sie zum Abte rief. In diesem Augenblicke verließen sie alle ihre Lebensgeister; die Krisis ihres Schicksals schien gekommen zu seyn; sie konnte nicht zweifeln, daß der Abt Willens war, sie dem Marquis auszuliefern, mit dem er aller Wahrscheinlichkeit nach, die Bedingungen zur Aussöhnung ausgemacht hatte. Eine lange Zeit verstrich, ehe sie Fassung genug wieder erlangen konnte, dem Befehle zu gehorchen; und als sie endlich ging, vermehrte jeder Schritt nach des Abts Zimmer ihr Grausen. Sie stand einen Augenblick vor der Thür stille, ehe sie Muth hatte, sie zu öffnen; der Gedanke an ihres Vaters unmittelbare Rache stieg vor ihrer Seele auf, und sie stand auf dem Punkte, wieder in ihr Zimmer zurück zugehen, als ein plötzlicher Schritt, von innen bey der Thür ihr Zögern zerstörte und sie ins Cabinett trieb. Der Marquis war nicht da, und ihr Muth lebte wieder auf. Das Frohlocken des Sieges schwebte auf den Zügen des Abts, obgleich noch ein Schatten unbefriedigter Rache sichtlich blieb. »Tochter!« sagte er: »die Nachricht, welche wir dir mitzutheilen haben, muß dich erfreuen. Deine Sicherheit hängt jetzt ganz von dir ab; ich gebe dein Schicksal in deine eignen Hände, und der Ausgang desselben komme über dem Haupt!« — Er hielt inne, und sie schwebte in verwunderungsvoller Erwartung des Ausspruchs, der nun kommen würde. — — »Feyerlich sichere ich dir hier meinen Schutz zu,« sagte er; »aber nur unter einer Bedingung: daß du der Welt entsagst und Gott deine Tage widmest.« — Mit Schmerz und Erstaunen horchte Julie zu. — »Ohne diese Bewilligung von deiner Seite ist es nicht in meiner Macht, dich zu schützen, wenn ich selbst wollte. Wenn du den Schleyer nimmst, so bist du in den Mauern der Kirche vor weltlicher Gewalt gesichert. Wenn du aber dieses vernachlässigst, oder verweigerst, so wird der Marquis sich an eine Macht wenden, von der ich nicht appelliren kann, und ich werde mich endlich gezwungen sehen, dich heraus zu geben. Um aber deine Sicherheit gewiß zu machen, wofern du den Schleyer wählst, wollen wir uns eine Dispensation von den gewöhnlichen Formen der Probezeit verschaffen, und wenige Tage sollen deine Gelübde bestätigen.« — Er hielt inne; aber Julie, von der grausamsten Unruhe zerrissen, wußte nicht, was sie antworten sollte. »Wir vergönnen dir drey Tage Bedenkzeit,« fuhr er fort, »über die Sache zu entscheiden, nach deren Verlauf entweder der Schleyer, oder der Herzog Luovo auf dich wartet.«
Julie verließ in stummer Verzweiflung das Cabinett, und ging zu Madame, die ihr kaum die demüthige Gabe des Trostes darzubiethen vermochte. Während dessen weidete sich der Abt an der siegenden Rache, und der Marquis seufzte unter den Stacheln vereitelter Hoffnung. Die Drohung des Ersteren war zu ernstlich beruhigend, als daß der Marquis gewaltthätige Maßregeln zu verfolgen wagen konnte; er hatte also beschlossen Geiz gegen Stolz aufzulehnen, und die Macht zu besänftigen, die er nicht zu überwinden vermochte. Nur wollte er nicht gern dem Abte einen Beweis seines Nachgebens und seiner Furcht durch Anbiethen einer Bestechung in einem Briefe anvertrauen, und wählte lieber den sichrern, obgleich demüthigendern Weg einer geheimen Zusammenkunft. Seine prächtigen Anerbiethungen machten den Abt Anfangs unschlüssig; allein seines Vortheils gewiß, ließ er sich auf nichts ein, und ließ den Marquis in ängstlicher Ungewißheit fortgehen. Nachdem er aber reiflicher die Vorschläge erwogen hatte, siegte sein Stolz über seinen Geiz, und er beschloß, Julien zu bereden, die Hoffnungen des Marquis mit einem Streiche zu Boden zu schlagen, indem sie ihr Leben der Religion widmete. — Julie brachte die Nacht und den folgenden Tag in einer Geistesqual hin, die alle Beschreibung übersteigt. Die Thore des Klosters, die mit Wache besetzt, die Wälder, die mit des Marquis Leuten umzingelt waren, machten es unmöglich, zu entwischen. Vor einer Verbindung mit dem Herzoge, dessen letztes Betragen die verhaßte Idee bestärkt hatte, die sie gleich Anfangs von seinem Charakter faßte, bebte ihr Herz voll Grausen zurück; in den Mauern eines Klosters aber lebenslänglich begraben zu seyn, war ein nicht weniger schreckliches Geschick. Doch war die Eingebung der geheiligten Liebe, die sie für Hippolytus Gedächtniß trug, so mächtig, so groß ihre Abneigung gegen den Herzog, daß sie bald sich entschloß, den Schleyer zu nehmen. Den folgenden Abend that sie dem Abte ihren Entschluß kund. Sein Herz schwoll von heimlicher Freude, und selbst die natürliche Strenge seines Betragens ließ bey dieser Nachricht ab. Mit einer Güte, die er noch nie gezeigt hatte, versicherte er sie seines Beyfalls und Schutzes, und sagte ihr, die Ceremonie sollte am dritten Tage vollzogen werden. Ihre Bewegung ließ ihr kaum zu, diese Worte zu hören. Jetzt, da ihr das Schicksal ohne Widerruf bestimmt war, bereuete sie beynahe ihre Wahl. Ihre Fantasie vergesellschafftete fremde Schreckbilder damit; und über dem Übel, welches sie, da es ihrer Entscheidung frey gestellt ward, ohne vieles Bedenken angenommen hatte, brütete sie jetzt in zweifelhafter Reue. So geneigt sind wir, uns einzubilden, daß das gewisseste Unglück auch das schrecklichste ist! —
Als der Marquis die Antwort des Abts las, wurden alle peinigenden Leidenschaften seiner Natur zu einem Grade, der beynahe an Wahnsinn grenzte, aufgereizt und entflammt. Im ersten Anfalle seiner Wuth hätte er die Thore des Klosters sprengen und der äußersten Boßheit seines Feindes Trotz biethen mögen. Eines Augenblicks Überlegung aber regte seine Furcht vor dem angedrohten Ausspruche wieder auf, und er sah, daß er noch immer in Mönchsgewalt war. Der Abt schaffte die nothwendige Dispensation herbey, und man traf unverzüglich die Zurüstungen zu der bevor stehenden Ceremonie. Julie sah mit der kalten Stärke der Verzweiflung die Augenblicke, welche ihr Schicksal herbey führten, verfließen. Sie hatte kein Mittel, vor dem kommenden Übel zu entwischen, ohne sich einem noch schlimmern auszusetzen; sie betrachtete es mit standhaftem Auge, und schrak nicht länger vor seiner Annäherung zurück. — Am Morgen vor dem Tage ihrer Einweihung sagte man ihr, daß ein Fremder am Sprachgitter sie zu sprechen verlangte. Ihre Seele war so lange an immer wechselnde Besorgnisse gewöhnt worden, daß Furcht die einzige Empfindung war, die sich in ihr regte. Sie vermuthete, ohne zu wissen, warum, daß der Marquis unten wäre, und war unschlüssig, ob sie hinunter gehen sollte. Endlich entschloß sie sich — sie ging in das Sprachzimmer, und sah zu ihrer unaussprechlichen Freude und Erstaunen Ferdinanden. —
Während der Abwesenheit des Marquis vom Schlosse bewerkstelligte Ferdinand, der Juliens entdeckten Aufenthalt erfahren hatte, eine Flucht, und war zum Kloster geeilt, in der Absicht, sie zu erlösen. Er war verkleidet durch die Wälder gekommen, und mit vieler Schwierigkeit der Bemerkung der Leute des Marquis entgangen, die noch rings um die Abtey vertheilt waren. Im Kloster war er, da er allein kam, ohne Bedenken zugelassen worden. Als er hörte, unter was für Bedingungen der Abt seinen Schutz gewährt hatte, und daß der folgende Tag zu Juliens Einweihung bestimmt war, erschrak er, und stand unentschlossen da. Ein so kurzer Zwischenraum ließ ihm wenig Zeit zu Hülfsmitteln, und noch weniger zum Zögern. Die Nacht eben dieses Tages war die einzige Zeit, die zum Versuche und zur Ausführung eines Plans zur Flucht ihm übrig blieb, und wenn er fehlschlug, so war Julie nicht nur lebenslang in die Mauern eines Klosters gebannt, sondern auch jeder Strafe unterworfen, welche die Strenge des Abts, durch die Entdeckung aufgebracht, ihr aufzulegen gut fand. Die Gefahr war verzweifelnd, aber die Lage war es auch. Das edle, uneigennützige Betragen ihres Bruders erfüllte Julien mit Dank und Bewunderung; allein Verzweiflung an dem Erfolge machte sie unschlüssig, ob sie sein Anerbiethen annehmen sollte. Sie erwog, daß seine Großmuth ihn wahrscheinlich mit in ihr Verderben verwickeln würde, und schwieg in tiefem Nachsinnen, als Ferdinand ihr einen Umstand entdeckte, den er bisher sorgfältig verschwiegen hatte, und der auf ein Mahl jede Furcht, jeden Zweifel vertrieb. »Hippolytus lebt noch!« sagte Ferdinand. »Lebt?« — wiederhohlte Julie mit bebender Stimme; »o, sage mir, wo? — wie?« — Ihr Athem verließ sie, und überwältigt von den gewaltsamen und mannigfaltigen Gefühlen, die zu ihrem Herzen strömten, sank sie in ihren Stuhl. Ferdinand, den das Gitter verhinderte, ihr beyzuspringen, sah mit äußerster Angst sie in diesem Zustande. Als sie wieder zu sich kam, sagte er ihr, daß ein Bedienter von Hippolytus, den sein Herr ohne Zweifel abgeschickt hätte, um nach Julien zu fragen, kürzlich von des Marquis Leuten in der Nachbarschaft des Schlosses aufgespürt wäre. Von ihm hatte man erfahren, daß der Graf von Vereza noch lebte, daß man aber an seinem Leben verzweifelt hätte, und daß er noch an gefährlichen Wunden in einer kleinen Stadt an der Küste von Italien läge. Der Mann hatte durchaus den Ort, wo sein Herr sich aufhielte, nicht sagen wollen. Als er erfuhr, daß der Marquis jetzt auf der St. Augustinerabtey wäre, wohin er seine Tochter verfolgte, verschwand er von Mazzini, und hatte sich seitdem nicht wieder sehen lassen. — Julien war es genug zu wissen, das Hippolytus noch lebte; ihre Furcht, entdeckt zu werden, ihre Bedenklichkeiten wegen Ferdinands verschwanden — sie dachte nur an Flucht, und die Mittel, welche noch vor kurzem ihr so furchtbar, so schwer zu erfinden, so gefährlich auszuführen schienen, waren jetzt in ihren Augen leicht, gewiß, und beynahe schon vollbracht. Sie gingen nun über den Plan zur Ausführung zu Rathe, und kamen überein, daß sie in zu große Gefahr laufen würden, wenn sie einen Bedienten im Kloster zu bestechen versuchten, und doch sahen sie keine Möglichkeit, ohne diesen Versuch ihren Zweck zu erreichen. Nach vielem Hin- und Hersinnen beschlossen sie, ihr Geheimniß niemand, außer Madame, anzuvertrauen. Ferdinand sollte Mittel ausfinden, sich bis zur Nacht in der Kirche zu verbergen, in welche einige Thüren aus dem Kloster gingen. Wenn die Einwohner der Abtey in Ruhe gesunken wären, sollte Julie in die Kirche schleichen, wo Ferdinand sie erwartete, und wo sie vielleicht durch eine äußere Thür des Gebäudes, oder durch ein Fenster entwischen könnten, auf welchen Fall Ferdinand sich mit Strickleitern versehen sollte. Ein Paar Pferde sollten zwischen die Felsen, jenseit der Wälder, gestellt werden, um die Flüchtlinge zu einem Seehafen zu führen, von wo sie leicht nach Italien übergehen konnten. Nachdem sie diesen Plan aufs reine gebracht hatten, trennten sie sich mit ängstlicher Hoffnung, in der Nacht sich wieder zu treffen. Madame nahm warmen Antheil an Juliens gegenwärtigen Erwartungen, und fühlte sich nun einiger Maßen von dem Drucke des Selbstvorwurfs befreyt, Julien aus einem sichern Zufluchtsorte gerissen zu haben. Die Nachricht, daß Hippolytus lebte, hatte Juliens Lebensgeister plötzlich wieder belebt. Aus der stumpfen Betäubung, worein Verzweiflung sie stürzte, erwachte sie als aus einem Traume, und ihre Empfindungen glichen den Gefühlen eines Menschen, der plötzlich von einer schrecklichen Erscheinung erwacht, und dessen Gedanken noch durch die Furcht und Ungewißheit umnebelt sind, womit die vorübergehenden Bilder seine Fantasie erfüllten. Ihre Verzweiflung schwand; Freude erhellte ihr Gesicht; doch zweifelte sie noch an der Wirklichkeit der Scene, die sich jetzt vor ihrem Blicke öffnete. Schwerfällig wälzten sich die Stunden fort bis zum Abende, wo Erwartung der Furcht Platz machte: denn sie wurde nochmahls zum Abte gerufen. Er hatte sie nur hohlen lassen, um ihr die gewöhnlichen Ermahnungen über die heran nahende Feyerlichkeit zu ertheilen, und nachdem er sie lange mit einer ernsthaften, langweiligen Rede aufgehalten hatte, entließ er sie mit einem feyerlichen Segen.
Der Abend sank nun in Dunkelheit, und die Stunde nahte heran, welche Juliens Schicksal entscheiden sollte. Zitternde Angst überwältigte jetzt jedes andere Gefühl, und so wie die Minuten verstrichen, nahm ihre Furcht zu. Endlich hörte sie die Thüren des Klosters für die Nacht verschließen; die Glocke läutete das Signal zur Ruhe, und die vorüber gehenden Fußtritte der Nonnen sagten ihr, daß sie dem Rufe derselben zu gehorchen eilten. Kurz nachher war alles stille; Julie wagte sich noch nicht hervor; sie benutzte diese Zwischenzeit zu einem interessanten zärtlichen Gespräche mit Madame de Menon, der ihr Herz ungeachtet ihrer Lage ein trauriges Lebewohl sagte. Die Glocke schlug zwölf, als sie aufstand, um fortzugehen. Nachdem sie ihre treue Freundinn mit Thränen der Angst und des Kummers umarmt hatte, nahm sie ein Licht in die Hand und stieg mit leisem, furchtsamem Schritte durch die langen Windeltreppen zu einer geheimen Thür herab, die in die Klosterkirche führte. Die Kirche war finster und einsam, und die schwachen Strahlen der Lampe, die sie trug, ertheilte gerade Licht genug, die schauerliche Größe derselben zu unterscheiden. So wie sie schweigend durch die gewölbten Gänge ging, warf sie ängstlich forschende Blicke umher; allein Ferdinand war nirgends zu sehen. Sie stand in ängstlichem Zweifel stille, furchtsam die düstre Finsterniß vor ihr zu durchdringen, und eben so voll Furcht zurück zu kehren. Als sie da stand, den Ort überschaute, vergebens sich nach Ferdinanden umsah, und doch sich fürchtete zu rufen, damit nicht ihre Stimme sie verriethe, stieg ein dumpfes Winseln nicht weit von ihr auf. Ihr Herz erbebte, und sie blieb auf dem Flecke eingewurzelt stehen. Sie wendete ihr Auge ein wenig zur Linken, und sah ein Licht durch die Ritzen eines Grabmahls in einiger Entfernung schimmern. Das Gewinsel wurde wiederhohlt — ein tiefes Murmeln folgte, und während sie noch staunte, kam ein alter Mann mit einer brennenden Kerze in der Hand aus dem Gewölbe hervor. Schrecken überwältigte sie, und sie stieß einen unwillkürlichen Schrey aus. Den Augenblick darauf ließ sich ein Geräusch in einem entlegenen Theile des Gebäudes hören. — Ferdinand sprang aus seinem verborgenen Aufenthalte hervor, und eilte ihr zu Hülfe. Der alte Mann, der ein Mönch zu seyn schien, und an dem Grabmahle eines Heiligen Buße gethan hatte, näherte sich jetzt. Sein Gesicht drückte einen Grad von Schrecken und Erstarren aus, der beynahe dem Juliens gleich kam, die jetzt in ihm Vincents Beichtvater erkannte. Ferdinand ergriff den Pater, legte die Hand an den Degen, und drohte ihm mit dem Tode, wenn er nicht augenblicklich schwöre, auf immer zu verschweigen, was er jetzt gesehen, und ihnen beystände, aus der Abtey zu entwischen. — »Undankbarer Jüngling!« antwortete der Mönch mit ruhiger Stimme; »steh von dieser Sprache ab, und füge nicht zu den Thorheiten der Jugend das Verbrechen hinzu, einen vertheidigungslosen alten Mann zu morden oder zu erschrecken. Deine Heftigkeit würde mich reizen, dein Feind zu werden, wenn nicht frühere Neigung mich zur Freundschaft gegen dich stimmte. Ich bemitleide Donna Juliens Lage, die mir nicht unbekannt ist, und will ihr freudig allen Beystand, der in meiner Macht ist, leisten.« — Bey diesen Worten lebte Julie wieder auf, und Ferdinand, beschämt durch die Großmuth des Mönchs, und seiner eigenen Kleinheit sich bewußt, fuhr zurück. — »Ich habe keine Worte, Ihnen zu danken,« sagte er »oder Vergebung für ein ungestümes Betragen zu erbitten; meine Lage allein, die Ihnen bekannt ist, muß für mich sprechen!«
»Sie thuts!« antwortete der Mönch; — »aber wir haben keine Zeit zu verlieren — folgt mir!«
Sie folgten ihm durch die Kirche in die Kreuzgänge, an deren Ende eine kleine Thür war, die der Mönch aufschloß. Sie stieß auf die Wälder. »Dieser Weg,« sagte er, führt durch einen entlegenen Theil des Waldes zu den Felsen, die zur Rechten von der Abtey empor steigen; in ihren Klüften könnt ihr euch verbergen, bis ihr zu einer längern Reise gefaßt seyd. Aber löschet euer Licht aus; es könnte euch des Marquis Leuten verrathen, die in dieser Gegend vertheilt sind. Lebt wohl, Kinder! Gottes Segen geleite euch!«
Juliens Thränen sprachen ihre Dankbarkeit aus; zu Worten hatte sie nicht Zeit. Sie betraten den Weg, und der Mönch schloß die Thür zu. Aus dem Kloster waren sie jetzt befreyt; allein von außen erwartete sie eine Gefahr, welche zu vermeiden ihre ganze Vorsicht erforderte. Ferdinand wußte, daß der Weg, den der Mönch ihnen angewiesen hatte, eben der war, der nach den Felsen führte, wo seine Pferde standen, und verfolgte ihn schweigend und mit schnellem Schritte. Julie, deren Furcht mit der Dunkelheit der Nacht zusammen traf, alle Gegenstände um sie her zu vergrößern und umzuformen, bildete bey jedem Schritte, den sie that, sich ein, Menschengestalten zu sehen, und hielt jedes Rauschen des Windes für Fußtritte, die sie verfolgten. Sie ging schnell fort, bis Julie athemlos und erschöpft nicht weiter konnte. Noch nicht lange hatten sie geruht, als sie in einiger Entfernung zwischen den Gebüschen rauschen hörten, und gleich darauf einen Schall von Stimmen unterschieden. — Ferdinand und Julie setzten so gleich ihre Flucht fort, und glaubten, daß sie noch immer Stimmen mit dem Winde heran nahen hörten. Dieser Gedanke wurde bald bestätigt; die Töne drangen näher, und sie unterschieden Worte, die nur ihre Furcht erhöheten, als sie das Ende des Holzes erreichten. Der Mond, der jetzt am Himmel stand, ging plötzlich hinter einer dunkeln Wolke hervor, und ließ sie verschiedene Leute wahrnehmen, die ihnen nachsetzten, so wie er auch den Verfolgern den Weg der Flüchtlinge zeigte. Sie bemühten sich, die Felsen zu erreichen, wo ihre Pferde verborgen standen, und die sie jetzt vor sich liegen sahen. Sie erreichten sie, als die Verfolger sie beynahe eingehohlt hatten — aber ihre Pferde waren fort; — die einzige übrig bleibende Möglichkeit zu entwischen war, in die tiefen Felsenhöhlen zu fliehen. Sie gingen also in eine krumme Höhle, aus welcher verschiedene unterirdische Wege ausgingen, und standen an dem Ende des einen stille. Die Stimmen von Menschen tönten jetzt in zitternden Echo's durch die verschiedenen, geheimen Höhlen des Orts, und immer dichter hörten sie Fußtritte heran nahen. Julie bebte vor Schrecken, und Ferdinand zog sein Schwert, entschlossen sie bis aufs äußerste zu beschützen. Ein verworrnes Gewühl von Stimmen scholl jetzt zu dem Theil der Höhle herauf, wo Ferdinand und Julie verborgen waren. Nach wenig Augenblicken nahmen die Schritte der Verfolgenden eine andre Richtung; die Töne starben allmählich hinweg, und wurden nicht mehr gehört. Ferdinand horchte eine lange Zeit aufmerksam zu; allein die Stille des Orts blieb ungestört. Es war nun gewiß, daß die Leute den Felsen verlassen hatten, und er wagte sich an die Mündung der Höhle hervor. Er überschaute die Wüste rings umher, so weit sein Auge dringen konnte, und erblickte kein menschliches Wesen; in den Pausen des Windes aber glaubte er noch immer einen Laut entfernter Stimmen zu hören. So wie er in ängstlichem Schweigen horchte, fing sein Auge einen Schatten auf, der sich nicht weit von ihm bewegte. Er sprang in die Höhle zurück, wagte sich aber nach einigen Minuten wieder hervor. Der Schatten blieb auf seinem Platze; nachdem er aber eine Zeit lang gewartet hatte, sah er ihn fortgleiten, bis er hinter einer Felsenspitze verschwand. Er zweifelte nunmehr nicht, daß die Höhle bewacht würde, und daß dieß der Schatten von einem ihrer letzten Verfolger gewesen sey. Er kehrte also zu Julien zurück, und hielt sich über eine Stunde in den tiefsten Felsenklüften verborgen; endlich, als kein Laut die Stille des Orts unterbrach, wagte er sich noch ein Mahl an die Mündung der Höhle hervor. Er warf einen ängstlichen Blick rings um sich, unterschied aber keine menschliche Gestalt. Die sanften Mondstrahlen schlichen auf die bethaute Landschaft herab, und die feyerliche Stille der Mitternacht hüllte die Welt ein. Furcht erhöhte den Flüchtlingen das Schauderliche der Stunde — Ferdinand führte nun Julien hervor, und schweigend schlichen sie längs dem schroffen Fuße der Felsen hin. — Sie setzten ihren Weg ohne weitere Unterbrechung fort, und entdeckten zu ihrer unaussprechlichen Freude in einiger Entfernung ihre Pferde, die sich los gerissen und hierher verirrt hatten, wo sie ruhig an der Erde lagen. Ferdinand und Julie stiegen unverzüglich auf; sie ritten die Ebene herab, nahmen den Weg, der nach einem kleinen, nahe gelegenen Seehafen führte, von wo aus sie sich nach Italien einschiffen konnten. — Einige Stunden weit ritten sie durch dunkle Wälder von Buchen und Kastanien, und ihr Weg wurde nur schwach vom Monde erleuchtet, der einen zitternden Schimmer durch das dunkle Laubwerk warf, und nur unterbrochen gesehen ward, wenn die vorüber ziehenden Wolken der Nacht seinen Strahlen wichen. Endlich erreichten sie den Saum der Wälder; die graue Dämmerung brach nun an, und die kühle Morgenluft schnitt empfindlich. Mit unaussprechlicher Freude sah Julie die entzündende Atmosphäre, und bald berührten die Strahlen der aufsteigenden Sonne die Spitzen der Berge, deren Seiten in dunklem Nebel gehüllt lagen. — Ihre Furcht zerstreute sich mit der Dunkelheit. Die Sonne ging zwischen Wolken von unbeschreiblichem Glanze hervor, und enthüllte eine Scene, welche zu jeder andern Zeit Julie mit Entzücken betrachtet haben würde. Zur Seite des Hügels, den sie hinab ritten, lag ein Thal, aus welchem wilde, hohe Gebirge aufstiegen, deren Seiten mit herab hangenden Wäldern bekleidet waren, ausgenommen wo hier und da ein Vorgebirge seine kühne, gefurchte Stirn empor hob. Hier hingen einige halb verwelkte Bäume aus Felsenritzen, und gaben der Gegend eine mahlerische Wildheit; dort verschönerten Reihen von halb versenkten Hütten, die aus dicken Gesträuchen hervorragten, den grünen Rand eines Stroms, der auf dem Grunde hinschlich, und seine Wellen in das ferne, blaue Meer trug. — Der Morgen hauchte seine Kühle über die Gegend und belebte jede Farbe der Landschaft; die glänzenden Thautropfen hingen zitternd an den Zweigen der Bäume, die hier und da die Straße beschatteten, und der fröhliche Gesang der Vögel begrüßte den aufsteigenden Tag. Aller ihrer Angst ungeachtet goß die Scene eine süße Wollust in Juliens Herz. Um Mittag erreichten sie den Hafen, wo Ferdinand so glücklich war, ein kleines Schiff zu bekommen; allein der Wind war ihnen entgegen, und es war Mitternacht vorüber, ehe sie sich einschiffen konnten.
Als die Dämmerung anbrach, ging Julie wieder aufs Verdeck, und sah mit einem Seufzer unerklärlichen Schmerzens die zurück weichende Küste von Sicilien. Mit hoher Bewunderung aber bemerkte sie das Licht; welches nach und nach sich über die Atmosphäre verbreitete, und einen schwachen Strahl auf die Oberfläche des Wassers schoß, das in feyerlichem Murmeln an den fernen Ufern hinrollte. Feurige Strahlen bezeichneten nun die Wolken, und der Osten glühte von wachsendem Glanze, bis plötzlich die Sonne über den Wellen aufstieg, sie mit einer Fluth von Strahlen erhellte, und Freude und Fröhlichkeit rings umher strahlte. Das kühne Gewölbe, der Himmel, mit der weiten Fläche des Oceans vereint, bildete einen hinreißenden, erhabenen Anblick. Die Pracht der Scene flößte Julien Entzücken ein; ihr Herz schlug von hoher Begeisterung, und sie vergaß, daß Kummer sie niedergebeugt hatte. — Einige Stunden lang trieb der Wind das Schiff sanft fort; dann aber trat plötzliche Stille ein. Kein Lüftchen kräuselte die glatte Oberfläche des Wassers, und schwer zog sich das Schiff auf der Tiefe hin. Sicilien war noch zu sehen, und dieser Aufenthalt erfüllte Julien mit wilder Angst. Gegen Abend sprang ein leichtes Lüftchen auf; allein es blies von Italien, und dicke Nebel gingen aus der Fläche des Horizonts hervor, und schwollen nach und nach, bis die Himmel sich ganz umzogen. Der Abend fiel plötzlich ein; der sich aufmachende Wind, die schweren Wolken, welche die Atmosphäre beluden, und die Donner, die von weitem brüllten, erschreckten Julien, und drohten einen heftigen Sturm. Der Sturm kam heran, und der Capitän warf vergebens das Senkbley nach einem Ankerplatze aus; es war hohe See, und das Schiff wurde wüthend vom Winde fortgetrieben. — Nur zu Zeiten ward die Dunkelheit von flammenden Blitzen unterbrochen, die auf dem Wasser zitterten, die tobenden Wellen erleuchteten, und die nachfolgende Finsterniß nur schrecklicher machten. Der Donner, der mit schrecklichem Gekrache oben losbrach, das laute Brüllen der Wellen von unten, das Geschrey der Matrosen, und das plötzliche Krachen und Stöhnen des Schiffs erhöhte vereint die furchtbare Erhabenheit der Scene.
[Im Original schließen sich hier folgende Verszeilen an:
Far on the rocky shores the surges sound,
The lashing whirlwinds cleave the vast profound;
While high in air, amid the rising storm,
Driving the blast, sits Danger's black'ning form.]
Julie lag ohnmächtig von Schrecken und Krankheit in der Kajüte, und Ferdinand, obgleich selbst beynahe hoffnungslos, versuchte dennoch sie aufzurichten, als ein lautes schreckliches Krachen von oben gehört ward. Das ganze Schiff schien von einander gerissen zu seyn. Die Stimmen der Matrosen erhoben sich zugleich, und alles war Verwirrung und Aufruhr. Ferdinand lief auf das Verdeck, und hörte, daß der große Mast vom Winde fortgerissen, auf das Verdeck gefallen, und von da über Bord gerollt sey.
Es war nun nach Mitternacht, und der Sturm dauerte mit unablässiger Wuth fort. Vier Stunden lang war das Schiff vom Sturme gewaltsam fortgetrieben, und der Capitän erklärte jetzt, es sey unmöglich, daß es noch länger laviren könnte, und befahl, das große Boot bereit zu halten. Kaum war sein Befehl vollzogen, als das Schiff an einer Felsenklippe scheiterte, und die ungestümen Wellen herein drangen — ein allgemeines Geheul erscholl von allen Seiten. Ferdinand flog herbey, seine Schwester zu retten, die er in das Boot trug, welches von dem Capitän und dem größten Theile seines Schiffsvolkes beynahe angefüllt war. Die Fluth war so hoch, daß es unmöglich schien, das Ufer zu erreichen; allein das Boot war noch wenige Klafter weit fortgerudert, als das Schiff in Stücken riß. Der Capitän wurde nun bey dem Leuchten des Blitzes eine hohe, felsige Küste nicht weit davon gewahr; die Matrosen arbeiteten aus voller Kraft bey den Rudern; allein fast so oft, als sie die Spitze einer Welle erreichten, wurden sie wieder zurück getrieben, und ihre Arbeit vereitelt. Nach vieler Schwierigkeit und Ermüdung erreichten sie endlich die Küste, wo eine neue Gefahr sich zeigte. Sie sahen ein wildes, felsiges Ufer, dessen Klippen unzugänglich schienen, und alle Möglichkeit anzulanden verhinderten. Doch fanden sie zuletzt einen Landplatz, und nach vielem Suchen entdeckten die Matrosen eine Art von Fußweg, der in den Felsen gehauen war, und den sie alle glücklich hinauf stiegen. Schwach schimmerte die Dämmerung, und sie übersahen die Küste, konnten aber keine menschliche Wohnung entdecken. Es schien ihnen, als wenn sie an der Küste von Sicilien wären; allein es gebrach ihnen an Mitteln, diese Vermuthung zu bestätigen. Schrecken, Krankheit und Ermüdung hatten Juliens Kräfte und Lebensgeister überwältigt, und sie sah sich genöthiget, sich auf den Felsen nieder zu setzen.
Der Sturm legte sich nun plötzlich, und die gänzliche Stille, die auf das wilde Toben der Winde und Wellen folgte, brachte eine große erhabene Wirkung hervor. Die Luft war in Todtenstille gewiegt; allein die Wellen waren noch in heftiger Bewegung, und bey dem zunehmenden Lichte sah man Stücke von dem gescheiterten Schiffe weit auf der Wasserfläche hinschwimmen. Auch einige Matrosen, die das Boot verfehlt hatten, sah man an Breter sich klammern, und nach dem Ufer hinarbeiten. Bey diesem Anblicke stiegen ihre Schiffskameraden sogleich in das Boot, stießen in die See, und erlösten sie aus ihrer gefährlichen Lage. — So bald Julie sich wieder einiger Maßen erhohlt hatte, gingen sie tiefer ins Land, um sich nach einer Wohnung umzusehen. Sie waren noch nicht weit gegangen, als das wilde Ansehen des Landes sich milderte, und sich nach und nach in die mahlerische Schönheit einer sicilianischen Gegend veränderte. Sie entdeckten in einiger Entfernung eine Villa, die auf einem mit Waldung gekrönten Hügel lag. Es war die erste menschliche Wohnung, die sie erblickt hatten, seit sie sich nach Italien einschifften, und Julie, die vor Mattigkeit fast erlag, sah sie mit Entzücken. Der Capitän und seine Leute eilten darauf zu, um ihre Noth kund zu thun, und Ferdinand und Julie folgten langsam nach. Sie sahen die Gesellschaft in die Villa gehen, und einer davon kam schnell zurück, um ihnen die gastfreye Aufnahme seiner Kameraden zu erzählen. Mit vieler Mühe erreichte Julie das Gebäude, und wurde an der Thür von einem jungen Cavalier empfangen, dessen angenehme, geistvolle Gesichtsbildung sie augenblicklich für ihn einnahm. Er bewillkommte die Fremden mit einer wohlwollenden Höflichkeit, die auf ein Mahl jedes unangenehme Gefühl, welches ihre Lage erregt hatte, austilgte, und ihnen ein augenblickliches Zutrauen einflößte. Durch eine helle, zierlich gebaute Halle, die in einen Dom aufstieg, den Pfeiler von weißem Marmor unterstützten, und der mit Büsten verziert war, führte er sie in ein prächtiges Gartenzimmer, das auf einen freyen Rasenplatz stieß. Hier nöthigte er sie, sich an einen Tisch mit Erfrischungen niederzusetzen, und ließ sie dann in Freyheit, die Pracht und Schönheit des Orts zu bewundern. Der Rasenplatz, der an jeder Seite von Gehölze eingezäumt war, glitt allmählich in einen schönen See hinab, in dessen glatter Fläche sich die umringenden Schatten spiegelten. Über denselben hinaus zeigte sich das ferne Land, das zur Linken in hohe, romantische Gebirge aufstieg, und zur Rechten eine sanfte, glühende Landschaft darstellte, deren ruhige Schönheit einen auffallenden Contrast mit der wilden Erhabenheit der gegen über liegenden Felsenhöhen bildete. Der blaue, ferne Ocean schloß die Aussicht. In kurzer Zeit kam der Cavalier zurück, und führte zwey Damen von sehr einnehmendem Ansehen herein, die er ihnen als seine Frau und Schwester vorstellte. Sie bewillkommten Julien mit entgegen kommender Gefälligkeit; allein Ermüdung nöthigte sie, sich zur Ruhe zu legen, und eine nachfolgende Unpäßlichkeit nahm so schnell zu, daß es ihr unmöglich war, ihren jetzigen Aufenthalt heute zu verändern. Der Capitän und seine Leute setzten ihren Weg fort, und ließen Ferdinand und Julien in der Villa, wo ihnen alle mögliche gütige und zärtliche Aufmerksamkeit bezeugt ward.
Der Tag, der Julien dem Kloster zu widmen bestimmt war, wurde in der Abtey mit den gewöhnlichen Ceremonien angefangen. Die Kirche wurde ausgeschmückt, und alle Bewohner des Klosters rüsteten sich zur Begleitung an. Der Abt frohlockte in dem glücklichen Erfolge seines Anschlags, und weidete sich im Voraus an der Wuth und Kränkung des Marquis, wenn er erführe, daß seine Tochter auf ewig für ihn verloren sey. Die Stunde der Feyer nahte nun heran, und mit stolzem, festem Schritte, und einem Gesicht, das seinen innern Triumph abmahlte, betrat er die Kirche. Er schritt zum Hochaltare fort, als man ihm sagte, daß Julie nirgends zu finden sey. Erstaunen verdrängte auf eine Weile alle andern Empfindungen — doch hielt er es für unmöglich, daß sie entflohen seyn konnte, und befahl, jeden Theil des Klosters zu durchsuchen — und vor allem die unterirdischen Gewölbe, die unter dem Walde hinliefen, nicht zu vergessen. Nachdem allenthalben gesucht war, und er an ihrer Flucht nicht langer zweifeln konnte, gohren seine betrognen Leidenschaften in eine Wuth auf, die alle Grenzen überschritt. Er schmetterte die schrecklichsten Flüche auf Julien herab, ließ Madame de Menon rufen, und klagte sie an, ihre heilige Religion durch Hülfleistung bey Juliens Flucht geschmäht zu haben. Madame ertrug diese Vorwürfe mit ruhiger Würde, und beobachtete ein standhaftes Stillschweigen; insgeheim aber beschloß sie das Kloster zu verlassen, und in einem andern die Ruhe zu suchen, welche sie in diesem nimmer zu finden hoffen durfte. Das Gerücht von Juliens Verschwinden breitete sich schnell über die Mauern aus, und drang zu des Marquis Ohren, der sich darüber freute, weil er glaubte, daß sie nun unfehlbar in seine Hände fallen müßte. Nachdem seine Leute auf seinen Befehl die umliegenden Wälder und Felsen sorgfältig durchsucht hatten, nahm er sie von der Abtey weg, vertheilte sie in verschiedene Wege, um Julien nachzuspüren, und kehrte auf das Schloß Mazzini zurück. Hier erwartete ihn ein neuer Verdruß; denn er erfuhr jetzt, daß Ferdinand aus seinem Gefängnisse entwischt war. Das Geheimniß von Juliens Flucht war nun aufgeklärt: es war augenscheinlich, durch wessen Hülfe sie solche bewerkstelligt hatte, und der Marquis stellte Befehl an seine Leute aus, sich Ferdinands zu bemächtigen, wo sie ihn auch fänden.
Hippolytus, der unter einer langen und gefährlichen Krankheit geseufzt hatte, welche seine Wunden erzeugten, und sein Seelenschmerz erhöhte und verlängerte, lag in einer kleinen Stadt an der Küste von Calabrien darnieder, und wußte noch nichts von Corneliens Tode. Er zweifelte kaum, daß Julie jetzt dem Herzoge geopfert sey, und dieser Gedanke war seinem Herzen Gift. So bald er seine Sinne wieder erhielt, schickte er einen Bedienten auf das Schloß Mazzini, um insgeheim Nachricht von dem, was seit seiner Abreise vorgegangen war, einzuziehen. Die Begierde, womit wir nach allem haschen, was uns dem Elende entreißen kann, ließ ihn zuweilen einer entfernten, romanhaften Hoffnung nachhangen, daß Julie noch für ihn lebe. Doch schwand auch diese Hoffnung endlich in Verzweiflung, als die Zeit verstrich, ohne daß sein Bedienter von Sicilien wieder kam. Tage und Wochen schlichen in äußerster Angst für Hippolytus dahin; denn noch immer ließ sein Abgesandter sich nicht erblicken; endlich vermuthete er, daß er von Räubern ergriffen, oder von dem Marquis entdeckt und zurück gehalten sey, und schickte einen zweyten Bothen nach dem Schlosse Mazzini ab. Durch diesen erfuhr er die Nachricht von Juliens Flucht, und sein Herz hüpfte vor Entzücken; schnell aber wurde sein Freude gedämpft, als er weiter hörte, daß der Marquis ihre Zuflucht im St. Augustinerkloster entdeckt hatte. Die Wunden, die ihn noch immer in Verhaft hielten, waren ihm jetzt unerträglich. Julie konnte auf immer für ihn verloren seyn. Allein selbst sein gegenwärtiger Zustand der Furcht und Ungewißheit war Segen, mit der Angst der Verzweiflung verglichen, die seine Seele so lange gefoltert hatte. So bald er hinlänglich hergestellt war, ging er nach Sicilien, in der Absicht, das St. Augustinerkloster zu besuchen, wo vielleicht Julie noch seyn konnte. Um so geheim, als es sein Plan erforderte, überzuschiffen, und den Angriffen des Marquis zu entwischen, ließ er seine Bedienten in Calabrien, und setzte sich allein zu Schiffe. Es war Morgen, als er an einem kleinen Hafen von Sicilien landete, und er machte sich sogleich nach der St. Augustinerabtey auf. So wie er fortritt, ging seine Einbildungskraft in die frühen Scenen seiner Liebe, in Juliens Unglück, in Ferdinands Leiden zurück, und sein Herz schmolz bey der Erinnerung. Er hielt es dann für wahrscheinlich, daß Julie in dem Mitleide des Abts Schutz vor ihrem Vater gefunden hatte; ja er wagte sogar einem schmeichelhaften, süßen Vorgenusse des Augenblicks nachzuhangen, der sie seinem Anblicke wieder gäbe. Er langte im Kloster an, und man denke sich seinen Schmerz, als er den Tod seiner geliebten Schwester und Juliens Flucht erfuhr. Ohne Verzug verließ er die Abtey, ohne einmahl zu wissen, daß Madame de Menon daselbst war, und wollte nach einer Stadt, einige Meilen weit, reiten, wo er die Nacht zuzubringen dachte. Versenkt in schwermüthigen Betrachtungen ließ er seinem Pferde die Zügel, und ritt fort, ohne auf seinen Weg zu achten. Der Abend war weit angebrochen, als er wahrnahm, daß er eine falsche Richtung genommen, und sich in einer wilden, einsamen Gegend verirrt hatte. Er war zu weit von der rechten Straße abgekommen, als daß er hoffen durfte, sie wieder zu erreichen, und hatte außer dem nicht auf die Gegenstände, die er hinter sich ließ, geachtet. Nur eine Wahl zwischen Irrwegen lag vor ihm. Zur Rechten sah er hohe, wilde Gebirge, mit Haide und schwarzem Strauchwerk bewachsen; ihr wildes, ödes Ansehen, und der sichtlich gefährliche Pfad, der sich daran hinauf wand, und die einzige Spur war, die man erblickte, hielt Hippolytus ab, sich hinauf zu wagen. Zur Linken lag ein Wald, nach welchem der Pfad, worauf er jetzt war, führte: er hatte ein düstres Ansehen; doch zog er ihn den Bergen vor, und da er den Umfang desselben nicht wußte, hielt er es für möglich, ihn zu passiren, und vor Einbruch der Nacht ein Dorf zu erreichen. Auf allen Fall mußte ihm der Wald eine Zuflucht vor den Winden verschaffen; und wenn er auch selbst sich in den Irrgängen desselben verirrte, konnte er einen Baum ersteigen, und sicher ruhen, bis das wieder anbrechende Licht ihm den Weg wiese, sich heraus zu finden. Zwischen den Gebirgen konnte er möglicher Weise keine andre Zuflucht finden, als die eine menschliche Wohnung ihm gewährte; und diese anzutreffen, war wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden. Noch außer dem drohten ihm dort unzählige Gefahren, vor welchen er auf ebnem Grunde gesichert war. Nachdem er also bey sich beschlossen hatte, welchen Weg er verfolgen wollte, setzte er sein Pferd in Galopp, und erreichte den Wald, als die letzten Strahlen der Sonne auf den Bergen zitterten. Das dicke Laub der Bäume verbreitete rings umher eine Dunkelheit, welche die Schatten des Abends mit jedem Augenblicke vertieften. Der Weg lief ununterbrochen fort, und der Graf verfolgte ihn, bis alle Unterscheidung sich in den Schleyer der Nacht verlor. Gänzliche Finsterniß machte es ihm jetzt unmöglich, seinen Weg fortzusetzen. Er stieg ab, band sein Pferd an einen Baum, und kletterte an den Zweigen hinauf, um bis zum Morgen daselbst zu bleiben. Er war nicht lange in dieser Lage gewesen, als ein verworrener Schall von Stimmen in der Ferne seine Aufmerksamkeit anzog. Der Schall kam von Zeit zu Zeit wieder, ohne daß er aber näher zu dringen schien. Er stieg vom Baume herunter, um besser von der Richtung, woher er kam, urtheilen zu können; allein ehe er den Grund erreichte, hörte das Getön auf, und alles war stille. Er horchte weiter; da aber die Stille ununterbrochen blieb, fing er an zu glauben, daß das Pfeifen des Windes zwischen den Blättern ihn getäuscht hätte, und schickte sich an, wieder hinauf zu steigen, als er ein schwaches Licht von fern durch die Bäume schimmern sah. Dieser Anblick regte die Hoffnung in ihm auf, daß er nahe bey einem menschlichen Wohnorte sey; er band sein Pferd los, und führte es nach der Gegend, woher der Strahl kam. Der Mond war nun aufgegangen, und warf einen gebrochenen Schimmer, hinlänglich ihm zu leuchten, auf seinen Pfad. — Ehe er noch weit gegangen war, verschwand das Licht. Er suchte sich indessen immer so nahe, als möglich, nach dem Orte zu halten, woher es gekommen war, und nach vieler Mühe drang er bis zu einem Orte durch, wo die Bäume rings um einen grünen Platz einen Kreis bildeten. Das Mondlicht ließ ihn ein Gebäude wahrnehmen, welches ehemahls ein Kloster gewesen zu seyn schien, jetzt aber nur einen Haufen von Ruinen zeigte, deren Größe durch den Verfall erhöht, den, der sie sah, mit Ehrerbiethung erfüllte. Hippolytus stand stille, um diesen Anblick anzustarren; die geheiligte Stille der Nacht erhöhte seine Wirkung, und ein geheimes Grausen, er wußte selbst, nicht woher, schlich sich in sein Herz. — Die Stille und das Ansehen des Platzes machte ihn zweifelhaft, ob dieß der Ort sey, den er suchte, und er stand unschlüssig, ob er fortgehen oder umkehren sollte, als er eine Gestalt unter einer Wölbung stehen sah. Sie trug ein Licht in der Hand, und ging schweigend fort, bis sie endlich in einem fernen Theile des Gebäudes verschwand. Hippolytus Muth verließ ihn auf einen Augenblick; dennoch überwältigte eine unüberwindliche Neugier sein Grausen, und er beschloß, wo möglich, den Weg, den die Gestalt genommen hatte, zu verfolgen. — Über lose Steine weg kam er in eine Art von Hof, bis er den gewölbten Gang erreichte. Hier stand er stille; denn seine Furcht kehrte wieder. Er raffte indessen seinen Muth zusammen, und ging weiter, indem er sich bemühte, den Weg, den die Gestalt genommen hatte, zu verfolgen, bis er sich plötzlich in einem eingeschloßnen Platze der Ruinen befand, dessen Ansehen wilder und öder war, als alles, was er noch gesehen hatte. Von unbezwinglichem Grausen ergriffen, wollte er zurück gehen, als die dumpfe Stimme einer bedrängten Person ihm ins Ohr drang. Sein Herz sank in ihm, seine Glieder bebten, und er war außer Stande, sich fortzubewegen — Der Ton, der das letzte Winseln eines Sterbenden zu seyn schien, wurde wiederhohlt. Hippolytus that sich eine plötzliche Gewalt an, sprang vorwärts, als ein Licht aus einem zerbrochenen Fenster des Gebäudes hervor brach, und er zu gleicher Zeit Menschenstimmen hörte. — Er ging leise nach dem Fenster zu, und sah in einem kleinen Zimmer, welches weniger verfallen war, als das übrige des Gebäudes, eine Gruppe von Menschen, die, aus ihren wilden Blicken und ihrer Kleidung zu urtheilen, Banditen waren. Sie umringten einen Menschen, der verwundet, und im Blut gebadet, auf der Erde lag, und von dem, allem Ansehen nach, das Winseln gekommen war. — Die Dunkelheit des Orts, den das Licht nur schwach erleuchtete, und die umringenden Banditen verhinderten Hippolytus, die Züge des Sterbenden zu unterscheiden. Aus dem Blute, das ihn bedeckte, und aus andern Umständen zu urtheilen, schien er ermordet zu seyn; und der Graf zweifelte nicht, daß die Leute, die er sah, seine Mörder wären. Das Schreckhafte der Scene überwältigte ihn ganz; er stand in den Boden eingewurzelt, und sah die Mörder die Taschen des Sterbenden ausplündern, der in kaum hörbarer Stimme, welcher Verzweiflung zu Hülfe zu kommen schien, um Mitleid flehte. Die Mörder antworteten ihm nur mit Flüchen, und setzten ihre Plünderung fort. Sein Winseln und seine Qualen schienen nur ihre Grausamkeit zu vermehren. Sie wollten ihm jetzt ein kleines Miniaturgemählde abnehmen, das an einem Bande um seinen Hals hing, und sich bisher in seinem Busen verborgen hatte, als er sich mit plötzlicher Gewalt von der Erde aufhob, und es aus ihren Händen zu reißen versuchte. Dieses Bestreben half ihm nichts; ein Schlag von einem der Bösewichter streckte den unglücklichen Mann ohne Bewegung zu Boden. Die gräßliche Barbarey dieser That ergriff Hippolytus Seele so gewaltsam, daß er, seine eigne Lage vergessend, laut aufschrie, und mit dem augenblicklichen Vorsatze, den Todten zu rächen, aufsprang. Das Geräusch beunruhigte die Banditen; sie sahen sich um, woher es käme, und erblickten durch das Fenster den Grafen. Flugs verließen sie ihre Beute, und stürzten nach der Thür des Zimmers. Das Gefühl seiner Gefahr war jetzt wieder in ihm erwacht, und er suchte nach dem äußersten Ende der Ruinen zu entfliehen; Schrecken aber verwilderte seine Sinnen, und er verfehlte den Weg. Statt den gewölbten Gang zu erreichen, verirrte er sich in fruchtlosem Wandern, und fand sich endlich tief in den geheimen Behältnissen des Gebäudes verwickelt. — Die Schritte seiner Verfolger waren dicht hinter ihm, und er ermüdete sich noch immer mit fruchtlosen Bemühungen zu entwischen, bis er endlich erschöpft zu Boden sank, und sich in sein Schicksal zu ergeben suchte. Mit finstrer Verzweiflung horchte er, und erstaunte, alles stille zu finden. Als er sich umsah, entdeckte er durch einen Strahl des Mondenlichtes, der von oben herein fiel, daß er in einem Gewölbe war, welches, so viel er urtheilen konnte, von großem Umfange zu seyn schien. — In dieser Lage blieb er eine lange Zeit, dachte über die Mittel zu entkommen nach; und fand keine. Blieb er in dem Gewölbe, so konnte er nur erwarten, gemetzelt zu werden; wollte er aber versuchen sich heraus zu wagen, so mußte er den Banditen in die Hände stürzen. Da er es also für den sichersten Weg hielt, zu bleiben, wo er war, suchte er mit Stärke sein Schicksal zu erwarten, als plötzlich die lauten Stimmen der Mörder in sein Ohr drangen, und er schnell Fußtritte nach dem Orte, wo er lag, heran nahen hörte — Verzweiflung erneute augenblicklich seine Stärke; er sprang von der Erde auf, warf einen Blick gieriger Verzweiflung rings umher, und haschte den Schimmer einer kleinen Thür, auf welche jetzt die Mondstrahlen fielen. Er eilte darauf zu, und ging eben hindurch, als ein Fackellicht auf den Mauern des Gewölbes strahlte. — Er tappte durch einen krummen Gang hin, und kam endlich an eine Stiege. Ungeachtet der Dunkelheit erreichte er sicher den Boden. — Jetzt zum ersten Mahle stand er stille, um zu horchen; er spürte keine Fußtritte mehr; alles war stille. Er wanderte immer weiter in fruchtlosem Bemühen zu entwischen, bis endlich seine Hände kaltes Eisen berührten; er fühlte sogleich, daß es zu einer Thür gehörte, allein sie war verschlossen, und widerstand allen seinen Versuchen, sie zu öffnen. Verzweifelnd wollte er den Versuch aufgeben, als ein lautes Geschrey von innen, worauf ein taubes, schweres Geräusch folgte, seine ganze Aufmerksamkeit erweckte. Er horchte lange an der Thür, seine Einbildungskraft; mit Schreckbildern erfüllt, und in Erwartung, den Schall wiederhohlt zu hören. Er suchte nach einer zerbrochenen Stelle der Thür, wodurch er entdecken könnte, was inwendig vorginge, fand aber keine, und nachdem er einige Zeit gewartet hatte, ohne weiter etwas zu hören, wollte er den Ort verlassen, als er mit dem Arme auf etwas Hartes an der Thür stieß. Er fühlte zu, und fand zu seinem äußersten Erstaunen, daß der Schlüssel im Schlosse steckte. Einen Augenblick über war er unschlüssig, was er thun sollte; Neugier aber überwältigte jede andere Betrachtung; und mit bebender Hand drehte er den Schlüssel um. Die Thür ging in ein großes, wüstes Zimmer, schwach erleuchtet von einer Lampe, die auf dem Tische stand, der beynahe das einzige Möbel im ganzen Orte war. Der Graf war einige Schritte vorwärts gegangen, als er einen Gegenstand wahrnahm, der seine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Auf die Erde ausgestreckt, dem Anscheine nach leblos, lag ein junges Frauenzimmer. Ihr Gesicht war in ihr Gewand gehüllt, und die langen kastanienbraunen Locken, die in schöner Fülle auf ihren Busen fielen, verschleyerten einen Theil der glühenden Schönheiten, welche die Unordnung ihres Anzugs enthüllt haben würde. — Mitleid, Erstaunen und Bewunderung kämpften in Hippolytus Brust, und während er da stand, und den Gegenstand anstaunte, der alle diese Gefühle in ihm erregte, hörte er Fußtritte nach dem Zimmer heran nahen. Er flog zu der Thür, durch die er herein gekommen war, und war so glücklich, sie zu erreichen, ehe die Menschen, deren Fußtritte er gehört hatte, herein traten. Er drehte den Schlüssel um, und blieb außen vor der Thür stehen, um ihrem Verfahren zuzuhören. Er unterschied die Stimmen zweyer Leute, und erkannte sie für die Mörder, die er oben gehört hatte. Gleich darauf hörte er einen durchdringenden Schrey, und zugleich wurden die Stimmen der Mörder laut und heftig. Einer von ihnen rief, daß das Frauenzimmer sterben würde, und klagte den andern an, sie zu Tode geschreckt zu haben, indem er mit schrecklichen Flüchen schwor, daß sie sein wäre, und daß er bis auf den letzten Blutstropfen sie vertheidigen wollte. Der Streit ward heftiger, und keiner von den Bösewichtern wollte seine Ansprüche auf den unglücklichen Gegenstand desselben aufgeben, — Bald nachher hörte man mit schrecklichem Geräusche Schwerter klirren. Das Schreyen wurde wiederhohlt, und die Eide und Flüche der Streitenden verdoppelten sich. Sie schienen nach der Thür zu gehen, hinter der Hippolytus verborgen stand: plötzlich, wurde die Thür mit voller Kraft erschüttert; ein tiefes Brüllen folgte, und gleich darauf kam ein Getös, als wenn jemand mit voller Schwere plötzlich zu Boden sänke. Einen Augenblick über war alles stille. Hippolytus zweyfelte nicht, daß der eine Mörder den andern erlegt hatte, und bald bestätigte dieß das viehische Triumphgeschrey des Siegers über seinen gefallenen Feind. Der Mörder verließ eilends das Zimmer, und kurz darauf hörte Hippolytus die fernen Stimmen verschiedner Personen in lautem Wortwechsel. Der Schall schien aus einem Zimmer über dem Orte, wo er stand, zu kommen; auch hörte er von oben das Trampeln von Füßen, und konnte sogar zu Zeiten die Worte der Streitenden unterscheiden. Aus diesen haschte er genug auf, um zu hören, daß der eben vorgefallene Streit und das Frauenzimmer, das die Veranlassung dazu gegeben hatte, die Gegenstände des Gesprächs waren. Allein die Stimmen schrien oft alle durch einander, so daß man wenig verstehen konnte. — Endlich legte sich der Tumult, und Hippolytus konnte nun unterscheiden, was gesagt wurde. Die Mörder kamen überein, daß das Frauenzimmer dem überlassen werden sollte, der um sie gefochten hätte. — Nach diesem einstimmigen Ausspruche ließen sie ihm seine Beute, und gingen aus, neue zu suchen. — Die Lage des unglücklichen Frauenzimmers erregte in Hippolytus eine Mischung von Empörung und Mitleid, die ihn eine Zeit lang gänzlich beschäftigte; er dachte über das Mittel nach, sie aus einem so kläglichen Zustande zu befreyen, und vergaß über diesen Gedanken beynahe seine eigene Gefahr. Er hörte jetzt ihre Seufzer, und während sein Herz bey diesen Tönen schmolz, wurde die andere Thür des Zimmers aufgerissen, und der Elende, dem sie überantwortet war, drang herein. Ihr Geschrey verdoppelte sich, war aber umsonst bey dem Barbaren, der sie in seine Arme gerissen hatte. Der Graf, der unbewaffnet war, fühllos gegen jeden andern Antrieb als den des edelmüthigsten Mitleids, drang in das Zimmer — und ward zur Bildsäule, als er in den Armen des Bösewichts Julien kämpfen sah. — Sie erkannte Hippolytus und that einen gewaltsamen Sprung, um sich zu befreyen; indem sie aber auf ihn zulief, sank sie leblos in seine Arme. — Muth und Erstaunen funkelten in den Augen des Mörders, und mit wilder Verzweiflung ging er auf den Grafen los. Dieser legte Julien nieder, riß das Schwert des todten Mörders, der auf der Erde ausgestreckt lag, weg, und setzte sich zur Wehre. Das Gefecht war wüthend; aber Hippolytus streckte seinen Gegner sinnlos zu seinen Füßen. Er flog zu Julien, die jetzt wieder auflebte, aber lange nur durch Thränen sprechen konnte. Der Übergang so verschiedener und schneller Empfindungen, die ihr Herz erfuhr, die wunderbar gemischten Regungen von Freude und Entsetzen in Hippolytus Brust kann nur die Erfahrung sich denken. Er hob sie von der Erde auf, und bemühte sich, ihr Fassung einzusprechen, als sie wild nach Ferdinanden rief. Bey diesem Nahmen erstarrte der Graf; er erinnerte sich an den sterbenden Cavalier, dessen Gesicht die Dunkelheit vor seinem Blicke verborgen hatte. — Sein Herz bebte vor gemeiner Angst; doch beschloß er, seine schrecklichen Vermuthungen vor Julien zu verbergen, von der er erfuhr, daß sie mit Ferdinanden auf ihrem Wege von der Villa, wo sie eine so gastfreye Aufnahme nach dem Schiffbruche fanden, von den Banditen überfallen wurden. Sie waren auf dem Wege nach einem Hafen, von wo aus sie sich wieder nach Italien einzuschiffen dachten, als dieses Unglück ihnen zustieß. Julie setzte hinzu, Ferdinand sey sogleich von ihr getrennt worden, und sie selbst sey einige Stunden lang in dem Zimmer eingesperrt gewesen, wo Hippolytus sie fand. — Kaum konnte der Graf seine schrecklichen Besorgnisse um Ferdinanden verhehlen, und vergebens strebte er, Juliens Kummer zu besänftigen. Allein es war jetzt keine Zeit zu verlieren — sie mußten einen Weg aus dem Gebäude suchen, und ehe sie dieß vollbracht hatten, konnten die Banditen zurück kehren. Auch war es möglich, daß ein Theil derselben zurück gelassen war, um diesen ihren Aufenthalt während der Abwesenheit der andern zu bewachen, und dieses war eine neue, gegründete Ursache zur Unruhe. Nach kurzem Hin- und Hersinnen hielt Hippolytus es für das Klügste, einen Ausgang durch eben den Weg, wodurch er herein gekommen war, zu suchen; er nahm also die Lampe, und führte Julien zur Thür. Sie traten in den Gang, schlossen die Thür hinter sich zu, und suchten die Stiege, die der Graf zuvor herunter gegangen war; nachdem sie aber lange den krummen Gang verfolgt hatten, ohne sie zu finden, sah er deutlich: daß er den Weg verfehlt hatte. Sie fanden indessen eine andre Stiege, die sie herab gingen, und in einen so schmalen und niedrigen Gang kamen, daß sie nicht aufrecht gehen konnten. Dieser Gang schloß sich mit einer Thür, die fast ganz von Eisen war. Hippolytus erschrak bey diesem Anblicke, als er sich aber mit voller Stärke dagegen lehnte, gab sie nach; die eingeschloßne Luft drang heraus und löschte beynahe die Lampe aus. Sie kamen jetzt in einen finstern Abgrund, und das Schloß, das eine Springfeder hatte, sprang plötzlich hinter ihnen zu. Als sie rings um sich blickten, sahen sie ein großes Gewölbe, und es ist unmöglich, ihr Entsetzen zu schildern, als sie entdeckten, daß sie in einem Behältnisse der ermordeten Körper der unglücklichen Menschen waren, die den Banditen in die Hände fielen. — Kaum konnte der Graf Juliens sinkende Lebensgeister aufrecht halten; er lief nach der Thür, und suchte sie zu öffnen; allein daß Schloß war so eingerichtet, daß es nur von der andern Seite bewegt werden konnte, und alle seine Bemühungen waren vergebens. Er suchte nun nach einer andern Thür, konnte aber keine gewahr werden. Ihre Lage war die bejammernswürdigste, die man sich nur denken kann; sie sahen sich in ein Gewölbe gesperrt, das mit den todten Körpern der Ermordeten bestreuet war, und mußten die Schlachtopfer des Hungers oder des Schwertes werden. Die Erde war an verschiedenen Stellen aufgeworfen, und bezeichnete die Grenzen neu gemachter Gräber. Die unbegrabnen Leichname waren entweder aus Eile oder Nachlässigkeit zurück gelassen, und zeigten einen Anblick, der zu schrecklich für die Menschheit war: Hippolytus Qual stieg, wenn er Julien anblickte, die vor Entsetzen erlag; er trug sie mehr, als er sie führte, nach einem Theile des Gewölbes, der in eine Höhlung zurück wich, worin eine Bank stand. Noch nicht lange waren sie in dieser Lage gewesen, als sie allmählich ein Geräusch heran nahen hörten, das nicht von dem Gange, den sie passirt hatten, zu kommen schien.Das Geräusch wurde stärker, und sie konnten Stimmen unterscheiden. Hippolytus glaubte, daß die Mörder zurück gekommen wären, daß sie seinen Aufenthalt ausgespürt hätten, und durch einen ihm unbekannten Weg nach dem Gewölbe kamen. Er machte sich auf das Schlimmste gefaßt, zog seinen Degen, und nahm sich vor, Julien bis aufs Äußerste zu vertheidigen. Ihre Furcht wurde indessen bald durch ein Trampeln von Pferden zerstört, die den Lärm verursacht hatten, und jetzt aus einem Vorhofe von oben, nahe bey dem Gewölbe zu kommen schienen. Er hörte deutlich die Stimme der Banditen, nebst dem Flehen und Winseln eines Menschen, den sie zu plündern beschäftigt schienen. Der Ton lautete so sehr nahe, daß Hippolytus erschrak und erstaunte; er sah sich rings in dem Gewölbe um, und nahm hoch in der Mauer ein kleines Gitterfenster wahr, aus welchem man den Ort, wo die Räuber versammelt waren, mußte übersehen können. Es fiel ihm ein, daß sein Licht ihn verrathen könnte, und so schrecklich der Tausch auch war, sah er sich doch genöthigt, es auszulöschen. Er versuchte nun nach dem Fenster hinauf zu klettern, durch welches er sehen zu können glaubte, was außen vorging. Es gelang ihm endlich: denn er konnte auf den rauhen Steinen fußen. Er sah in einem verfallnen Vorhofe, den das Fackellicht zum Theil erhellte, einen Haufen Banditen zwey Leute, die auf ihren Pferden fest gebunden waren, und um Gnade flehten, umringen. Einer von den Räubern bekräftigte mit einem Eide, daß dieß eine goldene Nacht wäre, befahl seinen Kameraden, fortzumachen, und setzte hinzu, daß er selbst gehen, und Paulo und die Dame aufsuchen wolle. Die Wirkung, welche diese letzten Worte auf die Gefangenen im Gewölbe hervor brachten, kann durch keine Worte beschrieben werden. Sie befanden sich jetzt in stockfinsterer Nacht in dieser Wohnung der Ermordeten, ohne Mittel zu entwischen, und in augenblicklicher Erwartung, das schreckliche Geschick der elenden Gegenstände um sich her zu theilen. Julie, von Angst und Entsetzen überwältigt, sank zur Erde, und Hippolytus, der von seinem Gitterfenster herunter stieg, vergaß in Angst um sie seine eigne Gefahr. In kurzem war alles u m sie her in Verwirrung und Aufruhr; der Mörder, der vom Hofe ging, kam mit der Nachricht zurück, daß Paulo ermordet, und das Frauenzimmer entflohen sey. Die Räuber ließen ihre Beute fahren, um der Flüchtigen nachzusetzen, und den Mörder zu entdecken, auf den schreckliche Flüche durch alle Höhlen des Gebäudes wiederhallten. Das Lärmen hatte eine lange Zeit gedauert, welche die Gefangenen in einem Zustande schrecklicher Qual zubrachten, als sie das Getümmel nach dem Gewölbe herannahen hörten, und bald nachher eine Menge Stimmen den Gang herunter schallten. Die Fußtritte wurden schneller; Hippolytus zog aufs neue sein Schwert, und stellte sich dem Eingange gegen über, wo er noch nicht lange gestanden hatte, als ein heftiger Stoß gegen die Thür geschah: sie sprang auf, und ein Haufen Menschen drang in das Gewölbe. Hippolytus behauptete seinen Posten und betheurete, daß er den Ersten, der sich ihm nahte, niederstoßen würde. Bey dem Laute seiner Stimme standen sie still, gingen aber sogleich vorwärts, und befahlen ihm in des Königs Nahmen, sich zu ergeben. Er sah nun, was seine Bewegung ihn früher zu sehen verhindert hatte, daß die Leute vor ihm nicht Banditen, sondern Gerichtsbediente waren. Sie hatten durch den Sohn eines sicilianischen Edelmanns, der in die Hände der Banditen fiel und ihnen nachher entwischte, von dieser Mördergrube Nachricht bekommen. Die Gerichtsdiener kamen in Begleitung einer Wache, und waren auf alle Art gerüstet, diese schrecklichen Höhlen aufs strengste zu durchsuchen. Hippolytus erkundigte sich nach Ferdinanden, und sie verließen insgesammt das Gewölbe, um ihn aufzusuchen. In dem Vorhofe, zu welchem sie jetzt hinauf stiegen, war der größte Theil der Banditen durch eine Zahl von der Wache in Sicherheit gebracht. Der Graf klagte die Räuber an, daß sie seinen Freund, den er beschrieb, verheimlichten, und drang auf seine Befreyung, Mit einer Stimme läugneten sie das Factum, und beharrten entschlossen dabey, daß sie nichts von der beschriebenen Person wüßten. Dieses Läugnen bestärkte Hippolytus in seinem ersten, schrecklichen Verdachte, daß der Cavalier, den er gesehen hatte, kein andrer, als Ferdinand, gewesen sey, und dieser Gedanke machte ihn rasend. Er bath die Gerichtsdiener, ihr Suchen fortzusetzen; sie ließen eine Wache bey den Banditen, die sie in Sicherheit gebracht hatten, zurück, und folgten ihm in das Zimmer, wo der letzte schreckliche Auftritt vorgegangen war. Das Zimmer war dunkel und leer, aber Spuren von Blute klebten noch auf dem Fußboden, und Julie, ob sie gleich den nähern Grund von Hippolytus Besorgniß nicht wußte, sank bey dem Anblicke beynahe in Ohnmacht. Aus dem Zimmer wanderten sie eine Zeit lang zwischen den Ruinen fort, ohne etwas Außerordentliches zu entdecken, bis, als sie in den gewölbten Weg traten, durch den Hippolytus zuerst in die Ruinen gelangt war, ihre Fußtritte einen dumpfen Schall zurück gaben, der sie überzeugte, daß der Raum unten hohl war. Auf nähere Untersuchung entdeckten sie bey dem Fackellichte eine Fallthür, die sie mit einiger Schwierigkeit in die Höhe hoben, und unter derselben eine schmale Stiege fanden. Sie stiegen alle in einen niedrigen, krummen Gang hinab, wo sie noch nicht weit gekommen waren, als sie von oben ein Pferdegetrappel und ein lautes, plötzliches Getümmel hörten. Die Gerichtsdiener fürchteten, daß die Banditen sich los gerissen, und die Wache überwältigt hätten, und eilten nach der Fallthür zurück, die sie kaum aufgehoben hatten, als sie Schwerter klirren, und ein Gewühl unbekannter Stimmen hörten. Sie blickten gerade aus, und sahen durch die Wölbung in einer Art innern Vorhofe eine große Anzahl Banditen, die eben angekommen waren, ihre Kameraden befreyen und wüthend mit der Wache kämpfen. Bey diesem Anblicke sprangen einige der Gerichtsdiener vorwärts, um ihren Freunden beyzustehen, und die übrigen, von Feigheit überwältigt, eilten die Stiege wieder herunter, und ließen die Fallthür mit donnerndem Getöse hinter sich zufallen. Sie benachrichtigten Hippolytus von dem, was oben vorging, und er trieb Julien eilends den Gang hinunter, um einen andern Ausweg oder Verbergungsort zu suchen. Sie konnten keines von beyden finden, und waren noch nicht lange aus den Krümmungen des Wegs fortgegangen, als sie die Fallthür aufheben, und Leute herab kommen hörten. Verzweiflung gab Julien Stärke, und beflügelte ihre Flucht. Jetzt aber hielt eine Thür sie auf, die den Gang verschloß, und entfernte Stimmen murmelten längs den Mauern. Die Thür war mit starken eisernen Riegeln befestigt, welche Hippolytus umsonst aufzuziehen versuchte. Die Stimmen drangen näher. Nach vieler Mühe und Anstrengung wichen die Riegel; die Thür ging auf, und Licht dämmerte durch die Öffnung einer Höhle, die sie jetzt betraten. Als sie die Höhle verließen, sahen sie sich im Walde, und erreichten in kurzer Zeit die Grenzen. Nun erst wagten sie stille zu stehen; sie blickten zurück, und wurden niemand gewahr, der sie verfolgte.
So bald Julie ein wenig geruht hatte, folgten sie der Spur vor ihnen, und erreichten in kurzem ein kleines Dorf, wo sie Sicherheit und Erfrischung fanden. Allein Julie, deren Seele mit schrecklicher Angst um Ferdinanden erfüllt war, sah alles um sie her gleichgültig an. Selbst Hippolytus Gegenwart, die noch vor kurzem sie vom Elende zur Freude empor gehoben haben würde, konnte jetzt ihren Kummer nicht besänftigen. Die standhafte, edle Zuneigung ihres Bruders war tief in ihr Herz gedrungen, und Betrachtung vermehrte nur ihren Kummer. Doch hatten die Banditen fest darauf beharrt, daß er nicht in ihren Höhlen verborgen wäre, und diese Bekräftigung, die Hippolytus Furcht nur noch verfinsterte, warf einen Schimmer von Hoffnung auf Juliens Seele. Ein sie unmittelbarer betreffender Gegenstand zwang endlich ihre Gedanken von dieser traurigen Beschäftigung ab. Es war nothwendig, sich zu einem bestimmten Verfahren zu entschließen, denn sie befand sich jetzt an einem unbekannten Orte, und wußte keinen Zufluchtsplatz. Der Graf, der vor den Gefahren, die sie umringten, und vor der Wahrscheinlichkeit, daß sie ihm auf immer entrissen werden könnte, erbebte, glaubte jetzt die gefährliche Delicatesse überwinden zu müssen, die unter diesen traurigen Umständen ihm Stillschweigen auflegte. Er bath sie, die Möglichkeit einer Trennung zu zerstören, und einzuwilligen, unverzüglich die Seine zu werden. Er stellte ihr vor, daß man leicht einen Priester von einem benachbarten Kloster herbey schaffen könnte, der die Bande, welche längst ihre Herzen vereinigten, befestigen, und so auf ein Mahl dem Geschicke Grenzen setzen würde, welches so lange ihren Hoffnungen gedroht hatte. Dieser Vorschlag, obschon gleich lautend mit dem, welchen sie zuvor angenommen hatte, und obschon das sicherste Mittel, sie vor dem Schicksale, das sie fürchtete, zu retten, erfüllte sie jetzt mit Kummer und Niedergeschlagenheit. Sie liebte Hippolytus mit standhafter, zärtlicher Liebe, welche noch durch die Dankbarkeit, auf die er als ihr Erretter berechtigt war, erhöht wurde; allein sie sah es für eine Entweihung des Gedächtnisses des Bruders an, der so viel um sie gelitten hatte, Freude in den Schmerz zu mischen, worein die Ungewißheit seines Schicksals sie versenkte. Sie milderte ihre Verweigerung durch eine holde Zärtlichkeit, welche schnell Hippolytus aufsteigende, eifersüchtige Zweifel zerstreute, und seine hohe Bewunderung ihres Charakters vermehrte. Sie wünschte sich auf einige Zeit in ein einsames Kloster zurück zu ziehen, und da den Ausgang der Begebenheit zu erwarten, die für jetzt sie in Angst und Kummer verwickelte. Hippolytus kämpfte mit seinen Gefühlen, und enthielt sich, weiter auf die Bitte zu dringen, von deren Erfüllung jetzt seine ganze Glückseligkeit, ja beynahe sein Daseyn selbst abhing. Er erkundigte sich im Dorfe nach einem benachbarten Kloster, und hörte, daß im Umkreise von mehr als sechs Meilen keins läge, in der Nähe der Stadt Palini aber, oder doch in dieser Entfernung lägen zwey. Er verschaffte sich Pferde, überließ es den Gerichtsdienern, eine stärkere Wache von Palermo zu hohlen, und begab sich von Julien begleitet auf den Weg nach Palini. Julie war stille und tiefsinnig. Nach und nach sank Hippolytus in eben die Stimmung, und oft warf er ängstliche Blicke um sich her, als sie einige Stunden lang an dem Fuße der Gebirge reisten. Sie hielten stille, um unter den Schatten einiger Buchen Mittag zu halten; denn aus Furcht entdeckt zu werden, hatte Hippolytus sich gegen die Notwendigkeit, in vielen Wirthshäusern einzukehren, versehen. Nach geendigtem Mahle setzten sie ihre Reise fort; jetzt aber wurde Hippolytus zweifelhaft, ob er auf dem rechten Wege sey. Da er sich aber auf keine Art Gewißheit über diesen Punct verschaffen konnte, folgte er dem Wege vor ihm, der sich jetzt einen steilen Hügel hinan wand, von welchem sie in ein blühendes Thal hinab stiegen, wo des Schäfers Flöte süß von den Hügeln ertönte. Die Abendsonne goß einen sanften Schimmer über die Landschaft aus, und hauchte auf jeden Gegenstand einen Purpurglanz, der ein weniger bekümmertes Herz, als Juliens war, in gleichstimmige Friedensgefühle würde gesenkt haben. Der Abend brach jetzt an, und da sie des Wegs zweifelhaft waren, und sahen, daß es unmöglich seyn würde, Palini auf die Nacht zu erreichen, lenkten sie auf ein Dorf zu, das sie am Ende des Thals wahrnahmen. Sie waren kaum eine halbe Stunde weit fortgeritten, als sie plötzlich Stimmen von den Hügeln hinter ihnen erschallen hörten, und durch die Abenddämmerung einen Haufen Leute zu Pferde erblickten, die auf sie zueilten. So wie sie näher kamen, konnten sie die Worte unterscheiden, und Julie glaubte ihren eignen Nahmen nennen zu hören. Erschrocken zweifelte sie nicht, daß eine Partey von ihres Vaters Leuten sie entdeckt hatte, und flog mit Hippolytus das Thal hinab. Die Verfolgenden hatten sie indessen beynahe eingehohlt, als sie die Mündung einer Höhle erreichten, in welche sie eilends liefen, um sich zu verstecken; Hippolytus zog sein Schwert, erwartete die Feinde, und blieb stehen, um den Eingang zu besetzen. — Nach wenig Augenblicken hörte Julie Schwerter klirren; ihr Herz zitterte für Hippolytus, und sie war im Begriffe zurück zu kehren, sich der Gewalt ihrer Feinde auszuliefern, und so die Gefahr von ihm abzuwenden, als sie die laute Stimme des Herzogs erkannte. Sie fuhr bey diesem Laute unwillkürlich zusammen, folgte den Krümmungen der Höhle, und floh in ihre innersten Behältnisse. Noch nicht lange war sie hier gewesen, als die Stimmen durch die Höhle ertönten, und näher kamen. Es war nun gewiß, daß Hippolytus überwunden war, und daß ihre Feinde sie suchten. Sie warf einen Blick unaussprechlicher Angst um sich her, und entdeckte dicht neben sich bey dem plötzlichen Schimmer einer Fackel eine niedrige, tiefe Spalte in dem Felsen. Das Licht, welches von ihren Verfolgern kam, wurde stärker: auf den Knien kroch sie durch die Spalte; denn die überhangenden Klippen ließen ihr nicht zu, anders hinein zu kommen, und nach wenig Schritten fand sie eine Thür. Die Thür ging auf, wie sie sich anlehnte, und sie sah sich nun plötzlich in einer hohen, gewölbten Höhle, die ein schwaches Licht von den Mondstrahlen erhielt, welche durch eine Öffnung oben im Felsen hinein drangen. Sie machte die Thür zu und stand still, um zu horchen. Die Stimmen wurden lauter und deutlicher, und kamen endlich so nahe, daß sie unterschied, was gesagt wurde. Vor allen andern hörte sie die Stimme des Herzogs. »Es ist unmöglich, daß sie aus der Höhle gegangen seyn kann,« sagte er; »und ich will sie nicht eher verlassen, bis ich sie gefunden habe. Durchsucht diesen Felsen zur Linken; ich will hier weiter gehen.« Diese Worte waren für Julien genug; sie floh von der Thür quer durch die Höhle, und nachdem sie lange gelaufen war, ohne zum Ende zu kommen, stand sie stille, um Athem zu schöpfen. Alles war jetzt stille, und so wie sie umher sah, fiel die düstre Einsamkeit des Orts mit allen Schrecknissen auf ihre Fantasie. Sie übersah in wildem Staunen den weiten Umfang der Höhle, und fürchtete, daß sie sich aufs neue in die Hände der Banditen gestürzt hätte, für die allein dieser Ort ein angemessenes Behältniß zu seyn schien. Nachdem sie lange gehorcht hatte, ohne weiter Stimmen zu hören, bemühte sie sich, die Thür wieder zu finden, durch die sie herein gekommen war; allein die Dunkelheit, und der weite Umfang der Höhle machte ihr Bemühen hoffnungslos und vergebens. Nachdem sie lange in der Kluft umher geirrt hatte, gab sie den Versuch auf, und suchte sich in ihr Schicksal zu ergeben, und ihre zerstörten Gedanken zu sammeln. Die Erinnerung an ihre vorige wunderbare Rettung flößte ihr Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes ein. Aber Hippolytus und Ferdinand waren beyde für sie verloren — vielleicht auf immer dahin, und die Ungewißheit ihres Schicksals gab ihrer Fantasie vollen Raum, und ihrem Kummer Stacheln. — Gegen Morgen mußte der Schmerz der Natur weichen, und Julie sank in Ruhe. Die Strahlen der Sonne, die quer durch die Öffnung des Felsens herein brachen, und einige Stellen der Höhle erleuchteten, weckten sie auf. Ihre Sinne waren noch vom Schlafe umnebelt, und sie fuhr voll Entsetzen zusammen, als sie sich in dieser Lage sah. Nach und nach drang Besinnungskraft in ihre Seele; ihr Kummer kehrte zurück, und sie erkrankte bey dem schrecklichen Rückblicke. Sie stand auf, und erneute ihr Suchen nach einem Ausgange. So unvollkommen das Licht auch war, kam es ihr doch jetzt zu Nutzen, und sie fand eine Thür, die aber nicht die war, durch welche sie den Eingang gefunden hatte. Sie war stark befestigt; indessen fand sie das Schloß und die Riegel, welche sie hielten, und brachte sie endlich auf. Sie stieß in einen dunklen Gang, welchen sie betrat. — Sie tappte eine Zeit lang an den Wänden hin, als sie wahrnahm, daß etwas den Weg hemmte. Sie entdeckte, daß eine Thür ihr Weitergehen hinderte, und suchte nach den Riegeln, die sie befestigen könnten. Sie fand diese, und durch Verzweiflung gestärkt zwang sie sie zurück. Die Thür that sich auf, und sie sah in einem kleinen Zimmer, in welches durch ein Fenster von oben ein schwaches Licht fiel, die bleiche, abgezehrte Gestalt einer Frau mit halb geschloßnen Augen in einem Lehnstuhle sitzen. Als die Frau Julien wahrnahm, starrte sie von ihrem Sitze auf, und ihr Gesicht drückte ein wildes Erstaunen aus. Ihre Züge, von Kummer zernagt, trugen noch Spuren hoher Schönheit, und eine milde Würde, die Julien eine unwillkürliche Ehrfurcht einflößte, war über ihr Wesen ausgegossen. — Sie schien reden zu wollen — häftete mit innigem, starrem Blicke ihre Augen auf Julien, stand einen Augenblick in heißem Anstaunen da, rief plötzlich: »Meine Tochter!« — und sank zu Boden. — Juliens Erstaunen ließ ihr kaum zu, der Frau beyzustehen, die fühllos auf der Erde ausgestreckt lag. Ein Gewühl wunderbarer, unreifer Ideen stürmte in ihre Seele, und sie verlor sich in Verwirrung und Zweifeln; als sie aber die Züge der Fremden, die sich jetzt wieder belebten, näher betrachtete, däuchte ihr Emiliens Ebenbild zu sehen. — Die Frau stieß einen Seufzer aus, und schlug die Augen auf; sie richtete sie auf Julien, die in sprachlosem Erstaunen über ihr hing, und indem sie mit zärtlichem innigem Ausdruck sich auf sie häfteten, füllten sie sich mit Thränen. Sie drückte Julien an ihr Herz, und einige Momente voll unaussprechlicher Bewegung folgten.
»Dank dir, ewige Gottheit!« — sagte sie; »mein Gebeth ist erhört! Es ist mir vergönnt, eins von meinen Kindern noch zu umarmen, ehe ich dahin gehe. Sage mir, wer führte dich hierher? hat der Marquis sich endlich erweichen lassen, und mir erlaubt, euch noch nochmahls zu sehen? oder hat der Tod meine unglücklichen Fesseln gelöset?« — Wahrheit dämmerte jetzt in Juliens Seele, aber so schwach, daß sie, statt sie zu erhellen, sie nur noch tiefer verwickelte. »Lebt der Marquis von Mazzini noch?« fuhr die Dame fort. — Diese Worte ließen keinen Zweifel mehr zu. Julie warf sich zu den Füßen ihrer Mutter, und in krampfhaftem Entzücken ihre Knie umklammernd, konnte sie nur durch Schluchzen antworten.
Die Marquise fragte begierig nach ihren Kindern. — »Emilie lebt,« antwortete Julie; »aber mein theurer Bruder! —«
»O! sage mir alles!« rief die Marquise mit schneller Bewegung. — Eine Erklärung erfolgte nunmehr. Als die Marquise Ferdinands Schicksal hörte, seufzte sie tief, schlug ihre Augen gen Himmel auf, und kämpfte, einen Blick frommer Ergebung anzunehmen; allein der Kampf mütterlicher Gefühle war zu sichtbar, und überwältigte beynahe ihre Kraft. — Julie gab ihr eine kurze Nachricht von allen vorher gehenden Begebenheiten und von ihrem Eingange in die Höhle, und fand zu ihrer unbeschreiblichen Verwunderung, daß sie jetzt in einer unterirdischen Wohnung war, die zu den südlichen Gebäuden des Schlosses Mazzini gehörte. — Die Marquise wollte ihre Erzählung anfangen, als sie eine Thür von oben aufschließen, und Fußtritte nahen hörten. »Flieh!« rief die Marquise; »verbirg dich wo möglich; der Marquis kommt.«
Juliens Herz erbebte bey den Worten; sie besann sich nicht einen Augenblick, sondern zog sich durch die Thür zurück, durch die sie herein gekommen war. Kaum war sie hinaus, als eine andre Thür der Zelle sich aufthat, und sie die Stimme ihres Vaters hörte. Der Ton derselben durchbebte sie mit Entsetzen, und Furcht, entdeckt zu werden, wirkte so stark auf ihre Seele, daß sie in augenblicklicher Erwartung stand, den Marquis die Thür des Gangs aufschließen zu hören, und aller Macht beraubt war, in der Höhle Schutz zu suchen. — Endlich verlieh der Marquis, der Speise gebracht hatte, die Zelle, und schloß die Thür wieder zu, und Julie schlich sich aus ihrer Zuflucht hervor. Die Marquise umarmte sie aufs neue, und weinte über ihrer Tochter. Die Erzählung ihres Leidens, die sie nun anhob, klärte jetzt gänzlich das Geheimniß auf, welches so lange über dem südlichen Flügel des Schlosses geschwebt hatte. —
»O warum,« sagte die Marquise, »muß es mir auferlegt seyn, meiner Tochter die Laster ihres Vaters zu enthüllen! Indem ich meine Leiden erzähle, offenbare ich sein Verbrechen! So viel ich im Stande bin zu urtheilen, mögen es jetzt gegen funfzehn Jahre seyn, seit ich diese schreckliche Wohnung betrat. Mein Kummer, ach, fing nicht erst hier an; er schreibt sich von einem früheren Zeitpuncte her. Es mag genug seyn, zu bemerken, daß ich die Leidenschaft, von der alle mein Unglück sich herschreibt, lange zuvor entdeckte, ehe ich diese schreckliche Wirkung ihres Einflusses erfuhr. — Sieben Jahre waren seit meiner Vermählung verflossen, als die Reize der Donna Maria de Vellorno, eines jungen Frauenzimmers von außerordentlicher Schönheit, dem Marquis eine heftige Leidenschaft einflößten. Mit tiefem, schweigendem Kummer bemerkte ich meines Gemahls grausame Kälte gegen mich, und den schnellen Fortschritt seiner Leidenschaft für eine andere. Ich untersuchte strenge mein vergangnes Betragen, und dem Himmel sey Dank, es stellte mir nur einen Rückblick auf schuldlose Handlungen dar, und ich bemühte mich, durch sanfte Unterwerfung und zärtliche Aufmerksamkeiten die Zärtlichkeit zurück zu rufen, die, ach! auf immer dahin war. Er betrachtete meine sanfte Unterwerfung als Zeichen einer knechtischen, fühllosen Seele, und meine zärtliche Aufmerksamkeit; die sein Herz nicht mehr beantwortete, erregte nur Mißfallen, und entfernte den stolzen Geist, der aussöhnen sollte, nur noch mehr! Der geheime Kummer, den diese Veränderung in mir erzeugte, verzehrte meine Lebensgeister, und nagte an meiner Gesundheit, bis endlich eine schwere Krankheit meinem Leben drohte. Mit standhaftem Auge sah ich den Tod heran nahen, und bewillkommte ihn sogar als den Übergang zur Ruhe; allein ich war bestimmt, durch neue Scenen des Elends zu schmachten. — An einem Tage, welcher der Paroxismus meiner Krankheit zu seyn schien, sank ich in einen Zustand gänzlicher Betäubung, worin ich einige Stunden blieb. Es ist unmöglich, meine Gefühle zu beschreiben, als ich bey meinem Wiedererwachen mich in diesem schrecklichen Aufenthalte erblickte. Eine Zeit lang zweifelte ich an meinen Sinnen; dann glaubte ich, daß ich diese Welt mit einer andern vertauscht hatte. — Ich wurde nicht lange in meinem Irrthume gelassen; die Erscheinung des Marquis brachte mich zu einem vollen Gefühle meiner Lage. — Ich vernahm nun, daß ich auf seinen Befehl nach dieser Höhle des Schreckens gebracht war, wo er wollte, daß ich bleiben sollte. — Meine Bitten, mein Flehen war fruchtlos; sein hartes Herz warf meine Leiden auf mich selbst zurück; und da keine Bitten ihn bewegen konnten, mir zu sagen, wo ich wäre, aus was für Ursachen ich hierher gebracht sey, so blieb ich viele Jahre lang, ohne meine Nachbarschaft bey dem Schlosse, oder die Ursache meiner Einkerkerung zu wissen. — Von diesem unglücklichen Tage an bis ganz vor kurzem sah ich den Marquis nicht mehr, sondern wurde von einem Manne verpflegt, der seit verschiedenen Jahren von seiner Güte gelebt hatte, und den wahrscheinlich Noth, mit einem fühllosen Herzen vereinigt, diesen Dienst zu übernehmen bewog. Er brachte mir zu bestimmten Zeiten gewöhnlich auf eine Woche Lebensmittel, und ich bemerkte, daß seine Besuche immer in der Nacht geschahen. — Gegen meinen Wunsch oder Erwartung that die Natur für mich, was Arzeney nicht konnte, und ich genas, als sollte ich mit Verdruß und Angst meinen grausamen Tyrannen strafen. In der Folge erfuhr ich, daß Vincent, des Marquis Befehlen gehorsam, mich in der Nacht hierher gebracht hatte, und daß mein leerer Sarg mit allem meinem Range gebührenden Pompe in einer benachbarten Kirche beygesetzt war.« — Bey dem Nahmen Vincent starrte Julie auf. Die zweydeutigen Worte, die er auf seinem Todbette aussprach, waren nun aufgeklärt; die Wolke von Geheimniß, welche so lange über den südlichen Gebäuden schwebte, brach auf ein Mahl hinweg, und jeder einzelne Umstand, der ihre vergangenen Schrecken erzeugte, stand nun völlig aufgeklärt durch der Marquise Worte vor ihr da. Die lange, gänzliche Verödung dieses Flügels; das Licht, welches durch das zerbrochene Fenster schimmerte; die Gestalt, die sie aus dem Thurme hervor gehen sah; das mitternächtliche Geräusch, das sie hörte, waren Umstände, die augenscheinlich mit dem Gefängnisse der Marquise zusammen hingen; das Geräusch war entweder durch Vincent oder durch den Marquis entstanden, wenn sie in der Marquise Kerker gingen. — Wenn sie die langen, schrecklichen Leiden ihrer Mutter erwog, die so viele Jahre in ihrer Nähe lebte, ohne daß sie ihr Elend, ja ihr Daseyn sogar wußte, so verlor sie sich in Erstaunen und Mitleid. —
»Meine Tage,« fuhr die Marquise fort, »verstrichen in todter Einförmigkeit, die mir schrecklicher war, als die bittersten Abwechselungen des Unglücks, und die gewiß meine Vernunft zerstört haben würde, hätten nicht die festen Grundsätze frommen Glaubens, die ich in früher Kindheit einsah, mithin den Stand gesetzt, dem stillen aber gewaltsamen Drucke meines Elends zu widerstehen. — Vincents unempfindliches Herz wurde endlich durch mein Unglück erreicht. Er brachte mir verschiedene Bequemlichkeiten, woran es mir bisher gefehlt hatte, und beantworten einige Fragen nach meiner Familie. Mich aus meiner Lage zu befreyen, selbst wenn er geneigt dazu gewesen wäre, stand nicht in seiner Macht, da er diese vermeinte Verletzung seiner Pflicht gewiß mit dem Leben hätte abbüßen müssen. — Jetzt erst erfuhr ich, daß ich dem Schlosse so nahe war. Ich erfuhr ebenfalls, daß der Marquis Maria de Vellorno geheirathet hatte, mit der er zu Neapel wohnte, daß aber meine Töchter zu Mazzini zurück gelassen wären. Diese letzte Nachricht erweckte in meinem Herzen Regungen warmer, mütterlicher Zärtlichkeit, und auf meinen Knien flehte ich ihn, mich sie sehen zu lassen. Ich flehte so inständig, und versprach so feyerlich, ruhig wieder in mein Gefängniß zurück zu gehen, daß endlich Klugheit dem Mitleide wich, und Vincent meine Bitte bewilligte. — Am folgenden Tage kam er in meine Zelle, und sagte mir, meine Kinder wären ins Holz gegangen, und ich könnte sie durch ein Fenster sehen, bey dem sie vorbey kommen müßten. Meine Nerven bebten bey diesen Worten, und kaum konnte ich mich nach dem so sehnlich erwünschten Orte hinschleppen. So viel ich aus den häufigen Drehungen schließen konnte — denn meine Augen waren verbunden —führte er mich durch lange, verwickelte Gänge bis in einen Saal der südlichen Gebäude. Ich folgte ihm in ein oberes Zimmer, wo das volle Licht des Tages noch ein Mahl in mein Auge strahlte, und mich beynahe überwältigte. Vincent stellte mich in ein Fenster, das nach dem Holze zuging. O! was für Augenblicke peinlicher Ungeduld waren diese, worin ich eure Ankunft erwartete! Endlich erschienet ihr: ich sah euch — ich sah meine Kinder, und durfte sie nicht in meine Arme schließen, mit ihnen reden. Du lehntest dich auf den Arm deiner Schwester, und die Fröhlichkeit der Unschuld und Jugend strahlte aus euren Gesichtern. Ach! ihr kanntet das elende Schicksal eurer Mutter nicht, die jetzt euch anstarrte. Ob ihr gleich zu weit entfernt waret, als daß meine schwache Stimme euch erreichen konnte, enthielt ich mich doch nur schwer, das Fenster aufzureißen, und mich zu erkennen zu geben. Die Erinnerung an mein feyerliches Versprechen, und daß Vincents Leben das Opfer werden würde, hielt allein mich zurück. Ich kämpfte eine Zeit lang mit Bewegungen, die für meine Natur zu gewaltsam waren, und sank endlich zu Boden. Als ich wieder zu mir selbst kam, rief ich wild nach meinen Kindern, und rennte ans Fenster. Keine Bitten von Vincent konnten eine lange Zeit über mich von dieser Stelle bringen, wo ich in thörichter Hoffnung euch wieder zu sehen wartete — Ach! ihr erschienet nicht mehr! Endlich ging ich mit einem tobenden Jammer, an welchen nur zurück zu denken ich zittre, in meine Zelle. Dieses so begierig gesuchte, so widerstrebend gewahrte Sehen ward mir nur eine Quelle neuen Elends. Statt meine Seele zu beruhigen, zerriß es sie mit rastloser Verzweiflung, die meiner stärksten Kraft widerstand. Ich raste unaufhörlich von meinen Kindern, flehte unaufhörlich sie wieder zu sehen. — Allein Vincent hatte zu viel Ursache gefunden, seine erste Nachsicht zu bereuen, um mir eine zweyte zu gewähren. Ungefähr um diese Zeit ereignete sich ein Umstand, der mir eine baldige Erlösung von meinem Elende zu versprechen schien. Über eine Woche verstrich, und Vincent erschien nicht. Mein kleiner Vorrath von Lebensmitteln war verzehrt, und ich hatte zwey Tage ohne Nahrung zugebracht, als ich wiederum die Thüren meines Gefängnisses an ihren Angeln krachen hörte. Ein unbekannter Fußtritt nahte heran, und nach wenig Minuten trat der Marquis in meine Zelle. — Mein Blut erstarrte bey seinem Anblicke, und ich schloß meine Augen, wie ich hoffte, zum lezten Mahle. Der Ton seiner Stimme rief mich zurück. Sein Gesicht war finster und mürrisch, und es schien mir, als ob er zitterte. Er sagte mir, daß Vincent nicht mehr sey, und daß er in Zukunft seinen Dienst selbst übernehmen würde. Ich enthielt mich, ihm Vorwürfe zu machen, wo Vorwürfe nur neue Leiden würden erzeugt haben, und hielt mein Flehen zurück, wo es nur das Gewissen getroffen, Rache aufgereizt haben würde. Ich verbarg ihm, daß ich etwas von seiner zweyten Vermählung wußte. Er kam gewöhnlich, wenn die Nacht am besten seine Besuche verhehlen konnte; doch waren sie unregelmäßig. Seit kurzem, warum, kann ich nicht rathen, hat er seine nächtlichen Besuche eingestellt, und kommt nur am Tage.«
»Einst, als die Mitternacht die Dunkelheit meines Gefängnisses vermehrte, und die schauerlichen Schrecken der Stunde die Stille furchtbarer zu machen schienen, goß ich mein Elend in lauten Klagen aus. O! nie werde ich vergessen, was ich empfand, als ich eine ferne Stimme auf mein Winseln antworten hörte! Ein wildes Erstaunen, wunderbar mit Hoffnung vermischt, ergriff mich, und ich würde in der ersten Bewegung auf den Ruf geantwortet haben, wenn nicht eine Erinnerung mich durchdrungen hätte, die plötzlich jede halb aufsteigende Regung von Freude erstickte. Ich erinnerte mich, daß der Marquis schreckliche Rache an mir auszuüben geschworen hatte, wenn ich je durch irgend ein Mittel den Ort meines verborgenen Aufenthalts kund zu machen suchte; und obgleich das Leben mir längst zur Bürde gewesen war, wagte ich's doch nicht, mich einer gewissen Ermordung auszusetzen Auch wußte ich wohl, daß niemand, der auch meine Lage entdeckte, meine Befreyung bewerkstelligen könnte; ich hatte keine Verwandten, die mich durch Gewalt befreyen konnten, und der Marquis hat, wie du weißt, in seinem Gebiethe nicht nur Macht zu verhaften, sondern auch Recht über Leben und Tod. Ich enthielt mich also auf den Ruf zu antworten, ob ich gleich meine Klagen nicht ganz unterdrücken konnte. Lange verwirrte ich mich mit Nachsinnen, diesen seltsamen Umstand zu erklären, dessen Ursache ich noch bis diesen Augenblick nicht weiß.«
Da Julie sich erinnerte, daß Ferdinand in einem Kerker des Schlosses verhaftet gewesen war, so kam sie sogleich auf den Gedanken, daß sein und der Marquise Gefängniß vielleicht nicht weit von einander entfernt wären, und sie stand nicht an zu glauben, daß ihre Mutter Ferdinands Stimme gehört hatte. Sie vermuthete richtig; es war wirklich die Marquise, deren Winseln vormahls Ferdinand, so wohl in der marmornen Halle in den südlichen Gebäuden, als in seinem Kerker so sehr beunruhigt hatte. — Als Julie ihrer Mutter ihre Vermuthung mittheilte, und die Marquise die Stimme ihres Sohns gehört zu haben glaubte, gerieth sie in die äußerste Bewegung, und es verstrich einige Zeit, ehe sie ihre Erzählung wieder fortsetzen konnte. »Kurz darauf,« fuhr die Marquise fort, »brachte mir der Marquis auf vierzehn Tage zu essen, und sagte mir, daß ich ihn wahrscheinlich vor Verlauf dieser Zeit nicht wieder sehen würde. Du hast mir jetzt durch deine Erzählung der Begebenheiten in der St. Augustinerabtey die Ursache dieser Abwesenheit erklärt. Wie kann ich je die Verpflichtungen, welche ich meiner theuren, unscheinbaren Freundinn Menon schuldig bin, genug anerkennen? O! daß es mir vergönnt seyn möchte, ihr meine Dankbarkeit zu beweisen!«
Julie hörte mit schweigendem Erstaunen auf die Erzählung ihrer Mutter, und bezeugte ihr alle Theilnahme, welche der Kummer nur fordern kann. »Gewiß!« rief sie, hat die Vorsehung, auf die Sie so fest vertrauten, und deren Rathschlüsse Sie mit so edler Festigkeit erduldeten, mich durch ein Labyrinth von Unfällen nach diesem Orte geführt, um Sie zu befreyen. O! lassen Sie uns eilen, aus dieser schrecklichen Wohnung zu fliehen! Lassen Sie uns durch die Höhle, durch welche ich herein kam, zu entwischen suchen! — Sie hielt inne, und harrte in ängstlicher Erwartung auf eine Antwort.
»Wohin kann ich fliehen?« sagte tief seufzend die Marquise. — Diese Frage, mit dem Ausdrucke trostloser Verzweiflung gesprochen, rührte Julien bis zu Thränen, und sie saß lange schweigend da. —
»Der Marquis,« fuhr Julie fort, »würde nicht wissen, wo er Sie suchen sollte, und wenn er Sie außerhalb seinem Gebiethe fände, würde er's nicht wagen, Anspruch auf Sie zu machen. Ein Kloster kann Ihnen für jetzt eine sichre Zuflucht gewähren; und was Ihnen auch in der Folge zustößt, kann gewiß nicht schrecklicher seyn, als Ihr jetziges Geschick.« — Die Marquise gestand diese Wahrheit zu, doch setzten ihre von langem Kummer und Verhaftung gebeugten Lebensgeister sie außer Stand, einen schnellen Entschluß zu fassen, und eine gewisse kalte Verzweiflung in ihrem Blicke mahlte nur zu deutlich den Zustand ihrer Gefühle. Julie vermuthete gewiß, daß die Höhle, durch welche sie gegangen war, unter der Kette von Bergen hinliefe, denen gegen über das Schloß Mazzini stand; die ringsum aufsteigenden Hügel bildeten einen Schirm, der ihren Ausgang aus der Mündung der Höhle, und ihre Flucht vor allen im Schlosse gänzlich verbergen mußte. Sie stellte ihrer Mutter diese Umstände vor, und drang so nachdrücklich darauf, daß die Betäubung der Verzweiflung der Hoffnung Raum gab, und die Marquise sich der Führung ihrer Tochter anvertraute. »O lassen Sie mich Sie zu Licht und Leben führen!« rief Julie mit Feuer; »gewiß könnte der Himmel keinen größern Segen auf mich herab strömen, als mich zur Befreyerinn meiner Mutter zu machen!« — Sie knieten beyde nieder, und mit der rührenden Beredtsamkeit, welche wahre Frömmigkeit einhaucht, und mit dem Vertrauen,welches in so schwerem Elende sie unterstützt hatte, übergab die Marquise sich dem Schutze Gottes, und erflehte sein Beystand zu ihrem Unternehmen. — Sie standen auf; als sie aber weiter über ihren Plan zu Rathe gingen, erinnerte sich Julie, daß sie ganz von Gelde entblößt war, weil die Banditen ihr alles geraubt hatten. Der plötzliche Schreck, den diese Erinnerung erzeugte, überwältigte beynahe ihre Lebensgeister; nie bis diesen Augenblick, hatte sie den Werth des Geldes gekannt. Doch überwand sie ihre Gefühle, und beschloß, der Marquise diesen Umstand zu verhehlen, indem sie die Gefahr eines jeden Übels, das von außen ihr zustoßen könnte, dem gewissen Elende dieses schrecklichen Kerkers vorzog. — Sie packten die Lebensmittel, die der Marquis ihnen gebracht hatte, ein, verließen die Zelle, und betraten den dunklen Gang, in welchem sie mit vorsichtigen Schritten fortgingen. Julie ging voraus nach der Thür der Höhle; aber wer kann ihr Elend mahlen, als sie sie verschlossen fand! Alle ihre Versuche, sie aufzureißen, waren vergebens. Die Thür, welche hinter ihr zugesprungen war, wurde durch ein Federschloß gehalten, und konnte von dieser Seite nur durch einen Schlüssel geöffnet werden. Als die Marquise diesen Umstand vernahm, wendete sie mit einer ruhigen Ergebung, welche sie über die Menschheit empor zu heben schien, sich zum Himmel, und ging in ihre Zelle zurück. Hier hing Julie ohne Zurückhaltung und ohne Bedenken dem Übermaße ihres Schmerzens nach. Die Marquise weinte für sie. »Nicht um meinetwillen,« sagte sie, »härme ich mich; ich bin zu lange gegen Unglück abgehärtet, um unter seinem Drucke zu erliegen. Diese Vereitlung ist genau erwogen, vielleicht klein; ich hatte keine sichre Zuflucht vor der Widerwärtigkeit; und hätte ich sie auch gefunden, so würden nur wenige Jahre des Leidens mir erspart seyn. Für dich, meine Julie, die du so bitterlich mein Schicksal beklagst, die du, der Gewalt deines Vaters ausgeliefert, ein Schlachtopfer des Herzogs werden wirst, für dich schwillt mein Herz.« Julie konnte keine andere Antwort geben, als daß sie die Hand, die ihr dargereicht ward, an ihre Lippen drückte. Sie fühlte alles Elend ihrer Lage, und ihre ängstliche Ungewißheit um Hippolytus und Ferdinanden machte keinen geringen Theil ihres Kummers aus. — »Wenn du,« fuhr die Marquise fort, »ein Gefängniß mit deiner Mutter einer Verbindung mit dem Herzoge vorziehst, so kannst du dich immer in dem Gange, den wir eben verlassen haben, verbergen, und den Vorrath, der mir gebracht wird, theilen.«
»O! reden Sie nicht, meine Mutter, von einer Verbindung mit dem Herzoge! gewiß ist jedes Schicksal dem vorzuziehen. Allein wenn ich erwäge, daß ich durch mein Hierbleiben nur zu den Leiden verdammt bin, welche meine Mutter so lange erduldete, und daß diese Verhaftung mich in den Stand setzen wird, die Bitterkeit ihres Leidens durch zärtliche Theilnahme zu lindern; so würde ich mit Freuden meiner gegenwärtigen Lage mich unterwerfen, wenn auch eine Verbindung mit dem Herzoge mir weniger gehässig schiene.«
»Theures Mädchen!« rief die Marquise aus, und drückte Julien an ihren Busen; »die Leiden, welche du beklagst, sind durch diesen Beweis deiner Güte und Liebe beynahe vergolten! — Ach! warum mußte ich einer solchen Tochter so lange beraubt seyn?«
Julie bestrebte sich nunmehr, die Stärke ihrer Mutter nachzuahmen, und verbarg zärtlich ihre Angst um Ferdinanden und Hippolytus, deren Idee stets um ihre Einbildungskraft schwebte. Wenn der Marquis Speise in die Zelle brachte, zog sie sich immer in den Gang, der nach der Höhle führte, zurück, und entging seiner Bemerkung.
Indessen war der Marquis, dessen unermüdetes Suchen nach Julien vergebens blieb, abwechselnd der Sclave verschiedener Leidenschaften, und ließ seine üble Laune an seinen unglücklichen Bedienten aus. — Die Marquise, die wir jetzt schicklicher Maria de Vellorno nennen können, entflammte mit schlauer Boßheit seine bereits gereizten Leidenschaften, und erhöhte mit grausamem Triumphe seinen Zorn gegen Julien und Madame de Menon. Sie stellte ihm vor, was seine eigene Gefühle zu bitter eingestanden, daß durch den halsstarrigen Eigensinn der erstern und durch die geheimen Winke der andern ein Priester in den Stand gesetzt sey, seine Autorität als Vater zu hemmen, die geheiligte Ehre seines Adels zu schmähen, und mit einem Streiche seine stolzesten Plane der Macht und des Ehrgeizes zu Boden zu werfen. Sie erklärte ihre Vermuthung, daß der Abt Juliens gegenwärtigen Aufenthalt gewiß vollkommen gut wüßte, und zog den Marquis über seinen Mangel an Muth auf, daß er sich so geduldig von einem Priester überlisten ließe, und nicht an den Papst appellirte, dessen Autorität den Abt zwingen würde, Julien heraus zu geben. — Dieser Vorwurf traf den Marquis an die Seele; er fühlte die ganze Starke desselben, und war sich zugleich bewußt, daß er nicht im Stande war, ihn aus dem Wege zu räumen. Die Wirkung seiner Verbrechen fiel jetzt schwer auf sein eigenes Haupt. Das angedrohte Geheimniß, welches kein anderes, als das Gefängniß der Marquise, war, hielt seinen Arm der Rache zurück, und zwang ihn, sich Spott und Kränkungen zu unterwerfen. Allein Mariens Vorwurf traf tief in sein Herz; er erhitzte seinen Stolz zu verdoppelter Wuth, und mit Verachtung stieß er jetzt den Gedanken, sich zu unterwerfen, zurück. — Er dachte über die Mittel nach, die seinen Zweck bewirken können — er sah nur eins: den Tod der Marquise. — Die Begehung eines Verbrechens erfordert oft die Vollstreckung eines andern. Wenn wir einmahl in das Labyrinth des Lasters eingehen, können wir selten den Rückweg finden, sondern werden durch angrenzende Irrgänge zum Verderben geführt. Um die Wirkung seines ersten Verbrechens zu vermeiden, mußte er jetzt ein zweytes begehen, und das Gefängniß der Marquise durch ihre Ermordung verhehlen. Da er selbst der einzige lebende Zeuge ihres Daseyns war, so konnte, wenn sie aus dem Wege geräumt wurde, der Abt seine Beschuldigungen mit keinem Beweise unterstützen, und er konnte sich dann dreist um die Wiederherausgabe seines Kindes an den Papst wenden. Er brütete über diesem Plane, und je mehr er seine Seele gewöhnte, ihn zu betrachten, je weniger bedenklich ward er. Das Verbrechen, vor welchem er vormahls zurück gebebt haben würde, betrachtete er jetzt mit standhaftem Auge. Die Wuth seiner Leidenschaften, die an keinen Widerstand gewöhnt waren, mit der Gewalt dessen zusammen genommen, was der Ehrgeiz Nothwendigkeit nannte, trieb ihn zu der That, und die Ermordung seines Weibes wurde beschlossen. Die Mittel, seinen Zweck auszuführen, waren leicht und mancherley; da er aber noch nicht so ganz verhärtet war, sich fähig zu fühlen, ihre Todesangst anzusehen, und seine eigenen Hände in ihr Blut zu tauchen, so beschloß er, sie durch Gift, das er unter ihre Speise mischen wollte, aus dem Wege zu schaffen. Ein neuer Kummer aber, der ihn angriff, wo er am verletzbarsten war, bereitete sich für den Marquis; der Schleyer, welcher so lange seine Vernunft umnebelt hatte, sollte jetzt weggezogen werden. Sein treuer Baptista benachrichtigte ihn von der Untreue der Maria de Vellorno. In der ersten Bewegung der Leidenschaft jagte er den Angeber aus seiner Gegenwart, und verachtete es, die Nachricht zu glauben. Eine kurze Überlegung veränderte den Gegenstand seines Zorns; er rief den Bedienten zurück, in dessen Treue er kein Mißtrauen zu setzen Ursache hatte, und ließ sich herab, ihn über den Gegenstand seines Unglücks näher zu befragen. Er erfuhr, daß seit einiger Zeit Maria mit dem Chevalier von Vincini einen vertrauten Umgang gepflogen hätte, und daß die Zusammenkunft gewöhnlich des Abends in einem Pavillon am Seeufer gehalten würde. Baptista erklärte weiter, wenn der Marquis eine Bekräftigung seiner Worte verlangte, so könnte er sie sich verschaffen, wenn er um die bestimmte Stunde an diesem Orte aufpaßte. Diese Nachricht zündete die wildesten Leidenschaften seiner Natur an; seine vorigen Leiden schwanden hinweg vor der stärkern Gewalt seines gegenwärtigen Elendes, und es schien, als wenn er nie bis jetzt Kummer empfunden hätte. Das Weib beargwohnen zu müssen, an dem er mit romanhafter Zärtlichkeit hing, in dem er alle seine festesten Hoffnungen auf Glück concentrirt, um derentwillen er das Verbrechen begangen hatte, welches selbst seine gegenwärtigen Augenblicke verbitterte, und ihn in noch tiefere Schuld stürzen mußte, sie undankbar gegen seine Liebe, als eine Verrätherinn an seiner Ehre zu finden, erzeugte ein schrecklicheres Elend, als seine Einbildungskraft noch gekannt hatte. Kämpfende Leidenschaften, widersprechende Entschlüsse zerrissen ihn; jetzt beschloß er ihre Schuld in ihrem Blute zu tilgen; jetzt schmolz er wieder in alle sanften Empfindungen der Liebe. Rache und Ehre hießen ihm das Herz durchstechen, das ihn verrieth, und trieben ihn augenblicklich, die That zu vollbringen; dann aber schlich das Bild ihrer Schönheit, ihr bezauberndes Lächeln, ihre süßen Schmeicheleyen sich wieder in seine Einbildungskraft, und überwältigten sein Herz; er weinte beynahe bey dem Gedanken, sie zu kränken, und sprach, trotz alles Anscheins, sie für unschuldig aus. Der folgende Augenblick stürzte ihn wieder in Ungewißheit; seine Qualen erlangten durch kurzen Aufschub neue Stärke, und wieder fühlte er allen Wahnsinn der Verzweiflung. Jetzt beschloß er, seine Zweifel zu endigen, und nach dem Pavillon zu gehen; bald aber wankte sein Herz wieder in Unentschlossenheit, wie er verfahren sollte, wenn seine Furcht sich bestätigte. Indessen beschloß er, Mariens Betragen mit strenger Aufmerksamkeit zu bewachen. — Sie kamen bey Tische zusammen, und er beobachtete sie scharf, konnte aber nicht die geringste Unschicklichkeit in ihrem Betragen bemerken. Ihr Lächeln und ihre Schönheit schlangen aufs neue Zauberfesseln um sein Herz, und im Übermaße ihres Einflusses war er beynahe geneigt, das Unrecht, welches sein Verdacht ihr zugefügt hatte, zu ihren Füßen zu bekennen und abzubitten. Die Erscheinung des Chevaliers erneuerte seinen Verdacht; sein Herz schlug wild, und mit rastloser Ungeduld erwartete er die Zurückkunft des Abends, der seine qualvollen Zweifel lösen sollte. — Endlich kam der Abend. Er schlich nach dem Pavillon, und verbarg sich zwischen den Bäumen, die ihn einschlossen. Noch nicht lange war er da gewesen, als er ein leises Flüstern sich zwischen den Bäumen herauf stehlen, und Fußtritte die Allee herab rauschen hörte. Halb versteinert von schreckhaften Empfindungen stand er da, und gleich darauf hörte er Leute in den Pavillon kommen. Er ging jetzt aus seinem Schlupfwinkel hervor; ein schwaches Licht dämmerte aus dem Gebäude. Er schlich sich ans Fenster, und sah von innen Maria und den Chevalier Vincini. Entflammt bey dem Anblicke zog er seinen Degen, und sprang vorwärts. Der Schall seiner Schritte beunruhigte den Chevalier; er sah den Marquis, sprang neben ihm hin aus dem Pavillon, und verschwand im Gehölze. Der Marquis setzte ihm nach, konnte ihn aber nicht einhohlen, und mit dem Vorsatze, sein Schwert in Mariens Brust zu tauchen, ging er wieder in den Pavillon zurück. Er sah sie fühllos auf der Erde liegen. Rache machte jetzt dem Mitleide Platz; sie ängstlich anstaunend stand er da, und steckte sein Schwert in die Scheide. — Sie erwachte; als sie aber den Marquis erblickte, that sie einen Schrey, und sank wieder, in Ohnmacht zurück. Er eilte aufs Schloß um Beystand zu hohlen, erfand, um seine Schande zu verhehlen, einen Vorwand für ihre plötzliche Unpäßlichkeit, und ließ sie in ihr Zimmer bringen. —Jetzt durfte er nicht länger an ihrer Untreue zweifeln; doch konnte ihre Treulosigkelt die Leidenschaft, welche ihr Betragen schmähte, nicht tilgen. Er hing noch immer mit unsinniger Zärtlichkeit an ihr, und beklagte sogar, daß Ungewißheit ihn nicht länger mit Hoffnung schmeicheln konnte. Es schien, als ob seine Sehnsucht nach ihrer Liebe mit der Gewißheit, sie verloren zu haben, wuchs, und gerade das, was seinen Haß hätte erregen sollen, schien durch seltsame Verkehrtheit seines Charakters seine Leidenschaft zu erhöhen, und machte ihm den Gedanken unmöglich, ohne sie leben zu können. So bald das erste Toben seiner Wuth sich gelegt hatte, beschloß er, ihr Vorwürfe zu machen, sie zu strafen, und dann wieder sie in seine Liebe aufzunehmen. Mit diesem Vorsatze ging er in ihr Zimmer, und warf ihr in Ausdrücken gerechten Unwillens ihre Falschheit vor. Maria des Vellorno, bey der die letzte Entdeckung, statt Buße zu erwecken, nur Zorn gereizt, statt Scham zu erzeugen, nur Zorn entflammt hatte, hörte die Schmähungen des Marquis mit Ungeduld an, und beantwortete sie mit bittrer Heftigkeit. Sie behauptete kühn ihre Unschuld, und erfand sogleich eine Geschichte, deren Glaubhaftigkeit einen Mann getäuscht haben könnte, der ein weniger zuverlässiges Zeugniß, als das seiner Sinne, gehabt hätte. Sie betrug sich mit äußerster Frechheit, bis sie endlich, da sie sah, daß der Marquis sich nicht länger irre führen ließ, und daß ihre Heftigkeit des gewünschten Zwecks verfehlte, zu Thränen und Flehen ihre Zuflucht nahm. Allein der Kunstgriff war zu merklich, um zu gelingen, und der Marquis verließ in wüthendem Zorne ihr Zimmer. Seine vorige Bezauberung kehrte bald zurück, und hielt ihn aufs neue schwankend zwischen Liebe und Rache. Damit es indessen der Heftigkeit seines Zorns nicht an einem Gegenstande fehlen möchte, befahl er Baptista, den Aufenthalt des Chevaliers auszuspüren, an dem er seine verlorne Ehre zu rächen dachte. Scham verboth ihm, sich anderer von seinen Leuten zu bedienen.
Diese Entdeckung hielt auf eine Weile die Vollstreckung des unglücklichen Plans auf, der zuvor des Marquis Gedanken beschäftigte; allein nur aufgeschoben, aber nicht vernichtet war er. Der letzte Vorfall hatte seine häusliche Glückseligkeit vernichtet; sein Stolz stieg jetzt hervor, ihn von der Verzweiflung zu erlösen, und er beschränkte alle seine künftigen Hoffnungen im Ehrgeize. In einem Augenblicke kalter Überlegung erwog er, daß er weder Glück noch Zufriedenheit aus dem Nachtrachten zerstreuter Vergnügungen, denen er bisher alle andern Rücksichten aufopferte, geschöpft hatte. Er beschloß also, die bunten Pläne zu Vergnügungen, die ihn bisher anlockten, fahren zu lassen, und sich ganz dem Ehrgeize hinzugeben, in dessen Verfolgung er alle seine Sorgen zu begraben hoffte. Juliens Vermählung mit dem Herzoge lag ihm nun eifriger, als je, am Herzen; denn durch dieses Schwiegersohns Macht hoffte er Einfluß in die Staatsangelegenheiten zu bekommen, und beschloß also, Julien wieder herbey zu schaffen, was es auch kosten möchte. Er wollte ohne weitern Verzug an den Papst appelliren; um aber dieses mit Sicherheit thun zu können, mußte die Marquise sterben; und er kehrte nun wieder zur Erwägung und Ausführung seines teufelischen Vorsatzes zurück. Er mischte einen Gifttrank unter die Speisen, die er ihr bestimmt hatte, und als die Nacht anbrach, trug er ihn nach der Zelle. Seine Hand zitterte, als er die Thür aufschloß; und als er der Marquise die Speisen hinreichte, und sie, die mit demüthigem Danke sie annahm, mit dem Bewußtsein, daß es das letzte Mahl war, anblickte, bereute es sein Herz beynahe. Sein Gesicht, über welches die Blässe des Todes sich ausgoß, drückte die geheimen Regungen seiner Seele aus, und er haftete Blicke starren Entsetzens auf sie. Erschreckt durch seine Blicke fiel sie auf ihre Knie, und flehte um Erbarmen. Ihre Stellung rief seine verwirrten Sinne wieder zurück; er bestrebte sich, eine ruhigere Miene anzunehmen, hieß sie aufstehen, und verließ sogleich die Zelle, weil er die Unstätigkeit seines Entschlusses fürchtete. Seine Seele war noch nicht verhärtet genug, die Pfeile des Gewissens zurück zu treiben, und seine Einbildungskraft unterstützte ihre Macht. So wie er durch die einsamen Gänge hinschlich, schienen schauerliche, heimliche Töne aus jedem Rauschen des Windes zu sprechen, der durch die Krümmungen pfiff, und oft starrte er, und sah zurück. — Er erreichte sein Zimmer, verschloß die Thüre, und sah mit ängstlichem Forschen rings umher. Luftgestalten schwirrten vor seiner Fantasie, und zum ersten Mahle in seinem Leben fürchtete er sich allein zu seyn. Nur Scham konnte ihn abhalten, Baptista zu rufen. Die Dunkelheit der Stunde, und das todtengleiche Schweigen ringsum unterstützten die Schrecken seiner Einbildungskraft. Halb bereute er die That, und doch hielt er es jetzt für zu spät, sie zurück zu nehmen. In schrecklicher Erschütterung warf er sich auf sein Bett — sein Kopf schwindelte — eine plötzliche Schwäche übernahm ihn — er zögerte noch — endlich richtete er sich auf, um nach Hülfe zu klingeln, fand sich aber außer Stande, sich aufrecht zu halten. — Nach wenig Augenblicken war er wieder etwas zu sich selbst gekommen, und zog die Glocke; ehe aber jemand kam, befielen ihn wieder so heftige Schmerzen; daß er nach seinem Bette schwankte, und sinnlos darauf hinsank. Hier fand ihn Baptista, der zuerst herein kam, mit dem Tode ringend. Das ganze Schloß wurde sogleich aufgeschreckt, und allgemeine Bestürzung verbreitete sich. Emilie lief durch das Gedränge hin zu ihrem Vater; aber sein schrecklicher Anblick überwältigte sie, und man mußte sie aus dem Zimmer tragen. Durch Hülfe gehöriger Mittel erhielt der Marquis seine Sinne wieder, und seine Schmerzen legten sich auf kurze Zeit. »Ich sterbe!« sagte er stammelnd; »ruft die Marquise und meinen Sohn!«
Ferdinand, der den Banditen entwischte, war aufs neues seinem Vater in die Hände gefallen, der ihn in einem Zimmer des Schlosses verhaften ließ, aus welchem er jetzt befreyet wurde, um dem Rufe des Marquis zu gehorchen. Des Marquis Gesicht war geisterbleich — Ferdinand starrte von seinem Bette zurück, von Entsetzen überwältigt. Der Marquis winkte den Umstehendem das Zimmer zu verlassen, und sie waren im Begriffe, fortzugehen, als die Thür aufgerissen wurde, und der Bediente, der nach der Marquise geschickt war, herein stürzte. Nur sein Blick sprach das Schrecken seiner Seele aus; Worte konnte er nicht hervor bringen. Er starrte wild, und zeigte auf den Gang, aus dem er gekommen war. Ferdinand, von neuem Schauder ergriffen, stürzte den Weg, den er zeigte, hin zu der Marquise Zimmer. Ein grausiger Anblick wartete hier auf ihn! — Maria lag leblos in ihrem Blute gebadet, auf einem Ruhebette. Ein Dolch, das Werkzeug ihrer Zerstörung, lag auf der Erde, und ein Brief neben ihr verkündigte, daß sie von eigner Hand starb. Das Papier enthielt folgende Worte:
An den Marquis von Mazzini.
»Ihre Worte haben mein Herz durchbohrt. Keine Macht auf Erden kann den Frieden wieder geben, den Sie zerstört haben. Ich will mich von meiner Qual befreyen; wenn Sie dieses lesen, werde ich nicht mehr seyn. Aber Sie sollen nicht länger triumphiren — der Trank, den Sie nahmen, war von der Hand der beleidigten
Marie von Mazzini.«
Es zeigte sich also, daß der Marquis durch die Rache des Weibes vergiftet war, für das er sein Gewissen Preis gegeben hatte. Ferdinands Bestürzung und Schrecken können keine Worte beschreiben. Er eilte in seines Vaters Zimmer zurück, entschlossen, ihm Maria de Vellorno's schreckliches Ende zu verhehlen; allein seine Vorsicht war unnütz. — Die Bedienten hatten in der Verwirrung des Schreckens es bereits entdeckt, und der Marquis lag ohnmächtig da. Wiederkehrende Schmerzen riefen seine Sinne zurück, und die Todesangst, welche er litt, war zu schrecklich für die Umstehenden. Man wendete alle Hülfsmittel an; aber das Gift war zu stark. Endlich ließen seine Schmerzen nach; das Gift hatte das Meiste von seiner Wuth erschöpft, und er wurde leidlich ruhig. Er winkte den Umstehenden nochmahls, das Zimmer zu verlassen, und ließ Ferdinanden, dessen Sinne durch diese gehäuften Schrecken fast betäubt waren, neben sich sitzen. — »Die Hand des Todes liegt jetzt auf mir!« sagte er; »ich wünschte diese letzten Augenblicke zur Enthüllung einer That anzuwenden, die gräßlicher als alle körperlichen Schmerzen, mich foltert. Es wird mir einige Erleichterung gewähren, sie zu entdecken.« — Ferdinand ergriff in sprachlosem Schrecken des Marquis Hand. — »Die Vergeltung des Himmels ist über mich gekommen,« fuhr er fort; »meine Strafe ist die unmittelbare Folge meiner Schuld. Der Himmel hat das Weib, für das ich meine Verbrechen beging, zum Werkzeuge seiner Gerechtigkeit gemacht — das Weib, für das ich Gewissen und Ehre vergaß, dem Laster trotzte — für das ich eine unschuldige Gemahlinn einkerkerte, und dann es mordete.« — Bey diesen Worten erbebten alle Nerven Ferdinands; er ließ des Marquis Hand fahren, und schauderte zurück. — »Siehe mich nicht so feurig an!« sagte der Marquis mit dumpfer Stimme; »deine Augen strahlen Tod in meine Seele; mein Gewissen bedarf dieser neuen Furien nicht!« —
»Meine Mutter?« rief Ferdinand; »O! meine Mutter? reden Sie! sagen Sie!«
»Ich habe keinen Athem mehr!« — stammelte der Marquis; »o! nimm diese Schlüssel! — der südliche Thurm — die Fallthür — es ist möglich — o Jesus!« — Der Marquis that einen plötzlichen Sprung in die Höhe, und mit gräßlicher Verzerrung fiel er leblos aufs Bett. Die Bedienten wurden herein gerufen — er war auf immer dahin! —Seine letzten Worte strahlten mit der Flamme des Blitzes in Ferdinands Seele — sie schienen zu sagen, daß seine Mutter noch leben könnte. Er nahm die Schlüssel, befahl einigen Bedienten, ihm zu folgen, und eilte nach den südlichen Gebäuden; er drang bis zu dem Thurme, und hob die Fallthür unter der Treppe in die Höhe. Sie alle stiegen in einen dunklen Gang hinab, der sie durch verschiedene Kreuzgänge nach der Thür der Zelle führte. Ferdinand in zitternder, schrecklicher Erwartung versuchte den Schlüssel — die Thür ging auf, und er trat hinein — aber wie erstaunte er, als er niemand in der Zelle fand! — Er glaubte, daß er an den unrechten Ort gekommen sey, und verließ ihn, um weiter zu suchen; nachdem er aber den ganzen Weg wieder zurück gegangen war, ohne eine andere Thür zu entdecken, ging er wieder in die Zelle, um sie genauer zu untersuchen. Er bemerkte jetzt die Thür, die nach der Höhle führte, und betrat den Gang; allein niemand war zu finden; keine Stimme antwortete seinem Rufe. Er ging bis zu der Thür der Höhle, die er verriegelt fand, und kehrte in Schmerz verloren, und über die letzten Worte des Marquis nachsinnend, wieder um. Er glaubte nun, daß er den Sinn derselben mißverstanden hätte, und daß die Worte: Es ist möglich — nicht auf das Leben der Marquise gehen sollten. Er schloß, der Mord sey schon lange begangen worden, und nahm sich vor, den Grund der Zelle aufgraben, und die Gebeine seiner Mutter aufsuchen zu lassen. — Als die erste Erschütterung, welche diese letzten Auftritte hervor brachten, vorüber war, erkundigte er sich näher nach den Umständen von Maria de Vellorno's Tode. — Er erfuhr, daß am Tage dieser schrecklichen That der Marquis einige Stunden in ihrem Zimmer zugebracht hatte; man hörte einen lauten Wortwechsel; der Marquis gerieth in heftige Wuth; er warf ihr ihr vergangenes Betragen vor, und drohte, sich von ihr scheiden zu lassen. Nachdem er sie verlassen hatte, hörte man sie laut schluchzend in schnellen Schritten im Zimmer auf und ab gehen; oft stand sie plötzlich stille, und stieß laute, aber unzusammenhängende Ausrufungen aus — endlich warf sie sich auf die Erde, und blieb eine Zeit lang stille. Hier fand ihre Kammerfrau sie, bey deren Eintritte sie eilends aufsprang, und ihr verwies, daß sie ungerufen erschiene. Nach dieser Zeit blieb sie stille und mürrisch. Sie kam zu Tische herunter, wo der Marquis allein mit ihr aß. Während der Mahlzeit wurde wenig gesprochen, und so bald abgegessen war, schickte sie die Bedienten fort. Man glaubte, daß sie während der Zwischenzeit zwischen dem Abendessen und Schlafengehen Gift unter des Marquis Wein gemischt hätte. Wie sie sich dieses Gift verschaffte, hat man nie heraus bringen können. — Sie zog sich früh in ihr Zimmer zurück, und da ihre Kammerfrau bemerkte, daß sie sehr unruhig schien, fragte sie, ob sie sich nicht wohl befände. Sie antwortete ganz kurz, und schickte bald ihre Kammerfrau fort. Kaum aber hatte sie die Thür zugemacht, als sie sich zurück rufen hörte. Sie kehrte um, erhielt einen unbedeutenden Befehl, und bemerkte, daß Maria ungewöhnlich blaß aussah; auch war etwas Wildes in ihren Augen, das sie erschreckte; doch wagte sie nicht, eine Frage zu thun. Sie ging wieder aus dem Zimmer, und hatte eben das Ende des Ganges erreicht, als ihre Frau klingelte. Sie eilte zurück; Maria fragte, ob der Marquis zu Bett, und alles ruhig sey. — — Nachdem die Kammerfrau dieses bejaht hatte, antwortete sie: »Dieß ist eine stille und dunkle Stunde! — Gute Nacht!« — Die Kammerfrau ging noch ein Mahl aus dem Zimmer, und stand lange vor der Thür stille, und horchte. Da aber alles stille blieb, legte sie sich zur Ruhe. — Wahrscheinlich beging Maria die unglückliche That bald, nachdem sie ihr Mädchen fortgeschickt hatte; denn als man sie zwey Stunden nachher fand, schien sie schon einige Zeit todt gewesen zu sehn. Bey Untersuchung fand man eine Wunde in ihrer linken Seite, die, nach ihrem plötzlichen Tode und dem starken Blutverluste zu urtheilen, gerade ins Herz gedrungen seyn mußte. Diese schrecklichen Begebenheiten erschütterten Emilien so tief, daß eine gefährliche Krankheit sie aufs Bett warf. Ferdinand kämpfte mit männlicher Stärke gegen den Stoß. Allein unter aller Unruhe dieser Auftritte machte vielleicht seine Angst um Julien, die er in den Händen der Banditen zurück ließ, und sie aufzusuchen oder zu erretten bisher verhindert ward, den quälendsten Theil seines Kummers. — — Der verstorbene Marquis von Mazzini und Maria de Vellorno wurden mit der ihrem Range schuldigen Pracht in der Kirche des St. Nicolausklosters beygesetzt. Ihr Leben zeigte eine ungezähmte Befriedigung heftiger, wollüstiger Leidenschaften, und ihr Tod bezeichnete die Folgen derselben, und stellte dem Menschengeschlechte einen wunderbaren Beweis göttlicher Rache dar.
Als man den Grund der Zelle aufgrub, zeigte sichs, daß sie mit dem Kerker zusammen hing, worin Ferdinand gesessen, und wo er das Winseln, welches ihm solches Entsetzen verursachte, gehört hatte. Es war augenscheinlich, daß der Marquis die Geschichte, die er jenes Mahl seinem Sohne von den südlichen Gebäuden erzählte, nur geschmiedet hatte, um das Gefängniß der Marquise zu verhehlen. Unstreitig zeigte er viel Kunst in der Wahl dieses Gegenstandes; denn die erzählten Umstände waren ganz geschaffen, Schrecken einzuprägen, und weiteres Forschen nach den Behältnissen dieser Gebäude abzuhalten. Auch wurde dadurch, vermöge übernatürlicher Beweise, die Ursache der Töne und die nächtliche Erscheinung erklärt, welche in der That keine andere, als der Marquis selbst, war.
Der Ausgang der Untersuchung der Zelle stürzte Ferdinanden in neue Verwirrung. Der Marquis hatte bekannt, daß er seine Gemahlinn vergiftet hätte — doch waren ihre Gebeine nirgends zu finden, und der Ort, den er als ihren Verhaftungsplatz angab, zeigte keine Spur von ihr. Man sah keinen Weg, durch den sie aus dem Gefängnisse hätte entwischen können; so wohl die Thür, die in die Zelle ging, als die, welche den Ausgang hinter derselben verschloß, waren verschlossen, als Ferdinand sie untersuchte. — Allein der junge Marquis hatte jetzt keine Zeit zu fruchtlosen Speculationen — ernsthafte Pflichten riefen ihn auf. Er glaubte, daß Julie noch immer in den Händen der Banditen sey, und so bald seines Vaters Leichenbegängniß vorüber war, machte er sich auf den Weg nach Palermo, um von dem Aufenthalte der Räuber Nachricht zu geben, und mit den Gerichtsdienern, von einem Theile seiner eignen Leute begleitet, zur Befreyung seiner Schwester zu eilen. Bey seiner Ankunft zu Palermo erfuhr er, daß eine Bande, die sich in den Ruinen eines Klosters im Walde Marentino aufgehalten hätte, bereits entdeckt sey; daß man ihre Wohnung durchsucht, und sie eingezogen hätte, um ein Beyspiel öffentlicher Gerechtigkeit an ihnen zu zeigen, daß aber kein gefangenes Frauenzimmer unter ihnen gefunden sey. Diese letzte Nachricht bekümmerte Ferdinanden sehr ernstlich, und er wußte nicht, was er von ihrem Schicksale denken sollte. Er erhielt indessen Erlaubniß, diejenigen von den Räubern, die zu Palermo verhaftet, waren, zu befragen, konnte aber keine befriedigende oder gewisse Nachricht von ihnen einziehen. — Endlich verließ er Palermo, und machte sich selbst nach dem Walde Marentino auf, weil er es für möglich hielt, in der Nachbarschaft desselben etwas von Julien zu hören. Traurig und niedergeschlagen ritt er vor sich hin, und der Abend hatte ihn längst überfallen, ehe er den Ort seiner Bestimmung erreichte. Die Nacht kam schwer in Wolken gehüllt, und ein heftiger Sturm von Wind und Regen machte sich auf. Der Weg ging durch ein wildes, felsiges Land, und Ferdinand konnte keine Zuflucht erhalten. Seine Bedienten bothen ihm ihre Mäntel an; allein er mochte keinen von seinen Leuten dem Ungemache Preis geben, dem er selbst sich nicht unterziehen wollte. Er reiste einige Stunden in schwerem Regen fort, und der Wind, der furchtbar zwischen den Felsen pfiff, und dessen feyerliche Pausen durch das ferne Gebrüll der See ausgefüllt wurden, erhöhte das Schreckliche der Scene. Endlich sah er zwischen der Dunkelheit von weitem eine rothe Flamme in den Wind wehen; sie drehte sich mit dem Blasen desselben, verschwand aber nie ganz. Er setzte sein Pferd in Galopp, und sprengte darauf zu. Die Flamme fuhr fort, seinen Lauf zu leiten; und so wie er näher kam, sah er durch ihren rothen Wiederstrahl, der einen langen Schimmer auf das Wasser unten warf, ein Lichthaus, das auf einer Felsenspitze stand, die über die See hing. Er klopfte eingelassen zu werden, und ein alter Mann öffnete ihm die Thür, und hieß ihn willkommen. Innerhalb zeigte sich ein freundliches, flackerndes Feuer, um welches rings im Kreise einige Leute saßen, die, wie er, vor dem Sturme Zuflucht gesucht zu haben schienen. Der Anblick des Feuers erfreute ihn; er ging darauf zu, als ein plötzliches Geschrey ihn erschreckte — die Gesellschaft stand in Verwirrung auf, und in eben dem Augenblicke entdeckte er Julien und Hippolytus. Die Freude dieses Augenblicks ist nicht zu beschreiben; allein seine Aufmerksamkeit wurde schnell von ihm selbst auf eine Frau gezogen, die unter dem allgemeinen Entzücken in Ohnmacht fiel. Was empfand er, als er hörte, daß es seine Mutter war! Sie lebte wieder auf. »Mein Sohn!« rief sie mit schwacher Stimme, indem sie ihn an ihr Herz drückte. — »Großer Gott! ich bin belohnt. Gewiß kann dieser Augenblick ein Leben voll Elend vergüten!« Er konnte nur schweigend ihre Liebkosungen erwiedern; die plötzlichen Thränen aber, die in seinen Augen schimmerten, sprachen eine zu deutliche Sprache, um mißverstanden zu werden. — Als die erste Erschütterung des Augenblicks vorüber war, fragte Julie, durch was für Mittel Ferdinand hierher gekommen sey. Er antwortete in allgemeinen Ausdrücken, und vermied für jetzt den letzten, schauderhaften Auftritt auf dem Schlosse Mazzini zu erwähnen. Julie erzählte ihm die Geschichte ihrer Abenteuer, seit sie sich von ihm trennte. Es erhellte aus ihrer Erzählung, daß Hippolytus, der von dem Herzoge von Luovo an der Mündung der Höhle gefangen genommen war, nachher entwischte, und wieder in die Höhle zurück ging, um Julien aufzusuchen. Er sah bey dem Lichte seiner Fackel die tiefe Spalte im Felsen, durch welche Julie schlüpfte; er drang bis jenseit der Höhle, und von da in das Gefängniß der Marquise. Keine Sprache kann die Scene, welche nun folgte, schildern. Genug, daß die ganze Gesellschaft beschloß, mit Einbruch der Nacht die Zelle zu verlassen. Weil die Marquise aber in dieser Nacht den Marquis vermuthete, kamen sie überein, ihre Abreise zu verschieben, bis er da gewesen wäre, und so der Gefahr zu entgehen, die eine zu frühe Entdeckung der Flucht der Marquise nach sich ziehen könnte. — So bald sie Fußtritte von oben hörten, verbargen sich Julie und Hippolytus in dem Gange, und so bald der Marquis fort war, eilten sie alle nach der Höhle, und ließen in der Eile ihrer Flucht die vergifteten Speisen, die sie, ohne sie zu berühren, mitgenommen hatten, zwischen den Felsen zurück. Nachdem sie glücklich aus den Felsen gekommen waren, gingen sie nach einem benachbarten Dorfe, wo sie Pferde nach Palermo nahmen. Hier langten sie nach einer ermüdenden Reise an, und wollten sich nun nach Italien einschiffen. Ungünstige Winde hatten sie bis zu dem Tage, wo Ferdinand die Stadt verließ, aufgehalten; sie mietheten ein kleines Schiff, und beschlossen, dem Winde Trotz zu biethen. Bald fanden sie Ursache, ihre Verwegenheit zu bereuen; das Schiff war noch nicht lange auf der See gewesen, als der Sturm sich aufmachte, sie an das Ufer von Sicilien zurück warf, und sie nach dem LLichthause brachte, wo Ferdinand sie entdeckte.
Am folgenden Morgen kehrte Ferdinand mit seinen Freunde nach Palermo zurück, und erst hier enthüllte er ihnen die letzten, unglücklichen Begebenheiten auf dem Schlosse. Sie entwarfen nunmehr ihre zukünftigen Plane, und Ferdinand eilte auf das Schloß Mazzini, um Emilien zu hohlen, und Veranstaltung zu treffen, seinen Haushalt nach seinem Pallaste zu Neapel zu verlegen, wo er seine künftige Residenz aufzuschlagen dachte. Emiliens Schmerz machte der Freude und Verwunderung Platz, als sie das Daseyn ihrer Mutter und die Sicherheit ihrer Schwester hörte. Sie reiste mit Ferdinanden nach Palermo, wo ihre Freunde sie erwarteten, und wo die Freude des Wiedersehens durch Madame de Menons Gegenwart noch erhöht ward, der die Marquise einen Bothen in das St. Augustinerkloster geschickt hatte. Madame hatte diesen Aufenthalt mit einem andern Kloster vertauscht, wohin indessen der Bothe gewiesen wurde. Die glückliche Gesellschaft schiffte sich nunmehr vereint nach Neapel ein.
Von diesem Zeitpuncte an wurde das Schloß Mazzini, welches der Schauplatz einer gräßlichen Katastrophe gewesen war, und dessen Anblick in den Seelen derer, die so nahen Antheil daran gehabt hatten, nur schmerzhaft schreckende Betrachtungen aufregen mußte, verlassen. Bey ihrer Ankunft zu Neapel überreichte Ferdinand dem Könige eine aufrichtige, befriedigende Angabe der letzten Begebenheiten, zu Folge welcher die Marquise wieder in ihren Rang eingesetzt, und Ferdinand als sechster Marquis von Mazzini anerkannt wurde. — Die Marquise so der Welt und der Glückseligkeit wieder gegeben, zog zu ihren Kindern in den Pallast von Neapel, woselbst, nachdem die Zeit die Erinnerung ihres Ungemachs einiger Maßen gemildert hatte, Hippolytus und Juliens Vermählung gefeyert wurde. Die Erinnerung an die Gefahren, denen sie ausgesetzt waren, an das Leiden, welches sie für einander erduldeten, erhöhte jetzt nur durch den Contrast ihre jetzige Glückseligkeit. Ferdinand nahm bald nachher ein Commando bey der neapolitanischen Armee an, und zeichnete unter den vielen Helden dieses kriegerischen und unruhigen Zeitalters durch seinen Muth und Talente sich aus. Die Scenen des Kriegs gaben seinem thätigen Geiste Beschäftigung, während sein Herz das Glück seiner Familie zu befördern strebte. — Madame de Menon, deren großmüthige, treue Liebe sich aufs vollgütigste bewiesen hatte, fand in ihrer wieder geschenkten Freundinn einen lebenden Zeugen ihrer Vermählung, und bekam die Güter heraus, die ihr so ungerechter Weise vorenthalten waren. Allein die Marquise und ihre Kinder, dankbar für ihre Freundschaft, und ihre Tugend verehrend, bewogen sie, den Überrest ihres Lebens im Pallaste der Mazzini zuzubringen. Emilie, ganz an ihre Familie gekettet, lebte immer bey der Marquise, die ihr Geschlecht in Hippolytus und Juliens Kindern erneut sah. So von ihren Kindern und Freunden umgeben, und beschäftigt, die Seelen der aufkeimenden Generation zu bilden, schien sie zu vergessen, daß sie je anders als glücklich gewesen war.
Hier schließen die Annalen der Urschrift. Wir sehen in dieser Geschichte einen wunderbaren, auffallenden Beweis moralischer Gerechtigkeit, und lernen, daß für die, welche auf dem rechten Pfade wandeln, das Unglück nur eine Prüfung ihrer Tugend ist, die, wohl überstanden, ihnen den sichersten Anspruch auf den Schutz des Himmels gibt.
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.